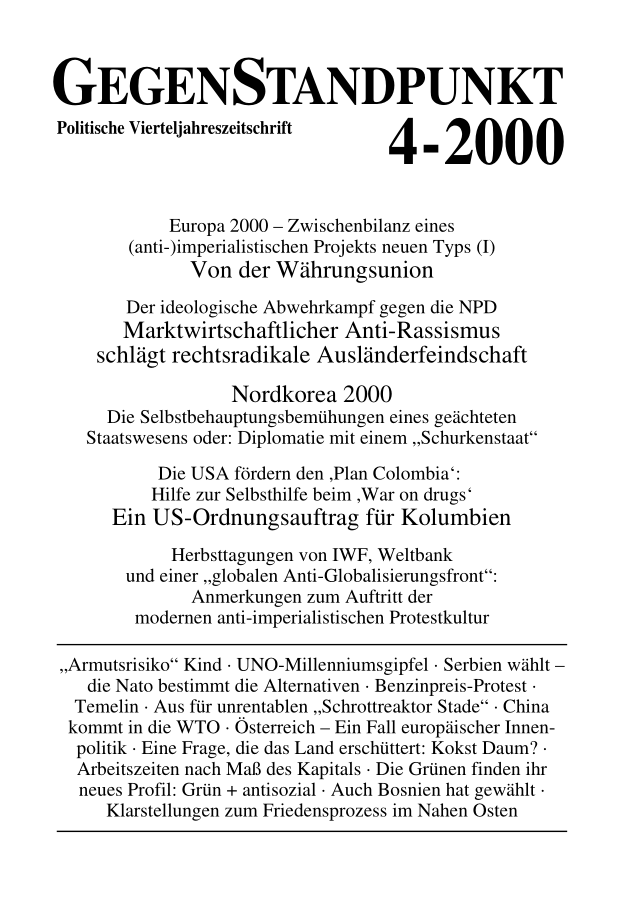Europa 2000 (I)
Zwischenbilanz eines (anti-)imperialistischen Projekts neuen Typs
Die Zweifel an der Machbarkeit einer verlässlichen Einheitswährung haben nicht dazu geführt, dass das Projekt aufgegeben wurde. Vielmehr ist gerade die ökonomisch-sachkundig warnende Fassung der Bedenken von den führenden Nationen in der Gemeinschaft, die in der Währungsunion den fälligen Schritt in Sachen Zugewinn an ökonomischer Macht ausgemacht hatten, etwas anders aufgenommen worden. Nämlich nicht als triftiger Grund für eine Absage, sondern als dringender Rat, bei der Durchführung der Währungsunion ein Verfahren zu wählen, das alle Zweifel ausräumen sollte.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Siehe auch
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Europa 2000 (I)
Zwischenbilanz eines
(anti-)imperialistischen Projekts neuen Typs
0.
Der Beschluss, das europäische Einigungswerk durch eine Währungsunion voranzubringen, war mit erheblichen Zweifeln verbunden. Zunächst einmal meldeten verschiedene Regierungen der EG-Mitgliedsstaaten ihre Bedenken an: Die Aufgabe ihrer Geldhoheit zu Gunsten einer gemeinsam bewirtschafteten Währung sahen manche als Entzug von Macht an, der durch die Vorteile eines Euro nicht zu kompensieren sein würde. Auch waren sie von der Organisierbarkeit der Vorteile eines einheitlichen Währungsraumes und der damit verbundenen Geldmacht Europas nicht überzeugt; und in ihrem Unwillen, sich dem riskanten Experiment anzuschließen, schlossen sie sich gern einem Argument an, das den Befürwortern des europäischen Geldes ebenfalls geläufig war: Eigentlich – so die vor zehn Jahren gängige Überlegung – sei für eine erfolgreiche Währungsunion die politische Union Europas vonnöten; die Stabilität eines gemeinsamen Geldes setze einen souveränen Hüter der Währung voraus, dessen geldpolitisches Schalten und Walten nicht durch konkurrierende Interessen von nach wie vor auf eigene Rechnung wirtschaftenden Nationen gestört und hintertrieben werden kann. Die Befürchtung, divergierende Interessen innerhalb des Bündnisses könnten die Etablierung einer soliden europäischen Geldmacht zum Scheitern verurteilen, ließ sich auch anders, im Gewande des ökonomischen Sachverstandes, vernehmen: Zu unterschiedlich sei der Entwicklungsstand der nationalen Wirtschaften, dementsprechend seien auch die wirtschaftspolitischen Belange der Mitgliedsländer schwer in Einklang zu bringen – nicht nur vom Willen her, auch nach der Seite ihrer Fähigkeiten wurden die Beiträge der einzelnen Nationen zum Gelingen des Projekts für höchst fragwürdig erklärt.
Bekanntlich haben auch diese Zweifel an der Machbarkeit einer verlässlichen Einheitswährung nicht dazu geführt, dass das Projekt aufgegeben wurde. Vielmehr ist gerade die ökonomisch-sachkundig warnende Fassung der Bedenken von den führenden Nationen in der Gemeinschaft, die in der Währungsunion den fälligen Schritt in Sachen Zugewinn an ökonomischer Macht ausgemacht hatten, etwas anders aufgenommen worden. Nämlich nicht als triftiger Grund für eine Absage, sondern als dringender Rat, bei der Durchführung der Währungsunion ein Verfahren zu wählen, das alle Zweifel ausräumt. In der erklärten Absicht, die ihnen wohlbekannten Risiken auszuschalten, haben die maßgeblichen Wirtschaftsmächte der Gemeinschaft einen „Fahrplan“ für den Euro aufgestellt, in dem lauter Bedingungen für den Übergang zum gemeinsamen Geld formuliert werden. Diese Bedingungen präsentierten sie als von der Gemeinschaft getroffene geldpolitische Vorkehrungen; ihre Einhaltung sollte der Stabilität der neuen Währung dienen und fiel in die Kompetenz der nationalen Haushaltspolitiken. Die einzelstaatlichen Haushalte hatten sich an den Stabilitätskriterien zu orientieren, was durch Einschränkungen der Staatsverschuldung zu bewerkstelligen war.
Bezüglich ihrer ökonomischen Wirkung – angesagt
war die „Herstellung“ einer soliden Weltwährung – waren
die Maßnahmen nie ernst zu nehmen. Die
haushaltstechnischen Korrekturen an den Prozentsätzen,
die in Maastricht für die Staatsschulden festgelegt
wurden, konnten ja nicht darüber hinwegtäuschen, dass
sich an der wirtschaftlichen Leistungskraft der
europäischen Nationen nichts verändert hatte. Das
beklagte Gefälle zwischen ihnen war nicht dadurch zu
bereinigen, dass sie sich ein paar Jahre lang weniger
Kredit genehmigten als vorgesehen, sich
Privatisierungserlöse gutschrieben, als wäre damit der
Reichtum der Nationen gewachsen; und der lautstark
geäußerte Verdacht, im europäischen Süden würden die
Bilanzen nur schöngerechnet, traf für die
nördlichen „Vorbilder“ in solider Haushaltsführung
genauso zu. Mit dem dann noch verabschiedeten
Stabilitätspakt
, in dem die Verpflichtung auf
Haushaltsdaten, welche seit Maastricht als Ausweis
nationalökonomischer Gesundheit gelten, für die Zukunft
fortgeschrieben wurde, kam es sogar zu einem offiziellen
Eingeständnis: Die fristgerechte Verbuchung der
Stabilitätskriterien verbürgt keine Stabilität der aus
der Taufe gehobenen Währung; was die taugt, ist allemal
eine Frage ihrer Bewirtschaftung, der Geschäfte, die mit
ihr angestellt werden, wenn es sie gibt.
Den ökonomischen Legenden der neunziger Jahre steht allerdings eine sehr reale Leistungsbilanz gegenüber, die den Architekten der Währungsunion über den Kunstgriff der wohlorganisierten Sorge um gutes europäisches Geld gelungen ist:
– Die Idee, eine Gemeinschaftswährung auch ohne politische Union zu schaffen und ihr durch den Beweis wirtschaftlicher Stärke Respekt zu verschaffen, kam ja nicht als wohl gemeinter Vorschlag daher, der einen brauchbaren Diskussionsstoff abgab. Da erklärten die mitteleuropäischen Wirtschaftsmächte dem Rest der Gemeinschaft, dass sie in der Lage und willens sind, der Konkurrenz auf dem Weltmarkt mit vereinigter Geldmacht gegenüberzutreten. Mit dieser Geldmacht in spe konfrontierten sie auch ihre Partner in der EU, verbanden selbstverständlich ihre Entscheidung mit der Einladung zum Mitmachen und gelangten in Maastricht zu der Übereinkunft, etwas für die Verlässlichkeit der künftigen Geldware zu tun. Mit einem Male war die nationalen Berechnungen entspringende Bereitschaft zur Mitwirkung am Euro nicht mehr genug – die Teilnahme wurde zu einer Frage der Eignung erklärt. Es wurde mit der Drohung des Ausschlusses hantiert, die Spaltung des Wirtschaftsbündnisses in potente und zweitklassige Volkswirtschaften war auf die Tagesordnung gekommen – man erinnere sich an die Rede vom Europa der „zwei Geschwindigkeiten“; die „Stabilitätskriterien“, durch deren Erfüllung der „Wirtschaft“ und dem Rest der Welt bewiesen werden sollte, welch solides Geld Europa garantiert, hießen zugleich „Beitrittskriterien“ – und die standen für einen innereuropäischen Eignungstest. Die Mitgliedsstaaten der EU hatten sich auf eine Satzung eingelassen, die ihnen bei ihrer Haushaltsführung Korrekturen an ihren nationalen Berechnungen aufnötigte. Mit diesen Korrekturen haben sie ihr Interesse daran bekräftigt, am internationalen Geschäftsmittel Euro beteiligt zu sein, es deswegen auch durch die eigene Politik zu fördern.
– Angesichts solcher Entscheidungen der nationalen Finanzpolitiker haben die eurokritischen Hinweise auf getürkte Bilanzen und unzureichende Konsolidierungsmaßnahmen keine Chance bekommen. Selbst der zeitweilig kursierende Befund, dass – streng gerechnet – nur der Haushalt von Luxemburg das Zeug zum Euro hat, führte nicht zum Abbruch des Unternehmens. Die „Anstrengungen“ der um Teilnahme bemühten Nationen zeugten nämlich davon, dass sie die Fortschritte ihrer Kapital-Standorte nur im Rahmen des Ausbaus einer gesamt-europäischen Wirtschaftsmacht gewährleistet sehen; dass ihre Perspektiven ganz in einem europäischen Aufbruch liegen, der die interne Konkurrenz der Währungen beendet, um eine vereinte Geldmacht nach außen zu entfalten; und dass sich dafür die erforderliche „Haushaltsdisziplin“, die Unterordnung der nationalen Standortbetreuung unter ein europäisches Geldregime lohnen. Durch die Annahme ihrer Rolle als Beitrittskandidaten haben die regierenden Nationalisten eben nicht nur eine extra Runde „Der Staat spart“ eingelegt, um nicht diskriminiert zu werden im künftigen Kampf der Weltwährungen. Sie haben den Euro in Auftrag gegeben, die Freiheiten und Notwendigkeiten im Umgang mit ihrer nationalen Geldmacht in eine neue Abhängigkeit gestellt – die Konjunkturen des gemeinsamen Geldes als maßgebliche Faktor ihres Haushalts etabliert. Die dazu gehörige Verpflichtung, ihre Politik an den Erfordernissen des Euro auszurichten, sind sie in einer neuen Geschäftsordnung für die EU eingegangen; die reicht von einer Festschreibung der innereuropäischen Währungsparitäten über einen Stabilitätspakt bis zur Gründung einer supranationalen Zentralbank.[1]
Das in ausgiebigen Verhandlungen, in denen auch mancher Streit um die rechte Haushaltsdisziplin etc. stattfand, unter Beweis gestellte Interesse an der Währungsunion, die praktisch bekundete Bereitschaft zur Selbstbeschränkung, zur Relativierung der nationalen Hoheit in Sachen Geld taugte auch den vorlautesten Stabilitätsfanatikern als ausreichende Grundlage für ihr Projekt. Sie war ihnen einiges an „Nachsicht“ wert in Bezug auf die „Konvergenz“ und „Kriterien“, deren Erfüllung sie wie eine „condition sine qua non“ gehandelt hatten; die Supranationalisten und Chef-Einiger Europas waren mit dem vorläufigen Ersatz für die politische Union des Kontinents zufrieden und erklärten Letztere zur eigentlich unausweichlichen Konsequenz der Währungsunion. Das reale Gemeinwesen Nr. 1, das europäische Geld und die mit ihm verbundene Wirtschaftsmacht, war festgeklopft, das Provisorium einer Weltmacht auf die Beine gestellt. Den Führungsfiguren aus den dominanten Staaten der EU ist in dem Hin und Her auf dem Weg zum Euro auch klar geworden, wie es weitergeht; die Zukunft ist ihnen kein Geheimnis mehr, weil sie davon ausgehen, einen veritablen „Sachzwang“ etabliert zu haben. Sie machen nämlich mit ihrem Provisorium Politik, kümmern sich in ihrem Europa und im Rest der Welt intensiv um „Marktwirtschaft & Demokratie“, reklamieren im Namen dieser unbezweifelbaren Werte und im Interesse Europas ihr natürliches wie Menschenrecht auf Einmischung daheim und auswärts – und wissen Bescheid: Jede Schranke, schon gleich jeder Misserfolg, den sie bei ihren Unternehmungen erfahren, verweist auf ein und denselben Mangel ihrer EU – es gebricht ihr am realen Gemeinwesen Nr. 2, der einheitlichen politischen Herrschaft über Europa und der einen gebündelten Gewalt von Europa, welches dann mit dieser „einen Stimme“ zur übrigen Welt „spricht“.
1. Von der Währungsunion
In der frommen Redensart, die Währungsunion sei die fällige „Antwort auf die Globalisierung“, haben die Veranstalter zum Ausdruck gebracht, dass sie unter einem imperialistischen Defizit leiden. Für ihren Geschmack gibt der Weltmarkt nicht genug her, ihre Bilanzen erachten sie für zu gering. Die europäischen Verwalter der politischen Macht, als deren Quelle sie das Kapital schätzen, sinnen auf Abhilfe: Es gilt mehr Geschäft zu organisieren, das sich – wo immer es sich abspielt – als Plus in ihren Haushalten niederschlägt. Um einerseits an ihren Kapitalstandorten mehr „Wachstum“ in Gang zu bringen, andererseits dieses Wachstum durch die Benützung auswärtiger Geschäftstätigkeit zu fördern, beschließen sie eine „Fusion“ ihrer ökonomischen Potenzen. Allerdings fällt der Übergang zur gemeinsamen Bewirtschaftung des „Standorts Europa“ erst einmal ziemlich beschränkt aus.
Denn die Schaffung des Euro ist bei allen Verpflichtungen und Abhängigkeiten, die seinen vorläufigen und künftigen Gebrauch bestimmen, nicht mit der Beendigung des nationalen Rechnungswesens verbunden. Nach wie vor konkurrieren die Haushalte der Mitgliedsländer auf der Grundlage ihrer Kosten und Erträge, widmen sich den Erfordernissen ihrer Standorte – und in den Bereichen, in denen europäische Kommissionen gemeinsame Fonds verwalten, wachen die nationalen Vertreter eifersüchtig darüber, dass ihre Volkswirtschaften bei den Beiträgen nicht über Gebühr strapaziert werden und bei den Zuwendungen aus der Gemeinschaftskasse nicht zu kurz kommen. An den Streitigkeiten um die „Agenda 2000“ ebenso wie am penetrant eingenommenen Standpunkt gewisser „Netto-Zahler“ wird deutlich, wie wenig für die Teilnehmer an der Währungsunion, die ihren Geldreichtum zum Anteil an der neuen Weltwährung Euro erklärt haben, das kompensatorische Teilen zugunsten des gesamten Standorts zum Programm gehört. Mangelnde Konsequenz ist den Vorkämpfern europäischer Stärke deswegen aber nicht vorzuwerfen. Schließlich verteidigen sie ganz im Geiste des Stabilitätspakts das neu geschaffene Instrument vor den Gefahren, die ihm vonseiten der Euro-Nationen drohen, die „über ihre Verhältnisse leben“ – was immer dann der Fall ist, wenn die Staatsverschuldung bzw. Geldschöpfung nicht mit einem Wirtschaftswachstum einhergeht, das von der einzig senkrechten Verwendung des Nationalkredits zeugt – er muss als Kapital Verwendung finden. Geschieht dies nicht, soviel wissen politische Wirtschaftslenker aus Erfahrung, sind zur Finanzierung der Staatsgeschäfte immer mehr Schulden erforderlich, die Kaufkraft des Geldes im Lande schwindet wie der Außenwert der Währung – und die Inflation der Umlaufsmittel, die nebenbei noch Zinsen kostet, ist ein ernstes Problem. Sie ist nicht nur die Folge der staatlichen Schuldenwirtschaft, die sich allemal einstellt und gewöhnlich von den Massen ausgebadet wird, in deren Verfügung das Geld über seine Verwendung als Kaufmittel nie so recht hinauskommt. Sie erweist sich auch als hinderliche Geschäftsbedingung; das Geld eines ganzen nationalen Standorts, das fortschreitend an Wert verliert, reduziert nicht nur das Vermögen seiner Besitzer, sondern büßt auch seine Verlässlichkeit als Kapitalanlage ein – welches schlechte Zeugnis der Währung und ihrem Standort von den berüchtigten „Märkten“, der internationalen Spekulation auf künftige Gewinne aller Art, ausgestellt wird.
Um dem Euro solches Ungemach zu ersparen, wie es den
Währungen mehrerer Mitgliedsländer in den Jahren zuvor
widerfahren ist, haben sich die bislang erfolgreichen
Währungshüter, Deutschland voran, für die
Haushaltsdisziplin in den Filialen von Euroland stark
gemacht. Sie bestehen darauf, dass auch ohne einheitliche
Wirtschafts- und Konjunkturpolitik zumindest eine
gemeinsame Verantwortung für die Brauchbarkeit des Geldes
wahrgenommen wird. Wenn sie die schädlichen Wirkungen,
die Konjunktur und Konkurrenz in der Zeit vor dem Euro
auf manche nationalen Gelder ausübten, darauf
zurückführen, dass sich die betroffenen
Haushaltsvorstände zu viel
Staatsverschuldung
geleistet hätten, mögen sie zwar den ökonomischen Betrieb
in ihren Marktwirtschaften etwas „verkürzt“ darstellen.
Dafür haben sie sich aber ein Rezept dafür zurechtgelegt,
wie man verhindert, dass eine Währung „weich“ wird: Die
beteiligten Regierungen dürfen sich nicht über Gebühr
verschulden – so lautet die Vorschrift in der
europäischen Hausordnung. Diese Vorschrift, die das
rechte und erlaubte Maß der Verschuldung selbst in deren
Verhältnis zum nationalen Umfang und Grad des Wachstums
legt, behandelt das zu vereitelnde „zu viel“ nicht als
ein Resultat, das der Verlauf der Konkurrenz zwischen den
Nationen einigen von ihnen aufherrscht. Sie setzt sogar
den Verdacht in die Welt, Finanz- und
Wirtschaftsministerien würden mutwillig zur überzogenen
Verschuldungspraxis greifen, sie zumindest in Kauf
nehmen, weil sie einen Vorteil damit verbinden. Den
Ideologen der Währungsunion ist da im Rückblick auf den
innereuropäischen Wettbewerb vor dem Euro die Sache mit
dem Export eingefallen, der von der Abwertung der eigenen
Valuta profitiert und quasi den Schaden des
Kaufkraftverlustes und die verminderte Tauglichkeit als
Kapital ungeschehen macht. Für das Entfallen dieses
Vorteils – so setzten sie ihre Berechnung fort – sorgen
nun zwar die fixen Paritäten in Euroland; allerdings
trifft ab sofort die einzelstaatliche Misswirtschaft,
weil sie schließlich die Geldwertstabilität gefährdet,
die gesamte Gemeinschaft, die mit dem Euro das
Konkurrenzmittel des „Standorts Europa“ geschaffen hat;
dessen Stabilität behandeln die Regisseure der
Währungsunion geldpolitisch, nämlich als
Voraussetzung für die Dienste, die der Euro am
europäischen Wachstum zu leisten hat. Dabei verlassen sie
jedoch die Bahnen der Geldpolitik, wie sie von
Nationalbanken gewöhnlich betrieben wird, in auffälliger
Weise. Wenn in Euroland auf die Stabilität des Geldes
geachtet wird, dann handeln nicht ein paar extra zu
diesem Zweck ins Amt bestellte Fachleute vom geschickten
Umgang mit dem Geldmarkt, von der konjunkturgerechten
Betreuung der Kredit- und Kapitalmärkte, von der
wachstumsfördernden Steuerung der Liquidität und der
Kontrolle der Geldmenge. Diese Aufgaben werden in
vereinbarter Kompetenzverteilung zwischen den noch
amtierenden Geldhütern und der EZB eher im Stillen
wahrgenommen – im Vordergrund steht seit Maastricht ein
politisches Regelwerk eigener Art. Es legt fest, wie die
EU als Gemeinschaft auf nationale
Zwischenbilanzen reagiert, die der Stabilität
des Euro abträglich sind.
Der Stabilitätspakt mit seinen Sanktionen gegenüber Mitgliedsländern, die sich ihrer nationalen Notwendigkeiten bzw. Ambitionen wegen zu viel Schulden genehmigen; die mit der Losung „no bail out“ bekräftigte Praxis, jede Nation für ihre Finanzprobleme haftbar zu machen; der auf dem Berliner Gipfel gestartete Angriff auf überkommene Formen der Umverteilung von Finanzen in der Gemeinschaft durch verschiedene Fonds – dieses Instrumentarium, das auf die Solidität des gemeinsamen Geldes abzielt, setzt dieses Erfordernis ausdrücklich den Interessen der beteiligten Nationen entgegen. Die Brauchbarkeit des europäischen Kreditgeldes zu gewährleisten, gilt als eine Aufgabe, in deren Erfüllung sich die europäischen Währungshüter mit einem für unzulässig erklärten Gebrauch des Euro seitens der Mitgliedsländer herumschlagen müssen. Auf Grundlage ihres diesbezüglichen Misstrauens haben sie einen Umgang mit den befürchteten Verfehlungen beschlossen, dessen Wirkungen sie sehr hoch veranschlagen – Europa rühmt sich einer Kontrolle über die Wertbeständigkeit seiner Währung, die ihresgleichen sucht. Um der Botschaft, dass die europäische Union ein einziger Stabilitätspakt ist, Nachdruck zu verleihen, haben Waigel, Duisenberg und Co. den Siegeszug der DM vor Maastricht erst den geldpolitischen Manipulationen der Deutschen Bundesbank zugeschrieben, um anschließend die Geschäftsführung der EZB zu preisen, die das deutsche Geldinstitut an Unabhängigkeit und Strenge übertrifft.
Über den Zweck der unablässigen Demonstration, dass in
Euroland mindestens genau so gut aufs Geld aufgepasst
wird wie in den bekannten Kapitalstandorten mit
mustergültigem Wachstum, herrschen ebenso wenig Zweifel
wie über die Adressaten der Ansage. Die
Veranstalter der Währungsunion hielten die Stiftung
von ganz viel Vertrauen für erforderlich,
und zwar einerseits beim Volk, andererseits auf
den Märkten
.
– Das Versprechen, der Euro werde „so stark wie die Mark“, wurde sowohl den inflationserfahrenen Völkern der Union gegeben als auch den stolzen Deutschen, die als brave Nationalisten in der Bild-Zeitung ihr Gewohnheitsrecht auf ihre harte Währung anmeldeten. Denn das ist sich die Haushaltsführung der Nation, die unter dem Titel „der Staat spart“ regelmäßig Lohn und Kaufkraft der Massen einschränkt, allemal schuldig: Die Versicherung, dass die Bürger in ihrer Eigenschaft als Besitzer von Zirkulationsmitteln keinen Schaden zu gewärtigen haben, weil ihre Regierung mit ihrem Projekt, in ganz Europa ganz viel kapitalistisches Geschäft zu mobilisieren, selbst kein Interesse an einer Schwäche der Währung hat, in der das „Wachstum“ seine Erfolge misst. Zur Vermeidung von „europafeindlicher Stimmung“ im Lande, von Wahlergebnissen und Volksabstimmungen, die die Tagesordnung durcheinander bringen, laufen selbst Finanzminister zu populistischer Höchstform auf; wenn sie wegen Stabilität bei den Sozialausgaben sparen und die Gesetzgebung insgesamt an der stets aktuellen Frage ausrichten, wieviel Lohnkosten das Wachstum noch verträgt, geben sich Währungshüter ganz fürsorglich. Vom Geld wenden sie jeden erdenklichen Schaden ab – und damit auch vom Volk, das sich die kleine Münze einteilt und dabei auf deren Kaufkraft angewiesen ist. Für dieses Geschäft halten sie sogar einen enormen Vorteil ihrer Währungsreform bereit: Wenn die Bürger mit ihrer Kaufkraft demnächst in Europa auf Reisen gehen, bleibt ihnen der lästige Umtausch erspart und dazu noch manche Gebühr…
– Mit dieser Verheißung wandten sich die Vereinfacher des Geldwesens ebenso eindringlich an die „Märkte“, wie heutzutage jene Minderheit genannt wird, die mit Geld in größeren Massen umgeht und es – statt zu sparen – anlegt. Allerdings wurde diesen Adressaten nicht mit einer Gunst für die Urlaubstage die Angst vor einem geschmälerten Geldbeutel auszureden versucht. Die Beseitigung der Währungsschranken hat für den Werktag des Investierens und Verkaufens eine andere Bedeutung. Die innereuropäische Rationalisierung der Geldzirkulation beseitigt Risiken für die Rentabilität des Geschäfts, was nach der Erwartung der Erfinder seine Wirkung tut: Wo Schranken der Zirkulation weggeräumt werden, entfällt ein Hindernis für das Wachstum des Kapitals, das auf ungehinderter Bewegung von Ware und Geld beruht – also stellt sich im Euroland mit der Währungsunion auch ein ordentliches Wachstum ein. Mit dieser „Prognose“ über den Standort Europa, auf dem die Stabilität des Euro unter Kontrolle ist, sind dessen Verwalter den „Märkten“ gekommen. Den Anlegern in Europa und in der ganzen Welt haben sie ihren Standort mit seinem guten Geld empfohlen und um verdienten Zuspruch geworben. Mit ihrem Angebot, den Euro und die wohlorganisierte Sphäre seines Wirkens mit den anderen Zentren der Weltwirtschaft zu vergleichen und sich für das europäische Geld zu entscheiden, haben die Einiger Europas nicht nur den schlicht imperialistischen Zweck ihres Projekts unterstrichen: Es geht ihnen darum, auf Kosten der anderen Wirtschaftsmächte mehr Anteile am Weltmarkt unter ihre Verfügung zu bringen, ihrer Geldmacht zuzuschlagen. Sie haben auch kein Geheimnis daraus gemacht, wovon das Gelingen ihres Unternehmens – Stabilitätspakt hin, EZB her – wirklich abhängt: Wer mit der Stiftung eines neuen Geldes eine neue Etappe der inter-nationalen Konkurrenz ausruft, preist die mit der Vereinheitlichung der Umlaufsmittel sich quasi automatisch einstellende Konkurrenzfähigkeit seines Standorts, weil das schöne Geld in möglichst großem Umfang als Kapital verwendet werden soll. Private wie „institutionelle“ Geldbesitzer aus aller Welt sind aufgefordert, das geplante, zukünftige Geschäftsleben in Euroland als ausgezeichnete Gelegenheit für ihre Bereicherung anzusehen, sich an ihm zu beteiligen, indem sie jetzt in der und in die Währung Europas investieren. Die Geschichte des Euro hat sehr sachgerecht mit einer Spekulation angefangen, in der erst einmal das internationale Geldkapital gefragt war: Für dieses präsentiert sich der Euro als Attraktion, als Geld eines so großen und florierenden Teils des Weltmarkts ist er zu bevorzugendes Anlageobjekt, so dass der Kredit von Euroland auf Kosten anderer Geldsphären bestätigt wird und die Wirtschaft Europas einen Zufluss von Kapital verzeichnet, die sie zu globalen Großtaten befähigt.
*
Die „Märkte“ haben dem Euro die erwünschte Anerkennung versagt und die europäische Geldmacht binnen zwei Jahren um ein Viertel reduziert. Dass man mit einer Einheit der Gemeinschaftswährung auf dem Weltmarkt nun erheblich weniger anstellen kann als vorgesehen, macht sicher nicht nur den stolzen Besitzern der Valuta, sondern auch den europäischen Geldhütern etwas aus. Betroffen sind eben neben den Amerika-Urlaubern und Autofahrern auch die Unternehmen, die sich Filialen in Übersee zulegen oder eine Fusion zur Erschließung außereuropäischer Märkte veranstalten. Speziell in Bezug auf die Kombination von teurem Öl mit teurem Dollar stellt sich alsbald die Befürchtung ein, dass der Verlust des Außenwertes einen der Kaufkraft im Inneren des Währungsbiets nach sich zieht. Dem Dementi der Geldpolitiker – „keine Inflation, also keine instabilen Geschäftsbedingungen für Produzenten und Verbraucher“ – folgt das statistisch bezifferte Eingeständnis auf dem Fuß, ergänzt um den Trost, für die europäische Exportwirtschaft sei die Euro-Schwäche ein nicht zu unterschätzender Konkurrenzvorteil. Natürlich will der ökonomische Sachverstand, der sich da aus den politischen Chef-Etagen von Euroland meldet, nicht übermäßig auf dieser Dummheit bestehen, derzufolge die große europäische Währungsreform eigentlich eine von Erfolg gekrönte strategische Abwertung im Interesse des Außenhandels wäre. Mit einer anderen albernen Einlassung bekennen sich dieselben Euro-Vertreter nämlich durchaus zum Zweck des Unternehmens, wenn sie dessen misslungenen Auftakt ebenso bedauern wie herunterspielen. Wenn sie sich und anderen vormachen, „in Wirklichkeit“ sei der Euro mehr wert als ihm von den Märkten zugebilligt, gestehen sie immerhin ein, dass sie die neue Währung geschaffen und der Konkurrenz ausgesetzt haben, damit ihr Geld ordentlich Kapital attrahiert. Dasselbe wiederholen sie, wenn sie die Ungerechtigkeit, die dem Euro widerfährt, nicht „dem schwachen Euro, sondern dem starken Dollar“ anlasten, und zwar mit dem Zusatz, der den Konkurrenten benennt, mit dem sich der Euro – in dem sich laut FAZ „das gemeinschaftliche Gewicht Europas ausdrückt“ – misst.
So laufen noch alle beschwichtigenden Ausflüchte über die eindeutig verlorene erste Runde des Vergleichs, den die Europäer mit ihrer Währung aufgemacht haben, darauf hinaus, dass auch die politischen Geldhüter und Wirtschaftslenker Europas zweierlei anerkennen:
– Erstens ist der wirkliche
Wert des Euro
der, den die als Schiedsrichter angerufenen
„Märkte“ durch die Verteilung ihrer gewinnorientierten
Gunst herstellen.
– Zweitens zeugt die Entscheidung der internationalen Kapitalgemeinde, gegen den Euro zu investieren, von Mängeln am Angebot, das die EU mit ihrer Währung „des größten Binnenmarktes der Welt“ bereitstellt.
*
Es wäre auch zu schön gewesen. Elf europäische Nationen legen unter heftiger Beteuerung, sie hätten ihr geldpolitisches Aufsichtswesen zur Voll-Kasko-Reife ausgebaut, ihr Geld zusammen; zwar nicht so richtig, weil sie nach wie vor auf eigene Rechnung wirtschaften – aber immerhin so, dass sie alle dasselbe Geld benützen, es als Mittel ihrer Politik einsetzen und in seiner Mehrung die Erfolge ihrer Wirtschaft messen, so dass es auswärtige Partner der EU-Staaten ab sofort nicht nur mit dem EU-Protektionismus zu tun haben, sondern auch immer mit derselben Währung. Dieses Produkt ihres Beschlusses statten die elf Staaten mit allen Geldfunktionen aus, was in ihrer Macht liegt. Zugleich verändern sie das Weltwährungssystem, indem sie ihre nationalen Gelder als spezielle Objekte des Vergleichs, der auf allen Ebenen des internationalen Handels zu seinem Recht kommt, aus dem Verkehr ziehen. Sie etablieren – noch vor der Umstellung der internen Umlaufsmittel – den Euro als neue Größe in den oberen, zumal den inter-nationalen Etagen des Geschäftslebens. Auf diese Leistung halten sie sich viel zugute; schließlich gibt es jetzt „den großen und einheitlichen Finanzmarkt“, „den Finanzplatz Europa“, so dass die Hüter des Euro zuversichtlich „die Schaffung eines wirksamen Gegenpols zu den anderen Weltwährungen“ vermelden können. Mit dieser Zuversicht erklären sie jegliches Misstrauen gegenüber ihrem Produkt für grundlos und unwahrscheinlich; sie tun so, als wäre dem Euro in der Konkurrenz mit den anderen Weltwährungen allemal der Zuspruch sicher, den er braucht und nach ihrer Meinung verdient – obwohl sie zunächst einmal nur ihre europäische Geldwirtschaft neu organisiert haben und auf einer neuen Geschäftsgrundlage zu konkurrieren beginnen. Für die „Märkte“ sehen sie die Rolle eines Erfüllungsgehilfen vor, der ihre Erwartungen ins Recht setzt. Das internationale Geldkapital aber hat den Europäern den Gefallen nicht getan. Es hat die neue Währung selbstverständlich in das Sortiment seiner wichtigsten Geschäftsmittel aufgenommen. Ebenso selbstverständlich ist es dazu übergegangen zu prüfen, was ihm der Stoff taugt, mit dem die EU ihre Emanzipation in Sachen „Konkurrenz der Weltwährungen“ um Anteile auf dem Weltmarkt bewerkstelligen will. Mit dem Ergebnis dieser Prüfung schlägt sich Europa nun herum, wobei sich die übliche Schelte des „Irrationalismus“ im Spekulationshandwerk in Grenzen hält. In der EU werden die disparaten Kriterien, die auf den „Märkten“ so zur Anwendung gelangen, durchaus akzeptiert; die Ablehnung, die dem Euro entgegengebracht wird, übersetzt man in Brüssel und Frankfurt ebenso wie in den Hauptstädten mit nationaler „Verantwortung“ in das Eingeständnis, dass Europa den Maßstäben der Anleger nicht genügt und manches für seine Konkurrenzfähigkeit tun muss:
a) Als erster und oberflächlicher Gesichtspunkt, der beim „Engagement“ von Kapital zum Zuge kommt, das per Währungsvergleich seine vorteilhafteste und sicherste Anlagesphäre wählt, werden die unterschiedlichen Zinssätze in Betracht gezogen. Doch kaum wird das schlichte Rezept einer Erhöhung des Zinsniveaus erörtert und verhalten zur Anwendung gebracht, stellen sich die Zweifel ein. Befürchtete oder erwiesene Wirkungslosigkeit lautet das Argument gegen solche Art „steuernden“ Eingreifens; ergänzt wird es durch den Hinweis auf schädliche Nebenwirkungen – Kosten, Konjunkturbremse, Inflation –, die in der nationalökonomischen Faktorenlehre gewohnheitsmäßig einem Zinsfuß zugeschrieben werden, wenn er „zu hoch“ ist. Nicht besser ergeht es dem kongenialen Vorschlag, Stützungskäufe zu organisieren. Diese Maßnahme aus dem Repertoire von Nationalbanken beruht auf der großartigen Einsicht, dass noch alle Gründe, eine Währung zu meiden, dazu führen, dass es dieser Währung an Nachfrage gebricht. Mit der behördlich veranstalteten Nachfrage wird Ersatz gestiftet – ein Ersatz, von dem alle Welt weiß, dass er keiner ist, der aber als Demonstration von Vertrauen seitens der Währungshüter die Märkte anstecken soll. Spätestens dann, wenn ein solcher Eingriff in den Markt „verpufft“, steht für alle Beteiligten fest, wie wenig mit geldpolitischen Manipulationen auszurichten ist. So gerät die Krise des Euro 2000 ganz nebenbei zu einer Richtigstellung. Die Wirtschaftslenker Europas und ihre öffentlichen Ratgeber sind gar nicht so überzeugt davon, dass die Stabilität ihres Geldes ein Werk ihrer haushalts- und geldpolitischen Künste ist. Bei dem Bemühen, aus dem Euro die schlagkräftige und attraktive Weltwährung zu machen, um die es ihnen geht, verlegen sie sich denn auch auf ein anderes Feld. Das Geldkapital – dessen sind sie sich gewiss – lässt es an der erwünschten Nachfrage nicht primär wegen ein oder zwei Prozentpunkten beim Zins fehlen. Es kalkuliert mit den künftigen Geschäften, die sich auf und mit dem Standort Europa machen lassen, wobei die aktuellen Statistiken über die Rentabilität von Kapital aller Art zu ihrem Recht kommen. Einschlägige – vergleichsweise – Mängel wie Vorzüge sind erstens ein „Datum“, zweitens ein Index für die Leistungen der Standortverwaltung. Die Taten und Programme der politischen Führung in Europa sind „Signale“; sie geben den Anlegern Auskunft darüber, was die Politik für die Beförderung des Geschäfts unternimmt. Und bei der Anwendung dieses Maßstabs kommt es schließlich zur Beurteilung der Fähigkeiten, welche die Politik bei der Ausübung ihrer Macht an den Tag legt. Souveränes, möglichst reibungsloses Regieren ist da mitten in der schönen europäischen Demokratie gefragt; Hindernisse nicht nur parlamentarischer Art sind zu überwinden, wenn die „Handlungs- und Durchsetzungsfähigkeit“ von Staatenlenkern in inneren wie äußeren Angelegenheiten getestet wird, was auch stets Stil- und Charakterfragen aufwirft, denen sich das Führungspersonal zu stellen hat…
b) In den Hauptstädten Europas weiß
man also, wodurch die Einheitswährung zu einem wirksamen
„Instrument“ im Angriff auf die weltwirtschaftliche
Vormachtstellung der USA und ihres Dollar wird. Die
„Stabilität“ des Euro steht und fällt mit den Leistungen
des Kapital-Standorts, auf dem er gilt. Die
Politik, der sich nun wirklich nicht nachsagen lässt, sie
hätte sich bislang nicht um „das Wachstum“ bemüht, weiß
sich in der „Globalisierung“ und speziell in der Sorge um
den Euro einem neuen „Sachzwang“ ausgesetzt, der sie dazu
verurteilt, den Wachstumsraten der USA ebenbürtige
„Daten“ in Euroland herbeizuregieren. Die „Wirtschaft“,
die mit ihren Produktions- und Zirkulationsbedingungen am
Euro hängt, rennt bei den Regierenden offene Türen ein,
wenn sie ihr Recht auf Rentabilität fordert.
Denn Volksvertreter von heute haben kein Problem damit,
erfolgreiches Regieren mit den schwarzen Zahlen
gleichzusetzen, zu denen sie den alten Konzernen und dem
jungen Mittelstand verhelfen. Ihr diesbezüglicher
Handlungsbedarf ist im Zuge der europäischen Offensive
mit ihren Unwägbarkeiten enorm gestiegen; seit sie sich
auf ihren Beschluss, die internationale Konkurrenz
aufzumischen und die „Gewichte“ gründlich zu verschieben,
wie auf eine neue „Lage“ berufen, der sie ausgesetzt
sind, spielen sich europäische Regierungen als radikale
Kritiker ihrer nationalen Wirtschaftsordnung auf. Wenn
sie täglich fünf Male „Globalisierung“ sagen und daraus
„folgern“, dass die Geschäftsbedingungen auf ihrem
Standort miserabel sind und jede Menge Reformen
benötigen, handelt es sich denn auch nicht um eine bloß
ideologisch-moralische Wende. Die europäische
Sozialdemokratie, die sich mit der Korrektur ihres
werbeträchtigen Wertekanons besonders hervortut – sie hat
in einem Jahrzehnt die Reste ihrer Selbstdarstellung als
Anwalt des Sozialen aufgegeben, weil sie ihre
„innovativen“ und „modernen“ Programme nicht mehr an
sozialen Idealen messen lassen möchte –, hat damit
schließlich die Macht erobert. Und mit der macht
sie sich an eben der „Modernisierung“ des jeweiligen
Standorts zu schaffen, wobei ihr ernstere
Durchsetzungsprobleme in der Verfolgung der neuen Linie
erspart blieben. Hunderte und Tausende von Genossen geben
praktisch zu, dass sie Prinzipien alternativen
Staatmachens gar nicht haben; sie wirken schlicht dort,
wo sie einen Zipfel der politischen Macht ergattern,
flott mit an der (Um-)Gestaltung des Rechts, das
ihnen wie eine einzige Behinderung der „Wirtschaft“
vorkommt. Gegen die, fasst dann ein Schröder leicht
fasslich zusammen, lässt sich nämlich keine Politik
machen. Für sie und gegen die überkommene
Geschäftsordnung umso mehr. Moderne Reformen
behandeln bisherige Regelungen des Wirtschaftslebens wie
einen Katalog von Verboten, die rentable Geschäfte
verunmöglichen. Mit ihnen reagiert der Staat, zuständig
für die „Rahmenbedingungen“ und das „Investitionsklima“
im Lande, erstens auf Fakten, die „die
Wirtschaft“ setzt, zweitens auf Anträge, die
deren Vertreter stellen.
– Die Fakten kommen dadurch zustande, dass Firmen aller Größenordnungen ganz unabhängig vom Euro ihren Erfolg in der Konkurrenz streng marktwirtschaftlich planen. Mit dem Einsatz ihres Kapitals produzieren sie nicht nur Waren aller Art, sondern auch eine große Anzahl Arbeitslose. Die einen, indem sie im Interesse ihrer Bilanz und unter Einsatz produktivitätssteigernder Technik an Lohnkosten sparen, die Belegschaft dezimieren; andere zusätzlich dadurch, dass ihre Anstrengungen vom Markt nicht mit einer erfolgreichen Bilanz honoriert werden, so dass sie statt Lohnabhängiger den Betrieb einstellen. Diejenigen, denen der Erfolg recht gegeben hat, fahren mit ihrer unternehmerischen Tätigkeit fort; ihr vermehrtes Kapital drängt sie zur Ausweitung ihrer Geschäfte. Den dafür benötigten erweiterten Markt finden sie dank fünfzig Jahren Europapolitik zu Konditionen vor, die im Kontrast zu zwischenstaatlichen Beschränkungen des Geschäfts „Freizügigkeit“ heißen. Das grenzüberschreitende Kaufen von Waren und Arbeit, die Inanspruchnahme von ausländischer Zahlungsfähigkeit beim Versilbern der Produkte, das internationale Investieren eben ist gewohnheitsmäßiges Moment wie Bedingung des „Wachstums“. Und die innereuropäische Geschäftsordnung wird von der auf Import & Export abonnierten Unternehmerschaft durchaus im Sinne ihrer Erfinder wahrgenommen. In ihrem Bedürfnis nach Expansion nützen industrielle, Handels- und Bankkapitalisten die ihnen und ihren Produktionsfaktoren eröffnete Mobilität gründlich aus, beziehen auch gleich die Geschäftsgelegenheiten in den künftigen Beitrittsländern in ihre Kalkulation ein, wodurch sie manchem gestandenen Europa-Politiker einen Strich durch die Rechnung machen. Tüchtigen Anwälten der europäischen Idee bringen sie mit ihrem Kapitalexport in Erinnerung, dass sie als Kanzler und Wirtschaftsminister einen nationalen Standort verwalten, dass sie als Finanzminister einen nationalen Haushalt betreuen, der durch die Verlagerung von Investitionen ins Ausland in Mitleidenschaft gezogen wird. Und das einerseits erwünschte „Engagement“ europäischer Multis in Übersee – wo sie „Märkte“ erobern sollen – gerät nicht immer zum nützlichen Ausbau von Geschäften, an denen sich z.B. die deutsche Nation bedient, sondern zur Alternative, die der Finanzminister als Haushaltslücke und als Abkehr vom Euro registriert. Wenn die Regierung freilich zu klagen anfängt, nach mehr „Beschäftigung“ im Land verlangt, ihren Haushalt für überstrapaziert erachtet und die „Globalisierung“ insgesamt für die Herausforderung der neuen Zeit, steht die Antwort der „Wirtschaft“ schon fest.
– Die Anträge der Unternehmerschaft, die von den Politikern ersucht wird, ihre Geschäfte auf eine der Nation zuträgliche Art und Weise zu erweitern, laufen auf den Vorwurf hinaus, die Politik habe es sich selbst zuzuschreiben, wenn die staatlichen Erfolgsbilanzen zu kurz kommen. In konstruktive Ratschläge gekleidet kommen lauter Forderungen auf den Tisch, die der Politik Maßnahmen abverlangen, welche Produktion und Handel rentabler machen. Nachdrücklich weist die „Wirtschaft“ darauf hin, dass sie bei ihrer Tätigkeit die nationalen Standorte einem Vergleich aussetzt; sie prüft nicht nur Preise und Zinsen, die zahlungsfähige Nachfrage und die natürlichen Voraussetzungen, die sie für ihr Gewerbe in verschiedenen Weltgegenden vorfindet – die wesentlichen Geschäftsbedingungen, auf die sie ihren Anspruch anmeldet, sind heutzutage ein Werk des Staates. Also ist eine Regierung, die Wert auf mehr Beschäftigung, solide Staatsfinanzen und globale Erfolge legt, gehalten, durch ihre gesetzgeberische Macht lauter Bedingungen für die Rentabilität von Kapital herzustellen.
Dieser Konsequenz wollen sich europäische Staatsmänner, die so ihre Drangsale mit dem Verlauf ihres geldmächtigen Aufbruchsprogramms haben, natürlich nicht verschließen. Sie teilen die Diagnose, dass ihr Euro schlicht daran laboriert, dass sich in Europas Landen mit Kapital zu wenig anstellen lässt und demonstrieren mit ihrem Reformeifer wieder einmal, wieviel staatlichen Einsatz ein wirklich marktgerechter Markt nötig hat – was sie allerdings nicht davon abhält, ihre „Modernisierung“ unter das Motto „mehr Markt, weniger Staat!“ zu stellen. Das andere, nicht minder häufig breitgetretene Dogma vom Zeitalter der „Globalisierung“, in dem die „Nationalstaaten“ an Bedeutung verlieren und ihr altmodischer Regulierungsbedarf zurückzustehen hat, ziehen sie ja auch nicht aus dem Verkehr, wenn sie ihren nationalen Herrschaftsbereich wegen der Internationalisierung des Geschäfts mit allen Reichtumsquellen des Globus neu ordnen.
Über die „moderne“ Qualität der Symbiose zwischen den Geschäftsbedürfnissen des Kapitals und politischer Tatkraft ist aus der Mitte Europas[2] einiges bekannt geworden:
Diverse Unternehmen lassen ihre Waren im benachbarten Ausland fertigen, ihre angestammten Filialen schließen sie unter großem Bedauern des Arbeitgeberverbandes, der auf die hohen Steuern im Inland hinweist. Die Regierung bestätigt den Grund der unternehmerischen Entscheidung prompt, erklärt die Definition von Steuern als „Belastung der Wirtschaft“ zur Staatsdoktrin und leitet eine Steuerreform in die Wege, die der Entlastung dient. Für neue und steigende Abgaben, die das Reformwerk ebenfalls enthält – teils wegen „Gegenfinanzierung“, teils wegen mit Steuern zu steuernder Umweltfreundlichkeit –, kriegt die Wirtschaft eine Befreiung, damit die Belastung keinen Falschen trifft…
Andere Unternehmen verlagern ihre Produktion ins nahe und
entferntere Ausland, statt ihren von gesundem Wachstum
zeugenden Expansionsdrang im Inland abzuwickeln; der
Arbeitgeberverband erweist sich erneut als
auskunftsbereit und gibt zu hohe Lohnkosten auf dem
Heimatstandort als Motiv an. Mit einer Andeutung, die
sich auf gewisse Rubriken der Brutto-Lohnabrechnung
bezieht: die gezahlt werden, obwohl sie gar nicht im
Haushalt der Lohnempfänger, sondern in den Sozialkassen
landen – mit der Klage über eine ungebührliche Belastung
eben durch Arbeitslose, Kranke und Rentner erhält die
Regierung einen Denkanstoß. Sie geht die Bilanz der
Sozialversicherungen durch, die Bestandteil des
Staatshaushalts sind, ermittelt per Hochrechnung, dass
sich der Anstieg der marktwirtschaftlichen Sozialfälle
nicht mit der bisherigen Art ihrer Finanzierung verträgt
–, und beschließt zu handeln. In aller Offenheit
revidiert sie die offizielle, bei Alt und Jung beliebte
Lehre vom Sozialstaat. Der ist ab sofort nicht
mehr das von Staats wegen verordnete Gegenmittel gegen
manchester-kapitalistische Entgleisungen, das den ärmeren
Schichten gestattet, ihren Frieden mit der
Marktwirtschaft zu schließen. Die ganze komplexe
Umverteilungsveranstaltung, durch die der Lohn von
Lohnabhängigen zur Bezahlung des Lohnersatzes für
unbrauchbare Teile ihrer Klasse herangezogen wird, heißt
mit einem Schlag Lohnnebenkosten
. An denen wird im
Interesse des Standorts gespart, weil die
Konkurrenzfähigkeit der Nation auch sonst gebietet,
Arbeit billiger zu machen
…
Der sturzmoderne Gesichtspunkt, dass alles, was nicht die
Rentabilität eines kapitalistischen Geschäftszweigs
befördert, auf Verschwendung hinausläuft, hat sich bei
den Verwaltern des Allgemeinwohls durchgesetzt. Sie
wenden ihn nicht nur auf das Lohneinkommen von Millionen
ihrer Bürger an, sondern auch auf die Milliarden von
Geldern, die sich alljährlich in der Staatskasse
einfinden. Ein falscher Gebrauch der Staatsfinanzen liegt
offensichtlich dort vor, wo der Staat nach alter Sitte
selbst Regie über ganze Abteilungen der nationalen
Wirtschaft führt. Als Betreiber von Unternehmen, die sich
um die landesweite „Infrastruktur“, das Transport- und
Kommunikationswesen kümmern, verhält er sich ziemlich
unwirtschaftlich. Den diesbezüglichen Klagen von
Fanatikern des Marktes hat sich die Politik endgültig
angeschlossen. Sie hat die Privatisierung von
Post und Bahn finanziert, damit aus dem
marktwirtschaftlichen Hin und Her veritable
Geschäftszweige entstehen. Diese Verwendung öffentlicher
Gelder rechtfertigt sich nicht zuletzt damit, dass nur
privaten Firmen der Zugang zum inter-nationalen
„Dienstleistungsmarkt“ offensteht – und der ist dank
gewisser technologischer Neuerungen eine
„Wachstumsbranche“, in der mehr Geld umgeschlagen und
„gemacht“ wird als in so gut wie jedem traditionellen
Gewerbe. Bei der Herausforderung mit dem Namen
„Globalisierung“ geht es nun einmal um diesen Stoff, und
die öffentliche Hand tut gut daran, die spekulativen
Firmengründungen zu fördern, die ebenso
spekulativen Fusionen vorzufinanzieren, eine
neue Aktienkultur
ins Leben zu rufen und darauf zu
setzen, dass ihre Kreationen in der Konkurrenz
bestehen. Für die Massenentlassungen, die der Staat mit
seinem Reformwillen lizenziert, wird er schließlich
doppelt entschädigt: Erstens entstehen auch in der
Informationstechnologie ein paar Arbeitsplätze, und
zweitens ist er am Umschlag der Kreditmassen immerzu,
sogar als Auktionator beteiligt…
c) Die Standortpolitik europäischer Regierungen zielt auf die Herstellung und Förderung von ganz viel kapitalistischer Geschäftstätigkeit. Ohne einen Anflug von traditioneller Scham und Schönfärberei bekennen sich die demokratischen Führungsmannschaften zum Kapital als dem Lebensmittel ihres Gemeinwesens; im dazugehörigen Umgang mit dem „Produktionsfaktor Arbeit“ nehmen sie Maß am amerikanischen „Modell“ von „Mobilität“ und „Flexibilität“ und was es sonst noch für Ausdrücke für eine echt schrankenlose, deregulierte Benützung von Arbeitskraft gibt; als Erben eines Sozialstaats machen sie regen Gebrauch von diesem Instrument, mit dem sich das Einkommensniveau einer ganzen Klasse regulieren lässt, wobei sie die Lebensbedürfnisse von Beschäftigten und Arbeitslosen, Jugend und Alter, Ossis und Wessis, Angestellten, Pendlern und Beamten so lange gegeneinander ausspielen, bis gerechterweise kein Lebensbedürfnis mehr im bisherigen Umfang mit den Erfordernissen des Wachstums vereinbar ist. Das moderne Regieren liefert, flankiert von den stündlichen Börsenmeldungen dauernden Anlass für die altmodische Kritik an „Demokratie & Marktwirtschaft“, die es zu Recht für keinen Beitrag zu seinem Gelingen hält. Da diese Kritik nicht stattfindet, können sich die nationalen Führungspersönlichkeiten ungehemmt den Drangsalen stellen, die ihnen erhalten bleiben, so gründlich sie auch ihren kapitalistischen Laden reformieren. Die Rede ist von der Europa-Politik, und die befaßt sich mit dem Nationalismus der anderen.
Denn darin besteht sie, die Verwaltung Europas: in der beständigen wechselseitigen Beaufsichtigung der nationalen Interessen, die sich zu diesem Projekt vereinigt haben. Davon und von der anderen Seite europäischer Aktivitäten, dem Auftreten der europäischen Nationen nach außen, handelt die Fortsetzung.
Europa 2000 – Zwischenbilanz eines (anti-)imperialistischen Projekts neuen Typs (Fortsetzung in der nächsten Nummer)
2. Die Ost-Erweiterung
Das Bündnis hat das mehr oder minder gute Gelingen seiner Währungsreform gar nicht erst abgewartet, also auch nichts davon abhängig gemacht, als es sich entschloss, auch anderweitig auf die Erweiterung seiner wirtschaftlichen Macht zu dringen. Ein Projekt namens Ost-Erweiterung ist seit Jahren in Arbeit; die dazu nötigen Leistungen der Außenpolitik sind längst in eine Diplomatie der Erpressung ausgeartet, obwohl bzw. weil die ‚Beitrittskandidaten‘ ihre neue Staatsräson ganz auf die Mitgliedschaft in der EU ausrichten. Die guten Europäer stehen nicht an, den Ex-Satelliten Moskaus zu helfen bei der Umstellung, die sie in ihren Gemeinwesen vornehmen müssen, um dabei sein zu dürfen. Ein ‚acquis communautaire‘ hat mit Diktaten und Einmischung natürlich nichts zu tun – er regelt bloß die Geschäftsordnung in den osteuropäischen Staaten, damit die ihre Produktivkräfte wie ihre Produktionsverhältnisse so gestalten, dass sie europäischen Ansprüchen entsprechen.
a) Vom Interesse an einer ‚friedlichen Eroberung‘ und dem Recht darauf
b) Die ökonomische (Un-)brauchbarkeit der realsozialistischen Hinterlassenschaft – Kapitalmangel gebietet Unterordnung, auch strategisch
c) Die Wirkungen der ‚Zusammenarbeit‘, ihre Tücken: Aufsicht in Rat&Tat – Die EU liest dem neuen Nationalismus ‚Marke Ost‘ seine Rechte vor, wobei sie bei sich ‚Reformbedarf‘ entdeckt.
3. Der Balkan-Krieg
Die Nationalisten der Beitrittskandidaten halten es im Prinzip für ein Glück, endlich als ein Teil von Europa zu gelten. Für den Balkan, speziell Ex-Jugoslawien, ist es eher ein Pech, zum Einzugsbereich dieser Zivilisation gezählt zu werden. Die europäische Befassung mit dem Erbe Titos hat die politische Landkarte verändert, war einen Krieg wert samt anschließendem Besatzungsregime – und belehrt über den Leitfaden, der im Abendland für das Fach Krieg&Frieden gilt.
a) Die Eigenarten der Initiative Europas, Jugoslawien zu zerlegen
b) Der Kontrast von Wille und Fähigkeit, einen Friedensprozess hinzukriegen – Die Traditionsfirma USA als Maßstab für das Unternehmen Europa
c) Die Moral von der Geschicht’: Europa darf auch militärisch kein Provisorium bleiben.
4. Eine enorm erweiterte Ost-Politik
Da das Weltordnen zum Berufsbild des Europäers gehört, fällt die Betreuung der gesamten Unordnung, welche die Sowjetunion hinterlassen hat, selbstverständlich in die Kompetenz der im Aufbruch befindlichen europäischen Weltmacht. Einige der Pflegeobjekte tauchen in der EU-Agenda als ‚zweite Stufe‘ der Ost-Erweiterung auf; die randständigen Staatsgründungen mit ihrem Öl, ihren Waffen und Bürgerkriegen – alle verkörpern sie den Auftrag Europas, den Export von Marktwirtschaft und Demokratie un- bis antiamerikanisch zu betreiben. Wer so ausgiebig in anderen Breiten und Längen nach dem Rechten sehen will, hat angesichts der Schranken und Misserfolge des eingeläuteten Programms von ‚Hilfe und Einfluss‘ (‚Imperialismus‘ gibt es ja nicht mehr!) allen Grund, seine Fähigkeiten auf Vordermann zu bringen.
a) Die gar nicht natürliche Zuständigkeit für die Hinterlassenschaft der Sowjetunion
b) Vom Öl, von der Energie, den Waffen und den (Bürger)Kriegen in ehemals sowjetischen Landen: Kapitalmangel rechtfertigt Erschließung, Ohnmacht ist ein Ruf nach der Nato
c) Die Unhandlichkeit der neuen Betreuungsobjekte und die begrenzte Wirkung europäischer Geld- und politischer Macht: noch ein Grund für die Herstellung wirklicher europäischer Großmacht.
5. Die Rechte Europas gegenüber Afrika
Was die bewährte Partnerschaft Europas mit den Staaten des schwarzen Kontinents betrifft, so ist den Außenpolitikern Europas aufgefallen, dass zwei Veränderungen eine gewisse Revision des Umgangs mit der afrikanischen Szene fällig machen. Die eine besteht darin, dass nach der Umsetzung von vier Lomé-Abkommen die Dienstbarmachung von Arbeit und Reichtum in afrikanischen Staaten zu einem für diese ruinösen Ende gekommen ist. Die andere ist die Abdankung des Ostblocks als konkurrierender Weltmacht, welche früher zu Anstrengungen besonderer Art Anlass gegeben hatte. ‚Entwicklungshilfe‘, die werbende Unterstützung von Nationen und nationalen Bürgerkriegsparteien etc. – das ist heute zunehmend überflüssig. Also ergeht der Rat, die afrikanische Politik möchte Konflikte unterlassen, demokratisch zu Werke gehen und darüber jene ‚Stabilität‘ erzeugen, die die Abwicklung der Restposten nützlichen Außenhandels gewährleisten. Auf supranationalen Begegnungen, die den Regeln des Weltmarkts und seines Fortgangs gewidmet sind, lässt sich Europa natürlich auch vernehmen: Dritte-Welt-Länder sind daran zu hindern, dass sie sich des ‚Umwelt- und Sozialdumpings‘ befleißigen, weil sie sich so Anteile am Weltgeschäft sichern, die ihnen nach den Regeln der ach so fairen globalen Konkurrenz nicht zustehen.
a) Warum ‚Entwicklungshilfe‘ überholt ist
b) Ein Lomé-Nachfolge-Abkommen; der dringliche Rat, sich auf dem Schwarzen Kontinent in Demokratie zu üben – und das Entsetzen über bürgerkriegerische Entgleisungen da unten
c) Die schwierige Arbeit an der Statuszuweisung für afrikanische Nationen und deren Absicherung in supra-nationalen Begegnungen der un-heimlichen Art: IWF – WTO – G7…
6. Die Konsequenz für das Bündnis: Eine neue Großmacht stiften! Aber Wie?
Aus den Ambitionen der EU folgt wie aus den Erfahrungen, die dieses Bündnis im letzten Jahrzehnt seiner Bemühungen, der ‚Globalisierung‘ gerecht zu werden, gemacht hat:
a) Erstens und immer wieder: Im europäischen Haus selbst hat die Konkurrenz der Unterordnung zu weichen; nur eine echte Fusion von politischer und Geld-Macht tut ihre Wirkung hinsichtlich verlässlicher Verfügung über auswärtigen Reichtum und Arbeit. Also braucht es eine neue Hausordnung.
b) Zweitens: Was aus diesem Bündnis wird, das zur beinharten Klärung inter-nationaler Eigentumsfragen ‚Globalisierung‘ sagt, bemisst sich daran, was es zur Beeinflussung und gewaltsamen Regelung auswärtiger Souveränitiät zu leisten vermag. Es braucht eine europäische ‚Stimme‘ mit Eingreiftruppe.
c) Beide Notwendigkeiten sind in Europa anerkannt, ebenso wie das ‚Wie‘ ihrer Vollstreckung umstritten ist. Aus zwei gar nicht verborgenen Gründen. Einerseits ist für europabeflissene Nationalisten das Sich-Unterordnen ein Opfer. Zweitens ist der Lohn dieses Opfers nur zu haben, wenn sich Europa von den USA ‚emanzipiert‘, die ihm – wg. Kommunismus – seine Karriere geld- wie machtmäßig in der NATO spendiert haben.
Freilich darf eine Warnung vor Missverständnissen nicht fehlen: Widersprüche in der Konkurrenz, bei Anläufen zu Korrekturen des internationalen Kräfteverhältnisses sind kein Trost, sondern tragen zur Aufmischung der Staatenwelt bei.
[1] Vgl. hierzu die Analyse des Weges zur „Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion“ in GegenStandpunkt 2-97, S.137 und GegenStandpunkt 3-97, S.169.
[2] Wie da im einzelnen argumentiert, gerechnet und entschieden wird, ist nachzulesen in dem Artikel „Die Nation senkt ihr Lohnniveau“ in GegenStandpunkt 4-99, S.51 und GegenStandpunkt 2-2000, S.51. Ergänzend dazu Artikel über Privatisierung (in GegenStandpunkt 2-2000, S.23), Informationstechnologie (in GegenStandpunkt 2-2000, S.77) und Fusionen (in GegenStandpunkt 2-2000, S.46 und GegenStandpunkt 2-2000, S.48).