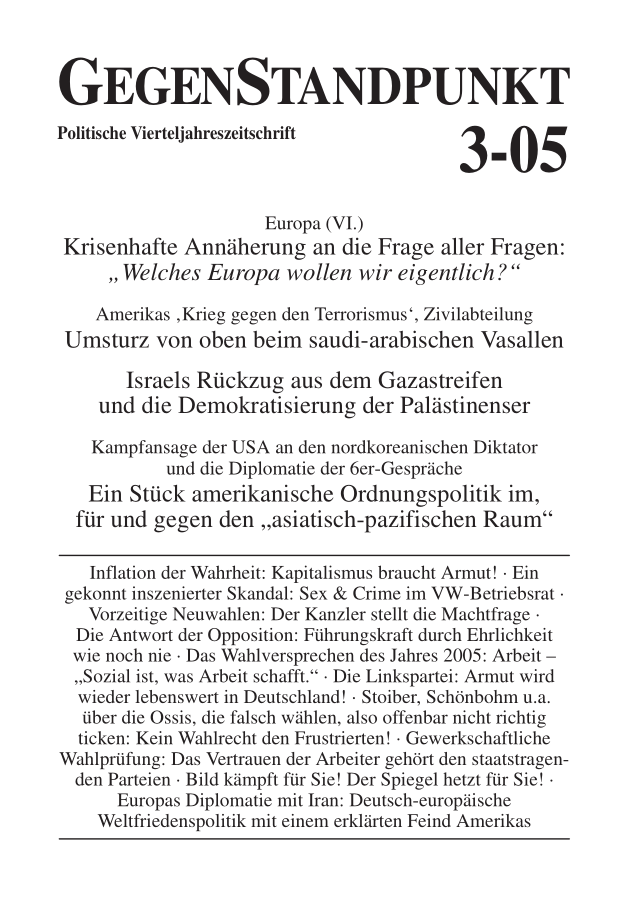Europa (VI):
Die „gescheiterten“ EU-Referenden in Frankreich und den Niederlanden, und was Europas Nationen daraus machen
Krisenhafte Annäherung an die Frage aller Fragen: „Welches Europa wollen wir eigentlich?“
Europas Bürger sind angesichts der neueren sozialen Nöte, die ihnen die Entfesselung einer europäisierten Kapitalkonkurrenz und die Standort-Rivalität ihrer Regierungen eingebracht hat, mehrheitlich europapolitisch enttäuscht: Wo sie zur Abstimmung über das neueste Dokument europäischen Zusammenwachsens gebeten werden, lassen sie sich die Gelegenheit zu einem genau nachgezählten demokratischen Protest nicht entgehen.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Siehe auch
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
- 1. Die Absage von unten: Ein politischer Fehler und seine interessierte Ausdeutung von oben
- 2. Die widersprüchliche Natur des Europa-Projekts und seine konstruktive Fortschreibung im neuen Verfassungsvertrag – ein Rückblick
- 3. Das Projekt ‚Weltmacht Europa‘ in der Krise
- 4. Ein gescheiterter Gipfel, ein großes Zerwürfnis und die vermiedene Kündigung
Europa (VI):
Die „gescheiterten“ EU-Referenden in
Frankreich und den Niederlanden, und was Europas Nationen
daraus machen[1]
Krisenhafte Annäherung an die Frage
aller Fragen: Welches Europa wollen wir
eigentlich?
Das französische und das niederländische Volk haben sich für kurze Zeit große Aufmerksamkeit in Europa errungen: Angeblich haben sie mit ihrem mehrheitlichen Nein zum europäischen Verfassungsvertrag die EU in die „schwerste Krise“ seit ihrem Bestehen gestürzt. Sie hätten den Europapolitikern im Allgemeinen und den Brüsseler „Eurokraten“ im Besonderen die gerechte „Quittung“ für ihre „Bürgerferne“ und diktatorische „Regelungswut“ erteilt, so dass diese Figuren, die bisher so allmächtig wie unlegitimiert über alle Europäer bestimmt hätten, sogar „Angst vor Europas Bürgern“ bekommen hätten und endlich wieder genau „hinhören“ wollten:
„Ein großer Teil der EU-Bürger will sich nicht mehr vor vollendete Tatsachen stellen lassen, bei deren Durchsetzung der Wille des Volkes als lästiges Hindernis oder notwendiges Alibi gilt… Das Volk hatte gesprochen, … die Eurokraten zitterten und zagten, als wären sie von einer Flutwelle überrollt worden.“ (Der Spiegel, Nr. 23/05, S.94ff)
Europas Bürger – ein Haufen revoltierender Menschen, die ihr Schicksal in die eigenen Hände nehmen? Und Europas Politiker – geläuterte Menschen, die Willen und Interesse ihrer Bürger achten wollen?
Nicht ganz. Schon der formale Anlass des Protests, ein Referendum über den EU-Verfassungsvertrag von Rom, gibt ja ein bisschen Auskunft über den Charakter dieser „Revolte von unten“: Brave Staatsbürger sind zu einer Veranstaltung gegangen, die von der Führung anberaumt und zu der das Volk ausdrücklich hinbestellt worden ist, und haben die Gelegenheit genutzt, ihre Meinung in Gestalt eines recht einsilbigen Wahlkreuzes zu äußern. Zweitens legen die offiziellen Reaktionen auf das Wählervotum und dessen Ausdeutungen durch die Politiker ein beredtes Zeugnis davon ab, welchen Respekt sich Bürger in den europäischen Demokratien erworben haben: Reflexartig haben deutsch-französische Spitzenpolitiker deutlich gemacht, was sie von einem Abstimmungsergebnis halten, das ihrem Herrschaftsinteresse nicht so recht entspricht. Und wenn die interpretierenden Politiker dem vielstimmigen Chor, der in Frankreich von rechten Le Pen-Anhängern bis zu linken Trotzkisten reicht und sich zu den 55% Nons zusammenaddiert – in den Niederlanden nicht viel anders –, die Klage über „Demokratiedefizite“ und „Bürgerferne“ als eigentlich gemeinten Inhalt unterschieben, sind das drittens eher eindrucksvolle Dokumente von Zynismus und Verlogenheit als von Achtung. Diese Deutungen des Wählervotums geben nämlich viel mehr Aufschluss über die Interessen, die Europas Machthaber an ihr Projekt „Europa“ knüpfen und für die sie sich auch noch auf den Willen ihrer Untertanen berufen.
1. Die Absage von unten: Ein politischer Fehler und seine interessierte Ausdeutung von oben
Europas Bürger sind vom „globalisierten“ Europa, das ihre nationalen Führungen in gemeinsamen Beschlüssen und in heftiger Konkurrenz gegeneinander schaffen, materiell betroffen. Sie registrieren Schädigungen, die ihnen aus einem „Binnenmarkt“ erwachsen, den ihre Politiker mitzuverantworten haben: Ihre Arbeitgeber erpressen sie mit dem Verweis auf die billigeren Löhne im Osten Europas zu Lohnverzicht und längeren Arbeitszeiten, stiften auch mit der tatsächlichen Verlagerung von Arbeitsplätzen an billigere Standorte zunehmende Existenzunsicherheit; oder sie gehören bereits dem Heer der Arbeitslosen an, die im Zuge des normalen „technischen Fortschritts“ wie von selbst angefallen sind. Bei ihnen zu Hause stellen findige Unternehmer polnische Fleischer und Fliesenleger ein, machen so bodenständige Handwerker, Scheinselbständige und reguläre Arbeitnehmer erwerbslos. Und zum zweiten Mal geschädigt ist das gewöhnliche Fußvolk in den letzten Jahren durch die politische Antwort seiner nationalen Standortverwalter auf die „Billiglohnkonkurrenz“ aus dem Osten, zu der diese ihre nationalen Unternehmen ermächtigt haben. Chirac, Schröder und Co verabreichen ihren Bürgern mehrere „Strukturreformen“: Mit all ihrer Macht über Arbeitsbedingungen und sozialisierte Lohnbestandteile verfügen sie „Flexibilität“ und eine Verbilligung des Lebensunterhalts ihrer Bürger, auf dass der französische oder deutsche Preis der Arbeit wieder konkurrenzfähig werde.
Europas Bürger sind angesichts dieser neueren sozialen Nöte, die ihnen die Entfesselung einer europäisierten Kapitalkonkurrenz und die Standort-Rivalität ihrer Regierungen eingebracht hat, mehrheitlich europapolitisch enttäuscht: Wo sie zur Abstimmung über das neueste Dokument europäischen Zusammenwachsens gebeten werden, lassen sie sich die Gelegenheit zu einem genau nachgezählten demokratischen Protest nicht entgehen, legen zu 55 bis 65% dagegen Einspruch ein – wo sie wohlweislich nicht zu einem Votum aufgefordert, sondern bloß nach ihrer Meinung gefragt werden wie in der BRD, sieht das Urteil kaum anders aus – und stellen damit ihre gute politische Erziehung unter Beweis. Denn wenn ihre heimischen Arbeitgeber polnische oder slowakische Billig-Arbeitskräfte gegen sie ausspielen, verübeln sie das weniger ihren Arbeitgebern als Europas offenen Grenzen, die von denen genau so ausgenutzt werden, wie es sich im Kapitalismus gehört, nämlich für die verschärfte Ausbeutung fremder wie heimischer Arbeitskräfte. Und wenn ihre Politiker ihnen die entsprechende sozialpolitische Rechnung aufmachen, nämlich dass sie mit ihrem bisschen Lebensstandard, ihren Gesundheitskosten und ihrer Altersrente im innereuropäischen Vergleich viel zu teuer sind und täglich wie lebenslänglich für weniger Lohn länger arbeiten müssen, dann fällt Europas auf Protest gestimmten Bürgern nichts Besseres ein als ein Votum nicht etwa gegen den Zynismus des marktwirtschaftlich-sozialpolitischen Standortvergleichs, sondern gegen den gesamteuropäischen Rahmen, in dem der stattfindet. Ausgerechnet ihrem Staat, der sie der freien Konkurrenz um niedrige Löhne als Mittel des nationalen Wachstums aussetzt, kommen sie mit dem vertrauensvollen Anspruch, er hätte sich als Schutzwall gegen die Folgen des nationalen Konkurrenzkampfs zu bewähren, den er gerade machtvoll führt; durch die jeweiligen Fortschritte Europas – des Binnenmarkts, der Einführung des Euro, und jetzt eben der EU-Verfassung – sehen sie sich betrogen um die eigentlich nützlichen Dienste ihrer nationalen Einrichtungen.
Mit ihrem aufgeregten Nein zum Verfassungsvertrag wenden
sie sich jedenfalls nicht gegen den machtvollen Gebrauch
der Macht, der sie unterworfen sind, sondern gegen den in
ihren Augen fatalen Fehler ihrer Politiker, wegen
„Europa“ von der exklusiv wirkenden nationalen Macht
etwas aufgegeben zu haben. Franzosen sind offen für die
Dummheit, auf den plombier polonais
als Urheber
ihrer sozialen Not loszugehen und gemeinsam mit LePen an
ihrem Präsidenten zu kritisieren, dass er als Vorsteher
der „Grande Nation“ die Macht aus den Händen gegeben
hätte, solche Fremden von französischem Boden fern zu
halten. Holländer halten allen Ernstes ihrem
Ministerpräsidenten vor, dass sie sich in Europa von den
anderen großen Staaten „herumgeschubst“ fühlen; wenn sie
in ihren leeren Geldbeutel blicken, schimpfen sie mit
ihrem „Nee“ auf den Euro, den sie als
Gemeinschaftswährung für ihre Armut haftbar
machen, und beklagen, dass ihre Regierung leichtfertig
den guten Gulden aufgegeben hat, zu dessen
Zeiten sich in Holland noch so gut leben ließ. Der
gedankliche Weg von der materiellen Betroffenheit des
verbilligten Arbeiters, des verelendeten Arbeitslosen,
des Alten mit der lückenhaften Rentenbiographie usw. zu
einer Proteststimme gegen einen „Beitritt der Türkei“,
gegen einen „zu hohen nationalen Pro-Kopf-Beitrag“ zum
EU-Haushalt oder überhaupt gegen „Europa“ ist für keinen
der zum Referendum einbestellten Nationalisten zu weit:
Die setzen alle sozialen Nöte umstandslos gleich
mit einer imaginierten Not ihrer Nation, die
der aus ihrer Unterordnung unter Europa schon
entstanden wäre und erst recht aus einem Türkei-Beitritt
erwachsen könnte, und diese vorgestellte nationale Not
denken sie sich wieder als die ihre. Diese Leute wollen
zwischen einem internationalen Konkurrenzproblem ihrer
Nation und den sozialen Drangsalen der Konkurrenz, der
sie und ihresgleichen ausgesetzt sind, nicht
unterscheiden und sind in unerschütterlich gutem Glauben
davon überzeugt, dass ihr Land mehr für sie als
Arbeiter und Rentner tun könnte, wenn, ja wenn seine
unverantwortlichen Führer eben nicht zu viel Macht aus
der Hand gegeben und Brüssel überantwortet hätten – als
ob in den gelaufenen Reform- und Entlassungsrunden
nationale Politik und privates Kapital nicht
eindrucksvoll demonstriert hätten, wofür öffentliche und
private Macht eingesetzt werden und wozu sie in der Lage
sind. So summiert sich die aus dem Sozialen ins Nationale
transponierte Unzufriedenheit europäischer Bürger, obwohl
deren Chefs sich etwas anderes bestellt haben, zu einem
starken mehrheitlichen Nein zu Europas schriftlicher
Verfassung.
Europas Politiker, die sich für die neue
EU-Verfassung stark machen, sind davon politisch
betroffen. Vor allem natürlich Frankreichs Präsident
und der Regierungschef der Niederlande: Chirac und
Balkenende wollten von ihrem Volk ein entschiedenes,
demonstratives Gut gemacht!
für – in dieser
Reihenfolge – sich, ihre Europapolitik und die
EU als solche. Das haben sie nicht bekommen.
Diese Niederlage freut die demokratische Konkurrenz der beiden Amtsträger, auch wenn die den Verfassungsvertrag selber befürwortet haben: Demokraten pflegen ihren gleich gesinnten Gegnern auch solche Erfolge nicht zu gönnen, die sie im Bewusstsein ihrer hohen nationalen Verantwortung eigentlich sachlich richtig und nötig finden. Distanziertere Befürworter einer EU-Verfassung nehmen es umgekehrt den Machthabern in Paris und Den Haag übel, dass die das für regierende Demokraten unbedingt Nächstliegende getan und die Abstimmung, deren positiven Ausgang sie sicher glaubten, als Akklamationsveranstaltung für sich inszeniert haben: Mit ihrem eigenen schlechten Stand bei ihrem Wahlvolk hätten sie so der europäischen Sache geschadet, nämlich ihren Stimmbürgern bloß die Gelegenheit geboten, mal wieder alles durcheinander zu bringen und ihren politischen Verdruss über ihre nationalen Führer an der völlig verkehrten Stelle, nämlich an Europas schönem neuen Grundgesetz auszulassen. Der Präsident aller Franzosen reagiert seinerseits genau so, wie regierende Demokraten auf massive Unzufriedenheit ihrer regierten Wähler zu reagieren pflegen: Chirac tauscht sein Kabinett aus, wechselt einen neuen Premierminister ein; damit darf und soll die Absage des Volkes, soweit sie der amtierenden Staatsspitze gilt, als erledigt gelten.
Eine europapolitische Bedeutung kommt dem Votum
der Franzosen und Niederländer freilich auch noch zu –
welche, das klären die Verantwortlichen sehr
sorgfältig kraft der Definitionshoheit über den Willen
des Volkes, über die sie von Amts wegen verfügen. Die
Ablehnung des Vertragstextes, den die regierenden
Herrschaften so mühevoll ausgehandelt haben, wird erst
einmal schlecht gemacht: Die Wähler hätten das 500 Seiten
starke Machwerk, über das sie abstimmen sollten, erstens
überhaupt nicht gelesen – ein verzeihliches Versäumnis
offenbar, wenn sie vertrauensvoll auf ihre Obrigkeit
gehört und zugestimmt hätten; Dafür-Sein geht unter
mündigen Bürgern ganz gut ohne Befassung mit der zum
Abnicken vorgelegten Sache; aber ohne gründliches Studium
ablehnen, was die Herrschaft möchte, das geht nicht; da
nimmt das Volk sich eindeutig zu viel heraus. Mit seiner
Ignoranz hat es sich zweitens selber ins Knie geschossen;
denn bei näherer Betrachtung hätte es herausgefunden,
dass alles, was man aus Sicht der Zuständigen an Europa
überhaupt aussetzen kann, durch den Verfassungsvertrag
gründlich gebessert würde – und dass der Bürger im
Übrigen und überhaupt heilfroh sein kann, dass seine
Politiker ihm „Globalisierung“ und „Strukturwandel“ auf
europäisch verabreichen; die könnten nämlich noch ganz
anders: Dabei ist die EU das beste Instrument zur
Bewältigung der Probleme der Globalisierung
(Günter Verheugen, Vizepräsident der
Kommission, in: SZ, 14.6.), die eine moderne
Kapitalstandortverwaltung ihrem Volk sowieso nicht
erspart. Dem muss man drittens ankreiden, dass es auf
seine Herren geschaut und denen, für was auch immer, eine
negative Quittung ausgestellt hat, statt ganz
unvoreingenommen deren europäisches Einigungswerk gut zu
finden: Dass der Wähler seine politischen Entscheidungen
als Frage des Vertrauens in seine Führer auffasst, ist
zwar in Ordnung; dann soll er aber auch ein
Vertrauensvotum abliefern, wenn das verlangt ist, und
sich sein Misstrauen aufheben, bis er offiziell
und ausdrücklich zu der freien Wahlentscheidung
aufgefordert wird, welcher Politikermannschaft er sein
grundsätzliches Vertrauen schenken möchte.
Doch abgesehen davon, dass die Franzosen und Holländer in
den Augen ihrer Führer eigentlich alles verkehrt
gemacht haben, zeigen die zuständigen Politiker in der
Deutung des Votums andererseits doch recht viel
Verständnis für ihre Bürger: Bürgerferne
,
Demokratiedefizite
, fehlende Legitimation
,
Gängelung
usw. hätten den durchaus gerechten Zorn
der EU-Völker auf eine Brüsseler Bürokratie gelenkt, die
ihnen mit ihrer allgegenwärtigen Regelungswut
unnötig das Leben schwer macht, sie entmündigt und
bevormundet: Tiroler Bauern schlagen sich mit
„Kampfstierverordnungen“ herum, Ostsee-Gemeinden müssen
Luftseilbahn-Verordnungen erlassen, und jede Gurke oder
Banane wird an einer EU-Krümmungsverordnung gemessen.
Lassen wir mal dahingestellt, wie viele Bürger sich wirklich an der fehlenden Legitimierung von Brüsseler Kommissaren und „Eurokraten“ stören. Und was deren „Regelungswut“ betrifft: Wenn Europas Bürger daran wirklich so viel auszusetzen hätten, wie ihnen ihre nationalen Meinungsführer so gerne nachsagen, hätten sie ja schon längst mal in ihren Heimatstaaten damit anfangen können; schließlich können sie in ihren durchorganisierten Vaterländern keinen Schritt machen, ohne von irgendeiner Verordnung „bevormundet“ oder „entmündigt“ zu werden. Wenn ausgerechnet ihre einheimischen Oberhäupter ihnen in diesem Punkt Recht geben und ein Recht auf Volkszorn zubilligen, dann ist das jedenfalls ein doppelter Treppenwitz: Andern Leuten Vorschriften machen ist schließlich ihr eigenes Alltagsgeschäft; und was die Brüsseler Bürokratie an Richtlinien und Verordnungen dazu beisteuert, das beruht auf Befugnissen, die die nationalen Chefs ihrer Zentrale übertragen, und oft genug auf Aufträgen, die sie ihr erteilt haben. Fast scheint es, als wollten die – demokratisch ganz einwandfrei legitimierten – nationalen Machthaber mit ihrer „Brüssel“-Schelte die politische Unzufriedenheit ihrer Stimmbürger von sich ablenken und ihr eine Richtung geben, in der sie, die Führer, sich mit ihren Völkern gemein machen können.
In Wahrheit verhält es sich freilich eher umgekehrt. Wenn die Regierenden öffentlich auf ihr eigenes Brüsseler Machwerk schimpfen und darüber den Schulterschluss mit ihrer Basis suchen, dann mobilisieren sie deren Verdrossenheit, um diese für ihre Unzufriedenheit mit dem von ihnen selbst ins Werk gesetzten Europa zu vereinnahmen. Zum einen sind nämlich die verantwortlichen Macher eines einheitlichen Europa selber seit jeher zugleich die geborenen Europa-Skeptiker; die Forderung nach und der Vorbehalt gegen eine immer mehr „zusammenwachsende“ europäische Staatenunion gehören bei ihnen zusammen – der Verfassungsvertrag ist selber ein Dokument dieses Widerspruchs; und dass man mit dem erreichten Stand der Dinge im Grunde nie zufrieden sein kann, weder als Anhänger eines supranationalen Europa noch als ideeller Verteidiger der nationalen Souveränität, das haben sie ihren Völkern wirklich längst beigebracht. Zum andern geht die Unzufriedenheit der Regierungen gerade der wichtigsten EU-Staaten mit der tatsächlichen Verfassung ihrer Union ausgerechnet da, wo der eine Art förmlicher Verfassung verpasst werden soll, über das gewöhnliche und gewohnte Maß an nationalistischer „Brüssel“-Kritik ziemlich entscheidend hinaus. Sie richtet sich nicht mehr bloß auf Verbesserungen im jeweiligen nationalen Interesse, sondern rührt an Grundfragen, die den Fortbestand des gesamten Unternehmens betreffen. Deswegen geht die „politische Klasse“ diesmal auch nicht – wie schon öfter – über ein „unvernünftiges“ Wählervotum hinweg zur Tagesordnung über.
2. Die widersprüchliche Natur des Europa-Projekts und seine konstruktive Fortschreibung im neuen Verfassungsvertrag – ein Rückblick
In Einem sind die Partnerstaaten der EU sich einig: Ein jeder ist und findet sich für das, was er will und braucht, um sich nach seinen eigenen Maßstäben erfolgreich in der imperialistischen Welt zu behaupten und durchzusetzen, zu klein. Sie alle brauchen und wollen gemeinsam eine Macht zustande bringen, die vermag und vollbringt, wozu sie je für sich allein nicht fähig sind.
Dabei sind die Schranken und Defizite, die jeder einzelne Staat an sich und seiner Nation entdeckt – in Sachen Wirtschaftskraft und Finanzmacht, Teilhabe am internationalen Handel und Kapitalverkehr und Gewinn daraus, Verhandlungsmacht und Einfluss aufs friedliche wie gewaltsame Weltgeschehen –, ganz unterschiedlicher Art: Wo es für die Großen – Deutschland, Frankreich, England in erster Linie – um nichts Geringeres als Gleichrangigkeit mit der amerikanischen Weltmacht geht, um die Position des zweiten Zentrums der Weltwirtschaft und um maßgebliche Mitbestimmung über die strategischen Fronten, an denen entlang die Staatenwelt sich ordnet, da sehen sich kleinere Nachbarn vor der Alternative ‚Mitmachen oder Marginalisierung‘; und die Neumitglieder aus dem einstigen ‚Ostblock‘ suchen die Chance, ihren weltpolitischen Frontwechsel gegen Moskau abzusichern und die Restauration des Kapitalismus national erfolgreich zu gestalten. Darin kommen aber alle mittlerweile 25 Unionsmitglieder überein, dass ihnen mit einem großen Binnenmarkt für ihre jeweilige nationale Kapitalistenklasse bzw. für die Entwicklung eines nationalen Kapitalkreislaufs, mit einer praktisch zusammenaddierten Finanzmasse und mit einem organisiert gemeinsamen Auftreten nach außen im Prinzip besser gedient ist als mit einer bloß nationalen Wachstums-, Finanz- und Weltpolitik – auch wenn die Beiträge der Partner zu dieser Übereinkunft ebenso wie die Erträge daraus selber wieder höchst unterschiedlich beschaffen sind: Einige wenige setzen die Ziele und definieren die Maßstäbe des gemeinsam zu erzielenden Erfolgs; die meisten fügen sich ein in ein imperialistisches Großunternehmen, das sie von sich aus noch nicht einmal planen, geschweige denn ins Werk setzen könnten.
Dieses Gemeinschaftsunternehmen verfügt über feste Institutionen, die von den souveränen Mitgliedern mit eigenen Kompetenzen und Befugnissen auch ihnen selber gegenüber ausgestattet worden sind; in deren Auftrag schaffen „Eurokraten“ immer mehr europäisches Recht, verwalten einen gemeinsamen Haushalt, und etliche Nationen verwenden bekanntlich schon dasselbe Geld. Die supranationale Ordnung, die die Europäer sich da zugelegt und als für sich verbindlich anerkannt haben, ist selbstverständlich keineswegs das Ende – auch nicht „der Anfang vom Ende“ – ihrer nationalen Konkurrenz gegeneinander. Die souveränen Mitglieder der Union rechnen nach wie vor national; die Regeln, die sie zum Zwecke der substanziellen Vergrößerung ihres Nutzens vereinbart, kodifiziert, organisatorisch verfestigt haben und beständig fortschreiben, regulieren ihren gemeinsamen Kampf um den Gesamtnutzen aller ebenso wie ihren Konkurrenzkampf unter- und gegeneinander um ihren nationalen Anteil an den Erfolgen wie an den Unkosten des Gemeinschaftsunternehmens; deswegen geraten die Nationen mit ihren Rechnungen auch immer wieder in Konflikt mit dem Regelwerk selber und dessen berufenen Sachwaltern. Das gilt seit jeher für den Binnenmarkt, der die kapitalistischen Unternehmen von nationalen Schranken freisetzt, um sie zu Konkurrenzerfolgen in neuer Größenordnung zu befähigen: Er beflügelt die Staaten zugleich zu neuen Anstrengungen, solche Erfolge dem eigenen nationalen Standort zugute kommen zu lassen. Das gilt nicht weniger für die Errungenschaft einer gemeinsamen Währung: Mit der stellt jeder Finanzminister seine nationale Vorteils-Nachteils-Rechnung an – und gerade die Erfinder mancher schönen Regelung in Sachen Haushaltsdefizit erleben derzeit, dass Vorkehrungen, die zur Sicherung der eigenen Finanzmacht gegen die Geldbedürfnisse schwächerer Mitmacher gedacht waren, sich gegen ihre eigene haushälterische Freiheit richten: Es handelt sich eben bei all den sinnreichen Maßregeln für einen stabilen Euro um die Ergebnisse eines allseitigen Bemühens der Regierungen, sich Handhaben zur Konsolidierung der eigenen nationalen Schuldenwirtschaft per Rückgriff auf die Potenzen und Beschränkung der Bedürfnisse der anderen zu sichern. Die Konkurrenz um das politische Gut schlechthin, um Macht in internationalen Dingen über andere, hört mit dem Willen zu einer gemeinsamen Weltmacht erst recht nicht auf; sie bekommt im Gegenteil neue Betätigungsfelder: den Kampf ums Hineinregieren in die Partnerländer sowie um den Gebrauch der gesammelten Macht des ganzen Clubs.
Dahin haben die EU-Nationen es mit ihrem großen Gemeinschaftswerk also gebracht: Ihr Konkurrenzkampf um nationalen Erfolg richtet sich ganz entscheidend auf den Nutzen, den sie aus einander und aus ihrer Gemeinschaft herauszuholen vermögen. Und dafür sind Prozeduren der Entscheidungsfindung, Brüsseler Rechtsverordnungen und Kompetenzen der Euro-Bürokratie tatsächlich alles andere als gleichgültig. Für alle Beteiligten sind das wichtige Mittel und Schranken ihrer Vorteilssuche. Auf die richtet sich daher ein guter Teil ihrer Konkurrenzanstrengungen: auf die Besetzung von Posten und deren Befugnisse, auf die Ausgestaltung und das Recht zur Auslegung EU-weit verbindlicher Rechtsvorschriften usw. sowie auf die Methoden der Beschlussfassung. Das alles ist folglich und ganz folgerichtig eine selbständige Quelle nationaler Unzufriedenheit – jener Unzufriedenheit, an der die nationalen Machthaber ihre Völker seit jeher teilhaben lassen, wenn sie denen die Brüsseler Eurokratie als ein verselbständigtes Unwesen ausmalen, das nur darauf aus ist, dem kleinen Mann das Leben schwer zu machen. Auf der anderen Seite wissen die Chefs natürlich, was sie an ihrem Gemeinschaftswerk und dessen relativ eigenständigem Funktionieren haben. Ihre Unzufriedenheit – mit mangelnden nationalen Erfolgen und im Lichte dieses Ergebnisses mit Prozeduren und Rechtsvorschriften, an die sie sich halten müssen, obwohl sie sich die gar nicht bestellt haben oder mittlerweile gerne abbestellt hätten – ist deswegen bislang auch nicht in eine Absage ausgeartet. Gerade bei den Chefs der tonangebenden, der Führungsmächte der Union wirkt sie im Gegenteil regelmäßig als Stachel, die ganze Konstruktion fortzuschreiben und weiterzuentwickeln; immer von dem Standpunkt aus, dass es für sie kein anderes Mittel gibt, ihr ehrgeiziges nationales Verlangen nach europäischer Weltmacht zu befriedigen – bzw. als kleiner Staat zwischen derart ehrgeizigen Mächten die eigene Bedeutung zu sichern und auszubauen und an einer Weltmacht völlig jenseits der eigenen nationalen Reichweite mitbestimmend zu partizipieren –, als die immer weiter vorangetriebene politische Einigung des Kontinents. Deren Fortschritte, so die europapolitische Leitlinie, müssten sich letztlich, bei allen Belastungen und Beschränkungen, in der eigenen nationalen Erfolgsbilanz unweigerlich positiv niederschlagen; umgekehrt käme ein Stillstand im Einigungsprozess schon einem Rückschritt gleich, wäre schon der halbe Abschied von dem großen Projekt, gemeinsam zur Nummer Eins in der Weltwirtschaft und zur strategischen Ordnungsmacht zu werden.
In diesem Sinne reformieren die europäischen Partner seit
den Gründungstagen ihrer Wirtschaftsgemeinschaft immerzu
an deren tatsächlicher wie rechtlicher Verfassung herum;
immer in der Absicht, den erreichten Stand gegen einen
„Rückfall in den Nationalismus“ abzusichern, den jeder
bei allen andern befürchtet und für den auch wirklich
jeder selber gut ist, weil keiner je seinen nationalen
Standpunkt preisgegeben hat. Und ganz auf dieser Linie
haben die seinerzeit noch 15 Mitglieder den Beitritt des
halben Ex-‚Ostblocks‘ zum Anlass genommen, ihre Union
vermittels eines Verfassungsvertrags in aller Form zu
vertiefen
.[2] Das Papier, das nach langem
Gezerre tatsächlich zustande gekommen ist, sieht zum
einen eine Ausweitung des Bestands an gemeinsamer Politik
vor. Für ihre Konkurrenz untereinander bekennen sich die
Staaten zu einem Abbau nationaler Schranken, wo die der
Freiheit des Geschäftemachens noch in die Quere kommen,
vor allem auf dem weiten Feld der „Dienstleistungen“,
deren „Deregulierung“ mittlerweile auch schon mit einer
neuen Richtlinie in Angriff genommen wird; für die
fernere Zukunft verpflichten sie sich sogar auf eine
„gemeinsame Wirtschaftspolitik“, also immerhin darauf,
noch über die Maßregeln des Euro-Stabilitätspakts hinaus
Europa nach gemeinsamen Kriterien als gesamtheitlichen
Kapitalstandort zu bewirtschaften. Ihr gemeinsames
Auftreten nach außen wollen sie nicht mehr dem machtlosen
Doppelpack aus Außen-Kommissar und „Mister GASP“
überantworten, sondern einem regelrechten
EU-Außenminister mit hohem Stellenwert in der
EU-Kommission wie im letztlich nach wie vor
entscheidenden Ministerrat sowie mit eigenem
diplomatischen Corps anvertrauen – wie im Vorgriff auf
die einheitlich agierende Weltmacht, die jede der
führenden Nationen gerne wäre, allein aber nicht
hinkriegt; und als wollten sie auch auf diesem Feld über
die Institution zur Sache gelangen: über den
Repräsentanten eines gesamteuropäischen
Weltordnungswillens zu einem kollektiven Imperialismus.
Zum andern und hauptsächlich widmet sich der Vertrag den
Institutionen, den Prozeduren der Beschlussfassung und
der Arbeitsweise der Gemeinschaftsbürokratie. Im
Ministerrat, dem eigentlichen Entscheidungsgremium, in
dem die jeweils zuständigen Minister bzw. in letzter
Instanz die Regierungschefs der Mitgliedsländer im
Prinzip gleichberechtigt die Politik der Union festlegen,
sollen in deutlich mehr Fällen als bisher, „als
Regelfall“, verbindliche Beschlüsse mit „qualifizierter
Mehrheit“ – mindestens 55% der Staaten mit zusammen
mindestens 65% der Bevölkerung – gefasst werden können;
das Prinzip der Einstimmigkeit, also das Vetorecht eines
einzelnen Mitglieds soll nurmehr als Ausnahmefall in den
Bereichen der Außen- und Sicherheits- sowie der Steuer-
und Sozialpolitik gelten; auch soll die Absage einzelner
Unionsstaaten andere nicht daran hindern können,
miteinander ohne den Rest europapolitisch „voranzugehen“
und eine „verstärkte Zusammenarbeit“ zu vereinbaren. Die
Kommission, die die supranationalen Amtsgeschäfte führt
und die in den Ministerräten gefassten Beschlüsse
exekutiert, wird neu zugeschnitten und von der Vorgabe
befreit, dass jedes Mitgliedsland mit einem Kommissar und
jeder von den Großen mit deren zwei darin vertreten sein
muss. All diese neuen Regelungen bekräftigen den
Gemeinschafts-Standpunkt – und verschärfen
dementsprechend den Konkurrenzkampf der Beteiligten um
ihren Einfluss auf dessen Ausgestaltung.
Denn das ist nach wie vor der wirkliche politische Gehalt dieses förmlichen Supranationalismus: Das Ringen der Nationen um ökonomische Erträge und politische Leistungen „Europas“ für sie wird auf Methoden der gemeinsamen Beschlussfassung festgelegt und damit nicht etwa überwunden, sondern um einen abgehobenen Bereich des politischen Kräftemessens erweitert. Ein solches Kräftemessen findet daher – logischerweise – bereits im Verhandlungs-„Poker“ um den Verfassungsvertrag statt. In der Welt der Verfahrensweisen, der Methodologie des kollektiven Entscheidens und Handelns suchen die EU-Staaten ihre Chance, ihren Nutzen vorzuprogrammieren, entdecken umgekehrt die Gefahr, sich unversehens möglicher Machtpositionen gegeneinander zu begeben, und tun alles, um sich das eine zu sichern und gegen das andere abzusichern. Je nach dem, was sie für sich erreichen wollen und was sie an tatsächlichem Einfluss und an Erpressungsmacht aufzubieten haben, legen sie sich zweckmäßig erscheinende Formvorschriften für ihr gemeinsames Entscheiden und Handeln zurecht und versuchen die durchzusetzen. So fordern die großen Führungsnationen Deutschland und Frankreich „demokratischere“ und meinen damit solche „Verfahren“, die es ihnen erlauben könnten, Mitglieder, die ihrem Weltmachtinteresse eventuell widerstreben, zu majorisieren oder mit der Drohung der Ausgrenzung zu disziplinieren oder auch tatsächlich partiell auszuschalten; sie dringen auf „Integration“ nicht als Anwälte und ehrliche Makler eines wirklichen Supranationalismus, sondern weil sie sich von der förmlichen Preisgabe gewisser Souveränitätsrechte und -vorbehalte durch alle Beteiligten eine größere Durchschlagskraft des materiellen Übergewichts ihrer Interessen und Machtmittel versprechen. Genau das fürchten andere, kämpfen daher – notfalls mit der Androhung oder dem Einsatz ihres Veto-Rechts, bevor sie es aufgeben oder durchlöchern lassen – um eine Sperrminorität gegen Mehrheitsentscheidungen, die von den Großen leichter zu manipulieren wären. Wo man sich nicht einigen kann, helfen bisweilen komplexe, weit in die Zukunft reichende Fristenregelungen weiter, manchmal auch zu Protokoll gegebene Vorbehalte gegen gewisse Vereinbarungen, beigeheftete nationale Lesarten oder Interpretationen des Vertragstextes. Am Ende dauert das europäische Grundgesetz seine 500 Seiten, die kein Wähler durchstudiert.
Die alles entscheidende Grundfrage der europäischen Staatenunion: ob, wie und unter wessen Federführung gut zwei Dutzend souveräne Nationen sich zu einer aktionsfähigen Weltmacht zusammenschließen, wird in diesem Vertrag permanent aufgeworfen und nirgends ehrlich gestellt. Sie wird schon gar nicht entschieden, dafür in tausend Einzelfragen zerlegt, und an denen wird so lange heruminterpretiert, bis sich ein Kompromiss findet. Das Ergebnis ist eine ihren Urhebern bis auf Weiteres hinreichend funktionstüchtig erscheinende Verlaufsform für das gemeinsame Unternehmen rivalisierender Führungsmächte, friedlich und ohne Waffen, unter Anerkennung der Souveränität aller Beteiligten und bei Wahrung aller nationalen Interessen und Berechnungen, vor allem ihrer eigenen, die Herrschaft über den alten Kontinent zu erobern und im Kollektiv einen entscheidenden Anteil an der Beherrschung der Welt zu erringen – ein dermaßen widersprüchliches Unterfangen ist einfacher wohl in der Tat nicht zu machen.
3. Das Projekt ‚Weltmacht Europa‘ in der Krise
Dass der EU-Verfassungsvertrag in zwei Gründungs- bzw.
Führungsnationen der EU deutlich abgelehnt wird, liegt
nicht am Inhalt des Vertrags, und dass die beiden
gescheiterten Referenden die EU in die tiefste Krise
seit ihrem Bestehen
stürzen, liegt nicht an den
beiden Volksabstimmungen. Ihre verkehrten Gründe dafür,
ihre Unzufriedenheit gegen „Europa“ zu wenden, haben
gelehrige Patrioten einschlägigen Hinweisen ihrer
„politischen Klasse“ entnommen; nicht zuletzt der
Agitation ihrer Regierenden für den
Verfassungsvertrag; die haben Chirac und Co nämlich
hauptsächlich mit der Botschaft bestritten, in ihrer
gegenwärtigen Verfassung wäre die EU mehr von Nachteil
als von Nutzen für die eigene Nation und im Falle einer
fortgesetzten Erweiterung ohne vorherige gründliche
Reform vollends ein Schadensfall. Und dieses kritische
Votum der Zuständigen zum Zustand ihrer Union, in dem
Befürworter wie Gegner des neuen Vertrags in ganz Europa
sich ziemlich einig sind, macht eine Krise offenkundig,
in der ihr schönes Projekt schon seit längerem steckt.
Zum einen leiden die zwei großen kontinentalen Führungsmächte Deutschland und Frankreich seit geraumer Zeit darunter, dass ihre Wirtschaft nicht mehr gescheit wächst. Die Steuereinnahmen sinken, die staatlichen Defizite in den Haushalten steigen über die erlaubten „Stabilitäts“-Grenzen, und die Arbeitslosigkeit, der Index für eine schwindende Masse an rentabler Arbeit, von der Kapital und Staat leben, steigt. Arbeitsplätze entstehen, wenn überhaupt, in den Ländern, die Europas Führer ihren Kapitalisten mit der Osterweiterung ihrer Union erschlossen haben. Diese Länder haben sich mit ihrem Überangebot an brauchbaren, dabei spottbilligen Arbeitskräften und mit äußerst unternehmerfreundlichen Steuersätzen partiell zu günstigen Anlagesphären entwickelt – eigentlich ganz nach Wunsch; genau so, als zusätzliches Geschäftsfeld für Firmen aus den seit Jahrzehnten erfolgreichen westlichen Standorten, sollte das eingemeindete Ostmitteleuropa funktionieren. Dass die Rechnung für die etablierten europäischen Weltwirtschaftsmächte nun nicht aufgeht, der Zuwachs an Märkten und Investitionsgelegenheiten kein Wachstum in den alten Kernländern der Union generiert, liegt nicht wirklich an den Neumitgliedern: Das Kapital insgesamt wächst nicht mehr; es hat – wieder einmal – mit der absurdesten seiner systemeigenen Errungenschaften, seiner Überakkumulation, seine Verwertungsbedingungen zunichte gemacht und statt zu allseitig vermehrtem Geldverdienen in eine Krise des Geschäftsgangs hineingeführt; deswegen geht der Zugriff auf neue Investitionssphären mit einem „Minus-Wachstum“ in den Heimatländern der zupackenden Multis einher. Solche politökonomischen Wahrheiten kümmern die Führer kapitalistischer Wirtschaftsmächte aber überhaupt nicht; praktisch könnten sie mit denen ja auch gar nichts anfangen. Sie nehmen nur wahr, dass die neu geschaffenen Kapitalstandorte munter gegen sie und auf Kosten ihrer Länder konkurrieren. Dagegen kämpfen sie an: im Inneren mit „Strukturreformen“, die den „Faktor Arbeit“ billiger und ergiebiger machen, damit Westeuropa gegen die „unfaire“ Billiglohnkonkurrenz aus dem Osten mit den gleichen Waffen und überlegener Macht zurückschlagen kann; außerdem europapolitisch mit einem ganzen Bündel von Maßnahmen und Initiativen. Der EU-Haushalt und vor allem ihre Netto-Beiträge dazu müssen sinken, speziell der Posten für „Strukturhilfen“, die es den Osteuropäern gestatten, ihre Gemeinwesen auf „unsere“ Kosten so gut auszustaffieren, dass Westeuropas Unternehmer dorthin auswandern. Die „Bolkestein“-Richtlinie, die den freien Dienstleistungsverkehr in Europa regeln soll, wird mit aller Macht als „unfair“ bekämpft, weil polnische Fleischer und Fliesenleger deutsche und französische Gewerbetreibende in die Pleite treiben. Fürs Kapital in den alten Ländern tut Brüssel zu wenig, schadet ihm sogar mit Richtlinien zum Umwelt- und Gesundheitsschutz; deswegen braucht es einen mächtigen deutschen Kommissar mit einem klaren industriepolitischen Auftrag und weitreichenden Kompetenzen und außerdem eine deutsch-französische Industriepolitik an der Brüsseler Kommission vorbei. Gegen den Widerstand der zuständigen Währungshüter nimmt man sich in Berlin und Paris die Freiheit, den Euro-Stabilitätspakt nicht bloß kontinuierlich zu brechen, sondern so zu interpretieren, dass man selber darf, was den anderen Teilhabern am Gemeinschaftsgeld nach wie vor verwehrt bleibt. So beantworten die beiden kontinentalen Führungsmächte der EU die kapitalistische Krise, unter der sie leiden, mit einer Politik der verschärften Konkurrenz gegen ihre Partner und nehmen damit einen Standpunkt ein, der die jahrzehntelang gültige Prämisse ihrer Europapolitik praktisch negiert und aufkündigt: Ihre Gleichung, dass „mehr Europa“ sich für die Führungsnationen unweigerlich lohnt, gilt nicht mehr; ihr eigenes Werk bereitet ihnen mehr Last, als es ihnen Erträge beschert; wenn ein verärgerter deutscher Super-Kommissar keineswegs bloß den dummen Stimmbürgern, sondern durchaus auch den politisch Verantwortlichen anlässlich der schief gegangenen Volksabstimmungen entgegenhält:
„Alles wird zusammengerührt: Die EU-Beiträge, die vermeintliche Gängelung durch Brüsseler Bürokraten, angebliche Korruption, die Sorge vor sozialem Abstieg, die Erweiterung – alles! All das wird vermischt mit dem eigentlichen Problem – der Globalisierung. Für mich ist dies die wichtigste Erklärung der derzeitigen Krise: Die Zukunftsangst der Menschen in Ländern wie Deutschland, Frankreich und den Niederlanden – dem alten industriellen Herz Europas, das dem globalen Strukturwandel am härtesten ausgesetzt ist. Dabei ist die EU das beste Instrument zur Bewältigung der Probleme der Globalisierung“ (Günter Verheugen, Vizepräsident der Kommission, in: SZ, 14.6.),
dann trifft er mittlerweile sogar in Berlin und Paris auf Politiker, die ganz im Gegenteil die EU als eines ihrer nationalen Hauptprobleme und keineswegs als deren Lösung identifiziert haben.
Als noch enttäuschender erweist sich die große Union für die Bestrebungen der BRD und Frankreichs, mit einer wachsenden Gefolgschaft an Kleinstaaten und mittleren Mächten, schließlich als Wortführer des ganzen Kontinents eine immer gewichtigere Rolle in der Weltpolitik zu spielen und den USA in aller Freundschaft die Definitionshoheit über gerechten Krieg und ordentlichen Frieden zu entwinden. Es ist ihnen nicht einmal gelungen, ihren Verein gegen Amerikas Irak-Krieg in Stellung zu bringen – es fehlt ihnen schlicht die Macht, den strategischen Fakten, die die Weltmacht mit ihren gewaltsamen Aufräumaktionen setzt, eigene „Tatsachen“ von ähnlicher Überzeugungskraft entgegenzusetzen. Stattdessen kann die US-Regierung den Erfolg verbuchen, dass wichtige EU-Partner sich gegen die in Berlin und Paris festgelegte Linie entschieden und ihrer „Koalition der Willigen“ angeschlossen haben. In ihrem Programm, eine einheitlich agierende europäische Weltmacht zu formen, sind und finden sich die beiden Führungsmächte dadurch schwer zurückgeworfen. Ihre undiplomatisch laut geäußerte Kritik vor allem an den neuen Partnern im Osten, die sich diesem Projekt in einer entscheidenden Situation entzogen und deutlich gemacht haben, dass sie zur Unterordnung innerhalb der EU eine Alternative jenseits des Atlantik haben und diese für die Durchsetzung ihrer Vorstellungen von einer freiheitlichen Staatengemeinschaft in der EU einzusetzen gedenken, verrät grundsätzliche Zweifel an der Brauchbarkeit der Union – in ihrer derzeitigen Verfassung, wenn nicht überhaupt – als „Keimzelle“ einer künftigen autonomen Weltordnungsmacht von gleichem Kaliber wie die amerikanische. Damit ist Europa auch weltpolitisch definitiv in der Krise.
Die zweifache imperialistische Enttäuschung der bislang entschiedensten Verfechter eines unter ihrer Führung geeinten Europa trifft sich mit dem Standpunkt der dritten europäischen Macht, die mit ihrem weltpolitischen Ehrgeiz bei diesem Projekt nicht zu übergehen, mit ihren Machtmitteln dafür auch unentbehrlich ist und die selber gleichfalls zu klein ist und sich zu klein findet, um in der Welt des 21. Jahrhunderts die ihr zukommende Rolle eines strategischen Subjekts zu spielen: Großbritannien hat und weiß zwar auch kein anderes Mittel, um sich für seine politischen Ambitionen den nötigen Rückhalt zu schaffen und seinem „special friend“ Amerika „auf gleicher Augenhöhe“ zu begegnen, als ein einiges Europa; in ihrer derzeitigen Verfassung jedoch, und erst recht unter der Ägide der beiden großen, in der aktuellen Krisenkonkurrenz wenig erfolgreichen und allzu antiamerikanischen Kontinentalmächte, erscheint die EU den Briten eher untauglich für ihre nationalen Bedürfnisse, wenn nicht sogar als Gefahr sowohl für ihre paar Konkurrenzerfolge ökonomischer Art als auch für den weltpolitischen Stellenwert, den sie als besonderer Partner der USA immerhin besitzen. Mit dem Standpunkt bestätigt und vertieft Großbritannien die Krise, in die das europäische Einigungswerk mit der „Wachstumsschwäche“ seiner Protagonisten, mit deren strategischer Niederlage im Kampf um eine gleichgeschaltete Gefolgschaft und mit der fundamentalen nationalen Unzufriedenheit der bislang führenden Europapolitiker geraten ist.
Es ist das Pech des so sorgfältig ausgeklügelten Verfassungsvertrags, dass seine Ratifizierung ausgerechnet mitten in dieser Krise auf der europäischen Tagesordnung steht. Der unterzeichnete Vertragstext ist selber schon ein mühsam ausgehandelter Kompromiss; die Beschlussfassung darüber in den Partnerstaaten gerät unweigerlich und außerdem sehr absichtsvoll zu einer Stellungnahme zu der kritisch verschärften Grundsatzfrage, wie und unter welchen Bedingungen es überhaupt mit der EU weitergehen soll, und lässt ganz folgerichtig überall nationale Enttäuschungen und Vorbehalte aufwallen. So setzt der französische Staatspräsident ein Referendum an und mobilisiert sein Volk für ein machtvolles „Oui“ in der Absicht, Frankreichs Rolle als Motor des ganzen Unions-Projekts zu demonstrieren, dadurch sich und sein Land als das maßgebliche Subjekt der weiteren Entwicklung, federführend bei der „Umsetzung“ des Vertragswerks in die politische Realität, in Position zu bringen: Nicht bloß um den Verfassungstext soll es bei der Abstimmung gehen, sondern um die europaweite Durchsetzung des „Sozialmodells“ der Grande Nation – also erstens um den Beweis, dass die Krise Frankreichs Wirtschaftsmacht überhaupt nicht erschüttern kann, und zweitens um die Beglaubigung des Willens und der Fähigkeit der Nation, sich im Kreise der EU-Partner durchzusetzen. Mit der demonstrativ einhelligen Verabschiedung des neuen europäischen „Grundgesetzes“ durch Bundestag und Bundesrat unmittelbar vor dem französischen Referendum und mit dringlichen Aufrufen deutscher Prominenz an die französischen Stimmbürger, ihrer europapolitischen Verantwortung gerecht zu werden und Ja zu sagen, unterstützt die Berliner Republik diesen Versuch, die Linie vorzugeben, auf der Europa aus seiner Krise herauskommen könnte und soll. Umgekehrt macht die britische Regierung mit ihrem Beschluss, ihr Volk, das in sämtlichen Umfragen seine entschiedene Ablehnung kundtut, über den Verfassungsvertrag abstimmen zu lassen, unmissverständlich deutlich, dass die EU sich noch ganz gewaltig ändern, nämlich von London aus umgestalten lassen muss, um in ihrem wichtigsten Mitgliedsland akzeptiert zu werden und „voranzukommen“.
Nun scheitert also die von Chirac anberaumte Akklamation des Vertragswerks durch den französischen Souverän; eine Mehrheit wendet die von den Regierenden selbst an den Tag gelegte und öffentlich geschürte Unzufriedenheit mit der tatsächlichen politischen und ökonomischen Verfassung der EU gegen den Präsidenten, der seinem Volk die aufgeschriebene Verfassung als Heilmittel gegen handfeste politische Übel verkaufen will; der Nationalismus von unten entscheidet sich mehrheitlich gegen die beantragte Demonstration europapolitischer Führerschaft. Das wirkt als Rückschlag nicht bloß für den weiteren Ratifizierungsprozess, sondern für die Union selbst und für alles, was sie an gemeinsamer Macht schon zustande gebracht hat und an gemeinschaftlicher Politik exekutiert. Niemand vertritt ernsthaft den Standpunkt, das Ergebnis aus Frankreich ließe sich so leicht reparieren wie schon so mancher andere Ablehnungsbescheid von unten, der die EU letztlich nur um ein paar Ausnahmeregelungen bereichert, ihren Fortgang aber nie aufgehalten hat, nach einiger Zeit dann auch meist revidiert worden ist. Eine solche Tiefstapelei verbietet sich spätestens mit dem noch kräftigeren „Nee“ der Niederländer, immerhin auch Gründungsmitglieder und gewichtige Nettozahler der EU: Auch die sehen nicht mehr ein, weshalb sie so viel beisteuern sollen, wo ihre Nation doch so wenig davon hat. Und prompt melden alle möglichen Seiten lange hintan gehaltene Vorbehalte an, so als hätten sie nur auf die Gelegenheit gewartet, zur offenkundig gewordenen Krise der Gemeinschaft das Ihre beizusteuern: Ein italienischer Minister erwägt mal eben, ob sein Land nicht besser die Lira wieder einführen und diese an den Dollar ankoppeln sollte; aus dem deutschen Finanzministerium ist die Beschwerde zu vernehmen, mit der D-Mark hätte die BRD einen Kostenvorteil bei den Zinsen für die Staatsschuld und damit einen gewichtigen Konkurrenzvorteil gegen den Rest der europäischen Staatenwelt hergegeben; Frankreich erklärt den „Briten-Rabatt“, Großbritannien die Subventionierung französischer und anderer südländischer Bauern für schlechterdings nicht mehr hinnehmbar. Quer durch die Reihen brechen sich grundsätzliche Zweifel Bahn, ob es mit der schon beschlossenen Erweiterung der Union um Bulgarien und Rumänien wirklich so weitergehen soll; von der Aufnahme der Türkei ganz zu schweigen. Auf einmal und einen historischen Augenblick lang ist gar nichts mehr selbstverständlich, das Ausscheiden von Mitgliedern aus der Währungs- oder überhaupt aus der Union zumindest „denkbar“, keine Errungenschaft irreversibel. Mit den „gescheiterten“ Abstimmungen in Frankreich und Holland und der absehbaren Ablehnung demnächst in anderen Ländern, aber keineswegs bloß deswegen steht nicht bloß der Verfassungsvertrag zur Disposition, sondern die weitere Entwicklung und mit dieser die Haltbarkeit der ganzen Gemeinschaft auf dem Spiel.
4. Ein gescheiterter Gipfel, ein großes Zerwürfnis und die vermiedene Kündigung
Unter diesen Vorzeichen kommen die Regierungschefs zu ihrem obligaten Gipfeltreffen zusammen und treiben dort die Krise ihres Vereins kunstgerecht voran.
Als Erstes werden sie sich darüber einig, den Fortgang der nationalen Beschlussfassungen über den Verfassungsvertrag weder zu stoppen, wo Termine schon festliegen – die Massen im luxemburgischen Großherzogtum dürfen wenig später unter heftigen Ermahnungen ihres bedingungslos proeuropäischen Ministerpräsidenten Ja sagen und so dem Ratifizierungsvorgang und dem Vertrag selber ein wenig neues Leben einhauchen –, noch auf die Tagesordnung zu setzen, wo bloß erneute Ablehnung zu erwarten ist; ein Sondergipfel unter österreichischer Präsidentschaft im Juni 2006 sieht dann weiter. Damit schaffen die Verantwortlichen sich erst einmal die Nötigung vom Hals, sich mit der unübersehbar kritisch gewordenen Grundsatzfrage zu befassen, unter welchen Bedingungen und mit welcher Perspektive sie überhaupt weiterhin gemeinsame Sache machen wollen.
Dies vollbracht, stehen allerdings heikle Finanzfragen zur Entscheidung an, Beschlüsse über den Haushalt der am 1.1.2007 beginnenden neuen Finanzperiode der Union. Und mit dem Streit ums Geld gerät dann doch die bestandsgefährdende Unzufriedenheit der Hauptmächte unbeschönigt auf die Tagesordnung. Zum Streitpunkt macht die eine Seite – Frankreich und Deutschland mit dem aktuellen Ratsvorsitzenden aus Luxemburg als Vorkämpfer – den Beitragsnachlass für Großbritannien, durch den sie als Nettozahler sich völlig ungerechtfertigt und über Gebühr in die Pflicht genommen sehen; umgekehrt will die britische Seite auf keinen Fall mehr einen EU-Haushalt tolerieren, der zu mehr als der Hälfte für die Alimentierung des kontinentalen Nährstandes draufgeht. Den Streit führen beide Seiten kompromisslos, weil sie nicht bloß im Namen hoher Grundsätze um Finanzmittel zanken, sondern an der Geldfrage ganz im Ernst die absolute Grundsatzfrage aufwerfen: nach dem Europa, das sie haben wollen; also nach der internen Einrichtung und der weltpolitischen Ausrichtung der imperialistischen Macht, die sie durch ihre Union gewinnen wollen; also auch und vor allem nach dem Stellenwert, den die eigene Nation bei der Definition und Schaffung und Anwendung dieser neuen Weltmacht für sich beanspruchen kann. Diplomatisch verlogen und dabei doch ganz unmissverständlich machen die großen Gegenspieler ihren Anspruch auf ein von ihnen geführtes, ihnen gemäßes, für sie nützliches Europa geltend, indem einer dem andern seine parteilich hingedrehte ultimative Entscheidungsfrage aufmacht.
– Für Schröder und Chirac geht es im Streit mit Blair um den britischen Beitragsrabatt recht eigentlich um die Wahl zwischen dem „europäischen Sozialmodell“ und einem „harten Kapitalismus angelsächsischer Prägung“; und in letzter Instanz steht mit der Konkurrenz der „Modelle“ eine noch viel grundsätzlichere Entscheidung an:
„Angesichts der Krise in der EU geht es jetzt im Kern um die Frage: ‚Welches Europa wollen wir?‘ Die Alternativen liegen auf der Hand: Wollen wir ein einiges, handlungsfähiges Europa, eine wirkliche politische Union? Oder wollen wir nur eine große Freihandelszone sein, wollen wir von der Europäischen Union zurück zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG)?“ (Schröder, in: SZ, 22.6.)
Das mit dem menschenfreundlich weichherzigen kontinentaleuropäischen Sozialmodell darf man als zynischen Witz abhaken – Schröder ebenso wie sein französischer Kollege setzen ihre Macht zielstrebig dafür ein, ihre Unternehmer mit „Deregulierung“ nach angelsächsischem Vorbild zu beglücken; gegen den britischen Partner und die USA konkurrieren sie mit allen, auch mit deren ureigenen Mitteln. Verlogen ist die Unterstellung, der britischen Regierung wäre an einer handlungsfähigen politischen Union gar nicht gelegen: Strittig ist die Politik, die eine „handlungsfähige“ Union machen soll. Auf die kommt der Kanzler mit der Alternative „europäisch“ versus „angelsächsisch“ dann auch andeutungsweise, aber deutlich genug zu sprechen: Das Europa, das Deutschland und Frankreich wollen, soll sich als imperialistische Macht von der amerikanischen Weltmacht, die in Großbritannien über ihren europäischen Brückenkopf verfügt, deutlich unterscheiden, also wirksam Einspruch einlegen gegen den Anspruch der USA, die Welt nach ihrem Vorbild, d.h. nach ihren Maßstäben und Interessen zurechtzumodeln. Dafür, dass Europa in diesem Sinne nicht bloß handlungsfähig wird, sondern handelt, die Partner also einig und geschlossen an diesem Ziel mitwirken, übernehmen Berlin und Paris gerne die Verantwortung.
– Blair seinerseits macht an der Geldfrage ganz ausdrücklich die Alternative fest, ob Europa sich unter der Ägide von „Männern der Vergangenheit“ auf ein „Sozialmodell“ festlegen lassen soll, das mit seinen hohen Arbeitslosenraten seine Untauglichkeit unter Beweis gestellt hat und Unmengen von Finanzmitteln für rückständige Gewerbe verschleudert, oder ob die Union mit Wettbewerb und Innovation und Umschichtung ihrer Haushaltsgelder in Forschung, Zukunftstechnologien usw. zu einem Zentrum des globalen Fortschritts werden will. Verlogen ist auch das; das Ziel, die globale Konkurrenz mit den modernsten Mitteln und Methoden zu gewinnen, teilen sämtliche EU-Kollegen. Klar genug ist aber auch, dass Blair, wenn er sich im Sinne seines Fortschrittsideals als „leidenschaftlicher Europäer“ bekennt, den Anspruch erhebt, Europa nach britischem Muster aus seiner Krise herauszuführen – also die wirtschaftspolitische Dominanz der BRD und Frankreichs zurückzudrängen, den großen Partnern ihren Antiamerikanismus abzukaufen und dafür eine europäische Führungsrolle zu übernehmen. Zurück zu einer bloßen Freihandelszone will er so wenig, wie Juncker, Chirac und Schröder einem Industriemuseum vorstehen wollen.
Wenn die Führungsmächte der EU auf die Art um Alternativen streiten, um die es dem jeweiligen Gegner gar nicht geht, dann liegt kein dummes Missverständnis vor; und um eine Schönheitskonkurrenz der „Modelle“ geht es auch nicht. Die Macher Europas führen auf diese verquere Art schon ziemlich direkt und unverhohlen einen Machtkampf um die Richtlinienkompetenz in der neuen Supermacht, die sie brauchen und wollen, aber nur zu ihren Bedingungen tolerieren. Sie führen einen Streit, der schon recht heftig auf die letzte und eigentliche Alternative zielt: Trennung oder Unterwerfung – und gleichzeitig will doch keiner weder das eine noch das andere: weder sich unterwerfen noch den Verein auflösen. Der angesagte Grundsatzstreit wird weder beigelegt noch bis zum bitteren Ende ausgetragen. Europa bleibt in der Krise, nach allgemeiner Einschätzung der tiefsten, die es je durchgemacht hat; die verschiedenen Protagonisten bilanzieren für ihre Nation auf allen Ebenen mehr Last als Gewinn, stellen mit ihrer fundamentalen Unzufriedenheit den Fortgang und damit den Fortbestand ihres Gemeinschaftsunternehmens glatt in Frage; zugleich fürchten sie um das Projekt, das sie selber gefährden, und vermeiden, einstweilen jedenfalls, alles, was auf eine Absage hinausläuft. Ihr Gipfeltreffen bringt kein Ergebnis zustande, offenbart ihre Uneinigkeit – demnächst sieht man sich wieder und schaut weiter.
Der Widerspruch zwischen dem unbedingten Verlangen der großen EU-Nationen, miteinander zur Weltmacht zu werden, und der Weigerung, für dieses Ziel die nationale Souveränität aufzugeben, ist nicht aufzulösen. Offenbar kann er deswegen sogar seine Krise überdauern.
[1] Die Open-End-Serie unserer Zeitschrift zum Thema Europa umfasst seit Beginn des neuen Jahrhunderts bislang die folgenden Artikel: Europa 2000 (I): Zwischenbilanz eines (anti-)imperialistischen Projekts neuen Typs – Von der Währungsunion; in GegenStandpunkt 4-2000, S.143 Europa 2000 (II): Zwischenbilanz eines (anti-)imperialistischen Projekts neuen Typs – Von der Währungsunion, Fortsetzung; in GegenStandpunkt 2-01, S.171 Europa (III): Das (anti-)imperialistische Projekt neuen Typs in der Krise – Amerikas Konkurrenten zählen Geld und Waffen nach und leiden am Ergebnis; in GegenStandpunkt 4-02, S.103 Europa (IV): Die Ost-Erweiterung – Die friedliche Eroberung des europäischen Ostens durch Europas Westen: Ein neuartiger Fall von imperialistischem Abenteurertum; in GegenStandpunkt 1-03, S.87 Europa (V): Die innere Verfassung – Die Krise des europäischen Projekts und ihre Produktivkraft für den Machtkampf der EU-Nationen; in GegenStandpunkt 1-04, S.73
[2] Siehe den Artikel „Europäische Grundrechte-Charta – Ein Stück Staatsverfassung auf Vorrat“, in GegenStandpunkt 1-01, S.145