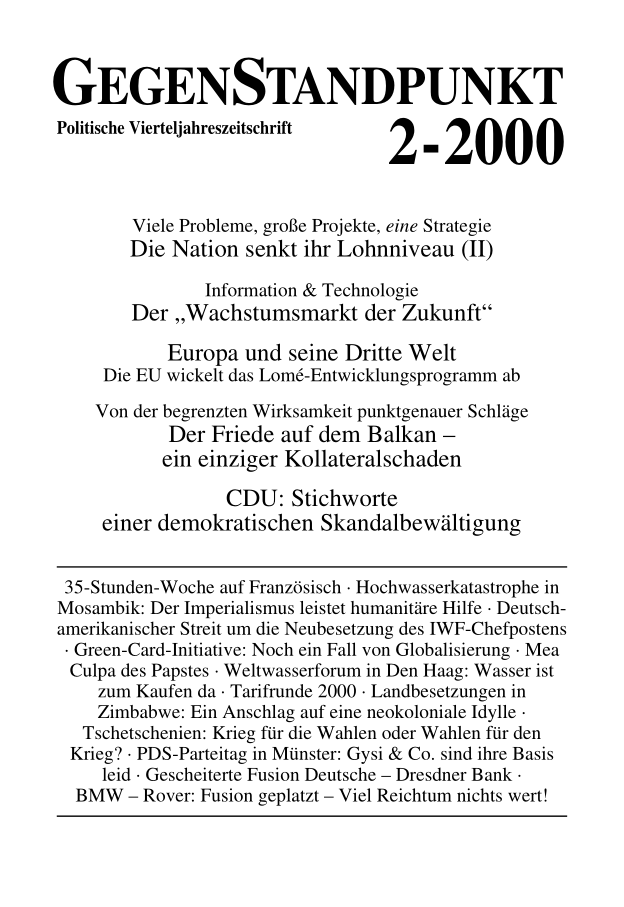„Bündnis für Arbeit“ bekämpft Arbeitslosigkeit
Sparprogramm saniert Schuldenstaat
Reformpaket sichert Finanzierbarkeit der Sozialpolitik
Wirtschaftspolitik stellt sich der „Globalisierung“
Viele Probleme, große Projekte, eine Strategie:
Die Nation senkt ihr Lohnniveau (II)
Weil er seine finanzpolitischen Stabilitätsziele erreichen und gleichzeitig seine Unternehmer von ihrer „Abgabenlast“ befreien will, ist dem rot-grün verwalteten Sozialstaat der Lebensunterhalt seiner lohnabhängigen Bürger zu teuer; er benutzt seinen Zugriff auf den national gezahlten Lohn für einen Angriff auf alle sozialen „Besitzstände“, die er aus dem politisch beschlagnahmten Lohn gewährt hat und nun für „untragbar“ erklärt. Er bewährt sich im globalisierten Wettbewerb der Standorte, der immer mehr Leute überflüssig macht, mit einem klaren „Rezept“: Die „Ansprüche“ derer, die auf seinem Standort von einem Arbeitsplatz leben müssen, müssen runter!
Aus der Zeitschrift
Teilen
Siehe auch
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Ein „Bündnis für Arbeit“ bekämpft die Arbeitslosigkeit –
Ein Sparprogramm saniert den Schuldenstaat –
Ein Reformpaket sichert die Finanzierbarkeit der Sozialpolitik –
Eine moderne Wirtschaftspolitik stellt sich der „Globalisierung“ –
Viele Probleme, große Projekte, eine Strategie:
Die Nation senkt ihr Lohnniveau (II)
Der lohnabhängige Mensch mag meinen, er lebte von seiner Arbeit; aber so ist es nicht. Den Lohn, von dem er tatsächlich leben muss, verdient er nur mit rentabler Arbeit. Der Nutzen seines Arbeitgebers entscheidet darüber, ob er überhaupt ein Geld zum Leben in die Hand bekommt – und dass das Verdiente nie recht reicht. Denn Rentabilität verträgt sich nicht mit Lohn. Dem Interesse an Rentabilität gibt der Staat Recht. Die fälligen Konsequenzen erhebt er damit zum Sachzwang. Den sieht die Gewerkschaft ein. Im „Bündnis für Arbeit“ bewältigen Politik, Unternehmer und Arbeitnehmervertreter die Folgen: Sie bringen die Unterwerfung der Arbeit unter das Rentabilitätsgebot auf den aktuell geforderten Stand.[1]
Doch dabei bleibt es nicht. Auch der Staatshaushalt, die Verwaltung des Regierungsbudgets, dreht sich um die Frage, wie viel Einkommen denen zusteht, die von einem Arbeitslohn leben müssen – worunter immer mehr Arbeitnehmer fallen, die gar nicht – mehr – arbeiten. Wenn die Regierung ihr Geld einteilt und im Parlament darüber gestritten wird, was sich die Staatsführung vornehmen soll, was es kosten darf bzw. wofür sie ihr Geld ausgibt und ob sie sich das leisten kann,[2] dann wird alle Mal über die Differenz zwischen Brutto- und Nettolohn neu entschieden, und darüber hinaus werden einige Gesetze auf den Weg gebracht, die Korrekturen an der Brauchbarkeit des Nettolohns wie des vom Brutto mitbezahlten Lohnersatzes vollziehen. Und wenn eine Sparpolitik im Programm ist, zu der es nach dem Willen der höchsten Gewalt keine Alternative gibt, dann werden Erwerbsleben und Einkommensverhältnisse in der Gesellschaft einigermaßen neu geregelt – zugunsten der Staatsfinanzen und ihrer Quellen, auf Kosten des Lebensunterhalts, den der Lohn den davon Abhängigen noch abwirft.
Und auch das ist noch nicht das letzte Machtwort über den Lohn. Die Unternehmer stehen im Wettbewerb um den Profit, der sich aus der universellen Marktwirtschaft herausholen lässt, und treiben dafür zu Lasten des Lohns die Rentabilität der Arbeit in immer neue Höhen. Die Machthaber, die für das ökonomische Wohl ihrer Macht politisch verantwortlich sind, begreifen ihren Job sachgerecht als Auftrag, ihrer Nation den größtmöglichen Nutzen aus dem kapitalistischen Weltgeschäft zu verschaffen, den unvermeidlichen Schaden auf andere Nationen abzuwälzen; und dafür setzen sie schon wieder, einigermaßen eindimensional, auf Minderung der Kosten, zu denen ihre nationale Arbeitnehmerschaft dem Kapital zur Verfügung steht. Weil sie hierbei den gesamten Rest der Staatenwelt als Konkurrenten im Visier haben und auf die Botschaft Wert legen, dass unausweichlich sein muss, was sie sich vornehmen und ihrem lohnabhängigen Volk zumuten, erklären sie ihre weltwirtschaftliche Offensive zur passenden Antwort auf eine Herausforderung, die sie Globalisierung
nennen.[3] Unter diesem Titel gehen sie gegen „Verkrustungen“ des Arbeitsmarktes und im sozialen Sicherungssystem vor, machen das Erwerbsleben in ihrer Gesellschaft „flexibel“ und „mobil“ und tragen überhaupt nach Kräften dazu bei, dass der Lohn an ihrem Standort im Verhältnis zur damit gekauften Arbeit universelle Maßstäbe setzt – was dem Lebensstandard der lohnabhängigen Arbeitskräfte endgültig schlecht bekommt.
2. Rotgrüne Sparpolitik: Auch die Finanzierbarkeit der Staatsschuld ist eine Frage der Lohnkosten
Die Regierung hat die Lage der Nation geprüft und einen kritischen Befund ermittelt: Der Staat hat so viele Schulden akkumuliert, dass die Zinspflichten den Haushalt über Gebühr strapazieren und die finanzielle Handlungsfreiheit der Politik gefährden. Zugleich hat er die Wirtschaft mit einem Übermaß an Steuern und Abgaben belastet; darunter leiden Wachstum und Beschäftigung und der Standort insgesamt, weil renditebewusste Kapitalanleger abgeschreckt statt angezogen werden. Beim Geldeinnehmen wie beim Geldausgeben hat die öffentliche Hand eine Misswirtschaft betrieben, die die staatliche Finanzmacht ebenso wie deren Quellen beschädigt.[4]
Der Kanzler und sein Finanzminister haben daher die Sanierung der Staatsfinanzen an die Spitze ihrer politischen Agenda gesetzt und eine Sparpolitik beschlossen, die dafür sorgen soll, dass die Wirtschaft stärker wächst und der Staatskredit in Ordnung kommt. Über die öffentlichen Kassen und Budgets leiten sie eine neue Bewirtschaftung ihrer heimischen Wirtschaftsmaschinerie in die Wege. Dabei wird zwar die Gleichheit aller – nämlich aller staatlichen und politisch anerkannten gesellschaftlichen Bedürfnisse, vertreten durch den jeweils zuständigen Minister mit seinem speziellen Finanzbedarf – vor dem alles überragenden Spar-Imperativ betont und hervorgehoben, alle Ressorts würden gleichermaßen, also gerecht und vor allem ohne jede „soziale Schieflage“ von Kürzungen betroffen. Klar ist aber auch, dass es mit einem pauschalen Konsumverzicht der verschiedenen Ministerien nicht getan ist.[5] Schließlich ist der Staatshaushalt kein bloßes regierungsinternes Rechenwerk. Mit ihrem Budget führt die Staatsmacht ihrer Nation buchstäblich den Haushalt: Umfassend und dauerhaft greift sie ins Erwerbsleben ihrer Gesellschaft ein, reguliert die Bedingungen, zu denen marktwirtschaftlich konkurriert und Geld verdient wird, richtet also die „Faktoren“ ihrer politischen Ökonomie: Kapital und Arbeit, so zu, dass jeder leistet und beiträgt, was er mit seinen vorhandenen oder nicht vorhandenen Mitteln vermag. Dementsprechend geht die rotgrüne Koalition bei der Neuordnung der Staatsfinanzen so differenziert vor, und ihre Sparpolitik fällt so klassenspezifisch aus, wie die diagnostizierte Problemlage es gebietet und wie es der funktionellen Verschiedenheit der politökonomischen Charaktere in der sozialen Marktwirtschaft entspricht.[6]
a)
Die Regierung verknüpft die zweieinhalb Billionen DM Schulden, die der deutsche Staat mittlerweile akkumuliert hat, sowie den Zinsdienst, der darauf zu leisten ist, mit der Frage ihrer politischen Handlungsfähigkeit. Appelliert wird an die Vorstellung, für solche Zinszahlungen gingen so viele Steuereinnahmen drauf, dass für anderes im Staatshaushalt kaum mehr Platz bleibe; der nachdrücklich bekannt gemachte Umstand, dass der Schuldendienst inzwischen den zweitgrößten Ausgabeposten im Bundesetat darstellt – hinter den Sozialausgaben, vor der Bundeswehr –, dient als Beleg. Ganz sachgerecht ist das nicht. Denn – auch daraus wird kein Geheimnis gemacht, Stichworte wie „Netto-Neuverschuldung“ sprechen das aus – bezahlt werden die Zinsen, und nicht nur die, aus neuen Schulden. Dass das schlechterdings nicht mehr gehen sollte, ist nicht recht abzusehen; viel zu gut passen die Gepflogenheit der Staatsmacht, Finanzbedarf mit Zahlungsversprechen zu decken, und das Geschäftsinteresse des Kreditgewerbes, für ein paar Prozent Zinseinkünfte diese Schulden wie Geld zu behandeln, zusammen. Erst recht ist es nicht so, dass der sozialdemokratische Finanzminister daran denken würde, diese allseits vorteilhafte Geschäftsbeziehung zum Finanzkapital aufzukündigen, bloß weil ihm die Größenverhältnisse zwischen den Ausgabepositionen seines Budgets nicht gefallen: Auf dem Kredit, den der Staat sich bei den kapitalistischen Geldanlegern nimmt, beruht schließlich die finanzpolitische Handlungsfreiheit, um die Eichel und sein Kanzler fürchten.
Dass sie ernste Sorgen haben, ist andererseits nicht zu übersehen. Schließlich haben sie sich mit ihren EU-Kollegen gemeinsam und so verbindlich, wie es in diesem Club üblich ist, auf ausgeglichene Budgets als Staatsziel festgelegt, die berühmt-berüchtigten „Maastricht-Kriterien“ für die Zulassung einer EU-Nation zur neuen europäischen Einheitswährung also noch beträchtlich radikalisiert. Dabei haben sie sich erklärtermaßen die USA zum Vorbild genommen, die sie seit längerem um die steigenden Milliarden-Summen beneiden, auf die der Budget-Minister dort seinen jährlichen Haushalts-Überschuss beziffert. Das ist ein klarer Hinweis auf das Konkurrenzproblem, das Europas Finanzpolitiker wirklich mit einem Schuldenberg haben, der ihnen immer höhere Zinszahlungen abverlangt und deswegen immer weiter wächst. Sie sehen sich einem kritisch vergleichenden Urteil der finanzkapitalistischen Geschäftswelt – „der Märkte“ – ausgesetzt, die angesichts der Überfülle wackliger Kredite, die sie selbst in die Welt gesetzt hat, umso mehr auf die Solidität staatlicher Kreditpapiere achtet und jedes Bedenken, zu dem sie sich durch das Finanzgebaren eines Staates berechtigt sieht, mit einer schlechteren Bewertung seiner Zahlungsversprechen wie auch des gesetzlichen Zahlungsmittels, auf das sie lauten, quittiert. Am praktischen Urteil des international agierenden Geldgewerbes, das die maßgeblichen Staaten selbst zur vergleichenden Bewertung ihrer Nationalkredite ermächtigt haben, entscheiden sich insoweit tatsächlich Zuwachs oder Abnahme der Finanzmacht ganzer Nationen – und darüber auch die Freiheiten einer Regierung bei der Finanzierung ihrer Politik; nicht gleich in dem Sinne, dass sie keinen Abnehmer für ihre Schuldscheine mehr fände, wohl aber in der Weise, dass sie selbst bei ihrer Geldbeschaffung immer gleich auf die Reaktion der Finanzmärkte reflektiert und sich verbindliche Grenzen für ihre Schuldenaufnahme auferlegt. Wenn die rotgrüne Regierung also mit Blick auf Gesamtschuldenstand und Zinsverpflichtungen Sorge um ihre Handlungsfähigkeit bekundet, dann meint sie dem international vergleichenden Geldgewerbe eine praktische Demonstration des Inhalts schuldig zu sein, dass sie ihre Verbindlichkeiten gut im Griff hat, auf ihre Geldmacht also Verlass ist. Sie verpflichtet sich zu einem Nachweis ihrer finanziellen Solidität, gerade um auch weiterhin problemlos mit Kredit Politik machen zu können. Für die Entscheidung, eine Bremsung und womöglich merkliche Reduzierung der Staatsschuld einzuleiten, ist das „Sachzwang“ genug.
Für den Stabilitätsbeweis, den sie damit aufs Programm setzt, stellt die Bundesregierung eine zweite Verknüpfung her, die ihrer sozialdemokratischen Führung gut zu Gesicht steht, nämlich zwischen der staatlichen Schuldenwirtschaft und dem Gebrauch, den der Staat per Steuern, Abgaben und sozialer Umverteilung vom Einkommen der „kleinen Leute“ macht. Ganz ausdrücklich wirbt der Finanzminister für die nationale Anstrengung zur Minderung der staatlichen Schuldenlast, die er sowieso verordnet, mit dem Argument, beim Zinsdienst, den er leisten müsse, handle es sich um die denkbar größte und sozial ungerechteste „Umverteilung von unten nach oben“; insofern diene der Schuldenabbau der sozialen Gerechtigkeit. In freundlicher Form wird den Leuten auf diese Weise mitgeteilt, dass sie mit ihren Abgaben an den Staat bisher schon immer für den Zinsdienst der Staatskasse hätten aufkommen müssen – was auf alle Fälle insofern stimmt, als steuerlich belastete Masseneinkommen offenkundig für Solidität der Staatsfinanzen bürgen und somit das stichhaltigste Argument für die Haltbarkeit staatlicher Schulden hergeben. Eine Gerechtigkeitslücke wird beklagt, aus der interessanterweise kein Vorwurf der ungerechtfertigten Bereicherung ans Bankkapital folgt, geschweige denn eine Beschwerde über ungerechte Einkommensverteilung im deutschen Gemeinwesen, womöglich gar zwischen Geldanlegern und Kredithaien auf der einen, werktätigen Volksgenossen auf der anderen Seite. Mit dem Großunternehmen, das Verhältnis zwischen den weniger betuchten Massen, die brav Steuern und Abgaben abliefern, und dem Finanzkapital, das Gewinne einstreicht, gerechtigkeitsmäßig in Ordnung zu bringen, wird vielmehr den angesprochenen „kleinen Leuten“ in Aussicht gestellt, dass sie, um nicht immer für Zinsen geradestehen zu müssen, umso gründlicher für eine allmähliche Schuldenreduktion, quasi für ein Stück Auszahlung der lästigen Staatsgläubiger hergenommen werden. Staatliche Ressource sind sie in dem einen wie in dem anderen Fall; die deutsche Sozialdemokratie begreift es als ihre soziale Pflicht, die Massen mit ihrem Einkommen als Ressource für ihr Stabilitätsziel in Anspruch zu nehmen.
Wie das geschehen soll, das wird in ebenso allgemeiner wie grundsätzlicher Weise angekündigt. Mit Verweis auf ihr Verschuldungsproblem wirft die Regierung die Frage der Finanzierbarkeit ihrer Ausgaben auf. Das tut sie freilich nicht pauschal und undifferenziert[7] und schon gar nicht im Hinblick auf die fälligen Zinsen, von denen man ja, wie gesagt, immerhin weiß, dass sie den zweitgrößten Ausgabenblock im Bundeshaushalt ausmachen. Sie hält sich vielmehr exakt an die Mehrheit, der gerade eröffnet worden ist, dass sie sowieso schon immer für die Schulden ihrer Obrigkeit haftet: Die Feststellung, dass „es“ angesichts der desolaten Finanzlage der öffentlichen Hand „so nicht mehr weitergeht“, zielt klar auf „Wohltaten“, die der Staat sich bislang nur wegen einer bestehenden Gesetzeslage, also quasi „aus alter Gewohnheit“, bei der Betreuung der kopfstarken ärmeren Schichten seiner Gesellschaft geleistet haben will. Warum „es“ gerade die treffen muss, die Nutznießer der Sozialhaushalte, dafür gibt es so viele gute Gründe wie Betroffene: Die Lebenserwartung steigt – und das ist in dieser besten aller Welten kein Glück für die Menschen, sondern ein Unglück für die Rentenkasse. Dass die Leute älter werden, hat seinen Grund unter anderem im medizinischen Fortschritt – im System der marktwirtschaftlichen Krankenversorgung ist dieser Fortschritt aber vor allem teuer, zumal wenn dann eben immer mehr Leute, alte wie junge, die Verschleißerscheinungen ihres Arbeitslebens immer länger aushalten. Zugleich wird dank der Segnungen des technischen Fortschritts im Arbeitsleben die „Beschäftigungs-Biographie“ des durchschnittlichen Arbeitnehmers immer löchriger; das kostet nicht bloß Arbeitslosengeld, sondern schmälert zugleich die Finanzbasis für Renten- und Krankenkassen. Und das alles ist noch einmal extra problematisch, weil den großen nationalen Sozialkassen seit einem Jahrzehnt auch noch die zu Demokratie und D-Mark befreiten Ex-DDR-Bürger mehr als Opfer des neu eingeführten kapitalistischen Arbeitsmarktes zur Last fallen, als dass sie tüchtig Beitrag zahlen würden. Und weil aus Gründen, die im folgenden Punkt b) unter dem Stichwort „Lohnnebenkosten“ noch ausführlich zu würdigen sind, die Bewältigung all dieser schicksalhaften Probleme auf dem bislang begangenen Weg der Beitragserhöhung ausscheidet, muss der steigende Bedarf an sozialstaatlichen Hilfsmaßnahmen mit deren vorsorglicher Reduzierung und Streichung beantwortet werden.
In ihrem Drang, diese Notwendigkeit möglichst plausibel und überzeugend darzutun und die fälligen Maßnahmen als Akt der reinen Menschenfreundlichkeit und sozialen Gerechtigkeit zu rechtfertigen, greifen die zuständigen Sozialreformer seit einiger Zeit zu einem verwegenen Mittel: Sie konfrontieren ihr Publikum mit einem Stück Wahrheit über die großartigen Sozialleistungen, auf die das „Modell Deutschland“ immer so stolz sein durfte. Als hätten sie nie etwas anderes behauptet – und als würden sie nicht zwischendurch immer wieder nach Bedarf auch auf die alten Lügen über ihr unverwüstliches „System der sozialen Sicherheit“ zurückgreifen –, dementieren sie glatt ihren eigenen Schwindel, der Sozialstaat würde seiner Klientel Wohltaten spendieren, und bekennen offensiv, dass letztlich doch bloß der ärmere Teil der Gesellschaft die an ihn ausgegebenen sozialen Zuwendungen selbst bezahlt und sich dadurch im Endeffekt überhaupt nicht besser stellt. Geradezu polemisch berufen sie sich auf die Schäbigkeit und Gemeinheit ihres eigenen Konstrukts: eines sozialstaatlichen „Wohlfahrts“-Wesens, das niemanden gut fahren lässt, sondern bloß unter denen, die sonst ganz aus dem gesellschaftlichen Lebensprozess herausfallen würden, deren eigene knappe Mittel so umverteilt, dass sie für alle dann doch wieder vorn und hinten nicht reichen. Mit solcher Ehrlichkeit untermauern die Herren des Staatshaushalts ihre neue sozialpolitische Linie, verschärften Mangel restriktiver umzuverteilen; in der Weise nämlich, dass sie den Betroffenen eindringlich – und genau so verlogen wie zuvor – vor Augen stellen, dass ihnen mit einer Auffüllung der „leeren Kassen“ aus ihren eigenen Taschen doch auch nicht gedient wäre; so als läge es völlig außerhalb der Reichweite staatlicher Sozialpolitik, „Kassen“ zu füllen, sobald das nur für hinreichend notwendig erachtet würde, und dafür womöglich sogar andere Quellen anzuzapfen als den Gelderwerb der potentiell oder schon wirklich Bedürftigen selber. Das wäre freilich in der Tat ganz systemwidrig: Wenn es darum ginge, die Not, die das wundervolle System der Marktwirtschaft beständig schafft, mit anderen Mitteln als denen der Armut zu behandeln, bräuchte es sie ja gar nicht erst zu geben. Deswegen wird so ein Verstoß gegen die politökonomische Ordnung auch gar nicht erst „angedacht“. Es bleibt vielmehr dabei: Die minder Bemittelten der Marktwirtschaft erhalten vermittels öffentlicher Sozialpolitik alle Mal immer bloß sich selbst – und das schaffen sie in Zukunft in Folge immer minderer Bemittelung keinesfalls mehr auf dem bisherigen Niveau. Die Botschaft, die die Regierung mit diesem schönen Eingeständnis ‚rüberbringen‘ will, ist dann allerdings wieder um einen entscheidenden Punkt kürzer. Sie lautet: Die Kassen sind leer. Und das soll so verstanden werden, dass eben die gesamte soziale Seite des gesellschaftlichen Haushalts, die der tief verschuldete Staat so fürsorglich betreut, schlechterdings unfinanzierbar geworden sei. Mit diesem Generalurteil stellen die rotgrünen Reformer die dritte Verknüpfung her, auf die es ihnen in ihrer Sparpolitik ankommt, nämlich zwischen dem unerträglichen Schuldenstand der Nation und den zunehmend klammen Finanzen der Sozialkassen.
So richtig korrekt ist das nicht. Die Summen, die der deutsche Sozialstaat in seinen diversen Budgets umherschiebt, haben zu dem Schuldenproblem, dessen Bewältigung die rotgrüne Regierung auf die Tagesordnung gesetzt hat, gewiss nichts beigesteuert. Tatsächlich haben sie vielmehr der Vorgängerregierung weitere zwei- bis dreistellige Milliarden-Schulden erspart, weil sie sich ganz locker als Finanzierungsinstrument für die sozialen Unkosten der Angliederung der DDR an den bundesdeutschen Kapitalismus einsetzen ließen; die gleichen guten Dienste tun sie der neuen Regierung weiterhin. So stehen die nationalen Sozialhaushalte allerdings durchaus in einer engen Beziehung zu der Frage finanzpolitischer Stabilität, der die Schröder-Mannschaft sich so tapfer stellt: Ihre Belastbarkeit war kein schlechtes Argument für ein gesundes öffentliches Geld- und Kreditwesen. Die ist mittlerweile aber heftig strapaziert worden und einigermaßen angegriffen. Was bequeme Finanzquelle war, ist laufend von Defiziten bedroht, zu deren Begleichung der Staat sich in besseren Zeiten verpflichtet hat, als es noch Überschüsse gab. Dass der Staat den Lohn, von dem die Massen in seiner Marktwirtschaft leben müssen und nicht recht können, seiner Verfügungsmacht unterstellt hat, bloß um daraus zu finanzieren, was er für sozialpolitisch geboten hält, und dass er sich zu den entsprechenden Ausgaben auch noch gesetzlich verpflichtet hat: das erweist sich nun glatt als Behinderung seiner finanziellen Handlungsfreiheit statt als Beitrag zu ihr, wie es doch gedacht und jedenfalls jahrzehntelang der Fall war. So folgt aus dem Verschuldungsproblem des Staates ganz klar und eindeutig, dass alles „auf den Prüfstand“ muss, was zur „Versorgung“ der Lohnabhängigen je beschlossen worden ist.
Was die rotgrünen Sozialreformer sich einfallen lassen, um den betreuungsbedürftigen Großteil ihres Volkes mit seinem sozialpolitisch organisierten Lebensunterhalt für die Sanierung ihres Schuldenstands in Haftung zu nehmen, wird in Punkt c) noch hinreichend gewürdigt. Zur Kenntnis nehmen sollte man erst einmal das konstruktive Dreiecks-Verhältnis zwischen Staatsgewalt, Finanzkapital und Lohn, das die Regierung mit ihren über jeden Zweifel erhabenen, weil praktisch unanfechtbaren sachzwanghaften Verknüpfungen aufmacht: Sie hat ein Problem mit ihrem Schuldenstand, nämlich, genauer gesagt, mit der Quelle der Finanzmittel, denen sie ihre Handlungsfreiheit verdankt, dem international spekulierenden Finanzkapital, weil umgekehrt dieser Geschäftszweig mit seiner vergleichenden Gewichtung und Bewertung staatlicher Schulden und Kreditgelder praktisch als Prüfungsinstanz für staatliches Finanzgebaren fungiert, auf Finanzprobleme kritisch reagiert und mit Beweisen stabiler staatlicher Finanzmacht bedient sein will; einen solchen liefert die Macht in Berlin, indem sie dem Lebensunterhalt der Lohnabhängigen zu Leibe rückt, soweit der aus staatlich eingesammelten Lohngeldern bestritten wird, und – das beeindruckt „die Märkte“ immer am meisten – bis weit in die Zukunft hinein gesetzlich zugesagte Geldabflüsse aus dem Fundus stoppt, den der Staat sich mit seinem Zugriff auf die Masseneinkommen, die ohne gesetzliche Umverteilung gar nicht zum Lebensunterhalt taugen, zulegt. Ganz nebenbei söhnt Schröder so Geldspekulanten und „kleinen Mann“ miteinander aus und stellt klar, wie die Sozialdemokratie heute soziale Gerechtigkeit zwischen Finanzkapital und Arbeiterklasse buchstabiert.
b)
Den Zugriff des Sozialstaats auf den national gezahlten Lohn bringt die rotgrüne Regierung noch ganz anders ins Spiel, sobald sie sich dem zweiten großen Projekt ihrer Sparpolitik zuwendet: der Minderung der Abgabenlast, die die Staatsgewalt ihrer Wirtschaft aufgebürdet hat und nun nicht länger zumuten kann. Dem Kanzler und seiner Koalition ist es damit genau so ernst wie mit dem Bremsen der Schuldenmacherei, und zwar letztlich aus dem gleichen Grund: Nach ihren anspruchsvollen Maßstäben wird in Deutschland von einheimischen wie ausländischen Kapitalanlegern zu wenig investiert; als Kapitalstandort hält das Land keinen absoluten Spitzenplatz; es gibt noch Konkurrenten auf der Welt, die besser abschneiden. Die Ursachen für diesen Missstand lassen sich die politisch Verantwortlichen von den ökonomisch Zuständigen erklären: Der Staat nimmt ihnen zu viel weg von ihrem Ertrag. Und zwar zuerst und vor allem mit seinem direkten steuerlichen Zugriff auf die Früchte kapitalistischer Geschäftstätigkeit im Land; da gibt es noch sehr viel wegzureformieren. Der Finanzminister sieht das ein und plant Erleichterungen in einem Ausmaß, dass die christliche Opposition schon auf längst vergessene Traditionen der katholischen Soziallehre zurückgreifen muss, um ihrem Oppositionsberuf gerecht zu werden, und eine ungerechte Bevorzugung des Großkapitals bejammert, während die Liberalen radikal werden und sich in der lächerlichen Pose des pseudo-anarchistischen Freiheitskämpfers gegen den Moloch Steuerstaat gefallen.
Mit der Absenkung des Spitzensteuersatzes, Steuerbefreiung von Firmenverkäufen und dergleichen ist es aber nicht getan. Fast ebenso nachdrücklich wie über ihre direkte steuerliche Enteignung beschweren sich die in der Nation tätigen Kapitalisten über die Last, die sie als Arbeitgeber zu tragen hätten; in Gestalt des „zweiten Lohns“ nämlich, den ihre Gehaltsbuchhaltungen immer gleich an den Staat und dessen gesetzliche Kassen zu überweisen haben und der den „eigentlichen“ Preis der Arbeit nahezu verdoppelt. Nun spricht in der Sache einiges dafür, dass diese Last genau genommen weniger die Bruttolohnzahler als die Nettolohnempfänger trifft. Die Unternehmer zahlen insgesamt nur so viel Lohn, wie sich an Aufwand für Arbeit für sie lohnt – die Arbeitslosen, deren Zahl immer nicht recht sinken will, die Arbeitnehmer mit ihrer zunehmend löchrigen Erwerbs-Biographie, die auf flexiblen Arbeitseinsatz, jederzeitige Verfügbarkeit und Hochleistung festgelegten Beschäftigten, die zeitweilig und dann in großer Zahl vorzeitig verschlissenen Arbeitskräfte sind der lebende Beweis dafür, dass wirklich nur lohnende Leistung entlohnt wird. Was zur Erhaltung all derer nötig ist, die aus diesem Lohn-Leistungs-Verhältnis herausfallen, wird von der gezahlten Summe abgezweigt; nach gesetzlicher Vorschrift, weil ohne Zwang kaum eine bezahlte Arbeitskraft von ihrem Verdienten das Nötige erübrigen kann. Die jeweils benutzten Arbeitnehmer der Nation haben sich mit ihren nicht gebrauchten oder ausgemusterten Kollegen in das Geld zu teilen, das die Arbeitgeber der Nation für ihre Benutzung zu zahlen bereit sind; das Teilen und Einteilen regelt die Staatsgewalt. Insofern handelt es sich bei den Abgaben an den Sozialstaat nicht um einen „zweiten“, sondern um Abzüge von dem ersten und einzigen Lohn, den die Lohnabhängigen für ihre Arbeit kriegen und der gedehnt und gestreckt und umverteilt werden muss, um absehbare Notlagen zu überbrücken – und der für die jeweils „aktiv“ Beschäftigten dann logischerweise einen umso mangelhafteren Lebensunterhalt abwirft. Weil das so ist, kommen diejenigen Lohnabhängigen, die gerade in Arbeit sind, sogar in den Genuss öffentlicher Anteilnahme: Die gesamte politische Klasse bedauert sie als Leidtragende der überlieferten Sozialpolitik – als Opfer freilich nicht des Systems rentabler Lohnarbeit, sondern des verrenteten, kranken, invaliden, arbeitslosen Teils der sozialversicherten Arbeitnehmerschaft; also von ihresgleichen in einer anderen Phase ihres gesellschaftsüblichen Erwerbslebens. So werden die braven abhängig Erwerbstätigen einmal mehr als die Ressource angesprochen, aus der der Staat seine Umverteilungspolitik bestreitet, und auf Nutznießer hingewiesen, die sich an ihren Lohnabzügen in nicht mehr gerechtem Umfang bedienen. Das ist nicht ungeschickt. Denn damit stehen einerseits für alle Mängel des Nettolohns Schuldige fest, die überdies den Vorzug haben, dass sie nicht tabu sind wie das Finanzkapital mit seinen Zinsansprüchen, sondern mit ihrem Lebensunterhalt direkt haftbar zu machen sind für mehr soziale Gerechtigkeit. Das versprechen die regierenden Sparpolitiker auch – und kündigen damit andererseits ganz unmissverständlich an, dass dieselbe Klientel, die dem Staat als Fundus für seine Sozialpolitik dient, in ihrer anderen Eigenschaft, als Unterstützungsempfänger, für die fällige Korrektur dieser Politik in Anspruch genommen wird. Denn eins steht fest, wenn die Arbeitnehmer wegen zu hoher Sozialabgaben bedauert werden und Abhilfe zu Lasten der mitversorgten Sozialfälle versprochen wird: Über den Bruttolohn, also eine Erhöhung der Summe, in die arbeitende wie nicht arbeitende Lohnabhängige sich teilen müssen und die ihnen dementsprechend eingeteilt wird von ihrer sozial denkenden Obrigkeit, ist der Mangel auf gar keinen Fall zu beheben.
Im Gegenteil. Wenn Arbeitgeber sich darüber beschweren, dass sie im Grunde nicht einen Lohn, sondern deren zwei zu zahlen hätten, dann geht es ihnen jedenfalls nicht um Verschiebungen innerhalb der gezahlten Gesamtsumme, sondern klar und eindeutig um deren Verringerung. Für sie handelt es sich bei dem Teil ihrer Lohnkosten, der an öffentliche Haushalte fließt – ganz gleich, ob er auf der Gehaltsabrechnung als Abzug vom Brutto-Entgelt oder als Arbeitgeberanteil an den Sozialversicherungsbeiträgen ausgewiesen ist –, um Lohnnebenkosten: einen Zuschlag, um den der Gesetzgeber die Arbeit verteuert, nämlich teurer macht, als sie sein müsste, wenn wirklich nur die aktuell geleistete Arbeit bezahlt würde und nicht noch der ganze Haufen von Alten, Invaliden, Ausgemusterten und das Gesundheitswesen obendrein. Diese Sichtweise entspringt ihrem Interesse; und deswegen meinen sie es so ernst damit, dass sie sich zwecks Verringerung ihres Lohnaufwands tatsächlich nicht bloß an die Gewerkschaften halten, mit denen sie die Löhne und Gehälter aushandeln. Genau so fordernd, wie sie denen gegenüber in den Tarifrunden auftreten, wenden sie sich in der Frage des „zweiten Lohns“ an den Staat als die Institution, die mit den sozialpolitischen Verfügungen, die sie über die national gezahlte Lohnsumme trifft, in Wahrheit für die Höhe der zu zahlenden Arbeitskosten insgesamt mitverantwortlich sei. Und mit diesem Standpunkt bleiben sie nicht allein. Ihr Tarifpartner besteht gleichfalls nicht darauf, dass das Aushandeln der Löhne seine Sache wäre. Dass es doch ein und dieselbe lohnabhängige Mannschaft ist, die für tarifliche Löhne arbeiten geht und in den unvermeidlichen „inaktiven“ Phasen ihres Arbeitslebens von den Lohnbestandteilen leben muss, die laut Gesetz in die Sozialkassen abzuführen sind; dass es sich also bei den Lohnnebenkosten um ein unentbehrliches Stück des nationalen Gesamt-Arbeitsentgelts handelt, das sie den Arbeitgebern abringen müssten: das kommt den Gewerkschaften tatsächlich nicht in den Sinn. Sie selber entdecken in den Sozialabgaben eine Belastung durch den Staat, und zwar nicht der Nettolöhner, sondern des „Faktors Arbeit“, der dessen vermehrte Anwendung auch durch gutwillige Arbeitgeber be- oder sogar verhindere; sie beklagen eine sozialpolitisch verursachte Lohnkost, die an der Arbeitslosigkeit mit schuld sei und deswegen besser durch eine Art Maschinensteuer ersetzt werden sollte – Letzteres ist dann allerdings schon ein für deutsche Gewerkschaftsverhältnisse ziemlich gewagter „linksradikaler“ Einfall und hat keine Chance, weil damit ja schon wieder eine Belastung des Kapitals programmiert wäre. Die Problemlage ist jedenfalls klar; und auf der Basis wird die Regierung sich mit der Wirtschaft und der nationalen Arbeitnehmervertretung vollständig einig. Wenn die Unternehmer über Lohnnebenkosten klagen und Gewerkschafter zustimmend mitjammern, dann verweist kein Sozialpolitiker sie auf ihre hochheilige Tarifautonomie zurück. Jeder gibt ihnen Recht und erkennt an, dass der Staat, indem er den gezahlten Lohn mit Beschlag belegt, aufteilt und einen erklecklichen Anteil einer Verwendung als Lohnersatz für aussortierte Arbeitnehmer und als kollektives Kaufmittel für das sonst unbezahlbare Gut Gesundheit zuführt, in Wahrheit einen zusätzlichen „zweiten Lohn“ von den Arbeitgebern verlangt. Und wenn die Tarifpartner diesem Kostenfaktor lauter schädliche Rückwirkungen auf Wachstum und Beschäftigung zur Last legen, dann übernehmen die Verantwortlichen die Verantwortung – und fällen damit über den Sozialstaat in seiner überkommenen Form ein denkbar radikales Urteil.
Es stellt sich nämlich heraus, und so will die rotgrüne Reformregierung auch durchaus verstanden sein, dass das System der sozialen Umverteilung nicht bloß irgendwie zu teuer, sondern absolut kontraproduktiv ist: Indem es die Arbeit verteuert, raubt es den Arbeitnehmern die Chance, Arbeit zu finden und einen Lohn zu verdienen, mindert also die Gesamtsumme, von der dann doch wieder alle Arbeitnehmer irgendwie leben müssen. Allgemeiner gefasst: Indem er die Möglichkeit schafft, dass entsprechend bedürftige Arbeitnehmer auch ohne Arbeit vom verdienten Lohn leben, erzeugt der Sozialstaat nach regierungsamtlicher Feststellung den Mangel, den er kompensieren will, und macht es erst unmöglich, vom verdienten Lohn zu leben. Mit dem nötigen Zynismus, über den Sozialpolitiker alle Mal von Berufs wegen verfügen müssen, lässt sich das sogar jedem betroffenen Arbeitnehmer vorrechnen: Die Pflichtbeiträge zur Rentenkasse verunmöglichen privates Sparen – wo man doch am Reichtum reicher Rentiers studieren kann, wie gut man mit privaten Rentenfonds und Lebensversicherungen durchs Alter kommt. Die gesetzlichen Krankenkassen machen Gesundheit erst unerschwinglich, weil sie systematisch Überversorgung organisieren, statt die Vermeidung von Behandlungskosten zu belohnen. Und bei den Arbeitslosen ist es gleich klar: Die Unterstützung, die sie bekommen, hindert sie daran, sich für das Geld, von dem sie leben, wieder nützlich zu machen. Die Sozialpolitik ruft sich gewissermaßen zur Ordnung, die im Kapitalismus noch alle Mal so aussieht, dass Lohnarbeiter von dem Preis leben, der für ihre Arbeit gezahlt wird, und ein für alle Mal nicht von den Umverteilungsmanövern, mit denen der Sozialstaat das Elend derer managt, die keine Arbeit – mehr – leisten können oder finden. Im Sinne dieses Grundsatzes erklärt die Regierung den Lohn, soweit sie darüber sozialpolitisch verfügt, also den Lebensunterhalt, den sie damit organisiert, zum sozialen Schaden – und hat damit einen zweiten und noch gewichtigeren Grund, ihren Kassen Ausgaben zu ersparen, die sich unter dem Gesichtspunkt der zu bekämpfenden Staatsverschuldung ohnehin schon als unfinanzierbar herausgestellt haben: Was nicht mehr geht, soll und darf auch gar nicht mehr sein. Im Dienst an den öffentlichen Finanzen, an den Arbeitsplätze schaffenden – und abschaffenden – Kapitalanlegern sowie an der betreungsbedürftigen nationalen Arbeitnehmerschaft bekennt sich die Regierung zu der sozialen Aufgabe, die die Staatsgewalt mit der Verstaatlichung des Lohns übernommen hat, und nutzt ihre Verfügungsmacht über den Lebensunterhalt der abhängig Beschäftigten, um das Grundnahrungsmittel ihrer Gesellschaft, die kapitalistische Ausnutzung des Faktors Arbeit, zu mehren.
c)
Die Weichen für eine Sparpolitik neuen Typs sind damit gestellt: Die Haushaltsführer der Nation begreifen den politisch beschlagnahmten Lohn als Hindernis für ordentliche Staatsfinanzen und Wirtschaftswachstum, und dementsprechend nehmen sie ihn als ihre finanzpolitische Manövriermasse in Anspruch. Die Sozialkassen, die Steuern und der öffentliche Dienst, in dem die Staatsgewalt selber als Arbeitgeber fungiert: das sind die Felder, auf denen sie in diesem Sinne tätig wird.
(1) Das herkömmliche Sozialversicherungswesen ist nicht bloß am Ende; es ist zu einem sozioökonomischen Schadensfall entartet. Eine „Revolution“ tut Not, um zu retten, was daran einstweilen noch unentbehrlich oder allenfalls wieder brauchbar ist. Die sieht dann zwar in der Praxis doch nie so umstürzlerisch aus, wie die Absage an das System der mit Zwangsbeiträgen finanzierten öffentlichen Kassen es eigentlich fordert; schon deswegen nicht, weil der Staat sich so umfassend ins Erwerbsleben und in den Lebensunterhalt seiner Klassengesellschaft eingemischt hat – wie sehr, das wird gerade an der Kompliziertheit seiner Reformen deutlich –, dass jeder Eingriff an einer Stelle lauter wohl zu beachtende Konsequenzen an anderen Positionen des nationalen Gesamthaushalts nach sich zieht und alles in Rechtsform gegossen ist. Gerade deswegen hat die polemische Generalabsage aber ihr Gutes: Sie gibt für alle nötigen Einzelschritte die eindeutige Zielrichtung vor und damit zugleich auch die Maßstäbe für eine kompetente kritische Meinungsbildung. Denn sie stellt klar, dass die tatsächlich vorgenommenen Eingriffe ins bestehende Sozialsystem nicht nach den Zumutungen beurteilt gehören, die sie für die Betroffenen mit sich bringen – geschweige denn, a propos „Revolution“, nach den wirklichen Sachzwängen sozialer Verelendung im System der Lohnarbeit –, sondern danach, was sie dem propagierten und eingesehenen Ideal einer vollständigen Abschaffung des „Krebsübels“ der Lohnnebenkosten noch schuldig bleiben.
Als erste Notmaßnahme ist jedenfalls eine sofortige Totalbremsung aller Ausgabenzuwächse nötig: ein „Deckel“ auf die Unkosten des Gesundheitswesens, ein an der vergangenen Episode stabiler Preise ausgerichteter „Inflationsausgleich“ als Marge für die fällige Renten-„Anpassung“. Gleich anschließend geht es dann um eine gründliche Reorganisation der Mittelbeschaffung wie insbesondere ihrer Verwendung durch die Sozialkassen. Konzepte sind in Arbeit, erste Maßnahmen bereits verwirklicht. So hat die Regierung z.B. diverse Leistungen im Rahmen der „originären“, also nicht durch eigene Beiträge „verdienten“ Arbeitslosenhilfe für Berufsanfänger und andere Gruppen gestrichen und ihrem Haushalt im engeren Sinn entsprechende Zahlungen an die Sozialkassen erlassen – 6 Milliarden pro Haushaltsjahr waren da schnell beieinander. Umgekehrt hat sie gewisse Zahlungsverpflichtungen des Sozialministers gegenüber der gesetzlichen Rentenkasse anerkannt und sich dafür gleich eine neue Einnahmequelle erschlossen, die nicht den Bedenken gegen eine standortschädliche Belastung der Arbeitgeber unterliegt: Bei der neuen Verbrauchssteuer auf Energie bleibt die Bruttolohnsumme tabu; und auch für das, was produzierende Firmen abzuführen haben, steht „der Verbraucher“ gerade. Das ist enorm gerecht, weil auf diese Weise alle, auch Beamte, Freiberufler und – man denke! – Abgeordnete für die Unkosten aufkommen, die daraus entstehen, dass die Rentenversicherung in ein paar Punkten nicht mehr aus ihrem Beitragsaufkommen für politisch einstweilen noch erwünschte Maßnahmen bei der Altersarmutsverwaltung einstehen muss. Sogar die Rentner und die Betroffenen selbst dürfen ihr Scherflein beitragen – ein schöner Akt der Generationen-Solidarität. Und zugleich ein erster Musterfall für den wegweisenden Einfall, die aus dem Bruttolohn nicht mehr finanzierbaren Sozialkassen durch verbesserten Zugriff auf die Nettolöhne zu retten, die sich sowieso ein jeder Arbeitnehmer sorgfältig einteilen muss.
Zwecks nachhaltiger Sanierung der drei großen Sozialversicherungen, die unter einer überalternden Gesellschaft, unerschwinglichen Heilverfahren und lockeren „Patchwork-Biographien“ als proletarischem Normalfall leiden, werden im Übrigen erst einmal die „Versorgungs“-Standards gesenkt. Bei den Renten geht es in Richtung auf zwei knappe Drittel des letzten Nettoentgelts als finale Quittung für ein erfülltes Arbeitsleben, wie es in Zukunft kaum noch jemand vorzuweisen hat. Bei den Arbeitslosen muss gut die Hälfte des zuletzt Verdienten reichen; auch das gibt es nur zu verschärften Bedingungen und für kürzere Fristen; dafür haben die Arbeitsämter jetzt eine Internet-Adresse. Das Rezept für die gesetzlich versicherten Kranken ist eine Billigbehandlung, die natürlich kein Verantwortlicher so nennt, aber jeder meint, wenn er beteuert, „das Notwendige“ werde weiterhin verordnet, „selbstverständlich“. Dass sie mit diesen Maßnahmen mehr Altersarmut, beschleunigte Verelendungskarrieren und einiges an gesundheitlicher Verwahrlosung ihres Volkes programmieren, ist den rotgrünen Sozialpolitikern völlig klar. Deswegen bemühen sie sich im zweiten Teil ihres Reformwerks um Konzepte, die das angezettelte Elend wieder eingrenzen sollen. Dabei knüpfen sie frei, aber folgerichtig an ihren Generaleinfall an, aus den Nettoeinkommen bezahlen zu lassen, was die Bruttolohnsumme auf keinen Fall mehr hergibt: Wem der ausgedünnte Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen nicht genügt, dem steht es – wie bisher – frei, sich die Extras privat zu kaufen oder auf eigene Kosten speziell zu versichern; das wiederum schafft Freiraum für die weitere Absenkung des Leistungsangebots, für die die Konkurrenz der Kassen um die niedrigsten Beiträge ohnehin sorgen wird. Dem Rentenelend, das nun wirklich unüberhörbar von allen Fachleuten in Aussicht gestellt wird, sollte jeder Arbeitnehmer eigentlich schon längst mit einer privaten Zusatzversicherung vorbeugen. Weil das nicht jeder tut und am Ende die Sozialhilfe der Kommunen überfordert werden könnte, erwägt das verantwortliche Ministerium den Aufbau einer privaten Haftpflichtversicherung gegen Altersarmut für alle einschlägig gefährdeten Personen. Nebenbei hätte eine solche Versicherungspflicht den Vorteil, den als Bezugsgröße für die Berechnung der gesetzlichen Rente veranschlagten Nettolohn zu senken und auf diesem Weg auch die aktuellen Ruheständler an der allgemeinen Abwärtsentwicklung der Einkommen aus unselbständiger Arbeit gerecht teilhaben zu lassen. Denn das ist ja die Kehrseite aller dieser vorbeugenden Maßnahmen gegen vermehrte soziale Not: Wer das Glück eines Arbeitsplatzes genießt und dort einen Lohn verdient, muss ein Mehrfaches dessen, was davon nicht als zusätzlicher Kassenbeitrag einbehalten wird, privat wegzahlen. Aber was sollte bei sozialstaatlichen Vorkehrungen gegen mehr Armut auch anderes herauskommen als – mehr Armut, anders verteilt. Was schließlich die Arbeitslosen betrifft, so ist die beschleunigte Verelendung selber schon das optimale Reformkonzept: Sie baut Hemmungen für die Wiederaufnahme von Arbeit, auch zu schlechteren Bedingungen, zuverlässig ab. Umgekehrt ist das auch der einzig Erfolg versprechende Weg, um dem Schicksal der Arbeitslosigkeit vorzubeugen: rechtzeitig billiger werden, „Bündnisse für Arbeit“ nach dem Muster „nachhaltiger Lohnverzicht gegen einstweilige Nicht-Entlassung“ anstreben; kurz: mit Arbeit nur ein bisschen ärmer werden statt ohne Arbeit gleich ganz beträchtlich …
(2) Von der Lohnsteuer hat noch nie ein seriöser Politiker behauptet, sie sei schlechterdings nicht länger „finanzierbar“, und mit ihr ginge es auf keinen Fall mehr so weiter wie bisher, wenn Deutschland ein guter „Standort“ bleiben bzw. wieder ein noch besserer werden will. Sie wird auch nicht zu den eigentlichen Lohnnebenkosten gezählt oder jedenfalls nicht zu dem „zweiten Lohn“, der die Arbeit so unerschwinglich teuer macht, dass Kapitalisten die Flucht ergreifen und die Arbeitslosen ihrem Schicksal überlassen müssen. Es wird also wohl unterschieden zwischen dem Teil der Lohnsumme, den der Staat sich bedingungslos aneignet und der in Ordnung geht, weil dem Arbeitnehmer damit die Ehre widerfährt, als Mäzen seiner Obrigkeit auftreten zu dürfen – auch wenn im Unterschied zu seinen reicheren Mitbürgern nichts seiner Steuerehrlichkeit überlassen bleibt, sondern gleich an der Quelle zugegriffen wird: nichts berechtigt so sehr zu dem Wahn, der Untertan wäre der Auftraggeber seiner Obrigkeit, wie die Rolle des Steuerzahlers! –, und jenem anderen Bestandteil der Differenz zwischen Brutto- und Netto-Entgelt, dessen Zweckbestimmung erst einmal bloß in der Subsistenz der von sich aus subsistenzunfähigen Abteilungen der Arbeitnehmerschaft liegt und der gar nicht in Ordnung geht, weil er bloß den Preis der Arbeit in die Höhe treibt und letztlich den gedachten Nutznießern selber schadet. Der weggesteuerte Lohnteil ist die wichtigste Quelle staatlicher Handlungsfreiheit und daher nicht zu kritisieren. Nachgeordneten Bedenken unterliegt er aber doch.
Die beziehen sich auf eine beabsichtigte Nebenwirkung des sinnreichen Arrangements, das die Bemessungsgrenzen fürs steuerfreie Existenzminimum sowie für die Progression des Steuersatzes in absoluten Zahlen festlegt. Ganz automatisch zeigt so die Steuerlast am unteren Ende der Einkommenspyramide im Maße der allmählichen Geldentwertung, mit der nach wie vor sicher gerechnet wird, und der entsprechenden Lohnanpassung, mit der der Fiskus einstweilen auch noch kalkuliert, immerzu steigende Tendenz. Solange ein relativer Steuernachlass auf Niedrigeinkommen überhaupt noch gewollt wird, muss daher von Zeit zu Zeit eine Revision der Maßzahlen her, die sich dann immer sehr schön als Steuergeschenk der amtierenden Regierung an die Allgemeinheit deklarieren lässt. Eine solche Reform tut erst recht not, wenn die Regierung – wie im „Bündnis für Arbeit“ beschlossen – praktisch daran geht, im Interesse des menschlichen Bodensatzes im großen Arbeitslosenheer der Nation einen breiten Niedriglohnsektor zu organisieren, der die öffentlichen Hände mal wirklich substanziell von Sozialhilfe entlastet. Insoweit räumt die Regierung dem Gesichtspunkt der zu vermeidenden Lohnnebenkosten dann doch auch in Bezug auf die Lohnsteuer eine gewisse Berechtigung ein und nimmt eine Absenkung ihres Zugriffs, sogar in mehreren Stufen, in ihre Steuerreform zur Belebung des Wirtschaftsstandorts auf. In dem Dreiecksverhältnis zwischen der Regierung und den Tarifparteien gibt diese Maßnahme gute, nämlich von den Gewerkschaften als stichhaltig anerkannte Argumente für die sog. „moderaten“ Lohnabschlüsse her und wirkt absichtsgemäß wie eine „Lohnsubvention“ für ganz besonders billige Vollzeitjobs.
So viel Großzügigkeit kann sich der rotgrüne Fiskus freilich nicht ohne Gegenfinanzierung leisten. Auch dafür greift er – nach dem schönen Grundsatz ‚Netto für Brutto‘, der mittlerweile schon mehrfach vorgekommen ist – auf die Geldsumme zurück, die den Leuten nach allen temporär abgesenkten Abzügen vom Verdienten verbleibt, um ihr privates Verbraucherverhalten zu finanzieren. Der Einfall, das nötige Geld für ein Bremsen der Abgaben an die gesetzliche Rentenversicherung durch eine stufenweise ansteigende Energiesteuer zu akquirieren, wurde bereits erwähnt; nachzutragen bleibt, dass dieses Steueraufkommen entgegen allen Gerüchten keineswegs zweckgebunden an die Rentenkasse durchgereicht wird, sondern in den Bundeshaushalt hinein- und zur Begleichung spezieller anerkannter Zahlungspflichten des Staates gegenüber seiner Rentenanstalt wieder herausfließt. Aber vor allem handelt es sich ja sowieso um eine Volkserziehungsmaßnahme zugunsten der nationalen CO2-Bilanz. Was den regierenden Finanz-Ökologen sonst noch alles einfällt, um zu gewährleisten, dass der Fiskus sich seine standortpolitisch notwendige und ökonomisch grundvernünftige Großzügigkeit gegenüber den direkten Steuerzahlern auch leisten kann, wird man schon rechtzeitig erfahren. Auch darauf ist Verlass, dass die Opposition ihrem parlamentarischen Beruf nachkommt und lautstark gegen steuerliche Ungerechtigkeiten polemisiert, die, das steht jetzt schon fest, wieder mal dem Mittelstand, den Autofahrern und anderen hochanständigen Charakteren des modernen Gemeinwesens angetan werden; schließlich soll der Wähler ja bei nächster Gelegenheit das schwere Geschäft der wirtschaftsfreundlichen Steuersenkung und ihrer so gerechten wie soliden Gegenfinanzierung wieder ihren Damen und Herren anvertrauen.
(3) Bei der Reorganisation der Einkommensverhältnisse in ihrer geldproduzierenden Klassengesellschaft und des sozialstaatlich erzwungenen Lebensstandards der lohnabhängigen Abteilung fällt der Blick der auf verschiedenen Ebenen Regierenden schließlich auch auf den gar nicht kleinen Bereich, in dem die Staatsgewalt selber als Arbeitgeber auftritt und „Masseneinkommen“ schafft. Ohne Scheu vor „Tabus“ – freilich noch immer viel zu halbherzig, wie der Mainstream des direkt oder indirekt staatlich entgoltenen wirtschafts- und finanzpolitischen Sachverstands meint – wird kritisch überprüft, ob es das überhaupt braucht, dass die Staatsgewalt mit ihren Finanzproblemen trotzdem den Arbeitgeber spielt und aus ihrem strapazierten Fundus auch noch einen beträchtlichen Teil der nationalen Lohnsumme selber zahlt. Natürlich braucht es das – wenn schon so gefragt und geprüft wird – in vielen Abteilungen des „öffentlichen Dienstes“ nicht. Das Meiste von dem, was frühere Politiker- und Bürgermeister-Generationen unter dem Gesichtspunkt der „allgemeinen Daseinsvorsorge“ auf Staatsrechnung an Versorgungsunternehmen aufgebaut haben, lässt sich mittlerweile gut ins freie Geschäftsleben überführen; das für den öffentlichen Betrieb Nötige kann man von geschäftstüchtigen Privatunternehmern ja wieder leasen oder billig einkaufen. Die segensreichen Sachgesetze des Marktes dürfen jedenfalls dafür sorgen, dass die Defizite, die die öffentliche Hand auf diese Art los wird – freilich nicht selten mit einem letzten großen Kreditaufwand, der aber in Ordnung geht, weil er private Bereicherung in die Wege leitet –, sich in Profite verwandeln. Einer von den Vorschriften des öffentlichen Dienstrechts befreiten Lohn- und Leistungsgestaltung, verbunden mit per Konkurrenz ermittelten Gleichgewichtspreisen, traut man da fast alles zu. Und wenn verschärfte Ausbeutung und gegebenenfalls steigende Preise trotzdem keine Rendite schaffen, dann war das Angebot im Grunde nie den Aufwand wert und darf gerechterweise eingestellt werden. So oder so werden also Leute entlassen, die verbleibenden schlechter bezahlt, „Gemütlichkeiten“ abgeschafft – und auf der anderen Seite einmal mehr alle Endverbraucher mit ihrem Netto-Einkommen für bislang gratis oder zu billig bereitgestellte „öffentliche Güter“ echt kostendeckend zur Kasse gebeten. Alle diese Effekte sind nicht der Preis des marktwirtschaftlichen Fortschritts: Sie sind der Fortschritt, den die reformwütige Staatsgewalt auf diesem Feld im Interesse ihrer „Handlungsfähigkeit“ inszeniert.
Gemessen am anspruchsvollen Ziel geht der natürlich viel zu langsam vonstatten; ihren gesamten öffentlichen Dienst wird die Staatsgewalt so schnell nicht an den privaten Erwerbssinn los. Umso mehr findet sie sich herausgefordert, selber marktwirtschaftlich zu verfahren – also auf Waren wie Studienplätze oder Autobahnkilometer Kostpreise zu erheben und Sinekuren in „moderne Arbeitsplätze“ mit Leistungskontrolle und leistungsabhängiger Bezahlung zu verwandeln. Einfälle zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen durch erfolgsabhängige Ärztehonorare oder zur Verbilligung der Universitäten durch leistungsbezogene Professorengehälter fügen sich da ein, lösen ernsthafte Diskussionen aus und signalisieren zumindest eine Entschlossenheit, die sich auf niedrigerer Einkommensstufe längst praktisch austobt. Das heißt natürlich wiederum überhaupt nicht, dass in den vom Staat als Arbeitgeber geführten Tarifverhandlungen auf das Argument verzichtet würde, die Segnungen eines sorgenfreien Lebens im öffentlichen Dienst wären per se schon ein paar Lohnprozente wert …
So komplettiert die regierende rotgrüne Reformbewegung ihr großes Rettungswerk an den Staatsfinanzen und dem nationalen Standort. Umfassend reorganisiert sie den nationalen Lohns nach der ebenso klaren wie schlichten Maxime: Der Staat will sich den gewohnten Lebensstandard seines lohnabhängigen Volkes nicht mehr leisten.
d) Ein Fazit.
Mit ihrer Sparpolitik greift die Regierung reformierend ins Erwerbsleben ihrer Gesellschaft ein; zu Lasten derer, die als abhängig Beschäftigte bezahlte Arbeit leisten. Die müssen, damit und vor allem: bevor sie von ihrer Arbeit leben können, nicht bloß ihre Arbeitgeber reicher machen, sondern auch die wirtschafts- und finanzpolitischen Zwecke bedienen, die die Regierung kraft ihrer sozialpolitischen Verfügungsmacht über den Lohn an ihnen und gegen sie geltend macht.
Das alles kommt davon, dass der Lohn von den Staatsfinanzen abhängt und das Geld der Nation vom Lohn. Die Staatsgewalt verfügt es so: Sie nimmt die Lohnsumme als ihre finanzielle Manövriermasse in Beschlag. Mit einem Teil dieser Mittel sorgt sie dafür, dass die Lohnabhängigen ihrem politökonomischen Beruf auch gerecht werden können und den Unternehmern als Arbeitskräfte, ihr selbst als Ressource erhalten bleiben. Weil es darum geht, ist die Regierung es aber auch allen Beteiligten schuldig, die sozialpolitisch beschlagnahmte Lohnsumme kapitalistisch korrekt zu bewirtschaften. Sich, weil ihre Finanzen davon abhängen. Der Wirtschaft, weil die ein Recht auf gute Wachstumsbedingungen und ein solides Geld hat. Und weil die Arbeitnehmer, so sehr sie für einen kompletten Lebensunterhalt auf die gesetzlich angeordnete und durchorganisierte Umverteilung des Verdienten angewiesen sind, doch nicht von der Umverteilung, sondern von der Lohnsumme leben, die ihre Arbeitgeber für rentable Arbeit zahlen, steht der Staat als politische Lohnagentur auch denen gegenüber in der Pflicht, den Unternehmern das Arbeitgeben leicht, also billig zu machen.
Mit ihrer Sparpolitik agiert die Schröder-Regierung in diesem Dreiecksverhältnis zwischen Lohnarbeit, Kapital und nationaler Masseneinkommensverwaltung. Sie benutzt den Lohn als Mittel für die Behebung ihres Doppelproblems einer stabilitätswidrigen Verschuldung und einer wachstumsfeindlichen Steuer- und Abgabenlast und legt damit auf der anderen Seite, für die Klasse der „abhängig Beschäftigten“, das aktuell geltende Maß nützlicher Armut fest. So setzt sie in die Tat um, was die in höchste Staatsämter eingerückten ehemaligen Linken in ihrer wilden Jugendzeit als „marx’sche Verelendungstheorie“ kennen gelernt und nie begriffen haben.
Begriffen haben sie spätestens mit ihrem Amtsantritt stattdessen, dass Wandel Not tut, weil es um Fortschritt, Modernisierung, Innovation und überhaupt darum geht, die Zukunft zu gestalten – dass es also für regierende Politiker, die sich ans „Ändern“ machen, darauf ankommt, den Gebrauch der Macht aus Notwendigkeiten „abzuleiten“, ohne dadurch die eigene Handlungsfreiheit über Gebühr festzulegen; was am besten eben so funktioniert, dass man – möglichst auf lateinisch – „Erneuerung“ ankündigt, ohne ein Aufhebens davon zu machen, was wie erneuert werden soll, und beim Verweis auf die „Zukunft“, an deren Eintreten ja wirklich nicht gezweifelt werden kann, davon absieht, was man auf wen „zukommen“ zu lassen gedenkt.[8] Begriffen haben sie außerdem, dass nicht bloß der Ablauf der Zeit, sondern auch die Krümmung des Raums unausweichlich gebietet, was sie mit ihrer Nation vorhaben: Die Globalisierung
fordert ihren Preis; und noch bevor dessen Höhe feststeht, ist allen klar, wer den zu zahlen hat. Aus dem Umstand, dass mittlerweile die ganze Welt für kapitalistische Benutzung erschlossen und verfügbar gemacht ist, folgt nämlich keineswegs nur für ein paar letzte kommunistische Kritiker dieser Errungenschaft, sondern für deren triumphierende Protagonisten selber zwingend und alternativlos schon wieder bloß das Eine: Die Lebensumstände der Lohnabhängigen, Lohnniveau, Arbeitsbedingungen, gewährte Rechte – das alles sind Besitzstände, die einfach nicht mehr haltbar sind. Und weil nicht sein darf, was sowieso gar nicht sein kann, gehören diese abgeschafft.
3. Die Herausforderung namens „Globalisierung“: Auch ein erfolgreicher Standort kostet Lohn
Wenn „Globalisierung“ wirklich bloß meinen würde – worüber bei Nennung des Stichworts jedes Mal von neuem gestaunt werden darf –, dass nervenstarke Agenten des Finanzkapitals mit sekundenschnell den Globus umkreisenden Finanzoperationen aus minimalen Margen maximale Gewinne herauszaubern, dann könnte man die Sache getrost den Insidern dieses „Casino-Kapitalismus“ überlassen. Wenn es bei besagtem „Phänomen“ nur darum ginge, dass Politiker einen Machtverlust beklagen, weil Firmenchefs frei darüber entscheiden, wo ihre Multis Niederlassungen eröffnen oder schließen, dann mag das glauben und sie dafür bedauern, wer sich nicht an Jahrzehnte einer Weltwirtschaftspolitik erinnern will, mit der die Inhaber der politischen Gewalt derartige Freiheiten fürs Kapital zielstrebig und berechnend herbeiregiert haben. Und wenn mit der jüngsten „Verkleinerung“ der Welt zum multimedialen „Dorf“ nicht mehr auf dem Spiel stände als die gute Meinung, die Soziologen, Kulturschaffende und Gewerkschaftsführer vom Nationalstaat haben, dann dürfte man das Thema gelassen überblättern.
Tatsächlich ist es aber so, dass Deutschlands Bürger bis hin zu jenen Massen, die weder global spekulieren noch welt- und wirtschaftspolitisch entscheiden noch um die Nation als Kulturstandort Sorge tragen müssen, ganz nachdrücklich mit „Chancen und Gefahren der Globalisierung“ bekannt gemacht werden. Und das keineswegs in theoretischer, quasi volksbildnerischer, sondern in sehr praktischer Absicht. Das ausgiebig beschworene kindische Bild einer Welt, in der „irgendwie“ alles mit allem „vernetzt“ ist, stellt einen direkten Zusammenhang her zwischen eben dieser großen Welt, in der es blitzschnell rund geht, und den Umständen, unter denen das heimische Erwerbsleben von Leuten stattfindet, die ihr Geld nun wirklich nicht auf dem Weltmarkt, sondern beim nächstbesten Arbeitgeber verdienen. An die ergeht die klare und eindeutige Botschaft: Dem Weltmarkt entgeht keiner. Lohn und Arbeit jedes Einzelnen hängen, jetzt schon und in Zukunft immer mehr, von der ganzen Welt ab. Und das keineswegs zum Vorteil der betroffenen Lohnarbeiter und Gehaltsempfänger, dafür aber so unwiderruflich, dass denen gar nichts anderes übrig bleibt, als das Beste daraus zu machen; und wenn es nur eine gute Miene zum bösen Spiel ist.
Warum muss das eigentlich so sein? Die Frage wird von den berufenen Experten der „Globalisierung“ nicht so recht beantwortet. Deshalb hier ein paar eventuell sachdienliche Hinweise.
a)
Die Unternehmer benutzen die Lohnarbeit als Instrument in ihrem Konkurrenzkampf um die Kaufkraft der Welt, genauer: um Anteile an dem Profit, der sich damit realisieren lässt. Dieser Gebrauch schließt ein, dass sie den „Faktor Arbeit“ permanent verändern. Beständig werden Techniken erfunden, entwickelt und verfeinert, die die Arbeit produktiver machen. Und sie werden, mit Maßnahmen zur Intensivierung der Arbeit und zur Leistungssteigerung sinnreich verknüpft, eingesetzt, um die Lohnarbeit rentabler zu machen, nämlich mehr verkäufliches Produkt und darüber mehr Gewinn aus weniger bezahlter Arbeit herauszuholen. Das Ganze nennt sich seit jeher „Fortschritt“ und hat logischerweise zur Folge, dass das Arbeitsleben keineswegs gemütlicher wird, sondern für die noch benötigten und bezahlten Kräfte anspruchsvoller, in der Regel hektischer und im besten Fall nicht noch strapaziöser als zuvor. Was ihre Entlohnung betrifft, so wächst auf alle Fälle der Abstand zwischen dem, was sie an gegenständlichem Reichtum schaffen, und dem, was sie sich davon leisten können. Und was an gesellschaftlicher Arbeit überflüssig wird, das schlägt sich nicht in mehr Freizeit für alle, sondern in der – vornehm so genannten – „Freisetzung“ nicht mehr benötigter Arbeitskräfte nieder, die, solange sie nicht wieder nützlicher Verwendung zugeführt werden, nichts verdienen und als Arbeitslose die sattsam bekannte Verelendungskarriere antreten. Nach kapitalistischer Logik ist es eben so, dass die Effektivierung der Produktion gesellschaftlichen Reichtums, eben weil der in der Akkumulation privaten geschäftlich engagierten Eigentums besteht, mehr Armut schafft.[9]
Für ihren Konkurrenzkampf belegen die kapitalistischen Unternehmer die ganze Welt mit Beschlag; als Quelle lohnender Produktion wie als Absatzmarkt zur Realisierung ihrer Gewinne. Das ist überhaupt nicht neu, aber natürlich gibt es da Fortschritte zu verzeichnen. Dass tatsächlich die gesamte Staatenwelt dem Kapital zu Gebote steht, und dass es sich mit jeder Phase seines Umschlags, von der ersten Investition bis zur Endabrechnung seiner Erlöse, frei über die Grenzen hinweg betätigen kann und darf: Dieser idyllische Zustand ist zwar schon seit Jahrhunderten in Arbeit, erst im letzten Jahrzehnt aber, nach der Selbstliquidierung der großen systematischen Ausnahme von der kapitalistischen Regel, so richtig wahr geworden. Seither wird endgültig weltweit alles Wirtschaften von der Privatmacht des Eigentums beherrscht; das Überleben der eigentumslosen Masse der Weltbevölkerung ist vom Bedarf der Unternehmer an nützlichen Diensten für ihren Konkurrenzkampf abhängig gemacht; und dessen Fortschritte scheiden unter den abhängig gemachten Weltbürgern zwischen Beschäftigten, Ausgemusterten und Überflüssigen, so wie die ökonomische Vernunft des Systems es verlangt.
Dabei treten neben den politisch erwünschten Haupteffekten unweigerlich auch unerwünschte Nebenwirkungen auf. Indem das Kapital seine Freiheit nutzt und die Weltbevölkerung nach dem Kriterium lohnender Benutzung durchsortiert, versorgt es die Staaten, die es zu solch segensreichem Tun ermächtigt haben, mit einem nationalen Erwerbsleben, aus dem die höchste Gewalt Geld abschöpfen kann, um damit Politik zu machen. Das gilt zwar nicht für alle. Manche Länder geben für den kapitalistischen Zugriff einfach zu wenig her, als dass es zu einem „sich selbst tragenden“ allgemeinen Geldverdienen kommen könnte. Deren Einwohner fallen dann fast komplett in die Kategorie „überflüssig“. Das braucht die maßgeblichen Weltwirtschaftsmächte freilich ebenso wenig zu beunruhigen wie die global agierende Geschäftswelt, die mit der Ausbeutung brauchbarer Ressourcen schon genug zu tun hat und zum Entwicklungshelfer ein für alle Mal nicht berufen ist. Allerdings werden auch die kapitalistisch intakten Nationen durch die Fortschritte im Konkurrenzkampf um immer höhere Rentabilität mit dem Ergebnis konfrontiert, dass sie einen Zuwachs nicht bloß an produktivem Reichtum, sondern auch an systemeigenem Pauperismus zu verzeichnen haben, der die finanzielle Verfügungsmasse der Staatsgewalt mindert. Und damit haben die politisch Verantwortlichen dann doch ein Problem. Sie verzeichnen eine Arbeitslosigkeit, der nur mit einem „Bündnis für Arbeit“ beizukommen ist, eine staatliche Verschuldungs- und Steuerquote, die eine ganz besonders konsequente Sparpolitik unausweichlich macht – Defizite, die darauf verweisen, dass die Basis des nationalen Reichtums und Quelle staatlicher Mittel zu wünschen übrig lässt: Es fehlt beim allgemeinen Erwerbsleben, aus dessen Früchten die öffentlichen Budgets ohne Scheu und ohne Reue schöpfen könnten.
Das ist die Sachlage, die die Regierung anspricht, wenn sie ihrem Volk von einer großen Herausforderung namens „Globalisierung“ erzählt.
b)
In dem Umstand, dass die freie Konkurrenz dank machtvoller staatlicher Nachhilfe mittlerweile die ganze Welt erobert hat, haben die negativen Auswirkungen des kapitalistischen Fortschritts auf die Verfassung auch der besser gestellten Nationen nicht ihren Grund.[10] Was die betroffenen Regierungen als Problem registrieren, ist die Konsequenz des Pauperismus, den die kapitalistischen Konkurrenten mit ihrer Jagd nach immer höherer Rentabilität der Lohnarbeit zu Stande bringen. Wenn die demokratischen Staatslenker ihr politökonomisches Leiden mit der erreichten Vollendung des Weltmarkts in Zusammenhang bringen, so als wäre die „Welt-“ und nicht der „-markt“ dafür verantwortlich, so macht das dennoch nicht bloß ideologisch Sinn. Die ideologische Verdrehung enthält nämlich eine klare Ankündigung: Es kann ihnen und soll deshalb auch gar nicht darum gehen, den Grund der Malaise abzustellen. Das Programm der „Globalisierungs“-Politiker heißt vielmehr: den systemnotwendigen Pauperismus „global“ anders verteilen, weg vom eigenen Zuständigkeitsbereich, zu Lasten anderer Nationen.
Für demokratische Standort-Verwalter ist diese Wendung nur logisch. Wenn sie Defizite beim nationalen Erwerbsleben registrieren, dann versteigen sie sich nicht zu einer Kritik an denen, von denen der gesellschaftliche Gelderwerb seinen Ausgang nimmt, weil die Staatsmacht sie zum Arbeitgeben ermächtigt hat. Sie halten sich auch nicht weiter damit auf, dass es die Bedingungen und Anforderungen kapitalistischen Arbeitgebens sind, nach denen permanent unter den existierenden Beschäftigungsverhältnissen aufgeräumt wird – so oder so, bei erfolgreicher „Rationalisierung“ wie bei Entlassungen wegen Erfolglosigkeit in der Konkurrenz, mit elenden Folgen. Sie sehen völlig ein, dass nur rentable Arbeitsplätze gute Arbeitsplätze sind – und wünschen sich davon mehr; von genau denen, deren Konkurrenzbemühungen immerzu Teile des nationalen Gelderwerbs lahm legen. Denn eins wissen sie ganz genau, das beweist ihnen jeder Blick über jede beliebige Grenze: Es gibt sie, die Arbeitsplätze, die bei ihnen fehlen – anderswo. Dass in anderen Staaten gleich gesinnte Politiker den gleichen Mangel verspüren und genau so missgünstig über die Grenze blicken, macht nichts, bestärkt nur die Gewissheit, dass fremde Standorte dem eigenen „Beschäftigung“ wegnehmen. Was kümmert es sie, dass der universell gewordene Kapitalismus universell für Pauperismus sorgt und mittlerweile sogar ganze Staaten darüber in ökonomische Existenznöte geraten? Den politischen Herren der Marktwirtschaft geht es nicht um die Widersprüche der Produktionsweise, der sie ihr Land verschrieben haben, sondern darum, mit deren Mitteln und folglich auch nach deren Kriterien gut abzuschneiden. Sie brauchen und wünschen sich für ihren Standort mehr Investitionen und Einkommensquellen; und deswegen sehen sie die Lage von vornherein gleich so, dass Arbeitsplätze anderswo statt bei ihnen entstehen. So – und nur so – wissen sie mit den Mangelerscheinungen ihrer politischen Ökonomie etwas Praktisches anzufangen: als Konkurrenten, die sich mit anderen Nationen um die Früchte des kapitalistischen Wachstums schlagen und um die Abwälzung der damit notwendigerweise verbundenen Lasten. Deswegen laufen sie zu höchster Form auf, wenn sie feststellen müssen, dass es in anderen Ländern – zwar bloß in ganz wenigen; dafür ist aber die große kapitalistische Vorbild-Nation Amerika darunter! – ausweislich der offiziellen Arbeitslosenstatistik sowie der Erfolgsmeldungen des Budgetministers ums nationale Geldverdienen sogar besser bestellt ist als selbst in der mächtigsten Euro-Nation. Dann führt endgültig kein Weg mehr an der herausfordernden Frage vorbei, warum bei ihnen nicht geht, was andernorts doch augenscheinlich klappt!
Damit steht fest, wie Politiker, die ihre Nation durch die „Globalisierung“ herausgefordert sehen, mit den Schäden umgehen, die der kapitalistische Fortschritt sogar an ihren erfolgsverwöhnten Standorten hinterlässt: Sie erleiden nicht – sie eröffnen aus dem Geist der inter-nationalen Konkurrenz um Nutzen und die Vermeidung von Schaden aus dem kapitalistischen Weltgeschäft einen praktischen Vergleich der Standorte.
c)
Durch den Beschluss der „globalisiert“ denkenden Obrigkeit, die eigene Nation so herzurichten, dass der Nutzen rentabler Arbeitsplätze – und einen anderen ökonomischen Nutzen wollen die Verantwortlichen sich gar nicht erst vorstellen können – wieder vermehrt in ihr statt anderswo anfällt, finden sich zuallererst die Arbeitgeber selbst zu konstruktiven Beiträgen herausgefordert. Die bestehen – wie nicht anders zu erwarten; schließlich handelt es sich auch bei den Vertretern der Wirtschaft nicht um Freunde richtiger Erklärungen, sondern um erfolgsorientierte Konkurrenzgeier – in der immer wieder erneuerten Forderung an die Staatsmacht, die lohnende Ausbeutung des Faktors Arbeit zu erleichtern. Nach der bestechenden Logik, dass, je größer das geschaffene Elend und die daraus resultierenden finanziellen Sorgen der Politik, erst recht umso größer die Ansprüche derer ausfallen, die diese Lage geschaffen haben, werden umfassende Änderungen angemahnt und geradezu erpresserische Töne angeschlagen. Völlig überflüssigerweise; denn dass die Bedingungen, die der Sozialstaat fürs Arbeitgeben gesetzlich vorgegeben hat, in Wahrheit lauter Behinderungen dieses edlen Zwecks darstellen, das hat die politische Führung sich selber schon gedacht; in diesem Sinn hat sie ja die vergleichende Musterung des eigenen Standorts überhaupt angestrengt.
Der Befund, über den sie sich mit ihrer Arbeitsplätze schaffenden Elite dementsprechend leicht einig wird und den sie zur reformerischen Staatsräson erhebt, fällt einigermaßen radikal aus und auch einigermaßen schlicht, ohne dass deswegen der Vorwurf laut würde, da würde wieder einmal auf eine schwierige Frage eine allzu einfache Antwort gegeben: Der Staat hat viel zu viel reglementiert; Deregulierung ist das Gebot der Stunde. Ganz so generell, wie es gesagt wird, ist das freilich dann doch nicht gemeint; aber auf die Idee, die Rechtssicherheit fürs Geschäft sollte angegriffen werden, kommt zu Recht sowieso niemand. Das Verdikt „Überreglementierung“ trifft zielgenau all die Fälle, in denen gesellschaftliche Belange jenseits des Geschäftemachens Rechtsschutz genießen. Denn solche Vorschriften, ob sie nun den Gesundheitsschutz oder die Bauaufsicht betreffen, schränken alle Mal den freien Gebrauch des Eigentums ein und behindern schon damit die einzig in Frage kommende Quelle von „Beschäftigung“. Stattdessen gehört das Eigentum, also die gesellschaftliche Klasse, die darüber verfügt, mit erweiterten rechtlichen Ermächtigungen ausgestattet und gegen alle anderen Interessen, die es irgendwie auch noch gibt, ins Recht gesetzt: Das ist der Inhalt des Imperativs, der Staat solle sich „heraushalten“ und „de-“ statt „regulieren“. Die schlimmsten „Verkrustungen“, die unbedingt „aufgebrochen“ werden müssen, sind daher logischerweise im Bereich des lohnabhängigen Arbeitslebens anzutreffen, überall dort nämlich, wo der Staat Arbeitnehmerrechte kodifiziert hat. Das fängt mit dem „Arbeitsmarkt“ an: Weder beim Einstellen von Arbeitskräften noch beim Kündigen und noch nicht einmal bei der Vertragsdauer herrscht die Freiheit, die Arbeitgeber brauchen; auch die „Mobilität“, die Arbeitslose sich zumuten lassen müssen, wenn sie für einen Arbeitsplatz im Einzugsbereich des Grundgesetzes in Frage kommen, lässt zu wünschen übrig. Das geht mit den Vorschriften zum Gebrauch eingestellter Arbeitskräfte weiter: Speziell in der Frage der Arbeitszeiten, arbeitstäglich wie übers Arbeitsleben gerechnet, fehlt es noch immer an „Flexibilität“. Und der immer wieder notwendigen „Anpassung“ von Leistungsstandards an den Stand der betrieblichen Konjunktur steht die gesetzliche „Bindewirkung“ von Manteltarifverträgen entgegen. Mit Lohnfragen soll das alles noch gar nichts zu tun haben; dabei geht es bei solchen angeblich von Staats wegen verhinderten Tugenden wie „Mobilität“, „Flexibilität“ oder „Anpassungsbereitschaft“ um gar nichts anderes als um die Gewinn bringende absolute Verfügbarkeit von Arbeitskraft im Verhältnis zur gezahlten Lohnsumme: Die Bedingungen, zu denen über Arbeit verfügt werden kann, werden für zu kostspielig befunden. Die Regelungen zur Lohnsumme im engeren Sinn bedürfen natürlich erst recht der „Deregulierung“. So verhindert die Rechtskraft einmal ausgemachter Lohntarife die Bemessung der Lohnkosten an der „Leistungsfähigkeit“ des einzelnen Unternehmens, wo doch jeder weiß, dass der Lohn der große „Jobkiller“ ist: Ohne freies Lohnsenken wird Arbeitgeben unmöglich. Und die „Lohnnebenkosten“ sind sowieso untragbar.[11]
Verbindliches Leitbild dieser Selbstkritik des größten europäischen Kapitalstandorts sind die USA; und wenn schon nicht in jedem einzelnen Punkt die wirklich dort herrschenden Lohnarbeitsverhältnisse, dann jedenfalls das Bild, das die konkurrierende Staatenwelt sich von einem wegen fehlender Staatseingriffe ungehemmt und schrankenlos aufblühenden amerikanischen „Wirtschafts-“ und insbesondere „Beschäftigungswunder“ macht. Skeptische Hinweise auf die miese Art der Jobs, deren Zahl schon deswegen gar nicht genug wachsen kann, weil oftmals erst mehrere einen Menschen ernähren, sind vor dem gebieterischen Interesse verstummt, das Deutschland an genau so einer Errungenschaft bekundet: Einen „explodierenden“ Billiglohnsektor brauchen „wir“ auch.
Die gleiche Lehre wie dem erfolgreichen Vorbild entnehmen die reformfreudigen Standort-Verwalter aber ebenso gut dem Blick auf Staaten am unteren Ende der kapitalistischen Erfolgsskala. Wenn in Tschechien und Polen industrielle Arbeitsplätze entstehen – in welch minimalem Umfang auch immer –, dann fällt deutschen Europa-Politikern zielstrebig immer dasselbe ein: Offenbar gibt es doch auch in diesen staatlichen Armenhäusern irgendwelche attraktiven Bedingungen, an denen es in Deutschland mangelt. Welche das sind, danach braucht nicht erst lange gesucht zu werden: Arbeit ist dort um die Hälfte oder mehr billiger als hierzulande. Also ist zumindest so viel klar, dass es spätestens im Zuge der europäischen Einigung schwierig bis unmöglich wird, das „hohe deutsche Lohnniveau“ zu halten. Wenn Firmen wie VW diese Zukunft schon vorwegnehmen, indem sie ganze Produktionslinien konzern-intern grenzüberschreitend ausschreiben und dem Betrieb, der am billigsten kalkuliert, den Zuschlag erteilen; wenn also ein vorbildlicher Weltkonzern ganz praktisch Lohnarbeiter aus deutschen mit solchen aus spanischen und tschechischen Unternehmensabteilungen konkurrieren lässt, in der Form nämlich, dass deutsche Werke ihre Leute mit der Alternative konfrontieren: Lohnverzicht oder Kurzarbeit plus Entlassungen – entsprechend in den auswärtigen Werken –; dann ist dieser Kunstgriff kapitalistischer Lohndrückerei für die Politiker eine beherzigenswerte Lehre. Sie nehmen das als unwiderleglichen praktischen Beweis, wie richtig sie liegen, wenn sie quasi vorauseilend die ganze Nation auf weniger Lohn für mehr Arbeit festlegen.
Man kann aber auch noch weiter nach unten gehen und einen Standort-Vergleich mit so genannten „Schwellenländern“ wie Brasilien oder Indien anstellen. Das tun sogar US-Politiker gerne, obwohl sie doch ein Maßstäbe setzendes Job-Wunder hingekriegt haben. Freilich werden solche Länder mit ihren nicht vorhandenen „Sozial-“ und „Umwelt-Standards“ nicht einfach neidvoll als Vorbilder anerkannt, sondern im Gegenteil genauso neidvoll ungerechtfertigter Bereicherung am Weltmarkt mit den unfairen Mitteln des „Lohn-“, „Sozial-“ und „Umwelt-Dumpings“ angeklagt; das Konkurrenzinteresse führender kapitalistischer Nationen treibt hier auf einmal die erratische Sumpfblüte einer Dollar- resp. Euro-imperialistischen Fürsorge für auswärtige Arbeits-Kulis hervor. Immerhin ist in diesem weltwirtschaftlichen Treppenwitz aber eine eindeutige Klarstellung darüber enthalten, worüber, über welche fundamentale politökonomische Größe, kapitalistische Nationen gleich welchen Reichtums- und Armutsniveaus sich praktisch konkurrierend miteinander vergleichen, worin sie sich also gleichen: Um rentable Arbeit geht es. Ihre ökonomischen Erfolge erringen oder verspielen Nationen mit dem Verhältnis zwischen Lohn und Leistung, mit dem Maß an Ausbeutung menschlicher Arbeitskraft also, das ihre Industriellen im Durchschnitt hinkriegen. Dass den Nationen, die auf Grund einer jahrzehntelangen kapitalistischen Karriere bzw. ihres Kampfes um einen Platz in der Konkurrenz der Großen nur noch oder nach wie vor nur über viel verarmtes Volk verfügen, die an frühkapitalistischen Sitten orientierte Ruinierung von Arbeitskräften als unfaire Erfolgsstrategie ausgelegt wird, ist der nächste zynische Treppenwitz, macht aber auch etwas klar: Das kapitalistische Erfolgsrezept heißt nützliche Armut, ist also aus zwei Variablen zusammengesetzt. Mehr Armut macht die Arbeit zwar nicht produktiver; ein wenig rentabler wird sie dadurch aber schon. Und wenn gewisse Konkurrenten unfairerweise auf Verelendung als weltwirtschaftliche Erfolgsmethode setzen, dann müssen sie sich in Acht nehmen; denn auch in dem Punkt können imperialistische Erfolgsnationen mit ihren „sozialen Standards“ leicht dagegen halten: Die vertragen alle Mal mehr Absenkung, als die Heimatländer des „Dumping“ an Lohn und Umwelt jemals zuzusetzen haben.
d)
Gegen die USA, gegen ihre Euro-Partner, gegen ihre sonstigen Nachbarn und schließlich sogar gegen die nennenswerten „Schwellenländer“ im Rest der Welt konkurrieren deutsche Politiker um die Verteilung des national zu Buche schlagenden Nutzens und Schadens aus dem Menschheitsfortschritt, den die Kapitalisten im Zuge ihres weltumspannenden Konkurrenzkampfes veranstalten. Dazu sagen sie gerne „Globalisierung“.[12] Das hat den Vorteil, dass ohne jedes weitere Argument, allein vermittels der Etikettierung, die Macher als Getriebene dastehen, die staatlichen Machenschaften als schicksalhafte Entwicklung erscheinen, die Konkurrenzoffensive, für die die Staatsmacht ihre lohnabhängigen Bürger einstehen lässt, als defensive Antwort auf eine subjektlose und folglich unentrinnbare Herausforderung durch „die Konkurrenz“ in Ordnung geht. Es handelt sich also um eine denkbar bequeme Manier, den Betroffenen zu erklären, dass genau das, was man mit ihnen vorhat und ihnen antut, zu ihrem eigenen Besten einfach sein muss.
Was die Regierung den Leuten unter diesem Titel ankündigt und antut, das ist ein praktischer und in praktischer Absicht vorgenommener kritischer Vergleich der nationalen Arbeitslöhne. Der Verelendung Rechnung tragend und vorauseilend, die das Kapital mit seinen Fortschritten in Sachen rentabler Benutzung des Faktors Arbeit zuwege bringt, definiert und bringt sie den staatlich administrierten Lebensstandard ihrer lohnabhängigen Massen auf das Maß herunter, das die Nation befähigen soll, bei der Sortierung der Arbeiterklasse auf der ganzen Welt in benutzte, Geld verdienende, also staatsnützliche Abteilungen und eine wertlose pauperisierte Überbevölkerung besser als die andern abzuschneiden. In die Festlegung des – wie Marx es genannt hat – „historischen und moralischen Elements im Wert der Ware Arbeitskraft“, die der Sozialstaat längst zu seiner Sache gemacht hat, führt die Regierung so das Kriterium ein, dass die Lohnarbeit sich universell bewähren muss, als Geschäfts- und Konkurrenzmittel der Arbeitgeber nämlich; und das so gut, dass die Nation mit dem Erwerbsleben ihrer Lohnabhängigen gut bedient ist. Sie organisiert den Pauperismus, der zu ihrem marktwirtschaftlichen System notwendig dazugehört, damit er produktiv und Standort-nützlich bleibt und nicht hierzulande, sondern anderswo staatsschädigende Ausmaße annimt.
*
Wenn es so weit gekommen ist: wenn die Abhängigkeit des Arbeitslohns von der Kalkulation des Geldes, mit dem Geschäft und Staat gemacht werden, außer Frage steht, der Gegensatz zwischen dem Lebensunterhalt der lohnabhängigen Mehrheit und dem gesellschaftlichen Reichtum normal ist, die Subsistenz der arbeitenden Klasse zur Disposition steht, der Antrag auf einen für Kapital und Staat nützlichen Pauperismus keine Unverschämtheit, sondern praktische Vernunft ist und der Hinweis, dass es auf der ganzen Welt so zugeht, jeden Zweifel erschlägt, ob das denn auch in Ordnung geht – dann ist der Kapitalismus fertig. Außer den Bedürfnissen des Kapitals ist nichts mehr der Befassung wert.
[1] Davon handelt das erste Kapitel unseres Aufsatzes in GegenStandpunkt 4-99, S.51.
[2] Dazu, wie der bürgerliche Staat mit Geld regiert, steht das Nötigste in GegenStandpunkt 4-97, S.191: „Der Staatshaushalt – Von der Ökonomie der politischen Herrschaft“.
[3] Von der tieferen Bedeutung, die dieses beliebte Wortungetüm dem kapitalistischen Weltmarkt und seinen zeitgenössischen Verlaufsformen und Wirkungen verleiht, handelt der Artikel „‚Globalisierung‘ – Der Weltmarkt als Sachzwang“ in GegenStandpunkt 4-99, S.77.
[4] Der politökonomische Begriff dessen, was die Haushälter der Nation da als Misswirtschaft diagnostizieren, ist in dem genannten Artikel über den Staatshaushalt entwickelt. Es geht um den absoluten und relativen Umfang, in dem der Kredit einer Nation, dessen Schöpfung durchs Finanzgewerbe der Staat als Urheber und Garant des nationalen Kreditgelds anstößt, fordert und fördert, von denen, die ihn geschäftlich benutzen, in akkumulierendes Kapital verwandelt wird. Wenn die Finanzpolitik sich mit dem prima facie so paradoxen Problem herumschlägt, ihrer Gesellschaft gleichzeitig zu viele kostspielige Dienste spendiert und zu viel Geld weggenommen, zu viel Steuern und Abgaben eingezogen und sich zu viele verfügbare Mittel geliehen zu haben, dann arbeitet sie sich an dem ökonomischen Sachverhalt ab, dass der Staat mit seiner Macht, Kreditgeschäfte quasi ins Unendliche auszuweiten, mehr Ansprüche auf kapitalistisch produzierten Reichtum in die Welt gesetzt hat und weiter setzt, als das dadurch vorangebrachte Kapitalwachstum im Land einzulösen vermag. Finanzpolitiker handeln freilich weniger auf Grund einer besseren Einsicht in diesen Sachverhalt, vielmehr in dem Interesse, bessere Erfolge in ihrer Haushaltsführung zu erzielen, und vom Standpunkt der Macht des Souveräns über Geld, Kredit und Erwerbsleben der Nation. Deswegen reflektieren sie die Wirkungen des nationalen Geschäftsgangs, wo immer sie ihnen zum Problem werden, erst einmal auf sich zurück, postulieren Fehler in der Wirtschaftspolitik, die ihr Staat praktiziert hat – eine Selbstkritik, die in der Demokratie als stereotypisierter Austausch von Vorwürfen zwischen Regierung und Opposition ihren festen Platz hat; woran einmal mehr zu sehen ist, wie hervorragend diese Staatsform zum Kapitalismus passt –, und suchen Besserung auf dem Wege des Haushalts, mit dem sie Jahr für Jahr die Ergebnisse ihrer nationalen Ökonomie und deren Wirkungen auf die staatlichen Finanzen, also auch umgekehrt die ökonomischen Effekte ihres eigenen Finanzgebarens quittieren und zugleich fordernd und fördernd in ihre Marktwirtschaft hineinwirken. Indem sie so die Verantwortung für Gedeih und Verderb ihrer Nationalökonomie übernimmt, geht die Staatsmacht praktisch auf die Leute los, die sich mit ihren jeweiligen Mitteln ihr Geld verdienen, begutachtet sie als Ressource des nationalen Wirtschaftserfolgs und macht sie dafür haftbar – jeden mit seinem Erwerbsmittel. Wie die rotgrüne Bundesregierung hier vorgeht und sich darauf kapriziert, den Faktor Arbeit sachgerecht herzurichten, davon handelt dieses zweite Kapitel unserer kleinen Abhandlung über die heutige Gestalt des ‚historischen und moralischen Elements im Wert der Ware Arbeitskraft‘.
[5] Die Sparpolitik, der sich die rotgrüne Bundesregierung verschrieben hat, wird in der Öffentlichkeit gerne vorstellig gemacht als ein Ringen der verschiedenen Bundesminister mit dem Finanzminister um die Ausstattung ihrer Ressorts. Ohne Zweifel läuft sie so auch ab. Deswegen ist das aber noch lange nicht die Sache, um die es geht.
[6] Den Betroffenen scheint das übrigens auch ohne jede theoretische Bemühung, aus praktischer Erfahrung wahrscheinlich, vertraut zu sein: Sobald die Regierung deutlich gemacht hat, dass sie es in ihrer Millenniums-Neuauflage staatlicher Sparpolitik wirklich auf substanzielle Änderungen in der nationalen Haushaltsführung anlegt, hat sie Beifall von „der Wirtschaft“ erhalten; deren Repräsentanten sahen sich durch die Ansage einer neuen finanzpolitischen Generallinie gleich dazu ermuntert, lauter Forderungen zum Vorteil der Unternehmer anzumelden. Dagegen war von der anderen Seite und deren öffentlichen Anwälten nichts weiter zu vernehmen als die unter dem üblichen Volksgemurmel – immer auf die Kleinen
, unsozial
, ungerecht
, total unausgewogen
… – vorgebrachte Erwartung, dass einmal mehr zum Nachteil der „kleinen Leute“ in deren Erwerbs- wie Nicht-Erwerbsleben samt Lebenshaltungskosten und Gesundheitsvorsorge eingegriffen wird. Die Klassen kennen halt ihren Klassenstaat, auch ohne die Feinheiten der Finanzpolitik zu verstehen.
[7] Was mit dem höchst undifferenzierten Urteil anfängt, der Staatshaushalt wäre unfinanzierbar geworden oder drohte es zu werden, hört immer mit einer höchst differenzierten Beurteilung der diversen Haushaltsposten auf. Darüber braucht man sich nicht zu wundern. „Finanzierbar“ ist immer genau das, was der Staat finanziert; und das entscheidet sich danach, welche Prioritäten die Politik setzt. Über die Finanzierbarkeit eines politischen Vorhabens zu rechten, ist nichts als eine – verlogene – Art, eine Entscheidung über dieses Vorhaben zu treffen; deswegen leitet die Beschwörung von Finanzproblemen auch immer eine ganze Kette von Beschlussfassungen darüber ein, was eine Regierung sich leisten will, wofür sie Geld einsammelt bzw. auf dem Kreditweg schöpft und ausgibt. Dass solche Entscheidungen unter dem Gesichtspunkt der „Un-“ resp. „Bezahlbarkeit“ der fraglichen Sache getroffen werden, kennzeichnet die für demokratische Überzeugungsarbeiter typische Unehrlichkeit, mit der vor allem solche Staatsaktionen durchgesetzt werden, die den verehrten Bürgern an den Lebensunterhalt gehen: Mit dem Verweis auf die „leeren Kassen“ ersparen die Regierenden sich jede Begründung, blocken jede Diskussion des amtlichen Prioritätenkatalogs ab und erklären ihre Beschlüsse für unwidersprechlich.
[8] Einer der letzten deutschen Philosophen, die sich noch um richtige Gedanken bemüht haben, hätte diese Berufungstitel einer Politik der sozialpolitisch organisierten Verelendung als moralisierende Reflexionsbestimmungen des Werdens identifiziert, aus denen gar nichts folgt, dafür aber alles, was man für notwendig erklären will, als Notwendigkeit gefolgert werden kann, weil – und solange – von dem, was da „wird“ und laufend „fortschreitet“, so schön total abstrahiert wird. So kann man sich dann, so weit die Befugnis reicht, frei ans „modernisieren“ machen und ganz nebenbei Hegel noch in einem ganz anderen Punkt widerlegen. Der hat nämlich noch gemeint, die Verwendung einer Sache als Mittel für ein praktisches Interesse erforderte deren pflegliche Behandlung. Wie die Berliner Koalition beweist, geht es auch anders: Man kann ein Mittel auch ruinieren, wenn es in seiner aktuellen Verfassung dem Zweck nicht recht genügt, der an es herangetragen wird.
[9] Weil auf den Unterschied zwischen Arbeitsproduktivität und Rentabilität im Kapitalismus alles ankommt, pflegt der ökonomische Sachverstand auf allen Ebenen ihn zu ignorieren, zu leugnen oder beides zu verwechseln. Deswegen kommt es uns in diesem Punkt auf Klarheit an. Um die haben wir uns in Abschnitt f) des ersten Kapitels dieses Aufsatzes in GegenStandpunkt 4-99, S.51, bemüht und vorgeführt, dass die sogenannte „Arbeitswertlehre“ von Marx eigentlich gar nichts anderes zum Inhalt hat.
[10] Einen Zusammenhang gibt es insofern, als mit der Vollendung des Weltmarkts ein Effekt definitiv ausgereizt ist, der dem Verlust an Arbeitsgelegenheiten und Masseneinkommen in den kapitalistisch führenden Nationen bis dahin immer noch – mal mehr, mal weniger – entgegengewirkt hat: die Kompensation der „Freisetzung“ überflüssig gemachter Arbeitskräfte durch die mit der Erschließung neuer Märkte verbundene Ausweitung des kapitalistischen Geschäfts. Auch das ist selbstverständlich nicht der Grund für die Wirkungen des kapitalistischen Fortschritts, die am Ende sogar von den zuständigen Staatsgewalten als Schaden für ihre Reichtumsquellen registriert werden, sondern Ursache für eine Verschärfung der kapitalistischen Konkurrenz.
[11] Dazu ist in Kapitel 2 unter b) schon das Nötigste gesagt.
[12] Zu dieser Ideologie und dem Nutzen der Debatte darüber wird nochmals empfohlen, den Artikel „‚Globalisierung‘: Weltmarkt als Sachzwang“ in GegenStandpunkt 4-99, S.77 nachzulesen.