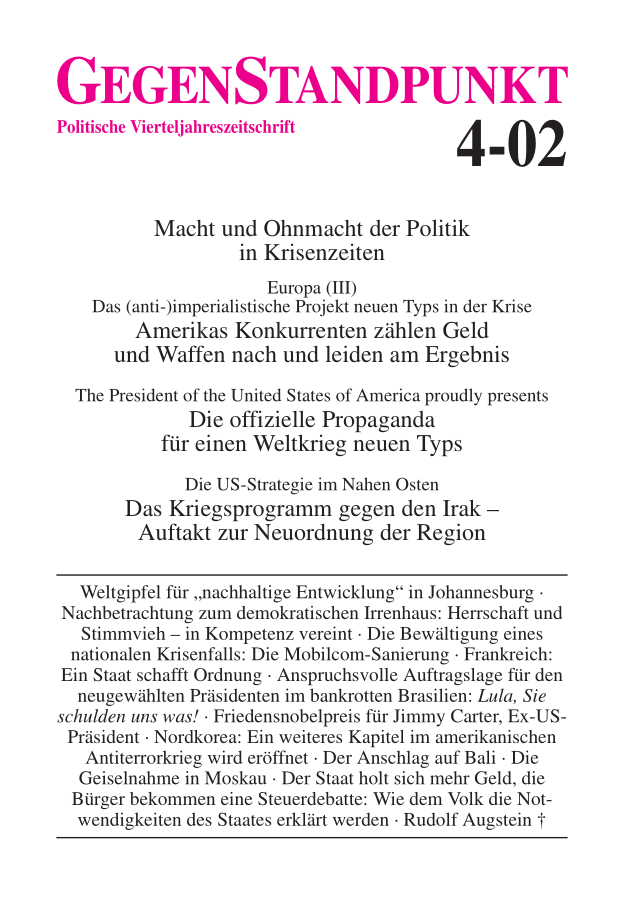Europa (III)
Das (anti-)imperialistische Projekt neuen Typs in der Krise
Amerikas Konkurrenten zählen Geld und Waffen nach und leiden am Ergebnis
Das Projekt eines mächtigen europäischen Imperialismus, der sich in Konkurrenz zu den USA Geld und Macht auf der Welt verschafft, ist in eine doppelte Krise geraten. Ökonomisch, weil die globale Krise dem Gemeinschaftsgeld Euro seine anvisierte Wucht als Mittel der Akkumulation nimmt. Politisch, weil die USA mit ihrem weltweiten Feldzug gegen anti-amerikanischen Terrorismus einer eigenständigen europäischen Ordnungsmacht ein Ende setzen. Die EU vollzieht diese Krisenlage intern mit einem gehörigen Maß an innerer Zersetzung.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Siehe auch
Systematischer Katalog
Europa (III)
Das (anti-)imperialistische Projekt neuen Typs in der Krise
Amerikas Konkurrenten zählen Geld und Waffen nach und leiden am Ergebnis
A. Das EU-Projekt im Stadium der gemeinsamen Währung und der Suche nach einer eigenen „Sicherheitsidentität“
I. Ein Geld für zwölf konkurrierende Nationen – Zwischenfazit eines einzigartigen Großversuchs in imperialistischer Politökonomie
Kapitalisten und Arbeitnehmer, Verbraucher und Börsenspekulanten, Bankiers und Sparer, Mieter und Vermieter, Finanzminister und Steuerzahler in den 12 Euro-Ländern der EU zahlen, rechnen, kalkulieren, wirtschaften, jeder auf seine Weise, in einem und demselben Geld. Der Stoff, über den der gesamte materielle Lebensprozess der bürgerlichen Gesellschaft zu Stande kommt, ist derselbe für die noch immer national geschiedenen Gesellschaften. Die nationalen Volkswirtschaften bedienen sich und dienen der Macht einer einzigen Notenbank, im Leihgeschäft mit den nationalen Kreditsystemen, als deren letzte Geldquelle, Kreditzeichen als gesetzliche Zahlungsmittel in Umlauf zu bringen; mit ihren jeweiligen Leistungen in Sachen kapitalistischer Geldvermehrung begründen sie gemeinsam die kapitalistische Substanz ihres Geschäftsmittels und damit dessen Weltgeltung. Der Währungsvergleich, die moderne Form einer permanenten Abrechnung zwischen den Nationen über ihre gegeneinander erzielten Konkurrenzerfolge und erlittenen Konkurrenzniederlagen und zugleich, in Abhängigkeit davon, ein nationales Konkurrenzmittel, ist zwischen ihnen definitiv abgeschafft; er findet zwischen Euro-Land und dem Rest der Welt statt, also vor allem mit dem US-Dollar und daneben mit dem japanischen Yen – eine starke Vereinfachung des „Wettstreits“ der Weltwirtschaftsmächte um die Beherrschung des Weltfinanzmarkts, die die Europäer in ihrem Bemühen, diese globale Konkurrenz erfolgreich zu bestehen, herbeigeführt haben. Als Quelle einer derart einheitlichen Kredit- und Weltgeld-Macht sind die Euro-Staaten, politökonomisch ganz real, ein Gemeinwesen.[1]
Bei der Herstellung dieser Einheit haben sie sich über alle Bedenken hinweggesetzt und nicht von der Schaffung eines politisch realen Gemeinwesens abhängig gemacht: eines europäischen Souveräns, der kraft seiner Geldhoheit über die Emission der neuen Währung entschieden, verbindliche Regeln für ihre Verwendung erlassen und überhaupt als Schöpfer und Nutznießer europäischen Kredits dessen Macht und die Geltung der ihn repräsentierenden papierförmigen Geldware verbürgt hätte. Zu der Notwendigkeit einer solchen politischen Garantiemacht für ihren gemeinsamen kapitalistischen „Fetisch“ und die dadurch praktisch in die Welt gesetzte ökonomische Einheit ihrer Nationen haben sich die „Väter“ des Euro funktionalistisch gestellt und ihr mit einer eigentümlichen Vertragskonstruktion Genüge getan: Eine förmlich autonome Zentralbank emittiert das Geld in eigener Regie und nach geld- und zinspolitischen Maßregeln, die nichts als die – von den verantwortlichen Bankern so gesehenen – immanenten Sachzwänge eines kapitalistisch tauglichen, konkurrenzstarken Kreditgelds in Weltgeldqualität widerspiegeln sollen. Die EU-Kommission als supranationales Exekutivorgan kontrolliert die Verwendung des gemeinsamen Geldes durch die Haushaltsminister der beteiligten Länder und setzt von den restriktiven Regeln, auf die diese sich seinerzeit in Maastricht geeinigt haben, so viel durch, wie man sie durchsetzen lässt. Über ihr stehen nämlich, als höchste Entscheidungsinstanz, die nationalen Regierungen, die sich von ihrer gemeinschaftlich zuwege gebrachten Kreditmacht abhängig gemacht haben und nun also auch wirklich davon abhängen, um je für sich damit zu wirtschaften. Das wiederum bedeutet nicht bloß, dass sie getrennt voneinander, in nationaler Eigenregie, ihre Haushaltspläne aufstellen und ausführen und dafür die nötigen Schulden machen: Mit ihren Nationalbudgets konkurrieren sie gegeneinander um die Attraktion von Kapital in ihren nationalen Wirtschaftsstandort, um Masse und Rate des für sie haushaltswirksamen Kapitalwachstums. Daneben kümmern sie sich in gemeinsamer Verantwortung um den Kredit der Gemeinschaft.
Diese Kombination einer formell supranationalen und im Kollektiv von allen Beteiligten wahrgenommenen Sorge um das zivile Herrschaftsmittel der Euro-Nationen, ihr Geld, mit dessen konkurrierender Verwendung als nationales Herrschaftsmittel durch die Einzelstaaten mit ihrem nach wie vor „heiligen Egoismus“ geht selbstverständlich nicht in einem sauberen Nebeneinander verschiedener politischer Aufgaben und Handlungsfelder auf, wie es der Funktionalismus des vereinbarten Geld- und Kreditregimes fiktiv unterstellt. Die gemeinschaftliche Verantwortung verwirklicht sich praktisch in wechselseitiger Überwachung – der Regierungen untereinander sowie durch die Kommission, der Kommission durch die Regierungen, der autonomen Zentralbank durch Kommission und Regierungen und umgekehrt; also in einem immerwährenden Streit um die Einhaltung der vereinbarten Benutzungsregeln durch die jeweils anderen und der Suche nach Kompromissen. Dieser EU-typische permanente Verhandlungs- und Verständigungsprozess schließt von Beginn an eine ziemlich tiefgreifende Unterscheidung der zusammenwirkenden Euro-Nationen ein: ihre Scheidung in solche, die in Gelddingen die Maßstäbe setzen und die anderen überwachen, weil sie mit ihrer größeren und erfolgreicheren Wirtschaftsmacht für die Schlagkraft des gemeinsamen Kredits und die Anerkennung seiner Münze im Weltvergleich der Währungen am wichtigsten sind und auch am meisten tun, und die übrigen, die als Teilhaber an einem Weltgeld von weit eindrucksvollerem Kaliber, als sie selber es je hingekriegt hätten, sich einiges an effektiver Überwachung gefallen lassen müssen. Am oberen Ende dieser Skala stand immer die BRD, die ihren Partnern das Angebot gemacht hat, ihnen die Währungskonkurrenz zu ersparen, in der sie immer wieder Einbußen erlitten haben, und sie stattdessen am Erfolg des deutschen Kapitalismus zu beteiligen, der durch Vorschriften beim Gebrauch des neuen Geldes unverwüstlich sichergestellt werden sollte, denen wiederum die anderen Folge zu leisten hätten. Die haben die komplementäre Spekulation angestellt und sich mehr in die mittleren bis unteren Ränge der politökonomischen Hierarchie einsortieren lassen.
Dabei sind die eher fragwürdigen ökonomischen Leistungen und Wirkungen dieses Überwachungswesens – vom guten oder schlechten kapitalistischen Sinn der finanzpolitischen Maßregeln für jede inskünftige nationale Haushaltsführung, auf die die Deutschen seinerzeit die Gemeinschaft festgelegt haben, ganz zu schweigen – nur die eine Seite der Angelegenheit. Immerhin betrifft das vereinbarte Geldregime ja die Freiheit der nationalen Standortverwalter bei der Beschaffung und Verwendung ihres zivilen Herrschaftsmittels, mit dem sie ihr Land samt einheimischer Klassengesellschaft regieren; auf diese Freiheit erstrecken sich also auch die Momente von Führungsmacht und Unterordnung, die in dem festgelegten Geldregime enthalten sind und die Streitkultur zwischen den kooperierenden Regierungen bestimmen. Was als funktionalistisches Arrangement von lauter marktwirtschaftlichen Sachnotwendigkeiten daherkommt, ist daher nur einerseits – das immerhin schon auch! – die unwiderrufliche Selbst-Einschwörung aller beteiligten Mächte auf den Dienst am kapitalistischen Erfolg als unbedingt verpflichtende Staatsräson. Dieses ganze quasi-sachliche Regime steht zugleich für das Kräfteverhältnis zwischen den Partnern; mit ihm ist die Machtfrage zwischen den formell gleichberechtigten souveränen Benutzern des einen Kreditgelds aufgeworfen und auch schon einiges darüber entschieden. Dieses Kräfteverhältnis mitsamt dem permanenten Streit darum ist – offiziell abgeleugnet, praktisch aber durchaus wirksam – der freilich gar nicht vollgültige vorläufige Ersatz für das politisch „reale Gemeinwesen“ unter einer höchsten Gewalt, zu deren Schaffung sich die Euro-Partner immerzu nicht durchringen können.
Mit diesem Arrangement kommt die Europäische Union einerseits ganz gut zurecht – deswegen hat sie es ja genau dazu gebracht. Dass sämtliche Teilhaber dieses Unternehmens unbedingt daran interessiert sind, zusammen mit den anderen mit einem Kredit, dessen kapitalistische Substanz sie alle gemeinsam mit ihrer Volkswirtschaft verbürgen, und mit einer entsprechend starken Weltwährung in der Konkurrenz der Nationen zu gewinnen, dass gleichzeitig aber keines dieser nationalen Individuen bereit ist, sich dem gemeinsamen Interesse definitiv unterzuordnen oder gar in ein neues reguläres souveränes Staatswesen hinein aufzulösen: das ist zwar ein Widerspruch; aber der hat in dem dauernden Ringen und Kräftemessen zwischen den nationalen Subjekten und den supranationalen Instanzen der Union eine offenkundig ziemlich haltbare Verlaufsform gefunden. Zu diesem institutionalisierten Machtkampf gehört allerdings andererseits, dass er wirklich ein dauernder Kampf und in einem doppelten Sinn nie fertig ist, die Sache also dauernd auch auf der Kippe steht: Die beteiligten Staaten kommen weder mit ihrem Kräfteverhältnis untereinander und ihrer Hierarchie noch mit dem jeweils erreichten Verhältnis zwischen ihrer kollektiven Wirtschaftsmacht und deren nationalem Nutzen jemals ins Reine. An beiden Streitfragen arbeiten sie sich unablässig ab; implizit in ihren sämtlichen, entsprechend doppelbödigen Auseinandersetzungen um Rechte und Restriktionen bei der Ausnutzung ihres Binnenmarktes im Allgemeinen und ihrer Zwölfer-Währung im Besonderen; daneben führen sie denselben Streit auf der höheren Ebene eines Ringens um die Fortentwicklung ihres Clubs, in der sie alle nicht weniger als dessen Bestandsbedingung sehen. In den einschlägigen Reform-Initiativen, den „Entwürfen“ zur „Zukunft Europas“ oder einer so auserlesenen Veranstaltung wie dem Konvent unter dem französischen Ex-Präsidenten Giscard d’Estaing geht es formell um die „beste Lösung“ für Funktionsprobleme der Union, um das „Subsidiaritätsprinzip“ und dessen optimale Verwirklichung, um die Kompetenzen von und eine Kompetenzabgrenzung zwischen den Gemeinschaftsorganen sowie zwischen denen und den nationalen Instanzen usw. In der Form wird aber nur immer derselbe Widerspruch durchgekaut, nämlich zwischen dem Bedürfnis nach einem schlagkräftigen Kollektiv-Subjekt, das der „Stimme Europas“ die Geltung verschafft, auf die alle einzelnen Mitglieder scharf sind, und dem Selbsterhaltungstrieb der nationalen Souveräne. Und tatsächlich geht es in all den so furchtbar komplexen Organisationsfragen und Verfassungsproblemen beständig um die Hierarchie zwischen den beteiligten Mächten, um deren Einfluss aufeinander und auf die Gemeinschaftspolitik, um Über- und Unterordnung – um das Kräfteverhältnis also, das in der europäischen Realität an der Stelle steht, an der kein Mitglied eine wirkliche Europäische Regierung haben will.
Dieser anhaltende Kampf um die Führungsmacht, der Gemeinschaft und in der Gemeinschaft – wobei immer eins fürs andere steht –, ist, wie gesagt, die Art und Weise, wie dieser Laden überhaupt funktioniert; funktional in dem Sinn, produktiv für die Bedeutung, die die Unions-Mitglieder gemeinsam in der Konkurrenz gegen Amerika und den ganzen Rest erobern wollen, ist er nicht. Von den engagierten Europäern selbst jedenfalls wird er – mehr oder weniger und mit je spezifischer nationaler Stoßrichtung – als entscheidender Wettbewerbsnachteil empfunden. Und das umso mehr, weil es ihrer Union schon längst nicht mehr „bloß“ in den zivilen Gefilden des Weltmarkts und der Weltwährungskonkurrenz um das hohe Ziel imperialistischer Erstklassigkeit geht:
II. Das europäische Imperium als Wille und Vorstellung – Europas Ordnungsmacht und Amerikas Übermacht
Die Europäische Union betätigt sich längst als Ordnungsmacht. Nicht bloß, was auch schon nicht zu verachten ist, nach innen, wo das „reale Gemeinwesen“ des grenzenlosen Binnenmarktes und des einen Geldes für die Gleichschaltung einstmals unterschiedlicher nationaler Sitten im kapitalistischen Erwerbsleben sorgt, „Schengen“ für eine einheitliche Polizeistaatskultur usw. Auch nach außen hin entfaltet die Union imperiale Wirkung. Schon allein durch das Gewicht ihrer Ökonomie und deren Interessen am und im Rest der Welt, umgekehrt durch das dadurch erweckte, manchmal alternativlose Bedürfnis der umgebenden und aller sonstigen Nationen, in Europa Geld zu verdienen und einzukaufen, Kapital anzulegen und Kredit aufzunehmen, ist sie längst auch zu einer politischen Größe geworden, an der kein anderer Staat vorbeikommt. Und so agiert sie auch; denn eben so ist der Zusammenschluss gemeint: Mit der Kombination ihrer nationalen Potenzen wollen die EU-Partner nicht bloß ihre Geschäftsbilanzen verbessern, sondern mehr Einfluss auf andere Nationen gewinnen – also denjenigen konkurrierender Dritter, Namen brauchen da gar nicht genannt zu werden, zurückdrängen –, Abhängigkeiten einrichten und ausbauen, ganze Regionen politisch ebenso wie ökonomisch auf sich hin orientieren, sich als Entscheidungsinstanz über Streitigkeiten wie Bündnisse auswärtiger Regierungen aufspielen, sogar über die inneren Verhältnisse fremder Staaten ein letztes Machtwort sprechen können. Die Nachbarn im Osten und Südosten des Kontinents sind die ersten Adressaten dieser Politik; mit deren Beitritt betreibt die „alte“ EU eine Neuausrichtung der ehemals sozialistischen Länder, die wahrscheinlich durchgreifender wirkt als alle einstige „Ostblock“-Disziplin, und komplettiert ihre Verfügungsmacht über den gesamten Bereich, den sie schon in ihrem Namen für sich in Anspruch nimmt. Der Balkan wird, kaum spalten munter gewordene Separatisten den alten jugoslawischen Staatsverband, als selbstverständliches Betätigungsfeld britisch-deutsch-französischer Oberhoheit über Europas Grenzen und Staatsgründungen entdeckt und behandelt. Die Ostsee wird als europäisches Binnenmeer in den „Brüsseler“ Zuständigkeitsbereich einbezogen; das Mittelmeer samt Anrainern ebenso; die Türkei wird in den Status eines Halb-Mitglieds hinein genötigt, von dem man sich von vornherein weniger kommerziellen Gewinn erwartet – türkische Hoffnungen in umgekehrter Richtung zählen ohnehin nicht – als vielmehr die politischen Dienste eines kooperativen islamischen Nachbarn und nützlichen Helfershelfers für europäische Zuständigkeitsansprüche im Nahen Osten. Und so weiter.
Die Entfaltung europäischer Ordnungsmacht nach außen ist in einem eigenen Kapitel des Maastricht-Vertrags über eine „Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik“ ausdrücklich vereinbart; dass damit Gewaltfragen aufgerührt werden, ohne „Sicherheitsidentität“ mit entsprechendem Waffenarsenal folglich gar nichts zu holen ist, ist den Beteiligten, diesem Vertragsteil zufolge, also völlig klar. Über einen eigenen Repräsentanten ihres kollektiven imperialistischen Ehrgeizes verfügen die EU-Europäer auch schon – und über Ambitionen, die sich allerdings, außer durch ihr hohes Anspruchsniveau, gleich durch mehrere gewaltige Widerhaken auszeichnen.
Der erste folgt aus dem schon benannten prinzipiellen Widerspruch, dass alle Beteiligten zur erstklassigen Weltmacht werden wollen – zu einer der beiden, die es dann fürs Erste nurmehr gäbe – und sich deswegen zusammenschließen, aber nicht bereit sind, der Gründung einer wirklichen derartigen Macht ihre Souveränität zu opfern. Dabei ist in dieser Angelegenheit, bei der Definition dessen, was als „vitales Interesse“ Europas gelten soll, und beim Aufbau der entsprechenden gesamt-EU-europäischen Ordnungsmacht mit dem vereinseigenen Funktionalismus, der Schaffung normativ wirkender Fakten, nicht viel auszurichten;[2] ein Kommissar und ein zusätzlicher „Mister GASP“, der den Wunsch nach machtvollem Auftreten der Union nach außen verkörpert, begründen keinerlei Einigungszwang in der Frage, mit welchem strategischen Ziel man wo und wie an welches Werk gehen soll und vor allem: wer dabei den Ton angibt. Zu einem Konzept, wie die Staatenwelt um Europa herum sortiert, auf welche europäischen Lebensinteressen sie ausgerichtet werden soll, welche Freund- und Feindschaften dafür zu eröffnen und zu riskieren, welche Mittel dafür wiederum nötig sind, oder auch nur zu einem entschiedenen gemeinsamen Willen, eine solche Strategie verbindlich zu definieren und die Welt damit zu konfrontieren, haben die Vorkämpfer eines christlich-abendländischen Ordnungsdienstes an der Menschheit es jedenfalls nicht gebracht.
Ganz zu schweigen von den Machtmitteln, die dafür gebraucht würden. Denn – dies der zweite große Haken an der so dringlich erwünschten EU-eigenen Ordnungsmacht – die Messlatte für imperialistische Kompetenz im angestrebten Sinn liegt enorm hoch. Und das nicht bloß, weil die Europäer potentiellen Ordnungsfällen mit fragloser Überlegenheit und keinesfalls in einem offenen Kräftemessen gegenübertreten wollen, sondern vor allem deswegen, weil die amerikanische Weltmacht mit ihrer Rüstung und ihrer eindrucksvollen Präsenz auf dem gesamten Globus die Maßstäbe dafür längst gesetzt hat und immer weiter in die Höhe treibt und damit das Gewalt-Niveau definiert, unterhalb dessen ein alternativer Imperialismus gar nicht erst anzutreten braucht. In dem Vergleich, und um den kommen die EU-Staaten mit ihrem großen Ehrgeiz einfach nicht herum, fehlt es ihnen bei weitem an der militärischen Substanz, mit der die Festlegung vitaler europäischer Weltordnungsinteressen und die Aufstellung entsprechender EU-dienlicher Weltfriedensbedingungen überhaupt zu machen wäre, ohne sich gleich an den von den USA gesetzten wirklichen Bedingungen einer friedlichen Weltordnung zu blamieren.
Dabei ist es nicht einmal bloß so, dass hinsichtlich eines einheitlichen imperialistischen Willens der Europäer Fehlanzeige zu erstatten und betreffs der nötigen Mindestausstattung mit Waffen ein beträchtlicher Mangel zu konstatieren ist. Der dritte große Haken ist der, dass die EU-Staaten – mit wenigen unwesentlichen Ausnahmen – bereits über eine kollektive „Sicherheitsidentität“ verfügen; eine solche sogar, die allen Ansprüchen an wirkliche Weltmacht genügt; dies allerdings aus einem peinlichen Grund: Es ist gar nicht ihre strategische „Identität“ als EU-Mitglieder, die sie da als ihre imperialistische „zweite Natur“ an sich haben, sondern eine, die aus ihrer ungekündigten Nachkriegs-Allianz mit den USA folgt. Als deren NATO-Partner sind sie schon, allerdings – das Kräfteverhältnis ist einfach so! – zu Amerikas Bedingungen, Teilhaber nicht nur irgendeiner, sondern der einzigen wirklich globalen strategischen Ordnungsmacht, stehen in dieser Eigenschaft gewissermaßen in Konkurrenz zu ihrem eigenen Bemühen, sich neben den USA als eigenständig weltmächtiges Imperium aufzubauen, und haben in ihrer relativen militärischen Schwäche einen handfesten Grund, daran festzuhalten. Zwar ist es gar nicht mehr so wie in den vier Jahrzehnten des Kalten Kriegs gegen die Sowjetunion, als Westeuropas kapitalistische „Mittelmächte“ mit ihrer alles andere als bescheidenen Ambition, die Sowjetmacht in Europa und den Einfluss ihres „realen Sozialismus“ weltweit zurückzudrängen, auf Gedeih und Verderb an ihre transatlantische Führungsmacht gebunden und mit ihrer unbedingten Bereitschaft, die totale und finale Weltkriegsdrohung gegen „Moskau“ mitzutragen, auf den „Schutz“ durch Amerikas „Atomschirm“ angewiesen waren. So verlogen die seinerzeit gültigen Bedrohungs-Szenarien auch damals schon waren: mittlerweile haben sie sich erledigt; die Allianz mit den USA ist für alle Beteiligten Gegenstand eines offenen Vorteils-Nachteils-Kalküls. Und da steht eben für die Europäer gegen den entschiedenen Nachteil, gar nicht Herr der eigenen Macht zu sein, der entscheidende Vorteil, mit der „Supermacht“ gemeinsame Sache zu machen; umgekehrt wäre Eigenmächtigkeit mit arg wenig eigener Macht verbunden.
Außerdem ist es aber auch so – dies der vierte Haken an Europas Willen zu eigener strategischer Größe –, dass keineswegs bloß die Europäer mit der NATO und dem nationalen Nutzen der supranationalen Allianz kalkulieren. Die Amerikaner tun das auch, mit noch eindeutigerem Ergebnis: Ihnen sichert die NATO nicht bloß machtvolle Präsenz in, sondern militärische Führungsmacht über Europa; mit dem Bündnis bauen die USA das wichtigste Drittel der kapitalistischen Welt zuverlässig in ihre eigene globale Strategie und in ihr Kontrollregime über den Globus ein. Auf dieses massive Eigeninteresse ihres großen Alliierten stoßen die Europäer mit ihrem doppeldeutigen Machtkalkül; für den Fall ernst zu nehmender Bemühungen um imperialistische Eigenständigkeit auf „gleicher Augenhöhe“ mit den USA haben sie mit Amerikas Einspruch zu rechnen.
Das alles ändert freilich nichts an der europäischen Hauptsache: Die Union braucht und will militärische Schlagkraft aus eigenem Vermögen, den Ausbau zur autonom handlungsfähigen, die „Weltlage“ – mit- – bestimmenden strategischen Macht; das ist und bleibt jenseits aller Haken und Ösen, aller Schwächen und Widersprüche ihr kategorischer Imperativ. Imperialismus, wie die EU-Partner ihn sich mit ihrem Zusammenschluss zum Ziel setzen, geht weder als halbe Sache, als bloß ökonomische Konkurrenz ohne Rivalität in Sachen Ordnungskompetenz und Gewaltmittel – die Europäer setzen nicht alles daran, gleichrangige Gegenspieler der USA in der Weltwirtschaft zu werden, um bei der Kontrolle der Geschäftsgrundlagen der globalen Konkurrenz, in der Gewaltfrage, bloße Vasallen Amerikas zu bleiben; noch funktioniert er kooperativ, als „Arbeitsteilung“ bei der Beherrschung der Staatenwelt, getrennt von dem Konkurrenzkampf, der um deren Benutzung tobt – auch wenn genau dies, Ironie der Geschichte, die historische Entstehungsbedingung und über lange Zeit die Geschäftsgrundlage für den Zusammenschluss der rivalisierenden Nationen Westeuropas zur EU war: dass die Gewaltfrage zwischen ihnen durch Amerikas Dominanz in der NATO geregelt war und die Europäer zusehen mussten, aber auch dafür sorgen durften, wenigstens auf dem Feld der zivilen Machtentfaltung, als Großmächte des Kapitals, mit der kapitalistischen Weltmacht Amerikas einigermaßen mitzuhalten. Nach dem Sieg über die Sowjetunion, für den Amerika und Westeuropa einander tatsächlich wechselseitig unbedingt gebraucht haben, kommen Europas Imperialisten um ihren Antiamerikanismus nicht mehr herum; in dem Maße, wie sie es mit ihrem Willen zur Gleichrangigkeit mit den USA ernst meinen, können sie es bei den doppeldeutigen Kalkulationen, mit denen sie sich immer wieder zur Einordnung ins transatlantische Bündnis bestimmen, nicht belassen. Dasselbe gilt für ihre interne Machtfrage: Wenn und weil aus der EU eine Weltmacht werden soll, kann es nicht dabei bleiben, dass alle Beteiligten, nicht zuletzt die beiden Atommächte im Club, zwar die Notwendigkeit eines einheitlichen strategischen Willens und militärischen Oberbefehls verspüren und beschwören, ihre unwiderrufliche Unterordnung aber ablehnen. Und dass zur sachgerechten Ausstattung eines solchen euro-strategischen Oberkommandos eine Rüstung gehört, die dem Anspruchsniveau der Europäer entspricht, also zur Definition und Durchsetzung eigener vitaler Interessen und Ansprüche an den Weltfrieden befähigt, versteht sich sowieso.
Also widmet sich die Union den Notwendigkeiten ihrer für überfällig befundenen Militarisierung und den Widerhaken ihrer imperialistischen Bedarfslage. Und sie tut dies, ihrer noch längst nicht ausgeräumten Schwäche und ihrer bleibenden Widersprüchlichkeit gemäß, auf ihre angestammte verlogen-pragmatische Art: Die Partnerstaaten verleugnen die harte Alternative, die sich ihnen im Verhältnis zueinander wie zu den USA unabweisbar aufdrängt – Trennung oder Unterwerfung. Die Dilemmata ihres imperialistischen Programms definieren sie so lange zu gar nicht so substanziellen politischen Problemen herunter, bis ihnen ein Konsens, untereinander wie mit Amerika, machbar erscheint. Das geht dann so – am „Fall“ Jugoslawien ist das exemplarisch mit allen dazugehörigen Winkelzügen und in all seinen verrückten Feinheiten „herausgearbeitet“ und durchgespielt worden: Wo ein hinreichend bedeutendes Unions-Mitglied die Notwendigkeit und Gelegenheit entdeckt, den Willen seines Vereins zur Ordnungsmacht zur Geltung zu bringen und strategische Statur zu gewinnen, da streiten sich die drei bis fünf Stärksten um die Federführung bei der Lagedefinition, der Herbeiführung einer Entscheidungssituation, der fälligen Entscheidung und bei deren Durchführung und einigen sich unter dem „Druck der Umstände“ auf eine alsbald wieder umstrittene Kompromisslinie. Dabei wird ein Mangel an verfügbaren Ordnungskräften – an Truppen und Rüstung wie an Bereitschaft der nationalen Instanzen, Kräfte zur Verfügung zu stellen – sogleich spürbar; er wird nämlich schon bei der Definition der jeweils anstehenden Aufgabe und erst recht bei deren Bewältigung zur Schranke. Um trotzdem den unionsinternen Streit um Führungsbefugnis in einen haltbaren imperialistischen Beschluss zu überführen und um sich damit nicht zu blamieren, die benötigten Gewaltmittel also auch wirklich zu mobilisieren, greifen die Ordnungsgewaltigen der EU auf die NATO zurück und bemühen sich, Amerikas überlegene Potenzen für die eigenen Vorhaben zu funktionalisieren. Soweit ihnen das gelingt, geht damit freilich auch die Federführung an ihren großen Bündnispartner über, der seinerseits wenig Zweifel daran lässt, dass die Indienstnahme fremder Kräfte für eigene Belange nur in umgekehrter Richtung richtig funktioniert. Dieses Ergebnis interpretieren die betroffenen Europäer als gar nicht so schlechten Kompromiss; notfalls definieren sie in den Konsens, den Amerika ihnen aufnötigt, ihre eigenen imperialistischen Gestaltungsinteressen hinein und versuchen, aus der hergestellten Lage für sich das Beste zu machen. Daneben erneuern sie ihren Entschluss, gemeinsame europäische Rüstungsprogramme zu verfolgen und – „schon einmal“ – wenigstens unterhalb der eigentlichen politischen Entscheidungsebene „Kommandostrukturen“ für eine Unions-eigene Interventionstruppe aufzubauen, für die im Bedarfsfall multi-, bi- oder rein nationale Kontingente bereitgestellt werden sollen; das ist allemal zu haben, auch ohne Einigung auf eine definitive europäische „Sicherheitsidentität“ und ohne souveräne Entscheidungsinstanz. Dass sie damit im Prinzip in Konkurrenz zu sich selbst als NATO-Mitgliedern und in Gegensatz zur Führungsmacht ihrer transatlantischen Allianz treten, dementieren die EU-Imperialisten in aller Form und berufen sich für die Vereinbarkeit ihrer Emanzipationsbemühungen mit ihrer Bündnistreue auf die Kritik der amerikanischen Führungsmacht selber an ihren mangelhaften militärischen Fähigkeiten; auf der Ebene muss der Widerspruch zwischen EU-Autonomie und US-Oberkommando ja tatsächlich noch nicht praktisch werden. Bei alledem ist freilich eines klar: Mit jedem Fortschritt, den sie so zu Stande bringen, entschärfen die EU-Staaten nicht, sondern verschärfen sie die Machtfrage, und zwar sowohl die untereinander als auch die zwischen ihrer Union und den USA. Sie arbeiten sich auf das Ergebnis hin, dass „es“ nicht mehr so weiter gehen kann wie bisher, ohne dass es allerdings schon ganz anders vorangehen könnte mit einem eigenständigen europäischen Unions-Imperialismus.
Bevor sie jedoch in die Verlegenheit kommen, von sich aus ein solches Fazit ziehen zu müssen, wird es ihnen von anderer Seite präsentiert: Die globale Wirtschaftskrise und das Kriegsprogramm der USA stürzen das EU-Projekt selbst in eine Krise.
B. Die doppelte Blamage der EU durch die kapitalistische Krise und Amerikas Feldzug gegen ‚den Terrorismus‘
I. Euro-Land in Zeiten der Kapitalentwertung: Die Pleite eines politökonomischen Erfolgsversprechens
Auch in Europas kapitalistischen Musternationen wächst „die Wirtschaft“ nicht mehr: Die Überproduktion von Kapital schlägt um in Entwertung; die Stockung des Geschäftsgangs dezimiert Reichtum und Reichtumsquellen; und der zu ansehnlichen Teilen erwerbslosen „Erwerbsbevölkerung“ geht es auch in ihren noch erwerbstätigen Abteilungen gar nicht gut. Da diese Bevölkerung aber europaweit trotzdem kaum bis gar keine Probleme macht – sogar das Meckern hat die bessere Gesellschaft sich reserviert –, können die Regierenden sich mit allem Nachdruck ihrem Hauptproblem widmen: Die nationalen Haushalte gehen nicht mehr auf; wo leichteres Regieren mit selbsttätig wachsenden Staatseinnahmen und abnehmender Kreditlast geplant war, müssen schöne, Wachstums-fördernd gedachte Vorhaben gestrichen oder verschoben, komplizierte Umschichtungen im Sozialhaushalt des Gemeinwesens zu Lasten der zunehmenden unproduktiven Armut im Land vorgenommen und trotzdem mehr Schulden gemacht werden, nur um das Nötigste und mit Gesetzeskraft Beschlossene bezahlen zu können.
Bei all ihren Drangsalen bleibt den Akteuren der politischen Ökonomie des Euro immerhin das Eine erspart: Eine Abrechnung untereinander, die wechselseitige Präsentation der Außenbilanz ihrer nationalen Misserfolge – heutzutage üblicherweise in der Form eines kritischen Leistungsvergleichs der Nationen an ihrem Kreditgeld, also einer Bewertung ihrer Währung, vorgenommen durch die dazu ermächtigte Internationale der Geldhändler – findet nicht statt. Diesen Effekt einer wirklich supranationalen Gemeinschaftswährung haben deren Schöpfer allerdings nur einerseits gewollt. Die daraus erwachsende Freiheit der Euro-Staaten, zu Lasten des Gemeinschaftskredits womöglich unproduktive Schulden zu machen – und nicht mehr, wie bisher, auf Rechnung ihres nationalen Kredits und zum Schaden ihres jeweiligen Nationalgeldes –, haben sie andererseits überhaupt nicht gewollt. Deswegen haben sie sich und einander Grenzen für die offizielle staatliche Schuldenmacherei – die „Maastricht-Kriterien“ – verordnet, ein Überwachungsverfahren beschlossen und sogar einen Ersatz für die ansonsten von den Geldmärkten in Permanenz vorgenommene Abrechnung zwischen den Nationen, den kritischen Währungsvergleich, eingerichtet; einen Ersatz, der ganz ungeschminkt klarstellt, dass es bei diesem Vergleich, den sie untereinander abgeschafft haben, um nichts anderes als Enteignung auf der einen Seite, die Aneignung nationalen Eigentums auf der anderen Seite geht: Ein Euro-Staat, der zu viele Schulden macht und dafür keine für stichhaltig befundene Entschuldigung vorweisen kann, muss zusätzlich zu den Defiziten, derer er schon nicht Herr wird, zahlen, nämlich schlicht Strafgelder in Höhe des Betrags, um den seine Defizite das erlaubte Maß überschreiten, an die Gemeinschaftskasse abführen. Mit diesen Kriterien geraten nun in der Krise etliche Euro-Länder in Konflikt; und zwar gar nicht bloß, wie ursprünglich gedacht, die am unteren Ende, sondern auch die zwei an der Spitze der politökonomischen Hierarchie. Pflichtschuldig setzt die Kommission gegen Portugal und, ausgerechnet, Deutschland das vorgesehene Defizit-Verfahren in Gang und verwarnt Frankreich – dies die vertragsgemäße Art der Abmahnung wegen mangelnden nationalen Erfolgs beim Gebrauch des gemeinsamen Kreditgelds als Wachstumsmittel.
Dies tut die Kommission jedoch nicht ohne eine gleichzeitige Klarstellung ihres Chefs, mit der dieser den verletzten „Maastricht-Kriterien“ den Charakter von Schönwetter-Richtlinien bescheinigt: in Wachstumszeiten leicht zu beschließen und einzuhalten, unvollziehbar jedoch, wenn „Krise herrscht“. Und tatsächlich sind die vorgegebenen Richtgrößen für eine „solide“ Haushaltsführung unter Krisenbedingungen nicht mehr das, als was sie in besseren Zeiten festgelegt und beschlossen worden sind. Gedacht waren sie als Vorkehrung gegen einen „Missbrauch“ des Gemeinschaftskredits, vor allem durch die Schwächeren, die sich so viel Kredit aus eigener Kraft gar nie hätten leisten können, in der Konkurrenz der Gemeinschafts-Mitglieder um Kapitalwachstum am jeweils eigenen Standort und zum Schaden des gemeinsamen Geldes. Jetzt werden die Kriterien zur Schranke für den Vollzug von Haushalten, in denen es um „leichtsinnige“ Vorschüsse auf ein unsicheres Wachstum in kapitalschwachen Ländern gar nicht geht; zur Fessel ausgerechnet für die stärksten Wirtschaftsmächte. Statt das gemeinsame Geld zu stärken, behindern sie die ökonomische Macht derjenigen, von denen der Euro und die darin gemessene Kreditmacht der Union am meisten abhängt.
Natürlich sind im Grunde nicht die Kriterien das Hindernis, mit dem Europas Haushaltsminister sich herumplagen; genau so wenig freilich ist nationaler Missbrauch, wie er durch sie ausgeschlossen und notfalls geahndet werden sollte, das Problem. Das liegt in den Umständen, unter denen die vereinbarten Defizit-Grenzen als Beschränkung wirken; und es betrifft gar nicht bloß die akut betroffenen Defizitländer. Mit der Krise erleidet das Erfolgsversprechen eine Blamage, das mit der Einführung des Euro verbunden war und das man durch die „Maastricht-Kriterien“ geldpolitisch abzusichern, quasi bürokratisch zu untermauern gedachte. Mit der neuen Währung sollte, nach dem Vorbild des deutschen „Wirtschaftswunders“, Europa-weit ein solches Wachstum losgehen, dass die daran partizipierenden Nationen ganz von selbst aus ihren Schulden herauswachsen und gar kein Problem damit haben würden, die beschlossenen Stabilitätsbedingungen für die Gemeinschaftswährung zu erfüllen; das war die Verheißung, die mit der Maxime: „So stark wie die Mark!“ in die Welt gesetzt wurde.
Tatsächlich ist die Sache schon von Beginn an ein wenig anders gelaufen. Mit der Einführung des neuen Geldes war bereits eine Art internationaler Abrechnung verbunden: eine kritische Besichtigung der frischen Ware, d.h. der Haltbarkeit der für sie abgegebenen bzw. in Aussicht gestellten Garantien, der ökonomischen Macht der beteiligten Kapitalstandorte sowie des politischen Willens der zuständigen Regierungen zu ihrer Einlösung; und die ist ziemlich heftig gegen den Euro ausgefallen. Im Verhältnis zur amerikanischen Weltwährung hat das neue Kreditgeld den darin gemessenen und existierenden Reichtum Europas erst einmal um ein rundes Fünftel verringert. Davon ist mittlerweile zwar die Hälfte wieder aufgeholt; Europas Geld ist als Geschäftsmittel der kapitalistischen Welt einigermaßen etabliert und, was den Wechselkurs zum US-Dollar betrifft, „so stark, wie die D-Mark“ schon gar nicht mehr war. Doch das eben nicht, weil das Geschäft mit der neuen Währung, die Verwandlung des von den Euro-Ländern in die Welt gesetzten Kredits in akkumulierendes Kapital so unschlagbar flott und gediegen verlaufen würde, sondern peinlicherweise aus dem entgegengesetzten Grund: Gar nicht viel anders als Dollar und Yen wird Europas Geld im Verhältnis zu den weltweit überakkumulierten Kapital- und Kreditmassen zu wenig angewandt; es wird gegen den in die Krise geratenen kapitalistischen Verwertungsprozess festgehalten. Mit seiner Stabilität und seiner zurückgewonnenen Dollar-Parität misst der Euro keine Kapitalakkumulation, sondern eine allgemeine „Stagnation“, die die nationalen Haushalte, und zwar gerade die größten, ins Minus treibt. Nach der Abwertung im 1. Kapitel handelt das 2. Kapitel der Geschichte der europäischen Gemeinschaftswährung, genauso Drehbuch-widrig, von einer großen Entwertung des Kapitals, dem sie doch auf die Sprünge helfen sollte; von außerplanmäßiger Zusatzverschuldung der öffentlichen Budgets, die gerade tendenziell entschuldet werden sollten; von Kriterien, die unhaltbar werden, weil das Wachstum fehlt, für das sie die Erfolgsmaßstäbe setzen sollten: Die Macht des neu geschmiedeten kollektiven Euro-Landes, kapitalistisch erfolgreich Kredit zu schöpfen, ist, kaum fertig etabliert, selber in der Krise.
Die Folgen bleiben auf die nationalen Haushalte und das damit dirigierte Innenleben der Euro-Länder nicht beschränkt. Das Geldregime selber, auf das die Partner sich geeinigt haben, wird von allen Seiten in Frage gestellt, seit es sich auf Grund der allgemeinen öffentlichen Finanznot als beschränkender Eingriff in die Haushaltspolitik der Nationen negativ bemerkbar macht. Die einen wollen „Investitionen“ mit Schulden über die Maastricht-Grenze hinaus finanzieren dürfen, andere ihre Aufrüstung; Naturkatastrophen, die in der Marktwirtschaft folgerichtig zu Finanzierungsproblemen ausarten, die nicht die Opfer, sondern den Staatshaushalt strapazieren, sollen ein Recht auf Ausnahmen von der Haushaltsregel begründen; Fristen sollen gedehnt, Abrechnungsposten nicht so genau genommen werden… Wie unsinnig oder zweckmäßig solche Anträge und Vorschläge nach dem Handbuch der Finanzministerei im einzelnen auch immer sein mögen: Angriffe auf die Konstruktion, die die EU-Partner an die Stelle einer einheitlichen Geldhoheit gesetzt haben, sind sie in jedem Fall. Sie wirken zersetzend auf das Regime, das die Kreditschöpfung in den Euro-Ländern reguliert und deren Stichhaltigkeit der globalen Geschäftswelt gegenüber formell garantiert. Notwendigerweise kommen Befürchtungen auf über eine allgemeine Auflösung der eigentlich festgelegten Haushaltsdisziplin. Und wie heuchlerisch diese Sorgen nun auch wieder sein mögen und wie albern die wirtschaftspsychologischen Mutmaßungen über die zu erwartende „Reaktion der Märkte“, so zeugen sie doch von einer tatsächlich drohenden „Gefahr“, auch wenn die dann doch wieder niemand „herbeigeredet“ haben möchte: Die offenkundige Fragwürdigkeit des europäischen Kredit- und Geldregimes könnte am Ende in einen von der Geschäftswelt praktisch vollzogenen Offenbarungseid über die Unhaltbarkeit der gesamten Konstruktion eines supranationalen Nationalkredits ausarten. Das ist die eine, die politökonomisch prekäre Seite der Initiativen zur Aufweichung des Maastrichter Regelwerks.
Daneben, dies ihre andere Seite, provozieren sie Unions-interne Streitigkeiten mit ziemlich einschneidenden Konsequenzen für die wirklichen Macht- und Unterordnungsverhältnisse innerhalb des europäischen Vereins, die mit dem Formalismus des Geldregimes von Beginn an als dessen tieferer politischer Sinn und Zweck verknüpft waren. Die scheinbar so unverrückbare Hierarchie der europäischen Wirtschaftsmächte, mit der BRD nicht bloß als größtem Kapitalstandort, sondern als Stabilitäts-Garant und „Wachstums-Lokomotive“ an der Spitze, wird nachdrücklich in Zweifel gezogen. Die eindeutige Unterscheidung und das klare, unter Vorbehalten aller Art doch allseits akzeptierte Kräfteverhältnis zwischen Aufsicht führenden und beaufsichtigten Partnerstaaten wird gründlich in Frage gestellt. Dem Nationen-übergreifenden politökonomischen Gemeinwesen kommt der Quasi-Ersatz für eine wirkliche gesamteuropäische Geldhoheit abhanden – und den Deutschen ihre quasi sachgesetzlich fundierte Führungmacht unter formell gleichen Währungspartnern. Die – ohnehin keineswegs allseitig begrüßte, aber auch nicht ganz unrealistische – Aussicht, mit Hilfe der Maastricht-Konstruktion auf dem Weg der friedlichen Eroberung des Kontinents durch seine ökonomisch wichtigsten Führungsmächte und zu einer höheren Stufe imperialistischer Handlungsfähigkeit voranzukommen, hat sich damit fürs Erste erledigt.
Stattdessen finden Fortschritte anderer Art statt: weg vom Streit der Regierungen um die Perfektionierung Europas als Kapitalstandort und Wachstumsregion unter besonderer Berücksichtigung des jeweils eigenen Herrschaftsbereichs, hin zu einer Krisenkonkurrenz um nationale Sonderrechte zur Schadensvermeidung und Verlustabwälzung, für die sich auch die mächtige BRD, bisher mehr auf die Rolle der sowieso überlegenen Führungsmacht und des allemal zahlungsfähigen und im Notfall auch zahlungsbereiten Schlichters und Schiedsrichters abonniert, nicht mehr zu vornehm ist. Den „Nettozahler“ haben auch frühere Bundesregierungen sich heraushängen lassen, eben zur Untermauerung ihres Rechts auf Gefolgschaft der Finanzschwächeren; jetzt wird mit Blick auf das drohende Defizit-Verfahren gegen Deutschland mit einer Kündigung dieser Rolle gedroht und eine massive Kürzung des Agrarhaushalts der Union eingefordert, über den sich der größte Teil des Saldos zu Lasten der BRD errechnet. Mit der Kommission – und über diese mit dem Rest der Gemeinde – führt die Berliner Regierung einen Streit nach dem andern, die allesamt erkennbar den Nöten der Krise und keiner offensiven Weltmarktstrategie entstammen: um spezielle Konkurrenzvorteile wie die überkommenen Staatsgarantien für Landesbanken; um besondere „Marktmechanismen“ im Autohandel; um eine auf deutsche Spezialbedürfnisse zugeschnittene Richtlinie zur Rechtslage bei Unternehmens-Übernahmen; um eine „Industriepolitik“, die dem deutschen Standort im Allgemeinen und dem ostdeutschen im Besonderen nützt… Umgekehrt kämpfen die Partner für ihre Bauern, für ihren Beitragsrabatt, für ihre Strukturförderung…
Und alle gemeinsam, wenigstens mal an diesem einen Punkt, wehren sich gegen neue Belastungen der Gemeinschaftskasse und damit ihres jeweiligen sei es Nettozahler-, sei es Nettoempfänger-Haushalts durch die Osterweiterung der EU. Die Beitrittskandidaten aus dem Osten will man zwar nach wie vor unbedingt dabei haben, schon allein aus dem übergeordneten ordnungspolitischen Grund einer definitiven „Zusammenführung“ des abendländischen Kontinents unter „Brüsseler“ Regie. Die Spekulation auf eine wunderbare Wachstumssphäre für Kapital aus westeuropäischen und vor allem deutschen Landen hat sich allerdings so ziemlich erledigt – was nicht an den Kandidaten und schon gar nicht an deren Vorbehalten gegen eine Übernahme zu denkbar schlechten Bedingungen liegt. Das einzigartige ökonomische Lebensmittel aller Staaten und Völker, das Kapital, kann mit Leuten und Reichtumsquellen schon an seinen angestammten Standorten nichts Profitliches mehr anfangen, also bis auf Weiteres auch nichts in slawischen Billiglohnländern; die demokratischen Herren des christlichen Abendlands kommen schon mit ihrer bisherigen Haushaltsführung nicht mehr klar und haben mit dem beschlossenen Anschluss der Osteuropäer vor allem ein Kostenproblem. Für die Beitrittsländer stellt sich umgekehrt der erhoffte Aufbruch „nach Europa“ als ein Abbruchunternehmen dar, das die längst erledigt geglaubte Frage wieder aufkommen lässt, wie sie ihre „Heimkehr“ in den westlichen Kulturkreis überhaupt aushalten sollen. So gerät das wichtigste laufende Gemeinschaftsunternehmen der EU durch die Krise selber in die Krise.
Ganz zu schweigen von der noch viel kostspieligeren „Zukunftsaufgabe“, die EU militärisch handlungsfähig
zu machen. Noch ist gar nicht viel Konsens erzielt über Konstruktion und Ausstattung des „europäischen Pfeilers“ einer „globalen Sicherheitsarchitektur“, zu dem man sich im Prinzip unbedingt hochrüsten will; schon gleich nicht über die Aufteilung der Kosten, von denen auf jeden Fall feststeht, dass sie schon dann enorm hoch ausfallen, wenn bloß der Rückstand gegenüber der Führungsmacht nicht im bisherigen Tempo weiter wachsen soll. Immerhin sind ein paar erste funktionelle Schritte hin zu einer kollektiven Streitmacht und einer gemeinsamen Rüstung beschlossen – und nun fehlt das Geld; die Partner gewähren sich im Zeichen ihrer Krisenhaushalte Aufschub bei ihrer Militärreform und bei der Waffenbeschaffung, einmal mehr wird die unbedingt gewollte und doch nur sehr bedingt betriebene Emanzipation von Amerika vertagt.
Und genau da werden die EU-Staaten von ihrem amerikanischen Freund mit einer „Lage“ und mit Anforderungen konfrontiert, die nicht bloß ihre Krisenhaushalte absehbarerweise völlig über den Haufen werfen.
II. Europas Imperialismus und Amerikas Krieg: Das tote Ende eines Schleichwegs zur Weltmacht
Ein gutes Jahrzehnt nach dem Triumph der westlichen Weltkriegspartei über den bis zur Selbstaufgabe friedfertigen sowjetischen Feind sehen sich die europäischen Teilhaber dieses historischen Sieges, die EU-Staaten, einer Bedrohung ihrer vitalen Interessen ausgesetzt. Die Sicherheit ihres Zugriffs auf Geldvermehrungsquellen in aller Welt und ihrer Machtpositionen auf dem Globus wird zunehmend gefährdet. Und das weniger durch die Feinde, die der amerikanische Bündnispartner als Verbrecher an der zivilisierten Menschheit namhaft macht, auf einer postkommunistischen „Achse des Bösen“ verortet und – wie ihre faschistischen und sozialistischen Vorläufer – zur Vernichtung bestimmt, als vielmehr durch die neue Freiheitsmission der USA selber: den angekündigten und bereits begonnenen „lang andauernden“ Feldzug gegen das universelle Terror-Potential samt unterstützenden „Schurken-Staaten“, das nach den Feststellungen der westlichen Führungsmacht in dem von ihr verbürgten Zustand namens Weltfrieden seine Brutstätte hat.
Denn damit erheben die USA eine terroristische Aktivität, die erklärtermaßen und unmissverständlich gegen sie, nämlich ihre bedenkenlos eigennützige und selbstbezogene Herrschaft über Staaten und Nationalökonomien gerichtet ist, ganz ausdrücklich und mit praktischer Wirkung in den Rang einer Menschheitsgefahr, von der alle Staatsgewalten der Erde sich, und zwar unmittelbar und als vom größten aller denkbaren Übel, betroffen sehen und für deren Ausrottung sie alles andere stehen und liegen lassen sollen. Sie erlassen praktisch ein Verbot, auch und gerade an die Adresse ihrer größten und wichtigsten Verbündeten, in der Sicherheitsfrage andere Prioritäten zu setzen oder überhaupt andere Gefahren auszumachen; keiner Nation ist es gestattet, den antiamerikanischen Terrorismus ebenso für ein Problem Amerikas zu halten wie, beispielsweise, den antibritischen der IRA für eines der Briten und Iren oder den antispanischen der ETA für ein spanisches; erst recht darf keine Regierung etwas, was auch immer, dafür tun, dass das eigene Land gar nicht erst zur Zielscheibe Amerika-feindlich gemeinter terroristischer Anschläge wird. Und so etwas lassen sich verantwortungsbewusste Sicherheitspolitiker, schon wegen ihrer unteilbaren und unveräußerlichen Verantwortung für das eigene Gewaltmonopol, normalerweise nicht gefallen. Nun haben die Kämpfer für Law & Order in Schengen-Land immerhin gute Gründe, die Stoßrichtung des antiamerikanischen Terrors auch, abgeschwächt, auf sich zu beziehen; schließlich sind sie die prominentesten Mitmacher, Nutznießer und Unterstützer des von den USA über die Welt verhängten Ordnungsregimes. Sie zögern daher nicht, die „üblichen Verdächtigen“ unter effektivere Aufsicht und „verstärkten Fahndungsdruck“ – der demokratisch-rechtsstaatliche Ausdruck für staatssicherheitspolizeiliche Verfolgung – zu setzen. Der amerikanische Anspruch geht aber noch viel weiter: Die Staatenwelt soll anerkennen, dass sie Amerikas Terrorismusproblem nicht bloß irgendwie auch hat, sondern von gar keiner anderen und schon gar nicht von einer größeren Bedrohung heimgesucht wird; außerdem, dass diese Bedrohung auch von Staaten ausgeht, die nach Washingtoner Urteil selber antiamerikanisch oder der Unterstützung des gewaltsamen Antiamerikanismus schuldig sind; und schließlich, dass diese „Lage“ ein Recht der USA auf Präventivkrieg begründet. Alle Staaten haben sich, bei Strafe „abgekühlter“ bis womöglich feindlicher Beziehungen Amerikas zu ihnen, mit all ihren bewaffneten Kräften in eine neue Weltkriegsfront zwischen guten, zivilisierten Nationen und bösen „Schurkenstaaten“ einzureihen, deren jeweiliger Verlauf und aktuelle Brennpunkte von der US-Regierung festgelegt und den Partnern dann schon mitgeteilt werden. Nichts von diesem Ansinnen stellen die USA irgendwie zur Diskussion, machen schon gar keinen Antrag an die „Völkergemeinschaft“ daraus. Sie eröffnen die gemeinte Front exemplarisch mit der gewaltsamen Beseitigung des Taliban-Regimes in Afghanistan und der Inszenierung einer gleichartigen Kriegsaktion gegen Saddam Husseins Irak, entfalten einigen erpresserischen Druck, um das „Lager“ der „Gutwilligen“ zu konsolidieren. Und damit schädigen und blamieren sie die EU; sowohl in ihrer Eigenschaft als imperialistische Ordnungsmacht als auch in ihren diesbezüglichen Ambitionen; und ökonomisch außerdem.
Der ökonomische Schaden betrifft zum Einen die Weltwirtschaft im Ganzen, also deren europäische Prominenz ganz besonders: Schon die Ankündigung eines Feldzugs von unbestimmter Dauer und Ausdehnung einschließlich allfälliger Vorbeuge-Kriege verunsichert das weltweite Geschäftsleben, das ohnehin schon krisenhaft darnieder liegt; jede tatsächlich anberaumte Militäraktion vernichtet nicht bloß Land und Leute, was Imperialisten nicht irritieren darf, sondern auch die damit schwer trennbar verbundenen Geschäftsgelegenheiten und bringt laufende Geschäfte zum Erliegen, was auch hartgesottene Imperialisten schon mal am Nutzen gewaltsamer Ordnungsstiftung zweifeln lässt. Und speziell der angesagte Krieg inmitten der wichtigsten Ölregion der Welt birgt Preisrisiken für den Energierohstoff der kapitalistischen Weltwirtschaft, die sich das europäische Wirtschaftsimperium gerade in seiner derzeitigen Verfassung gerne ersparen würde. Umso härter trifft die Europäer auf der anderen Seite die finanzielle Zumutung, die mit dem Anspruch der USA auf Mithilfe bei den anstehenden Kriegen an sie ergeht: Inmitten ihrer staatlichen Geldnot sollen sie ihren Krisenhaushalten die Lasten unkalkulierbarer Waffengänge aufladen und um der Sache des Guten willen alle Konditionen wegschmeißen, die sie sich für den Erfolg ihrer Euro-Ökonomie, ihr kollektives ökonomisches Wachstum, verordnet haben, und alle Rücksichten vergessen, die ihnen in der Krise erst recht vernünftig und eigentlich unerlässlich vorkommen.
Dieser zweifache ökonomische Schaden wäre nicht der Rede wert – so wie er die davon genauso betroffenen Amerikaner ja auch nicht weiter irritiert[3] –, wenn die EU-Staaten selber, aus eigenem vitalen Interesse und strategischen Kalkül, einen Weltkrieg, gegen „den Terrorismus“ oder gegen wen auch immer, für fällig erachtet hätten. Dann wäre der Übergang von der Bewirtschaftung der Krise zur Kriegswirtschaft eine reine Selbstverständlichkeit; die Frage, ob man sich Schadensfälle und finanzielle Lasten leisten kann, würde sich nicht stellen, weil entschieden wäre, dass man sie sich leisten muss. Die Betroffenheit der Europäer, ihre Sorge um zusätzliche weltweite Geschäftsschädigung und um die Lasten des Krieges wie seiner absehbaren wüsten Hinterlassenschaft – des deutschen Außenministers Fischer so ungemein kritische Frage nach dem „Danach“! –, macht umgekehrt deutlich, dass sie sich Amerikas Feldzug nicht nur nicht bestellt haben, sondern ihn auch nicht als die eigene „Lage“ akzeptieren: Sie sind nicht in einem Kriegszustand, der ihnen ihre Agenda, auch in der Finanz- und Wirtschaftspolitik, unwidersprechlich diktieren würde. Dass die USA einen solchen „Zustand“ ausrufen, kann die EU daher schon ökonomisch nicht gut verschmerzen. Noch schmerzlicher trifft sie freilich der bereits aktenkundige politische Schaden, der ihnen daraus erwächst: die Blamage der Ordnungsmacht, die sie sich schon erobert hat und weiter ausbauen will.
So ist die EU bereits aus den Entscheidungen über das weitere „Schicksal“ des Nahen Ostens komplett ausgemischt – ausgerechnet der ökonomisch so lebenswichtigen, politisch so heißen und in so brisante gewaltsame Auseinandersetzungen verstrickten Region vor ihrer südöstlichen „Haustür“, in der sie unbedingt eine wichtige Rolle spielen will. Israel führt täglich vor, dass es sich mit seiner amerikanischen Lizenz zur Terrorismusbekämpfung nach eigenem Gutdünken alles erlauben kann, was Großisrael-Fanatiker sich je erträumt und arabische Nationalisten schon immer befürchtet haben, europäische Einsprüche und Ermahnungen dagegen weniger als gar nichts zählen, die arabische Seite sich davon also auch weniger als nichts erwarten kann. Europas Einmischungswille blamiert sich gründlich; nicht eigentlich an der Intransigenz Israels, vielmehr an der Macht Amerikas, das an die israelische Regierung die Konzession vergeben hat, in eigener Regie einen Nebenschauplatz des angesagten antiterroristischen Weltordnungskriegs der USA zu organisieren. Und das ist sogar bloß ein Unterpunkt in der Klarstellung der nah- und mittelöstlichen Machtverhältnisse, die den Europäern mit der politischen Aufmischung der Region durch die Supermacht im Vorfeld eines eventuellen neuen Irak-Krieges bereits widerfährt – auf nichts, auf kein Stück des amerikanischen Vorgehens haben sie irgendeinen spürbaren Einfluss – und die mit dem projektierten Feldzug zur Beseitigung des irakischen Regimes erst noch so richtig auf sie zukommt – selbst für die Übernahme von Folgelasten können sie sich nicht selber zuständig machen, sondern brauchen eine amerikanische Einladung; und die gestattet ihnen mit Sicherheit nicht einmal einen Bruchteil der Eigenmächtigkeit, die das kleine Israel sich herausnimmt. Mit einem Krieg gegen den Irak nach Ansage und Drehbuch der USA wäre zudem nicht bloß über die vielleicht wichtigste Nachbarregion Europas politisch entschieden und die Nichtigkeit europäischer Ordnungsmacht an dieser Stelle festgestellt, sondern das maßgebliche Paradigma dafür in der Welt, wie es überhaupt und weltweit um den Einfluss der EU auf die Machtverhältnisse in und zwischen fremden Staaten bestellt ist, wenn die USA – was erklärtermaßen jederzeit und überall der Fall sein kann – zur prophylaktischen militärischen Gefahrenabwehr schreiten: Er ist gleich Null.
Einfach ohnmächtig sind und sehen sich die Herren des europäischen Quasi-Imperiums deswegen natürlich nicht. Sie planen weiterhin ihre eigene 60000 Mann-Eingreiftruppe mit Zugriffsrecht auf NATO-Einrichtungen, auch wenn sie damit noch nicht einmal über den Einspruch der Türkei hinwegkommen, die darüber mitbestimmen möchte. Und sie rechnen sich daneben durchaus einen global wirksamen Einfluss aus – an der Stelle, die sie damit allerdings auch als die entscheidende anerkennen: Sie sind wichtig für die Weltordnungspolitik der USA. Deren Fähigkeit, die Staatenwelt insgesamt ihrem neuen strategischen Regime zu unterwerfen, hängt schließlich nicht nur von ihnen selber ab, sondern auch von freiwilligen Mitmachern; und dass es dabei auf die anderen kapitalistischen Mächte, also vor allem auf die Europäer ankommt, erkennt Amerika selber an, indem es sich vermittels der NATO deren Bündnispartnerschaft sichert. Was das für Europa bedeutet und wert ist, stellt die US-Regierung mit ihrer „Doktrin“ der einseitig zu beschließenden Präventivkriege, praktisch an den Fällen Afghanistan und Irak sowie innerhalb der NATO allerdings auch gleich klar: Auf die Partner kommt es genau so an, nämlich ausschließlich in ihrer Eigenschaft als Helfer der amerikanischen Weltherrschaft und für Dienstleistungen an der US-Strategie. Dafür werden sie ausdrücklich in Anspruch genommen, in entlarvend ehrlicher rückblickender Erinnerung an die Unterordnungsverhältnisse beim gemeinsamen Kampf gegen das einstige sowjetkommunistische „Reich des Bösen“, wobei freilich die entscheidende andere Seite fehlt: Die damalige Gegenleistung Amerikas in Form eines atomaren Schutzes gegen die Bedrohung, die die Partner sich mit ihrer berechnenden Parteinahme für die „Sache der Freiheit“ und deren „Vorwärtsverteidigung“ einhandelten und der sie sich allein nicht gewachsen fühlten, entfällt; etwas Entsprechendes geben Al Kaida und Sadam Hussein einfach nicht her. Und die andere von den Europäern mehr erhoffte als verlangte Gegenleistung: ihnen, wenn sie schon mitmachen, mitbestimmenden Einfluss auf die Sache zu gewähren, bei der sie mitmachen, europäische Interessen in die amerikanische Problem- und Weltlage-Definition mit aufzunehmen, ihnen womöglich sogar dann Beachtung zu schenken, wenn sie sich mit der amerikanischen Planung nicht vollständig decken – so etwas ist nicht im Angebot. Nicht nur, dass imperialistische Partnerschaft sowieso nicht so funktioniert: Eine Rücksichtnahme auf EU-Interessen schließt der US-Präsident in denkbar entgegenkommender Form ganz prinzipiell aus, indem er die Möglichkeit abweichender Interessen der „Freunde Amerikas“ gar nicht erst in Betracht zieht. Seine Bedrohungsanalyse und sein strategisches Konzept buchstabiert er den Europäern als deren eigenes elementares Sicherheitsbedürfnis vor und erklärt vorab alle Differenzen, sollte es sie trotzdem geben, zu Inkonsequenzen der Partner bei der Wahrnehmung ihrer recht verstandenen Eigeninteressen. Eine „Vision für Europa“ offeriert er den Europäern, die sich gar nichts dergleichen in Washington bestellt haben, jetzt aber wissen, dass sie bei allem mittun wollen, was Amerika auf die weltpolitische Tagesordnung setzt, und dafür im Rahmen der NATO 20000 Mann Spezialtruppen samt hypermoderner Ausrüstung für fällige Überfälle auf „Schurkenstaaten“ und als „Türöffner“ für amerikanische Besatzungstruppen übrig haben. Dass das Mittel bindet, die die Europäer für ihr Projekt einer EU-eigenen Eingreif-Armee vorgesehen haben und dafür schon kaum aufbringen, also dem Willen zu mehr europäischer Autonomie widerspricht, geht in die amerikanische Rechnung natürlich mit ein; entsprechend stark ist der Druck, die neue Truppe gleich auf der „historischen“ NATO-Erweiterungskonferenz in Prag zu beschließen, was dann auch planmäßig geschieht. Ganz nebenher erfahren so auch alle zukünftigen EU-Mitglieder aus dem ehemaligen Ostblock, wo sie strategisch hingehören.[4]
Mit ihrem entgegenkommenden Angebot, Europas militärische Potenzen für Amerikas Feldzug nutzbar zu machen und die alte Allianz diesem neuen Ziel zu widmen, durchkreuzt die US-Regierung die ganze komplizierte Emanzipationsstrategie der EU-Staaten. Die bemühen sich, über die NATO ein halbwegs gleichgewichtiges wechselseitiges Brauchen und Gebraucht-Werden zu konstruieren, mit eigener Dienstbarkeit für US-Interessen ein Stück Funktionalisierung der „Supermacht“ Amerikas auch für eigene Belange zu erkaufen, daneben eigene Ordnungsmacht ohne amerikanische Unterstützung und Bevormundung wirksam werden zu lassen. Sie tun ihr Bestes, die in dieser Politik enthaltenen Widersprüche zu dementieren und der unausweichlichen Alternative – Trennung oder Unterwerfung – auszuweichen. Und sie brauchen sich gar nicht erst selber zu einer Beendigung ihrer doppelgleisigen und doppelzüngigen imperialistischen Generallinie durchzuringen: Die USA schaffen klare Verhältnisse. Sie bestehen auf Dienstbarkeit statt Emanzipation, schmettern alle Versuche gegenseitiger Funktionalisierung ab, weisen alle Bemühungen der Europäer zurück, aus ihrer Unentbehrlichkeit für Amerika einen beachtenswerten Anspruch auf Einfluss abzuleiten. Und sie tun das in der denkbar schärfsten Form: Sie blamieren Europas imperialistisches Geltungsbedürfnis mit dem schlichten Gegenauftrag, die Verbündeten sollten sich endlich überhaupt erst einmal die militärischen Kapazitäten verschaffen – mindestens die erwähnten 20000 Mann „NATO Reaction Force“ –, mit denen sie für Amerikas neue Strategie allenfalls von nennenswertem Nutzen sein könnten;[5] das selbstverständlich, bevor an eine EU-eigene Armee zu denken ist, die sich immerhin für die Überwachung der Hinterlassenschaft amerikanischer Vorbeugemaßnahmen gegen Terroristen und „Schurkenstaaten“ nützlich machen könnte. Das sitzt. Denn drastischer lässt sich kaum klarstellen, was die EU-Imperialisten selber längst wissen: Sie sind militärisch zu schwach; sowohl, um ohne die USA in einer von den USA beherrschten Weltordnung eigene Ordnungsmacht wirksam werden zu lassen, als auch, um für Amerika so wichtig zu sein, dass sie sich dafür den erwünschten Einfluss kaufen könnten. Deswegen fügt die US-Regierung ihrem Rüstungsauftrag an die NATO-Partner noch nicht einmal ein diplomatisch geheucheltes Versprechen hinzu, ihnen in Zukunft Gehör zu schenken oder gar Mitsprache einzuräumen. Deren Aufgabe ist es, amerikanische Vorgaben als ihr eigenes vitales Sicherheitsinteresse anzuerkennen und danach zu handeln; der Krieg gegen den Irak, wenn er denn demnächst losgeht, ist die erste praktische Nagelprobe.
Diese Blamage alles dessen, was die EU sich als „europäischer Pfeiler“ vorgenommen und ausgerechnet hat, trifft deren verschiedene Mitglieder unterschiedlich je nach dem, was sie in ihrer internen Konkurrenz um die Federführung bei der allseits als überfällig erachteten Militarisierung ihres imperialistisch ambitionierten Clubs erreicht haben; und noch ein wenig unterschiedlicher gehen sie damit um.
- Tief betroffen sind Deutschlands regierende Nationalisten, die sich viel darauf zugute halten, bei der gewaltsamen Befriedung der – unter heftiger äußerer Mitwirkung eskalierten – postjugoslawischen Staatsgründungskriege sowohl eine europäische Linie als auch eine Waffenbrüderschaft zwischen Europa und den USA, wegweisend über die obsolet gewordene Aufgabenstellung der alten NATO hinaus, organisiert zu haben. Die glorreiche Entmachtung des Milošević-Regimes war zwar auch schon ein imperialistisches Armutszeugnis der EU; ohne Amerika hätte es zu so oberhoheitlichem Durchgreifen gegen die geächtete Staatsmacht in Belgrad bei weitem nicht gelangt; deswegen wurden die Kriegsziele auch in Washington festgelegt. Tatsächlich war aber, unter Wahrung eines deutschen Einspruchs gegen die amerikanisch-britische Kriegsplanung – Schröders „Keine Bodentruppen!“ –, immerhin in einem praktischen Fall ein auch fürs europäische Interesse wichtiger Schulterschluss mit dem großen Verbündeten gelungen. Dass Amerika nun genau dieses Moment von Einvernehmen für absolut dysfunktional erklärt – „Koalitionskriege“ lehnt die Bush-Regierung ausdrücklich ab –, also die politische Bereitschaft zur Wahrung eines praktisch ausnutzbaren und insofern doch nicht bloßen Scheins von Interessensausgleich zwischen Europa und Amerika in Weltordnungsfragen kündigt, nimmt die deutsche Seite nicht hin. Quasi auf eigene Rechnung konstruiert sie sich ein nach ihrem Urteil gleichgewichtiges Verhältnis zurecht zwischen berechnender, den Schein einer eigenständigen Beschlussfassung wahrenden Unterordnung unter die neuen globalstrategischen Richtlinien aus Amerika – „der Terrorismus“ wird als größtes anzunehmendes Sicherheitsproblem auch für Europas und Deutschlands wehrhafte Demokratie, „Enduring Freedom“ als die passende Antwort anerkannt – und einer entgegenkommend formulierten Absage: An einem Krieg im Nahen Osten, der die Nichtigkeit europäischer Ordnungsmacht-Ambitionen, in der Region und überhaupt, besiegeln würde, beteiligt die Nation sich nicht. Die Bundesregierung testet damit aus, wie viel Abweichung die Bush-Administration ihr um des deutschen Gewichts im Bündnis willen zugesteht; sie probiert zugleich, mit dieser Linie Gefolgschaft unter ihren EU-Partnern zu finden, sich also in eine Führungsposition zu manövrieren. Dabei stößt sie allerdings bei den meisten EU-Kollegen auf wenig „Solidarität“; die teilen sich mit ihrem Pro- und Antiamerikanismus jedenfalls nicht so ein, dass eine Grußadresse nach Berlin dabei herauskäme. Und in Amerika bekommt sie es mit einer Politik zu tun, die, nachdem sie keinen eingestandenen Rückzug der Berliner Mannschaft von ihrem Nein zu einer deutschen Beteiligung am nächsten Golfkrieg erwirken kann, einiges dafür tut, den Wahlsieger politisch zu isolieren und dessen Absage durch die praktische Indienstnahme deutscher Potenzen zu unterlaufen: Entzug wird einfach nicht gestattet.
- Frankreich und Großbritannien, Amerikas klassische Alliierte und als Atommächte – was immer das im Zeitalter des neuen antiterroristischen Welt-Feldzugs der USA bedeuten mag – mit Veto-Recht im Weltsicherheitsrat der UNO vertreten, finden einen anderen Weg, der Blamage der strategischen Potenz Europas und der praktischen Nichtigkeitserklärung seiner Ordnungsmacht mit Nicht-Anerkennung zu begegnen. Sie manövrieren sich – Frankreich mit den Mitteln seiner UN-Diplomatie, Großbritannien mit der verstärkten Mobilisierung seiner ohnehin in Permanenz aufrechterhaltenen speziellen Waffenbrüderschaft mit den USA – in die Position von autonomen Miturhebern jeder einzelnen Kriegsaktion, die die Regierung in Washington auf die weltpolitische Tagesordnung setzt. So entziehen sie sich dem Ansinnen, die neue amerikanische Präventivkriegsstrategie pauschal zu billigen, ohne sich mit einer Zurückweisung im bestimmten Fall, die sie dann doch nicht wirksam durchhalten könnten, selber zu blamieren. Im Ergebnis tauschen sie für ihre Unterwerfung unter Amerikas Absichten und die Agenda der US-Regierung zwar nicht die Erfüllung, aber eine pflegliche Behandlung ihres Wunsches nach Mitentscheidung über letzte Gewaltfragen „auf gleicher Augenhöhe mit der Weltmacht“ ein. Das nehmen sie als hinreichendes Zugeständnis an ihre fiktive imperialistische Eigenständigkeit, um auf eine Aufrüstung der EU hinzuwirken, die diese Fiktion mit ein wenig mehr Substanz füllen könnte, und damit in die Konkurrenz um eine führende Position in ihrem Club einzusteigen.
- Andere Mitglieder – Berlusconis Italien und Aznars Spanien –, die in der Konkurrenz ums Kräfteverhältnis innerhalb der EU nach eigenem Urteil immer zu schlecht wegkommen und in der Hierarchie der Ordnungsmächte noch nicht auf dem ihnen zukommenden Rang gelandet sind, machen angesichts der Degradierung ihres unfertigen Euro-Imperiums durch die USA anscheinend eine ganz andere Rechnung auf. Im Vergleich mit ihrem Weltranglistenplatz als EU-Staat der zweiten Kategorie kommt ihnen die Position eines Hilfspolizisten der amerikanischen Weltmacht, auch wenn sie sonst mit keiner politischen Vergütung verbunden ist, glatt attraktiv vor. Damit stabilisieren sie immerhin die NATO; natürlich nur als Instrument amerikanischer Weltordnungspolitik und zu Lasten jenes europäischen Imperialismus, an dem sie sich aber sowieso nicht hinreichend beteiligt finden. Dafür sind ihnen Dank und Unterstützung der transatlantischen Führungsmacht gewiss. So kommt ein gehöriges Maß an innerer Zersetzung zu der Blamage hinzu, die die USA mit ihrer strategischen Neusortierung der Staatenwelt und, wenn es nach ihren obersten Strategen geht, mit der imperialistischen Überzeugungskraft eines rasanten Blitzkriegs gegen Bagdad allen Ambitionen Europas zufügen, es an Weltordnungsmacht den Amerikanern gleichzutun.
Was immer man Saddam Hussein und Usama bin Ladin Böses nachsagen mag: Wenigstens daran sind sie nicht schuld.
[1] Was hier und im folgenden Abschnitt kurz zusammengefasst ist, kann ausführlich in dem Aufsatz Europa 2000 – Zwischenbilanz eines (anti-)imperialistischen Projekts neuen Typs: Von der Währungsunion
in GegenStandpunkt 4-2000, S.143 und in GegenStandpunkt 2-01, S.171 nachgelesen werden.
[2] Das ist hier ein bisschen anders als in der Sphäre der politischen Ökonomie, wo, dem Kapitalismus sei Dank, Sachen und deren Zwänge, das Geld nämlich und die Erfordernisse seiner erfolgreichen Vermehrung, nicht bloß das Denken und Wollen der vielen kleinen und großen „Charaktermasken“ des gesellschaftlichen Erwerbslebens, sondern auch die Kalkulationen der höchsten Gewalten beherrschen: Sogar die Willkür bei der Festlegung von Kriterien für den staatshaushälterischen Gebrauch des Gemeinschaftskredits zeugt von dem Standpunkt bürgerlicher Regierungen, ausgerechnet in der souveränen Verfügung über den Reichtum ihrer Gesellschaft und dessen Reproduktion nicht frei zu sein.
[3] Hierzu ist das Nötige nachzulesen in dem Aufsatz Wirtschaftskrise und Kriegswirtschaft in den USA
in GegenStandpunkt 3-02, S.89.
[4] Die Eingemeindung der ehemaligen „sozialistischen Bruderländer“ der einstigen Sowjetunion in „den Westen“ wird von der US-Regierung überhaupt mit der doppelten Zielsetzung betrieben, das Bündnis nicht bloß zu erweitern, sondern sein Verhältnis zum Zusammenschluss der Europäer im Sinne Amerikas weiter zu entwickeln: Während die EU aus der Allianz mit den USA eine wohlfeil verfügbare Garantie für totale Überlegenheit bei ihren weltpolitischen Auftritten sowie eine letzte Rückversicherung für daraus womöglich dann doch erwachsende militärische Abenteuer machen möchte, wollen die USA die EU auf ein bloßes Wirtschaftsbündnis beschränken und auf die Funktion der ökonomischen Garantiemacht für die Dienstleistungen festlegen, die die Mitgliedsländer im Rahmen der erneuerten NATO für die amerikanische Weltmacht erbringen sollen. Die neuen Mitglieder erscheinen der US-Regierung als geeignete Adressaten und Partner für diese Politik des Vorrangs der von Amerika dominierten NATO als strategischer Ordnungsmacht vor dem eigenständigen Bündnis der Europäer als einer Institution, die dazu den kapitalistischen Unterbau liefert. In diesem Sinne hat der US-Präsident bei seinen eigens zu diesem Zweck im Anschluss an die Konferenz in Prag anberaumten Besuchen in Litauen und Rumänien speziell den Osteuropäern die Priorität des Kampfes für „die Freiheit“ als ihre europäische Zukunftsperspektive ausgemalt und gleich den ehrenvollen Auftrag erteilt, die NATO gegen die in Washington diagnostizierten Tendenzen der Alt-Mitglieder zur Appeasement-Politik
moralisch aufzurüsten.
[5] Der US-Verteidigungsminister stellt dazu klar: Wenn die Nato keine Streitkräfte hat, die schnell und agil sind, die in Tagen und Wochen statt Monaten und Jahren zum Einsatz gebracht werden können, dann wird sie in der Welt des 21. Jahrhunderts nicht viel zu bieten haben.
(Rumsfeld, Washington Post, 25.9.02)