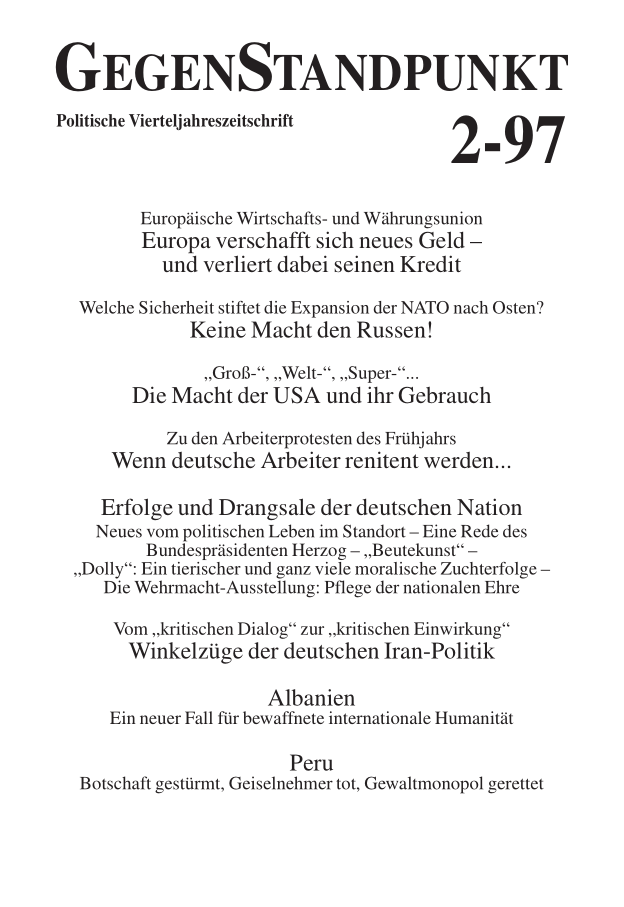Europäische Wirtschafts- und Währungsunion (I)
Europa verschafft sich neues Geld – und verliert dabei seinen Kredit (Teil 1)
Die Erfolge von 40 Jahren europäischer Wirtschaftsunion setzen den Stachel zur Schaffung einer Gemeinschaftswährung, die dem Dollar Konkurrenz machen will und die mit der bisherigen Geschäftsordnung innerhalb Europas aufräumt: Mit der Hoheit über ihren Nationalkredit ist den Nationen das entscheidende Konkurrenzmittel zur Standortpflege genommen, ohne andererseits das nationale Bilanzieren aufzuheben. Die „Stabilitätskriterien“ sollen die Weltgeld-Qualität des Euro von vornherein sicherstellen – was sie erstens nicht können, womit aber zweitens der Zwang zur Unterordnung des nationalen Finanzgebarens unter den gesamteuropäischen Standpunkt in die Welt gesetzt ist.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Siehe auch
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Europäische Wirtschafts- und Währungsunion (I)
Europa verschafft sich neues Geld – und verliert dabei seinen Kredit (Teil 1)
1. Der Aufbruch
Die Europäische Union hat beschlossen, ihr Geldwesen zu reformieren. Die frei gewählten Regierungen haben mit diesem Schritt keinem Antrag ihrer Völker stattgegeben – in wichtigen Angelegenheiten ist dergleichen in der Demokratie nicht üblich –, sondern entschieden, daß ihre Nationen mit einem Geld für ganz Europa ihre Geschäftsgrundlage erheblich verbessern. Dem Publikum, das sich seiner Statistenrolle in Geldfragen entsprechend erkundigt, ob es mit der neuen Währung womöglich Abstriche beim Einkommen bzw. seiner Kaufkraft zu gewärtigen hat, wird mitgeteilt, daß kein Grund zur Sorge besteht:
„Die Einführung des Euro ist keine Währungsreform; es werden keine Vermögensverluste eintreten. Alle Geldgrößen wie Bargeld, Sparguthaben, Schulden, Löhne und Gehälter, Renten und Pensionen, Preise und Mieten werden mit ein und demselben Umstellungsfaktor, der heute noch nicht bekannt ist, von DM in Euro umgerechnet. Diese Umrechnung ist somit ein rein technischer Vorgang. Am realen Wert einer Geldgröße ändert sich dabei nichts. Die Zahlen ändern sich, aber der Wert bleibt gleich… Niemand wird durch die Umstellung ärmer oder reicher.“
Natürlich beschränkt sich die Broschüre des Finanzministeriums, die da in den Briefkästen landet, nicht auf diese Entwarnung. Abgesehen davon, daß sich nichts ändert, führt die Währungsunion nämlich zu lauter vorteilhaften Veränderungen:
„Die vollen Vorteile des Binnenmarktes erschließen sich aber erst dann, wenn wir auch über eine einheitliche Währung verfügen. Das Festhalten an verschiedenen Währungen stellt – besonders bei stark schwankenden Wechselkursen ein gravierendes Handels- und Investitionshemmnis dar… Währungsbedingte Transaktions- und Kurssicherungskosten der Unternehmen entfallen innerhalb der Währungsunion… In der Wirtschaftswelt, in der Sicherheit Geld bedeutet, kann dieser Vorteil nicht hoch genug eingeschätzt werden… europaweit Wachstumsimpulse auslösen… Mit der Währungsunion wird die EU zu einem großen und einheitlichen Finanzmarkt… attraktive Anlage- und Finanzierungsmöglichkeiten… Jeder Kreditnehmer und jeder Investor kann auf das gesamte Kapitalangebot der Union zurückgreifen… Die Investitionsbedingungen werden dadurch deutlich verbessert. Dies sichert Wachstum und Beschäftigung… Der Euro wird zu einem wirksamen Gegenpol zu anderen Weltwährungen… Dies eröffnet die Möglichkeit, die Abhängigkeit Europas von der Tagespolitik in anderen globalen Finanzzentren zu lockern.“
Angesichts so vieler guter Argumente wäre es verfehlt, den Architekten der Währungsunion mit der Vernachlässigung der sozialen Frage zu kommen; sicher, die Liste der Errungenschaften, die die Regierung mit dem Euro verbindet, betrifft durchgehend die Bedürfnisse des Geschäfts, eben die Anliegen der „Wirtschaftswelt“, in der investiert und angelegt wird – aber mit deren Erfolgen steht und fällt nun einmal der Fortschritt der Nation. Deren Politiker haben nicht den geringsten Anlaß, sich ausgerechnet bei ihrem europäischen Einigungswerk dafür zu rechtfertigen, daß sie einen Kapitalstandort regieren – für den wollen sie ja die vollen Vorteile des Binnenmarktes erschließen. Wenn sie die Interessen der Nation umstandslos mit denen der Wirtschaft gleichsetzen –
„Dies ist besonders für Deutschland wegen seiner hohen Außenhandelsverflechtung wichtig. Rund ein Drittel unseres Bruttosozialprodukts wird im Export erwirtschaftet… Der Handel mit unseren Nachbarländern ist ein Lebensnerv der deutschen Wirtschaft…“ –,
haben sie die soziale Frage dann auch hinreichend berücksichtigt. Denn schließlich sind auch die nicht zur „Wirtschaft“ gehörigen Normalbürger Deutsche und als Lohnabhängige vom Gang der Geschäfte abhängig. Der Verweis darauf, daß „bei uns in Deutschland jeder vierte Arbeitsplatz“ vom internationalen Geschäft abhängt, die Gleichsetzung von Wachstum und „Beschäftigung“ darf deshalb als die zeitgemäße und einzig senkrechte Form gelten, in der die Europa-Politiker ihre soziale Verantwortung wahrnehmen. Die Tatsache, daß das Wachstum auf dem europäischen Binnenmarkt schon bislang ein sattes Maß an Armut und Arbeitslosigkeit erzeugt hat, zeugt – recht verstanden – nur davon, daß „wir“ noch viel mehr europäisches Wachstum brauchen. Insofern ist bei der Einführung des Euro ein Umdenken in sozialen Belangen erst einmal nicht notwendig.
Die Korrektur, die den Betreibern des Projekts „Euro“ im Rückblick auf ihre bisherige Zusammenarbeit in der europäischen Gemeinschaft eingefallen ist, richtet sich zunächst nicht auf das mehr oder minder gedeihliche Zusammenwirken von Kapital und Arbeit, sondern auf das Verhältnis zwischen den Nationen und dem Geschäft, das sie betreuen. Nachdem die Regierungen der EU ihre Volkswirtschaften zu Bestandteilen eines „gemeinsamen Marktes“ hergerichtet haben, sind sie zu der Auffassung gelangt, zu ihrem eigenen Schaden einen entscheidenden Schritt unterlassen zu haben – und sie definieren diesen Schritt als die konsequente Fortführung ihres bisherigen Bündniswerks. Mit der kritischen Betrachtung des gemeinsamen Marktes als einer halben Sache, die ganz gemacht und fertiggestellt gehört, knüpfen die Staaten der EU an den Zweck ihrer Bündniswirtschaft an:
- Als kapitalistische Nationen darum bemüht wie darauf verwiesen, ihren Reichtum wie ihre Macht aus der Betreuung möglichst großer Anteile des international tätigen Kapitals zu schöpfen, haben sie eine Sonderzone des Weltmarkts eröffnet. Unter der Losung „Beseitigung von Handelshemmnissen“ haben sie untereinander die Konkurrenzpraktiken schrittweise aufgegeben, durch die sich Nationen auf Kosten anderer den Zugriff auf die Erträge des Weltmarkts sichern; desgleichen sind sie von den Techniken der Betreuung von Geschäften abgekommen, die als „Protektionismus“ bekannt sind, weil sie den Schutz von Reichtumsquellen im lokalen Bereich staatlicher Herrschaft vor fremder Konkurrenz betreiben.
- Den Standpunkt der Förderung lokalen Geschäftslebens haben sie – zum Zwecke von dessen Erweiterung – um die praktische Einsicht ergänzt, daß sich am Geld der anderen und durch dessen Einsatz mehr verdienen läßt. Den Internationalismus des nationalen Geldmachens, der nach dem 2. Weltkrieg angesagt war, haben die Nationen Europas durch die Bildung eines Blocks ausgenützt. Innerhalb der Gemeinschaft entfallen für expansionsbeflissene Unternehmen nicht nur Beschränkungen und Kosten beim grenzüberschreitenden Kaufen und Verkaufen, Investieren und Anlegen; die Mitgliedsstaaten organisieren auch gemeinsam verbürgten Kredit und stiften allerlei Fonds in Größenordnungen, die von den einzelnen Nationen zur Eröffnung und Sanierung rentabler Geschäftszweige gar nicht aufzubringen wären.
- Die Kooperation auf dem Felde des Kredits hat nicht nur für die Förderung des europaweiten Wachstums, die kapitalistische Erschließung ganzer Regionen sowie für die Etablierung multinationaler Großprojekte (Energie, Luftfahrt, Rüstung) eine enorme Bedeutung. Sie umfaßt auch die Aufgabe, die Kontinuität des europäischen Wachstums gegen die Wirkungen zu sichern, die selbiges Wachstum auf die Bilanzen der Mitgliedsländer hat. Die über die Grenzen freigesetzte Konkurrenz der Kapitale vollbringt nämlich nicht das Wunder, allen europäischen Nationen in gleichem Maße den Segen zuzuteilen, um den sie miteinander konkurrieren: An den Standorten, die die EG-Mitglieder nun einmal sind, landen sehr unterschiedliche Massen von Gewinn, so daß immer wieder das Geld, das den Staatsschatz, die Zahlungsfähigkeit der Nation daheim und auswärts ausmacht, knapp wird. Die in Gestalt von Währungsverfall, Wechselkursproblemen auftretenden Gefährdungen des europäischen Geschäftsgangs wurden deshalb im EWS zum dauerhaften Regelungsfall der Gemeinschaft erklärt, um die Brauchbarkeit der Partner für die Fortführung europäischen Geldverdienens zu sichern.
Der Erfolg von vierzig Jahren Gemeinschaft für immer freieren Wettbewerb kann sich durchaus sehen lassen. Es ist – und darum geht es schließlich in der Marktwirtschaft, die da europaweit immer aufwendiger geplant wurde – sehr viel Geld verdient worden, die Unternehmen sind ebenso gewachsen wie Umsatz und Vermögen der Banken. Aber nicht nur in privaten Händen, wo das Geld erst einmal hingehört, hat es sich so kräftig angesammelt, daß zig Millionen Arme in den Völkerschaften der EU nicht umhin können, ihren Respekt zu bezeugen; auch in den öffentlichen Händen ist jede Menge Zahlungsfähigkeit gelandet. Soweit es sich dabei um Kredit handelt, genießt er wie alle anderen Sorten Schulden, die das Geschäft belebt haben, weltweit höchste Anerkennung. An den Börsen Europas ebenso wie an den Geldhäusern der übrigen Welt hat eine ständige Nachfrage nach Papieren, jenen merkwürdigen Objekten der Begierde, jedes Angebot ins Recht gesetzt. In und an den Ländern ist verdient worden; dabei waren zwar gewisse „Ungleichgewichte“ nicht zu vermeiden, weil die Konkurrenz neben Siegern auch Verlierer braucht. Dafür ist aber eine europäische Ankerwährung zustandegekommen, die sich großen Ansehens erfreut, die in den Staatshaushalten der ganzen Welt, an der europäische Unternehmen auch nicht zu knapp verdient haben, als Devisenreserve geschätzt ist. In der DM verfügt jeder – ob Privatmensch oder Staat –, der sie sich verschaffen kann, über ein solides Eigentum, das in aller Welt gutes Geld darstellt und als dieses Weltgeld, als sicheres Geschäftsergebnis wie als bevorzugtes Geschäftsmittel, begehrt ist. Die europäische Sonderzone des Weltmarkts hat sich bewährt – ihre Bewirtschaftung im Innern hat den Reichtum der beteiligten Nationen gemehrt, indem die Investitionen europäischer Kapitalisten dem Vergleich mit der weltweiten Konkurrenz gewachsen waren und sich als rentabel erwiesen.
Die „Weiterentwicklung des Binnenmarktes“
ist die in Angriff genommene Währungsunion nur in einer Hinsicht. Der Beschluß, eine Währung Europas einzuführen, setzt den Standpunkt des Wirtschaftsblocks fort, der im Verkehr mit und in Konkurrenz zu außereuropäischen Nationen sein Kapitalwachstum erwirtschaftet. Dieser Standpunkt ist der einer politischen Herrschaft, die in ihrem Zuständigkeitsbereich das ökonomische Leben – Produktion, Verteilung und Konsumtion – der Privatmacht des Geldes unterwirft, deswegen auch für das Vorhandensein des Geldes und für dessen Gültigkeit Sorge trägt. Die Zuordnung von Kapital zu den Belangen dieser Herrschaft ist schon wieder eine Frage des Geldes, was sich bei der Abwicklung von Geschäften auf dem Territorium der Nation automatisch ergibt: die Verwaltung eines Kapitalstandorts bezieht die zur Erfüllung ihrer Aufgaben nötigen Mittel durch Zugriff auf das von ihrer Gesellschaft verdiente Geld.
Im Falle der europäischen Union ist nicht zu übersehen, daß besagter Standpunkt praktisch nur sehr beschränkt existiert – ernst gemacht wurde mit ihm in Form von Übereinkünften, durch die in den verschiedenen Nationen gleiche Geschäftsbedingungen verbindlich wurden; dazu kommen die supranationalen Institutionen, an die die einzelnen Souveräne per Vertrag gewisse Rechte übertragen haben. Immerhin hat diese innereuropäische Zusammenarbeit dazu geführt, daß für außereuropäische Nationen, die mit Arbeit, Geld und Waren aller Art an Europa verdienen wollen, manche Schranke errichtet ist für den rentablen Verkehr mit den EU-Ländern. Diese inzwischen fünfzehnfache „Diskriminierung“ des nicht-gemeinschaftlichen Auslands hat für dieses die praktische Bedeutung, die ansonsten die die Konkurrenz und ihre Freiheit behindernden Maßnahmen eines politischen Subjekts aufweisen. Die Geschäftsbedingungen, die sich die EU-Mitglieder untereinander gewähren, stehen anderen Auslanden nicht offen.
An diese Leistung des Binnenmarktes knüpft die Währungsunion tatsächlich an:
„Sie ist die europäische Antwort auf die wachsende weltwirtschaftliche Verflechtung und die zunehmende Globalisierung der wirtschaftlichen Beziehungen.“ (Waigel)
Etwas anders sieht die Sache nach innen aus. Denn da räumt das Euro-Projekt mit der bisherigen Geschäftsordnung der Gemeinschaft auf. Alle zuvor erstrittenen „Weiterentwicklungen“ der EG, die zu Konventionen bezüglich der staatlichen Förderung des Geschäfts im Verein wurden, beruhten auf den Berechnungen eigenständiger National-Ökonomien. Die Mitglieder ließen sich zur Streichung von Handelshemmnissen und zur Beteiligung an gemeinsamen Unternehmungen herbei, weil sie jede Streichung aus dem Katalog ihrer Außenhandelspolitik gegen einen Vorteil aufzurechnen wußten, der ihrer nationalen Bilanz aus den neuen Regelungen winkte. Und diese Bilanz mochte mit ihren Auskünften über Wachstum und Exporte, Schulden und Außenstände mehr oder minder vorteilhaft ausfallen – stets bestätigte sie auch den europäischen Staaten die Verfügung über einen Nationalkredit.
Dieser kommt durch die Art und Weise zustande, in der moderne kapitalistische Staaten ihre Hoheit über das nationale Geldwesen ausnützen, um sich zur Erledigung ihrer Aufgaben zu verschulden. Dafür zuständig, jeder Münze und Banknote ebenso wie allen Sorten von Schulden und ihren papiernen Belegen die Funktion von Geld, das jemand besitzt und verwenden kann, zu garantieren, verfahren die Hüter des Geldes mit den Schulden der Staatsgewalt genauso. Jeder Kredit, den sich die Staatsmacht genehmigt, gerät zu einem Akt der „Geldschöpfung“, indem er über die Vermittlung des Bankwesens als verzinste Kapitalanlage und durch die ordnungsgemäße Bezahlung von Leistungen für den Herrschaftsbetrieb als vermehrte Zahlungsfähigkeit im lieben Wirtschaftskreislauf landet. Daß aufgrund dieser Praxis das staatliche Monopol auf die Ausgabe von Banknoten die Banken in ihrer Sucht, Kreditzettel in Umlauf zu bringen, nicht behindert, sondern zu allerlei Großtaten ermuntert; daß die kontinuierliche Verwandlung von Staatsschulden in gesellschaftlich gültige Umlaufsmittel die „Geldmenge“ erhöht, so daß sich tüchtige Geschäftsleute durch Preissteigerungen an der so erzeugten Zahlungsfähigkeit bedienen; daß also der „Geldwert“ – das, was eine Geldeinheit so an „Kaufkraft“ darstellt – ins Wackeln gerät: das alles ist den Geldhütern bekannt, und vor solchen Gefahren warnen sie sich ständig selbst. Der „Kampf gegen die Inflation“, die „Sicherung der Geldwertstabilität“ gehört zum Kanon der Finanzpolitik, weil ihn der staatliche Umgang mit dem Geld immerzu notwendig macht. Selbiger Kampf hat auch aus einem guten Grund mit der Unterlassung der stabilitätswidrigen „Geldschöpfung“ nichts zu tun; er beschränkt sich darauf, mit Hilfe der Steuern – den wirklichen Einnahmen, die der Staat seiner Gesellschaft abknöpft – die Glaubwürdigkeit alter und neuer Staatsschulden zu finanzieren.
Der gute Grund für die kontinuierliche Staatsverschuldung liegt schlicht im Bedarf der Staatsgewalt, deren Dienste – Ordnung, Recht und „Infrastruktur“ braucht das Land ebenso reichlich wie Verteidigung – unabdingbar sind für das „Wachstum“. Diese Dienste, die einerseits kein Geschäftsmann entbehrlich findet, kommen der „Wirtschaft“ nach der Seite ihrer Kosten ziemlich systemwidrig vor. In der Klage über bloß „konsumtive Ausgaben“ und eine „zu hohe Staatsquote“, auch im aktuellen Ruf nach ganz viel „Privatisierung“ monieren die Kenner der freien Wirtschaft, daß Staatsausgaben kein Beitrag zu, sondern ein Abzug von ihrem Geschäft sind – vom Standpunkt der flächendeckenden Geldvermehrung, der jede ökonomische Regung in der Gesellschaft zu entsprechen hat, stellen die Staatstätigkeiten lauter faux frais dar.
Diesen Charakter wird das staatliche Haushalten durch die Ergänzung des Steuerabzugs um das öffentlich-rechtliche Schuldenwesen zwar nicht los – wohl aber erhält die Belastung, die der Staat dem privaten Gelderwerb bereitet, zugleich die Form eines Dienstes am Markt. Die Unternehmen, die im Rahmen dieser Veranstaltung um ihre Gewinne konkurrieren, sind nämlich für ihren Konkurrenzkampf dauernd auf Mittel des Kredits angewiesen – und die Verfügbarkeit geborgter „Liquidität“ steigert der Staat durch seine Schulden, die er nach den Regeln des kapitalistischen Geschäfts in Umlauf bringt, erheblich. Die Banken, die für den Handel mit Kredit zuständig sind, stattet er mit zusätzlichen Geschäftsartikeln aus, was deren Umsatz beflügelt und das Volumen des Geldkapitals ebenso erhöht wie die Menge der umlaufenden Kreditzeichen. Produktives und Handelskapital bedienen sich nach Kräften an den Angeboten der Kreditwirtschaft, um ihre Geschäfte zu erweitern. Gehen diese Geschäfte gut, dann sichern sie nicht nur den erfolgreichen Unternehmen ihren Gewinn; sie bestätigen auch die Solidität der geldkapitalistischen Kalkulationen und lassen auch den in den Zinsen gegebenen Gegensatz zwischen produktivem und Geldkapital unbedeutend erscheinen. Schließlich rechtfertigt dasselbe Wachstum auch noch die Staatsverschuldung, die sich als Kapitalförderung bewährt hat, was sich per Steueraufkommen im Staatsbudget positiv bemerkbar macht.
Die bereits erwähnte Wirkung der marktwirtschaftlichen Technik, Staatsschulden in Geschäftsmittel zu verwandeln, die Inflation, zählt erst einmal nicht als Einwand gegen diese ebenso moderne wie umständliche Art des Gelddruckens. Solange die Unternehmen sich mit ihrer Kalkulation der Preise, die sie für ihre Waren verlangen, gegen den Wertverlust ihres Geldes schadlos halten und schwarze Zahlen schreiben, trifft die Geldentwertung nur alle anderen, also keinen Falschen. Daß der Kredit der Nation eine Art ständiger Umverteilung einschließt, macht lediglich gewerkschaftlichen Tarifkommissionen zu schaffen. Mit der prozentpunktgenauen Kompensation des Kaufkraftverlustes von Löhnen nehmen sie es dennoch nie so ernst; eingedenk der unleugbaren Abhängigkeit der von der Gewerkschaft vertretenen Lohnabhängigen von den Geschäften schreiten sie eher zum Ruf nach wirklichen Subventionen. Dieser Einsatz der Staatsschuld zur Eröffnung und Erhaltung ausgewählter Geschäftszweige gilt zwar immer wieder als Verstoß gegen die Grundsätze der Marktwirtschaft – Fanatiker halten halbe und ganze Staatsbetriebe sogar für Sozialismus. Dennoch ist die Verwendung staatlichen Kredits als Kapitalausstattung von Unternehmen nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Und zwar eine, die weniger mit sozialen Forderungen zu tun hat als mit einem prinzipiellen politischen Handlungsbedarf, der den Bedürfnissen des kapitalistischen Geschäfts entspricht. Wie lautstark gelegentlich auch der Vorwurf der Verschwendung ertönt – seine Freiheit zur Verschuldung gebraucht der politische Souverän noch stets in Verantwortung für das Kapitalwachstum auf seinem Hoheitsgebiet:
- Er bringt Geschäfte in Gang, bei denen Kapitalvorschuß und Umschlagszeit zu groß sind für private Investoren, so daß diese auf Jahre hinaus keinen Gewinn zu erwarten haben. In vollem Respekt vor dem Rentabilitätsgedanken der „Wirtschaft“ läßt er Kommunikationsmittel, Verkehrswege und Energie produzieren, damit die privaten Unternehmen ihre Rechnung mit den preiswerten Dienstleistungen machen können.
- Wenn sich die Notwendigkeit von Staatsschulden mit der Freiheit privatwirtschaftlicher Berechnungen kombinieren läßt, ruft die Nation Kapitalgesellschaften ins Leben. Diese stattet sie nicht nur mit einem hübschen Anteil am Kapitalvorschuß aus, sondern auch mit einer Garantie, die einer Versicherung gegen die notorischen Risiken der Konkurrenz gleichkommt. Die Kreditwürdigkeit solcher Unternehmen – ihren Aktien tut das auch gut – ist durch die Beteiligung der öffentlichen Hand von den üblichen Rentabilitätsnachweisen entlastet.
- Manches private Unternehmen läßt sich – wenn es für die Nation und ihre „Regional-“, „Struktur-“ oder „Konjunkturpolitik“, also für die Zukunft wichtig ist – durch Subventionen rentabel machen.[1] Das geht über Steuererlaß, preiswerte Grundstücke, Finanzierung von Forschung und Entwicklung, Rüstungsaufträge als festen Bestandteil des Umsatzes etc.
Solche Betreuung des Standorts – der „Wirtschaft“, von der die ganze Nation lebt – ist nicht nur normal, sondern selbst aus der Sicht von Eiferern des freien Marktes dringend geboten. Ein Geschichtsbewußtsein des banalen Inhalts, daß durch den „Hebel der Staatsschuld“ der ganze Kapitalismus erst so richtig in Gang gekommen ist, braucht es für diese Einsicht nicht. Ebenso wenig wie eine Ahnung davon, daß eine politische Herrschaft, die ihre Untertanen aufs Marktwirtschaften verpflichtet, immerzu Geld und Kredit unter die Leute bringen muß, damit die sich am Wachstum des Kapitals zu schaffen machen. Die ökonomischen Aufgaben des Gesamtkapitalisten Staat definiert sich der gesunde Sachverstand gleich so zurecht, daß der nationale Hüter des Geldes seinen Kredit so zu verausgaben hat, daß der internationalen Konkurrenzfähigkeit der unter seinem Regime tätigen Gewerbe gedient ist. Der Blick auf den Weltmarkt lehrt noch jeden Praktiker und Theoretiker des Kapitalerfolgs den Nationalkredit zu schätzen, auch wenn die Staatsschuld als Instrument des Wachstums, als alltägliche Förderung des Geschäfts und Sicherung seiner Bedingungen von den Anspruchsdenkern des privaten Allgemeinwohls ziemlich gering geachtet wird. Denn was sich im begrenzten Feld des nationalen Marktes ausnimmt wie eine Unterwanderung des heiligen Prinzips der Rentabilität – nur was Profit bringt, verdient gemacht zu werden –, erweist sich im internationalen Handel mit Ware und Geld als entscheidende Geschäftsgrundlage:
- Für die Unternehmen, die in den Genuß staatlicher Zuwendung kommen, verbessert sich die Kalkulation mit Kosten, Preisen und Gewinnen, von der der Ausgang des Vergleichs mit den ausländischen Konkurrenten abhängt.
- Für die Nation bringt der auswärtige Handel der unter ihrer Hoheit versammelten Kapitalisten, die sich im inter-nationalen Wettbewerb bewähren, auf dem Standort gesteigertes Wachstum. Und aus ihrem Geld macht der auswärtige Handel ein Geschäftsmittel, das auch außerhalb seiner Grenzen zu allen Arten der kapitalistischen Bereicherung taugt. Mit dem Beschluß der Konvertibilität ihrer Kreditgelder – durch ihre Austauschbarkeit ist ihre lokal beschränkte Geltung überwunden; sie sind gleich-gültige Arten von Geld, das weltweit sein Werk tut – eröffnen sich Staaten die Geschäfte auch in anderer Herren Ländern als Quellen ihres nationalen Reichtums. Mit den Leistungen des auf ihrem Territorium tätigen Kapitals konkurrieren sie um Anteile am international verdienten Geld; die Unternehmen, die sie fördern, befrachten sie mit dem Auftrag, ihrem Nationalkredit den Status einer relativ starken, stabilen Währung zu erwirtschaften.[2]
- In dieser, durch die Internationalisierung des kapitalistischen Geschäfts geforderten, Eigenschaft einer vom Verlauf der Konkurrenz, von den „Märkten“ bewerteten Währung präsentiert sich die Wirkung der Staatsschuld den Akteuren des Weltmarkts (selbst die Statisten sind in der Kaufkraft ihres Lohnes, ganz auffällig im Urlaub, betroffen): Im relativen Wert des nationalen Geldes sind Kapitalisten und Staatenlenker mit einem Datum konfrontiert, das weder die Schulden einer Nation beziffert noch die Kapitalvermehrung, die tüchtige Unternehmer zustandegebracht haben. Es drückt aus, inwieweit der auswärtige Handel die – sei es für Autobahnen, Schulen oder Subventionen – verausgabten Schulden rechtfertigt und in welchem Maße die Besitzer von nationalen Kreditzeichen über Geld verfügen – und zwar über Geld, das weltweit Besitz garantiert und als Erwerbsquelle taugt. Denn daß die Anzahl der in privater wie öffentlicher Hand befindlichen Zettel und Buchungssummen nicht lokal beschränkt gültig sind, ist die Voraussetzung für den Schiedsspruch der „Märkte“ über den relativen Wert der Währungen.
- Die Ergebnisse der Konkurrenz auf dem Weltmarkt stacheln sowohl Kapitalisten als auch nationale Währungshüter zu neuen Taten an. Unternehmer jeden Gewerbes sind damit vertraut, daß sie in Sachen Einkauf wie Verkauf sowie bei den Produktionsbedingungen dem weltweiten Vergleich ausgesetzt sind – also stellen sie in ihrer Kalkulation die einschlägigen Vergleiche auch an. Auf der Grundlage ihrer bisherigen (Miß)Erfolge prüfen sie die nationalen Geschäftsbedingungen, nach der lokalen Ausstattung (die umfaßt von der Infrastruktur bis zur Brauchbarkeit der Arbeitskräfte alles, was sich in einen geldwerten Beitrag zur „Kapitalproduktivität“ umrechnen läßt) des jeweiligen Standorts und nach der Brauchbarkeit des nationalen Geldes (mit der sich die Spezialisten des Finanzgewerbes speziell befassen). Daß sie dabei gegenüber den politischen Herrschaften und Währungshütern kritisch und fordernd verfahren, tut der Symbiose zwischen Kapital und Nation überhaupt keinen Abbruch. Denn die marktwirtschaftliche Staatsraison hat keinen anderen ökonomischen Inhalt als den der Betreuung eines Kapitalstandorts. In dessen geschäftsdienlicher Förderung besteht denn auch die Antwort auf die Anfragen des internationalisierten Kapitals. Die Nation, die ihren Wohlstand auf die Verfügung über Weltgeld gründet, weiß sich auf die Attraktion von Kapital verpflichtet – und auch dies in dem doppelten Sinne: der Zurichtung ihres Territoriums zu einem Ensemble von Geschäftsbedingungen, die Rentabilität verheißen – und der Pflege ihres Geldes, der sie in Form der „Finanz- und Währungspolitik“ ein Handwerk eigener Art widmet: Das Vertrauen der Geldmärkte will nämlich benützt und hergestellt sein.
- Daß das Bemühen um Anteile am Weltgeschäft einmal als Wirtschaftspolitik, das andere Mal als Finanzpolitik stattfindet, hat seinen Grund in der Abtrennung des Geldkapitals, das eine eigene Sphäre des Gewinnemachens neben der Wirtschaft darstellt, in der die Geldvermehrung durch Produktion stattfindet. Nicht zu übersehen ist freilich, daß beide Abteilungen bei so verschiedenen Aufgaben wie der Zurichtung rentabler Geschäftszweige, die heute Hi-Tech heißen, und der Emission attraktiver Staatspapiere auf haargenau dasselbe Instrument zurückgreifen. Der Hebel, mit dem Nationen Erfolge ihres Standorts verteidigen und ausbauen; die Waffe, mit der sie Defizite ihres Standorts gegen den Vorsprung der Konkurrenz abbauen und beseitigen, ist und bleibt der Nationalkredit. Durch den zweckmäßigen Einsatz der Staatsschuld – und zweckmäßig ist alles, was rentable Geschäfte ins Leben ruft, die sich in den Bilanzen der Nation niederschlagen und ihrem Kredit zum Status eines respektablen, in allen Funktionen von der „Kaufkraft“ bis zur puren Geldanlage brauchbaren Geldes verhelfen – verschaffen sich die konkurrierenden Nationen den die anderen ausschließenden Zugriff auf die ökonomische Macht, die das „globalisierte“ Geschäft für Patrioten des Geldes so abwirft. Und diese Bestimmung des Nationalkredits als Konkurrenzmittel der Standortbewirtschafter und Währungshüter relativiert sich überhaupt nicht durch die nur allzu bekannte Tatsache, daß auf dem Weltmarkt nicht alle Nationen auf ihre Kosten kommen…
Die europäische Währungspolitik zielt auf die Herstellung eines solchen Konkurrenzmittels, indem sie den Mitgliedern der Gemeinschaft die Hoheit über ihr Geldwesen, die sie haben, entzieht. Alle Argumente, mit denen die Veranstalter ihr noch nicht ganz fertiges Produkt preisen, berichten von der Entfaltung ökonomischer Potenzen, die Europa aus der Beschränktheit herausführt, in der es sich wegen der Zersplitterung seines Geldwesens zur Zeit noch befindet. Die bisherige Gemeinschaft wird verächtlich als „bloß eine bessere Freihandelszone“ tituliert – und zwar von deutschen Politikern, die bestimmt mitbekommen haben, daß ihre Nation samt der DM, auf die sie so stolz sind, von der europäischen Kooperation der vergangenen Jahrzehnte enorm profitiert hat. Da wird Maß genommen an der Wirtschaftsmacht eines Blocks, der – wäre er durch ein Geld bewirtschaftet und wären die Unternehmen und Banken diesem Geld verpflichtet – viel mehr aus dem Weltmarkt herausschlagen könnte, als Europa in seiner jetzigen Verfassung zufällt. Vor dieser Vision, auf deren Verwirklichung die EU-Staaten nun hinarbeiten, zieht sich der bisherige Binnenmarkt den Makel zu, bei aller gedeihlichen Zusammenarbeit die europäische Sache ständig zu belasten. Das „Festhalten an verschiedenen Währungen“ gerät in manchen Fassungen des Plädoyers für die Einheit zur gigantischen Quelle von Kosten, in anderen zum unerträglichen Handels- und Investitionshemmnis…
Die Selbstkritik am Binnenmarkt: ebenso radikal wie inkonsequent
Solche Charakterisierungen dessen, was überwunden werden soll, leiten sich alle vom vorgestellten Nutzen ab, den man erzielen will. Die mit demonstrativem Eifer vorgetragenen Beispiele verharmlosen auch in eigentümlicher Weise die Veränderung, auf die die Gemeinschaft da zusteuert, wenn der Wandel als Entlastung von den Mängeln des bisherigen Arrangements verdolmetscht wird. Dafür, daß die verschiedenen Währungen die Handels- und Investitionstätigkeit in der EG nicht hemmen, haben schließlich schon die verabredeten Bestimmungen über den freien Waren- und Kapitalverkehr Sorge getragen; und das EWS hat sich stets darum bemüht, daß die Wirkungen auf die nationalen Gelder nicht in eine Beschränkung des innereuropäischen Geschäfts ausarten. An der Mark, die – so das andere Beispiel – bei ihrer Wanderung durch die Staaten der Gemeinschaft fünfzig Pfennige einbüßt, ist nämlich immer auch die Hälfte verdient worden; das Kreditgewerbe, das doch noch immer als Dienstleistungsbranche gilt, der ihre Gewinne zustehen, verliert ohne den regen Austausch von Devisen einen bedeutenden Geschäftsposten… Solche Hinweise zählen gegenüber dem erklärten Reformwillen nicht, obwohl sie den offiziellen Vorteilsrechnungen durchaus ebenbürtig sind, was im übrigen auch für die Frage nach den enormen Kosten der Währungsunion zutrifft. Die verblassen nämlich vor den aufgezählten Vorzügen, weil diese nur als plausible Stellvertreter für die Sache fungieren; und die halten die Anwälte der Währungsunion nicht für vorteilhaft, sondern für notwendig. Wenn sie die Abschaffung von „Kosten“ und „Hemmnissen“ propagieren, fingieren sie nämlich den Standpunkt nicht nur des Euro-Geldes, sondern auch den des dazu gehörigen Hüters. Und weil beide noch gar nicht existieren, aber her müssen, geht das Projekt gegen das Geld vor, das es in Europa gibt. Den Euro schaffen ist eben dasselbe wie die Abschaffung der vorhandenen Währungen.
Darin besteht die radikale Seite des Angriffs auf die überkommene Geschäftsordnung der Gemeinschaft: Mit der Verfügung über einen eigenen Nationalkredit ist den Souveränen das Instrument entzogen, mit dem sie ihren Standort zu einer nationalen Geschäftssphäre herzurichten gewohnt sind, um mit anderen Nationen innerhalb der EU um die Erträge des grenzüberschreitenden Geschäfts zu konkurrieren. Insofern ist der Einwand, den der Beschluß von Maastricht praktisch geltend macht, einer gegen die Konkurrenz eigenständiger Nationalökonomien innerhalb Europas, und zwar im Namen und zugunsten der Konkurrenz, die diese Einheit gegen den Rest der Welt austrägt. Die Schwäche des Wirtschaftsbündnisses besteht nach der längst maßgeblichen Sicht des WWU-Vertrags schlicht darin, daß sich die Mitglieder – was für kapitalistische Nationen ebenso geboten wie normal ist – nach wie vor die dem Weltmarkt abgerungenen ökonomischen Potenzen streitig machen. Das ist bekanntlich der Sinn von Einheit: kein Gegensatz, sondern gemeinsame Sache machen, sich ihr unterordnen.
Die Inkonsequenz einer Währungsunion des Maastrichter Typs ist denen zuerst aufgefallen, die als Strategen der internationalen Konkurrenz noch stets für mehr Macht viel übrig haben. Mit dem Antrag „Erst politische Einheit – dann Währungsunion!“ haben sie – auch mit ostentativer Sorge um das neue Geld und seine Brauchbarkeit – Einspruch angemeldet. Es wollte ihnen nicht einleuchten, daß in bezug auf das Handwerkszeug – die nationale Geldhoheit – eine reale Entmachtung der europäischen Souveräne nützlich ist, solange diese Nationen ansonsten weiterhin ermächtigt bleiben, im Interesse ihrer Anliegen, auch solcher der Standortbetreuung, zu kalkulieren. Sie haben bemerkt, daß mit einem Euro die Standortkonkurrenz – bei eigenständiger Haushaltsführung, weiterhin nationalen Bilanzen, mit Sitz und Stimme in europäischen Institutionen, wo die EU-Staten ihre Rechte beim Haushalten mit dem gemeinsamen Supranational-Kredit geltend machen – überhaupt nicht beendet ist und deswegen womöglich das famose Instrument unbrauchbar macht.
Und soviel geht ja auch aus der Konstruktion von Maastricht hervor: Die Teilnehmer am Projekt haben aufgrund nationaler Berechnungen am Instrument des einen Geldes Geschmack gefunden; sie haben unterschrieben, weil sie sich zugunsten ihrer Nationalökonomie eines brauchbareren Geldes bedienen wollen als dessen, das sie haben; ihre Mitwirkung verbinden sie mit dem Ziel der Mitbestimmung, die sie von der EU-Agenda gewohnt sind – ganz so, als ob die Bewirtschaftung des Euro-Währungsgebiets in derselben Form wie bisher als produktiver Streit um die Verteilung von Mitteln stattfinden müßte. Dabei haben sich kalkulierende Nationalisten, denen eine Zukunft mit Euro-Besitzern als Konkurrenten ausreichend überzeugend vorkam für ihre Unterschrift, auch nicht von den gar nicht verhohlenen Motiven mancher Partner abschrecken lassen. Daß die politische Union die fällige Konsequenz der Währungsunion sei, ja durch das gemeinsame Geld, wenn es erst einmal da ist, ernötigt werde, ist als absichtsvolle Perspektive wirklich zur Genüge dargetan worden. Andererseits war aber mit dem Maastrichter Vertrag selbst eine Unterordnung, gar eine Preisgabe der eigenen Souveränität nicht verbunden. Vielmehr die Aussicht auf einen Zuwachs an ökonomischer Macht für die Teilnehmer. Und was die Lesart des ganzen Projekts als einer „Umkehrung der Reihenfolge“ – erst Währungs-, dann politische Union – anlangt, so gilt in allen europäischen Königshäusern und Kanzlerbuden eben die Devise, daß man auch bei diesem Prozeß als berechtigter Souverän dabei sein wird…
Dennoch ist das radikale Moment angesichts der Vertagung der Gründung der „Vereinigten Staaten von Europa“ nicht zu kurz gekommen. In Anbetracht der Leistung, für die das gemeinsame Geld vorgesehen ist; unter Berücksichtigung der Berechnung, die allen beteiligten Nationen mit der Schaffung des Euro genehmigt wurde – dieses Mittel soll ihnen als überlegener Ersatz ihres existierenden Nationalkredits verfügbar sein –, haben die Architekten von Maastricht eine Entdeckung gemacht. In vollem Bewußtsein des Risikos ihres Unternehmens gewahrten sie, daß auch ein künftiger Nationalkredit nur so gut ist, wie vorher mit ihm gewirtschaftet und hausgehalten wurde. Der umstandslose Ersatz der alten Gelder durch das neue, in Form eines schlichten Umtausches, kam daher nicht in Frage. Schließlich hatte sich in Jahrzehnten europäischer Bündniswirtschaft herausgestellt, daß die europäischen Gelder einen recht unterschiedlichen Grad von Zuverlässigkeit in Sachen weltweites Geschäftsmittel aufweisen. Und dies galt den mit der Schaffung des neuen Geldes betrauten Währungshütern nicht einfach als „natürliches“ Resultat der innereuropäischen Konkurrenz, sondern als Beweis für geschäftsschädigenden Umgang der in Gelddingen unterlegenen Nationen mit ihrem Haushalt. Dergleichen wollen sie dem Euro von vorneherein ersparen. Dieses Urteil hat der Vertrag von Maastricht in die Forderung verlängert, die beitrittswilligen Länder hätten die erwiesene Mißwirtschaft bei der Betreuung ihrer Standorte abzustellen – und sich dadurch den Zugang zum Euro zu verdienen. Die Mitgliedschaft in der Währungsunion ist seitdem nicht mehr nur eine Frage des Willens, sondern auch der Fähigkeit. Und über die urteilt eine gemeinsame Satzung, die den Nationen einen Preis benennt, nach dessen Entrichtung sie mitmachen dürfen beim neuen Geld. So daß die Unterordnung der Souveräne doch zu ihrem Recht kommt: in der als Beitrittsbedingung formulierten Selbstbeschränkung – bei der Benützung des Kredits, den sie haben.
2. „Stabilität“: Die Verpflichtung der Nationen auf die Macht des Euro-Geldes
Dem Bedürfnis, die vielbeklagten „Reibungsverluste“ durch Währungsvielfalt abzustellen, wäre mit der Einführung des einen Geldes Genüge getan. Was die neue Währung in der Konkurrenz Europas mit dem Rest der Welt und für sie leistet, ergäbe sich aus der Mobilisierung von Kapital, die der Einsatz des gemeinsamen Nationalkredits zustandebringt; und die Geldmärkte hätten zu entscheiden, ob die Rentabilität der mit dem Euro, in den Mitgliedsstaaten wie außerhalb, getätigten Geschäfte sichere Anlagen und Zinsen versprechen, die konkurrierenden Angeboten ebenbürtig sind. Genau mit diesem Ensemble von Bewährungsproben rechnen die Planer der Währungsunion – und weil sie sie bestehen wollen, führen sie die neue Einheitswährung nicht einfach ein.
Das Bedürfnis nach einer Erfolgsgarantie, zumindest nach einer Minimierung der Risiken, denen sie ihren Supranationalkredit allemal aussetzen, hat sie auf den folgenschweren Befund gebracht, daß nur gutes Geld den Test der Märkte besteht. In getreulicher Mißachtung ihres Sachverstandes –
„International erfolgreiche Währungen – so lehrt allerdings nicht nur die jüngere Wirtschaftsgeschichte – werden nicht von der Politik per Dekret etabliert; sie müssen sich an den Finanzmärkten im Wettbewerb durchsetzen.“ (Issing vom Direktorium der Deutschen Bundesbank) –
treffen sie währungspolitische Vorkehrungen dafür, daß der Euro als gutes Geld auf die Welt kommt. Dabei bereitet ihnen das Gleichheitszeichen, dem sie durch ihre Währungsreform praktische Geltung verschaffen – die alten nationalen Gelder werden durch die neue Währung ersetzt – einiges Kopfzerbrechen. Denn der Blick auf die europäische Währungslandschaft verrät ihnen, daß die Stellung der nationalen Währungen „an den Märkten“, das internationale Vertrauen in sie recht unterschiedlich ausfällt. So würde nach ihrem Urteil der Euro durch den Tausch gegen die alten Gelder mit der Erblast geschlagen sein, die ihm aus den Schwächen einer ganzen Reihe seiner Vorgänger bzw. Bestandteile zufällt. Gegenüber den Finanzmärkten würde er gleich mit dem Makel antreten, die Defekte der unzuverlässigen Nationalkredite (mit) zu repräsentieren – und den Nutzen seines besseren Erbguts untergraben.
Daß die Losung „Stabilität“, die hierzulande „stark wie die Mark“ heißt, auf eben diese Sicht der Dinge zurückgeht, beweisen nicht nur einschlägige Zitate von Bundesbankern und Ministern, in denen die Qualifikation für die Finanzmärkte die Voraussetzung dafür ist, daß der Euro seine segensreichen Wirkungen für das Wachstum in Europa entfaltet. Wenn die Wechselkurse in Europa, die schließlich über die relative Kaufkraft der Devisen Auskunft geben und – durchaus dem Urteil der Märkte zufolge – die Brauchbarkeit der diversen Zettel als Geld in seinen einfachen Funktionen gewichten, gar nicht als verläßlicher Ausgangspunkt für die Union zählen, dann ist eines klar: Die erste Prüfung, zu deren Absolvieren die Macher ihr Geschöpf befähigen wollen, ist die im Fach „Weltgeld“. Bei aller ideologischen Beflissenheit ist ihnen geläufig, daß sie einen Nationalkredit ins Leben rufen, dem die internationale Geldhandelszene seine Geldqualitäten attestieren muß. Und überhaupt: Was anderes hat die nationalökonomische Kategorie der „Stabilität“ zum Inhalt als eben die Sicherheit, mit der ein nationales Kreditgeld auf dem Weltmarkt immerzu dasselbe leistet wie daheim, wo es gesetzlich geschützt ist?
Vom Herstellen einer stabilen Währung für Europa
Das Risiko einer Währungsunion, ein Produkt auf den Weltmarkt zu bringen, dem die Anerkennung der Märkte als brauchbares Geschäftsobjekt und -mittel verweigert wird, gründet eindeutig in der mangelhaften Qualität der Nationalkredite, aus denen das Produkt verfertigt werden muß. Jedenfalls ist dies der Inhalt des Beschlusses von Maastricht, der – von den EU-Mitgliedern unterzeichnet – den Hütern der Währungen, die abgeschafft werden, ein Reparaturprogramm vorschreibt. Die Stabilitätskriterien kritisieren nämlich die Tauglichkeit der nationalen Geldwesen und machen die Mißwirtschaft ihrer Verwalter dafür verantwortlich, daß die Ablösung der Währungsvielfalt durch den Euro eine so prekäre Sache ist.
Durch diese Kriterien ist das Paradox in die abendländische Kultur gekommen, daß ein Projekt von Nationen, ein Einigungswerk, bei dem sie alle mitmachen wollen, zum Zwang gegen sie ausartet. Und nicht nur das: Die Auflagen, die sie gegen sich selbst beschlossen haben, wollen sie auch prompt erfüllen und regeln über das Scheitern bzw. Gelingen der einschlägigen Bemühungen, ob sie an der Veranstaltung teilnehmen dürfen. Das Bedürfnis nach einer Erfolgsgarantie des künftigen Geldes hat ein Verfahren zu seiner Herstellung hervorgebracht, das den Umgang mit den noch vorhandenen Nationalkrediten, dem aktuellen Konkurrenzmittel der EU-Staaten, mit lauter Ge- und Verboten belegt. So hat die zum Zweck der Stabilitätsgarantie des Euro verabschiedete Satzung für den Weg zur Währungsunion dafür gesorgt, daß die Unterordnung unter den gesamteuropäischen Standpunkt schon stattfindet, bevor die Währungseinheit fertig ist.
Die einstigen Konvergenzkriterien leisten als Beitrittsbedingungen offenbar mehr, als sie als Stabilitätskriterien taugen. Denn die Prozentzahlen, die man erstens nicht mehr hören und sehen mag und die zweitens alles auf den Kopf stellen, werden zum Leitfaden der Haushaltsführung in allen europäischen Nationen. Zunächst bei allen, die nach dem Muster: „Stabil ist eine Nation, die folgende%-Zahlen aufweist“, andere Zahlen hatten und sofort merkten, daß sie ihre Finanzen anders einteilen mußten, als sie es von sich aus getan hätten. Dann sogar in Deutschland, dessen unbestritten stabile Mark den Prozenten zum Status von Indices verholfen hat, die gutes Geld nicht nur anzeigen, sondern verbürgen. Der finanzpolitische Umkehrschluß, der sich bis Maastricht noch nicht einmal in VWL-Büchern fand, wo manche Wirkung mit ihrer Ursache erst verwechselt und dann gleichgesetzt wird, fand Eingang in die innereuropäische Konkurrenz. Die dreht sich seitdem um den Nachweis der Euro-Tauglichkeit, die unablässig von jeder nationalen Öffentlichkeit überprüft wird – daheim und bei den anderen.
Die berüchtigten Prozente geben zwar als Garant einer stabilen Währung wenig her – nicht einmal Waigel dürfte daran glauben, daß die Gelder der Mittelmeerländer mit der Erfüllung der Kriterien plötzlich als Reservewährung der gehobenen Staatenwelt oder als Transaktionswährung fürs internationale Ölgeschäft fungieren. Das Urteil, das sie über die Ökonomie der EU-Staaten fällen, ist auf eine andere Wirkung berechnet – und die kommt durch die Befolgung des mit ihm verkündeten Imperativs zustande. Daß in europäischen Landen ein Mißverhältnis zwischen Wachstum und Schulden des Staats besteht, wollen die Ziffern schon behaupten. Und im Namen des Euro ergeht die Aufforderung an die Regierungen, sich gefälligst zu entschulden. So reicht die europäische Satzung für die Währungsunion den Ergebnissen der innereuropäischen Konkurrenz den Befund hinterher, daß den Verlierern die Befugnis entzogen ist, sich mit ihrem durch das Bündnis anerkannten Nationalkredit um die Verbesserung ihrer Lage zu kümmern. So werden die geschädigten Nationen mit dem Status vertraut gemacht, der ihnen vom Standpunkt des geldvereinten Europa aus zusteht. Zu ihrer Förderung, für die Bedienung ihrer nationalen Rechnungen ist europäischer Kredit schon jetzt nicht mehr da. Und die Gunst, den von ihnen regierten Landstrich der Bewirtschaftung durch den Euro zu überantworten, müssen sie sich dadurch erwerben, daß sie keine Belastung darstellen.
Mit der Währungsunion ist also auch der Fortschritt verbunden, daß die Hierarchie in der europäischen Staatenwelt geklärt wird, wobei bei allem Einheitsgedusel überhaupt nicht verborgen bleibt, welche ökonomischen Musterstaaten aus den „Sachzwängen“, die mit Maastricht aufgestellt wurden, ihre Zuständigkeit für den Gebrauch europäischen Geldes ableiten. Das hindert die zweit- und drittklassigen Souveräne allerdings überhaupt nicht daran, die Teilnahme am Projekt anzustreben. Denn daß ihre Nationalökonomien dank längerer Bündniswirtschaft „von Europa leben“ und „Dabeisein“ die bessere Alternative darstellt, als gegen den in einer Geldunion zusammengeschlossenen Verein bestehen zu müssen, braucht ihnen keiner zu sagen.
Die Erfüllung der Stabilitätskriterien hat die Regierungsprogramme in Europa um einen dominanten Auftrag bereichert und ist in vollem Gange. Von den Maßnahmen, mit denen die Häupter der Nationen in nahezu identischer Weise ihren Standort auf Euro-Kurs bringen, wird zwar ausführlich, aber nicht immer ganz zutreffend berichtet. Das liegt schon daran, daß Entschuldung und Sparen nicht dasselbe sind, ganz zu schweigen von der Verwechslung von Sparen mit weniger Schulden machen
:
- Eine Verringerung der Staatsschulden findet schon deshalb nicht statt, weil sie da sind. Sie befinden sich als geldwerte, mehr oder minder fest verzinsliche Eigentumstitel und Banknoten unter den Leuten – und der Staat wird den Teufel tun, diesen Derivaten seiner hoheitlichen Kreditwirtschaft die Anerkennung zu entziehen und damit seine Schulden zu streichen. Die europäische Währungsreform zielt darauf ab, das ganze Zeug in Euro-Geld zu überführen; von einem Offenbarungseid als Weg dahin ist nichts zu hören. Vielmehr bedient jede Nation brav ihre Schulden, damit sie weiterhin etwas wert sind. Deswegen werden sie auch stündlich mehr.
- Was die Abteilung „weniger Schulden machen“ betrifft, so hat sie ihr Maß an einem
als eigentlich geplant
, das sich auf staatliche Vorhaben bezieht, die in die Standortpflege vom Museum bis zur Wehrmacht fallen. Besagtes Maß hat den Nachteil, daß es ein ideelles ist, also für das, was gemacht wird, auch neue Schulden in die Welt gesetzt werden. Aber eben nicht so viel, wie man sich genehmigen wollte – und Streichungen bei bisherigen Posten der Volksbetreuung (Ausbildung, Bäder, Bibliotheken) finden statt. - In der Abteilung Standortpflege, die auf die Förderung rentabler Geschäfte gemünzt ist, verhält es sich einerseits genauso. Allerdings besinnt sich der Staat, der „für den Euro spart“, hier darauf, daß die Maastrichter Prozente ein Verhältnis von Staatsschuld zu Wachstum gebieten und daß dieses durch die Anwesenheit international konkurrenzfähiger Betriebe im Land zustandekommt. Also müssen nicht nur trotz Euro, sondern auch wegen ihm ein paar Subventionen sein, aber andererseits nicht alle, die der Nation ohne Euro einen Versuch wert gewesen wären. Bei der Sichtung der Unternehmen nach dem Grad ihrer Förderungswürdigkeit kommt es da schon vor, daß Staatsschulden als Finanzierung von rentabler Industrie durch die Vergangenheit ins Unrecht gesetzt worden sind und eine Werft zumachen muß; aber auch, daß die Zukunft zu sichern ist und für die Konkurrenzartikel des Marktes von morgen Kredit da ist. Die Entscheidungen zwischen Tun und Lassen rufen viel Volksgemurmel und allerlei alternative Kalkulationen hervor, weil sich Nationalisten nur wegen Europa nicht gern „ihre Region“ platt machen lassen und ihre Steuern für den Transrapid abliefern.
- Da der Kapitalstandort ein Sparen in dem Sinn auch nicht ratsam erscheinen läßt, trifft es sich gut, daß mit dem Sozialstaat auch das Volk zu der Ehre gelangt ist, in die nationalökonomische Rubrik der Kosten zu rutschen, die den Staatshaushalt belasten. An Leuten, die keiner rentablen Betätigung nachgehen, weil sie krank, für die Rentabilität überflüssig oder alt sind, eröffnet sich stabilitätsbeflissenen Nationen wirklich ein gewisses Sparpotential. Die europäische Konkurrenz auf diesem Feld kann sich sehen lassen, ebenso wie die staatlichen Anstrengungen zur Senkung des Lohns im Lande, was als Waffe der internationalen Konkurrenz in ganz Europa anerkannt ist. Ergänzt um die wohldosierte Gegenfinanzierung der Staatsschuld durch Steuern bewirkt das alles zwar keine Wunder, aber es macht sich gleich hinter dem Komma der Zahlenwerte bemerkbar, mit denen die europäischen Staaten ihren Gesundheitszustand messen.
Was die Selbstbeschränkung im Einsatz des Nationalkredits, die Streichung von Staatsausgaben, die bis dato fester Bestandteil von Standortbetreuung waren und jetzt für verzichtbar erklärt werden, wirklich leistet, ist denen leicht anzusehen, die die Standorte mehrheitlich bevölkern. Aber darum geht es schließlich nicht, was auch die unterrichtende und unterrichtete Öffentlichkeit weiß – andernfalls wäre der Zynismus nicht Gewohnheit geworden, der sich im Kontrast von nationalen Erfolgsmeldungen – „Börsen tendieren fest“, „DM stark“ – auf der einen Seite und rührenden Geschichten über die alltägliche Verelendung auf der anderen austobt. Ebensowenig ist die Sortierung unter den europäischen Nationen, die Tatsache, daß die zweit- und drittklassigen Partnerstaaten an Reichtum nicht nur verloren haben, sondern sich ihren dauerhaften Ausschluß vom großen Geschäft gefallen lassen, groß der Rede wert. Die Hierarchie im Abendland gilt längst als natürlich und liefert auch europäisch gebeutelten Untertanen den Stoff für manche rassistische Einlage. Nein – die eigentliche Frage, die sich stellt, lautet: „Kommt der Euro oder kommt er nicht?“ Und diese Neugier, die ohne jede Ahnung auskommt und von der Sache gar nichts wissen will, wird kräftig bedient: durch Unterrichtung der notorisch Betroffenen über die Schwierigkeiten der Macher mit ihrem Projekt. Und das sind nicht wenige.
***
Mit der Erklärung dieser Schwierigkeiten, ihrer ideologischen und praktischen Bewältigung befaßt sich der 2. Teil des Artikels in der nächsten Nummer:
Das Unbehagen an der „Stabilitätskultur“
So sehr die auf Erfüllung der Maastricht-Kriterien gerichtete Haushaltsdisziplin geschätzt wird, so gründlich wird auch daran gezweifelt, daß sie den Erfolg des Projekts sicherstellen.
Neben die Prüfung, welche Nationen die verlangten Zahlen rechtzeitig zustandebringen, tritt die Frage, ob es sich bei der Befolgung der Vorschriften nicht um eine vorübergehende Anstrengung, schlimmer noch: um eine bloße Schönung der Bilanzen handelt. Und dieser Verdacht ist begründet. Nichts von dem, worauf es kapitalistischen Nationen ankommt, hat sich in den Jahren gebessert, in denen die EU-Staaten gespart haben.
Von einem Abbruch des Projekts ist allerdings nicht die Rede. Der politische Wille, ein gutes Geld auf dem Weltmarkt zu etablieren, erklärt sich nicht für gescheitert. Statt selbst Mißtrauen gegenüber der Qualität europäischer Finanzen zu stiften, beschließt die EU zusätzliche Maßnahmen, die Stabilität verbürgen sollen.
- Mit einem „Stabilitätspakt“ wird das Regime der Kreditdisziplin für die Zukunft festgeschrieben. Damit die Welt sieht, daß der Euro vor Mißbrauch geschützt ist. Nationen, die sich zuwenig Wachstum, also zuviel Schulden zuschulden kommen lassen, werden für ihren Verlust – der kein Beitrag zu Europa ist – bestraft.
- Mit einer Europäischen Zentralbank wird die zentrale Bewirtschaftung der Euro-Zone beschlossen. Die „politische Unabhängigkeit“ dieses Instituts soll die nach wie vor vorhandenen Nationen daran hindern, den Euro für ihre eigenen Kalkulationen einzusetzen. Ihre Wirtschaftspolitik ist darauf verpflichtet, Beiträge zur Mehrung europäischer Geldmacht zu leisten – nicht den Euro als Hebel für ihre Konkurrenz einzusetzen.
- Der doppelte Schutz vor schädlichem Gebrauch des Euro ist dasselbe wie eine Entmachtung der Einzelstaaten zugunsten der Bewirtschaftung Europas als Domäne eines politischen Standortbetreuers und Währungshüters, den es aber immer noch nicht gibt. Die Ausschaltung des innereuropäischen Nationalismus, der in Gestalt der verschiedenen Souveräne nach wie vor sein Recht besitzt, gebietet die höchstförmliche Regelung der Kompetenzen. Also die Organisation einer „Entscheidungsstruktur“, die verhindert, daß der Standpunkt der Einheit am Partikularismus zuschanden wird. Die Gemeindeordnung, die das leistet, will erstritten sein – den Partnern ist schließlich die Zustimmung zu manchem Souveränitätsverzicht abzuringen. Wem die Kompetenzen zufallen, wem sie entzogen werden – die politische Verteilung der Macht in Europa – leitet sich – so ist das in Wirtschaftsfragen – aus den ökonomischen Potenzen ab, die die einen „einbringen“ und die anderen brauchen.
Die „Technik“ der Umstellung: Vorkehrungen für die Bewährungsprobe
Weil das europäische Geld die Anerkennung der „Märkte“ will, braucht es sie auch. Mit jedem Schritt, der im „Fahrplan“ zur Währungsunion getan wird, mit jedem Stichtag (Festschreiben der Wechselkurse, Umrechnung in Euro, Eröffnungsbilanz gegenüber dem Dollar) soll der Respekt der ganzen Welt vor dem Euro gesichert werden – also setzt sich Europa auch dem Urteil der maßgeblichen Instanzen aus. So erhält jede Entscheidung, von der innereuropäischen Quotenregelung bis zur Bestückung der gemeinsamen Reserve, den Charakter eines Signals – für eine Szene, in der der ökonomische Sachverstand so seine spekulativen Eigenheiten aufweist.
3. Der kritische Zustand des europäischen Kapitalismus – die historische Rahmenbedingung der Währungsunion
Die Währungsunion ist zwar von der nun schon Jahre währenden Krisenbewältigung durchaus zu unterscheiden; praktisch zu trennen sind die Durchsetzung der Entwertung von Kapital und die Konkurrenz um einen neuen Nationalkredit allerdings nicht mehr. Auch die „Suche nach Wegen aus der Krise“, die stets den Charakter einer Rettung der Nation aufwiesen, die ihren Aufschwung organisierte, ist im europäischen Zirkus unter Aufsicht gestellt. Dadurch wird sichtbar, was das imperialistische Experiment einer supranationalen Währungsreform alles aufmischt.
[1] „Arbeitsplätze“ werden durch diese Finanzierung von Gewinnen bekanntlich noch teurer, als sie ohnehin schon sind.
[2] Vgl. GegenStandpunkt 4-94, S.137 „Weltmarkt und Geldmarkt – Die Währung und ihr Wert“