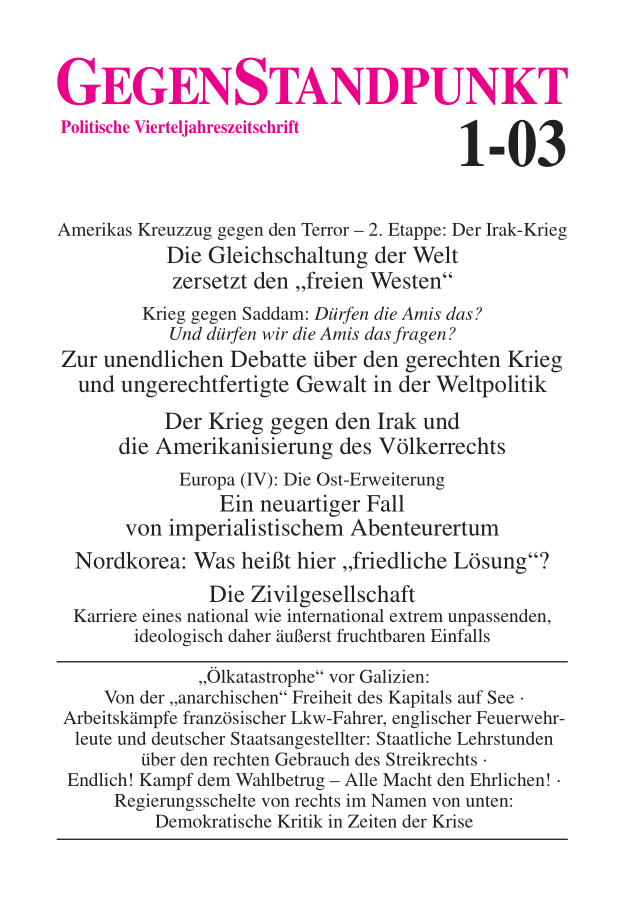Europa (IV): Die Ost-Erweiterung
Die friedliche Eroberung des europäischen Ostens durch Europas Westen:
Ein neuartiger Fall von imperialistischem Abenteurertum
Nach der Auflösung des Warschauer Pakts und der Selbstzerstörung der Sowjetunion hat die EU keine historische Sekunde gezögert, ihren Anspruch anzumelden: Die aus dem Moskauer Regime entlassene Staatenwelt vom Baltikum bis zur ihrerseits „ethnisch“ zerlegten Tschechoslowakei gehört – zu – ihr. Dass diese Länder ihrer gesamten inneren Verfassung nach zu dem exklusiven Club „westlicher“ Nationen überhaupt nicht passten, spielte für den Entschluss zu ihrer Eingemeindung keine Rolle – oder vielmehr eine nachdrücklich bestärkende.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Siehe auch
Systematischer Katalog
Gliederung
- Die Beitrittskandidaten: Eine „marktwirtschaftliche“ Wende von oben, ein Kapitalismus ohne Kapital und das Paradox einer passiven Standort-Politik
- Die Aneignung Nahosteuropas: Die Subsumtion der Beitrittsländer unter das Regime einer neuen europäischen Standortpolitik
- Der imperialistische Fortschritt: Das strategische Kalkül der EU, ein „machtpolitischer“ Zugriff und lauter alte und neue Drangsale
Europa (IV): Die Ost-Erweiterung
Die friedliche Eroberung des
europäischen Ostens durch Europas Westen:
Ein neuartiger
Fall von imperialistischem Abenteurertum
Nach der Auflösung des Warschauer Pakts und der Selbstzerstörung der Sowjetunion hat die EU keine historische Sekunde gezögert, ihren Anspruch anzumelden: Die aus dem Moskauer Regime entlassene Staatenwelt vom Baltikum bis zur ihrerseits „ethnisch“ zerlegten Tschechoslowakei gehört – zu – ihr. Dass diese Länder ihrer gesamten inneren Verfassung nach zu dem exklusiven Club „westlicher“ Nationen überhaupt nicht passten, spielte für den Entschluss zu ihrer Eingemeindung keine Rolle – oder vielmehr eine nachdrücklich bestärkende: Wenn Arbeit und Lebensunterhalt der Bevölkerung ersichtlich völlig anderen Richtlinien folgten als denen größtmöglicher Kapital-Rentabilität, wenn die öffentliche Gewalt sich um ganz andere Dinge zu kümmern hatte als im „marktwirtschaftlichen“ Rechtsstaat, wenn sogar Ärzte und Künstler ganz andere Probleme als die Abrechnungssorgen ihrer westlichen Kollegen hatten und im Militär sowieso ein ganz anderer „Geist“ herrschte als unter Westeuropas „Bürgern in Uniform“, dann lag hier eine Erblast aus den Zeiten der „nationalen Unterdrückung“ durch den russischen Sowjetkommunismus vor, die schleunigst aus der Welt zu schaffen wäre und deren Beseitigung auch weiter keine Probleme bereiten dürfte. Dass die vom „sowjetrussischen Joch“ befreiten Nationen mit ihrer frisch gewonnenen politischen Autonomie etwas anderes anzufangen wissen könnten, als sich ohne Umschweife bruchlos in den sehr speziellen Supra-Nationalismus der Europäischen Union einzugliedern, eine solche Möglichkeit haben Westeuropas Machthaber gar nicht erst in Betracht gezogen – oder vielmehr: durch ihr großherziges Angebot einer Beitrittsperspektive haben sie sie mit aller Entschiedenheit ausgeschlossen.
In den neuen bzw. antikommunistisch „gewendeten“ alten Nationalpolitikern Osteuropas haben sie für diese Politik denkbar passende Erfüllungsgehilfen gefunden. Die Machthaber im ehemaligen „Ostblock“ haben zielstrebig die überkommene Parteiherrschaft liquidiert, die „realsozialistische“ Planwirtschaft eingestellt, die Einbindung ihrer Länder in das „sozialistische Lager“ und eine von Moskau gelenkte Arbeitsteilung mit ihren „Brudernationen“ gekündigt – und mit ihrer neu gewonnenen vaterländischen Freiheit haben sie wirklich nichts Besseres anzustellen gewusst, als unbedingt und mit allen Mitteln den Anschluss an „den Westen“, an NATO und EU, anzustreben. Der Vollzug hat dann zwar noch gut ein Jahrzehnt gedauert; auch sind noch nicht alle Staaten dabei, die die Westeuropäer ihrem unmittelbaren exklusiven Zuständigkeitsbereich zurechnen und einfügen wollen; die Ratifizierung des großen Vertragswerks über den Beitritt von acht Ländern aus dem ehemaligen sowjetischen Machtbereich sowie der beiden souveränen Mittelmeer-Inseln Cypern und Malta durch 25 Nationalparlamente steht noch aus; in manchen Fällen muss sogar noch eine Volksabstimmung stattfinden, deren Ausgang noch nicht einmal sicher ist. Die Vereinbarung steht jedoch; nach Auskunft aller Beteiligten ist in Kopenhagen im Dezember einmal mehr „Jalta endgültig überwunden“ worden und die unwiderrufliche „Wiedervereinigung Europas“ gelungen.
Und sonst nichts?!
Die Beitrittskandidaten: Eine „marktwirtschaftliche“ Wende von oben, ein Kapitalismus ohne Kapital und das Paradox einer passiven Standort-Politik
Die „Wende“-Regierungen der ehemaligen Ostblock-Staaten haben beschlossen, in ihrem Land „die Marktwirtschaft“ einzuführen: kapitalistische Produktions- und Konsumtionsverhältnisse. Diese Entscheidung haben sie nicht auf Antrag oder auf Druck einer bereits existierenden oder in Entstehung begriffenen kapitalistischen Bourgeoisie getroffen, als die politischen Akteure einer neuen Eigentümerklasse, die schon dabei gewesen wäre, die alten ökonomischen Zustände und Beziehungen „von innen her“ zu zersetzen und durch das Kommando ihres Geldes über die in der Gesellschaft verrichtete Arbeit zu ersetzen, und die von ihrer Obrigkeit die Anpassung von Recht und Gesetz, Verfassung und Politik an die bereits virulenten gesellschaftlichen Interessen-Gegensätze, Konflikte, Konkurrenzbeziehungen und ein diesen gemäß definiertes Gemeinwohl verlangt oder erzwungen hätte. Der Umsturz ging von der politischen Führung aus: Die Chefs der bis dahin auf „realen Sozialismus“ programmierten Staatsparteien, leitende Funktionäre eines nach amtlichen „Kennziffern“ und mit Produktionsplänen, „Hebeln“ des „sozialistischen Wettbewerbs“ und dergleichen bewirtschafteten nationalen Gemeinwesens, waren zunehmend unzufriedener geworden mit den im Vergleich zum „marktwirtschaftlich“ operierenden „westlichen“ Gegner höchst mangelhaften Erträgen, die ihre Nationalökonomie dem staatlichen Gemeineigentümer abwarf.[1] Regierungen und „Eliten“ der egalitären Arbeiter- und Bauern-Staaten waren sich zudem untereinander und auf der Ebene der materiellen Wünsche und Hoffnungen auch mit ihrem gleichfalls unzufriedenen werktätigen Fußvolk darüber einig geworden, dass letztlich doch nicht bloß die mangelhafte Umsetzung bester sozialistischer Absichten, sondern das System selbst, die un-„marktwirtschaftliche“ Natur ihres staatsparteilich regulierten Produktions- und Versorgungswesens schuld sein müsste an dessen fehlender Effizienz. Dass Volk und Führung beim Wunsch nach höherer Effektivität inkommensurabel Verschiedenes im Sinn hatten – die einen träumten von dem in der freiheitlich-„marktwirtschaftlichen“ Werbung zu besichtigenden Überfluss an Mangelgütern ihres „realsozialistischen“ Alltagslebens, ohne der Preisfrage das Gewicht beizumessen, das ihr im real existierenden Kapitalismus unweigerlich zukommt; die anderen kalkulierten kritisch die Machtmittel durch, die sie aus dem gesellschaftlich erzeugten Überschuss abschöpfen bzw. im Kräftevergleich mit ihren „westlichen“ Kollegen nicht abschöpfen konnten –, das war der letzteren Seite ganz recht und ist der ersteren bis heute nicht klar geworden. Beschlossen wurde der „Systemwechsel“ jedenfalls von den Inhabern der politischen Macht mit dem Ziel, ihre Staatsgewalt und das von ihnen kommandierte Gemeinwesen aus den Drangsalen einer welthistorischen „Konfrontation der Systeme“ zu befreien, die ihr eigenes zunehmend schlechter aushielt und schon gar nicht mehr zu gewinnen vermochte.[2] Einer Gesellschaft ohne die Leute, die im Reich der Freiheit „die Wirtschaft“ heißen, zusammengesetzt aus staatlich verplanten und mit allerlei „ökonomischen Hebeln“ „angereizten“ Werktätigen und Funktionären einer auf Arbeiterfreundlichkeit festgelegten „Planung und Leitung“, wurde „Marktwirtschaft“ verordnet: ein Wirtschaften nach den Maximen eines „richtigen“, auf Profit und sonst nichts programmierten Kapitalismus.
Mit diesem „Systemwechsel“ haben die zur „Marktwirtschaft“ bekehrten Machthaber im „Ostblock“ nicht mehr und nicht weniger als eine gründliche Effektivierung der Basis ihrer nationalen Macht bezweckt – und nicht nur das: Sie haben sich auch praktisch so dazu gestellt, als ginge es beim Umsturz ihrer Produktionsweise um gar nichts weiter als um eine Art durchgreifender wirtschaftstechnischer Runderneuerung, den Austausch einer umständlichen Weise der Wirtschaftslenkung gegen eine bessere. Sie sind ans Werk gegangen, als bräuchte nur von dem vorhandenen Bestand an produktivem Reichtum und an ebenso gebildeter wie disziplinierter Arbeitskraft, über den sie nach Jahrzehnten „realsozialistischer“ „Ineffizienz“ in durchaus reichlichem Maß verfügten, ein flotterer Gebrauch gemacht zu werden, um ihre Länder in der Hierarchie der Nationen nach oben zu katapultieren, und als wäre der Kapitalismus die optimale Methode dafür. Eine Ironie der Geschichte: Mit umgekehrten Vorzeichen und in entgegengesetzter Richtung hatten ihre antikapitalistisch und proletarisch gesinnten Vorgänger, die Erfinder des „realsozialistischen“ Systems, den komplementären Fehler begangen. Die hatten ihre „Planwirtschaft“ so organisiert, als hätte ihnen die kapitalistische Produktionsweise nicht bloß allerhand Produktivkräfte und eine tüchtige Arbeiterklasse hinterlassen, sondern mit ihren verdinglichten gesellschaftlichen Produktionsverhältnissen, ihren systemeigenen zivilisatorischen Errungenschaften wie Lohn, Preis, Profit, Kredit, Zins usw., auch schon die „Hebel“ für eine auf wundersame Weise automatisch wirkende vernünftige „Planung und Leitung“ der gesellschaftlichen Produktion und Versorgung an die Hand gegeben, und als würden ausgerechnet diese Instrumente des kapitalistischen Konkurrenzkampfes ihre wahre planerische Leistungskraft und menschenfreundliche Wirksamkeit erst und nur dann entfalten, wenn sie den konkurrierenden Unternehmern weggenommen und von Staats wegen im richtigen Sinne eingesetzt würden. In Wirklichkeit hat ihre Partei mit der Entmachtung und Abschaffung der Eigentümerklasse und der Verstaatlichung aller politökonomischen Verrücktheiten des Kapitalismus gar nicht einfach einen anderen Gebrauch von an und für sich unbestreitbar sinnreichen „Mechanismen“ der Wirtschaftslenkung gemacht, sondern deren ein für alle Mal und ausschließlich kapitalistische Zweckbestimmung und Wirkungsweise gründlich zerstört. Mit dem Gebrauch von Lohn, Preis, Profit usw. als politökonomischem „Hebel“werk hat sie zwar keine kommunistischen, aber durchaus neuartige Produktionsverhältnisse in Gang gebracht. Die Planungsinstrumente dieser neuen politischen Ökonomie wiederum ließen sich bei aller Namensgleichheit mit kapitalistischen Einrichtungen genauso wenig auf dem Wege gesetzlicher Umwidmung in einen funktionierenden Kapitalismus zurückverwandeln, wie dieser per „Sozialisierung“ in ein System vernünftiger gesellschaftlicher Lebensplanung zu „transformieren“ gewesen war. Das haben freilich die aus nationaler Unzufriedenheit systemkritisch gewordenen Nachfolger genauso wenig so gesehen wie die „realsozialistischen“ Systemgründer. Mit ihren Fabriken und Landgütern, ihrem Gemeineigentum und ihrem politökonomischen Instrumentarium – Geld, Warenpreisen, Löhnen, Profiten, planmäßiger „Kredit“-Zuteilung an volkseigene Betriebe, der Pflicht zu planmäßiger Zinszahlung als Erfolgsausweis, Gewinnabführung an den staatlichen Gesamteigentümer usw. – haben die sich im Besitz eines kompletten, im Prinzip funktionstüchtigen Kapitalismus gewähnt, der durch den Rückzug des Staates aus seiner Planungs- und Leitungstätigkeit und die Überantwortung des Wirtschaftsgeschehens an die „Privatinitiative“ neuer Eigentümer nur freigesetzt werden müsste, um unweigerlich und machtvoll aufzublühen – ein Wahn, wie gesagt, ganz komplementär zur Illusion der einstmaligen Avantgardisten des Proletariats, sie bräuchten dem Kapitalismus bloß seine privateigentümlichen „Fesseln“ abzunehmen, um ihn in ein sozialistisches Paradies zu verwandeln.
Tatsächlich ist aus dem erhofften allgemeinen kapitalistisch effektiven Los-Wirtschaften nichts geworden. Der „Systemwechsel“ hat im Gegenteil den flächendeckenden Zusammenbruch der nationalen Ökonomien des Ex-„Ostblocks“ bewirkt. Die Schuldfrage war schnell beantwortet: Die Planwirtschaft von früher hätte mit all ihren produktiven Reichtümern wohl doch bloß Schrott hinterlassen. Und in gewissem Sinn trifft das ja auch zu: Wenn es ab sofort darauf ankommen sollte, im internationalen Wettbewerb mit kapitalistisch produzierten Waren mitzuhalten und in nationalem Maßstab Geld zu verdienen, dann war mit den überkommenen „realsozialistischen“ Produktionsmitteln und -methoden wirklich nicht viel herzumachen. Im „freien Westen“, dessen Erfolgsrezepte man kopieren wollte, hatte schließlich das unbedingte Interesse an immer rentablerer Arbeit und der Zwang der Konkurrenz zu dauernder allgemeiner Rentabilitätssteigerung Jahrzehnte lang für den entsprechenden „technischen Fortschritt“ gesorgt: für einen verschwenderischen „moralischen Verschleiß“ der jeweils gerade erst eingeführten Produktionsapparate, für eine Runde „Innovationen“ nach der anderen. Während dessen waren die Planer und Leiter des „realen Sozialismus“ zwar mit den Erträgen ihrer Ökonomie immer unzufriedener geworden; zu dem Übergang, weltrekordmäßige Ertragsziffern in vollem Ernst zur Überlebensbedingung ihrer volkseigenen Betriebe zu machen und steigende Rentabilität der Arbeit zur Existenzfrage für ihre „Werktätigen“, hatten sie sich aber nicht – bzw. erst ganz am Ende – verstanden; und die gigantische Verschwendung von durchaus noch benutzbaren Produktionsmitteln, die der kapitalistische Konkurrenzkampf ganz nebenher zu Stande bringt, planmäßig zu organisieren, wäre ihnen vollends gegen den Strich gegangen. Das Ergebnis sah und sieht entsprechend aus: Mit jeder echten kapitalistischen Bewährungsprobe, der der „realsozialistische“ Produktionsapparat ausgesetzt wurde,[3] stellte sich nicht bloß ein gewisser „Innovationsbedarf“ heraus, sondern die komplette „moralische“, nämlich nach den Sitten des Konkurrenzkampfes um überlegene Kapitalproduktivität praktisch ermittelte Untauglichkeit sämtlicher Produktivkräfte, mit denen die Herren der osteuropäischen Industriestaaten groß und erfolgreich ins Weltgeschäft hatten einsteigen wollen.
Interessanterweise war den forschen „Transformations“-Politikern aber auch gleich klar, welcher Weg einzig und allein aus dem Desaster herausführen könnte. Wirksame Abhilfe erhofften sie sich nicht von einer Mobilisierung überlegener Ingenieurskunst und einer Ankurbelung der Produktionsmittelindustrie – das wäre ja wieder „Planwirtschaft“ und „Sozialismus“, also hoffnungslos ineffektiv gewesen! –, sondern allein, aber auch mit größter Sicherheit von der Zufuhr auswärtigen Kapitals: Nicht einfach neue Maschinen, sondern Anlage suchende Gelder müssten her, flüssiger kapitalistischer Reichtum aus den westlichen Ländern, die davon sowieso mehr als genug hätten. Mit diesem dringlichen Antrag sind sie in der „marktwirtschaftlich“ entwickelten Welt ringsum vorstellig geworden – und haben damit ein in mehreren Hinsichten höchst bemerkenswertes und auch folgenreiches Eingeständnis abgeliefert. Erstens nämlich und vor allem haben sie damit – und das ganz gewiss nicht aus wissenschaftlicher Einsicht – klargestellt, was ihrer nationalen Wirtschaft zu einem anständigen Kapitalismus fehlt: Es fehlt komplett an Kapital – nicht an dem, was der ökonomische Sachverstand „Kapitalgüter“ nennt, sondern an dem ökonomischen Gegenstand, an dem das den Kapitalismus auszeichnende gesellschaftliche Herrschaftsverhältnis, die exklusive und universelle Kommandogewalt des Privateigentums, hängt: Es fehlt an einem Geldvermögen, das sich flächendeckend der überkommenen Produktionsmittel bemächtigt und diese zu Konkurrenzzwecken dauernd erneuert, das per Lohnzahlung über die Arbeitskraft der Gesellschaft verfügt, das also Arbeit und gegenständliche Reichtumsquellen für seine Vermehrung in Anspruch nimmt und das Überleben der nationalen Menschheit von seinem profitträchtigen Umschlag abhängig macht. Alles andere war und ist ja sogar noch da: An Fabriken, Maschinen, Landgütern usw. fehlt es nicht – davon gibt es im Gegenteil, gemessen an den Erfordernissen der neuen Produktionsweise, viel zu viel, wie an ihrer ziemlich flächendeckenden Stilllegung abzulesen ist. Bereitwillige, taugliche Arbeitskräfte gibt es erst recht nicht bloß zur Genüge, sondern im Verhältnis zum nunmehr geltenden gesellschaftlichen Bedarf in viel zu großer Zahl. Und der „Sachzwang“, für den die öffentliche Gewalt zuständig ist: die praktische Nötigung der bislang „realsozialistisch“ kommandierten und versorgten Gesellschaft, sich fortan eigenverantwortlich mit privatem Gelderwerb im Dienste kapitalistischer Dienstherren durchzuschlagen, lässt schon gar nichts zu wünschen übrig, nachdem die Staatsmacht das einstige Gemeineigentum ideellen oder wirklichen Privateigentümern überantwortet, die bisherige Wirtschaftsplanung und -lenkung ersatzlos eingestellt, ihre frühere Verantwortung für Lebensunterhalt und Versorgung der Leute gestrichen und an sie zurück-delegiert und das Geldverdienen zum einzigen und ausschließlichen gesellschaftlichen Lebensmittel erhoben hat. Das alles bleibt jedoch unproduktiv ohne private Geldmittel, die als Vorschuss fungieren und reichlich genug sind, um Warenproduktion und -zirkulation immer rentabler zu gestalten und so Überschuss zu erzielen. Und solches Vermögen kommt durch das Dekret einer „marktwirtschaftlichen“ Wende noch lange nicht zustande. Eben deswegen ergeht an die Kapitalbesitzer, die es im eigenen Land nicht, dafür aber im Ausland gibt, das dringliche Gesuch, sie möchten sich der nationalen Kapitalnot annehmen und das lebende und tote Inventar des Landes in ihre Geschäftstätigkeit einbeziehen.
Natürlich geht die wirtschaftspolitische Aktivität der „marktwirtschaftlich“ gewendeten Ex-„Ostblock“-Staaten nicht im Versenden von Bittbriefen auf. Sie tun durchaus auch einiges für die Entstehung kapitalistischer Geldvermögen in ihren Ländern: Geld drucken sie wie jeder anständige Souverän, alimentieren damit auf dem Kreditwege eine nationale Bankenwelt, von der sie sich umgekehrt die Haushaltsmittel leihen, die ihre steuerpflichtige Bürgerschaft ihnen nicht abwirft; so kommt dann schon ein Haufen geldwerter Forderungen an den Staat in privater Hand zusammen. Und was an Zahlungsfähigkeit in der Gesellschaft zirkuliert, findet auch seinen Weg in die schwarzen und offiziellen Kassen geschäftstüchtiger Kaufleute. Der Haken ist nur, dass das Geld, das die Staatsgewalt stiftet und das im Land umläuft, für die Zwecke einer allgemeinen kapitalistischen Akkumulation nicht taugt. Was bei privaten Geschäftemachern hängen bleibt, langt regelmäßig nicht als Vorschuss für irgendeinen nennenswerten Produktions- und Zirkulationsprozess; schon gar nicht unter den Bedingungen einer freien Konkurrenz um das bisschen brauchbare Kaufkraft im Land mit etablierten westlichen Unternehmen, die sich in Jahrzehnte langen Konkurrenzkämpfen vor allem mit ihrer Kapitalgröße gegen ihresgleichen durchgesetzt haben und damit nun auch im Osten auftrumpfen; und auf freies Konkurrieren haben sich die dort regierenden „Marktwirtschaftler“ ziemlich unbesorgt festgelegt und halten daran schon allein deswegen fest, weil sie sich sonst mit ihrem Wunsch nach Kapitalimport auswärts überhaupt nicht sehen lassen könnten. Was insgesamt von Staats wegen an Kreditgeld geschaffen wird und hauptsächlich sowieso bloß unproduktiv und auf staatliche Rechnung zwischen Staatsbank, Kreditspekulanten und Fiskus hin und her zirkuliert, langt schon gleich nicht, um eine ganze kapitalistische Nationalökonomie in Gang zu setzen, geschweige denn flächendeckend mit neuen Produktionsmitteln auf dem Rentabilitätsniveau der erfolgreichsten Weltmarkt-Konkurrenten auszustatten; es ist eben ein Unterschied, ob ein staatlicher Geldschöpfer mit seinen Produkten eine kapitalistisch tätige nationale Geschäftswelt auf dem Kreditweg beim Reicher-Werden unterstützt oder ob seine Druckerzeugnisse gar nicht vorhandenes Geldvermögen ersetzen müssen. Einen entscheidenden Unterschied macht das vor allem für kapitalistische Unternehmer, die erstens jede ihnen zur Übernahme angebotene Firma auf attraktive Geschäftsaussichten hin begutachten und mit den Beständen an alten „realsozialistischen“ Reichtumsquellen schon mal überhaupt nichts anfangen können, und die zweitens die Währung eines jeden Landes, in dem sie sich engagieren sollen, äußerst kritisch darauf hin befragen, ob es sich um eine handelt, die zu verdienen sich überhaupt lohnt – was dann ganz bestimmt nicht der Fall ist, wenn ein Staat immerzu zu Lasten seines Haushalts Zahlungsfähigkeit „schöpft“ und kein Kapitalwachstum seine Schöpfungen rechtfertigt. Auch diesem kritischen Urteil über ihre zu „marktwirtschaftlichem“ Geld umdeklarierte Nationalwährung haben die osteuropäischen Reformstaaten sich gestellt, eben weil sie mit ihrer „realsozialistischen“ Erbmasse einen Erfolg als Teilhaber des globalen Kapitalismus anstreben, und den Bescheid erhalten, dass ihr Geld als kapitalistische Anlagewährung überhaupt nichts wert ist und als Erlös aus Warenexporten nur so viel, wie sich davon garantiert in Devisen umtauschen lässt. Dieser Ablehnungsbescheid eint die Osteuropäer mit all den „emerging markets“ und „überschuldeten Schwellenländern“, die eine Karriere als Verlierer im kapitalistischen Wettbewerb der Nationen hinter sich gebracht haben, darüber enorm viel abstrakten Reichtum an auswärtige Nutznießer los geworden sind und aus eigener Kraft nurmehr über wertlos gewordenes Kreditgeld verfügen – nur dass bei den „Transformations“-Staaten alles ganz anders ist: Die fangen ihre kapitalistische Karriere ohne Kapital an; was sie an konkretem, gegenständlichem Reichtum und gesellschaftlicher Produktivkraft besitzen, ist kapitalistisch nichts wert, weil es nicht das Ergebnis flächendeckender kapitalistischer Bereicherung, also nicht schon als Verfügungsmasse privater kapitalistischer Kommandomacht in die Welt gekommen ist; deswegen fehlt umgekehrt das private Vermögen, sich der vorhandenen Mittel zu bemächtigen und sie für das eigene Wachstum zu instrumentalisieren. Mit dem Beschluss, dass bei ihnen fortan Kapital akkumuliert oder gar nicht mehr gewirtschaftet werden soll, büßen diese Staaten daher – „marktwirtschaftlich“ völlig folgerichtig – ihre sämtlichen ökonomischen Mittel ein. Statt aus dem bisherigen Staatsbesitz produktives Kapital „freizusetzen“, enteignen sie sich und ihre Gesellschaft und führen selber ihre Unfähigkeit herbei, aus eigener Kraft überhaupt noch irgend ein Produktions- und Versorgungswesen, geschweige denn ein Wachstum zustande zu bringen.
Mit ihrem Entschluss zum „Systemwechsel“ haben die anti-„realsozialistischen“ Machthaber im Osten Europas somit eine Entscheidung getroffen, deren entscheidende zweite Hälfte, die Neueröffnung einer „real existierenden“ kapitalistischen Nationalökonomie nämlich, gar nicht in ihrer Macht liegt. Das überkommene Produktions- und Verteilungssystem lahmlegen bzw. in den vollständigen Zusammenbruch treiben oder treiben lassen, Arbeitskräfte zur Untätigkeit verurteilen, Lohnzahlungen stornieren und Fabriken vergammeln lassen, das „volkseigene“ Gemeineigentum zur Privatisierung ausschreiben: Das alles war per Dekret zu bewerkstelligen, sehr leicht sogar bei einem so extrem pflegeleichten Volk und einer Staatspartei aus lauter antikommunistischen Renegaten. Damit haben sie aber ein Projekt in Angriff genommen, dem sie überhaupt nicht gewachsen sind: Ihr Zerstörungswerk kapitalistisch produktiv werden zu lassen, liegt gar nicht mehr in ihrer Hand.
Irritiert hat sie das jedoch nicht und schon gar nicht von ihrer Entscheidung abgebracht. Im Gegenteil: Die „marktwirtschaftlichen“ Erneuerer alter nationaler Herrlichkeit standen nicht an, ihre Ohnmacht einzugestehen, aus der niemand anders als das von Kapital überquellende westliche Ausland ihnen heraushelfen könnte und heraushelfen sollte. Und das ist, wie folgerichtig auch immer, dann doch ein wenig paradox. Denn immerhin waren sie angetreten, um ihrer nationalen Staatsmacht eine effektivere ökonomische Basis zu verschaffen, ihrem Anspruch auf weltweiten Respekt und einen Aufstieg in der Hierarchie der souveränen Nationen zu mehr autonomer Durchschlagskraft zu verhelfen, der einstigen Bevormundung durch ein auswärtiges Machtzentrum – das in Moskau – einen ganz nationalen Erfolgsweg entgegenzusetzen; nichts und niemand sonst als ihr eigener patriotischer Ehrgeiz hatte schließlich den „Systemwechsel“ in Gang gesetzt.
Genau dieser „Aufbruch“ mündet nun geradewegs und alternativlos in die programmatische Entscheidung, die Bewirtschaftung von Land und Leuten, die materielle Basis der nationalen Staatsmacht und insoweit auch die Handlungsfreiheit der souveränen Landesherren selber von den Kalkulationen auswärtiger Geschäftsleute und den Beschlüssen fremder Regierungen abhängig zu machen. Der Wille, einen eigenen ordentlichen Kapitalstandort zu eröffnen, verwirklicht sich in dem Antrag, in die Standortpolitik anderer einbezogen zu werden: in die Unternehmenspolitik von Multis, die mit ihrem Stammsitz, ihren Börsennotierungen, ihren Konkurrenzkalkulationen, dem Geld, in dem sie ihre Erfolge und Misserfolge nachzählen, mit ihren Schulden und ihren Investitionsentscheidungen in ganz anderen nationalen Welten zu Hause sind als ausgerechnet in der des ostmitteleuropäischen Post-Sozialismus; und in die Wirtschaftspolitik fremder Regierungen, die ihre hoheitliche Gewalt darauf verwenden, ihrem Kapitalstandort und ihrer Währung die optimale Pflege angedeihen zu lassen. Ausgerechnet an die Funktionäre der etablierten Profitmacherei und an die Instanzen eines auswärtigen ökonomischen Nationalismus wenden sich die gewendeten Reformpolitiker mit ihrem unbefriedigten und erklärtermaßen hilflosen nationalen Materialismus; und zwar mit dem einzigen „Argument“, das ihnen in diesem schönen Verhältnis überhaupt bloß zu Gebote steht: Sie deklarieren alles, worüber sie politisch zu bestimmen haben – Land und Leute, Produktivkräfte und Versorgungsnotwendigkeiten, Geldbedarf und Zahlungsfähigkeit, zur Geschäftsgelegenheit für auswärtige Interessenten –, zur freien Verfügungsmasse aller Vorteilsrechnungen, die Firmenmanager und Standortpolitiker anderswo anstellen. Deren Konkurrenzstrategien liefern sie ihre Nationen aus und spekulieren dabei auf die Produktivkraft des Zugriffs- und Eroberungswillens von Kapitalisten und westlichen Politikern, mit dem ihre „realsozialistischen“ Vorgänger ja wahrhaftig zur Genüge behelligt worden sind: Den Feinden von einst müsste doch daran gelegen sein, den Triumph ihres überlegenen Systems mit dessen erfolgreichem Export nach Osten zu vollenden und ein bisschen kapitalistische Aufbauhilfe zu leisten. Mit ihrer Politik der aktiven Passivität, der offensiven Überantwortung des ökonomischen Schicksals ihrer Nationen an „Kapitalgeber“ und wirtschaftspolitische Betreuer aus dem Ausland, sind die Erneuerer der einstigen „Ostblock“-Staaten gleich so weit gegangen, die Aufnahme ins Wirtschaftsbündnis der perfekt entwickelten kapitalistischen Nationen Westeuropas zu beantragen. Erst und nur die Integration in deren Binnenmarkt, so ihre Kalkulation oder jedenfalls die innere Logik ihres Beitrittsgesuchs, wäre die Garantie für den durchgreifenden, irreversiblen „Entwicklungsschub“, den sie wollen und brauchen und aus eigener Kraft nicht hinkriegen. Denn als Teilhaber der Europäischen Union wären sie Teil des großen Kapitalstandorts Europa und damit unweigerlich Nutznießer des kollektiven Wachstumsinteresses aller Mitgliedsstaaten und der auf die gesamte Union bezogenen Standortpolitik der Brüsseler Behörden.
Ganz offensichtlich haben sie da einiges übersehen; nämlich vor lauter Bewunderung, dass im Westen des Kontinents ökonomisch dauernd so enorm viel los ist, die Kleinigkeit, was da läuft und warum. Immerhin: Ihr Kalkül ist aufgegangen, sie dürfen in die EU hinein. Zu welchen Konditionen, mit welchen Zwischenergebnissen und mit was für einer Perspektive, das ist freilich ein anderes Kapitel.
Die Aneignung Nahosteuropas: Die Subsumtion der Beitrittsländer unter das Regime einer neuen europäischen Standortpolitik
Die EU hat den Beitrittswillen der anti- und post-sozialistischen Regierungen in Osteuropa mit einer klaren Beitrittsperspektive honoriert und sogleich umfassend in Beschlag genommen. Assoziationsabkommen wurden geschlossen; und zum Zwecke der „Heranführung“ an die kapitalistischen Standards der Union ist den Kandidaten das gesamte wirtschaftspolitische Regelwerk aufs Auge gedrückt worden, an das die alten Mitglieder über Jahre und Jahrzehnte hinweg ihre nationale Geschäftswelt und das sie zugleich umgekehrt an die speziellen Bedürfnisse ihres Standorts angepasst haben. Dabei ging und geht es keineswegs bloß darum, die Neuen mit der Geschäftsordnung des Vereins vertraut zu machen. Vermittels einer eigens entwickelten „Heranführungsstrategie“ werden die Beitrittsländer dazu angehalten, aus dem „acquis communautaire“ der Gemeinschaft, dem Gesamtbestand an Gesetzen, Vereinbarungen, wirtschaftspolitischen Maximen und kapitalistischen Gebräuchen, der sich seit den Tagen der ursprünglichen EWG akkumuliert hat, ihre eigene neue Staatsräson abzuleiten und diese pünktlich in die Tat umzusetzen. Wie das zu gehen hat, ist den Kandidaten kapitelweise vorbuchstabiert, ihre ökonomische und soziale Verfassung ist daran gemessen und kritisiert, fällige Korrekturen sind abgesprochen, deren Ergebnisse überprüft, neue Vorgaben erlassen, ganze Kataloge von Anpassungsschritten sind über Jahre hinweg abgearbeitet worden.[4] Dabei sind die Prüfungs- und Korrekturbeauftragten der EU so zu Werk gegangen – und in dem Sinn sind sie sich auch mit ihren Partnern „vor Ort“ einig geworden –, als ginge es um gar nichts weiter als um die Übernahme einer vorbildlichen, vielfach bewährten und leicht zu kopierenden Methodik guten Regierens. Tatsächlich definieren sie praktisch, nach der grundsätzlichen formellen Seite hin wie inhaltlich, was die Souveränität und nationale Selbstbestimmung der Neumitglieder in spe überhaupt wert und wozu sie gut ist. Formell geht sie darin auf, Diktate der EU anzuerkennen, als eigenes Vorhaben zu übernehmen und für die erfolgreiche Durchführung zu haften. Was den Inhalt dieser Diktate und der daraus zu deduzierenden neuen nationalen Freiheit betrifft, so besteht er in der kompletten Agenda einer umfassenden (Konter-)Revolution von oben. Er passt insofern haargenau zu dem Kalkül der zuständigen Regierungen, mit EU-Hilfe den „Systemwechsel“ erfolgreich hinzukriegen; allerdings schon auch ein wenig wie die Faust aufs Auge: Den anpassungswilligen Partnern wird die Hoffnung, die sie auf Europa setzen, als Anspruch der Union an sie zurückserviert. Sie kommen in den Genuss einer kollektiven Standort-Betreuung, die erst einmal voll zu ihren Lasten geht.
– So werden sie zielstrebig an den Binnenmarkt „herangeführt“, auf dem Europas Kapitalisten zu gleichen Bedingungen grenzüberschreitend konkurrieren und der Konkurrenz ausgesetzt sind. Konkurrenzerfolge und -niederlagen verteilen sich national höchst unterschiedlich; deswegen hat ein ganzes System von kollektiven Fördermaßnahmen und Ausgleichszahlungen den bisherigen Mitgliedern eine reelle Chance eröffnet, die eigene Geschäftswelt an die jeweils herrschenden Konkurrenzbedingungen zu gewöhnen, Nachteile durch Wachstumsgewinne an anderer Stelle zu kompensieren, insgesamt die entsprechend dosiert eingeführten Freiheiten des Waren-, Kapital- und Dienstleistungsverkehrs auszuhalten. Irgendwie haben das auch alle Beteiligten geschafft; vom freigesetzten Konkurrenzkampf profitieren sie zwar keineswegs gleichmäßig, doch haben ihn auch die minder Bemittelten nationalökonomisch einstweilen überlebt. Den Osteuropäern, die auf eine ebenso erfolgreiche „Umstellung“ ihrer ex-„realsozialistischen“ Volkswirtschaften setzen, wird nun die umstandslose Unterwerfung aller ökonomischen Aktivitäten unter den fertigen Binnenmarkt abverlangt – also nicht nur unter die kodifizierten Freiheiten eines länderübergreifenden kapitalistischen Konkurrierens, sondern unter die Konkurrenz- und Marktbeherrschungsverhältnisse, die Kapitalisten und Standort-Manager geschaffen haben, ohne dass ein Osteuropäer dabei gewesen, geschweige denn ein nationales Interesse aus dem Reich des einstigen Sowjetkommunismus berücksichtigt worden wäre. Die Unfähigkeit der Kandidatenländer, dieser Konkurrenz standzuhalten, wird allenfalls selektiv in Gestalt von einzelnen anerkannten „Anpassungsschwierigkeiten“ in Rechnung gestellt; grundsätzlich haben sie selbst die Konkurrenzfähigkeit aller wichtigen Sektoren ihrer Volkswirtschaft herzustellen. Praktisch läuft das auf die Nötigung hinaus, der Konkurrenz aus der EU alle Geschäfts-, also Konkurrenzbedingungen bereit zu stellen, die die für ihren Erfolg braucht, also selber dafür zu sorgen, dass zum Beitrittstermin bei ihnen definitiv nicht anders produziert und verkauft, Geld verdient und ausgegeben wird als genau so, wie der EU-„Markt“ es will, also auch zum Vorteil derer, die diesen „Markt“ ohnehin schon beherrschen. Das schließt ein, dass den Neulingen vorsorglich Beschränkungen auferlegt werden, wo sie sich Konkurrenzvorteile ausrechnen könnten und Altmitglieder um ihre europäisch verbrieften kapitalistischen Besitzstände meinen fürchten zu müssen.
– Was für den Binnenmarkt im Allgemeinen gilt und den Beitrittskandidaten aufgegeben wird, das gilt im Besonderen und ganz besonders streng in allen Belangen, die für die EU-Unterhändler in das Kapitel Privatisierung fallen. Bei den altgedienten kapitalistischen Nationen Europas bezeichnet dieses Stichwort den wirtschaftspolitischen Beschluss, alle Industrieunternehmen, die die bürgerliche Staatsgewalt besitzt und betreibt, weil sie sie, aus welchen speziellen Gründen auch immer, auf eigene Rechnung gegründet oder verstaatlicht hat, sowie alle möglichen öffentlichen Dienstleistungen, die traditionell in staatlicher Regie abgewickelt wurden und noch werden, weil es um die Sicherstellung allgemeiner Voraussetzungen des nationalen Geschäfts- und Erwerbslebens geht, in reguläre kapitalistische Unternehmungen zu verwandeln und diese direkt oder über die Börse an private Eigentümer zu verkaufen. Dem Fiskus bringt das ein letztes Mal Geld ein; der kapitalistischen Geschäftswelt wird eine neue Anlagechance geboten, im jeweils eigenen Land, aber auch mit Zugriffsmöglichkeiten auf die entsprechenden Geschäftsgelegenheiten in den Partnerländern. Der staatliche Alt-Eigentümer verspricht sich davon eine Zunahme der nationalen Wirtschaftskraft; manchmal so viel, dass er sich für die Rationalisierung und Entschuldung des zukünftigen Multi schon mal einen „finanziellen Kraftakt“ leistet, der die erhofften und erst recht die realisierten Privatisierungserlöse bei weitem überschreitet. Auf alle Fälle wickeln die EU-Regierungen solche Aktionen bei sich daheim sehr umsichtig berechnend ab; gegebenenfalls unter zeitweilig oder auch unbefristet geltenden Sonderkonditionen, die z.B. Konkurrenten aus dem außer- oder sogar dem innereuropäischen Ausland ausschließen. Das hindert sie aber überhaupt nicht daran, mit dem Anspruch auf alsbaldigen, umfassenden und rückhaltlosen Ausverkauf jeglichen „volkseigenen“ Betriebsvermögens über die „Transformations“-Länder herzufallen, für die damit etwas ganz anderes auf dem Spiel steht als der Rückzug der öffentlichen Hand aus ein paar letzten Staatsbetrieben und eventuell profitträchtigen Infrastruktur-Aktivitäten. Bei denen geht es um das Haupt- und Generalproblem ihres „Systemwechsels“, nämlich die große Schwierigkeit, überhaupt hinreichend viele und potente Privateigentümer für die Übernahme ihrer überkommenen Reichtumsquellen und die Neueröffnung eines kapitalistischen Geschäftslebens zu interessieren. Mit ihren wahrlich rücksichtslosen Angeboten stoßen sie auf eine wenig positive Resonanz: Das feilgebotene alte Zeug taugt nichts – Ausnahmen bestätigen die Regel – für welt- und binnenmarktgerechte Rentabilitätsanforderungen; die Aussicht, ein flächendeckendes Gewinnemachen erst in Gang bringen zu müssen, statt an einem allgemeinen Wachstum teilhaben zu können, überfordert grundsätzlich die Risikobereitschaft des wagemutigen kapitalistischen Privateigentums; entsprechend selektiv ist das Investitionsinteresse, und oft genug ist es sogar negativer Art, nämlich nur darauf aus, ohne wirkliche Investitionen, womöglich sogar per Lahmlegung und Schließung eines ortsansässigen Unternehmens Zahlungsfähigkeit abzusahnen. Bei allem Willen zur umfassenden Ermächtigung eines privaten Unternehmertums finden sich die zuständigen Reformregierungen daher fortwährend genötigt, zur Rettung der überkommenen industriellen Substanz ihrer Nationalwirtschaft und der Subsistenzmöglichkeiten ihrer Bevölkerung doch noch in der einen oder anderen Form als Unternehmensbetreiber tätig zu sein; also z.B. die Verwandlung eines ehemals volkseigenen Betriebs in eine eventuell sogar börsentaugliche kapitalistische Firma so vorzunehmen, dass erst einmal bloß eine Bank alle Aktien besitzt, die ihrerseits selber in irgendeiner Form dem Finanzministerium gehört – eine Privatisierungs-Technik übrigens, die so ähnlich auch in gediegenen europäischen „Marktwirtschaften“ praktiziert wird.
Gegen solche Notmaßnahmen zur Rettung vorhandener Reichtums- und Erwerbsquellen jedoch schreitet die EU im Rahmen ihrer „Heranführungs“-Politik mit Nachdruck ein, auch wenn mit diesen Rettungsbemühungen die ererbten Produktivkräfte nicht vor den neu einzuführenden Produktionsverhältnissen, sondern für dieselben gerettet werden sollen, und auch wenn andernfalls die De-Industrialisierung und totale wirtschaftliche Austrocknung ehemals schlecht und recht „blühender Landschaften“ droht. Auch und gerade dann, wenn für ganze Branchen keinerlei Aussicht auf ein privatwirtschaftliches Überleben besteht; auch wenn es dabei um so elementare Produktions- und Geschäftszweige geht wie die Herstellung der Grundstoffe einer „modernen Industrienation“ wie Energie oder Stahl oder ums Bankwesen – Wirtschaftstätigkeiten, die noch jeder kapitalistische Staat eher unter seine „dirigistische“ Fuchtel nimmt, als dass er sie verkommen ließe –: Aus allem soll der Staat „sich zurückziehen“; denn nach den binnenmarktwirtschaftlichen Maßstäben der EU beweist fehlendes kapitalistisches Interesse unwiderleglich die definitive Unbrauchbarkeit und Überflüssigkeit eines Unternehmens und gegebenenfalls auch eines ganzen Erwerbszweigs. Zu den wichtigen Forderungen der EU-Vertreter gehört daher die Einführung und konsequente, durchgreifende Anwendung eines Konkursrechts, das in der Nationalökonomie der Anschlussländer definitiv nichts bestehen lässt, was sich nicht so sehr lohnt, dass sich am Ende doch noch ein privater Käufer und Investor dafür findet – also nicht eben viel. So – nämlich dass die Privatisierung bei der Masse der Betriebe schlicht auf deren Abwicklung hinausläuft – haben sich die Reformer den Übergang zu einer „Marktwirtschaft“ auf EU-Niveau dann doch nicht gedacht; und entsprechend viel gibt es für die „Transformations“-Experten aus Brüssel zu tun, damit diese zentrale Beitrittsbedingung nicht bloß formell akzeptiert, sondern im richtigen „marktwirtschaftlichen“ Geist und ohne falsche Rücksichten mit Leben erfüllt wird.
– Ähnliches gilt für das Geld des Staates: für seine Beschaffung vermittels Schaffung durch Schulden der öffentlichen Hände ebenso wie für die damit finanzierten Posten in den öffentlichen Haushalten. Nach den Regeln der in der EU zur Vollendung gebrachten politischen Kunst, einen Kapitalstandort einschließlich lohnabhängiger und sonstiger Bevölkerung mit Geld zu regieren, steht hier dem Finanzbedarf der Staatsgewalt und deren Freiheit, gesetzliche Zahlungsmittel zu „schöpfen“, das förmlich ins Recht gesetzte gebieterische Interesse der kapitalistischen Geschäftswelt auf ein anständiges Geschäftsmittel, ein weltweit akzeptiertes „gutes“ Geld, gegenüber. Die Macht des bürgerlichen Staates, sich selbst zu kreditieren, relativiert sich an der Notwendigkeit, die der im internationalen Geldhandel vollzogene Währungsvergleich praktisch geltend macht: Jede Geldsumme, die die staatliche Verschuldung dem an rentablen Arbeitsplätzen geschaffenen Reichtum der Nation hinzufügt, muss ihrerseits als Vorschuss für lohnende Geschäfte Verwendung finden. Für die Regierung ergibt sich daraus der Auftrag, sich selbst und ihre kredithungrige Geschäftswelt einerseits so reichlich mit Finanzmitteln zu versorgen, wie das Kriterium des guten Geldes es andererseits bloß zulässt. Der Reiz dieser Aufgabe liegt darin, dass sie auch durch eine noch so raffinierte Handhabung der öffentlichen Gelder gar nicht wirklich zu lösen ist, weil in letzter Instanz der Saldo aus kapitalistischen Erfolgen und Niederlagen im Konkurrenzkampf der Nationen entscheidend ist. Für diesen Konkurrenzkampf haben die EU-Partner sich auch in der Währungsfrage zusammengetan und ein System der wechselseitigen Stützung der nationalen Gelder bei gleichzeitiger Kontrolle über deren Vermehrung und Verwendung durch die nationalen Staatsgewalten entwickelt. Dieses Währungssystem ist mittlerweile in die Schaffung einer gemeinsamen Währung und eines kollektiven Währungsregimes eingemündet und hat insoweit funktioniert, als die Teilnehmer das System weder gesprengt haben noch mit ihrer Haushaltspolitik daran gescheitert sind – wenn auch nur so lange, bis die so ekelhaft tiefe und lang andauernde kapitalistische Krise das europäische Kunstwerk derzeit dann doch einigermaßen durcheinander bringt.[5] Auf alle Fälle haben die Teilnehmer der Europäischen Wirtschafts- und Währungs-Union sich und einander auf ein Geldregime festgelegt, das jeden Staat für eine geglückte Verbindung von staatlicher Schuldenwirtschaft und kapitalistischem Wachstum im nationalen Maßstab haftbar macht. Und nichts geringeres als dieses Regime muten sie als Teil des „acquis communautaire“ ihren osteuropäischen Beitrittskandidaten zu: Staaten, die die Herstellung eines nationalen Kreditgeldes zwar kapitalistisch formvollendet zu organisieren verstehen, damit aber weder über ein anerkanntes, stichhaltiges kapitalistisches Geschäftsmittel verfügen noch über ein Budget, das den Grundregeln bürgerlicher Haushaltspolitik entspricht. Die Kapitalakkumulation, die mit ihrer Masse und Rate die Schöpfung eines staatlichen Kreditgelds rechtfertigen könnte, wollen sie überhaupt erst in Gang bringen; dem Geld, das sie zirkulieren lassen, müssen sie daher nicht zu einem stabileren, sondern überhaupt erst zu einem kapitalistischen Wert verhelfen; dafür wiederum fehlt ihnen das entscheidende Instrument, nämlich – Ironie der „Marktwirtschaft“ – ein Geld, dem die Geschäftswelt traut, was sie eben nur tut, wenn es sich schon als Mittel kapitalistischer Akkumulation bewährt. Dabei sind die Reformregierungen noch viel mehr als ihre kapitalistisch etablierten Kollegen anderswo, und in der EU schon gleich, auf Kredit angewiesen – aus demselben Grund, aus dem sie keinen haben: weil ein flächendeckendes und ersprießliches kapitalistisches Erwerbsleben fehlt, aus dem ihnen ganz regulär die Masse der benötigten Haushaltsmitteln in Form von Steuern zufließen würde. Auf der anderen Seite haben sie, wiederum aus demselben Grund, mit ihrem mittellosen Staatshaushalt einen umso umfangreicheren Aufgabenkatalog zu bewältigen. Nicht bloß Staatsbedienstete in großer Zahl aus den früheren Zeiten staatlicher Wirtschaftsplanung, auch die Masse der ganz normalen „Werktätigen“ steht noch auf Lohnlisten, für die direkt oder letztendlich die Staatsmacht gerade zu stehen hat; die leicht ebenso große Masse der nicht – mehr – gebrauchten „Werktätigen“ fällt sowieso öffentlichen Kassen zur Last. Vor allem aber die Fortführung einer nationalen Ökonomie, die diesen Namen noch verdient, durch den Staat – die wenigstens vorläufige Aufrechterhaltung eines wenigstens rudimentären Wirtschaftskreislaufs vom „primären“ Sektor und einer Produktionsmittelindustrie bis zum „Endverbrauch“, die Sicherstellung elementarer gesellschaftlicher Überlebens-Notwendigkeiten wie Stromversorgung, Verkehrswesen u.Ä. – schlägt nach der neuen Rechenart in dessen Kasse als Anhäufung von Verbindlichkeiten zu Buche, denen nicht eben viel an Erträgen gegenübersteht. Dafür sollen nun also die mittlerweile auch im kapitalistisch wohlsituierten Westen in Verruf gekommenen „Maastricht-Kriterien“ einer soliden Haushaltsführung gelten, schon vor dem Beitritt, und das sehr rigide. Immerhin hat die EU für die besondere pekuniäre Zwangslage ihrer Neumitglieder in spe insoweit Verständnis, dass sie die Notwendigkeit anerkennt, den dort geschaffenen und zirkulierenden nationalen Geldzeichen von außen die Geltung zu verschaffen, die ihre Urheber ihnen nicht verleihen können, nämlich überhaupt erst einmal eine gewisse Glaubwürdigkeit als Statthalter eines wirklichen Weltgeldes. Nötig findet sie das schon allein deswegen, weil schließlich ihre eigene etablierte Geschäftswelt auch auf dem nach Osten erweiterten Binnenmarkt ein Kauf- und Zahlungsmittel vorfinden will und soll, das zu verdienen sich lohnt. Also verspricht die EU und gibt sogar auf die Geldzeichen ihrer neuen Partner Kredit; formell nach dem Muster der Währungskredite, mit denen die stärkeren Mitglieder der EWWU früher schon operiert, in der Sache freilich etwas ganz anderes getan, nämlich die traditionsreichen, aber wacklig gewordenen Kreditgelder ihrer schwächeren Partner vor weiterer „erratischer“ Abwertung bewahrt haben. Umso härter fallen andererseits die Ansprüche aus, die ihre Unterhändler an die Haushaltsdisziplin der unbemittelten Neulinge stellen: Alles, was in deren Auf- und Ausgabenliste über die Positionen eines regulären westeuropäischen Staatsbudgets hinausgeht, verfällt schon mal per se dem Verdikt der anti-„marktwirtschaftlichen“ Abweichung, der unbilligen und gar nicht zu rechtfertigenden Subventionierung von Unternehmungen, die längst privatisiert oder liquidiert – oder auch per Privatisierung in den Konkurs geschickt – gehört hätten, der Fehlfinanzierung von schierem unproduktivem Konsum usw. Bei den Posten, die auch in schon seit Menschengedenken „marktwirtschaftlich“-freiheitlichen Nationen zum Kernbestand staatlicher Tätigkeit zählen, steht die ganz besonders kritische Prüfung an, was bei der Ausgestaltung dieser Teil-Haushalte womöglich noch auf das Konto überkommener Unsitten des „realen Sozialismus“ geht; im Ausbildungswesen wie in der Gesundheitsfürsorge und von der Kinderkrippe bis zur Altenpflege steht da vieles als „sozialer Luxus“ und Überbleibsel „wohlfahrtsstaatlicher“ – was selber schon ein Schimpfwort ist – „Bevormundung“ auf der Abschussliste. Beim verbleibenden Rest ist sorgfältig zu ermitteln, was der Staat sich überhaupt leisten kann, andererseits aber auch neu und womöglich über seine bisherigen Sorgepflichten hinaus leisten muss – eine Arbeitslosenkasse z.B. hat das „realsozialistische“ Gemeinwesen seinen Bürgern glatt vorenthalten; und die Infrastruktur an Autobahnen, mit der es ausgekommen ist, muss schleunigst der Umschlagsgeschwindigkeit des westeuropäischen Handelskapitals angepasst werden, damit Europa auch wirklich zusammenwächst. So bewährt sich der kategorische Imperativ der Haushaltsdisziplin als Instrument, die ehemals „realsozialistischen“ Gesellschaften Punkt für Punkt von oben her komplett „marktwirtschaftlich“ umzukrempeln – und dabei so unbefangen zu Werk zu gehen, als ginge es bloß um die selbstverständliche und für die EU-Partner insgesamt verbindliche Tugend staatlicher Sparsamkeit.
– Ein Kapitel für sich ist bei alldem die
Agrarpolitik, auf die die EU ihre
Beitrittskandidaten festlegt. Sie selber gibt seit
Jahrzehnten nach offiziellen Angaben mindestens die
Hälfte ihres kollektiven Budgets dafür aus, die
Produktivität ihrer zunehmend zur kapitalistischen
Agrarindustrie mutierten Landwirtschaft zu steigern, den
weltweiten Absatz der anfallenden Überproduktion zu
subventionieren und gleichzeitig den Großteil des
überkommenen Bauernstandes abzuwickeln; mit ansehnlichen
Erfolgen in allen drei Punkten. Dabei wird im Feilschen
um die einschlägigen Konditionen keineswegs bloß über
Ackerbau und Viehzucht verhandelt, sondern um die
Verteilung vergemeinschafteter Haushaltsmittel auf die
einzelnen Nationen gestritten, woraus sich die notorische
„Komplexität der Materie“, die Erbitterung bei der
„Konsensfindung“ sowie der Drang zu immer neuen Reformen
erklärt. An dieses „System“ lassen sich die zukünftigen
Mitglieder gar nicht so einfach „heranführen“ wie an die
anderen „marktwirtschaftlichen“ und
klassengesellschaftlichen Errungenschaften der Union.
Denn mit ihrer Aufnahme steht nicht bloß die Unterwerfung
auch noch ihrer Landwirtschaft unter die
Europa-gemeinschaftlich verfügten Rentabilitätskriterien
an, sondern eben auch ihre Eingliederung in das kunstvoll
austarierte Geflecht von Milchquoten,
Rindfleischsubventionen, Hartweizenkontingenten und allen
sonstigen Subsidien, aus denen sich der Saldo aus
Zahlungen in die und Bezügen aus der Gemeinschaftskasse
und somit der ganz wichtige Unterschied zwischen
„Nettozahlern“ und „Empfängerländern“ errechnet. Fest
steht auf alle Fälle, dass dieses „System“ weder so, wie
es ist, auf die Neumitglieder übertragen noch erst recht
auf deren besondere Stärken und Schwächen zugeschnitten
werden kann. Die bekommen stattdessen den Auftrag – und
mit den Konditionen für Einkommenshilfen an
Vollerwerbs-Landwirte, Preisgarantien für bestimmte
Produkte usw. auch gleich manch hilfreichen Sachzwang für
die pünktliche Erledigung der Aufgabe – verpasst, ihre
bäuerliche Bevölkerung auf das in der EU erzielte
Durchschnittsmaß von ca. 5 Prozent der erwerbstätigen
Gesamtheit zurückschneiden. Mit dem Anschluss an die EU
stellt sich nämlich heraus, dass die Länder Osteuropas
unter „realsozialistischer“ Herrschaft nicht bloß
überindustrialisiert worden, sondern
gleichzeitig überagrarisiert
gewesen sind, und
zwar ganz gleich, ob ein reaktionärer Kleinbauernstand
seine kommunistische Unterdrückung mit viel geistlichem
Zuspruch und unter dem Beifall aller Freunde der
freiheitlichen bäuerlichen Selbstausbeutung überdauert
hat oder ihrer Selbständigkeit beraubte Landarbeiter es
sich in agrarischen Großbetrieben gemütlich gemacht
haben. Hilfestellung für das fällige „Bauernlegen“
leisten die Verhandlungsführer der EU mit all den
restriktiven Marktzugangsregeln, mit denen ihre
heimischen Landwirte und Agrarindustrien groß geworden
sind und vor denen sich umgekehrt fast alles, was zu
Zeiten des „realen Sozialismus“ zur Ernährung der Massen
durchaus getaugt hat, schon wieder als hoffnungslos
„marode“ blamiert und vor allem als viel zu
„arbeitsintensiv“.
– Demokratisch soll es bei alledem auch noch zugehen. Denn auch das überlassen die EU-Funktionäre keineswegs den Machthabern vor Ort: zu entscheiden, wie der Fortschritt zur Klassengesellschaft modernen europäischen Zuschnitts am besten durchzusetzen, mit welchen politischen Mitteln einem an ziemlich viel „Gleichmacherei“ gewöhnten und vollzählig zu produktiver Tätigkeit herangezogenen Volk die „Rosskur“ einer Umstellung auf kapitalistische Lebensverhältnisse ohne einigermaßen flächendeckende Lohnarbeit am effektivsten aufzunötigen, mit wie viel Gewalt und welcher ideellen Belohnung die unausbleibliche Unzufriedenheit am wirksamsten unter Kontrolle zu bringen ist. Den Reformregierungen wird die Leistung abverlangt, ihre Revolution von oben gegen alle Widerstände bedingungslos durchzusetzen, dabei einen totalen „sozialen Frieden“ zu erzwingen und ihrem freien Wählervolk die Alternativlosigkeit der neuen Verhältnisse dadurch überzeugend klarzumachen, dass sie diese überhaupt nicht, dafür und stattdessen sich zur Wahl stellen. Bei den Gesichtspunkten, unter denen sie ihren mündigen Bürgern diese Alternative eröffnen, also Varianten der Zustimmung zur Auswahl anbieten, hat der Wunsch nach Wiederherstellung einstiger „realsozialistischer“ Bequemlichkeiten sowieso und auf alle Fälle der Ächtung anheim zu fallen; das brauchen die EU-Demokraten ihren Kollegen im Osten nicht erst mühsam beizubringen – obwohl auch da mit freiheitlichem Unwillen registriert werden muss, dass einige postsozialistische Machthaber sich nur um des lieben inneren Friedens willen um die eigentlich fällige Kriminalisierung der alten Herrschaft herumdrücken. Auch allzu viel Nationalismus soll aber nicht sein, weil es schließlich um ein allgemeines Ja zu einer Einordnung der jeweiligen Nation in den westeuropäischen Supranationalismus geht, die alle Merkmale einer Unterordnung des vom „Sowjetjoch“ befreiten Vaterlands unter die interessierten Direktiven mächtiger Nachbarn an sich hat. Die Machthaber selbst darf das sowieso nicht stören. Sie müssen darüber hinaus aber das Kunststück vollbringen, einerseits das vaterländische „Wir“ als neue antikommunistische Staatsgesinnung durchzusetzen, die ihre zur freien Meinungsbildung ermächtigte Gesellschaft überhaupt erst zum Volk macht und zuverlässig an „die nationale Sache“ bindet, und gleichzeitig andererseits dieses bedingungslos vereinnahmende nationale „Wir“ nicht absolut zu setzen, sondern mit einem entschieden pro-europäischen Internationalismus zusammenzurühren; gerade das Anschlussverfahren selber und seine Prozeduren und Zumutungen strapazieren nämlich die Vaterlandsliebe erheblich, fordern die in patriotische Enttäuschung übersetzte Unzufriedenheit von Regierenden wie Bürgern heraus, sorgen sogar für mancherlei Empörung und benötigen deshalb entschiedene Initiativen zur Bremsung des Nationalgefühls. Die Elite, die ihr Volk „nach Europa heim“führt, soll ihren Massen daher durchaus die nationale Parteilichkeit einimpfen, die eine funktionierende Demokratie allemal voraussetzt, Unzufriedenheit im Volk aber ausgerechnet da in die Schranken weisen, wo das den eigentlich total konstruktiven Übergang ins Politische macht, das eigene Wohl- und vor allem Schlecht-Ergehen mit dem der Nation identifiziert und mit dessen Schicksal hadert. Die emanzipierte Öffentlichkeit soll ihr Publikum patriotisch bei Laune halten, dabei aber von jeglicher Hetze gegen die reichen und besserwisserischen Nachbarn im Westen Abstand nehmen. Und dabei tun die hart gesottensten Nationalisten aus dem westlichen „Europa der Vaterländer“ so, als wäre ihr gebieterischer Anspruch auf einen demütigen Patriotismus im Osten nichts weiter als eine legitime Forderung der europapolitischen Hygiene und deren Erfüllung ein Kriterium demokratischer Reife.
Es ist per Saldo nicht eben viel, was die EU bei der „Heranführung“ ihrer östlichen Nachbarn an die westeuropäischen Standards von „Demokratie & Marktwirtschaft“ der marktwirtschaftlichen Eigeninitiative und dem demokratischen Selbstbestimmungsrecht der herangeführten Kandidaten selber überlässt – außer eben der Pflicht der zuständigen Machthaber, für das Ergebnis zu haften: mit ihrem Wahlamt vor ihrem wahlberechtigten Volk, und mit all ihrer Regierungsgewalt der EU gegenüber für die kompromisslose Durchsetzung der jeweils geforderten wirtschafts-, kredit-, haushalts-, sozial- und sonstigen politischen Fortschritte. Die von ihren Wählern mehrfach ausgewechselten Regierungen der Beitrittsländer und die Beitrittsmanager der EU haben auf die Art immerhin ein bemerkenswertes Gemeinschaftswerk hingekriegt. So ist es tatsächlich dahin gekommen, dass ausländische, in erster Linie westeuropäische und vor allem deutsche Kapitalisten in den neu erschlossenen Geschäftssphären zugegriffen haben. Banken und Autokonzerne, Handelsketten und Zeitungsverlage, Reiseunternehmen und Energie-Multis haben sich engagiert. Die können mit der Beitrittsperspektive, die das Vereinigte Europa seinem nahen Osten eröffnet hat, schon vor dessen Beitritt wirklich etwas anfangen: Dem ernsthaft vorangetriebenen „Heranführungs“-Prozess entnehmen sie die Gewissheit, dass es sich über kurz oder lang unbedingt lohnen wird, im Anschlussgebiet Geld zu verdienen; sie halten die Beitrittsländer insoweit für brauchbare Spekulationsobjekte; das macht diese Länder – bedingt, aber immerhin – kreditwürdig; und damit sind auch schon ein Geld und Geschäftschancen da, die kapitalistische Unternehmer sich nicht entgehen lassen. Die einen schöpfen mit konkurrenzlos billiger Massenware und daneben mit konkurrenzloser Luxusware ab, was bei den neuen Reichen wie den vielen Armen an Zahlungsfähigkeit zu holen ist. Andere Firmen finden Geschmack an der „realsozialistisch“ gepflegten und dabei spottbilligen Arbeitskraft in nächster Nachbarschaft ihrer angestammten Absatzmärkte, lassen die für sagenhaft niedrige Preise Zähne reparieren, Beeren und Pilze für die Küche auch noch der Aldi-Kunden sammeln und investieren sogar in neue Betriebe, so wie die „Transformations“-Politiker sich das erhofft hatten. Wieder andere entdecken den Reiz weiträumiger Landstriche und reichlich vorhandener Natur, was kombiniert mit der Geldnot der ortsansässigen Staaten die Verlegung von Produktionsanlagen oder Deponien heraus aus dem Geltungsbereich kleinlicher Umweltgesetze und – nur zum Beispiel – eine ebenso liberale Holzwirtschaft gestattet. Zu diesem insgesamt dann doch äußerst stückwerkhaften Aufbau gehört auf der anderen Seite eine ziemlich flächendeckende und überhaupt nicht produktive Zerstörung: Die Untauglichkeit der von der einstigen „Hebelwirtschaft“ übrig gebliebenen Reichtumsquellen für die Bedürfnisse der kapitalistischen Konkurrenz in Europa wird gnadenlos offengelegt. So robust die alten Industrieanlagen, so naturnah die Landwirtschaft – dem Kriterium der Rentabilität hält nichts davon Stand. Für die menschliche Arbeitskraft gilt dasselbe: Im Reich der „realsozialistischen“ Gemütlichkeit mag sie Nützliches geleistet haben; unter den Rentabilitätsbedingungen des Standorts Europa erfüllt sie den Tatbestand massenhafter, bislang bloß künstlich „verdeckter Arbeitslosigkeit“. Die wird nun gleichfalls ungeschönt „aufgedeckt“; und das Ergebnis ist nicht bloß eine staatlich registrierte Massenarbeitslosigkeit, wie sie allemal zu den Fortschritten des Kapitals dazugehört, sondern eine Subsistenzwirtschaft neuen Typs: Ein „werktätig“ gewesenes, in seiner neuen Bestimmung als Lohnarbeiterklasse gar nicht nachgefragtes Volk kämpft in einer „Schattenwirtschaft“ aus Selbstausbeutung und Tauschhandel um seinen Lebensunterhalt.
Diesen mittlerweile erreichten Zwischenstand behandelt die EU als Erfolg, der es rechtfertigt, den „Heranführungs“-Prozess allmählich abzuschließen, den Beitritt der ersten acht „Transformations“-Länder vertraglich zu vereinbaren und einen Termin dafür festzulegen. Dabei gibt sie sich keineswegs der Illusion hin, eine wirkliche Angleichung der Wirtschaftskraft dieser Staaten an das Anspruchsniveau des westeuropäischen Kapitalismus wäre schon erreicht oder wenigstens in Gang oder auch nur in absehbarer Zukunft zu erwarten. Sie rechnet vielmehr mit der fortdauernden Armut ihrer Neuerwerbungen und trifft Vorkehrungen für einen Umgang damit, der ihrem Haushalt ungebührliche Folgelasten erspart. So ist schon klar, dass die osteuropäischen Anschlussgebiete nach den Kriterien der EU ziemlich komplett in die Rubrik der „strukturschwachen Regionen“ fallen, denen eigentlich eine „Strukturförderung“ aus dem Unionshaushalt zusteht. Von der werden sie auch nicht ausdrücklich ausgeschlossen; fest steht aber schon, dass weder die bisherigen „Geberländer“ mehr zu „geben“ noch die bisherigen Nettoempfänger auf Zuschüsse zu verzichten gedenken. Und wie es aussieht, wird das auch gar nicht unbedingt nötig; denn ausgezahlt werden die entsprechenden Hilfen nach geltendem Gemeinschaftsreglement sowieso nur, wenn der begünstigte Staat Eigenmittel beisteuert, über die die bedürftigen Kandidaten nur sehr bedingt verfügen; vor allem dürfen sie damit ihren Schuldenhaushalt nicht belasten, ohne mit den Budget-Kontrolleuren der Union in Konflikt zu geraten und den Verlust von Kredithilfen zu riskieren. Die „Anschubfinanzierung“ eines flächendeckenden kapitalistischen Gebrauchs von Land und Leuten ist schon gleich in dem Wirtschaftssektor nicht geplant, dessen „Modernisierung“ die Union sich bei ihren Altmitgliedern die berüchtigte Hälfte ihres Budgets hat kosten lassen: Das massenhafte unproduktive Elend, das in der Landwirtschaft dahinkümmert, wird von Brüssel nicht mitfinanziert. Dafür wird es gleich anders ins Auge gefasst: als Teil der definitiv nutzlosen Überbevölkerung, die man durch Einschränkungen des Privilegs der Freizügigkeit daran hindern muss, im alten EU-Gebiet herumzuvagabundieren – der mit dem „Systemwechsel“ aufgeblühte Pauperismus hat das Problem seiner Heimatländer zu bleiben. Finanzhilfen bekommen deren Ordnungspolitiker immerhin für die Errichtung einer wirksamen EU-Außengrenze gegen das noch weiter östlich angesiedelte Massenelend; dass diese Grenzziehung einiges von dem jämmerlichen Tauschhandel unterbindet, mit dem die Geschädigten des Übergangs zur „Marktwirtschaft“ sich dort „marktwirtschaftlich“ über Wasser halten, geht wiederum die EU nichts an.
So betätigt und bewährt sich der Club der kapitalistisch erfolgreichen Nationen Europas als Entwicklungs- und Aufbauhelfer für die „Transformation“ seiner Nachbarn zu einem Bestandteil seines Binnenmarkts. Er entspricht dem Antrag, der an ihn herangetragen wird, und schließt ausgewählte Teile Osteuropas in seine kollektive Standortpolitik mit ein. Die besteht auf der einen Seite in der wohlmeinenden Nötigung der zuständigen Reformregierungen, alle Voraussetzungen für kapitalistisches Geldverdienen zu schaffen und bereitzustellen und zu diesem Zweck konsequent alle staatswirtschaftlichen Aktivitäten abzubrechen, ganz gleich, ob privates Gewinnemachen an deren Stelle tritt oder nicht, ihr nationales Wirtschaftsleben also auf das zu beschränken, was an kapitalistischem Geschäft in Gang kommt, und die unausbleibliche Armut auf eigene Rechnung zu bewältigen. Für diese Leistung bekommen die Beitrittskandidaten erstens Beihilfen aus der EU-Kasse und zweitens den Status von Ländern mit kapitalistischer Perspektive, auf die zu spekulieren sich lohnen muss und die dadurch bedingt kreditwürdig werden, auch für Investitionen europäischer Multis gut sind und als zusätzliche Absatzmärkte ihren Dienst tun.
Fragt sich nur, warum die Europäer eigentlich so großzügig sind.
Der imperialistische Fortschritt: Das strategische Kalkül der EU, ein „machtpolitischer“ Zugriff und lauter alte und neue Drangsale
Bei ihren früheren Erweiterungsrunden sind die jeweiligen Mitgliedsstaaten der einstigen EWG und heutigen EU stets davon ausgegangen, dass der angestrebte Zuwachs sich für sie lohnen würde. Dies durchaus auch politisch in dem Sinn, dass der vergrößerte Club und auch jedes Einzelne seiner Mitglieder im Rest der Welt mit größerem „Gewicht“ auftreten könnte und mit seinen Ansprüchen größeren Respekt finden würde; doch diese Spekulation auf mehr Macht in der Staatenwelt, über andere Souveräne, und eine stärkere strategische Position stand schon deswegen nie im Vordergrund des Erweiterungsstrebens, weil Stellung und Stellenwert der westeuropäischen Nationen im globalen Kräfteverhältnis und Kräftemessen durch ihre Teilnahme an der großen Weltkriegsallianz unter Führung der „Supermacht“ Amerika und durch deren selbsterteilten Auftrag zur Zurückdrängung der Sowjetmacht festgelegt war. Lohnen musste und, davon gingen die Stifter der neuen europäischen Einheit fraglos aus, würde sich jede Erweiterung des Teilnehmerkreises um benachbarte nationale Kapitalstandorte auf alle Fälle und in erster Linie ökonomisch: jedes neue Mitglied ein Zuwachs an Kapital, an Ressourcen aller Art, auf die erfolgstüchtige Unternehmer frei und überall zu den gleichen Bedingungen zugreifen, eine Vermehrung der Kaufkraft, um die sie völlig freizügig konkurrieren konnten; insgesamt und überhaupt ein Beitrag zu einer absolut wie im Weltvergleich relativ anwachsenden Wirtschaftsmacht. Natürlich war dieser Zugewinn allemal auch mit Belastungen verbunden; nicht einmal ausschließlich für die neu beitretenden Länder, deren Geschäftswelt einer in den meisten Belangen überlegenen Konkurrenz aus den schon länger vergemeinschafteten Nationen ausgesetzt wurde. Auch die jeweiligen Altmitglieder hatten Konkurrenzniederlagen hinzunehmen und außerdem immer wieder einmal zusätzliche Geldmittel bereitzustellen, um die Bedingungen für eine gedeihliche Ausnutzung der neu erworbenen Geschäftssphären zu verbessern und vor allem den jeweiligen nationalen Bauernstand in das Bemühen um eine sogar auf den Weltmärkten konkurrenzfähige Agrarindustrie zu integrieren. Mittlerweile herrschen überall die gleichen harten Rentabilitätsbedingungen, ziemlich gleichartige kapitalistische Sitten, und vor allem beherrschen dieselben Kapitale das Erwerbsleben und den Konsum der Gesellschaft; mit der Folge, dass zwischen den beteiligten Nationen und auch innerhalb der Länder zwischen den Regionen eine neue Hierarchie der Kapitalstandorte entstanden ist. Europa als Gesamt-Kapitalstandort ist darüber in der Konkurrenz der Weltwirtschaftsmächte vorangekommen; und genau darum ist es in allen bisherigen Erweiterungsrunden gegangen.
Bei der laufenden Osterweiterung ist das anders. Formell geht es zwar so ähnlich zu wie in den früheren Fällen: Die Kandidaten werden mit dem inzwischen enorm angewachsenen „acquis communautaire“ der Union konfrontiert und in ausgiebigen Verhandlungen mit ein paar entgegenkommenden Kompromissen dahin gebracht, dass sie sich ein- und unterordnen und zurechtreformieren. Im Fall der ehemaligen „Ostblock“-Nationen hat die EU es aber nicht bloß mit – aus ihrer Sicht – ungleich größeren Umstellungsschwierigkeiten bei ihren Kandidaten zu tun. Sie nimmt denen gegenüber von vornherein einen anderen Standpunkt ein: Sie stellt sich darauf ein, dass ihrem Wirtschaftsclub kein lohnender Zuwachs ins Haus steht, sondern, rein ökonomisch durchkalkuliert, ein größerer Problemfall, zusammengesetzt aus ganz besonders dürftigen und bedürftigen Staatshaushalten, einer sehr überschaubaren Anzahl wirklich lohnender Geschäftsgelegenheiten von nennenswerter Größe und entsprechend viel Fehlanzeige, was ein flächendeckendes profitträchtiges Erwerbsleben und einen staatsnützlichen nationalen Überschuss betrifft. Zwar werden auch jetzt wieder die Häupter der neu hinzukommenden EU-Bürger durchgezählt und als Konsumenten verbucht, die den europäischen Binnenmarkt endgültig zum größten der Welt machen – das allerdings wirklich nur der Kundenzahl nach. Denn was da an Zahlungsfähigkeit neu hereinkommt, ist bestenfalls für ein paar Supermarktketten und Luxusausstatter von Belang. Das zusätzliche Bruttosozialprodukt fällt sowieso wenig ins Gewicht; das Wachstum im neuen Osten der EU sieht – in den Prognosen zumindest – prozentual zwar ansehnlich aus, aber nur wegen der geringen absoluten Größe der wachsenden Ziffern. Alles das wird durchaus offiziell zur Kenntnis genommen und überhaupt nicht beschönigt; vielmehr wird vorgerechnet, dass nicht bloß die Beitrittsländer nach EU-Definition allesamt „arm“ sind, sondern die Union selber mit der Erweiterung als ganze nicht reicher und im Durchschnitt deutlich ärmer wird; intern streitet man sich um die wirksamsten Vorkehrungen dagegen, dass die neuen Mitglieder den alten auf unabsehbare Zeit und über Gebühr zur Last fallen. Mit den Ansprüchen, zu denen eine Vollmitgliedschaft sie berechtigen würde, sind sie für den Verein der kapitalistisch erfolgreichen Europäer eigentlich untragbar; und der Beitrag an kapitalistischen Reichtumsquellen, den sie mitbringen, ist nicht bloß gering – und im Übrigen schon durch die bisherigen Assoziationsabkommen für westliche Interessenten sichergestellt –, sondern überhaupt problematisch. Um – irgendwann einmal – wirklich nützlich zu werden, muss das Anschlussgebiet auf alle Fälle erst nützlich gemacht werden. So gesehen wären also Güterabwägungen geboten, die nach allen bislang gültigen Kriterien einer auf globalen Konkurrenzerfolg berechneten Bewirtschaftung des Standorts Europa allemal eher negativ ausfallen würden – der Zugriff auf die neue Gemeinschaftswährung, der Beitritt zum „Euro-Raum“, bleibt den Nachzüglern aus dem Osten denn auch bis auf Weiteres verwehrt. Wenn die maßgeblichen EU-Mächte und die Brüsseler Vereinsmanager trotzdem alle Bedenken ökonomischer Art, ohne dass sie ausgeräumt wären, so entschlossen zurückstellen, keine bloße Nutzenkalkulation als Einwand gelten lassen, vielmehr ohne Zögern die alsbaldige Aufnahme der osteuropäischen Kandidaten in ihren erlauchten Kreis beschließen, dann haben sie dafür auf jeden Fall andere und gewichtigere Gründe als solche ökonomischer Art.
Die liegen auf dem Gebiet der strategischen
Zuständigkeit. Die EU macht die
„marktwirtschaftliche“ Zukunft der ehemals
sozialistischen Länder Osteuropas zu ihrer Sache, weil
sie die Staatenwelt des „alten Kontinents“ westlich der
GUS, der Erbengemeinschaft der untergegangenen
Sowjetunion, als ihren angestammten Machtbereich
betrachtet und reklamiert.[6] Sie versieht nicht bloß einen
ordnungspolitischen Dienst, indem sie die dem
Kapitalismus entfremdete Region wieder „an die
Marktwirtschaft heranführt“: Sie verleibt sie sich ein,
baut sich damit als übergeordnete, oberhoheitliche
Instanz über den renovierten Nationalstaaten im Osten
auf, gebärdet sich als gesamteuropäische Macht, die
keineswegs bloß einen großen Markt verwaltet, sondern den
Kontinent, indem sie ihn als einen großen
Kapitalstandort bewirtschaftet, politisch eint.
Unübersehbar und unmissverständlich trennt und
distanziert sich die Union von ihrem früheren Dasein als
Wirtschaftsclub, der die politische Grundsatzfrage, die
Einsortierung der beteiligten Nationen in die
Machtverhältnisse, die den Globus beherrschen, mehr oder
weniger konsequent und ausdrücklich aus seinen
eigentlichen Aktivitäten ausklammert und einem anderen,
kompetenteren Zusammenschluss überlässt, der
strategischen Allianz der Mitgliedsländer mit der
Führungsmacht USA. So hat sie angefangen, und so hat sie
agiert, als die Feindschaft zwischen „freier Welt“ und
„Sowjetblock“ noch die Scheidelinie war, an der entlang
die Staatenwelt im Allgemeinen und die europäische im
Besonderen sich sortierte. Da hat Amerikas europäische
Gefolgschaft sich unter und neben und komplementär zu
ihrer Einbindung in das transatlantische Militärbündnis
zu einer Wirtschaftsgemeinschaft zusammengetan, um auf
dem Feld der zivilen Konkurrenz der Nationen um den
kapitalistischen Reichtum der Welt den Abstand zur
Supermacht der Weltwirtschaft zu verringern; und über die
Jahrzehnte ist aus der Absurdität eines quasi
arbeitsteiligen Nebeneinander von strategischer
Unterordnung und ökonomischer Rivalität beinahe so etwas
wie der neue imperialistische Normalfall geworden. Für
diese Konstruktion ist mit der Selbstauflösung der
Sowjetunion die Grundlage entfallen, nämlich die für
Europäer wie für Amerikaner unverzichtbare
Waffenbrüderschaft für den Weltkrieg, in deren Rahmen die
USA ihren Partnern die Freiheit zur konkurrierenden
ökonomischen Benutzung der Welt konzediert und die
Europäer ihre darüber erworbene Macht der gemeinsamen
Sache des „Westens“, dem von den USA geführten Bündnis,
untergeordnet hatten. Mit der großen, nur per NATO zu
bewältigenden Konfrontation mit dem Weltkriegsgegner
verflüchtigt sich die unbedingte Bündnisdisziplin; also
auch der Zwang und die Bereitschaft auf beiden Seiten des
Atlantik, von den strategischen Qualitäten der innerhalb
des transatlantischen Bündnisses herangewachsenen
Wirtschaftsmacht Europa, von den in dieser Macht
unweigerlich enthaltenen Ansprüchen auf eine
entsprechende Entscheidungskompetenz in internationalen
Gewaltaffären, zu abstrahieren. Den Machern der EU stellt
sich dieser Machtanspruch, also ihr eigener
imperialistischer Eingriffswille, von seiner bislang
respektierten Beschränkung freigesetzt, als neue
Lage
dar, der sie nolens volens entsprechen
müssten. Bescheiden wie sie sind, nehmen sie diese
geänderte „Weltlage“ zuerst und vor allem in ihrer
Nachbarschaft wahr, aus der die Sowjetunion als drohende
Übermacht und „Völkergefängnis“ mit „eisernem Vorhang“
glücklich verschwunden ist, und finden sich prompt
herausgefordert und berufen, in das dortige „Machtvakuum“
hineinzustoßen, bevor es eine Chance hat zu entstehen:
Bis an die Grenze zur GUS – dieses „Gebilde“ selbst mit
seinem strategisch unhandlichen Moskauer Zentrum, seinen
erst recht nicht zu handhabenden inneren Konflikten und
seinen extrem unübersichtlichen Kräfteverhältnissen
bleibt außen vor – nehmen sie als kollektive
Ordnungsmacht den Osten ihres Kontinents als ihren
strategischen Zuständigkeitsbereich politisch in
Besitz.
Dass sie damit zum Ordnungsanspruch der USA in Konkurrenz treten, die sich ihrerseits durch die Abdankung ihres großen Gegenspielers dazu ermächtigt und berechtigt finden, ihre Vormundschaft über das bisher schon verbündete Europa nicht bloß ungeschmälert fortzuführen, sondern außerdem auf das freigegebene Osteuropa auszuweiten, ist den Anführern des vereinigten Europa ebenso klar wie ihrer amerikanischen Führungsmacht. Kenntlich wird das nicht zuletzt daran, dass sie sich alle Mühe geben, jeden Gegensatz zwischen ihrem freigesetzten imperialistischen Ehrgeiz und ihrer alten Bündnistreue zu dementieren, etwa mit Hinweis auf die von Amerika selbst gewünschte Stärkung des „europäischen Pfeilers“ der transatlantischen Allianz – eine diplomatische Heuchelei, zu der sie gute Gründe haben. Sie brauchen nämlich die überlegene Militärmacht der USA und kalkulieren damit als Rückversicherung, im extremen Ernstfall der gewaltsamen Befriedung des Balkan sogar als Erstversicherung, für ihre Oberherrschaft über den Kontinent. Einen zwingenden Grund, sich im Gegenzug als Amerikas verlängerter Arm zu begreifen und aufzuführen und mit ihrer neuen Ostpolitik den amerikanischen Hegemonie-Anspruch statt den eigenen zu bedienen, können die EU-Mächte aber nicht mehr entdecken. Die Kontrolle über Osteuropa beanspruchen sie uneingeschränkt und im Prinzip exklusiv, ausschließend gegen Russland wie auch gegen die imperialistische Allzuständigkeit und die bündnispolitische Vorherrschaft der USA, für sich. Die Aufnahme der osteuropäischen Staaten als Vollmitglieder in ihre Union ist das politische Mittel, mit dem sie den Vorrang und die Exklusivität ihrer Hegemonie auf dem Kontinent unbedingt und unwiderruflich durchsetzen wollen und auch meinen durchsetzen zu können.
Damit setzen Europas ehrgeizige Imperialisten allerdings eine Unternehmung in Gang, deren Verlauf und Ausgang gar nicht wirklich in ihrer Macht liegt – fast so wie ihre neuen Partner mit ihrem „Systemwechsel“ –; und sie setzen damit einiges aufs Spiel. Zum einen riskieren sie einiges von der Grundlage ihres speziellen Imperialismus, das erfolgreiche Wachstum ihrer ökonomischen Macht. Denn immerhin leisten sie sich die vollständige Integration von Ländern in ihren Binnenmarkt und in ihr länderübergreifendes Kreditsystem,[7] die auf unabsehbare Zeit bestenfalls bruchstückhaft als höchst minderwertige Bestandteile des Kapitalstandorts Europa taugen; sie spekulieren gewissermaßen auf die kapitalistische Zukunft von Nationen, in denen die großflächige Vernichtung ehemaliger Reichtumsquellen und Überlebensmittel wegen mangelnder Rentabilität noch gar nicht abgeschlossen ist. Gegen die absehbaren Belastungen sichern sie sich zwar nach Kräften ab und wälzen die finanziellen Unkosten, soweit es geht, und die sozialen sowieso auf die Beitrittskandidaten ab. Praktisch haften letztendlich aber doch auch sie für den Erfolg oder Misserfolg dieser Spekulation. Mit ihrem Vorstoß zur politischen Inbesitznahme Osteuropas leisten sich die EU-Mächte aber noch einen ganz anderen Widerspruch. Sie reklamieren nicht bloß eine erweiterte Zuständigkeit, sondern nehmen sie mit ihrer fast ans Ziel gebrachten Osterweiterung bereits praktisch wahr. Das tun sie allerdings, ohne überhaupt die handlungsfähige imperialistische Macht zu sein oder zu Stande gebracht zu haben, die ein unwidersprechlich wirksames Kontrollregime über den Kontinent exekutieren könnte. Für ein solches Regime verlassen sie sich ja immer noch, zumindest in letzter Instanz, auf das Bündnis mit den USA, die ihrerseits dieselbe Weltgegend als ihre strategische Manövriermasse behandeln und deshalb deren Eingliederung in die NATO betreiben. Die ehemaligen „Vasallen Moskaus“ nutzen diese Osterweiterung des transatlantischen Militärbündnisses als zweiten Weg neben dem EU-Beitritt, um sich unwiderruflich aus allen alten Abhängigkeiten zu emanzipieren und aus früheren strategischen Verhältnissen zu lösen. Die Macher der EU tragen in ihrer Eigenschaft als NATO-Partner ihrerseits die Ausdehnung ihrer Militärallianz mit, mit der diese sich nach ihrem Willen als ‚neue NATO‘ bewähren soll, als hinreichend gewaltbewehrter Geburtshelfer eines ‚neuen Europa‘ nämlich – und treiben gleichzeitig mit demselben Ziel die politische Okkupation Osteuropas auf eigene Rechnung und so exklusiv wie eben möglich zu Gunsten ihrer Ordnungsmacht voran: ohne die USA, in Konkurrenz zur NATO, im Klartext also gegen deren Führungsmacht. Das leisten sie sich, wie gesagt, ohne überhaupt schon über die dazu unerlässliche eigene politische Führungsmacht, geschweige denn die nötigen militärischen Potenzen zu verfügen. Und nicht nur das: Der Formierung einer solchen Macht, mit der sie diesem ihrem eigenen Unternehmen gewachsen wären, wirken sie mit ihrer Ein- und Unterordnungspolitik nach Osten hin direkt entgegen.
Das gilt schon für die fünfzehn Altmitglieder: Die haben sich zwar durch ihre ambitioniertesten Vorkämpfer auf die Osterweiterung ihres Vereins einschwören lassen, und sie haben im Prinzip auch zu einem Konsens darüber gefunden, dass und wie die Neumitglieder EU-gemeinschaftlich in Beschlag genommen werden sollen. Für die Durchführung dieses anspruchsvollen Vorhabens existiert aber nach wie vor keine Entscheidungsinstanz mit Richtlinienkompetenz. Ausgerechnet der Fortschritt der Union zur Entfaltung einer eigenen strategisch relevanten Ordnungsmacht findet statt im Streit der imperialistisch kompetentesten Nationen um die Federführung bei diesem Prozess; die kleineren Partner mischen dabei auf ihre Art mit. Und so viel ist klar: Dieser EU-eigene Konkurrenzkampf gewinnt in dem Maß an Schärfe und wirkt zersetzend, wie er nunmehr direkt, ohne Umschweife und in allem Ernst um die Hegemonie in Europa geführt wird. An diesem Streit um die Führungskompetenz in der und über die erweiterte EU nehmen außerdem die Neumitglieder teil, und zwar nicht bloß als Objekte des Herrschaftsanspruchs der alten Führungsmächte, sondern demnächst als souveräne Subjekte mit der Lizenz, genau darüber mit zu entscheiden. Denn für die politische Inbesitznahme ihrer östlichen Nachbarn, und gerade um deren Eingliederung unwiderruflich sicherzustellen, bringt die Union das Instrument der Vollmitgliedschaft zur Anwendung. Sie ermächtigt also genau die Staaten, die ökonomisch in eine neu eröffnete Rangstufe hineinbugsiert werden, in der sie mehr als Risiko und Last denn als Beitrag zählen, und die politisch für die schöne Rolle vorgesehen sind, mit ihrer ganzen souveränen Gewalt dem strategischen Regime der etablierten Mächte inkorporiert zu werden, zur gleichberechtigten Teilnahme am EU-internen Verhandeln, Feilschen, Blockieren, Konkurrieren, Kräftemessen und Beschlussfassen. Dabei – und das macht den Widerspruch in der Konstruktion des großen europäischen Aufbruchs nach Osten erst komplett – operieren die demnächst 25 formell gleichrangigen Partner allesamt[8] zweigleisig, nämlich eben nicht bloß als EU-Strategen, sondern dabei immer auch mit einem berechnenden Blick auf ihre Allianz mit und ihre Abhängigkeit von Amerika, das sich seinerseits an dieser Stelle schon gar nicht zurückhält. Immerzu haben es die derzeitigen und inskünftigen EU-Partner nicht bloß mit einander und ihrem internen Kräfteverhältnis zu tun: In all den nationalen Berechnungen, die da aufeinander prallen, sich aneinander abarbeiten und sich am Ende zu einem Konsens über nichts Geringeres als lauter kontroverse Machtfragen hinbewegen sollen, sind immer auch die USA als externe, aber allgegenwärtige, auch in Europa verankerte und bestimmende Macht und Alternative zur Dominanz der EU-Führungsmächte präsent. Kein Mitglied der Union ist, was seine weltordnungspolitische und euro-strategische Positionierung betrifft, auf Gedeih und Verderb auf das EU-Kollektiv und dessen andere Teilhaber angewiesen und mit deren Ansprüchen, Erpressungen und Angeboten konfrontiert; sie alle sehen sich zugleich den Forderungen, Verhandlungsangeboten und Machtworten ausgesetzt, mit denen Amerika sich als NATO-Führungsmacht in die politische Willensbildung auf dem „alten“ Kontinent einschaltet und deutlich macht, dass es durchaus nicht gewillt ist, sich durch die Emanzipationsbemühungen seiner Verbündeten aus seiner führenden Position verdrängen zu lassen.
Ein attraktives Angebot ist die Präsenz der US-Macht natürlich vor allem für diejenigen EU-Staaten, die befürchten oder sogar zu dem Befund gelangen, sie kämen im innereuropäischen Streit- und Einigungsprozess zu kurz. Und deren Zahl vermehrt sich unweigerlich in dem Maß, wie es wirklich auf kollektive imperialistische Handlungsfähigkeit ankommt – vor allem um die Neumitglieder aus Osteuropa, die zwar für ihre Zukunft als europäische Kapitalstandorte keine Alternative zur EU sehen, für politische Unzufriedenheit mit ihrem Club aber mehr als genügend Gründe haben. Für die ist ausgerechnet ihre Mitgliedschaft in der NATO, von deren „Führungsstruktur“ die EU als ganze sich emanzipieren will, mit ihrem anspruchsvollen US-Regime und ihrer sehr speziellen Bündnisdisziplin[9] eine Art Freibrief: ein Stück Ermächtigung dazu, sich ihrer politischen Vereinnahmung durch die EU und namentlich durch die Hauptbetreiber der Osterweiterung von NATO und EU zu entziehen. So handelt sich das Vereinigte Europa ausgerechnet da, wo es sich als Kontrollmacht über den Kontinent aufbaut, und ausgerechnet durch die Art und Weise, wie es diesen Fortschritt irreversibel und unbedingt erfolgreich gestalten will, lauter politische Sprengsätze ein.
Tatsächlich bringen Europas Vereinsleitungen es fertig, sogar dieses Nest von Widersprüchen noch nach altbewährtem Muster zur mehr technischen Verfahrensfrage bei der Herbeiführung von Gemeinschaftsbeschlüssen herunter zu definieren: Die große Zahl von demnächst 25 gleichberechtigten Mitgliedern, die noch dazu fast zwei Dutzend verschiedene Sprachen sprechen, wird als Hauptproblem ins Auge gefasst; und das soll, wenigstens fürs Erste, „pragmatisch“ bewältigt werden: durch „gestraffte“ Abstimmungsverfahren, qualifizierte Mehrheitsentscheidungen an Stelle von Einstimmigkeit in etlichen Fragen, ein Rotationsprinzip bei der Besetzung von EU-Posten durch kleinere Nationen und eine unterproportionale Ausweitung der Übersetzungsdienste; eine Verfassung, die aller Ineffektivität und aller Unklarheit ein Ende machen soll, ist bekanntlich in Arbeit und gilt bereits vor dem ersten Entwurf als immer wieder reformbedürftig. Dabei verrät die Sorge, eine größere Mitgliederzahl und unpraktische Beschlussverfahren würden die Union politisch lähmen, was tatsächlich auf dem Spiel steht: Es geht um das imperialistische Interesse der Europäer und dessen machtvolle Durchsetzung nach außen und nach innen; und dessen Protagonisten leiden nicht an den mangelhaften Techniken einer Konsensbildung, sondern an der Notwendigkeit, dauernd um einen Konsens im Sinne der eigenen nationalen Rechnung kämpfen und dafür stets von neuem die nationalistische Widerspenstigkeit ihrer Kollegen überwinden zu müssen. Die „pragmatischen Lösungen“ folgen deswegen auch nicht den Maximen einer effektiven Bürokratie, sondern spiegeln das Bemühen wider, noch im Kleingedruckten der Geschäftsordnung Richtlinienkompetenzen zu erobern bzw. abzuwehren. Das „Geschäft“ selbst, dessen Abwicklung so geregelt werden soll, dass kein Quertreiber es „lähmen“ kann, besteht eben in einer fortwährenden Konkurrenz um die Macht in und über Europa und um ihren Gebrauch; und deswegen wird da auch mit ganz anderen Mitteln als mit Geschäftsordnungstricks operiert. Andere Machthaber schädigen, mit der Androhung von Schäden und der Aussicht auf einen Nutzen erpressen, Fakten setzen, um die niemand herum kommt, den souveränen Entscheidungsinstanzen der anderen Nationen die Alternativen vorgeben, in denen die sich zu entscheiden haben: Auch in der EU funktioniert Imperialismus noch allemal so. Eben deswegen leiden die maßgeblichen Euro-Imperialisten aber auch weniger am Nationalismus ihrer minder bemittelten Partner als an der Macht der USA, denen politische Optionen zu eröffnen, die die Festlegung der Union auf die Hegemonie europäischer Führungsmächte verhindern, und überhaupt mit strategischen Ansprüchen und weltpolitischen Festlegungen aufzuwarten, denen sich auch die Größen des europäischen Machtgeschäfts nicht entziehen können. Krieg, wo und gegen wen auch immer, ist in der Hinsicht höchst produktiv; und deswegen wirkt der angesagte Irak-Krieg der USA auch prompt so, dass alle inneren Sprengsätze im unierten Europa hochgehen: Kaum „endgültig wiedervereinigt“, spaltet sich der Kontinent auch schon wieder in das „neue“ – ausgerechnet Erweiterungskandidaten einschließende – Europa, das seine vaterländische Freiheit nur in der einseitigen Waffenbrüderschaft mit der transatlantischen Weltmacht richtig aufgehoben sieht und auf jeden Fall besser bedient findet als durch eine hegemonial durchkonstruierte EU, und das „alte“ – ausgerechnet von den ‚kerneuropäischen‘ Protagonisten der Osterweiterung angeführte – Europa, das sich angesichts der Kündigung seiner alten NATO-Waffenbrüderschaft durch die USA, nämlich der Fiktion einer gewissen Gleichberechtigung in der transatlantischen Partnerschaft, zu etwas mehr von dem Antiamerikanismus durchringt, ohne den ein Euro-Imperialismus eben doch nicht zu machen ist. So blamieren die USA mit ihrem Feldzug, noch bevor der Erweiterungsvertrag unter Dach und Fach ist, das EU-Projekt einer friedlichen Eroberung des europäischen Ostens und entlarven es als das, was es ist: eine welthistorisch neue Variante imperialistischen Abenteurertums.
[1] Ein äußerst wirksamer Hebel, um die regierenden Parteien von der grundsätzlichen Ineffizienz ihres Systems zu überzeugen, war ironischerweise der Kredit, den sich die meisten dieser Staaten im Westen besorgt hatten: Dessen zerrüttende Wirkungen auf ihr System, der Abzug von Gütern zum Zweck der Kreditbedienung, die dann in der Versorgung der eigenen Betriebe und Werktätigen unangenehme Leerstellen hinterließen – ein Anlass für einen ganzen Volksaufstand in Polen –, sprachen in ihrer Optik nicht gegen den Kredit, sondern für das feindliche System, das seinen Staatenlenkern eine ganz andere Mobilisierung von Geld und Gütern erlaubte. Die Parteien, die immer noch Marx im Emblem mit sich herumtrugen, ließen sich davon nicht über die Natur des Kredits als Mittel der Verarmung und Erpressung zwischen Nationen belehren, sondern ganz umgekehrt zur Nachahmung animieren.
[2] Insbesondere für die kleineren Partner im Warschauer Pakt waren die Rüstungslasten ein ständiger Anlass zu Beschwerden: Die konnten sich alle eine bessere Verwendung ihrer Mittel vorstellen und waren außerdem dem nationalistischen Verdacht nicht abgeneigt, dass sie diese Belastungen eigentlich nur ihrer sozialistischen Brudernation und sowjetischen Vormacht zuliebe zu tragen hätten, weil sie ‚persönlich‘ mit der Konfrontation des Westens mit ihrem „sozialistischen Lager“ doch eigentlich gar nichts weiter zu schaffen hatten. Inzwischen dürfen sie sich vor der NATO für mangelhafte Rüstungsanstrengungen verantworten.
[3] Die vorherrschende Verlaufsform dafür war die, dass die „volkseigenen“ Betriebe, zugeschnitten auf den Bedarf der Arbeitsteilung innerhalb des ‚Rats für gegenseitige Wirtschaftshilfe‘, die hierzulande so betitelten „stalinistischen Dinosaurier“, von heute auf morgen keine Abnehmer mehr hatten und mit einer kapitalistischen Eröffnungsbilanz dastanden, die massenhaft Produkte auf Halde und Schulden aus den bisherigen Zahlungsverpflichtungen verzeichnete. In den Brudernationen war reihum kein Geld vorhanden bzw. keines, das zu verdienen sich nunmehr noch lohnte – per Systemwechsel machten sich die Nationen schlagartig unbrauchbar füreinander; auch im Westen herrschte Verwunderung über diese „Märkte“, die dermaßen schlagartig „wegbrachen“. Auf dem Weltmarkt konnten sich Produkte der ehemals sozialistischen Betriebe dann schon gleich gar nicht blicken lassen; einerseits deshalb, weil das eine Frage der Zulassung ist, insbesondere auf dem der Binnenmarkt der EU; andererseits wäre auch schon für eine solche Umorientierung des Handels Kapital vonnöten gewesen – und das war eben nicht vorhanden.
[4] Über diesen
„Heranführungs“-Prozess informiert ausführlich der
erste Artikel über die Osterweiterung der EU in dieser
Zeitschrift: Ein weiterer Schritt der EU auf dem Weg
zum Euro-Imperialismus
in GegenStandpunkt 1-98, S.109.
[5] Hierzu haben wir uns
in der vorigen Nummer dieser Zeitschrift geäußert:
Europa (III): Amerikas Konkurrenten zählen Geld und
Waffen nach…
, GegenStandpunkt 4-02, S.103.
[6] Das Interesse der EU an den beiden anderen Beitrittskandidaten, an den zwei souveränen Mittelmeerinseln Malta und Zypern, ist offenkundig von gleicher Art. „Transformations“-Probleme bereiten sie zwar nicht; einen substanziellen ökonomischen Beitrag erwartet sich das kapitalistische Europa von ihnen aber auch nicht. Ihr Wert liegt, jedenfalls hauptsächlich, in ihrer Lage: Mit ihrem Anschluss macht die EU sich demonstrativ im Mittelmeer breit, vereinnahmt es in ihren politischen Besitzstand und weitet so ihre strategische Zuständigkeit nachdrücklich bis an die Grenzen der arabischen Welt hin aus.
[7] Dass sie die Neuen bis auf Weiteres von der Teilhabe am gemeinsamen Kreditgeld ausschließen, zeugt vom Bewusstsein der Euro-Währungshüter von den Risiken, die sie sich mit der Ermächtigung dieser Staaten zu freier Inanspruchnahme des Gemeinschaftskredits einhandeln würden. Ausgeräumt ist das Risiko damit nicht. Denn auch ohne Euro wirtschaften die neuen Mitglieder in Zukunft als Teil des Kapitalstandorts EU und als solcher Teil auch mit dem Kredit, den die kapitalistische Union als Ganze in der Geschäftswelt hat, für den sie also auch haftet, und mit einem Geld, dem das Euroland Anerkennung und folglich seine Garantie nicht versagen kann.
[8] Die paar Nicht-NATO-Mitglieder fallen erstens nicht ins Gewicht, und zweitens gilt für sie auch ohne formelle Teilnahme an der Allianz mit Amerika im Wesentlichen dasselbe.
[9] Dieselben Staaten, die die Zersetzung des ehemaligen Warschauer Pakts und seine Auflösung nicht zuletzt in der Erwartung betrieben haben, national uneinsichtige und schon deshalb untragbare Rüstungslasten los zu werden, bekommen als NATO-Mitglieder von ihrer neuen Führungsmacht erklärt, wie lächerlich unzureichend für eine moderne Militärmacht ihre früheren Rüstungsanstrengungen gewesen sind, und werden regelmäßig wegen unzureichend ausgestatteter Militärhaushalte von der NATO-Leitung zur Rechenschaft gezogen – noch so ein Treppenwitz der Weltgeschichte.