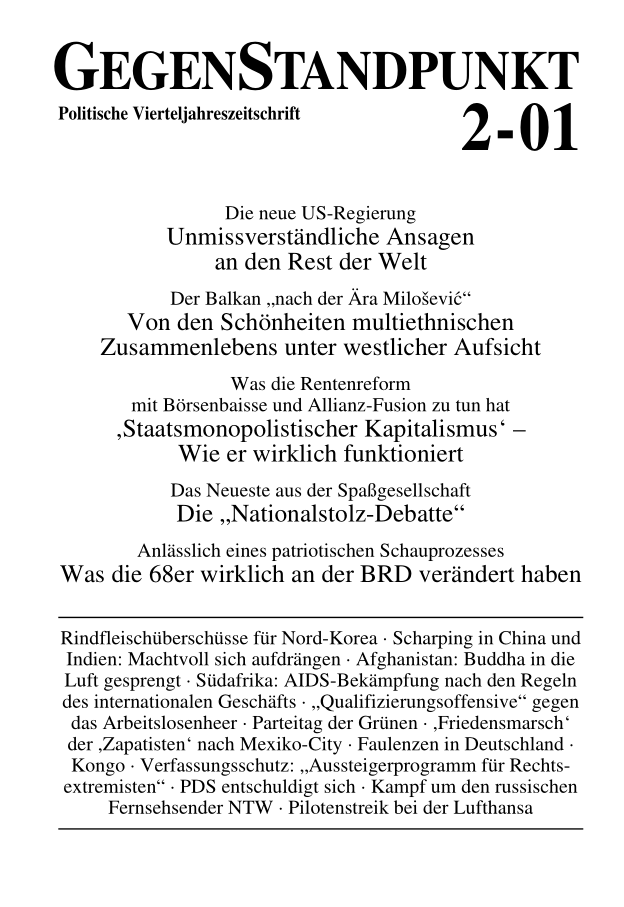Europa 2000 (II)
Zwischenbilanz eines (anti-)imperialistischen Projekts neuen Typs
Die Europapolitik ist durch den Widerspruch eines pro-europäischen Nationalismus gekennzeichnet: Auf Basis einer durch nationalen Protektionismus ungehinderten Konkurrenz der Mitgliedsnationen um Kapitalwachstum gibt es das Bedürfnis nach nationaler Schadensbegrenzung, dem unter dem supranationalen Regelwerk der EU entsprochen wird. Die Mitgliedsstaaten, die dem Ideal der friedlichen Eroberung aktiv am nächsten kommen, wollen die bisher gültigen Regeln und Rechte außer Kraft setzen, die sie jetzt als einziges Hindernis ihres Fortkommens in und mit Europa bewerten.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Siehe auch
Systematischer Katalog
Europa 2000 (II)
Zwischenbilanz eines (anti-)imperialistischen Projekts neuen Typs
1. Von der Währungsunion
(Fortsetzung von GegenStandpunkt 4-2000, S.143)
c) Die Standortpolitik europäischer Regierungen zielt auf die Herstellung und Förderung von ganz viel kapitalistischer Geschäftstätigkeit. Ohne einen Anflug von traditioneller Scham und Schönfärberei bekennen sich die demokratischen Führungsmannschaften zum Kapital als dem Lebensmittel ihres Gemeinwesens; im dazugehörigen Umgang mit dem „Produktionsfaktor Arbeit“ nehmen sie Maß am amerikanischen „Modell“ von „Mobilität“ und „Flexibilität“ und was es sonst noch für Ausdrücke für eine echt schrankenlose, deregulierte Benützung von Arbeitskraft gibt; als Erben eines Sozialstaats machen sie regen Gebrauch von diesem Instrument, mit dem sich das Einkommensniveau einer ganzen Klasse regulieren lässt, wobei sie die Lebensbedürfnisse von Beschäftigten und Arbeitslosen, Jugend und Alter, Ossis und Wessis, Angestellten, Pendlern und Beamten so lange gegeneinander ausspielen, bis gerechterweise kein Lebensbedürfnis mehr im bisherigen Umfang mit den Erfordernissen des Wachstums vereinbar ist. Das moderne Regieren liefert, flankiert von den stündlichen Börsenmeldungen dauernden Anlass für die altmodische Kritik an „Demokratie & Marktwirtschaft“, die es zu Recht für keinen Beitrag zu seinem Gelingen hält. Da diese Kritik nicht stattfindet, können sich die nationalen Führungspersönlichkeiten ungehemmt den Drangsalen stellen, die ihnen erhalten bleiben, so gründlich sie auch ihren kapitalistischen Laden reformieren. Die Rede ist von der Europa-Politik, und die befaßt sich mit dem Kapitalismus der anderen.
Und zwar erst einmal nicht mit der mit diesem Wort bezeichneten Gesinnung, die in allen Völkern des traditionsreichen Kontinents ein munteres Leben führt, gerne in Stolz übergeht und immer wieder mal in Rassismus umschlägt. Gute Europäer sind in bezug auf die staatsbürgerlichen Einbildungen anderer Völker, die sich an landesüblichen Sitten erwärmen, Traditionen hegen und pflegen, ihren Staat als Heimat achten und auf ihre kulturellen Gewohnheiten nichts kommen lassen, eher tolerant. Es ist ihnen eben geläufig, daß dieser Bestandteil der öffentlichen Moral einen unverzichtbaren Beitrag zur Harmonie zwischen Volk und Staat leistet, auf den ihre Amtskollegen dasselbe Recht haben wie sie selbst. Von der völkerverbindenden Tourismusindustrie ganz zu schweigen, die in Zeiten der „Globalisierung“, da das Geld manch schönen Unterschied zum Verschwinden bringt, in der verehrten Landeskultur ihre zweite Säule – neben der Natur – besitzt.
Der Nationalismus, an dem sich Politiker abarbeiten, wenn sie sich um Europa kümmern, ist von anderem Kaliber. Er betätigt sich in der Standortpolitik und bemüht sich nach Kräften, den gewöhnlichen Leuten ihre Heimatgefühle abzugewöhnen, weil sie für alles geradestehen müssen, was die Regierung unternimmt, um allen Sorten von Kapital eine Heimat zu bieten. Mit diesem Bemühen treten nämlich Nationen in Wettbewerb miteinander und werfen mitten im alten Europa unter sich lauter inter-nationale Eigentumsfragen auf. Sie konkurrieren einerseits wie alle kapitalistischen Nationen darum, dass sich auf ihrem Territorium möglichst viel Kapital effizient betätigt und durch sein Wachstum dem Staat als Reichtumsquelle dient; andererseits ergänzen sie diese Praxis, durch die sie sich ihre ökonomischen Erfolge wechselseitig beschränken und bestreiten, um die Übereinkunft, dass innerhalb Europas die komplementären, quasi natürlichen Techniken solcher Standortbetreuung unterbleiben. Politische Maßnahmen, die Geschäfte erschweren oder gar verhindern, weil sie auf Kosten der nationalen Bilanz gehen; die Unternehmen fördern, weil sie aufgrund ihrer lokalen Bindung und/oder ihrer kreditären Verbindungen einen unverzichtbaren Posten der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung darstellen; „diskriminierende“ Praktiken eben sind den auf Freihandel eingeschworenen Mitgliedsländern der EU im Prinzip verboten – jedenfalls haben sie sich durch ihre Beteiligung am europäischen Projekt auf das Prinzip verpflichtet, ihre nationalen Rechnungen auf die Leistungen des freigesetzten Kapitals zu gründen.
Das Bedürfnis nach protektionistischer Regulierung der Konkurrenz ist damit allerdings nicht erloschen. Es hat sich gerade wegen der Bereitschaft der beteiligten Nationen, „sich zu öffnen“, um sich die nationalen Märkte der anderen im Gegenzug zu erschließen, erneuert. Und zwar in doppelter Weise:
- Nationen, die darauf setzen, daß ihnen ihre kapitalistische Industrie und Landwirtschaft bessere Dienste leistet, wenn diese mit ihren Produkten in allen europäischen Nationen zu gleichen Bedingungen – also ohne hoheitliche Eingriffe in ihre Kalkulation – handeln können, gehen ein Risiko ein. Mit der Entscheidung für den Außenhandel als maßgebliche Reichtumsquelle setzt der Staat alle einheimischen Geschäftszweige der internationalen Konkurrenz aus, mit deren Ergebnissen er auch im negativen Fall „leben“ muß. Dabei kommt es nicht nur zur Verteilung von Gewinnen bzw. Verlusten der Unternehmen auf die nationalen Bilanzen, was sich in der Finanzkraft der Nation, in den Möglichkeiten der Regierung bei der Gestaltung des Haushalts etc. niederschlägt. Insbesondere in der Phase der Umstellung, wenn Staaten mit geringen Anteilen auswärtiger Betätigung seitens ihrer Volkswirtschaft und an ihr in den großen europäischen Rentabilitätsvergleich einsteigen, erweisen sich bisweilen mit einem Schlag ganze Abteilungen einer überkommenen Nationalökonomie, auch ganze Regionen als „nicht konkurrenzfähig“. Aber auch schon zum Rang von „Exportnationen“ aufgestiegenen EU-Staaten bleiben solche Erfahrungen nicht erspart; ganze Branchen müssen da „gesundschrumpfen“, wenn sie nach dem Verzicht auf die spezielle Betreuung, die ihnen auf ihrem Heimatstandort zuteil geworden war, ohne Zoll und Subventionen nicht so kostengünstig produzieren können wie die Anbieter aus anderen Ecken der EU. Deswegen präsentiert sich die Geschichte der EG bis zur heutigen EU als ein ständiges Neben- und Nacheinander von Wachstumserfolgen und lokalen Stilllegungsaktionen. Die letzteren haben vor allem in ehrwürdigen Sphären der Landwirtschaft, im Heringswesen, aber ebenso im Bereich von Textil- und Stahlproduktion Schlagzeilen gemacht; jedenfalls immer dann, wenn die betroffenen Unternehmen und ihre lohnarbeitenden Anhängsel lautstark Klage führten; wenn Weinbauern der einen Nation den Wein der anderen verschütteten, die Obsthändler die Exportschlager europäischer Nachbarn auf offener Straße vernichteten oder Stahlwerker gegen die Schließung „ihres“ Betriebs mahnwachten. Hinzu kommen die spektakulären Fusionen, durch die europäische Kapitalisten grenzüberschreitend die Kapitalgröße herstellen, durch die sie in Europa und weltweit den Kampf um Marktanteile für sich zu entscheiden suchen. Jedes dieser Projekte, ob sie nun in der Auto- und Flugzeugindustrie, im Sektor der Telekommunikation oder im Finanzgewerbe stattfinden, wird – spätestens mit den Entscheidungen über die „Synergie-Effekte“ – zu einer Abrechnung mit Standorten, zu einer Frage der Verteilung des Wachstums, von Einkommen und „Beschäftigung“ auf die Nationen der EU.
- Den Schutzbedürfnissen, die der europäische Freihandel – mit der Währungsunion einer weiteren Schranke enthoben – hervorruft, kommen die nationalen Führungen selbstverständlich nach; auf die Proteste geschädigter Lohnabhängiger, die als brave Bürger ihr Recht auf Arbeit anmelden, das sie gar nicht haben, braucht dabei keine Regierung einzugehen. Umgekehrt pflegt sich allerdings jede Regierung auf die Nöte der betroffenen Unternehmen zu berufen, wenn der gemeinsame Markt das nationale Wachstum zu stark beeinträchtigt; und vor allem dann, wenn das Urteil der Konkurrenz das Schicksal ganzer Geschäftszweige besiegelt, ohne dass eine Kompensation für die nationale Bilanz und die lahmgelegte Region in Aussicht steht. So wenig nun in der europäischen Gemeinschaft die elementare Aufgabe des Staates verschwunden ist, per Gesetzgebung und mit Hilfe von öffentlichen Geldern das Wachstum von Kapital so zu steuern, dass es den Reichtum der Nation erhält und mehrt, so sehr hat sich die Praxis dieses ökonomischen Nationalismus verändert. Die Mittel, mit denen die Mitgliedstaaten der Union auf diesem Felde tätig werden, das Maß ihres Einsatzes und die Bereiche, in denen die öffentliche Hand der Rentabilität von Unternehmen auf die Sprünge hilft bzw. ihr Fehlen kompensiert – all die Maßnahmen, die unter Titeln wie „Staatseingriffe“ oder „Subventionen“ bekannt und üblich sind, bilden schließlich den zentralen Stoff des europäischen Regelwerks. Gemäß der Geschäftsordnung der EU sind sie entweder erlaubt oder verboten, werden sie genehmigt oder beschränkt. Die Satzung hat nämlich die Ausgestaltung des Verhältnisses von Staat und Kapital zum Gegenstand, wodurch sie die Konkurrenz zwischen den Nationen Europas reguliert, manches durch Nichtbefassung (noch) zuläßt, anderes auf indirektem Weg – durch die geldpolitischen Vorschriften – einzuschränken sucht, und einige Bereiche staatlicher Wirtschaftspflege werden überhaupt supranational organisiert. Die Bedürfnisse der einzelnen Mitgliedsländer bei der Betreuung ihrer Standorte sind damit im Verein der EU einerseits anerkannt; andererseits ist ihre Entscheidungsfreiheit in wirtschaftspolitischen Dingen erheblich relativiert. In vielen Angelegenheiten sind die Staaten Europas von der Vereinbarkeit ihrer Maßnahmen mit dem Vertragswerk der Gemeinschaft abhängig, die Durchführung ihrer Absichten bedarf der Zustimmung der anderen, die Durchsetzung ihres nationalen Interesses ist gewissermaßen genehmigungspflichtig und mit Zugeständnissen an den Nationalismus der verbündeten Konkurrenten verbunden. Die entsprechenden Tauschgeschäfte finden in Verhandlungen mit den supranationalen Institutionen der EU statt, in denen die Staaten vertreten sind und sich ständig bemühen, die Fortschreibung bzw. Revision der europäischen Geschäftsordnung zu erstreiten, die den Erfordernissen ihres Standorts Recht gibt.
*
Den Leitfaden für diese Konstruktion bildet offenbar ein Ideal, das die Erbauer der Wirtschaftsmacht Europa aus der Führung und Leitung ihrer Heimatstandorte entlehnt haben. Denn auch dort ging es stets um die Unterscheidung zwischen nützlichen Staatsinterventionen und überflüssiger Hilfe, zwischen „produktiven“ Investitionen aus dem Haushalt, die der Herstellung von Rentabilität dienen, und unproduktiven Überlebenshilfen, die nur den Fortbestand unwirtschaftlicher Unternehmen sichern und höchstens zeitweise zu rechtfertigen sind – als „Abfederung“ unerwünschter Wirkungen und Kosten, die eine zu schnelle Abwicklung verursachen würde.
In der EU sind diese Güterabwägungen nun nicht mehr den Berechnungen der jeweiligen Regierung überlassen. Abstimmung ist geboten, seitdem im Zuge der Vergrößerung der EG ein zusätzlicher, quasi übergeordneter Standpunkt praktiziert wird. Dieser behandelt den gemeinsamen Markt, auf dem die Konkurrenz das Geschäft belebt, als einen Standort Europa, dessen Inventar – Territorium, Kapital, Arbeitskräfte – in möglichst großem Umfang für die Auseinandersetzung mit den anderen Wirtschaftsmächten mobilisiert werden muss. Die unter den Bedingungen der Marktöffnung entfachte Konkurrenz zwischen den Partnerstaaten wurde um eine Kooperation ergänzt, die auf Schadensbegrenzung ausgerichtet ist: Die nationalen Filialen sollten die mit dem entschränkten Markt fällige Auslese in einer Verfassung überstehen, die sie zu Beiträgen zur europäischen Sache befähigte; als Gemeinschaft verpflichteten sich die EU-Staaten auf eine Kompensation für ihren Verzicht auf ihren angestammten Protektionismus. Und diese Veranstaltung bestand nicht nur in den Abmachungen des EWS, der wechselseitigen Unterstützung in Fällen ernsthafter, aber für vorübergehend gehaltener Beeinträchtigung der nationalen Währungen; sie erstreckte sich auch auf die wirtschaftspolitische Förderung von Reichtumsquellen in europäischen Landen: Mit gemeinschaftlichen Finanzmitteln bemühte man sich um Entwicklung
nationaler Geschäftszweige.
So hat sich die EG von Anfang an der im Kapitalismus notorischen Bauernfrage angenommen und das nationale Subventionieren durch ein europäisches Agrarprogramm abgelöst. Allerdings so, dass sie von der Not, mit öffentlichen Mitteln eine Landwirtschaft zu erhalten, weil die dem marktwirtschaftlichen Gebot lohnender Preise nicht genügt, zur Tugend übergegangen ist, die Landwirtschaft zu einem rentablen Geschäftszweig herzurichten. Die dafür fälligen Kosten sind enorm – sie machen den größten Posten des europäischen „Staatshaushalts“ aus –, werden aber nicht für den vergleichsweise bescheidenen Zweck aufgebracht, einen Nährstand die Konkurrenz überleben zu lassen, der er immerzu nicht gewachsen ist, weil die erzielten Marktpreise keinen Überschuß über die Kosten für Kapital und Grundeigentum hergeben, bei allem Aufwand an Arbeit auf dem Feld und im Stall. Die europäischen Preis- und anderen Subventionen lohnen sich dadurch, dass sie die Kapitalisierung der Landwirtschaft vorantreiben: Sie ermöglichen den landwirtschaftlichen Betrieben die kostenträchtige Steigerung ihrer Produktivität, die auch in diesem Zweig der Marktwirtschaft dem Gewinn verpflichtet ist. Sie fordern aber auch den Betrieben ein ertragreiches Wirtschaften ab; die mit den Segnungen moderner Agrartechnologie entfachte Konkurrenz bewirkt eine flotte Auslese in der europäischen Bauernschaft, deren Gang durch gemeinschaftliche Instanzen gesteuert wird. Die Aufmerksamkeit gilt einerseits der Balance zwischen erwünschter Förderung haltbarer Projekte und dem Abbruch überflüssiger „Kapazitäten“ auf den einzelnen Standorten. Andererseits erfolgt diese innereuropäische Zuteilung von Mitteln für die Rationalisierung von Ackerbau und Viehzucht unter dem Gesichtspunkt, die zielstrebig hochgezüchtete Agrarindustrie der EU zum Nutznießer des Weltmarkts zu machen.
Dieselben Zielsetzungen – „Entwicklung“, Vermeidung von störenden „Ungleichgewichten“, Befähigung zum Wettbewerb gegenüber der außereuropäischen Konkurrenz – liegen der Schaffung und Bewirtschaftung der anderen Fonds zugrunde. Diese tragen in der Art ihrer Beschickung der unterschiedlichen Finanzkraft der europäischen Staatshaushalte Rechnung, weisen – wenngleich in bescheidenem Maße: der gemeinsame Markt „verteilt“ Kapital in ganz anderen Größenordnungen – den Charakter einer Umverteilung auf und bringen allerlei Projekte in Gang. Unter Titeln wie „Kohäsion“ und „Strukturförderung“ wurde hier die rückständige Infrastruktur aufgemöbelt, da etwas an Forschung & Entwicklung etabliert und in Gegenden mit chronischer Wachstumsschwäche Hilfe für die Sanierung oder Gründung von Unternehmen gewährt.
Solche Eingriffe in die Freiheit der Konkurrenz werden von Regierungen, die bei ihrer Standortbetreuung von den Töpfen der EU profitieren, allemal geschätzt. Aber mit einer Absage an die Konkurrenz zwischen den Nationen war die wohldosierte Fürsorge nie zu verwechseln; vielmehr wurden die Auseinandersetzungen über Art, Umfang und Dauer der Zuwendungen zum institutionalisierten Bestandteil des innereuropäischen Wettbewerbs, der ja ansonsten mit den wirtschaftspolitischen Anstrengungen nationaler Prägung weitergeführt wird. Der Einsatz nationaler Haushaltsmittel ist in den meisten Fällen, wo europäische Fonds ein Projekt unterstützen, sogar die Voraussetzung für solche Leistungen der Gemeinschaft. Eine Wettbewerbskommission war für die Europa-Politiker zu keinem Zeitpunkt entbehrlich. Unter Nationen, die ihre Mitwirkung an Europa immerzu mit der Berechnung verknüpfen, ob und in welchem Maße sich ihr Beitrag zum EU-Haushalt für sie auszahlt, ist der Unterhalt einer solchen Kontrollinstanz – als spezielle Abteilung der EU-Kommission – nämlich kein Luxus. Sie wacht über die Einhaltung der Wettbewerbsordnung, welche die große Kommission über Europa verhängt. Dabei befasst sich das Kommissariat nicht nur gerichtsförmlich mit der Zulässigkeit von Subventionen, die sich das eine oder andere Land aus den Töpfen der EU an Land gezogen hat, es überprüft auch die Befolgung von Quoten, die in der Brüsseler Zentrale beschlossen wurden und die Zuteilung von Reichtumsquellen auf die Standorte organisieren, weil in manchen Gewerben Überproduktion samt ihren negativen Wirkungen auf die Konkurrenz droht. Zu kontrollieren gilt es auch die Rechtmäßigkeit von einzelstaatlichen Sonderwegen in der Standortbetreuung – da ist in einem Fall die Privatisierung nicht EU-konform verlaufen, in einem anderen verstößt ein Staatsbetrieb mit seinen Vorteilen gegen die marktwirtschaftliche Fairness. Ob eine Regierung mit ihrem Haushalt einen Konzern sanieren darf, wird genauso überprüft wie die Steuerpolitik, mit der ein Finanzminister der Strombranche oder den Banken des Landes auf die Sprünge hilft. Und auch aus Affären, die zunächst ganz andere Bereiche der hoheitlichen Fürsorge betreffen – Verkehr und Post, Gesundheit und Seuchen[1] –, werden in der EU Aufsichtsfälle, weil noch jede Regierung die Veränderung der nationalen Geschäftsbedingungen wahrnimmt und die eingetretenen Unterschiede zwischen daheim und auswärts zum „nicht-tarifären Handelshemmnis“ erklärt bzw. in ein solches ummünzt. So dass die Kommissare, die bei der Erfüllung ihrer Pflichten den Interessen der Gemeinschaft folgen und von ihren Regierungen keine Anweisungen entgegennehmen dürfen, alle Hände voll zu tun haben. Jahraus, jahrein beschäftigen sie sich damit, die nationalen Praktiken der Geschäftsförderung auf ihre Europatauglichkeit hin zu besichtigen, letztere zu definieren und die Regierungen der Mitgliedsländer ihren Setzungen zu unterwerfen.
*
Die Urheber dieses Regimes – die nationalen Regierungen von Europa, ihre Vorgänger und oppositionellen Ersatzmannschaften – hatten mit den Leistungen der supranationalen Instanzen, deren Ermächtigung ihr Werk ist, immer dieselben „Schwierigkeiten“. Einerseits ist Respekt vor den Entscheidungen der europäischen Behörden geboten, andererseits gehört an jeden Beschluß der Maßstab des bedienten oder übergangenen nationalen Interesses angelegt. Der Vorbehalt gegenüber den übergeordneten Befugnissen, die alle wollten – sie taugen, einmal anerkannt, der Unterordnung anderer –, hat den Weg zur heutigen Geschäftsordnung bestimmt und macht das „Konstruktionsprinzip“ Europas aus. Ihr Zustandekommen ist eine Geschichte von Kampfabstimmungen, die den Grad der Ermächtigung der Zentrale betrafen, zu gewärtigende Entscheidungen in Betracht zogen und heftige Auseinandersetzungen bezüglich der Besetzung europäischer Gremien und Posten hervorriefen. Beim Postenschacher war die offizielle Lesart von der „Unabhängigkeit“ der Amtsträger nie ein Hindernis für sehr eindeutige Anträge, die europäische Sache den Leuten zu übertragen, die „qualifiziert“ waren – für die eigene nationale Linie. Und im formellen Teil der EU-Hausordnung – Sitz & Stimme, Abstimmungsmodi – ist sichergestellt, dass der Nationalismus auch in zahlreichen Einzelentscheidungen zu seinem Recht kommt, was zu lebhaften Intrigen und Tauschgeschäften führt.
Beobachter von kleinen und großen Europagipfeln wissen mit der größten Selbstverständlichkeit von Siegern und Verlierern zu berichten, bedauern oder feiern Kompromisse, die den Kontrahenten in der heimatlichen Szene Lob oder Schelte einbringen. Sie bewerten wie die Protagonisten der Europapolitik selbst die Verhandlungsergebnisse als gerechten Ausdruck der innereuropäischen Kräfteverhältnisse – oder als Verstoß dagegen. Dass es eine Hierarchie in Europa gibt, in der die potenteren Staaten und ihre Politiker immerzu etwas „durchsetzungsfähiger“ sind, wird gerne bekanntgemacht, ohne damit „Erpressung“ zu beklagen. Solcher Tatbestand wird umgekehrt entdeckt, wenn sich kleine, offenbar auf Unterordnung abonnierte Nationen der gültigen Regelungen in der EU bedienen und sich für manchen Geschmack zu viel herausnehmen. Bis dann wieder Milde waltet und „Realismus“ einzieht; dann ist das rücksichtslose Dringen auf Unterordnung kein Patentrezept für den europäischen Fortschritt. Das Mitmachen auch der kleineren Partner will durch Zugeständnisse an ihr Kalkül erkauft sein.
So treibt sich die Europapolitik und mit ihr die Schar ihrer Liebhaber in dem Widerspruch des pro-europäischen Nationalismus herum. Von der kapitalistischen Qualität der Vorteilsrechnungen, denen „Europa“ dienstbar gemacht werden soll, brauchen sie kein Aufhebens zu machen, die Vorkämpfer des ewigen Friedens zwischen den Nationen auf „unserem“ Kontinent. Wenn sie in einem Zug die Fortsetzung der Konkurrenz unter den EU-Partnern beklagen, also los sein möchten, und dem unverbrüchlichen Recht ihrer Standorte das Wort reden, welches Recht ihnen durch die EU gesichert werden muss, werden alle Europa-Politiker zu bekennenden Anhängern des Ideals einer friedlichen Eroberung. Wenn der alltägliche Verlauf des europäischen Programms mit seinen Händeln dann zeigt, dass die gleichberechtigte Fusion von fünfzehn auf Vermehrung von Kapital und Macht erpichten Nationen diese Güter höchst unterschiedlich verteilt und dass das aus der Verfügung über diese Güter errechnete „Gewicht“, mit dem die Staaten in die EU eintreten und an ihrer Gestaltung mitwirken, seine Wirkung tut; wenn dieses Gewicht außer dem gang und gäben Konkurrenzkampf zwischen den Nationen auch einen zweiten bestimmt, nämlich den um die supranationale Macht, deren Gebrauch und damit den Status jedes Mitgliedslandes im gegenwärtigen wie künftigen Europa – dann kriegt besagtes Ideal seine Kratzer. Die europäischen Politiker scheiden sich in solche, die vor der Verwirklichung der friedlichen Eroberung auch einmal Angst bekommen, weil sie mit ihrem Sprengel auf nützliche Unterordnung festgelegt werden. Und in andere, die darauf bestehen, dass Europa gescheit und fertig gemacht gehört – die nämlich in den aktuellen Mängeln der EU, in ihrer Verfassung und in ihrer ökonomischen Verwaltung lauter Gründe dafür sehen, dass sie zu kurz kommen.
*
Seitdem der Euro unterwegs ist und keine gute Figur macht, beherrschen ökonomische Nationalisten ein Argument: Obwohl diese Geldsorte das Kapital des größten Binnenmarktes auf Erden repräsentiert, unterbleibt seine allen Geschäften mit ihm förderliche Anerkennung. Unter Verweis auf zunächst noch günstige „fundamentals“ in Europa waren deutsche Kenner der Lage schnell mit einem Schluss bei der Hand: Die Gunst, die die internationalen „Märkte“ einer Währung gewähren, ist nicht zuletzt eine Folge des Vertrauens, das Anleger und Spekulanten den politischen Herren des Geldes entgegenbringen. Die Fragwürdigkeit des politischen Willens, mit dem die Bewirtschaftung der Euro-Zone vorgenommen wird, die Unsicherheit in bezug auf die innereuropäischen Entscheidungen – von der Geldpolitik in Frankfurt über die Haushaltsführung in den Hauptstädten bis zu den umstrittenen Projekten der Kommission – war als Grund für die Schwäche des Euro ausgemacht. Solche Selbstkritik ist zwar selbst ein offizieller Beitrag zum Grund der Misere, war aber anders gemeint: als Aufruf zur Überwindung der EU-Geschäftsordnung, die alles andere ermöglicht, nur nicht jene Zuverlässigkeit in der Planung und Steuerung europäischen Wachstums, vor der dann die internationale Geschäfts- und Staatenwelt den Hut zieht.
Derselbe wuchtige Vorwurf ist – in Verbindung mit dem Euro wie unabhängig davon – auch in einer Klage zu vernehmen, die in einen Antrag mündet. Die Klage: Entscheidungen, obgleich dringlich erwartet und vonnöten, kommen zu langsam oder gar nicht zustande. Das liegt am überkommenen Procedere der EU, die Organisation der Willensbildung ist falsch gestrickt, ein veritables Hindernis, in und für Europa Politik zu machen. Der Antrag: Beseitigt werden muss die für so viele Bereiche erforderliche Einstimmigkeit der Beschlussfassung. Diese Bremse und Verhinderung konsequenten politischen Handelns ist zu ersetzen durch Mehrheitsbeschlüsse, denen sich auch die Mitglieder zu unterwerfen haben, die in der jeweiligen Sache Gegner sind.
Die Heuchelei, die sich als entschiedenes Eintreten für Effizienz vorträgt, ist bei solchen Demarchen unschwer herauszuhören. Es wird schon Stoff geben, für dessen europäische Behandlung Deutschland einen Vorschlag hatte und kein Gehör fand, weil andere nationale Interessen verletzt werden sollten und die Zustimmung unterblieb. Und die Fortsetzung des Antrags macht deutlich, welche Veränderungen des überkommenen Schachers mit Sitz um Stimme angestrebt sind. Ein bißchen Gewichtung der nationalen Stimmkräfte muss schon sein, welche Forderung aber – leider – noch nach dem Modus des alten, gänzlich unproduktiven Stimmrechts entschieden wird; ebenso wie der Streit darum, in welchen Affären demnächst Mehrheitsbeschlüsse gelten oder die Einstimmigkeit ihr destruktives Werk weiter treibt. Schön zu sehen an der Auseinandersetzung ist auch, dass man in Europa genauso wie im eigenen Staat Unterordnung will und Demokratie dazu sagt…
Die verwegene Kombination einer schlichten nationalen Vorteilsrechnung mit der Unterbreitung eines Verbesserungsvorschlags, der sich ganz der Sorge um Europa verdankt und widmet, ist nicht nur in Verfahrens-, sondern auch in Sachfragen üblich. In der Berliner Verhandlung zur Agenda 2000 ist es nicht bei der Ernennung Deutschlands zum Nettozahler geblieben. Diese Figur aus dem Rechnungswesen der EU ist nicht aufgetreten, um zu verkünden, dass sie ihr Geld ab sofort behält. Dass die Agrarsubventionen den Charakter von überflüssigen faux frais für die Gemeinschaft aufweisen, war schon darzulegen. Einerseits der Zustimmung wegen – die nicht nach Wunsch ausgefallen ist –, andererseits auf Grund der Tatsache, dass der Haushalt der EU nach wie vor auf Wirkungen berechnet ist, die im nationalistischen Schlagwort vom „Nettozahler“ glatt vergessen sind. Der mag, insbesondere für den Hausgebrauch, noch so sehr die Pose des Opfers seiner Gemeinschaft einnehmen, die seiner Nation nur Kosten statt Nutzen beschert: Sein Antrag ist einer zur Gestaltung des europäischen Haushalts und damit auf die künftigen Bedingungen der Konkurrenz in und zwischen europäischen Landen, wie er sie haben will.
Wer mit diesen, nun einmal durch die Kommission gesetzten, Regeln für das Geschäft auf dem Markt Europas nicht mehr zufrieden ist, kann sich auch eine Zeitlang darauf beschränken, einfach „Brüssel“ zu rufen. Dieser Städtename steht dann für die Regulierungswut
einer fremden Behörde, die „uns“ Vorschriften macht, obwohl sie gar nicht weiß, was „wir“ brauchen. Wenn ein bayerischer Ministerpräsident seinem Lokalpatriotismus auf diese Weise ein bisschen Luft macht und sich als Opposition gegen die Bundesregierung profiliert, weil diese sich und ihren Bundesländern zuviel Beschränkungen gefallen lässt, ist keine Kündigung der Mitgliedschaft in der EU zu befürchten. So populär geben sich alternative Nationalisten, die die deutsche Europapolitik weit kompromissloser haben möchten. Dass ausgerechnet sie als Standortverwalter eines Teilstaats ihr eigenes Regelwesen wegen der „Eurokraten“ ein bisschen umstellen müssen, erklären sie zur Bevormundung des Volkes, dem sie rückhaltlos dienen. Vom Bierzelt aufs diplomatische Parkett zurückgekehrt, werden sie richtig konstruktiv, wenngleich schon wieder sehr verlogen. Sie erfinden ein Prinzip, das sie gewahrt sehen möchten, nennen es Subsidiarität
und erläutern es ungefähr so: Alles, was in Europa durch die Nationalregierungen geregelt werden kann, ist dort zu entscheiden. Damit ist ein Recht angemeldet, das mit „Schutz vor Brüssel“ wirklich nicht zu verwechseln ist. Unter dem leicht verfremdenden Titel „klare Abgrenzung der Kompetenzen zwischen Brüssel und den lokalen Regierungen“ wird das Gesuch eingereicht, unter gewisser Berücksichtigung der eigenen Interessen an der Ausgestaltung supranationaler Macht in Europa mitzuwirken. Bei Gelegenheit wird noch das eine oder andere Beispiel dafür nachgereicht, was man sich als unverzichtbaren Fall von Eigenverantwortung
so vorstellt. Die Sozial- und Steuerpolitik haben dort zu bleiben, wo sie sind, und in Europa nichts verloren; diese Bereiche werden ausdrücklich als Mittel des Wettbewerbs veranschlagt – und niemandem fällt ein, diese Tour der Europapolitik mit den sonstigen Bemühungen ihrer Vertreter zu konfrontieren. Neben den für die Stabilität des Euro ergangenen Vorschriften in bezug auf die Haushaltsführung, die durchaus einiges an sozialer Wirkung entfalten und das auch sollen, befürworten solche Kritiker des Brüsseler Bevormundungswesens locker massiven „Druck“ auf Staaten, die ihnen mit ihren Zinsen und Steuern Kapital abspenstig machen…
Die diplomatischen Vorstöße, mit denen vor allem deutsche Politiker ihr flammendes Bekenntnis zu Europa mit sehr grundsätzlichen Reformvorschlägen verbinden und nie vergessen, ihr Volk als Opfer der Unzulänglichkeiten der Union hinzustellen, mögen bisweilen den Eindruck erwecken, dass da nichts zueinanderpasst. Es passt aber zusammen, auch wenn der eine mehr Europa!
schreit und der andere weniger Europa!
fordert. Es ist sehr schlicht. Die auf den Publikumsgeschmack ausgerichteten und bewusst bescheuert gehaltenen Kürzel sind Chiffren, mit denen erstens die Konkurrenz zwischen den EU-Staaten ins Visier genommen wird, zweitens die Konkurrenz um die Politik der supranationalen Zentrale ihre Würdigung erfährt. Und bei der streng national eingestellten Optik der kritischen Europa-Politiker präsentieren sie ihre Unzufriedenheit mit dem ganzen Laden, indem sie dem Ausland wie den Eingeborenen erzählen, was sie loswerden wollen, wovon „man“ in bezug auf die bisherige Organisationsweise der EU „Abschied“ zu nehmen hat. Wer das Recht anderer Staaten, die Brüsseler Politik mitzuentscheiden, für eine Störung der Effizienz hält, mit der Europa verwaltet gehört; wer die Wahrnehmung dieses Rechts als einen „nationalen Alleingang“, einen Verstoß gegen den europäischen Gemeinsinn geißelt; dem fällt schon einmal „mehr Europa!“ als Rationalisierungsmaßnahme ein. Umgekehrt fallen einem kongenialen Beobachter die kostenträchtigen Zuwendungen, die sich manche Länder durch ihre Mitsprache erstreiten, ins Auge. Sie sind dem Herrn „Nettozahler“ zu viel, was ihm beweist, dass „weniger Europa!“ mehr wäre. Darüber, dass sie ihr eigenes nationales Interesse an der EU, ihre Vorstellungen von deren Führung und Leitung mit dem einzig senkrechten „Europa“ identifizieren, brauchen sie kein Wort zu verlieren. Wenn sie dazu aufgelegt sind, bezeichnen sich deutsche Europapolitiker aber auch einmal gerne als echte Europäer. Und das sind sie auch, wenn sie sich um die künftige Geschäftsordnung der EU bemühen.
*
Ihr konstruktiver Einsatz, den sie mit lauter Variationen des Themas einläuten: „Die EU in ihrer gegenwärtigen Verfassung taugt nichts!“, zielt auf die Etablierung einiger Faustregeln für das Verhältnis von Geschäft und Gewalt in Europa, die mit der Einführung des Euro vorbereitet worden ist:
- Für die nachhaltige Härte des Euro ist bei seiner Einführung ein Stabilitätsgebot über die nationalen Haushalte verhängt worden. Die Regierungen, die ihre Politik mit Geld machen, sollen sich bei ihrer Standortbetreuung darauf beschränken, was sie sich leisten können. Das ergibt sich daraus, was an nationalem Wachstum auf dem Standort und mit seinen übernationalen Handelsbeziehungen zustandekommt. Staatsschulden zum Zwecke der Herstellung von Konkurrenzfähigkeit, das vertraute Instrument zur Mobilisierung rentablen Kapitals und der dazugehörigen Arbeit, sind ein Verstoß gegen die Währungsunion, wenn sie am dringendsten gebraucht werden. Die Nationen haben sich damit zu bescheiden, was die freigesetzte Konkurrenz in Europa hergibt – politische Korrekturen an der Konkurrenzlage stehen unter europäischer Aufsicht. Die vorhandene und politisch erzeugte (Lohn-)Armut darf sich als Attraktion für europäisches Kapital bewähren, der Staat die Geldströme zu seiner Bilanz hochrechnen. Und sich damit abfinden, dass die EU ihren Mitgliedern den ihnen gebührenden Status zuweist.
- Die „Nettozahler“ der EU beschließen, dass es sich bei der Bewirtschaftung der Fonds um faux frais handelt, die Europa nicht mehr voranbringen. Solche Rücksichtnahme auf den Status der Mitglieder, auf ihre ökonomischen Schwächen hat ihre Dienste getan. Was durch die Förderung an rentablen Geschäften entstanden ist, hat sein Existenzrecht bewiesen; die anderen gibt es nicht mehr oder sie sind definitiv überflüssig, wie die agrarische Überschussproduktion beweist, die aus EU-Töpfen bezahlt wird. Deshalb gilt heute: Was die freie Konkurrenz quer durch Europa für die Standorte hergibt, geht in Ordnung; Subventionen sind kontraproduktiv, kosten europäischen Kredit und sind keine „sozialen Besitzstände“ der Mitgliedsländer. Künftig können sie sich auch auf diesem Feld nur leisten, was ihr eigener Haushalt gestattet.
- Dass sogar solch vernünftige Veränderungen am Umgang mit dem Geld der EU nicht schnurstracks durchgeführt werden können, liegt am Status, den sich die Nutznießer des Förderungswesens in grauer Vorzeit ergattert haben. Heute steht fest, dass sie im Verhältnis zu ihrem Anteil an der und Beitrag zur EU einfach zuviel Macht haben. Mit Sitz und Stimme konterkarieren sie bei allen Entscheidungen darüber, wie die EU regiert werden soll, die offenkundigen Kräfteverhältnisse. Ohne Reform keine verlässliche Unterordnung.
Es ist kein Geheimnis, worauf sich die Erneuerer Europas verlassen, wenn sie sich daran machen, die Regeln und Rechte, die bislang für den Verkehr zwischen den Mitgliedsländern der EU gelten, außer Kraft zu setzen. Ihre Sicherheit betrifft den Ausgang einer Güterabwägung, die auch kleine Nationen der Gemeinschaft anstellen: Die Prüfung, was und wieviel die EU mit welcher Hausordnung für ihren kapitalistischen Nationalismus taugt, artet nicht in Richtung Absage aus. Ein paar Jahrzehnte gemeinsamer Markt und das mehrheitliche Ja zum Euro haben „Abhängigkeiten“ gestiftet, die eine „Kündigung“ nicht geraten scheinen lassen. Wo die „Lebensmittel“ dieser auf Kapital gegründeten Nationen – ob sie nun Investitionen, Wachstum, Einkommen, Märkte oder sonstwie heißen – auf dem europäischen Geschäft beruhen, mit ihm stehen und fallen; wo schließlich auch noch das Maß und Ziel all dieser entscheidenden Faktoren, das Geld, eine europäische Größe ist, sind Kompromisse geboten. Umgekehrt: Hier sind Politiker mit ihrer Selbsternennung zu quasi natürlichen Führern Europas befasst. Zu solch forscher Ermächtigung weiß sich eine Nation befugt, die vom Stoff, von dessen Mehrung alle Partner leben, das Meiste und darum die Macht hat, die überzeugt. Die Politiker dieser Nation scheuen auch nicht den Streit, den sie bewusst anzetteln. Euro-Imperialisten ihres Schlages riskieren auch den Test, den sie dabei an den großen Partnern vornehmen. Von den Schwierigkeiten, die der Euro der EU-Gemeinde gerade beschert, lassen sie sich noch weniger beirren. Für dessen Geldmacht wollen sie nämlich die politische Macht in Europa auf sich konzentrieren.
Und noch etwas. Für den Fall des halben oder ganzen Scheiterns dieses Versuchs zeihen sie sicher ihre widerspenstigen EU-Partner der Verantwortungslosigkeit, wenn der Euro weiter wackelt und das europäische Geschäftsleben stottert – womit sie nur den nächsten Anlauf ansagen. Die Opposition wird eine Zeitlang Gelegenheit haben, das Unvermögen und Ungeschick zu brandmarken – bei der Durchführung einer Initiative, gegen die sie gar nichts hat, vielmehr lieber selbst in die Hand nehmen würde. Für den Fall des halben oder ganzen Gelingens allerdings – einiges ist ja im Rahmen der Agenda 2000 und in Sachen Stimmengewichtung schon gelaufen – ist eines so sicher wie das Amen: die Beschwörung von Madame Geschichte, die kleine und große imperialistische Erfolge mit dem Etikett „historisch“ versieht.
Diesem Zirkus hat der grüne Außenminister schon einmal vorgearbeitet. Seitdem die deutsche Attacke auf die Fehlkonstruktion der EU unterwegs ist, läuft der Mann mit Visionen herum und malt ein Europa aus, in dem alle ihren Platz haben. So schön kann Europa-Politik sein.
[1] Zur Verwandlung von BSE in eine innereuropäische Konkurrenzschlacht und ihren Schönheiten vgl. GegenStandpunkt 1-01, S.129