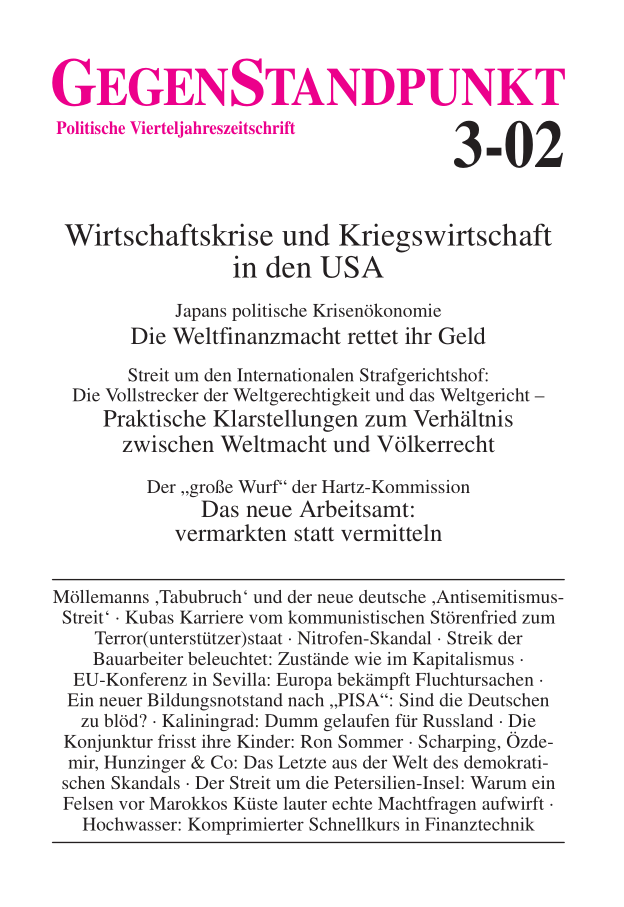Krise und Kriegswirtschaft in den USA
Die amerikanische Regierung verordnet weltweit eine rücksichtslose Unterordnung politökonomischen Rechnens unter den von ihr ausgerufenen Weltkrieg, ruiniert die Geschäftsmöglichkeiten in ganzen Regionen und schädigt damit ganz fundamental das weltweite Geschäft. Im Verhältnis zur eigenen ökonomischen Basis vollzieht der amerikanische Staat den Übergang zur kapitalistischen Kriegswirtschaft, d.h. er postuliert ungerührt die Vereinbarkeit seines kriegsmäßigen Finanzbedarfs mit dem kapitalistischen Wachstum.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
- A. Die Wirtschaftskrise und ihre politische ‚Bewältigung‘
- B. Kriegswirtschaft
- I. Das Kriegsprogramm
- II. Exkurs zum Thema ‚Kriegshaushalt‘
- 1.) Zur kapitalistischen Natur der Staatsfinanzen im allgemeinen: ‚faux frais‘ auf Kredit[11]
- 2.) Zum geschäftlichen Nutzen von Rüstungsausgaben: Reichtumsvermehrung durch die permanent erweiterte Reproduktion von Zerstörungsgerät
- 3.) Vom Rüstungsbudget zum Kriegshaushalt – und wieder zurück: „Höhere Gewalt“ als Schadensfall
- III. Welt-Kriegswirtschaft neuen Typs
Krise und Kriegswirtschaft in den USA
A. Die Wirtschaftskrise und ihre politische ‚Bewältigung‘
I. Der Crash
Nicht bloß ein großer Energiehandels-Spekulant geht pleite, sondern zusammen mit oder kurz nach Enron gleich die Hälfte und mehr der stolzen „New Economy“ Amerikas. Die Elite des US-Managements gerät in den Verdacht der Bilanzfälschung. Der drittgrößte Autokonzern der USA fährt seiner schwäbischen Muttergesellschaft nichts als Milliardenverluste ein; um die beiden größeren steht es kaum besser. Die „Talfahrt der Börsenkurse“ findet kein Ende, weder im „klassischen“ noch im „Technologie“-Sektor. Das statistisch ermittelte „Konsumentenvertrauen“ lässt schwer zu wünschen übrig; der ideelle Durchschnitts-Amerikaner hat schon genug Schulden. Nationale Wachstumsziffern aus zurückliegenden Quartalen werden nachträglich ins Minus herunterkorrigiert. Dem Staatshaushalt brechen Steuereinnahmen weg; die steuerpflichtigen Einkommen geben nichts mehr her. Immer mehr arbeitsame Amerikaner beziehen, trotz „Jobwunder“ und vorbildlich „entkrustetem“ Arbeitsmarkt, gar kein Einkommen mehr.
Wenn das alles zusammenkommt, dann sind nicht bloß ein paar Wirtschaftsgangster beim Betrügen erwischt worden, oder ein paar Autobauer bei einer falschen Modellpolitik, oder ein paar Börsenspekulanten auf dem falschen Fuß, oder ein paar brave Leute von einem Schicksalsschlag. Dann sind im Kreditüberbau der Nation Gewinnansprüche in solcher Masse akkumuliert worden, dass der gesamte Kredit nehmende „Unterbau“ sie definitiv nicht mehr einzulösen vermag. Dann sind umgekehrt im produzierenden und Handel treibenden Gewerbe viel zu große Mengen von Waren und Produktionsmitteln, also von geschaffenem Reichtum und Reichtumsquellen akkumuliert worden, als dass sich damit noch wachsende Mengen von Geld verdienen ließen und die Finanziers des nationalen Kapitalumschlags noch auf lohnend re-investierbare Gewinne setzen würden. Und dann ist, aus welchem Anlass auch immer, eine Wirkungskette in Gang gekommen – erste Firmenpleiten ziehen Verluste und die Aufdeckung bislang in Kauf genommener Verluste an anderer Stelle nach sich; der eine einbrechende Börsenkurs reißt andere mit herunter; die Börsen-Baisse schmälert ihrerseits die Kreditwürdigkeit und damit die Geschäftsfähigkeit weiterer Unternehmen; die Bankenwelt sieht sich zur vermehrten Abschreibung „fauler“ Kredite gezwungen, verschärft ihre Konditionen für weitere Kreditvergabe und treibt damit Unternehmen in die Pleite, die ‚frisches Geld‘ gebraucht hätten… –, die gnadenlos aufdeckt, dass offenbar alle Beteiligten, von respektablen Multis über das Bankenwesen bis hin zu den Brokern der Wall Street, ihr Geschäft erfolgreich bis zu dem Punkt ausgeweitet haben, wo seine Fortsetzung kapitalistisch gar nichts mehr bringt und damit auch die gelaufene Akkumulation sich als Flop herausstellt. Mit einem Wort: Dann ist auch die amerikanische Wirtschaft in der Krise.[1]
Und wenn in der US-Wirtschaft Krise herrscht, dann ist das für den Rest der kapitalistischen Welt kein Glück, sondern in dem Maße ein Pech, wie sie sich über die vielen Boom-Jahre hinweg auf dem amerikanischen Waren- und Finanzmarkt ihre Geschäftsanteile besorgt hat. Dann leiden nicht bloß ein paar Exportfirmen, und nicht bloß die eine oder andere Bank muss ein paar Kredite abschreiben: Der Welthandel schrumpft, wenn der größte Markt der Welt mit Waren und Wertpapieren überfüllt ist und die Realisierung der erhofften Gewinne nicht mehr hergibt, und die Börsenkurse sinken auch andernorts unaufhaltsam. Dann stimmt weltweit so gut wie keine Bilanz mehr, und schon gar nicht die der mit Amerika rivalisierenden Staaten. Auch den Staatshaushalten der EU-Partner fehlt es an Einnahmen, und die Beschaffung von Finanzmitteln per Kreditschöpfung wird, jedenfalls nach Einschätzung der verantwortlichen Haushaltspolitiker, prekär. So sehr sich Europa einen starken Euro wünscht: Wenn der Dollar wg. Krise fällt, gibt es nichts, was die europäischen Standortverwalter daran ausnutzen könnten – zu viel vom Reichtum der eigenen Multis und „Mittelständler“ steht und fällt mit dem Geschäft, das jetzt in den USA dahin ist. So macht sich eben in der Krise geltend, dass die USA der Haupt-Standort der globalen kapitalistischen Akkumulation sind, mit der es deren Akteure wieder einmal zu weit getrieben haben: Mit dem wichtigsten „Marktteilnehmer“ ist das Weltgeschäft insgesamt im Eimer. Also starrt und hofft das Ausland zwecks Belebung der eigenen Geschäfte auf den Aufschwung in den USA, der sich nicht einstellen will; und die hiesige Presse, die neulich noch den „andauernden Boom“ der amerikanischen Wirtschaft gar nicht genug bewundern konnte, versteigt sich glatt zur Anklage an das kapitalistische Vorbildsland, es habe beim Verwalten seiner Kreditmaschinerie seinen nationalen Wirtschaftsführern zuviel Freiheit gelassen.[2]
Dort sieht man das freilich nur sehr teilweise so ähnlich.
II. Krisenpolitik auf amerikanisch
Zu der kritischen Lage ihrer Nationalökonomie stellt sich die US-Regierung, wie es sich für die Weltwirtschafts-Supermacht gehört. An den US-Börsen mögen Geldvermögen im Umfang der Staatshaushalte minderer Nationen zerstört werden; US-Großkonzerne mögen die Produktion zurückfahren, Betriebe schließen und Arbeiter zu Zigtausenden entlassen – der zuständige Präsident verkündet ebenso selbstbewusst wie erfolgsgewohnt: „Unser Kapitalismus ist stark!“ Das ist keine haltlose Angeberei, sondern die Ankündigung eines praktischen Programms. Die US-Regierung beauftragt sich mit der Mobilisierung der nationalen Ressourcen, die sie zur Überwindung aller ökonomischen Missgeschicke in ihrem Land für erforderlich hält und derer sie sich absolut und fraglos gewiss ist: Ressourcen moralischer, finanzieller und welthandelspolitischer Art, mit denen Amerika tatsächlich überreichlich gesegnet ist.
1.) Mit Fahneneid und Schadensersatzdrohung gegen die Großpleitenwelle in der „New Economy“
Ausgerechnet den größten Pleiten und Problemfällen, die die amerikanische Finanzwelt erschüttern – nacheinander offenbaren die größten Erfolgsnummern des Booms der 90er Jahre: die frisch aufgeblühten Energievorsorgungsspekulanten von Enron bis, passender Name, Reliant Energy, die Telekom-Giganten von Qwest bis Worldcom, Unterhaltungsspezialisten wie AOL Time Warner usw., dass sie sich mit fingierten Einnahmen reich gerechnet haben und weder ihre Schulden bezahlen können noch auch nur einen Bruchteil ihres Börsenwerts rechtfertigen –, stellt die Bush-Regierung mit all ihrer Gewalt das trostreiche Zeugnis aus, dass ihre Misserfolge im Grunde, nämlich dem Grunde nach mit dem amerikanischen Kapitalismus, diesem unbedingt auf grenzenlosen Erfolg abonnierten First-Class-Wirtschaftssystem, überhaupt nichts zu tun haben. Um halb oder ganz kriminelle Ausnahmen von der Regel soll es sich handeln, wo Milliarden in den Sand gesetzt werden. Die Diagnose wird in empörten Reden ans amerikanische Volk gestellt, mit Anklagen gegen die verantwortlichen Bilanzkosmetiker und gegen pflichtvergessene Wirtschaftsprüfungsfirmen – die eine von den fünf großen geht auch prompt kaputt, zur Freude der vier übrig gebliebenen Konkurrenten – gerichtlich verifiziert und durch das Versprechen des Präsidenten, die antiamerikanische Unmoral in den Chefetagen ab sofort machtvoll auszumerzen, praktisch beglaubigt.
Dieses Verdikt ist ausgesprochen dreist. Nicht bloß deswegen, weil die politischen Machthaber in ihrem früheren Leben als erfolgreiche Geschäftsleute nachweislich genau das praktiziert haben, was sie jetzt inkriminieren, und dadurch so vorbildlich reich geworden sind, wie das die Nation von einem Führer erwartet, der auch sie reicher machen soll. Sondern viel mehr noch deshalb, weil eben diese ehrenwerten Häupter sich mit Recht gegen den Vorwurf verwahren, gegen geschriebenes Recht und die Gesetze kapitalistischer Bereicherung verstoßen zu haben. Was sie überhaupt nicht anders als die jetzigen Groß-Pleitiers getrieben haben, war damals und ist im Prinzip und der guten Absicht nach immer noch wenn schon nicht hundertprozentig legal, so doch auf alle Fälle legitim und nach allen Regeln der kapitalistischen Geschäftskunst nicht bloß in Ordnung, sondern geradezu geboten. Denn was haben sie schon gemacht: mit dem Geld anderer Leute auf die zukünftige Wertsteigerung von Rendite versprechenden Wertpapieren spekuliert, die in Zukunft abzuwickelnde geschäftliche Transaktionen zum Inhalt hatten – und daran verdient; mit jedem Spekulationserfolg neues Geld in ihr Geschäft hereingezogen und damit umgekehrt den Erfolg ihrer Spekulation finanziert – und daran schon wieder verdient; der ganzen Welt ein als mustergültig anerkanntes Beispiel dafür gegeben, wie perfekt sich ein Selbstlauf spekulativer Wertsteigerung einer Firma völlig jenseits ihrer tatsächlich realisierten oder absehbarerweise demnächst realisierbaren Firmengewinne in Gang setzen lässt – und wie man daran verdient; sie haben alle Zweifel, ob das denn ins Unendliche so weitergehen könne, kreditierte Ertragsversprechen mit nichts als immer höheren neuen Schulden zu bedienen, durch eindrucksvolle Wachstumsraten eben dieses Schuldenzirkels erfolgreich zum Verstummen gebracht – und daran weiter verdient; haben ohne oder auch mit gutem Gewissen Kreditverpflichtungen ihres Unternehmens ungefähr so geschickt als „Sondervermögen“ verbucht wie der deutsche Staat die Kosten seiner „Wiedervereinigung“; schließlich haben sie ihre Hausbanken vor die schwierige Entscheidung gestellt, zur Fortführung des Spekulationsbetriebs frisches Geld nachzuschießen oder einen riesigen Haufen verbrauchten Kredits definitiv abzuschreiben – und daran ein letztes Mal verdient. Und über die ganze Zeit hinweg haben sie nicht bloß das unverbindliche Wohlwollen der öffentlichen Gewalten genossen, sondern größtes Entgegenkommen in allen eventuell hinderlichen Rechtsfragen erfahren. Denn gerade die großen und die vielen kleinen Pleite- und Problemfirmen, die jetzt vor lauter Geldgier alles falsch gemacht haben sollen, haben die seit über einem Jahrzehnt geltende oberste wirtschaftspolitische Richtlinie der „Deregulierung“, nämlich der Überantwortung aller großen Restbestände an staatlichen Versorgungsleistungen etwa im Telekommunikations- und im Energiesektor an den Geschäftsgeist privater Unternehmer und der Freisetzung dieses Geschäftsgeistes von einengenden Vorschriften zur finanziellen Solidität ihres Ladens, über acht goldene Jahre hinweg zur viel bewunderten und beneideten neuen amerikanischen Erfolgsstory gemacht.[3] Und solange der Erfolg angehalten, das Wachstum der Branche und in der Branche jede Aufblähung der hereingeflossenen Kreditmassen spekulativ völlig plausibel gemacht hat, so lange haben die Firmen der „New Economy“ nicht bloß den besten Ruf genossen; sie haben auch tatsächlich das Ihre zum ehrlichen amerikanischen Wirtschaftswachstum beigetragen. Vielleicht nicht immer ganz so viel, wie sie verbucht haben und ihnen zugeschrieben worden ist; aber was ist schon gegen eine seinerzeit zu offiziellen Würden gelangte Expertenrechnung zu sagen, nach der ein reales Verkaufsplus der Computerbranche von 1,3 Milliarden Dollar volkswirtschaftlich und wachstumspolitisch mit über 20 Milliarden zu verbuchen ist, weil die verkaufte Rechenleistung um eben diesen Dollar-Betrag besser geworden sei?![4] An solchen hübschen Rechnungen, mit denen sich ein paar dieser Computer sicher gut bezahlt gemacht haben, sind die Verlierer der Branche jedenfalls bestimmt nicht gescheitert. Und schon gar nicht ist der kapitalistischen Energie, mit der da Erfolgstypen vom Schlage des derzeitigen Präsidenten-Duo Geld gemacht haben, der allgemeine Börsenkrach und der „Vertrauensverlust“ der Finanzwelt bis hin zu einem zeitweiligen Misstrauen in den Dollar als Anlagewährung anzulasten – außer in dem grundsätzlichen Sinn, dass diese Energie zur allgemeinen Überakkumulation von Kapital, in der „alten“ Ökonomie der Autobauer, Stahlfabrikanten und Maisproduzenten übrigens ganz genau so wie in der „neuen“ der Software-Start-ups und der Handy-Spekulanten, den „subjektiven Faktor“ beisteuert.
Freilich, mit dem ausbleibenden Erfolg ändert sich die Optik; und mit den großen, nicht mehr aufzuhaltenden Misserfolgen erwacht in der Regierung schlagartig ein rückwirkendes Unterscheidungs- und Kritikvermögen, die Besonderheiten der so besonders viel Kapital vernichtenden Geschäftsabteilung betreffend. Doch es will nachher so wenig wie vorher irgend jemand, geschweige denn irgendein verantwortungsbeladener Wirtschaftspolitiker, irgendetwas von der wirklichen politökonomischen Besonderheit des Kapitalumschlags in der „New Economy“ wissen – die es ja immerhin gibt: Die Unternehmen in dieser „deregulierten“ Bereich starten mit einer Trennung und quantitativen Diskrepanz zwischen Betriebsvermögen und Gewinn auf der einen, kreditierter Gewinnerwartung und Börsenwert auf der anderen Seite, in die herkömmlich investierende Kapitalisten sich mit vielen erfolgreichen, kreditierten bzw. börsenfinanzierten, entsprechend verstärkten und schon wieder um so erfolgreicheren Konkurrenzanstrengungen zur Eroberung und Monopolisierung ihres Marktes, die am Ende in dessen hoffnungslose Überfüllung mit konkurrierenden Warenangeboten einmünden, erst einmal hineinwirtschaften müssen. Deswegen ist es auch gar kein Wunder, sondern kapitalistisch völlig in Ordnung, dass die krisenhafte Aufdeckung allgemeiner Überakkumulation bei den besonders kühn konstruierten Schuldentürmen der Großen dieser Branche anfängt und die Annullierung vorgeschossenen Geldes hier besonders drastisch und gigantisch ausfällt – außer Schulden bleibt bei einem Konkurs ja kaum etwas übrig. Genau dies jedoch: die kapitalistische Folgerichtigkeit von kühner Finanzierungskunst und spektakulärem Zusammenbruch in der mustergültig „deregulierten“ Sonderwirtschaftszone des amerikanischen Kapitalismus, stellt die Regierung praktisch in Abrede, indem sie den uramerikanischen „pursuit of happiness“, der sich da einmal so richtig hemmungslos hat austoben dürfen, nachträglich unter Anklage stellt – unter allerlei Rechtstiteln, die aus den Bilanzierungsvorschriften schon herauszulesen sein werden, tatsächlich aber auf Grund keines anderen wirklichen Verbrechens als wegen des eingetretenen Misserfolgs. Dass Reichtumsvernichtung, noch dazu so konzentriert und in derartiger Größenordnung und mit schädlichen Wirkungen für die Nation, an Stelle von Kapitalvermehrung zu privatem und öffentlichem Nutzen, wie sie doch jahrelang geklappt hat, zu dem „starken Wirtschaftssystem“ Amerikas und dessen gewohnten Aufs und Abs dazugehören könnte, lässt die Regierung schlicht nicht gelten; was so eklatant scheitert, sortiert sie schon mal vorweg als quasi kriminellen Akt aus der allgemeinen Stockung des nationalen Geschäftsgangs heraus, die sie daneben freilich schon auch zur Kenntnis nimmt. Sie lässt Firmen scheitern, die das Recht der Nation auf erfolgreichen Kapitalismus so massiv und irreparabel verletzen, überantwortet sie dem Konkursrichter und fingiert nicht nur, sondern inszeniert mit der Gewalt ihres Rechts einen tiefen sittlichen Graben zwischen den Wirtschaftsverbrechern, die an so viel Misserfolg schuld sind, und dem soliden Rest der Managerzunft, bei dem Amerikas Recht und Fähigkeit, im System der freien Konkurrenz immer und überall zu gewinnen, in guten Händen ist.
Für diese Maßnahme zur Wiederherstellung des Vertrauens in Amerikas „starke Wirtschaft“ ist der Bush-Administration – neben ein paar Ideen zu einer verschärften Auskunftspflicht für börsennotierte Unternehmen – ein Regieeinfall gekommen, der in seiner Schlichtheit als genial zu bezeichnen ist. Gott und Geld, die beiden heiligsten Güter und höchsten Werte der Vereinigten Staaten, bringt sie in Anschlag, um die Grenze zwischen dem Reich des amerikanisch-kapitalistisch Guten und dem des bösen unamerikanischen Misserfolgs zu markieren und dicht zu machen: Sie verlangt von der Geschäftsführung großer Firmen einen Eid auf die Richtigkeit ihrer Bilanzen; und sie droht für falsch beeidete Verluste die Verpflichtung der Chefs zu Schadensersatz aus ihrem privaten Vermögen an. Das bringt nach Beschluss und Willen der nationalen Führung den Kapitalismus auch im so großartig gescheiterten Segment der „New Economy“ unweigerlich wieder in die Erfolgsspur – und ob man’s glaubt oder nicht: Kaum ist die Elite aus den Chefetagen zum Fahneneid auf die Ehrlichkeit der eigenen Erfolge angetreten, macht die New York Stock Exchange einen der prozentual größten Sprünge in ihrer abwechslungsreichen Geschichte nach oben!
Allerdings nur für einen Tag. Denn so ganz löst sich die allgemeine „recession“ dann doch nicht in Sünde und Gottvertrauen auf.
2.) Steuersenkungen für mehr amerikanische Wirtschaftskraft
Als ‚Rezession‘ bezeichnet der kapitalistische Sachverstand den allgemein unerwünschten Zustand, dass die Wirtschaft insgesamt schrumpft, statt zu wachsen. In dem Befund ist auch schon die Diagnose enthalten – und zwar ziemlich genau das Gegenteil der absurden Wahrheit, die da am Werk ist: dass da eine ganze kapitalistische Nationalökonomie schrumpft, weil ihr Kapital sich so exzessiv vermehrt hat, und Entwertung um sich greift, weil zu viel von all den Mitteln weiteren kapitalistischen Wachstums vorhanden ist, als dass die sich noch weiter verwerten könnten, Anlage suchendes Geldkapital insbesondere, das keine lohnende Anlage findet: Die zuständigen Experten sehen die Sache ganz sachverständig so, dass zu wenig Geld sich zu wenig vermehrt. Damit ist die Therapie auch schon klar: Mehr Geld muss „in die Wirtschaft gepumpt“ und gleichzeitig dafür gesorgt werden, dass es nur noch und besser lohnende Verwendung findet. Und damit steht im Prinzip der politische Handlungsbedarf fest, der sich für die Staatsgewalt, in den USA nicht anders als überall, aus der Feststellung einer „recession“ ergibt: Sie muss dafür sorgen, dass die darnieder liegenden Wachstumskräfte ihrer Wirtschaft sich wieder durchsetzen.
Das Instrument, dessen der Staat sich dafür bedient, ist sein Haushalt: das kunstvoll organisierte Gefüge staatlichen Geldeinnehmens und -ausgebens, mit dem sich kapitalistische Nationen die Mittel beschaffen, die sie für ihren aufopferungsvollen Dienst am kapitalistischen Wachstum benötigen, und das sie deshalb nach beiden Seiten so zu gestalten suchen, dass diese förderliche Wirkung auch herauskommt. Das allerdings ist in Krisenzeiten leichter beschlossen als getan. Denn wenn die Wirtschaft schrumpft, dann ist der Staatshaushalt selber in der Krise – auch da unterscheidet sich die führende Wirtschaftsmacht nicht von ihren weniger potenten Konkurrenten: Eingeplante Steuereinnahmen brechen weg; das projektierte Verhältnis von Einnahmen und Ausgaben kommt durcheinander; nicht nur die private Geschäftswelt, auch der Staat schreibt „rote Zahlen“. Für die politischen Haushälter der Nation ergibt sich daraus ein gewisses Dilemma: Wenn sie mit den Mitteln ihres Staatsetats die Defizite beim Wachstum ausbügeln, wachsen die Defizite ihres Haushalts; und daraus erwächst ihnen regelmäßig das Risiko, dass ihre Schulden für unsolide erachtet werden: Das Finanzkapital, die weltweit anerkannte Instanz zur Beurteilung und Einschätzung von Krediten aller Art, bestraft staatliche Wertpapiere und am Ende sogar das nationale Geld mit schlechter Bewertung, wenn es die Masse der nationalen Schulden für nationalökonomisch nicht mehr gerechtfertigt hält, vielmehr als Überbeanspruchung der kapitalistischen Ressourcen des Landes einstuft. Deswegen finden mit Krisenbewältigung befasste Haushaltspolitiker es immer wieder ratsam, erst einmal ihr Instrument selbst, den Haushalt der Nation, zu sanieren, also Steuereinnahmen und Ausgaben zur Deckung zu bringen und so die Verschuldung zu reduzieren, um dann um so wirksamere „Wachstumsimpulse“ setzen zu können; damit unterbleibt aber fürs Erste die Aufmöbelung der nationalökonomischen Basis, um die es in der Krise doch gerade gehen müsste, oder es wird sogar bloß deren Schrumpfungsprozess unterstützt.
Unbekannt ist dieser Zwiespalt auch den amerikanischen Budgetpolitikern nicht. Sie kennen ihn aber vor allem bei anderen, als Notlage auswärtiger Staatsgewalten.[5] Für den Umgang mit ihrer eigenen Krise will die Bush-Regierung jedenfalls nur von einer Lösung wissen: Wenn Steuereinnahmen wegbrechen, weil es an Wachstum fehlt, dann müssen die Steuern gesenkt werden, damit das Wachstum wieder anspringt. Denn – so die „Logik“ dieses Vorgehens – Wachstum unterbleibt ja nur, weil, siehe oben, nicht genügend kapitalistisches Privateigentum nur ungenügende Vermehrungsraten erzielt. Und dagegen kann die Staatsgewalt auf alle Fälle etwas tun, indem sie weniger Privateigentum verstaatlicht und die Rendite seiner kapitalistischen Verwendung mit geringeren Abgaben belastet. Ihren zahlungskräftigen Steuerbürgern mehr von ihrem Einkommen zu lassen, erscheint der Regierung folgerichtig als die probate Art und Weise, ein neues Anfahren der Konjunktur zu befördern. Und es ist alles andere als ein „Konstruktionsfehler“ dieser Steuerreform, dass sie den Steuerzahlern um so mehr bringt, je höher deren Einkommen ist: Nur die Reichen können mit ihrem Geld ja überhaupt maßgeblichen Einfluss auf das Wachstum des Geschäfts in den USA nehmen.[6]
Natürlich handelt sich der US-Staat mit diesem Vorgehen ein um so größeres Haushaltsdefizit ein. Aber das bereitet der Bush-Administration keinerlei Kopfschmerzen. Das Problem der europäischen Konkurrenten, die sich noch mitten in der Krise an ihre in besseren Zeiten beschlossenen Defizit-Beschränkungen klammern, um ihrer neuen Gemeinschaftswährung allgemeine Wertschätzung zu verschaffen, hat sie nicht und sieht sich beim Schuldenmachen auch sonst kein bisschen in einer Notlage. Bedenkenlos setzt sie den bislang gültig gewesenen haushaltspolitischen Programmpunkt des „balanced budget“ außer Kraft und traut sich, d.h. ihrem nationalen Geld ein zusätzliches Defizit lässig zu; die Art Bedenklichkeiten sind ihr fremd, die in Finanztiteln handelnde Geschäftswelt könnte sich eventuell angesichts einer solchen „unsoliden“ staatlichen Schuldenwirtschaft misstrauisch von dem Geld abwenden, in dem diese Schulden aufgelegt werden. Die US-Regierung verlässt sich voll auf die Unentbehrlichkeit ihrer Währung und sogar ihrer staatlichen Schuldenpapiere für den Umschlag des Kapitals in der ganzen Welt und für die Anlagebedürfnisse des internationalen Geldkapitals im Besonderen; sie beansprucht mit der größten Selbstverständlichkeit die unweigerlich daraus resultierende, in ihren Augen absolut unverwüstliche Wertschätzung der Finanztitel, die sie, in welcher Menge auch immer, in die Welt setzt. So nutzt sie die überlegenen Ressourcen, über die Amerika als Weltfinanzmacht verfügt, für ihre Krisenpolitik.
Ungeschehen macht sie die weltweite Krise des Kapitalwachstums und der Staatsfinanzen damit selbstverständlich nicht. Sie mehrt ja im Gegenteil die globale Plethora des Kredits sowie die Masse kapitalistisch einsetzbaren Privateigentums und dafür verfügbarer Geschäftsmittel, an deren Überakkumulation die Weltwirtschaft gerade laboriert. Ihrem Kapitalstandort verschafft die Bush-Regierung aber auf die Art, nämlich durch die fiskalische Verbilligung aller Voraussetzungen und Instrumente kapitalistischer Geschäftemacherei, einen gewichtigen generellen Vorteil in der Konkurrenz der Nationen, die in der Krise ja keineswegs aufhört, sondern erst richtig erbittert um die Verteilung des Schadens aus der allgemeinen ‚Rezession‘ auf die verschiedenen nationalen Geschäftssphären entbrennt.
Auf diesem Feld sieht sie sich im Übrigen noch außerdem zu speziellen Eingriffen herausgefordert:
3.) Ein staatliches Förderprogramm für notleidende nationale Branchen
Mit ihrem kritischen Blick auf die ungute ökonomische Lage ihrer Nation nimmt die US-Regierung wichtige nationale Branchen wahr, die besondere Fürsorge benötigen – und auch verdienen.
- Die Fluggesellschaften des Landes leiden schon seit längerem unter den Überkapazitäten, die sie sich in ihrem Konkurrenzkampf um Anteile am Beförderungsgeschäft zugelegt haben. Seit jenem 11. September leiden sie aber außerdem, und das als völlig unschuldig Betroffene, unter einem sinkenden Passagieraufkommen, und die Maßnahmen, die der US-Staat im Rahmen seiner innenpolitischen Anti-Terror-Politik ergreift, verursachen ihnen zusätzliche Kosten. Großzügig verkündet daher die Regierung, den nationalen Fluglinien mit staatlichen Zuwendungen aus der Finanzklemme helfen zu wollen. Schließlich ist hier eine nationale Branche in Not geraten, auf deren Leistung der Staat in doppelter Hinsicht setzt: Erstens sollen es schon aus Gründen der nationalen Sicherheit US-Unternehmen sein, die den inneramerikanischen Flugverkehr abwickeln und die vielfältigen Verbindungen zum Rest der Welt maßgeblich bedienen; zweitens sollen sie an diesen Leistungen selbstverständlich gescheit verdienen und damit einen Beitrag zum nationalen Wachstum leisten. Also erklärt sich die Regierung bereit, zur Wiederherstellung der Rentabilität der Sphäre einen Beitrag zu leisten – unter der Bedingung, dass jede Fluggesellschaft für sich mit ansonsten soliden Bilanzen aufwartet, die beweisen, dass sie es verdient, weiterhin ein Teil dieser Geschäftssphäre zu sein: Sie knüpft ihre Hilfen an den von den Fluggesellschaften zu erbringenden Nachweis, dass sich ihre roten Zahlen tatsächlich den Folgekosten vom 11. September verdanken und nicht unternehmerischer Misswirtschaft. Unter dieser Maßgabe geht in der amerikanischen Luftfahrtindustrie der nötige Konzentrations- und „Gesundschrumpfungs“-Prozess seinen Gang und fordert seine unausweichlichen Opfer bei Löhnen und Arbeitsplätzen.
- Die amerikanische Landwirtschaft ist in Not – so jedenfalls der Präsident in seiner Haushaltsansprache vor dem Parlament. Mit diesem Befund begründet die Regierung eine massive Aufstockung der Subventionen für den Agrarsektor und korrigiert damit die Politik ihrer Vorgänger, die unter dem programmatischen Titel eines „free to farm act“ das Projekt eines Subventionsabbaus in Gang gebracht hatten. Die „Freisetzung“ des Agrarsektors von staatlicher Gängelung durch Mindestpreise und Aufkaufregelungen, mit der ein Clinton die Kapitalproduktivität in diesem Sektor befördern wollte, befindet die jetzige Regierung für den falschen Weg. Dabei ist es ihr herzlich gleichgültig, welchen Beitrag gerade der Erfolg dieses Programms zu der weltweiten Überproduktion von Agrarprodukten geleistet hat, unter der jetzt auch US-Bauern leiden; die sollen jedenfalls nicht die Opfer dieser Überproduktion sein. Und sie müssen es auch nicht: In seiner Kreditmacht verfügt ihr Staat ja über die nötigen Mittel, um Verluste der Branche abzuwenden.
- Auch die Stahlindustrie leidet unter der Krise. Als nationale Grundstoffindustrie, die auch die Rüstungsfabriken als Großkunden beliefert, genießt die Stahlindustrie schon immer den besonderen Schutz des US-Staates. Um diesem Industriezweig den nationalen Stahlmarkt gegen die auswärtige Konkurrenz als wesentliche Verdienstquelle zu reservieren (und zugleich amerikanischen Stahlfirmen die Freiheit des Zugriffs auf auswärtige Märkte und Anlagesphären zu sichern), belegt das US-Handelsministerium die Importe auswärtiger Stahlproduzenten in regelmäßigen Abständen mit Strafzöllen; nämlich immer dann, wenn es meint feststellen zu können, dass es sich bei den Preisen für Importstahl um „Dumpingpreise“ handelt – ein Befund, für den entsprechende Klagen der Stahlindustrie über wachsende Importziffern ein wichtiges, wenn auch nicht ausschlaggebendes Indiz sind. Zu diesem Ergebnis ist das Handelsministerium im vorigen Herbst wieder einmal gekommen. Die allgemeine Herabsetzung der Stahlpreise, mit denen sich die Stahlproduzenten in der Krise den Weltstahlmarkt streitig machen, nimmt die Behörde ganz sachgerecht als Angriff auf die marktbeherrschende Stellung des US-Stahlkapitals in den USA und tritt mit Zöllen dazwischen, um den eigenen Firmen ihren Absatz zu höheren als den geltenden Weltmarktpreisen zu sichern.[7] Im März setzt die Regierung noch eins drauf und beschließt unter schlichter Berufung auf die schlechte Geschäftslage der Stahlindustrie sogenannte „safeguard“-Zölle. Der von amerikanischen Stahlabnehmern, vor allem von der Autoindustrie vorgetragenen Beschwerde über mit ihrer Geschäftslage unverträgliche Preissteigerungen trägt sie durch Ausnahmeregelungen Rechnung, die bestimmte Käufer bzw. Stahlsorten vom Zoll ausnehmen. So hält die Regierung an ihrer Absicht fest, der nationale Stahlindustrie den heimischen Markt – und das neue Rüstungsgeschäft – als Gewinnquelle zu sichern, und erhält anderen Kapitalen zugleich den Zugang zu kostensenkenden Importen.
Der Maßstab, den der US-Staat bei seinen Maßnahmen an die Leistungsfähigkeit seiner nationalen Branchen anlegt, ist immer derselbe: Es geht um die Her- bzw. Sicherstellung einer im Weltmaßstab überlegenen Rentabilität. Dass amerikanische Firmen in der Konkurrenz um Anteile am Weltmarkt – dessen größter und produktivster Standort der US-Markt selbst ist – zurückfallen, ihre überlegene Position verlieren könnten, hält er grundsätzlich für illegitim, für die Folge von Regelverstößen, die er nicht dulden kann. Wenn Flugunternehmen, Stahlkonzerne, Agrarproduzenten in allen Staaten mit Überkapazitäten und roten Zahlen zu kämpfen haben; wenn sich weltweit Zahlungsunfähigkeit offenbart und Konkurse häufen, dann dürfen – so der Standpunkt der US-Politik – jedenfalls US-amerikanische Branchen unter dieser Lage nicht mehr leiden als nötig, sollen nach Möglichkeit sogar aus der krisenhaft verschärften Konkurrenz gestärkt hervorgehen. Wenn der dazu nötigen Rentabilität des Kapitals mit direkten Subventionen nachgeholfen werden muß, dann steht der Staat nicht an, die entsprechenden Mittel bereit zu stellen.
Mit dem Einsatz ihres politischen Kredits macht die Regierung eine großangelegte Offensive gegen ihre Weltmarktkonkurrenten auf. Die Unterstützung, die sie eigenen Branchen zukommen lässt, ist ja nicht nur ein Angriff auf die Geschäftskalkulationen auswärtiger Produzenten; sie trifft damit zugleich, und das ganz bewusst, die Bilanzen von deren Heimatnationen. Dabei braucht sie sich mit keinem Kontrahenten abzusprechen, muss nichts bei irgendeiner internationalen Agentur beantragen und ist auf diplomatisch erpressten Konsens der Betroffenen gar nicht angewiesen: Indem die USA die Geschäftsbedingungen auf ihrem Markt politisch neu definieren, definieren sie sie zugleich für die ganze Welt neu. Auf die Art führen sie ihre „Handelskriege“: in der Sicherheit, dass die Konditionen, die sie setzen, für die Konkurrenz einfach Fakten sind und eine weltwirtschaftliche „Lage“ schaffen, mit der diese sich nolens volens herumzuschlagen und fertig zu werden hat. Für diese Sicherheit sorgt schon die einigermaßen einseitige Abhängigkeit, in der die Bilanzen anderer Staaten vom Geschäft ihrer Exporteure auf dem US-Markt stehen, und die Konkurrenz, die die einander um Anteile auf diesem Markt machen. Aus dem gleichen Grund können sich die anderen Nationen entsprechende Gegenmaßnahmen gegen US-amerikanische Exportoffensiven gleich gar nicht oder nur unter Inkaufnahme von weiteren Schäden an ihrer nationalen Wirtschaft leisten.
Dieser einseitigen Konkurrenzlage entspricht die ebenso einseitige Deutung, die die US-Politik von jeher den Ergebnissen der weltweiten Konkurrenz um Märkte und Erträge gibt. Wenn Amerikas Wirtschaft Schaden am Gang der Weltwirtschaft nimmt, dann hat dieser Sichtweise zufolge allemal das Ausland die „freie Konkurrenz“ verfälscht, weshalb die USA gegen deren Subventionen und Protektionismus mit entsprechenden „Gegenmaßnahmen“ vorgehen muss. Das ist eine Sicht der Dinge, die im Prinzip durchaus auch in den Hauptstädten Afrikas, Lateinamerikas und Europas vertreten wird, allerdings mehr im Konjunktiv; denn dort erfüllen derartige Beschwerden entweder bloß den Tatbestand folgenlosen Gejammers, oder sie sind der Auftakt dazu, mit den USA auf der Ebene der Handelsdiplomatie um Zugeständnisse rechten zu wollen. Wenn die weltwirtschaftliche Supermacht USA die Lage ihrer Wirtschaft so deutet, dann geht es allemal schon darum, solche „Verfälschungen“ ganz freihändig zu korrigieren. Das nationalökonomische Ideal eines allgemeinen „freien Welthandels“, der allen Nationen nütze, verfechten amerikanische Regierungen mit eindeutiger Stoßrichtung und ganz ohne Doppelmoral: Weil US-Kapital sowieso und per definitionem das produktivste ist, besteht der amerikanische Einsatz für Freihandel darin, gegen die Subventions- und Dumpingpreis-Politik anderer Staaten die ungerechtfertigte Beschlagnahme des US-Marktes durch Konkurrenten zu verhindern und umgekehrt die Märkte anderer Nationen für die überlegene Produktivität amerikanischer Unternehmen zu öffnen
– wenn nötig, unter souveräner Missachtung der weltwirtschaftlichen „Regeln“, auf die sich die USA in anderen Zusammenhängen gegen andere ebenso gerne berufen. Ihre weltwirtschaftliche Macht macht’s möglich; also haben sie – jedenfalls in ihren eigenen Augen – allemal auch das Recht auf ihrer Seite.
Wenn betroffene Nationen dagegen vor formell überstaatlichen Instanzen Einspruch einlegen, dann gerät das Verfahren mit schöner Regelmäßigkeit zu einer Dokumentation ihrer bestenfalls relativen Ohnmacht, und der Machtlosigkeit besagter Instanzen dazu. Das gilt sogar für das Verfahren, das die Europäer vor der WTO gegen die US-Stahlzölle eröffnet haben. Zwar beschließt die EU eine Liste von ihrerseits mit Strafzöllen zu belegenden US-Waren, falls die USA ihre Zölle nicht zurücknehmen; sie lässt sie aber nicht in Kraft treten, sondern begibt sich dann doch lieber ihrerseits auf den Weg der Verhandlungen über Ausnahmen, zu denen sich die USA – schon im Interesse ihrer eigenen Importeure – doch gnädig herbeilassen könnten. Das tun diese dann aus eigener Berechnung auch glatt, und schon ist der „Handelskrieg“ aus Sicht der EU entscheidend „entschärft“ – was sie ihrerseits nicht hindert, dritten Staaten in Form eigener Zollerhöhungen den EU-Markt als Ausweichverkaufsstelle zu versperren.
So schaffen es die USA mit ihren Zollmaßnahmen, bestehende supranationale Absprachen über „geregelten Marktzugang“, also über verlässliche Bedingungen für’s gesamte Welt-Stahlgeschäft, ad absurdum zu führen[8] – was die US-Regierung andererseits überhaupt nicht daran hindert, ungerührt die Konformität ihrer Maßnahmen mit WTO-Vorschriften zu behaupten. Ihr Vorgehen ist eben nicht als Absage an diese wirtschaftsdiplomatische Einrichtung gemeint; sie behält sich vielmehr das Recht vor, nach den Kriterien nationaler Zweckmäßigkeit darüber zu entscheiden, wann sie deren Regelungs- und Schlichtungsapparat zur Durchsetzung nationaler Interessen einsetzen, wann sie ihn schlicht ignorieren will. In diesem Sinne beantragt die US-Delegation beim Vorbereitungstreffen zur nächsten WTO-Tagung erneut die Beseitigung aller Agrarsubventionen bei ihren Konkurrenten: Aus ihrer Sicht beweisen die eigenen neuen Maßnahmen zur Förderung der US-Agrarindustrie nämlich nur, wie sehr die Subventionen Europas und Japans den Weltagrarmarkt verfälschen…
Eine ganze Abteilung amerikanischer Krisenbewältigungspolitik besteht also darin, dass die Regierung die Finanzmacht ihrer Nation mobilisiert, um erfolgsschwache, aber dennoch für wichtig erachtete nationale Branchen konkurrenztüchtig zu machen; die Gegenwehr ihrer weniger potenten Konkurrenten lässt sie an der „Macht der Fakten“ schlicht scheitern, die sie mit ihren überlegenen Mitteln setzt; und gegen deren Versuche, ihrerseits mit Staatskredit Standort-Erfolge im internationalen Konkurrenzkampf herbei zu subventionieren, geht sie mit der Gewalt vor, die sie bei Bedarf genau den Institutionen leiht, deren Entscheidungen sie ebenso bedarfsweise ignoriert und jedenfalls nur nach eigenem Ermessen gelten lässt. So kommt Amerika, wenn schon nicht aus der Krise heraus, so doch in der Krisen-Konkurrenz voran.
4.) Krisenbewältigung im Hinterhof: Wer darf was?
Wo die Weltfinanzmacht derart überlegen mit den Folgen der Weltwirtschaftskrise umgeht, die auch und nicht zu knapp sie und ihren Reichtum treffen, da kann es nicht ausbleiben, dass sich am anderen Ende der Skala die „Fälle“ von Nationen häufen, die in der Konkurrenz um die Rettung ihres kapitalistischen Reichtums und um den erfolgreichen Einsatz ihrer staatlichen Schulden und ihres heimischen Geldes als Motor wachstumsträchtiger Geschäftstätigkeit im Land überhaupt nicht mehr mithalten können; um deren Kreditwürdigkeit es also nicht nur ziemlich schlecht bestellt ist, denen diese vielmehr überhaupt abhanden zu kommen droht. Auch in dieser Abteilung weltwirtschaftlicher Schadensregulierung wissen sich die USA an vorderster Stelle zuständig, weil allemal am heftigsten betroffen. Immerhin ist es ja zu großen Teilen ihr Geld, in dem solche Nationen sich verschuldet haben; es sind ihre Banken, bei denen diese Schulden als Vermögen aufgeschrieben sind, und ihre Dollarkapitalisten, die diese Staaten zu ihrer Geschäftssphäre und Gewinnquelle gemacht haben. Von Einmischung in fremde Angelegenheiten kann also gar nicht die Rede sein, wenn die USA sich an erster Stelle um die Abwicklung und/oder Abwendung der nationalen Bankrotte kümmern, die mit der globalen Krise fällig werden: Sie kümmern sich ja – so sehen sie es jedenfalls und handeln danach – um gar nichts anderes als um das verlässliche Funktionieren ihrer Dollar-Weltwirtschaft. Und das tun sie selbstverständlich nach dem einzigen dazu passenden Gesichtspunkt, nämlich dem, welche Rückwirkungen die Pleite von Ländern wie Argentinien oder Brasilien auf die Geschäftslage amerikanischer Multis und Banken sowie auf den Stand des Dollar haben könnte.
In diesem Sinne machen sich die USA daran, den Auftrag der Aufsichtsinstanz über den Weltkredit, des IWF, ein wenig umzudefinieren. Fest steht für sie, dass von einem grundsätzlichen Nutzen, den die Aufrechterhaltung der Kreditwürdigkeit fallierter Nationen hätte, nicht mehr die Rede sein kann: Auch bei Nationen müssen Konkurse sein, wenn es an ihnen in ihrer gegebenen Lage keine Dollar mehr zu verdienen gibt. Auch in der Sphäre der supranationalen Kreditbetreuung machen sich die USA stark für die Unterscheidung zwischen einer Kreditvergabe, mit der Konkurrenzergebnisse eigentlich bloß verfälscht worden sind – wo also gute US-Dollar zur Rettung von Geschäften verpulvert werden, die es gar nicht verdient haben[9] –, und solchen, bei denen eine Prolongation des Kredits ansteht, weil ansonsten unangefochtene Säulen des US-Kapitalismus in zu großem Umfang als Gläubiger in Mitleidenschaft gezogen werden. Die Entscheidung darüber überlässt die Regierung nicht dem an irgendwelchen „objektiven“ Kriterien der Sanierungsfähigkeit orientierten Management der zuständigen Instanzen, sondern führt sie nach ihrem pflichtgemäßen Ermessen herbei. So gelangt dann der IWF im Falle Argentiniens zu dem Befund, hier habe ein Land eindeutig über seine Verhältnisse gelebt, und der internationalen Spekulation, die ihr das ermöglicht habe, geschehe es nur recht, wenn sie jetzt Einbußen erleide; im Falle Brasiliens wird die Sachlage umgekehrt so interpretiert, dass hier einer eigentlich soliden Nation über eine Vertrauenskrise hinweggeholfen werden müsse. Ihr Geld gibt den USA allemal die Macht, also das Recht, bis zum Ruin geschädigten Nationen Vorschriften zu machen hinsichtlich der Frage, wie sie ihren Anteil an der globalen Krise, nämlich ihren Kollaps abzuwickeln, wie sie mit ihrem Haushalt, ihrem Geld, ihrer Bevölkerung umzugehen haben; bei Bedarf werden ganz umsonst auch noch eindeutige Belehrungen über „richtige“ Wahlergebnisse erteilt, die sich einstellen müssen, damit weiter Kredit fließt. Denn der Dienst, den die betreffenden Nationen am US-Geschäft und an den US-Bilanzen leisten, ist der Maßstab dafür, ob und inwieweit sie allenfalls mit gnädiger Stundung ihrer Schulden rechnen dürfen.
So geht Krisenbewältigung auf amerikanisch. Aber wenn es bloß das wäre.
B. Kriegswirtschaft
Die US-Regierung macht auf ihre Art mobil gegen die Folgen der kapitalistischen Krise, die den Reichtum auch ihrer Nation dezimiert – und betreibt zugleich vorrangig eine Mobilmachung ganz anderer Art. So wichtig das amerikanische Wirtschaftswachstum ihr auch ist, sie hat erklärtermaßen Wichtigeres zu tun: Mit aller Gewalt, und koste es, was es wolle, führt sie ihr Gemeinwesen, und nicht nur das Ihre, in einen „Krieg gegen den Terrorismus“.
I. Das Kriegsprogramm
Den erfolgreichen Doppel-Anschlag aufs Pentagon und das New Yorker World Trade Center hat die US-Regierung zum Kriegsakt eines weltweit virulenten, nicht eigentlich staatlichen, von Amerika feindlichen „Schurkenstaaten“ jedoch gedeckten, wenn nicht gezüchteten Feindes erklärt. Dabei handelt es sich nicht um bloße politmoralische Rhetorik. Allen Ernstes hat sie damit die ab sofort gültige neue Prämisse ihrer Sicherheitspolitik festgelegt. Im Sinne ihrer Bedrohungsanalyse und Feind-Definition hat sie ein weltumspannendes Kriegsprogramm entwickelt; und das setzt sie Zug um Zug in die Tat um.
1.) Die „Kriegslage“
Amerika führt einen räumlich und zeitlich nicht begrenzten Vernichtungsfeldzug gegen die Urheber potentiell gewalttätiger antiamerikanischer Umtriebe: gegen terroristisch aktionsfähige Gruppen wie die der Flugzeug-Attentäter vom 11. September sowie gegen Staaten, die derartigen Gruppen Zuflucht gewähren, Ressourcen zugänglich machen oder womöglich sogar Aufträge erteilen. Zur Vernichtung vorgesehen sind keineswegs bloß solche Akteure, von denen eine wirkliche Bedrohung fürs amerikanische Heimatland ausgeht, sondern alle, die irgendwie und irgendwann zu einer Gefahr für die amerikanische Nation und deren weit gespannte Interessen werden könnten. Es geht um global flächendeckende, dauerhafte Generalprävention gegen terroristisches Potential mit antiamerikanischer Stoßrichtung, und für diesen Zweck gestattet die Regierung sich den Einsatz aller Gewaltmittel, vorhandener wie überhaupt denkbarer; auch in diesen beiden Hinsichten ist der begonnene Feldzug nicht begrenzt. Geführt wird er, sachgerecht, auf zwei Ebenen:
- Es geht – ganz offenkundig und wie immer wieder betont: eine Aufgabe für Jahrzehnte – um die Durchdringung der inneren Verhältnisse sämtlicher Staaten mit einer permanenten flächendeckenden Terroristen-Fahndung und -Ausmerzung nach amerikanischen Vorgaben, also gemäß der Gefahrendefinition aus Washington, die einerseits kein „Potential“ auslässt, andererseits auf nichts anderes als eine mögliche Bedrohung amerikanischer Interessen schaut. In diesem Sinne sollen die Sicherheitsapparate aller Nationen, gegebenenfalls neu eingerichtete, mit Dienststellen der US-Regierung zusammenwirken, denen also zuarbeiten. Das wird nicht einfach beantragt, sondern von Amerika aus gleich so organisiert und den zuständigen Landesherrschaften mehr oder weniger zugemutet; die sind eingeladen, sich selber in dem vorgegebenen Sinn als bedroht zu begreifen und Amerikas Anspruch auf willfährige Mitarbeit bei der gebotenen Kontrolle ihres Volkes und bei der Beseitigung ihres nationalen Untergrunds als Hilfestellung für eine zeitgemäße innere Sicherheitspolitik aufzufassen.
- „Regime“, die sich diesem antiterroristischen Gemeinschaftswerk aller zivilisierten Nationen verweigern oder entziehen und sich damit oder auch aus ganz anderen Gründen das Verdikt einhandeln, antiamerikanischer Gewalttätigkeit einen Freiraum zu lassen oder gar Vorschub zu leisten, und erst recht solche, die sich selber eines Antiamerikanismus in praktischer Absicht schuldig machen, auch wenn bei ihnen von einer für die Supermacht irgendwie bedrohlichen Militärmacht nichts zu sehen ist, sind mit einer prinzipiellen, jederzeit aktivierbaren Kriegserklärung konfrontiert; mit der entsprechenden Feindschaftserklärung nimmt die US-Regierung umgekehrt ihre Definitionshoheit darüber wahr, mit was für einem „Regime“ die zivilisierte Welt es im jeweiligen Fall in Wahrheit zu tun hat. Mit der Verhängung eines derartigen Kriegszustands quasi auf Vorrat über Länder ihrer Wahl will sie erklärtermaßen jedem denkbaren Angriff zuvorkommen: Von ihr ausgemachten Feinden wird präventiv das Handwerk gelegt, damit sie gar nicht erst in die missliche Situation gerät, auf feindliche Gewalttaten reagieren zu müssen. Verabschiedet ist damit jener politische Gebrauch überlegener militärischer Gewalt, der statt auf die Zerstörung auf erpresserische Terrorisierung eines staatlichen Gegners: auf „Abschreckung“ zielt: Die hat nach Amerikas neuer Lesart bereits „versagt“, wenn man in Washington zu dem Urteil kommt, dass sich in einem fremden Land eine Bedrohung zusammenbraut. Gegen solches „Potential“ hilft folglich nur dessen vorsorgliche Vernichtung. Dafür gelangen alle Mittel zum Einsatz, auch bislang mehr oder weniger geächtete wie politischer Mord oder, im akuten Kriegsfall, Atomwaffen; das gehört mit zur offiziellen Kriegsansage und lässt deren Adressaten allenfalls noch die Chance, durch nachweisliche Liquidierung des eigenen Waffenarsenals und Rüstungspotentials die eigene Liquidierung hinauszuschieben. Am afghanischen Taliban-„Regime“ ist dieses Drehbuch antiterroristischer Kriegführung gegen ein staatliches Gebilde demonstrativ durchexerziert worden; mit dem Irak nimmt das Programm seinen Fortgang – mit einer Unerbittlichkeit, die dadurch nicht relativiert, sondern unterstrichen wird, dass der Präsident weder die Hektik, die seine Gegner, noch die Eile, die seine Scharfmacher von ihm erwarten, an den Tag legt: Bush nimmt sich alle Zeit, die seine Offiziere brauchen, um die Hinrichtung des „Schurken von Bagdad“ eindrucksvoll zu inszenieren und sorgfältig zu exekutieren.
2.) Ein neues Gewaltregime über die Militärgewalt der Nationen
Mit der Ausrufung eines im Prinzip weltweit und dauerhaft geltenden antiterroristischen Kriegszustands revidieren die USA die Prämissen ihres eigenen strategischen Blicks und Zugriffs auf die Staatenwelt und setzen neue Prämissen für die Strategie aller übrigen Militärmächte, insbesondere für ihre Verbündeten sowie für ihren russischen Partner – die meisten der anderen Staaten kriegen ihren neuen strategischen Stellenwert ganz einfach verpasst. An sie alle ergeht die verbindliche Ankündigung, Amerika werde sie bedarfsweise für die Zusammenstellung eines passenden Überfallkommandos heranziehen. Das ist Auftrag und Beschränkung zugleich für alle kooperationsbereiten Nationen: In dem Beitrag, den sie zur Erledigung der jeweils auf die Tagesordnung gesetzten Säuberungsaktion leisten können und erbringen wollen, liegen Sinn und Zweck ihrer kriegerischen Potenzen; und grundsätzlich erschöpfen sie sich darin auch; ein Gebrauch militärischer Gewalt für andere Zwecke ist einfach nicht vorgesehen und auf alle Fälle vor dem Ziel einer Weltverbesserung durch Ausräumung antiamerikanischer Potentiale zu rechtfertigen. Im Falle Russlands macht die US-Regierung ein gewisses Zugeständnis an Moskaus Not, um den Bestand der postsowjetisch übrig gebliebenen Nation kämpfen zu müssen: Die Heuchelei, in Tschetschenien ginge es um gar nichts anderes als einen Teil des von Amerika ausgerufenen Antiterrorkriegs, wird als Zeichen der Anerkennung des globalen Kriegsprogramms der USA gelten gelassen; zugleich wird – aktuell in Georgien – einiges unternommen, um russische Eigenmächtigkeiten zu beschränken und unter Kontrolle zu bringen. Die Rolle der NATO-Partner wird auf das Privileg reduziert, nicht bloß als lokale Helfershelfer für amerikanische Unternehmungen beansprucht, sondern als Hilfskräfte für die Erledigung militärischer Kontroll- und Ordnungsaufgaben in aller Welt in Betracht gezogen zu werden; so weit reicht gerade noch die Anerkennung, die die USA dem konkurrierenden Allzuständigkeitsanspruch ihrer Mit-Imperialisten, die ein halbes Jahrhundert lang so erfolgreich in die große „Ost-West-Konfrontation“ eingebaut waren, zuteil werden lassen.
Unter der neuen Funktionszuweisung an die restliche Staatenwelt leiden, auch dies sehr sachgerecht, die überkommenen diplomatischen Sitten, was für die Klärung der Sachlage aber nur von Vorteil ist: Anders als bei den gigantischen Zurüstungen für einen atomaren Weltkrieg gegen das einstige „sowjetische Lager“ ziehen die USA die Staaten an ihrer europäischen „Gegenküste“ für ihre antiterroristische Kriegsplanung, aktuell gegen den Irak, nicht zu Rate, fordern gleichwohl pauschal Zustimmung und Einsatzbereitschaft ein, weisen wiederum das Bedürfnis, dann auch in die Einsatzplanung wenigstens Einblick zu bekommen, noch ehe sie fertig ist, mit der Beschwichtigungsformel zurück, ein fertiger Einsatzplan läge ja noch gar nicht vor, geschweige denn eine definitive Entscheidung des Präsidenten darüber – die sollen die Europäer also offenbar abwarten; dann erfahren sie schon, wann es losgeht und wofür man sie gerne dabei hätte. Mit den arabischen Staaten, die als Anrainer des nächsten prospektiven Kriegsschauplatzes für Etappendienste vorgesehen sind, wird noch ganz anders verfahren: Durch Israel, das die Lizenz, seinen selbstdefinierten Antiterrorkrieg gegen die Palästinenser-Autonomie als integralen Teil der US-Kampagne führen zu dürfen, voll ausreizt, werden sie ununterbrochen ganz praktisch und sehr drastisch mit dem Beschluss der Weltmacht konfrontiert, arabische Eigeninteressen nicht länger berechnend zu respektieren und in mehr oder weniger „gutem Einvernehmen“ zurechtzurücken, sondern schlicht abzuweisen. Die Dienste, die ihnen abverlangt werden, werden nicht honoriert; Widerspenstigkeit stärkt nur die Position ihres regionalen Hauptfeindes.
Das alles ist nicht abgeschlossen. Aber das wäre nach bloß einem Jahr und bloß einem Vorsorge-Krieg der neuen Art auch etwas zu viel verlangt. Es langt ja, dass die strategische Neusortierung der Staatenwelt im Sinne des Antiterror-Weltkriegsszenarios der Bush-Administration ernsthaft in Gang gekommen ist.
3.) Eine innere Mobilmachung
Was die US-Regierung dem Rest der Welt aufnötigt, das verlangt sie selbstverständlich auch und zuerst ihrem eigenen Volk ab. Die amerikanische Gesellschaft selber wird in einen Kriegszustand neuen Typs versetzt: den Dauerzustand eines präventiven Abwehrkampfes gegen einen virtuell allgegenwärtigen inneren Feind, der aus seiner zivilen Deckung herausgeholt und ausgelöscht werden muss, sowie gegen „schurkisch“ regierte Staaten, denen nur mit einem unbedingt zu sichernden unendlichen Vorsprung in allen Fragen militärischer und terroristischer Gewalt beizukommen ist.
Dementsprechend werden die inneren Verhältnisse der Nation, ihr öffentliches und natürlich auch unabsehbar viel Privatleben, verschärften Sicherheits-Imperativen unterworfen: einer Volkskontrolle auf potentiell terroristische Aktivitäten im eigenen Land und einem großzügig erweiterten Zugriffsrecht der Staatsorgane auf Verdächtige. Letzteres gibt besorgten Menschenrechtsaktivisten viel zu denken und einiges zu protestieren, ist im Grunde aber durch die Bürgerrechte des freien Amerikaners voll gedeckt. Denn die stehen nach allgemeinem Konsens ohnehin nicht solchen Elementen zu, die sich, wodurch auch immer, mitten in Amerika unamerikanischer Aktivitäten verdächtig machen; sie schließen umgekehrt ganz wesentlich das Recht auf Gewalt gegen solche Figuren ein, ohne die die Welt allemal ‚a better place‘ sein würde. Im gleichen patriotischen Geist findet sich der loyale US-Bürger durch ein flächendeckendes Ausspähungswesen, das in seiner vom Justizminister geplanten Ausdehnung und Engmaschigkeit den Vergleich mit dem einstigen realsozialistischen „Überwachungsstaat“ nicht zu scheuen braucht – jeder Postbote und jeder LKW-Fahrer ein IM der freiheitlichen Staatssicherheit! – nicht so sehr selber überwacht als vielmehr zum Mit-Kontrollieren aufgerufen. So wird zumindest das Bewusstsein wach gehalten, und Gedenktage sowie spektakuläre Fahndungs- und Verhaftungsaktionen frischen es außerdem immer wieder auf, dass die Nation den terroristischen Feind bereits im eigenen Land stehen hat. Den praktischen Abwehrkampf organisiert ein üppig ausgestattetes Heimatschutz-Ministerium, für dessen Einrichtung der Präsident sogar die sonst ziemlich sakrosankte überkommene Arbeitsteilung innerhalb der Administration revidiert.
Diese innere Aufrüstung, vor allem aber die Entwicklung neuartiger und die Beschaffung schon entwickelter überlegener Waffen zur Niederhaltung und Beseitigung Terrorismus-verdächtiger Staatsgewalten kostet selbstverständlich enorm viel Geld. Mit dessen Beschaffung greift die US-Regierung auch ganz ordentlich in die Lebensverhältnisse ihrer freien Bürger ein: Sie revidiert die Prioritätenliste, nach der sie mit ihrem Staatshaushalt ihre Ami-Gesellschaft bewirtschaftet. Da werden schon in einer ersten Reaktion auf den eigenen Beschluss zur Ausrufung eines antiterroristischen Welt-Feldzugs in den Militärhaushalt zusätzliche Mittel eingestellt, die den Gesamtetat wichtiger NATO-Verbündeter für Kriegszwecke überschreiten – vom Militärhaushalt der restlichen Welt ganz zu schweigen –; ein Dreivierteljahr später kommen noch einmal fast 30 Milliarden Dollar zusätzlich hinzu, damit auch wirklich jedem, der sich in den Vereinigten Staaten aufhält, sein Recht auf Überwachung zuteil werden kann, damit bei der Visa-Erteilung nie wieder etwas schief läuft, und um auswärtigen Regierungen bei analogen Maßnahmen in deren Land beizustehen. Wichtiger noch als die jeweiligen absoluten Summen ist freilich der klare Standpunkt, den die Regierung bei deren Anforderung einnimmt: Der Präsident beantragt nicht einen Sonderhaushalt, sondern verlangt dessen sofortige Bereitstellung.
„Ich erwarte vom Kongreß der Vereinigten Staaten nicht nur die Verabschiedung dieses Haushalts, ich erwarte auch von ihm, dass er dies zu seiner obersten Priorität macht, so dass wir für diesen Krieg planen können.“ (Bush, Rede vom 15. März 2002 in North Carolina)
Und er mobilisiert seine gesamte Eloquenz und Überzeugungskraft, um seiner Nation klarzumachen, dass jetzt ein neues Kriterium für die Verwendung des nationalen Reichtums überhaupt in Kraft tritt und auf absehbare Zeit in Kraft bleiben wird:
„Nichts ist wichtiger als die nationale Sicherheit, nichts ist wichtiger. Also ist nichts wichtiger als unser Verteidigungshaushalt. Einige sagen, der Verteidigungshaushalt sei zu hoch. Lassen Sie es mich einfach so deutlich sagen, wie ich kann: Der Preis der Freiheit ist hoch, aber meines Erachtens niemals zu hoch.“ [10]
Also wird der bezahlt, wie hoch auch immer er ausfällt.
Dass er zu bezahlen ist, dass für den guten Zweck Finanzmittel in jeder beanspruchten Größenordnung zu mobilisieren sind: Davon geht der Präsident ebenso bedingungslos aus. Und das ist immerhin bemerkenswert – erstens überhaupt und zweitens speziell in einer „Lage“, in der gerade ein ganzes „Segment“ des Finanzkapitals, nämlich ein ganzer Wachstumshoffnung spendender „neuer Markt“ kaputt gegangen ist, auch sonst ringsum Unmengen kapitalistischen Vermögens gestrichen werden, weil ihre Vermehrung nicht mehr gelingen will, und der Staatshaushalt dadurch ganz heftig ins Minus gezogen wird. Das antiterroristische Kriegsprogramm schafft sich ganz offensichtlich – wie noch jeder Krieg und durchaus ähnlich wie seinerzeit Ronald Reagans Rüstungs-Feldzug gegen die Sowjetunion – seine eigenen haushaltspolitischen Regeln: Die etatmäßige Bewirtschaftung des nationalen Kapitalismus wird unter Kriegsbedingungen gestellt.
Zur gerechten Würdigung dieses Übergangs mag eine grundsätzliche Klarstellung beitragen: ein
II. Exkurs zum Thema ‚Kriegshaushalt‘
1.) Zur kapitalistischen Natur der Staatsfinanzen im allgemeinen: ‚faux frais‘ auf Kredit[11]
Staatliche Herrschaft kostet Geld. Das nimmt sie sich von ihrer kapitalistisch erwerbstätigen Gesellschaft: Sie ‚sozialisiert‘ Privateigentum. Das gehört sich eigentlich nicht in diesem System, steht in Widerspruch zu der Tatsache, dass der gesellschaftliche Reichtum als Privateigentum in Geldform existiert, und zu dem Zweck, für den das Geld eigentlich da ist: um als Mittel seiner eigenen Vermehrung, also der Bereicherung seiner kapitalistisch engagierten Eigentümer zu dienen. Geld in Staatshand ist Abzug vom Eigentlichen; Staatsausgaben sind falsche Kosten, weil kein Vorschuss, der getätigt wird, um vermehrt zurückzufließen; ein Aufwand, der sich nicht rechnet; „faux frais“. Und deswegen sind sie bei den professionellen Eigentümern des gesellschaftlichen Reichtums und den Apparatschiks seiner Vermehrung ein für allemal und grundsätzlich unbeliebt.
Dabei haben sich die Nutznießer des privateigentümlichen Reichtums diesen Kostenblock selber zuzuschreiben. Ihr Liebstes, ihr auf Vermehrung abonniertes Vermögen, wäre gar nicht vorhanden, geschweige denn sicher, und um seine Verwendung als Zugriffsmittel auf die Quellen des gesellschaftlichen Reichtums, um seine Kommandogewalt über die gesellschaftliche Arbeit, wäre es schlecht bestellt, wenn keine allgemeine öffentliche Gewalt mit Gesetzen und einem gigantischen Verwaltungsapparat dafür sorgen würde. In den „faux frais“ der Staatsmacht begegnen die grundsätzlich unzufriedenen Kapitaleigner und -manager einfach dem Umstand, dass das flächendeckende Gewaltverhältnis, auf dem ihre Herrschaft über alle gesellschaftlichen Produktivkräfte beruht, nicht zum Nulltarif zu haben ist. Was im übrigen die Last betrifft, die ihr Gewaltmonopolist ihnen da auferlegt, so können sie sich absolut sicher sein, dass eine moderne demokratische Regierung bei der haushälterischen Gestaltung ihrer kostspieligen Herrschaftstätigkeit deren Grund und Zweck keinen Moment lang vergisst. Die Bedienung aller Erfordernisse einer erfolgreichen marktwirtschaftlichen Benutzung von Land und Leuten, die auf so wundersame Weise mit den materiellen Interessen der geldbesitzenden Minderheit der Gesellschaft zusammenfallen, ist alternativlos anerkanntes und befolgte Kriterium aller Budgetpolitik. Das gilt schon für den Zugriff des Fiskus auf die Geldeinkommen und -vermögen seiner Bürger: Die kapitalistisch produktiven Revenuen werden geschont; dafür wird den Beziehern „abhängiger“ Einkommen praktisch nachgewiesen, wieviel Überschuss zu Händen der Staatsgewalt noch aus den Summen herauszuquetschen ist, die ihrem Eigentümer kaum zum Leben reichen. Bei den Ausgaben wird erst recht darauf geachtet, dass alles, was eine Staatsmacht sich leistet, „ökonomisch vernünftig“ ist, nämlich die Bedingungen für kapitalistisches Wachstum verbessert; darauf hat der geschröpfte Bürger ein Recht.
Und in einer Hinsicht kommt besagte „Vernunft“ mit ihren Rechnungen auch allemal auf ihre Kosten. Denn tatsächlich ist es ja gar nicht so, dass die Geldsumme, die der Staat ent-privatisiert und für seine Belange verwendet, damit ihrer geschäftlichen Verwendung definitiv entzogen wäre. Sicher, sie gehört eine Zeitlang nicht den berufsmäßigen Geldvermehrern, die sich in aller Bescheidenheit ein unbedingtes Recht darauf anmaßen; dieses kapitalistische Ärgernis bleibt bestehen. In deren Kassen fließt sie aber allemal „zurück“. Denn von seinen kapitalistischen Unternehmern kauft sich der Staat – direkt oder indirekt –, was er benötigt und was sein Personal verbraucht; anstelle anderer Kundschaft versilbert er deren Waren samt der darin enthaltenen Rendite; er fügt sich also völlig systemkonform ein in den Umschlag des gesellschaftlichen Kapitals – was auch sonst im System der Marktwirtschaft. In dieser Rolle des potenten Großkunden beschränkt sich der moderne Staat noch nicht einmal auf die Summen, die er sich aus der Gesamtmasse des gesellschaftlich Verdienten aneignet. In großem Stil leiht er sich Geld und zahlt dafür Zinsen, verwandelt also auf direktestem Wege Geldvermögen in zinstragendes Kapital – und vermehrt damit nicht bloß die Adressen, bei denen reiche Leute ihr Geld „arbeiten“ lassen können, um eine ganz besonders solide und zuverlässige. Er gestattet überdies die Verwendung seiner Schuldpapiere als seinerseits beleihbares Vermögen und Grundlage für die Macht des Kreditgewerbes, Kredit zu schöpfen, garantiert sogar als letztinstanzliche „Bank der Banken“ die jederzeitige Verfügbarkeit der Geldmittel, mit denen da Geschäfte gemacht werden, ohne dass sie schon verdient worden wären. Mit seiner Verschuldung nimmt er eben keinem Geschäftsmann etwas weg; er vermehrt im Gegenteil sowohl die Finanzmittel für die Einleitung kapitalistischer Geschäfte als auch die gesellschaftliche Kaufkraft, von der deren Vollendung abhängt, schiebt so – in beiderseits gedeihlicher Kooperation mit dem Finanzkapital – die Begrenzung des nationalen Geschäftslebens durch die Größe des schon akkumulierten Kapitals auf der Seite des kapitalistischen Vorschusses wie des durch die allgemeine Zahlungsfähigkeit zu bewerkstelligenden Rückflusses hinaus, bläht Vorschuss und Überschuss in nationaler Größenordnung auf. So mindern die Unkosten, die er seiner Gesellschaft verursacht, den kapitalistischen Geschäftsgang in seiner Gesellschaft nicht, sondern ent-schränken ihn.
Sicher, der dermaßen flott gemachte nationale Kapitalstandort muss dann auch ein anständiges Wachstum zuwege bringen. Andernfalls wird die machtvolle Gleichung, mit der der Staat seine kapitalistisch guten Werke tut, dass nämlich seine Schulden so gut wie echt vermehrtes Geld wären, doch ein wenig fragwürdig: Schließlich erwirtschaftet er aus dem Geliehenen keine Rendite, sondern lässt in letzter Instanz dann doch wieder seine Steuerzahler für Grundsumme und Zins einstehen; am Wachstum der national verdienten und besteuerbaren Geldsumme entscheidet sich daher, ob er mit seiner wunderbaren Geschäftsvermehrung wunschgemäß kapitalistisch produktiv gewirkt hat oder ob die gewaltsame Gleichsetzung seiner Schulden mit echtem Geld doch zu gewagt war und dann nur allzu folgerichtig gegen das echte Geld der Gesellschaft ausschlägt. Das Risiko ist in der staatlichen Schuldenwirtschaft also durchaus enthalten: dass die private Geschäftswelt sich mit ihren nationalen Erträgen zwar reich rechnet, aber gar nicht wirklich bereichert und sich mit ihren fiktiven Verdiensten international schon gar nicht sehen lassen kann; denn am Ende bestraft das dazu ermächtigte Finanzkapital Kredit- und Geldsorte der Nation mit kritischen Bewertungen. Dieses Risiko ist aber nur die unausbleibliche Kehrseite des allseits begrüßten, verlangten und praktizierten Verhältnisses, dass der Staat mit seinen „faux frais“ die Akkumulation des kapitalistischen Reichtums betreibt und mit dem Kredit, den er sich dafür nimmt, wachsende private Bereicherung zum Sachzwang macht; einem Sachzwang, an dem er mit seinem Kapital-förderlichen Einsatz sogar scheitern kann. Kapitalistisches Wachstum und staatliche Finanzmacht bedingen einander, das gilt eben im Boom wie in der Krise.
2.) Zum geschäftlichen Nutzen von Rüstungsausgaben: Reichtumsvermehrung durch die permanent erweiterte Reproduktion von Zerstörungsgerät
Von der Regel der ökonomischen „Vernunft“, der die „faux frais“ des modernen Staatswesens gehorchen, macht das, was Staaten für ihr Militär ausgeben, keine Ausnahme.[12] Fürs Wachstum des Kapitals im nationalen Maßstab notwendig ist dieses Geld ganz unbedingt, nötiger als vieles andere, was eine Staatsgewalt sich zu leisten pflegt. Sie finanziert damit schließlich die Sicherheit, die einheimische Firmen bei der geschäftlichen Beschlagnahme und Benutzung auswärtiger Reichtumsquellen – Arbeitskräfte, natürliche Ressourcen, Produktionsanlagen, Zahlungsfähigkeit – brauchen. Die Zerstörungskraft einer Armee ist insofern eine wirkliche kapitalistische Produktivkraft. Deswegen versteht es sich auch von selbst, dass der Aufwand für Militär und Rüstungsgüter um so höher ausfallen muss, je mehr Kapital in einer Nation akkumuliert, je weiter folglich der Umkreis der von dem Land ausgehenden Geschäftsinteressen gesteckt ist, und erst recht, je mehr Kapital auswärts bereits engagiert ist. Zwar sind die Frühzeiten des modernen Imperialismus vorbei, als Kolonialarmeen noch den Zugriff auf auswärtige Landstriche überhaupt zu eröffnen und möglichst exklusiv zu garantieren hatten; im Vergleich dazu genießen Multis wie „Mittelständler“ von heute bei ihren weltweiten Fischzügen und Anlageentscheidungen so etwas wie einen globalen Landfrieden. Eben der setzt aber ein ganz besonders hohes Maß an militärisch zweifelsfrei garantierter politischer Kontrolle über die gesamte Staatenwelt voraus; und an der möglichst federführend beteiligt zu sein, das sind die friedlichen Weltwirtschaftsnationen sich selbst und ihrem Kapitalstandort schuldig. Deswegen kommt es ihnen essentiell und existenziell auf ihre absoluten und relativen kriegerischen Fähigkeiten an: An denen entscheidet sich, ob und inwieweit unter den Bedingungen der heutigen Weltfriedensordnung sie mehr zu den Kontrolleuren oder den Kontrollierten gehören. Und wie tödlich ernst sie diese Frage nehmen, das wird ganz aktuell an dem Aufruhr deutlich, den die USA mit ihrer Neudefinition globaler Sicherheit gerade unter ihren Verbündeten stiften.
Kapitalistisch produktiv sind Militärausgaben auch in der anderen Hinsicht, dass sie kapitalistischen Produzenten als Bereicherungsquelle dienen; darin stehen sie einem Verkehrs- oder Bildungsetat schon überhaupt nicht nach. Sie realisieren den Profit, den hochqualifizierte Belegschaften in die feinen Rüstungsgüter wie in jede kapitalistische Ware hineingebaut haben. Dass Waffen so gar nichts gebrauchswertmäßig Aufbauendes an sich haben, nur zum Kaputtmachen taugen, ändert daran überhaupt nichts, macht im Gegenteil nur die abstrakte Natur des Reichtums augenfällig, auf den es im System der Marktwirtschaft einzig und allein ankommt: Für dessen Vermehrung eignen sich Panzer haargenau so gut wie Straßenbaumaschinen und Gewehrkugeln nicht anders als Kaugummi. In einer nachgelagerten Hinsicht taugt Rüstungsgerät dazu eher noch besser als das zivile Warenangebot für jedermann: Der Staat mit seiner quasi unerschöpflichen Kaufkraft, seinem enormen Bedarf, seinem Planungs-Vorlauf, seiner Bereitschaft, Offiziere und Experten der engagierten Industrie zusammen zu setzen und zukünftige Kriegsbedürfnisse erfinden zu lassen, usw. ist für kapitalistische Unternehmer einfach der ideale „Markt“. Zum allgemeinen Wachstum leistet der Militäretat gleichfalls seinen soliden Beitrag: Zulieferer verdienen mit; Geld kommt „unter die Leute“ und bleibt selbstverständlich nicht dort, sondern findet prompt seinen Weg in die Kassen anderer Unternehmer, wo es nach den Regeln der „ökonomischen Vernunft“ auch hingehört. Mit seiner Art der „Wertschöpfung“ macht der Kapitalismus durch die Produktion von purer Vernichtungspotenz den gesellschaftlichen Reichtum, nämlich das private Eigentum größer; für seine Konjunktur ist daher ein üppiger Rüstungshaushalt kein Schaden, sondern der reine Segen.
Deswegen finden die Regierungen potenter kapitalistischer Nationen es auch allemal gerechtfertigt, für Rüstungsvorhaben mehr Kredit aufzunehmen. Sie erwarten sich davon Wachstumsimpulse, und sie tun einiges dafür, dass jede Summe, die sie ihrer Rüstungsindustrie zu verdienen geben, sich kapitalistisch gleich mehrfach lohnt. Hier, in enger militärisch-industrieller Kooperation, treiben sie den technischen Fortschritt voran, sorgen auf allen Sektoren, von der Werkstoffkunde bis zur Pharmakologie und von der Elektronik bis sonst wohin, für die Entwicklung von Spitzentechnologien, die den nationalen Firmen auch im zivilen Anwendungsbereich entscheidende Konkurrenzvorteile sichern. Das Militärgerät selbst verfällt entsprechend schnell dem „moralischen Verschleiß“: Es veraltet im Nu. Anders als andere Güter hat es damit aber als Geschäftsmittel noch lange nicht ausgedient: Es wird all den vielen auswärtigen Gewaltmonopolisten verkauft, die sich in eigener Regie noch nicht einmal das Drittbeste an Gewaltmitteln verschaffen könnten; die Regierung knüpft die dafür nötigen Bande. Die Waffen-Unternehmen der Führungsnationen bereichern sich am Gewaltbedarf fremder Staaten; auswärtige Finanzmittel stützen das nationale Wachstum und tragen so dazu bei, dass aus den „faux frais“, die der nationale Auftraggeber in seinen fortschrittlichsten Industrie-Komplex hineingesteckt hat, eine allgemeine Kapitalakkumulation erwächst, mit der die aufgeblähte Masse staatlicher Schulden wieder halbwegs ins Lot kommt. Und an politischem Einfluss auf fremde Souveräne, mit Nutzen auch für die geschäftlichen Beziehungen, gewinnt die Nation außerdem, wenn die Regierung das alles nur halbwegs geschickt anpackt.
Fürs kapitalistische Gemeinwesen ist es also nicht Fluch, sondern Segen, wenn es für seine Wehrhaftigkeit dermaßen viel Kredit verpulvert, dass die damit so üppig versorgte Branche sich gegen alle Konkurrenz den Weltmarkt für Gewaltmittel erobert. Auch so passen Geschäft und Gewalt in der marktwirtschaftlichen Idylle einfach unverwüstlich gut zusammen.
3.) Vom Rüstungsbudget zum Kriegshaushalt – und wieder zurück: „Höhere Gewalt“ als Schadensfall
Etwas anders sieht die Sache aus, wenn ein Staat nicht mehr friedlich denkbare Kriege vorbereitet, sondern wirkliche Kriege führt. Dann hört das bürgerliche Gemeinwesen zwar noch längst nicht auf, nach allen Regeln der doppelten Buchführung abzurechnen. Der Aufwand für Mord- und Totschlag-Aktionen sowie, gegebenenfalls, für Reparaturen am eigenen Standort wird säuberlich als Haushaltsposten verbucht. Das muss schon deswegen sein, weil an diesem Aufwand nach wie vor ganz reell gutes Geld verdient werden soll. In der Marktwirtschaft ist eben selbst Krieg noch eine ehrenwerte Bereicherungsquelle; für Kapitalisten, die der Staatsgewalt das Benötigte liefern und dabei stur an ihre Rendite denken. Deswegen muss auf der anderen Seite das Umbringen und Verwüsten und Reparieren finanziell ordentlich „dargestellt“ werden: in einem Haushalt, für den der Kriegsherr sich bei seinen Finanzkapitalisten verschuldet; mit Kreditpapieren, die ordentlich gehandelt werden und die gesellschaftlich verfügbare Finanzmasse aufblähen. In allen Hinsichten bewährt sich im Krieg die schon beim Rüsten erprobte Symbiose von staatlicher Gewalt und kapitalistischem Geschäft – doch dabei bleibt es nicht. Denn andererseits bringt die Durchführung größerer Militäraktionen dann doch nicht bloß zusätzliche Geschäfte in Schwung, sondern eine Menge laufender und geplanter Geschäfte zum Erliegen. Die kapitalistischen Reichtumsquellen – Arbeitskraft, Produktionsanlagen, eigene und erst recht viel auswärtige Zahlungsfähigkeit – werden beschädigt; da geht dann auch die normale Zirkulation nicht einfach weiter, und die Spekulation auf deren Fortgang, dieser empfindsame Überbau, von dessen Kredit- und Anlageentscheidungen der materielle Unterbau so entscheidend abhängt, kommt durcheinander. Laufende Geschäfte sind gestört oder kaputt, Vorschüsse müssen abgeschrieben werden, die Basis für neuerliche Akkumulation ist dezimiert. Mit der Vernichtung materieller Reichtumsquellen leiden eben auch die Kapitalgrößen, auf die es marktwirtschaftlich wirklich ankommt: die Rechtstitel auf künftige Erträge, aus denen kapitalistisches Eigentum recht eigentlich besteht. Denn das wäre ja keines, wenn es bloß dinglich herumläge; in der einen oder anderen Form ist es allemal als Vorschuss auf Profit und Wachstum unterwegs, als Forderung oder Verbindlichkeit mit Renditeversprechen. Deswegen ist es letztlich aber auch nur so viel wert wie die Aussichten des Geschäfts, in dem es steckt. Und mit denen ist es im Kriegsfall aufs Ganze gesehen nicht mehr weit her. Auf diese etwas komplizierte Art ist Krieg auch nach kapitalistischer Rechnungsart ein immenser Schadensfall.
Das gilt ganz speziell für den privaten Reichtum, den die Krieg führende Staatsmacht sich geliehen hat und dessen solide Fortexistenz und Vermehrungskraft sie mit ihren Zinszahlungen verbürgt. Denn die kennt auf der einen Seite bei der Finanzierung ihrer Militäreinsätze keinerlei funktionelle Rücksichten aufs nationale Wirtschaftswachstum mehr; sie finanziert jenseits allen wachstumsorientierten Haushaltens mit den Mitteln der Nation Erhaltung und Durchsetzung ihrer Macht. Der entsprechend maß- und rücksichtslosen Ausweitung ihres Schuldenbestandes steht auf der anderen Seite überhaupt keine gleichgewichtige Aufblähung des allgemeinen nationalen Geldverdienens gegenüber, vielmehr einiges an Einschnitten ins bisherige Geschäftsleben, eine Reduktion des akkumulierten Vermögens. Diese Relation relativiert die Gleichung, wonach Staatsschulden Finanzierungsmittel von unverwüstlichem Wert sein sollen und um der gedeihlichen Symbiose von staatlicher Finanzmacht und privater Bereicherung willen sachzwanghaft sein müssen, dann doch ganz erheblich. Auf nationaler Ebene leidet der „abstrakte“ Reichtum mitsamt seiner nationalen Ausprägung, der Währung, unter einem Krieg.
Und das, obwohl er durch Waffengewalt so unmittelbar gar nicht umzubringen ist. Denn genau genommen ist es sogar so – eine letzte Schönheit des innigen Verhältnisses zwischen Kriegsgewalt und Kapitalakkumulation –, dass der Krieg den Eintritt des kapitalistischen Schadensfalls, den er verursacht, suspendiert. Er höhlt zwar das kapitalistische Vermögen der Krieg führenden Nation aus; die verbittet sich aber, solange sie im Krieg ist, jede finanzkapitalistische Kritik an ihrem Bemühen um eine systemkonforme Finanzierung ihres Kampfes, unterbindet also die Aufdeckung der zunehmenden Fragwürdigkeit all der Anspruchstitel auf zukünftige Wachstumserträge, die ihre Regierung in Umlauf gebracht hat und die sonst noch so in Umlauf sind. Gerade unter Inanspruchnahme der Techniken des Finanzkapitals wird die Frage, ob der kapitalistische Reichtum der Nation für den Krieg überhaupt reicht, praktisch nicht zugelassen. Richtig kritisch wird es, wenn wieder Frieden einkehrt und mit der Neueröffnung eines zivilen Geschäftslebens die Probe aufs Exempel ansteht, wieviel kapitalistisches Wachstum mit all den aufgeblähten Massen zirkulierender Vermögenstitel tatsächlich in Gang kommt, welches gesellschaftliche Geldprodukt also absehbarerweise für die Verzinsungsversprechen des staatlichen Schuldners einstehen muss – und was dessen Schulden folglich überhaupt wert sind. Dann pflegt sich herauszustellen, dass „kriegsbedingt“ – nämlich genauer: bedingt durch die blitzsaubere marktwirtschaftliche Finanzierung des ganzen Gemetzels – viel zu viel Kredit unterwegs ist, als dass dessen lohnende Verwendung absehbar und auf staatliche Schuldscheine noch irgendein Verlass wäre. Der errungene Frieden ist daher der eigentliche ökonomische Schadensfall einer kapitalistischen Kriegswirtschaft.
Dabei ist immerhin – um dem Kapitalismus auch in dieser Hinsicht die Ehre zu geben, die ihm gebührt – zumindest die Nachkriegs-Not, das Elend einer ansonsten anständig und arbeitsam gebliebenen Bevölkerung inmitten einer Ruinenlandschaft, in der es enorm viel wieder aufzubauen gibt, doch auch wieder eine ausgesprochen gute Geschäftsbedingung; vorausgesetzt nur, es findet sich genügend Kapital, das diese Chance nutzt, sowie ein gutes Geld, das zu verdienen sich kapitalistisch lohnt. Wo eine solche Symbiose von Kapital und Not zu Stande kommt, da blüht das Geschäft, und gewisse Nationen haben damit im Anschluss an die größte Katastrophe ihrer Geschichte einen weltweit beneideten Nachkriegs-Boom hingelegt – sehr passend für eine Produktionsweise, die ihr Wachstum schon in Friedenszeiten in der Weise abwickelt, dass sie ihren zunehmenden privateigentümlichen Reichtum periodisch mangels weiterer Aufblähungschancen rigoros zusammenstreicht und produzierte Güter wie Reichtumsquellen samt Personal verkommen lässt, um auf reduzierter Basis neu mit ihrem Wachstum loslegen zu können. Ohne ein Geld freilich, das die Nachkriegsnot überhaupt erst kapitalistisch nutzbar macht, und ohne Kapital, das sie als Geschäftsbedingung auch wirklich nutzt, bleiben nach den Gesetzen der Marktwirtschaft die Notwendigkeiten eines Wiederaufbaus eine bloße Geschäftsbedingung – ein höchst trübseliger politökonomischer Zustand, der das Elend perpetuiert. Die Beispiele dafür sind deutlich zahlreicher als die für den kapitalistischen Glücksfall, dass kapitalkräftige Investoren eine Trümmerwüste voller anstelliger armer Leute zum Ausbeutungsparadies machen. Und das ist auch kein Wunder; denn gutes Geld und ein solider Kredit, diese unabdingbaren Mittel eines kapitalistischen Wiederaufbaus, sind eben Mangelware in einer Nation, die sich für ihren Krieg all die Schulden geleistet hat, die sie aus Gründen einer sauberen Kriegsfinanzierung eben benötigt hat.
Vom Prinzip zurück zum gegenwärtigen Fall: Im Vergleich zu dem, was die großen kapitalistischen Nationen in ihrer bisherigen Geschichte schon an Kriegskapitalismus hingekriegt haben, veranstaltet Amerika eine
III. Welt-Kriegswirtschaft neuen Typs
Was der US-Präsident „so deutlich, wie ich kann,“ der eigenen Nation und dem Rest der Welt ansagt, ist nicht bloß enorm viel amerikanische Rüstung, sondern die mit Krieg bewerkstelligte Einführung neuer strategischer Grundkonstanten in der Staatenwelt sowie die dazu passende Haushaltspolitik. Und das bedeutet eine von bisherigen Sitten und Regularien merklich abweichende militaristische Perspektive für den Kapitalismus Amerikas und der Welt.
1.) Kriegskredite auf amerikanisch
Der US-Präsident hat nicht den geringsten Zweifel: Der Finanzbedarf, den er anmeldet, wird befriedigt. Diese Selbstsicherheit ist bemerkenswert. Denn immerhin geht es nicht bloß um ein wenn auch sündteures, so doch abgegrenztes Rüstungsvorhaben wie sein – sowieso weiter betriebenes – Lieblingsprojekt eines undurchlässigen Raketenabwehrsystems, sondern um den einen oder anderen Krieg: Unternehmungen mit vorweg nicht begrenzbaren militärischen Weiterungen, Kollateralschäden, Nachschub-Bedürfnissen – also, auf den wesentlichen Punkt gebracht: finanziellen Erfordernissen. Es geht nicht nur um einen einzelnen Feldzug von allenfalls abschätzbarer Dauer, sondern erklärtermaßen um eine offene Liste von Fällen einer auf Dauer angelegten militärischen Durchsortierung der Staatenwelt insgesamt: ein Unternehmen, das auch zwischen den jederzeit fälligen regulären Waffengängen die Militarisierung der internationalen Beziehungen und eine entsprechende quasi-kriegsmäßige Anspannung aller Kräfte, auch der finanziellen, für das totalitäre Ideal einer vollständigen, weltweiten, präventiven Absicherung amerikanischer Belange verlangt. Und insofern geht es um einen in seinen Dimensionen und seinen Unwägbarkeiten tatsächlich kriegsmäßigen Bedarf an Budgetmitteln. Für deren Beschaffung sieht der Präsident jedoch ein größeres Problem als die Zustimmung seines Kongresses überhaupt nicht – und die ist ihm von vornherein sicher. Er hält die Finanzierung seines neuesten „amerikanischen Traums“ von der Ausrottung des gewaltbereiten Antiamerikanismus auf dem Globus für eine lockere Übung, die mit ihrer Ankündigung schon so gut wie erledigt ist – und außerdem leicht vereinbar mit einer Steuersenkung für Reiche, die das Wirtschaftswachstum wieder aus der Krise herausführen soll.
Ganz offensichtlich verlässt sich die US-Administration darauf, dass das Finanzkapital der kapitalistischen Welt für ihre kriegerischen Belange Kredit in unbegrenzter Höhe und sogar zu billigen Tarifen übrig hat. Sie kennt eben, seit dem Ende des „Sowjetblocks“ schon gleich, zwar einen Haufen politischer und strategischer Problemfälle auf der Welt; ihre Finanzjongleure jedoch kennen nichts anderes mehr als Kapitalisten und Nationen, die alles daran setzen, Dollar zu verdienen; die scharf darauf sind, die verdienten Dollar in Amerika wieder auszugeben oder anzulegen; die daher aus purem Eigennutz jeden Kreditbedarf des amerikanischen Staates als Angebot akzeptieren, also befriedigen – weltwirtschaftliche Verhältnisse, die Tag für Tag die Identität von US-Schulden mit dem geldförmigen Reichtum der kapitalistischen Welt beglaubigen, an der ein Amerikaner, vom Präsidenten ganz zu schweigen, ohnehin nie einen Zweifel hat. Mit dieser soliden Sachkenntnis gehen Bush und seine Mannschaft davon aus, dass das auch so bleibt; durch alle Fährnisse ihres unabsehbaren antiterroristischen Kreuzzugs hindurch und im Zeichen dieses Weltverbesserungsprojekts erst recht.
Und das ist, um das Wenigste zu sagen, gewagt. Denn mit ihrer selbstdefinierten globalen Mission erschüttern die USA – schon jetzt, und mit jeder weiteren Eskalation immer fundamentaler – alle politökonomischen Verhältnisse, die sie selber eingerichtet, abgesichert und ausgenutzt haben; sie stören und zerstören tendenziell den Nutzen und die Benutzbarkeit des Globus als große Geldmaschine, die nicht zuletzt in ihrem Sinne und für ihren Bedarf gelaufen ist und noch immer funktioniert. Die Wirkungen sind bereits zu besichtigen.
2.) Beabsichtigte politische Wirkungen und weniger beabsichtigte politökonomische Nebenwirkungen des Antiterrorkriegs: Viel kaputt, der Rest nicht mehr sicher
a.
So hat bereits das erste Jahr Terrorismusbekämpfung die Region zwischen Indien und dem Mittelmeer gründlich aufgemischt.
- Pakistan macht Karriere im Dienst der USA, als Helfershelfer und Objekt zugleich einer ‚Säuberung‘ seiner Grenzgebiete zu Afghanistan von – offenbar nicht zu knapp – übrig gebliebenen „islamistischen Terroristen“. Und die fällt völlig anderes aus als alles, was die Staatsmacht sich mit ihrer langjährigen Einmischung in Afghanistan, mit ihrer „islamischen“ Atombombe, mit ihren Kriegen um Kaschmir und ihrem Dauerstreit mit Indien um die Provinz, schließlich noch mit ihrem Schwenk zur Dienstbarkeit für Amerikas Krieg gegen das Taliban-Regime je vorgenommen und ausgerechnet hat. Eigene nationale Belange zählen überhaupt nichts mehr; umgekehrt wird das Land untauglich für alle auswärtigen Belange und Interessen, die an seine Staatsmacht herangetragen werden – außer für den Auftrag zur Terroristen-Bekämpfung, dessen Erfüllung das Land eben bis zur völligen Unbrauchbarkeit unsicher macht. Ökonomisch überlebt der Staat in Gestalt seines diktatorisch regierenden Generals-Präsidenten und des Militärs mit Krediten des IWF und der amerikanischen Antiterror-Allianz; Krediten, die weder geeignet noch überhaupt dazu bestimmt sind, irgendwelche eventuellen Ansätze zu einer wenigstens rudimentär weltwirtschaftlich ausnutzbaren Nationalökonomie voranzubringen. Sie sichern gerade mal die Herrschaft des Präsidenten, der den Amerikanern eine fragwürdige, aber die beste Garantie, die überhaupt zu haben ist, dafür bietet, dass antiamerikanische Aktivitäten unterdrückt und verfolgt werden – und dass der nach Amerikas strategischen Vorgaben völlig nutz- und sinnlose Einsatz militärischer Kräfte und erst recht der atomaren Rüstung des Landes gegen Indien unterbleibt: einiger Aufwand allein dafür, dass der Verfall des Landes zum unkalkulierbaren Groß-Schadensfall nicht selber außer Kontrolle gerät.
- Der Türkei, dem US-Verbündeten am anderen Ende des derzeit abgesteckten Antiterrorkriegsgebiets, wird ein wichtiger Dienst als Etappe und Kampfgenosse der US-Armee für den im Vergleich zum Afghanistan-Feldzug weit umfänglicher dimensionierten zweiten Krieg gegen Saddam Husseins Irak auferlegt. Im Hinblick auf diesen Dienst wird das Land mit IWF-Krediten von außerordentlicher Größe zahlungsfähig, seine krisenhaft schrumpfende Nationalökonomie noch in Gang gehalten. Eine Sanierung der Nation, wie immer die aussehen könnte oder sollte, ist damit nicht in Reichweite gekommen, ist im Übrigen auch in dem Fall weder Grund noch Zweck der großen Leihaktion: Die politökonomische Notlage des Landes wird damit „stabilisiert“, ganz nebenbei die seiner Bevölkerung verschärft und auf Dauer festgeschrieben. Die innere politische Ordnung der Nation leidet ohnehin seit längerem unter etlichen unversöhnlichen Gegensätzen, darunter dem zwischen oppositionellen islamischen Moralisten und NATO-Generälen, die sich berufen und von ihrer Allianz auch ermächtigt sehen, notfalls wieder einmal mit Gewalt die Demokratie zu retten. Gleichzeitig inszeniert die politische Führung innere Reformen, die das Land EU-tauglich machen sollen; und das, obwohl die EU das Land in ihrem Club gar nicht haben will und schon gar kein Geld dafür übrig hat, seine Europa-Tauglichkeit zu befördern. Mindestens drei Drangsale also, die jedes für sich ausreichen, um den Staat zu ruinieren – und alles das soll zurücktreten vor der überragenden Aufgabe, den USA gegen Saddam Hussein zu helfen. Mitten in all ihren Krisen wird die Türkei genötigt – das Widerstreben des siechen Regierungschefs hilft dagegen gar nichts –, alle Kräfte für ein großes finales Militärabenteuer an seiner Ostgrenze anzuspannen: die militärischen, die es zweifellos hat, und die ökonomischen und politischen, die es schon kaum mehr besitzt und durch eine solche Anspannung vollends ruiniert. Die Chancen stehen gut, dass von der großartigen strategischen, ökonomischen und kulturellen „Brücke zwischen dem europäischen Westen und der islamischen Welt“, als die das Land sich seinen NATO-Partnern einmal empfohlen hat, am Ende auch nichts weiter übrig bleibt als ein militärisches Zwangsregime, das den Anforderungen der US-Streitkräfte an ein Hinterland für ihre Kriegführung entspricht, so gut es kann – und ansonsten ein sehr bevölkerungsreicher Schadensfall.
- Saudi-Arabien, traditionell als politischer Klient, als militärischer Aufmarschplatz, als gelungene Synthese von islamischer Orthodoxie und arabischem Pro-Amerikanismus, als unverzichtbare Ölquelle und als schwergewichtiger Geldanleger engstens mit den USA verbunden, wird seit einem Jahr zu seinem Schaden einer gründlich revidierten Einschätzung unterzogen. Nach den Kriterien des verschärften antiterroristischen Kontrollregimes, dem die USA die Welt Stück um Stück und zuerst eben im Nahen Osten unterwerfen, ist das Land verdächtig: Weil führende antiamerikanische Aktivisten aus führenden saudischen Familien stammen, gilt das Land als deren faktischer, wenn nicht sogar bereitwilliger Zufluchtsort. Und weil es die verlangte Beihilfe für einen Krieg zur Entmachtung Saddam Husseins deutlich verweigert, ordnet es sich nach den Kriterien der neuen amerikanischen Feinderkennung tendenziell der falschen Seite zu. Auf diesen ihren neuen kritischen Blick auf ihren bislang zweitwichtigsten nahöstlichen Verbündeten reagiert die US-Regierung nach der Maxime, die sie ihrer globalen Säuberungsmission vorangestellt hat: ‚Wer nicht für uns ist, ist gegen uns!‘, macht, andersherum betrachtet, klar, was diese Maxime für den Umgang selbst mit bislang treu ergebenen und äußerst nützlichen Vasallen bedeuten kann: Sie macht sich an die Destruktion der politischen und ökonomischen Rolle, die das große Königreich für Amerika bislang gespielt hat. Kritik an den Herrschaftssitten des saudischen Herrscherhauses kommt auf; nicht bloß unter Menschenrechtlern, die schon immer die amerikanische Art von Justiz der islamischen vorgezogen haben, sondern in Regierungskreisen und einer des puren Idealismus unverdächtigen demokratischen Öffentlichkeit;[13] so wird dem Verbündeten die Kündigung der bisherigen „strategischen Partnerschaft“ angesagt. Die Verlegung von Truppen und Kommandozentralen in benachbarte Scheichtümer setzt die entsprechenden ersten Fakten. Schon das schmälert ganz gewaltig die politische Bedeutung alles dessen, was die saudische Regierung international will und betreibt: Sie zählt nicht mehr als verlängerter Arm und Sprachrohr der Interessen der Supermacht, also nicht mehr viel. Mit der zielstrebigen Diversifizierung ihrer Ölquellen – die neue russisch-amerikanische Freundschaft hat hier einen ihrer Gründe – entzieht die US-Regierung dem Land zugleich nach und nach die materielle Grundlage für sein gewichtiges politisches Auftreten: Es soll die Position des Haupt-Öllieferanten verlieren, der mit seinen Entscheidungen die Zufuhr und damit den Preis des kapitalistischen Energierohstoffs Nr. 1 von einem Tag auf den andern zu ändern vermag; dass es diese Funktion regelmäßig im Sinne amerikanischer Interessen wahrgenommen hat, hilft ihm nichts. Wo das alles noch hinführen kann, wenn Washington es darauf anlegt, das macht die bizarre Klage einer amerikanischen Opfer-Vereinigung vor einem US-Gericht gegen Mitglieder des saudischen Königshauses in Regierungsfunktion, saudi-arabische Banken und Institutionen auf – immerhin – 300 bis 1000(!) Milliarden Dollar Schadensersatz wegen Unterstützung terroristischer Umtriebe einschließlich des Attentats aufs WTC deutlich: Ernsthaft wird die Möglichkeit erwogen, dass die amerikanische Regierung saudisches Vermögen in den USA „einfrieren“, also quasi beschlagnahmen könnte. Seither weiß man, dass dieses Vermögen auf – immerhin – 600 bis 800 Milliarden Dollar geschätzt wird. Dass davon ein erstes Viertel bereits aus den USA abgezogen worden sei, wird von maßgeblichen saudischen Prinzen zwar dementiert; schon die Nachricht zeugt aber von den rohen Sitten, die im bislang blühenden Geschäftsverkehr zwischen dem Königreich und den Vereinigten Staaten eingerissen sind. Wenn zudem die Schweiz als Zufluchtsort für saudisches Geldvermögen ins Gespräch kommt und ein Umtausch von Dollar- in Euro-Bestände für eher unwahrscheinlich erklärt wird, dann tut das Gerücht bereits seine mehrseitig geschäftsschädigende Wirkung – würde es offiziell bestätigt, wäre das ein weltwirtschaftlicher Schadensfall von schlecht überschaubarer Tragweite, an dem auch die USA keine Freude haben könnten.
- Israel, umgekehrt, hat es erreicht, dass seine ausgreifende Offensive gegen die widerspenstige Einwohnerschaft seiner Besatzungsgebiete von den USA als integraler Bestandteil des großen Antiterrorkriegs anerkannt wird. Dermaßen ins Recht gesetzt, hat die Sharon-Regierung die alte Palästinenser-Autonomie des Präsidenten Arafat praktisch vernichtet, die ökonomischen Voraussetzungen für ein auch nur halbwegs lebensfähiges palästinensisches Gemeinwesen zerstört, damit die immerhin von der EU mit Milliardenbeträgen vorfinanzierte Spekulation auf geordnete und irgendwann sogar brauchbare Verhältnisse am Jordan zunichte gemacht – und mit alledem nicht zuletzt ihr eigenes Land ruiniert. Denn all die erfolgreichen Militärschläge treffen nicht bloß die arabische Seite, sondern Israels eigene Einnahmequellen und zehren zudem seinen Staatshaushalt auf, so dass mit der politischen Verrohung auch die Verelendung im Land ordentlich vorankommt. So bezahlt die Nation ihre Karriere zum selbständig agierenden Lizenznehmer und Agenten des US-Antiterrorkriegs, der zudem zu dessen nächster Etappe die Fähigkeit und jederzeitige Bereitschaft zu einem präventiven Überfall auf den Irak beisteuert, mit ihrem Bankrott, den nur noch amerikanische Hilfszahlungen hinauszögern. Eine andere Brauchbarkeit des Judenstaats als die allerdings sehr große für Amerikas Kriegszwecke ist gar nicht mehr absehbar – aber anscheinend auch gar nicht mehr gefragt: Auch so kann ein Staat offensichtlich überleben und sich sogar als aufsteigende Macht begreifen.
- Afghanistan schließlich – um die glorreiche Befreiung des Landes vom Verbrechen des Schleierzwangs auch noch gerecht zu würdigen – ist überhaupt so zerstört, als Gemeinwesen und wenigstens potentieller Teilhaber an einem anderen Weltgeschäft als dem mit Opium und Hungerhilfe so wenig existent, dass es umgekehrt schon eine nationale Perspektive für das Land bedeutet, wenn die US-Armee in der Nähe von Kabul einen gewaltigen Stützpunkt bezieht. Dabei vermeidet Amerika sorgfältig den Fehler der damaligen Sowjetunion, die in Afghanistan einen mit ihr verbündeten kompletten Staat mit Nationalökonomie, Sozialwesen, einer Volksbildung jenseits von Allah-Glaube und Waffenkunde und unter Führung einer als sozialistisch formierenden Partei errichten wollte. Mehr als eine Funktion als Kasernenhof ist nicht geboten. Und das ist doch ein schöner Kriegsgewinn.
Und so weiter. Die Bemühungen der USA um die Einfügung der nahöstlichen bis zentralasiatischen Region in ihr antiterroristisches Weltkriegsszenario haben diese Weltgegend bereits nach kaum einem Jahr gründlich aufgemischt und eine ganze Sammlung unterschiedlicher politökonomischer Schadensfälle zu Stande gebracht, die auch beim Veranstalter mit Unkosten noch weit über den Wiederbeschaffungspreis der verschossenen Raketen hinaus zu Buche schlagen.
b.
Von noch ganz anderem Kaliber sind die Zumutungen und – gewollten oder ungewollten – Nebenwirkungen ökonomischer Art des US-Kriegsprogramms, von denen sich die Staaten betroffen sehen, die imperialistisch und weltwirtschaftlich etwas zählen; die Tatsache, dass sie sich je länger, je mehr zu regelrechten diplomatischen Abwehrkämpfen gegen die Forderungen und das Vorgehen der Weltmacht genötigt finden, gibt darüber einige Auskunft.
Sie sollen auf der einen Seite mit ihrem finanziellen Aufwand nicht geizen, wenn die Führungsmacht im Antiterrorkrieg Unteraufgaben verteilt, militärische Beiträge einfordert, auf einem Ausbau der internen Kontrollapparate und auf antiterroristischen Fahndungserfolgen besteht, im Übrigen über die bekundete generelle Kriegsbereitschaft hinaus auf eine deutlich und dauerhaft verbesserte Kriegsfähigkeit ihrer Verbündeten pocht und dazu eben als Erstes eine massive Aufstockung ihrer Militärbudgets verlangt. Darunter geht nichts mehr: Wer beschließt, dass die eigene Nation unmöglich abseits stehen kann, wenn weltweit mit Terroristen aufgeräumt und die zivilisierte Staatenwelt von verkehrten Regimen befreit wird; wer also in der eingeleiteten neuen Etappe imperialistischer Ordnungsstiftung nicht abgehängt, sondern aktiv mit dabei sein möchte: der muss auch mit seinem nationalen Vermögen für diesen Ehrgeiz einstehen. Dabei zählen zaghafte Kalkulationen, die den finanziellen Aufwand zum imperialistischen Ertrag ins Verhältnis setzen wollen, gar nichts, sondern allein die Maßstäbe, die die US-Regierung mit ihrer Entscheidung, für „die Freiheit“ dürfe „nichts zu teuer“ sein, schon gesetzt hat. Eine Haushaltspolitik mit kriegsmäßiger Prioritätensetzung ist gefordert; eine Budget-Gestaltung, die die Rücksicht auf nationale Wachstumsziffern und Defizit-Begrenzungen entschieden hinter das Ziel der gewaltsamen Ausrottung antiamerikanischer Umtriebe zurückstellt.
Auf der anderen Seite sollen die Partner, und das gilt nun mit ganz besonderer Dringlichkeit für den neuen NATO-externen Quasi-Verbündeten Russland, bei ihren weltwirtschaftlichen Aktivitäten alle Beschränkungen und Regularien respektieren, die Washington respektiert sehen möchte. Das beginnt mit so vergleichsweise billigen Angelegenheiten wie einem penetranten Kontrollregime in allen Handelshäfen dieser Welt, das Amerika mit über 100-prozentiger Sicherheit vor ausländischen Milzbrand-Bakterien und nuklear verschmutzten Terrorbomben abschirmt und in Friedenszeiten als Kosten treibendes „außertarifäres Handelshemmnis“ der Kritik aller Globalisierungs-Freunde verfiele.[14] Das betrifft aber vor allem die bi- und multilateralen Handelsbeziehungen der Konkurrenz: Alle wichtigen Staaten sollen gefälligst den Boykott gegen Länder mit tragen, die die US-Regierung auf der „Achse des Bösen“ angesiedelt hat oder unter den Verdacht stellt, das könnte demnächst fällig werden; und das ganz unabhängig davon, ob sie derartige Maßnahmen in Form einer UNO-Resolution mit beschlossen oder immer abgelehnt haben. Dass europäische Firmen und Russlands fragwürdige Marktwirtschaft ihre Chance ergreifen und unbehelligt durch US-Konkurrenten den Ölstaat Iran und sogar den Hauptfeind mit seinen immensen Ölreserven, den Irak, als Geldquelle nutzen; dass russische Unternehmen dem „Mullah-Regime“ zu Atomenergie und nukleartechnischer Kompetenz verhelfen und die deutsche Bundesregierung eine Industriemesse in Bagdad unterstützt:[15] Das ist für Amerika einfach nicht hinnehmbar und Stoff für politische Zerwürfnisse unterschiedlicher Größenordnung.
Doch ob sie sich nun erpressen lassen oder nicht: auf alle Fälle werden die imperialistischen Freunde und Konkurrenten dritterseits mit dem Faktum konfrontiert, dass ihre verbotenen Geschäftssphären im Visier der amerikanischen Antiterrorkrieger liegen und mit großer Wahrscheinlichkeit platt gemacht werden, noch bevor größere Geschäftsbeziehungen zu Stande gekommen sein und bedeutendere Investitionen sich gelohnt haben können. Die US-Regierung, darin von der israelischen sehr nachdrücklich unterstützt und angestachelt, stellt den Kaufleuten und Kapitalanlegern, die sich in Irak und Iran bereichern wollen, sowie den für derlei Vorhaben politisch Verantwortlichen die militärische Vernichtung ihrer Geschäftspartner in Aussicht. Auch sonst kommen den Europäern in dem „Krisenbogen“ zwischen Indischem Ozean und Mittelmeer hoffnungsvolle Geschäftsgelegenheiten allein dadurch abhanden, dass die Region einem Kriegsaufmarsch der US-Armee entgegensieht und für größere Projekte, die für ihre Abwicklung ein Mindestmaß an stabilen Verhältnissen brauchen, einfach nicht mehr die Zeit ist. Und wenn – um dieses Beispiel noch zu nennen – das Zerwürfnis zwischen den Vereinigten Staaten und dem saudischen Königreich weitergeht, dann dürften auch Schweizer Bankiers kaum davon profitieren.
Die neue geschäftsschädigende Unsicherheit, mit der die freiheitlich verbündeten Welthandelsmächte konfrontiert sind, beschränkt sich im Übrigen keineswegs auf die akut durcheinander gebrachte nah- und mittelöstliche Region. Sie betrifft sehr fundamental die „fundamentals“ der Weltwirtschaft überhaupt; so wachstumsentscheidende, weil in allen kapitalistischen Rechnungen enthaltene Größen wie den Ölpreis z.B., und das noch ehe irgendein irakisches oder sonstiges Ölfeld wirklich angezündet ist. Denn das ist ja gerade das kapitalistisch Fundamentale an den fundamentalen Voraussetzungen und Mitteln des marktwirtschaftlichen Geschäftslebens: Es geht um Vorschuss und Überschuss, um die Erwirtschaftung zukünftiger Gewinne aus aktuellem Aufwand, und alle kapitalistische Rechenkunst dreht sich um die Frage, wie sicher das eine aus dem andern folgt. Die Spekulation, durchkalkuliert in den Firmenzentralen dieser Welt und leibhaftig vergegenständlicht in den Börsensälen und -Computern des Finanzkapitals, entscheidet über den Gang der kapitalistischen Produktion und Zirkulation; und der kommen mit den Wirkungen des Antiterrorkriegs der USA ihre gewohnten Kriterien abhanden. Nicht bloß Einkaufspreise und Absatzmärkte werden nach allen bisherigen Maßstäben unkalkulierbar: Ganz generell wird unsicher, und zwar aus anderen und gewaltsameren Gründen als den gewohnten geschäftlichen und wirtschaftspolitischen, wie die Lebensfrage der Kapitalistenwelt zu beantworten ist, nämlich auf welches „Engagement“ sie ihr Kostbarstes, ihr Eigentum, setzen soll. Keine Frage, für die professionellen Teilnehmer dieser absurden Veranstaltung ist auch das Abhanden-Kommen gewohnter Geschäftsbedingungen nichts weiter als eine neue – aber eben eine schlechte. Und das genügt schon, um Börsenkurse sinken zu lassen, Firmen in die Pleite zu treiben und Staatshaushalte deutlich tiefer in die „roten Zahlen“ zu befördern.
Natürlich finden sich auch da gleich wieder Spekulanten der höheren Hedge-Fonds-Sorte, die aus den neuen Unsicherheiten und Verlusten ihre spezielle Goldgrube machen. Doch deren Aktivitäten erwachsen gerade aus einer insgesamt katastrophalen Geschäftslage: Sie sind die Exekutoren der einreißenden Verwirrung aller kapitalistischen Kalkulationen, der allgemeinen Schädigung des Wachstums, die aus der kriegerischen Verunsicherung des weltweiten Handels und Wandels folgt.[16]
3.) Die neue Zusatzqualifikation der globalen Marktwirtschaft: Kriegsökonomie
Für eine Politik, die genau diese Wirkungen zeitigt, genehmigt sich die US-Regierung Kredit; nicht bloß absolut beträchtliche Summen, sondern grundsätzlich beliebig viel. Völlig ungerührt durch nationale „Stagnation“ und größere Zusammenbrüche in aller Welt, durch „wegbrechende“ Steuereinnahmen und eine allgemeine „Verunsicherung“ der Geschäftswelt befindet sie die Finanzierung ihres geschäftsschädigenden Kriegskurses für vollkommen unproblematisch und deckt ihre „explodierenden“ Budgetdefizite mit neuen Schulden. Ihren Antiterrorkrieg, der lauter Schadensfälle produziert, Geldquellen lahmlegt und die Basis ihrer eigenen Finanzmacht schmälert, offeriert sie der herrschenden Klasse der Industriebosse, Aktienspekulanten und Staatsschuldenhändler als Geldquelle.
Und dieses Angebot wird – offensichtlich – angenommen. Für Kapitalanleger eine völlig „rationale“ Entscheidung: Wenn schon so viel Geschäft darnieder liegt und „die Zukunft“ so unsicher ist, dann empfiehlt „es sich“ um der Sicherheit der getätigten Geldanlagen willen, auf die Macht zu setzen, die alles so unsicher macht: auf den materiellen Kriegs- und den Finanzbedarf der Weltmacht. Ganz unspektakulär verschieben die Manager in den Entscheidungszentralen der Weltwirtschaft die Gewichte in ihrem Risikokalkül: Militaria und glaubwürdige Kriegsentschlossenheit werden ein wenig höher bewertet oder überhaupt als neue Zusatz-Gesichtspunkte in die spekulative Rechnung eingeführt, umgekehrt solche Geschäftsaussichten, die friedliche und zivile Verhältnisse voraussetzen, kritischer eingestuft. Und schon geht die Sache ihren Gang: Der weltweite Kapitalismus bedient Amerikas neuartigen Weltkrieg mit allem, was der braucht, und bedient, i.e. bereichert sich daran.
Was in den höheren Sphären der weltmächtigen Finanzpolitiker und finanzkapitalistischen Entscheidungsträger allenfalls den Tatbestand eines kleineren „Paradigmenwechsels“ erfüllt, ist tatsächlich der Übergang zur kapitalistischen Kriegswirtschaft. Die zeichnet sich dadurch aus, dass der Staat – der amerikanische in dem Fall, mit Folgen für die ganze Welt – bei der Ausnutzung seiner Finanzmacht deren Funktionalität fürs kapitalistische Wachstum weiterhin postuliert und unterstellt, ihre Abhängigkeit vom allgemeinen Wirtschaftswachstum aber praktisch negiert. Nicht als ob er diese Abhängigkeit in Friedenszeiten bedingungslos respektieren würde; auch da ist sein Haushalt de facto der dauernde praktische Test darauf, ob seine geldschöpferische Verschuldung durch das Wachstum, das er damit anstößt, auch gerechtfertigt wird; die gesellschaftlich verdiente Masse Geldes, die ihm als seine Steuerbasis zu Gebote steht, ist die praktische Auskunft und die Quittung über den entsprechenden wirtschaftspolitischen Erfolg oder Misserfolg. Mit dem Übergang zum Krieg als oberster nationaler Priorität erlässt der Staat jedoch praktisch das interessante ‚Dekret‘, dass die Beschaffung und Schöpfung von Geldmitteln, mit denen er seiner kapitalistischen Ökonomie die Mittel für seine militärischen Abenteuer abkauft, grundsätzlich frei sei von den Schranken, die das Wachstum des gesellschaftlichen Reichtums in seiner privateigentümlichen Gestalt, die gelungene Kapitalakkumulation, einer soliden Staatsverschuldung eigentlich setzt. Nach wie vor und wie in tiefsten Friedenszeiten – sofern es die für die Weltmacht im letzten Jahrhundert überhaupt je gegeben hat… – besteht die kriegführende höchste Gewalt Amerikas darauf, dass der Kredit, den sie sich nimmt und verzinst und als Kaufkraft für ihre Siege verwendet, ökonomisch in Ordnung geht, nämlich regulär vermehrten kapitalistischen Reichtum repräsentiert, und dass er deswegen das ihm einbeschriebene Gleichheitszeichen, das die in Umlauf gebrachten Dollars als das verbindliche Geld der kapitalistischen Welt ausweist, auch weiterhin unbedingt verdient; zugleich will sie von einschränkenden ökonomischen Bedingungen dieser Gleichung, von der Notwendigkeit einer Beglaubigung ihrer Schuldenwirtschaft durch einen irgendwie „entsprechenden“ Prozess der Kapitalakkumulation schlechterdings nichts wissen. Sie bedient sich der Usancen des Finanzkapitals, um dessen und die eigenen Forderungen an eine kapitalistisch solide staatliche Schuldenwirtschaft zu genügen und dabei die Frage, ob die Kredit-Rechnung mit dem Krieg überhaupt aufgehen kann, nicht zuzulassen. Ohne an den wundervollen Sachgesetzen ihrer Marktwirtschaft etwas zu ändern und ohne von der Privatmacht des Geldes als höchster ökonomischer „Instanz“ die geringsten Abstriche zu machen, verfügt der Staat, formvollendet nach den Regeln einer Kapital-freundlichen Budget-Gestaltung, die Emanzipation seiner Finanzmacht und des durch diese initiierten allseitigen Geldverdienens von eben den Sachgesetzen, auf denen sein etatmäßiges Herumwirtschaften beruht. Die Zerrüttung seiner ökonomischen Basis durch seinen Krieg soll deren Leistung nicht mindern, vielmehr umgekehrt die militärische Leistung, die er zu Stande bringt, alle ökonomische Zerrüttung, die er mit seiner Kriegführung anrichtet, ungeschehen machen. Es ist, als wollten Bush und seine Antiterrorkrieger den strategischen Welterfolg, den sie sich vorgenommen haben und zu erkämpfen gedenken, an die Stelle des kapitalistischen ‚Wertgesetzes‘ setzen und eben diesem ‚Gesetz‘ genau dadurch gerecht werden.
Wer das für widersprüchlich hält, liegt sicher nicht falsch. Aber was heißt das schon – in einer Welt, die sowieso von den Regeln der ökonomischen „Vernunft“ des Kapitalismus, den Sachzwängen imperialistischer Herrschaft und von den Charaktermasken, nicht den Kennern des ‚Wertgesetzes‘ regiert wird. Da stellen sich eben die größten Absurditäten als interessante Gesichtspunkte dar, die von Spekulanten und Politikern eingeschätzt, gegeneinander abgewogen und nach Beschlusslage beherzigt werden oder auch nicht; da kann man am Ende sogar um die – im akuten Kriegsfall freilich schon aus sittlichen Gründen unzulässige – Frage streiten, ob Krieg sich lohnt oder nicht.[17] Deswegen folgt aus dem Widerspruch einer kapitalistischen Kriegswirtschaft made in Washington auch nicht mehr und nicht weniger, als dass Amerika für seinen Krieg auf nichts verzichtet und auf nichts verzichten muss, was es braucht; die Kapitalisten dieser Welt verdienen sich, wenn’s mit dem „alten“ nicht mehr so gut klappt, ihre goldene Nase an einem „neuen Markt“ neuen Typs, der „einfach mal“ und bis auf weiteres dem Kriterium des militärischen Aufwands und Erfolgs der USA größeres Gewicht beim Geldanlegen einräumt. Und genau dieselben Instanzen bringen es – im Friedensfall oder wann auch immer, nach der An- oder nach der Absage des übernächsten Waffengangs, gemeinsam oder gegeneinander, mit einem (um einen großen US-amerikanischen Propheten falsch zu zitieren) großen Knall oder mit einem langandauernden Winseln, auf jeden Fall mit aller imperialistischen Brutalität – auch wieder zuwege, ihr kriegsmäßiges politökonomisches Gemeinschaftswerk mit dem ehernen Imperativ des guten Geldes und soliden Wachstums kollidieren zu lassen.
Etliche Spekulanten werden daran wieder viel Geld verdienen.
[1] Die Erinnerung an Krisenphänomene, die die US-Ökonomie seit mindestens einem Jahr beherrschen, ist mit dem Begriff der kapitalistischen Krise nicht zu verwechseln. Dazu ist GegenStandpunkt 4-92, S.121 sowie der Artikel zur Krise in GegenStandpunkt 4-92, S.83 zu konsultieren.
[2] Auch diese Bemerkungen möchten bitte nicht als Erklärung der ersten kapitalistischen Weltwirtschaftskrise des neuen Jahrhunderts genommen werden. Dafür vertrösten wir unsere Leser auf die nächste Nummer.
[3] Alles Wissenswerte über den Wahnwitz dieses Geschäftszweigs und seine Schönheiten teilt der Artikel „Neues von der ‚New Economy‘: Von Nutzen und Nachteil der Spekulation auf den totalen Markt“ in GegenStandpunkt 1-01, S.121 mit.
[4] Anekdoten dieser Art kennt die europäische Wirtschaftspresse haufenweise und unterhält damit gerne ihre Leser, seit der gute Ruf der amerikanischen „New Economy“ im Eimer ist. Quelle in dem Fall: das Handelsblatt vom 3./4. Mai des Jahres.
[5] Für die wissen sie dann auch immer gleich ein Rezept, nämlich genau das Gegenteil dessen, das sie bei sich anwenden: In Staaten wie Argentinien oder Brasilien, deren nationaler Kredit wacklig geworden oder ganz kaputt gegangen ist, sprechen rote Ziffern im nationalen Haushalt immer dafür, dass hier Staaten „über ihre Verhältnisse gelebt“ haben und nun „sparen“ müssen – auf wessen Kosten, ist auch klar. Die USA hingegen kennen gar keine „Verhältnisse“, über die sie leben könnten – es sind nämlich allemal ihre, von ihnen geschaffen und deshalb auch von ihnen frei benutzbar.
[6] Sehr passend deshalb auch die neuesten Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung, die die US-Regierung in Reaktion auf den Vorwurf der Opposition, sie würde wg. Terror die Ökonomie vernachlässigen, ergriffen hat. Im Rahmen des absurden Theaters eines ökonomischen „Forums“ unter Beteiligung aller Klassen und Schichten – angeblich wurde auch ein Müllmann eingeflogen – versprach Bush neuerliche Steuersenkungen, vor allem auf Aktienbesitz.
[7] Amerikanischen Zeitungsberichten zufolge leiden die Bilanzen der großen amerikanischen Stahlkonzerne vor allem unter der „Last“ von Pensionszahlungen an ehemalige Beschäftigte; die waren nämlich der „Preis“, den diese Unternehmen der Gewerkschaft für ihr Entgegenkommen bei den Rationalisierungs- und Entlassungsmaßnahmen der letzten 10 Jahre zu zahlen bereit waren. In der Tat: Das sind ja nun wirklich Bilanzposten, deren Nutzen für die Rentabilität der Unternehmen weit und breit nicht zu erkennen ist. Vielleicht liegen Firmen wie Enron mit der Ausgabe von „stock options“ als Pensionszahlungen ja doch eher richtig…
[8] Als besonders WTO-widrig, nämlich „wettbewerbsverzerrend“, wird die Absicht der US-Regierung inkriminiert, die qua Importzoll einkassierten Gelder direkt der Stahlindustrie als Subvention zugutekommen zu lassen – quasi als „Entschädigung“ für die Geschäftseinbußen, die sie durch die Importe schon erlitten haben.
[9] Der Begriff des „moral hazard“ will eben dies inkriminieren: Dass Unternehmen und Banken in unverantwortlicher Weise im Vertrauen auf die „Rettung“ durch den IWF längst zahlungsunfähigen Staaten Kredit gegeben hätten und dadurch der Nation und ihrem Kredit geschadet hätten. Damit soll jetzt Schluß sein.
[10] Die Demokraten im Kongress verstehen die Botschaft und schließen sich ihr an. Kleinliche Rechnereien verbieten sich, wenn die Nation im Krieg steht. Zum Beweis ihres guten Willens legen sie deshalb hier und dort noch etwas drauf; niemand soll sagen können, die Opposition habe in Sachen Terrorbekämpfung sich irgendwelche Pflichtversäumnisse zuschulden kommen lassen.
[11] Dieses Thema ist ausführlich abgehandelt in dem Aufsatz „Der Staatshaushalt. Von der Ökonomie der politischen Herrschaft“ in GegenStandpunkt 4-97, S.191.
[12] Es soll ja mal ‚gute Menschen von links‘ gegeben haben, denen der Rüstungsetat als eine einzige gewaltige Schranke für die gemeinnützigen Posten im übrigen Staatshaushalt vorgekommen ist, und außerdem volkswirtschaftlich als eine einzige gewaltige Verschwendung marktwirtschaftlicher Produktivkraft. Sie haben sich getäuscht: in Sinn und Zweck eines Staatshaushalts – dessen Mittel finanzieren in allen ihren Abteilungen die Durchsetzung, nicht die Gemütlichkeit kapitalistischer Daseinsbedingungen der Gesellschaft – wie in der Frage, was im Kapitalismus alles zu den Produktivkräften zählt – Gewaltmittel jedenfalls allemal, was denn sonst in einem derart produktiven gesellschaftlichen Gewaltverhältnis. Dass mittlerweile alle Welt die Unerlässlichkeit gigantischer Gewaltmittel für ein respektables Gemeinwesen eingesehen hat, ist freilich kein Fortschritt.
[13] Die Freunde des Menschenrechts sind zufrieden: Endlich finden sie sich ins Recht gesetzt – und wollen gar nicht wissen, warum.
[14] Im Kampf der europäischen Häfen um Frachtanteile ist das neue Container-Sicherheitsprogramm der USA ein wichtiger Wettbewerbsvorteil. Schiffe, die bereits im Heimathafen überprüft wurden, werden an den amerikanischen Zielorten bevorzugt abgefertigt. Alle übrigen Frachter hingegen müssen zeitaufwändige Zollkontrollen durchlaufen, bevor die Ware gelöscht werden darf. Die EU-Kommission fürchtet daher, dass die einzelstaatlichen Abkommen mit den USA zu Wettbewerbsverzerrungen zwischen den europäischen Häfen führen.
(Handelsblatt, 30.8.)
[15] Ungeachtet kritischer US-Töne unterzeichnet die Bundesregierung ein Investitionsschutzabkommen mit Teheran und fördert die deutsche Beteiligung an einer Messe in Bagdad.
Moskau und Bagdad bauen Kontakte aus.
(Handelsblatt, 19.8.) Und so weiter.
[16] Von den immanenten Wirkungen der kapitalistischen Krise, in der die Weltwirtschaft mal wieder steckt, wird dieser Effekt wohl nie mehr zu unterscheiden sein. Aber wozu sollte ein solches Auseinanderdividieren auch gut sein, wenn die Geldbesitzer und -manager selber beim Spekulieren nichts auseinanderhalten. Zu den Dingen, die die Spekulantenwelt bei ihren existenziellen Entscheidungen über den Gebrauch des kapitalistischen Vermögens, über das sie disponiert, nicht auseinanderhält, gehört jedenfalls seit etlichen Monaten die Tatsache, dass das von Washington auf die Tagesordnung gesetzte globale Kriegsszenario Sicherheiten des Spekulierens beseitigt.
[17] Deswegen finden sich auch wieder die unvermeidlichen Moralisten, die sich vor und nach und, wenn man sie lässt, sogar mitten im Krieg heftig über Kriegsopfer und zweckentfremdete Produktivkräfte empören und damit doch bloß den Einwand loswerden wollen, den sie für den realistischsten und deswegen schlagendsten halten: dass Krieg sich marktwirtschaftlich nie und nimmer auszahlen könne.