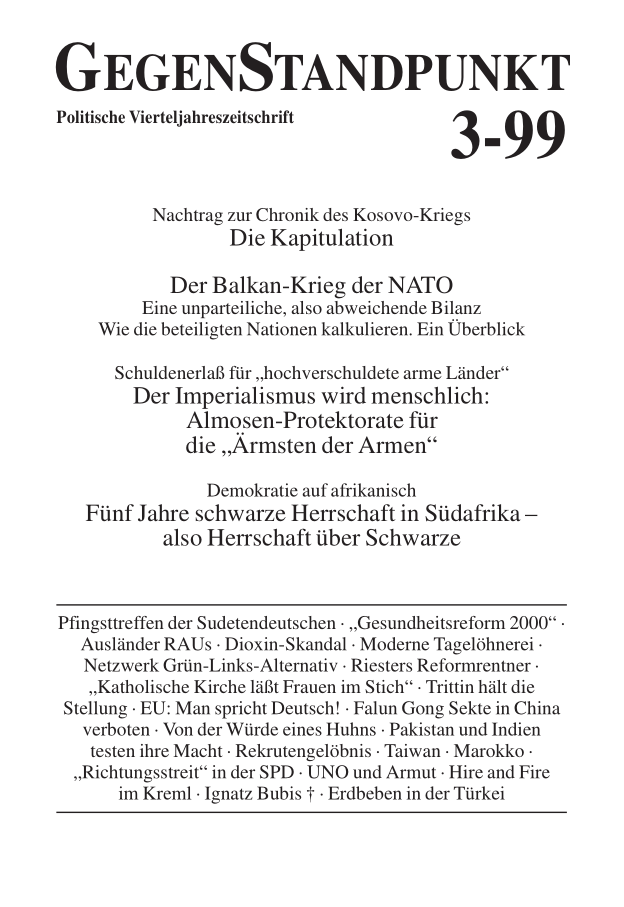Wie die am Balkan-Krieg der NATO beteiligten Nationen kalkulieren:
Die USA: Führungsrolle bewiesen – alle Fronten neu eröffnet
Clinton befindet, dass sich der Krieg für die USA gelohnt hat: die Selbstbehauptung der USA als Weltmacht ist gelungen, alles ist so gelaufen wie die amerikanische Führung und die Militärs es wollten. Zweifel gibt es im Volk, in der Öffentlichkeit und bei der Opposition hinsichtlich dessen, ob nicht neue Gefährdungen amerikanischer Sicherheit entstanden seien. Deshalb ergeben sich Folgeaufträge. Es muss an allen Fronten klargestellt werden, dass die neue Ordnung auf dem Balkan eine amerikanische ist. Das serbische Volk muss einsehen, dass sein Führer ein Verbrecher ist, der ausgeliefert werden muss. Den anderen am Krieg beteiligten Parteien, Verbündeten ebenso wie Russland und China wird mitgeteilt, dass sie sich amerikanischen ‚Ordnungsvorstellungen‘ unterzuordnen haben.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Siehe auch
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
- Selbstlob für einen epochalen Sieg
- Anspruchsvolle Zweifel am Glanz des Sieges
- Folgeaufträge
Wie die am Balkan-Krieg der NATO beteiligten Nationen kalkulieren:
Die USA: Führungsrolle bewiesen – alle Fronten neu eröffnet
Selbstlob für einen epochalen Sieg
Anläßlich des vorläufigen Stopps der NATO-Bombardierung am 10. Juni unterbreitet der Präsident der USA seinem Volk eine erste Erfolgsbilanz des Krieges. Die frohe Botschaft lautet, „daß wir einen Sieg für eine sicherere Welt, für unsere demokratischen Werte und für ein stärkeres Amerika erreicht haben.“ Der Auftrag an
„unseren bewaffneten Kräfte“, „dem Volk der Kosovaren… die Rückkehr in ihre Heimat zu ermöglichen und ihnen zu Sicherheit und Autonomie zu verhelfen; die serbischen Militärkräfte… zum Verlassen des Kosovo zu zwingen; und eine internationale Sicherheitstruppe mit der NATO als Kern zu stationieren, um alle Völker dieses gequälten Landes, Serben und Albaner gleichermaßen, zu beschützen,“
diente, so der Präsident, dem hohen Ziel der Selbstbehauptung der USA als Weltmacht. Darum muss es schon gehen, wenn die USA es für nötig befinden, ihre Bomber losfliegen zu lassen. Als moralische Ehrentitel für den Krieg dürfen geschundene Menschen vor Ort allemal herhalten, als Kriegsgrund reichen sie keineswegs aus – da ist sich der Präsident mit seinen „fellow americans“ einig.[1] Schließlich ist das moralische Recht der Amis, überall auf der Welt nach dem Rechten zu sehen, ebenso über jeden Zweifel erhaben wie die dazu passende militärische Potenz. Also verlangt das nationale Selbstbewußtsein nach Beweisen dafür, daß im speziellen Fall Kosovo Moral und Militär am rechten Ort, weil im übergeordneten nationalen Interesse zum Einsatz kamen; und der Präsident kommt seiner nationalen Pflicht nach, solche Beweise zu liefern.
Der Krieg, so Clinton, hat sich im weltpolitischen Maßstab für die USA gelohnt – weil in ihm alles so gelaufen ist, wie die amerikanische Führung und ihre Militärs es wollten:
„Die NATO hat diesen Erfolg als geschlossene Allianz erreicht… Neunzehn Demokratien kamen zusammen und blieben zusammen in der größten militärischen Herausforderung in der 50jährigen Geschichte der NATO. Wir haben ebenfalls unsere entscheidend wichtige Beziehung zu Rußland bewahren können, das unser militärisches Engagement ablehnte, aber die Diplomatie zur Beendigung des Konfliktes nach unseren Bedingungen unterstützte… Und schließlich haben wir die Ausweitung des Krieges verhindert, welche dieser Konflikt sehr wohl hätte auslösen können. Die Staaten Südosteuropas unterstützten die NATO-Kampagne… Dieser Sieg macht es wahrscheinlicher, daß sie eine Zukunft der Demokratie, des Minderheitenschutzes und des Friedens wählen werden.“
Alles, was im Krieg so passiert ist, war amerikanisches Werk: Die USA haben dafür gesorgt, daß die NATO zusammenhielt; sie haben die Russen bei der Stange gehalten, sie haben die südosteuropäischen Staaten für das NATO-Kriegsprogramm gewonnen und ihnen damit den Weg gewiesen, sich nach amerikanischem Bilde zu formen. Egal, wie die am Krieg beteiligten oder von ihm betroffenen Nationen jeweils kalkuliert haben mögen, welche Vorteils- oder Schadensrechnungen wer angestellt haben mag, welche ökonomischen Schäden, welche politischen Verwerfungen der Krieg in dieser Weltgegend verursacht hat – daß sich alle Staaten in der Region und darüber hinaus ins amerikanischen Interesse eingeordnet haben, ist der entscheidende „Sieg“, der den Präsidenten zu der hochgemuten Mitteilung beflügelt, jetzt, nach der Niederringung von Milošević, sei die Welt „für Amerika sicherer“.
Diese hoffnungsfrohe Botschaft wird auch nicht durch die Folgeaufträge beeinträchtigt, die Clinton aus dem gelungenen Feldzug ableitet. Diese bestätigen den Kriegserfolg nur – wenn man sie denn so liest, daß die USA jetzt endlich freie Hand haben, um im Kosovo „Ordnung“ zu schaffen, eine zivile Verwaltung aufzubauen, den Demokratien Südosteuropas den Weg zu „einer gemeinsamen Zukunft im Wohlstand“ aufzuzeigen… Das kostet natürlich. Aber auch in seiner Rolle als Steuerzahler darf der amerikanische Bürger beruhigt sein: Erstens paßt der Präsident schon auf die richtige Lastenverteilung auf, und zweitens ist das Geld gut angelegt – für „amerikanische Interessen“: Unsere europäischen Partner müssen die meisten Ressourcen für diese Anstrengung bereitstellen, aber es ist im amerikanischen Interesse, auch unseren Teil dazu beizutragen
.
So gibt, alles im allem, der Ausgang des Krieges nur Anlass zur Genugtuung:
„All diese Herausforderungen sind erheblich, aber sie sind der Herausforderung des Krieges und weiterer Instabilität in Europa bei weitem vorzuziehen. Wir haben eine Botschaft der Entschlossenheit und Hoffnung an alle Völker der Welt geschickt. Wegen unserer Entschlossenheit endet das 20. Jahrhundert nicht mit machtloser Empörung, sondern mit einer hoffnungsvollen Bekräftigung menschlicher Würde und menschlicher Rechte für das 21. Jahrhundert… Amerika sieht sich noch mit großen Herausforderungen auf dieser Welt konfrontiert, aber wir werden sie mit Freuden annehmen.“
Soweit die Erfolgsbilanz des Präsidenten. Was die USA sich vornehmen, das schaffen sie auch; Kosten und Risiken haben sie im Griff, dem großen Ziel einer amerikagemäßen Welt sind wir alle durch diesen Krieg ein Stück nähergekommen. Das kann jedem Amerikaner Anlass zu Stolz und Freude sein.
Anspruchsvolle Zweifel am Glanz des Sieges
Ist es aber nicht – oder jedenfalls nicht so ohne weiteres.
- Das Wahlvolk jedenfalls ist von Anfang an für diesen Krieg gar nicht recht zu begeistern. Das nationalistische Gemüt des Volkes fühlt sich von der Kriegsentschlossenheit des Präsidenten viel weniger angesprochen als von der Standhaftigkeit, mit der Clinton noch ein paar Wochen vorher allen Anfeindungen seiner Impeachment-Gegner widerstanden hat. Der Durchschnittsami beherrscht nämlich die Lehre vom übergeordneten nationalen Interesse, das einen Krieg rechtfertigen muss, vor allem in ihrer moralisch bornierten Fassung, die besagt, daß in aller Regel die Völkchen in entfernten Erdteilen soviel amerikanische Zuwendung gar nicht verdienen, wie sie ihnen mit dem Einsatz der prachtvollen Jungs von Luftwaffe und Armee zuteil wird. Sollen sie sich doch die Köpfe einschlagen, die Verbrecher…
- So borniert will sich die amerikanische Öffentlichkeit nicht geben. Sie steht selbstverständlich voll hinter dem Auftrag der Nation, überall auf der Welt „wegen der Menschenrechte“ nach dem Rechten zu sehen. Eben deshalb will sie der Regierung die Prüfung nicht ersparen, ob das in diesem Fall auch wirklich sein mußte, ob es „genützt“ hat: „Den Menschen“, der Ordnung vor Ort, dem globalen Gleichgewicht, den USA… Gegenüber der von der Regierung behaupteten Notwendigkeit, im Dienste „amerikanischer Werte und Interessen“ auf die „Herausforderung“ namens „Kosovo“ reagieren zu müssen, gestattet sich die Öffentlichkeit zu fragen, ob der Einsatz der militärischen Gewalt auch wirklich dem amerikanischen Weltordnungsauftrag angemessen ist, also das Verhältnis von Aufwand und nationalem Ertrag auch stimmt – wie immer der jeweilige Gutachter Amerikas Auftragslage definieren mag.
- In die gleiche Kerbe haut die parlamentarische Opposition quer durch beide Parteien: Die Kongressmehrheit läßt es sich zu Kriegsbeginn nicht nehmen, Clinton die Billigung des Krieges zu versagen und gleichzeitig eine Zuweisung von zusätzlichen Geldmitteln ans Militär zu beschließen, die ein paar Mrd. $ höher liegt als von der Regierung beantragt. So will sie der Regierungsmannschaft die Lehre erteilen, daß sie sich wegen unverantwortlicher Kürzungen in den Militärbudgets vergangener Jahre einen solchen Krieg eigentlich gar nicht leisten könne, ohne die globale strategische Präsenz der USA zu gefährden.[2] Demselben Beweiszweck dient der Einfall der Opposition, vor der Genehmigung der Gelder für die amerikanische Beteiligung am KFOR-Einsatz von Clinton eine schriftliche Garantie zu verlangen, daß dieser Einsatz „ohne Beeinträchtigung der militärischen Bereitschaft der USA“ erfüllt werden könne – erst dann findet sie sich bereit, die dafür nötige Finanzierung über den 30.9. hinaus bereitzustellen.
Die Kapitulation des Feindes stellt die Kritiker keineswegs zufrieden. Die Opposition liest die Erfolgsbilanz des Präsidenten einfach umgekehrt: In ihren Augen bleibt nach dem Krieg auf dem Balkan noch so viel zu tun, noch nichts ist richtig „erledigt“ – und daran ist selbstverständlich der Präsident schuld, der den Krieg – ganz im Gegensatz zur Behauptung der Regierung – nicht mit angemessener amerikanischer Entschlossenheit geführt hat, sondern unentschieden und im Geiste schwächlicher Zweifel. Wer weiß: Vielleicht wäre er sogar überflüssig gewesen, wenn der Präsident vorher eindrucksvoller gedroht hätte… Und überhaupt: Ohne den Kriegsbeschluß gegen Serbien wären die „Nebenprobleme“ eines Zusammenhalts der NATO, einer Verärgerung der Russen und eines „Hineinziehens“ von Südosteuropa gar nicht aufgekommen – also steht die Frage im Raum, ob mit dem Krieg nicht im Gegenteil lauter neue Gefährdungen amerikanischer „Sicherheit“ auf die Tagesordnung gesetzt seien; bis hin zu der Gefahr, daß durch den Einsatz im Kosovo die Einsatzfähigkeit des militärischen Apparats überhaupt in Mitleidenschaft gezogen sein könnte – so daß dem Präsidenten der Vorwurf nicht erspart bleibt, leichtfertig mit amerikanischen Machtmitteln umgegangen zu sein.
Diese Debatte ist einerseits äußerst luxuriös: Sie wird nämlich von der festen Überzeugung her geführt, daß es bloß eine Frage amerikanischer Entschlossenheit ist, ob die Welt nach der amerikanischen Pfeife tanzt oder nicht. Daß es wirklich am Entschluß der Supermacht liegt, einen „lokalen Konflikt“ als Bestreitung ihrer weltpolitischen Interessen zu definieren und vor Ort entsprechend zuzulangen, überhöhen amerikanische Nationalisten in den Anspruch an ihre Führung, sie habe die Garantie dafür abzugeben, daß die „Fälle“, in denen sie sich zum Krieg entschließt, für „das amerikanische Interesse“ auch eindeutig und unbestreitbar notwendig sind, weil amerikanische Suprematie anders nicht zu haben sei. Die Regierung Clinton mag für die Entscheidung, den Kosovo zu einem Fall amerikanischer Weltordnung zu erklären, ihre guten Gründe haben; den Beweis, daß „die amerikanische Weltordnung“ gerade dort und mit den gewählten Mitteln verteidigt werden muss, muss sie selbstverständlich schuldig bleiben. Selbst wenn sie einen Feldzug gewinnt: Am Maßstab der uneingeschränkten Gültigkeit amerikanischer Macht ist jeder Sieg ein „bloß“, jeder Erfolg ein „erst“…
Die nationale Debatte bezeugt also vor allem das Anspruchsniveau, von dem her die USA ihre Feldzüge praktisch kalkulieren und deren Erfolg beurteilen. Die USA haben sich entschlossen, am Kosovo den Test auf ihre Durchsetzungsfähigkeit als übergeordnete, den Verkehr der Staatenwelt regelnde und bestimmende Macht durchzuziehen; und die amtierende Regierung wäre die letzte, die nicht wüßte, daß die neu bewiesene Selbstbehauptung der USA als Ordnungs- und Führungsmacht nur Bestand hat, wenn sie gesichert wird. Nichts anderes sagt Clinton, wenn er seine Erfolgsbilanz zugleich als neue Auftragslage verkündet, die die USA zu bewältigen haben. Wenn die USA sich entscheiden, zuzuschlagen, dann ist eben die Bewährung im Krieg eine Bewährungsprobe in diesem anspruchsvollen Sinn. Und wenn der Sieg über Milošević, die Sicherstellung der Gefolgschaft der Partner und die Ein- und Unterordnung der Russen das Produkt amerikanischer Entschlossenheit waren, dann ist diese Entschlossenheit auch weiterhin nötig, um die erreichte Klärung der Kräfteverhältnisse zu sichern und auszubauen. Dann muss eben auch an allen Fronten, die im Krieg aufgemacht wurden, der Beweis gelingen, daß der Krieg „Amerika“ vorangebracht und nicht seinen Interessen geschadet hat. Es gibt also viel zu tun.
Folgeaufträge
1. Bewährung als oberste Aufsichtsmacht auf dem Balkan
„Die USA werden fortfahren, eine äußerst wichtige Rolle in Südosteuropa und insbesondere auf dem Balkan zu spielen… Wir haben bisher eine führende, vielleicht die führende Rolle gespielt… Wir haben die EU stark unterstützt, eine sehr wichtige Rolle zu spielen, und wir sind dankbar, daß die EU nun die Führung bei der Etablierung des Stabilitätspakts und bei der Bereitstellung von Aufbauhilfe für den Kosovo übernimmt. Aber es sollte keinen Zweifel bei irgend jemandem geben, daß die USA fortfahren werden, einer der führenden Staaten nicht nur auf dem Balken, sondern, selbstverständlich, auf der ganzen Welt zu sein.“ (Balkan-Sonderbotschafter Gelbard, Interview in WorldNet, 9.7.)
Soweit die erste Lehre aus dem Krieg gegen Serbien: Nichts vor Ort anderen Mächten und Interessen überlassen; an allen Fronten klarstellen, daß die Ordnung, die dort unten etabliert wird, eine amerikanische ist. Einerseits haben die USA so ihre Pläne und Vorstellungen, die neu zu erringende „Stabilität“ im Kosovo und in der Region betreffend; wenn diese sich mit denen der EU oder der Völkerschaften vor Ort nicht decken, dann müssen sie eben dahin gebracht werden, sich amerikanischen Interessen zu beugen. Andererseits und ganz unabhängig von allen real existierenden Differenzen beharren die USA immerzu auf der selbstverständlichen Prämisse, daß alles, was auf dem Balkan passiert, am besten auf amerikanischen Wunsch, auf jeden Fall aber mit ihrer Genehmigung und letztendlicher Billigung zu erfolgen hat. Anders ausgedrückt: Wenn die USA sich eine Auftragslage definieren, dann verstehen sie darunter, daß andere ihre Aufträge zu erfüllen haben. Das heißt „leading role“; so schlicht denkt eine Supermacht.
*
Mit einer Rundreise durch den Balkan im Anschluß an das G7-Treffen in Köln demonstriert der US-Präsident diesen Anspruch praktisch. Seine erste Botschaft an die Völker vor Ort heißt: Schluß mit Mord und Totschlag; jetzt paßt die NATO darauf auf, daß zwischen den Volksgruppen Einvernehmen herrscht. Um diese Botschaft loszuwerden, fährt der Präsident extra nach Slowenien. Das Ländchen hat zwar mit dem Krieg im Kosovo eigentlich wenig zu tun, dafür hat es aber vom Standpunkt amerikanischer Politstrategen zwei unschätzbare Vorzüge: Erstens liegt es auf dem Balkan; zweitens ist es der einzige Nachfolgestaat des alten Jugoslawien, in dem „Demokratie und Marktwirtschaft“ zur Zufriedenheit der Aufsichtsmächte funktionieren. Also beweist es erstens, daß selbst Balkanesen eine rechte Ordnung hinbekommen können; woran man zweitens sehen kann, daß die letztlich nur eine Frage des guten Willens, also der rechten Einstellung ist. Für diesen guten Willen und ihre „beachtlichen Aufbauleistungen“ dürfen sich slowenische Politiker loben und als leuchtendes Vorbild für die ganze Region feiern lassen. An Slowenien ergeht das höchste Kompliment, das sich ein amerikanischer Politiker überhaupt vorstellen kann: „Sie sind ein ausgezeichneter Kandidat für die NATO“. (Clinton laut International Herald Tribune, 22. 6.) Damit ist der Zweck des Clinton-Auftritts erledigt.
So einfach ist das. Die Amerikaner haben die Prinzipien menschengerechten Zusammenlebens auf der Welt erfunden; wenn die Völker der Erde sich nach diesen richten, passen sie in ihre Völkergemeinschaft, und dann herrscht Frieden. Das ist nicht bloß ein albernes Weltbild, sondern die passende ideologische Fassung für den unbedingten Anspruch auf genehmes Regieren in jeder Weltgegend – also amerikanische Staatsräson. Die USA beziehen alles, was Staaten und Völker so treiben, darauf, ob es ihnen paßt; also interpretieren sie auch alle Interessen und Anliegen, die sie auf dem Balkan und anderswo vorfinden, als Übereinstimmung mit oder Verstoß gegen ihre Interessen und Werte. Egal, was sich ein Serbe, ein UCKler, ein Albaner, was sich Regierende und Regierte so vornehmen – immer stellen sich die USA die Frage: Sind die jetzt für uns oder gegen uns? Je nach Antwort sortieren sich die Menschen: in verhetzte Nationalisten oder gute Menschen, die sich nach nichts anderem sehnen als nach freedom and democracy. Aufgabe der freiheitsliebenden Weltmacht ist es, dem guten Kern der Menschennatur mit geeigneten Mitteln auf die Sprünge zu helfen. Das ist sie nicht nur den Völkern vor Ort, sondern vor allem sich schuldig.
*
Deswegen findet ein Präsident der Vereinigten Staaten auch nichts dabei, den Insassen eines Flüchtlingslagers vor allem eines mit auf den Heimweg zu geben: die Mahnung, „ihre Rachegelüste gegen Serben zu zügeln“ (Clinton, Neue Zürcher Zeitung, 23.6.). Dieselbe Gesinnung, die im Krieg als „albanischer Widerstand“ der UCK hochwillkommen war, paßt eben nicht mehr, seit der Krieg vorbei ist und die NATO das Kommando hat. Die ist jetzt für die Verfolgung serbischer Missetäter zuständig; „ethnischer Hass“ ist nur in seiner amtlichen Fassung gestattet, als Bekämpfung und Beseitigung serbischer Vergehen gegen das Recht der Protektoratsmächte; also in deren Auftrag. Dann allerdings ist das Aufspüren und Einsperren serbischer „Kriegsverbrecher“ nicht nur ein Dienst am Recht, sondern zugleich einer an den Menschen vor Ort, die einen Anspruch auf Bestrafung ihrer Verfolger haben. Das ist aus der Sicht eines politisch denkenden Amerikaners überhaupt das Allerwichtigste, was Völker brauchen, noch vor einem Dach über dem Kopf und sauberem Trinkwasser: eine verbrecherfreie Umwelt, in der sie sich „sicher fühlen“ können. Also machen sich die US-Instanzen höchstselbst an die Verbrecherjagd. Sie verfügen über eine nationale Ermittlertruppe, die im Aufspüren und Fertigmachen von Mafiabossen und Drogenhändlern Erfahrung hat: den FBI. Der darf sich jetzt im Kosovo, als wäre er in New York oder Chicago, einer neuen Aufgabe widmen: der „Beweissicherung“ zwecks Untersuchung und Aufklärung von Kriegsverbrechen.
Der Oberverbrecher ist natürlich, da ist sich die NATO einig, Milošević. Der ist allerdings immer noch jugoslawischer Regierungschef, weswegen seine Ergreifung und Bestrafung nicht so einfach zu haben sind. Die USA gehen auch hier mit gutem Beispiel voran. Der Präsident beauftragt den CIA, das Belgrader Regime zu „unterminieren“; u.a. ist vorgesehen, in die Auslandskonten von Milošević bzw. der serbischen Regierung – auf den Unterschied kommt es dann auch nicht mehr an – einzubrechen, um deren Geld zu konfiszieren. Verbrecher haben ihr Recht auf Eigentum verwirkt; also gebietet das amerikanische Strafgesetzbuch hier entsprechenden Vollzug. Darüber hinaus setzen die USA eine Belohnung von 5 Mio. $ aus für Informationen, die zur Gefangennahme von gesuchten Kriegsverbrechern führen, einschließlich Milošević. Die USA haben keine Zweifel, daß rechtstreue serbische Bürger dieses Angebot überzeugend finden. Daß brave serbische Nationalisten ihren Staatschef in Ehren und ihre Soldaten für anständige Menschen halten könnten, die nur ihre Pflicht tun, also eine solches Angebot als Aufforderung zum Vaterlandsverrat empfinden könnten, kommt den Amerikanern gar nicht in den Sinn. Wenn sie einen Staatsführer als Verbrecher definiert haben, dann versteht es sich für sie von selbst, daß der Rest der Welt das genauso sehen muss – wenn nicht, handelt es sich um verbohrte, verhetzte Menschen, denen erst noch zur wahren Einsicht verholfen werden muss.
Von denen gibt es leider und unverständlicherweise in Serbien immer noch ziemlich viele. Aber es gibt auch Kräfte vor Ort, die Front gegen Milošević machen. Eine serbische Opposition macht dem „Diktator“ und „Kriegstreiber“ die politische Führung des Landes streitig. Allerdings ist diese Opposition nicht so ganz nach amerikanischem Geschmack; sie will nämlich die Macht in Serbien und muss sich schon deshalb den Verdacht gefallen lassen, auch bloß aus serbischen Nationalisten zu bestehen:
„Ein Regierungsvertreter sagte, daß man Vuk Draskovic als „Opportunisten“ abgeschrieben habe… Zoran Djindjic wird ebenfalls nicht von Washington favorisiert… Regierungsvertreter sagen, daß Djindjic die Unterstützung und die Führungsqualitäten fehlen, die nötig sind, um die Bewegung gegen Milosevic vorwärtszubringen. Bei dem Versuch, eine Opposition gegen Milosevic zu fördern, steht die Regierung schweren Hürden gegenüber; manche davon gründen in der Tatsache, daß sie gerade Krieg gegen ihn geführt hat. … Die USA haben keine Botschaft in Belgrad, und außerdem steht das Volk zu großen Teilen immer noch hinter ihm.“ (International Herald Tribune, 13.7.)
Einerseits soll der neue Führer eine bedeutsame Anhängerschaft haben, also eine Erfolgsperspektive vorweisen können, damit die US-Regierung auf ihn setzt. Einfach oktroyieren will und kann sie den erwünschten „gewendeten“ Führer nicht, obwohl das natürlich das Beste wäre. Andererseits folgt das Volk nur solchen Führern, die sich der Sache Serbiens verschrieben haben; also ist wiederum Mißtrauen gegen jeden geboten, dem das Volk hinterherläuft. So bleibt als beste Strategie, die Serben zu ihrem Glück zu zwingen, eben doch, sie auszuhungern. Dann merken sie nämlich, daß „die serbische Sache“ am besten in den Händen von NATO-freundlichen Politikern aufgehoben ist:
„Der US-Senat hat 535 Millionen $ Finanzhilfe für den Kosovo sowie mehrere Balkanstaaten bewilligt… Die jugoslawische Teilrepublik Serbien wird in dem Gesetzestext als terroristischer Staat bezeichnet und erhält keine Gelder. US-Präsident Clinton hatte bereits vor der Abstimmung sein Veto angedroht. Die Bezeichnung Serbiens als terroristischen Staat könne auch die Länder von US-Hilfen abschneiden, die lediglich humanitäre Hilfe an Serbien lieferten, erklärte die US-Regierung.“ (SZ, 2.7.)
In der Sache sind sich Regierung und Opposition einig; die Regierung hat es nur nicht gerne, wenn der Kongress ihren diplomatischen Spielraum zu sehr einengt. Auf der G7-Tagung setzen die USA eine möglichst enge Definition dessen durch, was als „humanitäre Hilfe“ zu gelten habe. Kleinlich wird gefeilscht, ob Elektrizität für Krankenhäuser noch dazugerechnet werden könne; Hilfe zum Wiederaufbau der Brücken kommt aus amerikanischer Sicht nicht in Frage: „Das ist Teil von deren ökonomischem Wiederaufbau, und da zahlen wir keinen Pfennig“ (Clinton, International Herald Tribune, 22.6.)
Die Serben haben die Wahl: Entweder, sie werden ihren Präsidenten los; oder sie disqualifizieren sich als Volk eines „Schurkenstaates“ und werden von jeder Lebensperspektive abgeschnitten. Das, so findet ein US-Politiker, ist nur „common sense“:
„Ich kenne das serbische Volk und ich weiß, daß es über gesunden Menschenverstand verfügt. Wir wollen es unterstützen… aber wir können das nur, wenn es eine demokratische Regierung gibt, und wenn die Regierung von jemandem geführt wird, der nicht ein gesuchter Kriegsverbrecher ist. Ich habe also großes Vertrauen in das serbische Volk, in dessen Urteilsfähigkeit, darin, daß es auf einem positiven Weg vorankommen will.“ (Gelbard, ebd.)
*
Die zweite Hälfte des Auftrags namens „Ordnung im Kosovo“ betrifft die Rolle, die Freunde und Verbündete vor Ort zu spielen haben. Da gibt es zum einen die UCK, zum anderen die Regierung Montenegros. Beide waren brauchbare Hebel, um Milošević kleinzukriegen und seine Macht zu untergraben; das heißt noch lange nicht, daß deren Vorstellungen von einem zukünftigen Jugoslawien und ihrer Rolle darin maßgeblich wären.
Was die UCK betrifft, so fühlen sich die USA diesen selbsternannten Bodentruppen der NATO durchaus zu Dank und Entgegenkommen verpflichtet – wenn sie sich in die neue Ordnung im Kosovo einfügen. Ihre Waffen müssen sie abgeben; gleichzeitig stellt die US-Außenministerin den UCK-Kombattanten in Aussicht, sich später im Auftrag der NATO als „provisorische Armee“ neu formieren zu dürfen, „nach dem Modell der US Nationalgarde“ (International Herald Tribune, 22.6.) – selbstverständlich nach gehöriger „psychologischer Überprüfung“ hinsichtlich der Frage, ob sie ihre neue Aufgabe nicht etwa als Lizenz zur Serbenjagd mißverstehen. Deutsche Einwände gegen diese Zusage räumt Albright mit der entwaffnenden Auskunft aus, „daß man sonst die Zusage der UCK zur Entwaffnung nicht bekommen hätte.“ (ebd.). Auf der Suche nach möglichen Trägern einer künftigen Kosovo-internen Ordnungsgewalt hält die amerikanische Regierung die antiserbische Befreiungstruppe für eine durchaus brauchbare Kraft – sie muss sich nur nach den Dienstvorschriften aus Washington richten.
Auch im Umgang mit der Regierung Montenegros beweisen amerikanische Politiker viel Vertrauen in ihre manipulativen Fähigkeiten. Montenegrinische Politiker dürfen sich großer amerikanischer Zuwendung erfreuen; der Sonderbeauftragte feiert Montenegro als „leuchtende Fackel der Demokratie“; der Präsident wird im Weißen Haus empfangen; amerikanische Experten beraten die Provinz in Fragen der Rechtsreform und der Modernisierung der montenegrinischen Wirtschaft; alles unter dem unübersehbaren Gesichtspunkt, die dortige Führung gegen die Zentralregierung aufzuhetzen und deren Herrschaft zu untergraben. Zugleich läßt der Sonderbotschafter keine Zweifel aufkommen: „Wir unterstützen nicht die Idee eines unabhängigen Montenegro, ebensowenig wie wir die Idee eines unabhängigen Kosovo unterstützen.“ (Gelbard, ebd.)
Das mag für die Nationalisten vor Ort ein schwer auflösbarer Widerspruch sein; die müssen dann eben zusehen, wie sie damit zurechtkommen. Die USA jedenfalls haben ihr „Modell“, und das heißt: Grenzen werden nicht verändert; Staaten und Volksgruppen der Region sollen sich im Rahmen der gegebenen Grenzen aus- und zueinander sortieren; das ist die „Stabilität“, die die USA anbieten und über die sie wachen. Daß sie diese Aufgabe nicht ernst nehmen, kann man den USA beim besten Willen nicht vorwerfen; bis in die kleinsten Rechts- und Zuständigkeitsfragen stellen sie klar, wessen Gewalt gilt und wozu die Regierungen vor Ort allenfalls befugt sind. Dem Einsichtigen winkt als Lohn die Teilhabe an den Segnungen dieser amerikanischen Ordnung.
*
Mit einer dritten Reise schließlich stellt die US-Regierung den größeren Zusammenhang her, in den sie die Stabilität auf dem Balkan einordnet. Anfang Juli veranstaltet der Verteidigungsminister Cohen eine Rundreise durch die Staaten Dänemark, Norwegen, Ungarn, Albanien, Griechenland und Türkei. Auf dieser Reise sind vier Themen Gegenstand:
„Das weitere Vorgehen im Kosovo und bei der Südosteuropäischen Initiative[3]; Verbesserung der Fähigkeiten der NATO-Streitkräfte; Stärkung der Partnership for Peace; und Verbesserung des Verhältnisses zu Rußland.“ (Cohen-Interview am 8.7.)
Jedem dieser Staaten, ob NATO-Mitglied oder nicht, präsentiert der Verteidigungsminister u.a. eine amerikanische Wunschliste hinsichtlich dessen, was er sich an Militärgerät zuzulegen habe, um amerikanischen Vorstellungen bezüglich seiner Rolle in einer europäischen Gesamtverteidigung zu genügen. Wie so etwas aussieht, verdeutlicht Cohen am Beispiel von Albanien:
„Was wir den Albanern gesagt haben, und sie stimmten zu, ist, daß sie sich darauf konzentrieren sollten, ein relativ begrenztes Militär zu haben, weil sie ihr Geld in die Wirtschaft des Landes stecken müssen; sie sollen sich auf Grenzkontrolle konzentrieren und auf das Wegräumen von Minen, Geschossen etc…“
– also sich im Prinzip darauf einstellen, daß ihnen mehr als eine Polizeitruppe nicht zusteht, weil sie mit einer Armee doch nichts NATO-Förderliches anstellen könnten. Diese Reise ist keine Initiative des NATO-Bündnisses, mit der EU ist sie auch nicht abgesprochen. Die USA lassen keine Zeit verstreichen, um ihre ganz speziellen Vorstellungen davon an den Mann zu bringen, wie die europäischen Nationen – nicht nur, aber auch die entsprechenden Problemkandidaten – sich in das Gesamtkunstwerk einer europäischen „Sicherheitsarchitektur“ einzufügen haben; und da sehen sie die Sache so, daß die Frage der militärischen Einordnung eine entscheidende Weichenstellung darstellt. Das richtet sich auch an die Adresse Rußlands. Es „verbessert“ nämlich die Beziehungen zu diesem Land ungemein, wenn es vorgeführt bekommt, daß Südosteuropa fest in NATO-Hand ist und die beanspruchte exklusive Verfügungsgewalt jetzt ein für allemal institutionalisiert wird; dann weiß Rußland wenigstens, woran es ist. Den Europäern wiederum wird bedeutet, was ihr „Stabilitätspakt“ als Mittel, den Balkan zur europäischen Aufsichtssache zu machen, wert ist, wenn vorweg schon klargestellt ist, daß Südosteuropa seine politischen Direktiven nicht aus Brüssel, sondern aus Washington bekommt.[4]
2. Sicherstellung der Richtlinienkompetenz gegenüber den Verbündeten
Mit der Aufsicht über den Balkan wollen die USA ihre Führungsrolle in der NATO sichern und ausbauen. Zugleich bleibt der Balkan ein Feld, auf dem Ansprüche Rußlands zurückzuweisen und unterzuordnen sind. In beiden Hinsichten denken die USA über den Balkan hinaus daran, was aus dem Krieg für ihr Verhältnis zu den europäischen NATO-Partnern und Rußland überhaupt folgt.
Die Kosten des Krieges
Hierzulande wollten nationale Kriegskritiker im Krieg gegen Serbien eine Zwangsveranstaltung des amerikanischen „Hegemonismus“ gegen echt deutsche Interessen entdecken. In den USA stellen, spiegelbildlich dazu, maßgebliche Pressestimmen den Krieg als Feldzug der USA im Dienste der europäischen Verbündeten dar, um „Europa für die EU sicher zu machen“ (International Herald Tribune, 11.6.). Die US-Regierung sieht die Sache ähnlich: Erst hätten die Europäer den Streit mit Milošević diplomatisch hochgekocht, und dann hätten die USA dafür sorgen müssen, daß sie auch die Konsequenzen tragen:
„Der Showdown in Rambouillet, so sagte neulich ein Mitglied des Stabes von Ministerin Albright, hatte nur ein Ziel: Den Krieg in Gang zu bringen und dabei die Europäer bei der Stange zu halten.“ (ebd.)
Ob das nun so war oder nicht; das Leiden, das die USA an ihren europäischen NATO-Verbündeten plagt, ist genau so beschaffen. Als weniger potente, eben bloß Mitmacher der NATO gelten sie der Führungsmacht einerseits als (undankbare) Nutznießer ihrer überlegenen Militärmacht, andererseits als unzuverlässig und wankelmütig; so daß man, d.h. die USA im Ernstfall alle Hände voll zu tun haben, um sie auf einen konsequenten Kriegskurs zu verpflichten.[5] Diese Sichtweise ist insofern etwas heuchlerisch, als die USA gar nicht daran denken, sich des „Mißbrauchs“ ihrer Militärmacht durch „Europa“ etwa dadurch zu entziehen, daß sie den Europäern das Ordnen „ihres“ Kontinents allein überließen – dazu ist „Europa“ militärisch wie ökonomisch denn doch zu mächtig, also für die USA zu wichtig. Ihr Schluß aus allen diesbezüglichen Anstrengungen der EU ist allemal, sich erst recht einzumischen und die EU dazu zu bewegen, das Ordnen in ihrem, der USA Sinne vorzunehmen – wie in diesem Krieg geschehen.
Kaum ist der vorbei, geht der Streit um Kosten, Nutzen, Risiken und Lasten los. In der Frage der Kosten, welche die noch herzustellende Ordnung auf dem Balkan mit sich bringt, ist die Position der USA eindeutig: Sie haben die „Lasten des Krieges“ getragen, also sind jetzt zunächst einmal die Europäer an der Reihe. Die Amerikaner rechnen ihren Verbündeten den Dollarpreis für verschossene cruise missiles und anderes Gerät als Aufwand vor, den die USA für einen gemeinsamen Zweck aufgebracht hätten, weshalb nun die andere Seite am Zug ist: „Burden sharing“ nennen das die USA. Gerade weil beim Führen des Krieges kein Aufwand gescheut wird, muss hinterher haarklein nachgerechnet werden, ob andere Nationen nicht aus ihm ungerechtfertigte politische oder ökonomische Vorteile ziehen:
„Während die militärischen Lasten des Kosovo-Konflikts bisher in großem Umfang von den Vereinigten Staaten getragen wurden, …wird der Wiederaufbau Jugoslawiens eine vorwiegend europäische Aufgabe sein… Außer auf die hohen Ausgaben für den militärischen Einsatz verweisen die USA auch darauf, daß ihre Wirtschaft vom Wiederaufbau weniger stark profitiert als europäische Unternehmen, an die Gelder in Form von Aufträgen zum Teil zurückfließen dürften.“ (SZ, 11.6.)
Letzteres ist eher ein nachgeschobenes Argument. In Wahrheit entdecken weder die USA noch Europa in dem Trümmerfeld Südosteuropa die Perspektive einer lohnenden Anlagesphäre, weshalb beide Seiten Ausgaben für Bomben wie Brücken gleich behandeln: Nicht als „Zukunftsinvestition“, sondern als Belastung des nationalen Haushalts. Da steht diesseits wie jenseits des Atlantik fest: Der Haushalt verträgt nicht mehr allzuviel „Zusatzaufgaben“. Erstens war das Zerstörungswerk schon teuer genug; zweitens steht in der Waffenfrage noch einiges an.
Europäische Aufrüstung, transatlantisch betrachtet
Das ist nämlich die zweite Abteilung „Folgekosten“, die die USA aufmachen. Angesichts des Aufwands für den Krieg gegen Milošević wirft man in Washington die Frage auf, wie es denn die Europäer überhaupt künftig mit ihrem Beitrag zur NATO-Rüstung halten wollen. So ein Zufall: Just in dem Moment, da europäische Politiker ihren Rückstand in Militärfragen beklagen und ernsthaft Schritte beschließen, um den Abstand zur USA ein wenig zu verringern, ergeht seitens der USA die Klage darüber, die Europäer täten zuwenig für ihre Verteidigung:
„Die Europäer geben im Durchschnitt weniger als Zweidrittel soviel wie die USA für Verteidigung aus, gemessen am BSP… Damit sich das ändert, damit die Europäer sich aus ihrer Abhängigkeit von den USA befreien, müssen sie ihre Verteidigungsausgaben um mindestens 50% erhöhen und ihre Rüstungsindustrien zusammentun… Aber es ist unwahrscheinlich, daß dies passiert. Die Europäer haben sich daran gewöhnt, wenig für Verteidigung auszugeben.“ (International Herald Tribune, 21.6.)
Der amerikanische Verteidigungsminister Cohen bläst ins gleiche Horn. In einem Interview vor seiner Rundreise durch mehrere NATO-Randstaaten Anfang Juli begrüßt er die europäischen Bemühungen um neue Bewaffnung: – „Wir wollen, daß die Alliierten mehr tun“ – und macht gleich klar, wie dies gemeint ist: Im gemeinsamen Programm der NATO sollen die Verbündeten mehr Aufgaben übernehmen und damit die USA entlasten. Die amerikanische Regierung stellt die Sache so dar, als wäre es überhaupt ihr Einfall gewesen, daß Europa sich auf den modernsten Stand der Rüstungstechnik bringt:
„Seit Kosovo hat Washington die Verbündeten gedrängt, mehr für elektronische Waffen auszugeben, um mit den US-Streitkräften mitzuhalten. Die europäischen Streitkräfte haben das Problem erkannt (!) und drängen auf mehr Kooperation im Gefolge ihrer Erfahrungen mit den USA im Kosovo… Die europäischen Verbündeten werden größere Investitionen in den (amerikanischen) Rüstungssektor nur unter der Bedingung machen, daß die Vorteile des Verkaufs – im Sinne von Arbeitsplätzen und Gewinnen – nicht den USA reserviert bleiben. Europäischen Firmen muss erlaubt werden, sich bei der Entwicklung geheimer Technologien mit US-Firmen zusammenzutun und die Profite zu teilen… Für den Fall, daß in dieser Hinsicht bestehende Restriktionen aufgehoben würden, würde Washington nach Auskunft von Pentagon-Vertretern dann auch auf den europäischen Märkten auf Reziprozität für US-Waffen bestehen.“ In diesem Sinne will die Clinton-Regierung „laut Aussage eines Beamten aus dem Pentagon transatlantische Partnerschaften und Fusionen in der Rüstungsindustrie aktiv unterstützen. Es zeigt sich eine veränderte Einstellung zugunsten eines wärmeren Empfangs für ausländische Aufkäufer im sensiblen Sektor der Bewaffnung…“ (International Herald Tribune, 8.7.)
Auch in der Frage der europäischen Auf- und Umrüstung wollen die USA also wenigstens mitbestimmen, wie sie stattfindet. Sie entnehmen der gemeinsamen Kriegführung gegen Jugoslawien lauter Indizien, daß auf Seiten der Europäer nach wie vor die Berechnung gültig ist, daß sie im Bündnis mit der „einzig verbliebenen Weltmacht“ allemal besser fahren als ohne und damit gegen sie. Auf dieser Grundlage läßt sich erfolgversprechend kalkulieren und fordern: Die Bündnispartner sollen sich und ihre auf mehr Eigenständigkeit zielenden Ambitionen in ein übergeordnetes US-Konzept einfügen und den darin festgelegten strategischen und rüstungskapitalistischen Bedürfnissen der Führungsmacht genügen; von ihren konstruktiven Beiträgen können und dürfen sie dann umgekehrt – sozusagen in einem gerechten Tausch – militärisch und wirtschaftlich profitieren. Die Amerikaner weisen das Ansinnen der EU-Staaten, mittels besserer Kooperation und mehr Militärgerät wirksamer als bisher Einfluß auf die NATO-Politik und -strategie zu nehmen, nicht zurück, sondern wollen dies Interesse dafür ausnutzen, um Europa noch enger als bisher an die NATO, d.h. an sich zu binden. Das heißt für die USA „Arbeitsteilung im Bündnis“: Unter der militärisch-strategischen Oberaufsicht der USA und in gehörigem Abstand zu deren militärischer Machtentfaltung sollen die Europäer soviel zum Kriegführen beitragen, wie sie können. Ansonsten sind sie dafür vorgesehen, die allfälligen Aufräumarbeiten zu erledigen und zu finanzieren.
3. Rußland und China: Zwei „schwierige Verhältnisse“ sind noch längst nicht geregelt
Freundlicherweise erkennen die USA an, daß sie Rußland und China durch den Kosovo-Krieg – oder jedenfalls in seinem Zuge – ein wenig vor den Kopf gestoßen haben. Das ist nun einmal nicht zu ändern; und in der Sache, d.h. nach der Seite der Klarstellung, was den USA zusteht und was sie anderen Großmächten ungestraft zumuten können, wollen die USA ja auch gar nichts ändern. Sie möchten die Beziehungen, die sie zu beiden Mächten unterhalten, auf der neuen Grundlage jedoch fortsetzen, also auf jeden Fall verhindern, daß die Diplomatie abbricht und die andere Seite zu Gesprächen nicht mehr bereit, also für Erpressungen, Angebote, Drohungen, Händel nicht mehr zugänglich ist. Es ist ernst zu nehmen, wenn die amerikanische Diplomatie es als Durchbruch feiert, daß Ende Juli die Russen wieder mit der NATO, die Chinesen wieder mit amerikanischen Abgesandten „reden“. Das ist aus Sicht der US-Regierung bereits der halbe Erfolg: Sie hat ihre Kontrahenten dazu bewegt, den Störfall namens „Kosovo“ nicht zum Grund für eine prinzipielle Absage an weitere „Zusammenarbeit“, auch und gerade in Militärfragen, zu nehmen – und das, ohne daß sie von ihrem tatkräftig praktizierten Standpunkt der Rücksichtslosigkeit gegen russische und chinesische Ansprüche auf Mitentscheidung in der Weltpolitik auch nur das Geringste zurückgenommen hätte [6]
4. Neue Aufrüstung für eine neue „Sicherheitslage“
Die USA haben sich ein neues, umfangreiches Aufrüstungsprogramm vorgenommen. Vorgesehen sind neue Kriegsschiffe aller Art, Transportflieger, neue Satellitentechnologien, ein nationales Raketenabwehr-System (NMD) sowie eines für den ostasiatisch-pazifischen Raum (TMD). Das beschlossene Raketenabwehr-Programm ist eine – der neuen strategischen „Lage“ und den neu definierten „Herausforderungen“ entsprechende – Neuauflage dessen, was unter Reagan „star wars“ hieß: ein Defensivsystem, das laut offizieller Darstellung darauf berechnet sein soll, vor allem Angriffe „kleinerer“ Atomwaffenstaaten abzuwehren (die der größeren also eher nebenbei!) und die USA auf diese Weise unangreifbar zu machen. Dafür werden über die 112 Mrd. Dollar hinaus, um die der Verteidigungsetat für die nächsten 6 Jahre erhöht wird, hinaus weitere 6,6 Mrd. $ in den Haushalt eingestellt.
Die jüngst verabschiedete neue NATO-Strategie, die politische Absegnung einer geographisch unbegrenzten Zuständigkeit der transatlantischen Allianz bei der Verteidigung gemeinsamer Interessen sowie die damit anvisierte neue Arbeitsteilung im Bündnis machen eine eigenständige US-amerikanische Rüstungsoffensive also nicht überflüssig. Gerade angesichts der Tatsache, daß die USA die Europäer für weltweite Militäroperationen in die Pflicht nehmen wollen, soll der Abstand gewahrt bleiben. Mit der Herstellung militärisch-strategischer Gleichberechtigung im Bündnis hat die „neue Strategie“ nichts zu tun, da mögen sich die Europäer noch soviel einbilden.[7] Daß die Alliierten „mehr tun“ sollen, heißt nicht, daß die USA „weniger tun“ wollen, ganz im Gegenteil: Durch mehr „Arbeitsteilung“ im Bündnis wollen sich die USA neue Freiheiten für die Ausstattung ihres Militärs im Hinblick auf jederzeitige globale Einsatzbereitschaft schaffen.
Die Umsetzung des nationalen Programms zur Errichtung eines universellen Kontrollregimes, dem sich kein Staat der Welt entziehen kann, erfordert nämlich einigen Aufwand. Die USA stellen sich praktisch darauf ein, daß ihr Projekt namens „neue Weltordnung“ andere Nationen zu neuen Berechnungen veranlaßt. Der Krieg hat nicht nur neue Kräfteverhältnisse zwischen den Staaten geschaffen; er hat zugleich ein neues Kräftemessen der Nationen auf die Tagesordnung gesetzt – siehe Rußland und China. Alle Beteiligten sind sich sicher: Eine Rückkehr zum „business as usual“ im zwischenstaatlichen Verkehr findet nicht statt. Die restliche Staatenwelt ist längst dabei, sich auf das US-Programm der „bedingten Souveränität“ einzustellen; alle sehen sich vom Krieg in Jugoslawien irgendwie „betroffen“ und sind es auch. Unterordnung ist nicht der Schluß, den Nationalisten aller Couleur aus der amerikanischen Beschlußlage und dem Exempel des Kosovokrieges ziehen. Für jede Nation stellt sich vielmehr die Frage, was sich mit der US-Macht im Rücken neu anzetteln läßt, welche Verbündete sich gegebenenfalls gegen sie finden lassen. Allemal ist klar: Neue Gewaltmittel müssen her, um in der neuen Weltlage zu bestehen.
Die USA rechnen mit den Konsequenzen, die ihr Weltordnungsprogramm dadurch zu gewärtigen hat, daß die anderen Nationen sich auf ihre „Doktrin der begrenzten Souveränität“ einstellen. Aus der Sicht der USA stellt sich der Sachverhalt, daß der Rest der Welt auf ihren bewiesenen Willen zum Durchfechten von Unterordnung reagiert, nämlich umgekehrt dar: Obwohl sie doch mit dem Krieg in Jugoslawien deutlich genug gemacht haben, daß man sich als minder bemitteltes Staatswesen lieber mit den USA gut stellt, hat der Rest der Welt nichts Besseres zu tun, als ständig neue Konflikte vom Zaun zu brechen und gegen US-Recht zu verstoßen. Da sind die Amerikaner sich jetzt schon sicher: Nach dem Krieg gegen Serbien wird es solche „Fälle“ nicht seltener, sondern eher häufiger geben. Darauf bereiten sie sich vor.
[1] Mustergültig hatte Clinton dieses Zusammenhang bereits vor dem Krieg in einer programmatischen Rede in San Francisco formuliert: Es ist leicht, beispielsweise zu sagen, wir hätten wirklich kein Interesse daran, wer in diesem oder jenem Tal in Bosnien lebt oder wer Eigentümer eines Streifens Buschland im Horn von Afrika oder eines Stücks verbrannter Erde am Jordan ist. Aber der wahre Maßstab für unser Interesse ist nicht, wie klein oder weit entfernt diese Orte sind oder ob wir Schwierigkeiten haben, ihre Namen auszusprechen. Wir müssen uns die Frage nach den Konsequenzen für unsere Sicherheit stellen, sollte Konflikten erlaubt werden zu schwelen und sich auszubreiten. Wir können und sollen nicht alles tun und überall sein. Aber wo es um unsere Werte und Interessen geht und wo wir etwas bewirken können, müssen wir bereit sein, etwas zu tun.
(Rede vom 26.2.99) Das amerikanische Sicherheitsinteresse ist eben wirklich völkerverbindend.
[2] Das Repräsentantenhaus hat Washington letzte Woche einen Schlag versetzt, indem es sich weigerte, die NATO-Luftoffensive mehrheitlich zu unterstützen.. Das Parlament lieferte damit ein Symbol nationaler Ambivalenz, das Clinton nicht ignorieren kann… Das Problem ist nicht, daß der Präsident es versäumt hätte, die militärischen und politischen Ziele für den Kosovo zu verdeutlichen… Er hat es bislang versäumt, diese Ziele mit weiterreichenden US-Interessen so zu verbinden, daß dies eine Mehrheit seiner Landsleute überzeugt, daß ein Krieg gegen Milosevic gerechtfertigt ist… Um die Unterstützung des Landes zu gewinnen, muss Clinton diese Ziele in einen breiteren Zusammenhang stellen… Nach dem Ende des Kalten Krieges müssen die USA ein neues Kalkül entwickeln, um zu definieren, wann ihre Sicherheit gefährdet ist und der Gebrauch militärischer Gewalt gerechtfertigt ist. Kosovo ist ein Testfall… Welchen Weg Präsident Clinton auch wählt, die Amerikaner müssen zufriedengestellt sein, daß er die Opfer wert ist, die verlangt sein könnten. Wenn Clinton im Kosovo siegen will, muss er sich erst der Unterstützung des amerikanischen Volkes und des Kongresses versichern.
(International Herald Tribune, 3.5.) Der Sieg hat dann aber auch so ganz gut geklappt.
[3] Dabei handelt es sich in den Worten Cohens um den (geplanten) Beitrag, den die Militärs zu den gesamten Bemühungen um Stabilität in Südosteuropa leisten können.
(Interview am 8.7.99)
[4] Ein unzufriedener „Europäer“: Während Europa zaudert, schreitet die NATO nach Osten voran… Washington wollte, daß die NATO das ganze Europa integriere, und sich sogar jenseits von Europa auf einige der ehemaligen sowjetischen Teilrepubliken ausdehne. Dieser Plan stellte sich die EU als eine untergeordnete regionale Gruppierung westeuropäischer Mitglieder einer erweiterten, von Washington geführten NATO vor. Dieser Plan missfiel vielen Westeuropäern, die nichtsdestotrotz keine kohärente Alternative anboten… Europa findet sich gegenwärtig politisch in Zentral- und Osteuropa durch die NATO ausmanövriert, zu einem Zeitpunkt, zu dem der Kosovo seine militärische Abhängigkeit von den USA enthüllt hat.
(William Pfaff, International Herald Tribune, 24.6.)
[5] In der amerikanischen Berichterstattung zum Krieg spiegelte sich dies darin, daß ungefähr die Hälfte der Zeitungsartikel sich verständnisvoll mit den „Problemen“ beschäftigte, die vor allen den amerikanischen Militärs, aber auch der politischen Führung der USA daraus erwachsen seien, daß sie immerzu mit „neunzehn Staaten“ (man denke!) palavern mußten, um ihren Krieg am Laufen zu halten.
[6] Vgl. hierzu die entsprechenden Passagen der allgemeinen Bilanz des Kosovo-Krieges in diesem Heft.
[7] ‚Als die einzige Nation, die militärische Operationen im großen Maßstab, effektiv und im Verbund mit anderen nationalen Streitkräften und weit entfernt von ihren eignen Grenzen durchführen kann, sind die Vereinigten Staaten in einer einzigartigen Position… Um diese Führungsposition zu bewahren, müssen die USA kampfbereite und flexible Truppenverbände unterhalten, die imstande sind, ein breites Spektrum von militärischen Aktivitäten und Operationen auszufüllen.‘ Da sich Washington nicht darauf verlassen kann, loyale Bündnispartner vor Ort vorzufinden, die US-Interessen im Ausland schützen, fordert das Pentagon, daß die USA fähig sein müssen, eigene Streitkräfte in Unruhegegenden zu stationieren und dort jeder Form von Widerstand überlegen zu sein. ‚Wenn man über diese Fähigkeit zur Machtprojektion verfügt, können die USA Krisen in Übersee im eigenen Interesse steuern und angemessen auf sie reagieren, selbst wenn sie über keine permanente Präsenz bzw. nur über begrenzte Einrichtungen in der betreffenden Region verfügen.‘
(Jährlicher Bericht des US-Verteidigungsministeriums, zit. Nach LMD)