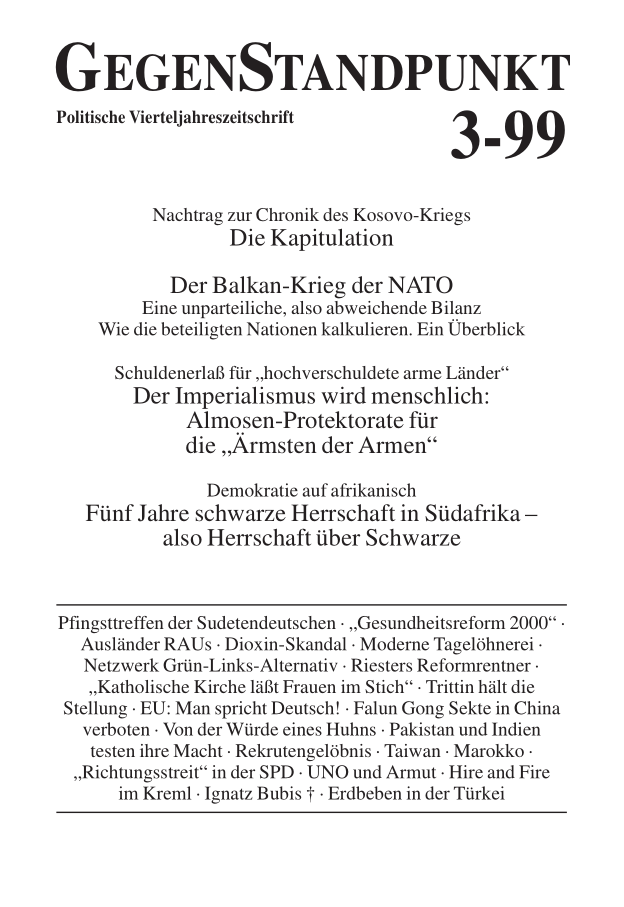Wie die am Balkan-Krieg der NATO beteiligten Nationen kalkulieren:
Österreich: Adabei
Österreich ergreift entschieden Partei für die Nato-Entscheidungen gegen Jugoslawien, weil es sich vom Zerfall des ehemals kommunistischen Staatenverbands eine Stärkung seiner vitalen und sicherheitspolitischen Interessen verspricht, nicht nur im Hinblick auf die“ neuen Nachbarn“, sondern auch als EU-Mitglied. Als neutraler Kleinstaat, der nicht viel beizutragen hat, ist Österreich aus dem Kriegsgeschehen ausgemischt und leidet an seinem Machtdefizit, was sich in Debatten um Neutralität –ja oder nein – niederschlägt und in dem Verlangen nach einem größeren militärischen Gewicht Europas.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Siehe auch
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
- Neutralität in den Zeiten des Balkankriegs
- Die Feindschaft gegen Serbien: Ganz in der Logik eines Wiener ‚Masterplans‘, den Zerfall der südosteuropäischen Staatenwelt als Chance zu nutzen
- Die Kehrseite des Krieges: Zurückstufung des Nichtkombattanten
- Einmischungsversuche eines Trittbrettfahrers und eine spärliche Gewinnbeteiligung
Wie die am Balkan-Krieg der NATO beteiligten Nationen kalkulieren:
Österreich: Adabei
Neutralität in den Zeiten des Balkankriegs
Österreich ist klein und neutral. Deswegen ist es aber noch lange nicht unparteiisch und zurückhaltend, wenn der Westen nach langer Vorbereitung endlich den Krieg gegen den Belgrader Diktator beginnt. Die Gnade des rechtzeitigen EU-Beitritts hat dem Land bis Ende 98 die Präsidentschaft im Club der Macher Europas eingetragen; in der noch nachwirkenden Funktion des EU-Repräsentanten tritt das Land in Rambouillet als Mitveranstalter des erpresserischen Verhandlungsarrangements der westlichen Betreuungsmächte auf und wirkt an der Übermittlung unverhandelbarer Kapitulationsdiktate an Milošević konstruktiv mit. Daß seine Macht gering und in aller Form auf Neutralität festgelegt ist, gibt seinen diplomatischen Aktivitäten – jedenfalls aus österreichischer Sicht – ein besonderes Gewicht, moralisch wie politisch:
„Gerade das kleine, neutrale Österreich kann Serbien besonders glaubwürdig darstellen, daß es nicht um eine Aggression gegen Serbien, sondern ausschließlich um die Wahrung des fundamentalen Menschenrechts geht.“ (EU-Chefverhandler Petritsch)
Wenn der jugoslawische Machthaber sich trotzdem nicht
fügt und folglich mit den Drohungen von Rambouillet
ernstgemacht werden muß, kann das für den neutralen
Kleinstaat selbstverständlich kein Grund sein, sich ins
überparteiliche Abseits zurückzuziehen. Der Krieg findet
zwar ohne seine Soldaten, aber mit seiner Zustimmung und
Unterstützung statt: Erkenntnisse des österreichischen
Geheimdienstes werden ganz ohne Neutralitätsvorbehalt an
die kriegführende NATO weitergeleitet, und mit
patriotischem Stolz wird das dicke Lob eingeheimst, daß
sich niemand am Balkan so gut auskenne wie die
Österreicher
(ein
NATO-Sprecher). Das offiziell ausgesprochene
Überflugverbot für NATO-Gerät wird sehr flexibel
gehandhabt; im März und April kommt es zu einem
erstaunlichen Anstieg der Flugbewegungen im
österreichischen Luftraum
, der mit der
Luftraumüberwachung durch die acht funktionsfähigen
österreichischen Draken
einfach nicht zu erklären
ist. Warum Österreich nicht umhin kann, auf diese Art
neutral zu sein, wird den Serben mit dem Hinweis
erläutert, daß ihr nationaler Führer mit seiner
Intransigenz gar kein nationales Anliegen vertritt,
sondern eine reine Machterhaltungsstrategie auf Kosten
der serbischen Bevölkerung
verfolgt. Dem eigenen Volk
offeriert die öffentlich-rechtliche Elite einen Weg, auch
ohne Soldaten seinem Engagement fürs Gute auf dem Balkan
Genüge zu tun, was Herr Karl auch diesmal wieder gerne
mitmacht: Als „Spendenweltmeister“ öffnen die
Österreicher ihre Herzen und Geldbörsen, um voll korrekt
zwischen guten und schlechten Opfern zu unterscheiden –
die von Milošević drangsalierten Albaner werden zum
Sorgeobjekt „Nachbar in Not“ erkoren, die Opfer der
NATO-Angriffe als notwendige Kollateralschäden abgehakt.
Die Feindschaft gegen Serbien: Ganz in der Logik eines Wiener ‚Masterplans‘, den Zerfall der südosteuropäischen Staatenwelt als Chance zu nutzen
Daß sie sich mit ihrer entschiedenen Parteinahme gegen Jugoslawien zum Anhängsel von NATO-Entscheidungen und zum Mitläufer fremder Interessen machen würde: Das braucht die souveräne Republik Österreich sich nicht nachsagen zu lassen. Länger als viele andere, die jetzt Krieg führen, wirkt man in Wien bereits auf den Zerfall des südlichen Nachbarn in handliche Kleinstaaten und auf die Schaffung eines europäischen Hinterhofs auf dem Balkan hin, für den man gerne bereit wäre den Hausmeister zu machen:
„Mit der Zersplitterung des bisher weitgehend einheitlich agierenden ehemals kommunistischen Staatenverbandes in unterschiedliche Ziele verfolgende Nationalstaaten und als Konsequenz der Staatenteilung in der nordöstlichen, östlichen und südlichen Nachbarschaft erfährt Österreichs regionale Stellung in Mitteleuropa insgesamt eine nicht unbeträchtliche Veränderung. Daraus entsteht die Möglichkeit, daß Österreich politisch, kulturell und ökonomisch verstärkt in den ostmittel- und südosteuropäischen Raum hineinwirkt und dadurch seine vitalen sicherheitspolitischen Interessen – erstmals seit 1955 – aktiv bzw. präventiv in dieser Region zum Tragen bringt.“ (Österreichs Verteidigungsminister Fasslabend, bereits 1993)
Viel früher als alle anderen hat man insbesondere erkannt, daß der Herauslösung der nördlichen Teilrepubliken Slowenien und Kroatien aus dem tito-kommunistischen Staatsverband unweigerlich die Zerteilung Serbiens folgen muß, weil „die Bevölkerungsstruktur“ des Balkan regionale Machtzentren jenseits der österreichischen Grenze einfach nicht erträgt. Der Krieg um Bosnien war noch gar nicht in Schwung gekommen, da hat der damalige Außenminister Mock bereits, ebenso weitsichtig wie anspruchsvoll, Europa aufgerufen, seine Zuständigkeit für die Menschenrechte auf die serbische Souveränität auszudehnen, und für das Kosovo einen europäischen Ordnungsauftrag reklamiert.
„Ich warne davor, daß die Europäische Gemeinschaft über die Ereignisse in Slowenien und Kroatien und bald auch Bosnien die Augen vor den Menschenrechtsverletzungen im Kosovo verschließt. Dort wird die albanische Bevölkerung seit 1989 obsessiv unterdrückt. Angesichts der Bevölkerungsstruktur in der Region droht ein Flächenbrand, der die gesamte Region betreffen kann. Wir dürfen Herrn Milosevic nicht zugestehen, daß er eine ganze Region in den Abgrund reißt.“ (Außenminister Mock, schon Ende 1992)
Das war schon damals keine Diagnose, sondern ein
Interventionsprogramm, nämlich im Namen der
Menschenrechte in den Balkan politisch, kulturell und
ökonomisch hineinzuwirken
(Fasslabend), und ein kriegsträchtiger
politischer Angriff auf ein Restjugoslawien, das sich
alternative Ordnungsvorstellungen für sein ehemaliges
Staatsterritorium herausnahm und nach dem Austritt von
Slowenien, Kroatien und Bosnien aus dem gemeinsamen
Staatenverbund keine weiteren Souveränitätsverluste
hinnehmen wollte.[1] Und natürlich war auch damals
schon klar, daß die damit angesagte Feindschaft gegen
Belgrad die Potenzen Österreichs weit übersteigt. Aber
das Land wollte ja gar nicht allein bleiben. Damals wie
heute ist es entschlossen und rechnet sich auch Chancen
aus, als Teil eines größeren Ganzen über seine Ost- und
Südgrenzen hinaus bestimmenden Einfluß und Ordnungsmacht
zu entfalten. Im Rückblick kommt die politische Führung
nicht darum herum, sich für ihren entsprechenden
Weitblick und die Zielstrebigkeit zu loben, mit der sie
die Erweiterung ihrer Machtmittel betrieben hat:
„Die aktuellen Ereignisse im Kosovo haben die Richtigkeit unserer Entscheidung für die Mitgliedschaft bei der Europäischen Gemeinschaft voll bestätigt. Von Anfang an war völlig klar, daß die Menschenrechte gegen einen so gefährlichen und unberechenbaren Mann wie Milosevic und die berechtigten österreichischen Sicherheitsinteressen gegenüber unseren südlichen Nachbarn nur im Rahmen einer gemeinsamen europäischen Sicherheitspolitik unter Beteiligung der USA durchgesetzt werden können.“ (Außenminister Schüssel, Fernsehdiskussion)
Via EU eignet sich das neutrale Österreich also alle
Vorteile einer Partnerschaft mit den USA gleich mit an
und profitiert enorm: Die auf überlegener Gewalt
beruhende Überzeugungskraft des westlichen
Verteidigungsbündnisses und die politische und
ökonomische Wucht der EU, beides zusammen gibt nach
österreichischer Rechnung den eigenen
Sicherheitsinteressen und Zuständigkeiten Recht; die von
der EU propagierte und betriebene Politik der Ein- und
Unterordnung des östlichen Vorfelds samt
südosteuropäischem Hinterhof – die ökonomische,
politische und sicherheitspolitische Anpassung an den
Westen
– deckt sich für Österreich aufs Erfreulichste
mit der eigenen historischen Verantwortung für die
Region
. Als Mitglied der einzigen europäischen
Einigungskraft
gewinnt man Anteil an dessen
respektgebietender Größe. Und auf genau dieser Basis
erhofft man sich gerade als Kleinstaat ein besonderes
Entrée bei den „neuen Nachbarn“:
„Dazu kommt, daß die ‚neuen‘ Nachbarstaaten aufgrund der wechselseitigen Größenverhältnisse nicht das Entstehen eines einseitigen Abhängigkeitsverhältnisses befürchten müssen.“ (Verteidigungsminister Fasslabend)
Gewissermaßen von gleich zu gleich will Wien den ruinierten Völkerschaften des ehemaligen Ostblocks mit der ganzen Macht des westlichen Reichtums und Gewaltapparats im Rücken besonders wirkungsvoll gegenübertreten. Und über den Einfluß, den es so gewinnt, verbessert Österreich unweigerlich – so geht die Kalkulation weiter – seine Position im europäischen Bündnis; eine Rückwirkung auf die EU-interne Konkurrenzlage, die, das hat man in Wien gleich erkannt, ungleich wichtiger ist als jeder denkbare Zugewinn auf dem Balkan selbst. Der ist umgekehrt im Wesentlichen Material für das eigentliche Anliegen: Per aktiver Beteiligung an der Umwandlung der ehemals feindlichen Nachbarn in einen europäischen Hinterhof betreibt man die eigene Aufwertung.
„Die Konsequenz einer wirtschaftlichen und politischen Stabilisierung seines nordöstlichen, östlichen und südöstlichen Umfeldes wäre eine Gewichtsverlagerung innerhalb der demokratischen Staatengemeinschaft Europas nach Osten und damit auch nach Österreich, also eine auch sicherheitspolitische Aufwertung Österreichs im gesamteuropäischen Kontext.“
Deswegen also tut Hilfe not für die „Nachbarn in
Not“: Mit der EU und indirekt den USA im Rücken will
Österreich zum stabilitätsstiftenden Ansprechpartner
aller Regierungen eines in kaum überlebensfähige
Kleinstaaten zersplitterten Balkan werden; und als deren
Betreuungsmacht rechnet es auf wachsende Wichtigkeit,
mehr Respekt und steigenden Einfluß in der Europäischen
Union, die für die neutrale kleine Republik von
vornherein weit mehr ist als ein Wirtschaftsverbund,
nämlich der Club zur strategischen Beherrschung,
machtvollen Befriedung und ordnungsstiftenden
Durchsortierung des gesamten alten Kontinents.
Dafür muß das, was von Jugoslawien noch übrig
ist, auf den Status einer subalternen Balkanrepublik von
EU-Gnaden zurückgestuft werden. Das wiederum geht
freilich nur mit einer Gewalt, über die Österreich allein
nicht verfügt; nicht einmal der wagemutigste
Oberbefehlshaber des Bundesheeres könnte den Versuch
wagen, neutral-souverän in den postjugoslawischen
Bürgerkrieg einzugreifen und den Rückzug Serbiens zu
erzwingen. Die NATO aber kann das schon. Und dazu, daß
sie das auch will, kann Österreich wiederum
etwas beitragen: Mit seinem EU-Chefverhandler in
Rambouillet wirkt es mit darauf hin, daß der Belgrader
Regierung dort Bedingungen diktiert werden, die kein
souveräner Staat unterschreiben würde
(ORF-Kommentator Lendvai).
Die Kehrseite des Krieges: Zurückstufung des Nichtkombattanten
Da Milošević das genauso sieht, ist auch für Österreich
der Krieg „notwendig und gerechtfertigt“. Die eigene
„Friedensdiplomatie“ wird nochmals über den grünen Klee
gelobt, um die Schuld am Krieg dem „uneinsichtigen
Machtmenschen Milošević“ in die Schuhe zu schieben. Daß
der Alpenrepublik dennoch ein von ihr mitgestalteter
diplomatischer Sieg über Serbien lieber gewesen
wäre, kann man ihr getrost glauben, solange man das nicht
mit besonderer Friedensliebe verwechselt. Denn der heiße
Einsatz der Waffen bedeutet für Österreich vor allem
einmal, daß seine Dienste nicht mehr gefragt sind. Gerade
noch genoß man die Rolle des diplomatic player
beim Niederringen des gemeinsamen Feindes und versprach
sich eine dementsprechende Berücksichtigung bei der
„Implementierung einer Nachkriegsordnung“ am Balkan; nun
wird zugeschlagen, und es gilt unerbittlich: Wer nicht
mitbombardiert, hat überhaupt nichts mehr zu melden;
weder zur Durchführung der Aktion noch zum Maß der
Zerstörung Jugoslawiens noch zur Frage ihrer Beendigung
noch zum Ergebnis und seiner politischen Ausgestaltung.
Alle Entscheidungen liegen bei den militärisch aktiven
Allianzpartnern, auch da eindeutig abgestuft nach der
Wucht und militärischen Bedeutung ihres Engagements. Ein
Kleinstaat wie Österreich, der nur bei der Auslösung des
Krieges ein wenig mitgespielt hat und dann nicht viel
mehr beitragen kann als seine guten Wünsche, ist ohne
Chance auf Einflußnahme aus dem Geschehen ausgemischt.
Der NATO-Krieg auf dem Balkan ist eben von ganz anderer Art als jene „bewaffneten Konflikte“ einer vergangenen Epoche, in denen die USA und ihr sowjetischer Widerpart sich in der UNO auf die Neutralisierung und Einhegung des Kriegsgeschehens einigen konnten, die Weltorganisation einen Auftrag zur Überwachung des vom Sicherheitsrat dekretierten Waffenstillstands bekam und Österreich als neutrales Land gerne die Verantwortung für ein Blauhelm-Kontingent übernahm, gelegentlich sogar mit dem Kommando betraut wurde und sich entsprechender weltpolitischer Anerkennung und daraus abgeleiteter Wichtigkeit erfreuen konnte. Die weltpolitischen Voraussetzungen für solche seltsamen Befriedungsmanöver sind längst entfallen; nun macht die NATO mit ihrem Kosovo-Einsatz, der noch dazu paradigmatisch sein soll für die völkerrechtliche Behandlung der Gewaltaffären des kommenden Jahrhunderts, auch ausdrücklich Schluß mit dieser veralteten Art staatengemeinschaftlicher Kriegsbetreuung und ersetzt die wunderlichen Errungenschaften einer Ära imperialistischer Verlegenheit, in der sich Österreich zur Rolle eines Wärters im globalen Irrenhaus aufschwingen durfte, durch die brutale Anwendung von Gewalt als einzig verläßlichem Mittel imperialistischer Friedenspolitik. Mit ihrer überlegenen Militärgewalt setzen die NATO-Mächte sich selbst als letztentscheidende Schiedsgewalt in der Staatenwelt ein; und schlagartig erlischt der Schein, „friedensbewahrenden“ UNO-Blauhelmtruppen käme irgendeine weltordnungspolitische Bedeutung zu und ihren Heimatländern eine entsprechende Wichtigkeit. Was ein Staat strategisch zählt – die imperialistische Wahrheit gilt wieder ohne Wenn und Aber –, das richtet sich nach seiner praktisch bewiesenen Kriegsfähigkeit. Und da zählt Österreich – nichts.
Einmischungsversuche eines Trittbrettfahrers und eine spärliche Gewinnbeteiligung
Ihre Degradierung nimmt die wehrhafte Alpenrepublik selbstverständlich nicht einfach hin, sondern als Herausforderung. Man akzeptiert zwar die Notwendigkeit, in der Kosovo-Frage die UNO zu umgehen, weil der Westen sich mit seiner Abschreckungspolitik selbstverständlich nicht vom Abstimmungsverhalten Rußlands und Chinas abhängig machen kann. Andererseits kann Österreich die Entwertung der UNO auch nicht billigen; um so weniger, als die Alternative zur bisherigen Art ihres weltpolitischen Mitmischens, die der Nation allenfalls zu Gebote steht, nämlich der Tausch der UNO-tauglichen Neutralität gegen eine NATO-Mitgliedschaft, keine rundum und fraglos überzeugende nationale Perspektive hergibt. Das Nachbarland und neue NATO-Mitglied Ungarn bietet dafür ein unschönes Beispiel: Aus Rücksicht auf die ungarische Minderheit in Nordjugoslawien wünscht Budapest keine Bombenangriffe von ungarischem Boden aus – und muß erleben, daß die Führungsmächte sich souverän über sein nationales Anliegen hinwegsetzen. Dieser Umgang mit einem kleineren Bündnispartner kratzt sogar die ansonsten geübte demonstrative Solidarität mit dem Kriegsbündnis ein wenig an. Von „hemdsärmeliger Cowboymentalität“ ist in der zweiten Politikergarnitur der Regierungspartei SPÖ da plötzlich die Rede, und der Kanzler mahnt für künftige Interventionen ein UNO-Mandat an. Das hilft bloß nichts; schon gar nicht für die gegenwärtige Lage.
Was die betrifft, so tut die Nation ihr Bestes, um zu beweisen, daß sie doch auch als Nichtkombattant, vielleicht sogar gerade in dieser undankbaren Rolle, für die Kriegführung und erst recht für die anschließende zweckmäßige Befriedung des Balkan von Wichtigkeit sein kann. Sie übt praktische Solidarität mit den NATO-Soldaten, die in der Etappe, in Mazedonien und Albanien, die Invasion des Kosovo vorbereiten und dabei nebenher die Flut der Vertriebenen bewältigen müssen – nämlich so unterbringen, daß sie nicht stören, das aber so heimatnah, daß sie zur jederzeitigen Rückführung als Bevölkerung des vorgesehenen Protektorats bereitstehen und nicht nach Westeuropa durchsickern. Mit vorbildlichen Lagereinrichtungen leistet Österreichs Armee Beihilfe zur Errichtung dieser „Zweiten Front“ der Allianz. Für die erste, den Luftkrieg, tut man gleichfalls, was man mit seinem neutralen Gewissen vereinbaren kann, also was in den bescheidenen nationalen Kräften steht. Daneben versucht die Regierung sich auf diplomatischem Wege für die gemeinsame Sache nützlich zu machen. Der österreichische EU-Repräsentant Petritsch bemüht sich, die zerstrittenen politischen Parteien der Albaner und die kämpfende UCK unter der Maxime zu einen, daß einzig die Unterwerfung unter ein EU-Protektorat Kosovo und die konstruktive Mitarbeit daran der albanischen Sache weiterhelfen kann. Dann sucht die EU in ihrer Eigenschaft als europäischer NATO-Pfeiler einen bündnisfreien Unterhändler, der dem selbsternannten russischen Vermittler seinen untergeordneten Platz anweist und mit Tschernomyrdin im Schlepptau die definitiven Kapitulationsbedingungen des Westens nach Belgrad übermittelt; und prompt meldet sich das balkanerprobte Österreich:
„Als Land mit langjährigen engen Verbindungen zu den Balkanstaaten und einer gemeinsamen Vergangenheit können wir wertvolle Dienste bei der Neuordnung des Raums anbieten.“ (Bundespräsident Klestil)
Doch von dem schönen Angebot aus Wien machen die wirklich Mächtigen keinen Gebrauch; EU und G7 betrauen stattdessen den Repräsentanten der nächsten EU-Präsidentschaftsnation, den ersten Mann Finnlands, mit der Mission, die den serbischen Rückzug bringt. So kann es gehen, wenn man sich einmischen und mitmischen will und letztlich doch abwarten muß, welche Aufgabe einem von den kriegführenden Mächten zugeteilt wird.
So bringt der Krieg am Ende für Österreich alles andere
als das gewünschte Resultat. Dem Ziel, die Neuordnung des
Balkan maßgebend mitgestalten zu können und darüber auch
im europäischen Bündnis mehr Gewicht zu bekommen, ist die
Nation nicht recht nähergekommen: Zwar ist Jugoslawien
noch ein Stück weiter zerlegt; das Szenario eines
zersplitterten Balkan, in den Österreich als europäisches
Bollwerk politischer und ökonomischer Stabilität
„hineinwirken“ könnte, ist perfekt. Tatsächlich
„wirken“ da aber andere, nämlich die NATO-Siegermächte;
die teilen sich ihr Protektorat auf – außer einer kleinen
militärischen Fußnote schaut für Österreich nichts
heraus. Und auf die Leitung des Stabilitätspaktes für den
Balkan hat man sich vergeblich Hoffnungen gemacht: Statt
den Wiener „Balkanfachmann“ und
Ex-Vize-Ministerpräsidenten Busek dranzulassen, reißt
Deutschland diesen begehrten Posten an sich und besetzt
ihn mit einem geschasten Minister
(Kurier). Immerhin, ganz verzichtet die
Völkergemeinschaft dann doch nicht auf Österreichs
diplomatische Kunst und Balkanerfahrung: Der in
Rambouillet bereits bewährte Petritsch erbt den Posten
des quasi regierenden Bosnien-Beauftragten von dem
Spanier Westendorp. Das ändert zwar auch nichts an den
Machtverhältnissen in Europa, zeigt aber, daß die Welt
doch noch weiß, was sie an Österreich hat…
Eine neue Runde Neutralitätsdebatte: Drangsale eines Kleinstaats mit großen Ambitionen und einem ebenso großen Machtdefizit
Verlauf und Zwischenergebnis des ersten offiziellen NATO-Kriegs geben Österreichs Politikern zu denken. Unter dem Eindruck der Überlegenheit der Allianz und mit Blick auf die eingetretenen wie die zu erwartenden Auswirkungen des einseitigen Waffengangs auf die Rangordnung der Nationen in Europa und im Club der westlichen Demokratien überhaupt legen sie ihre mittlerweile schon traditionsreiche nationale Generaldebatte neu auf: Am Thema „Neutralität – ja oder nein“ diskutieren sie, wie ihr Staat sich den klargestellten Machtverhältnissen auf dem Kontinent und in der Welt strategisch zuordnen sollte, damit sich seine bedingungslose Parteinahme für die Mächtigen und Siegreichen national besser auszahlt.
Auf neue Einfälle kommen sie freilich nicht. ÖVP und FPÖ
fühlen sich durch den Krieg in ihrer Auffassung
bestätigt, daß Österreich nur als full player
in
einem europäischen Sicherheitsbündnis unter
NATO-Beteiligung weiterkommt:
„Österreich dürfe sich nicht selbst beschränken und an die Seitenlinie stellen. Es sei absolut notwendig, als ‚full player‘ aufzutreten und in allen wichtigen Gremien mitzuentscheiden – und das sei eben nur als Mitglied in der transatlantischen Allianz möglich. Zuletzt habe sich dieser Umstand bei der Bestellung des Mr. Gasp gezeigt. Einige Mitglieder hätten vehement gefordert, daß die neue außen- und sicherheitspolitische Integrationsfigur der EU in keinem Fall aus einem ‚nicht-alliierten Land wie Österreich‘ kommen dürfe.“ (Staatssekretärin im Außenministerium Ferrero-Waldner)
Dem halten Teile der SPÖ und die Grünen ihr Erkenntnis entgegen, daß die NATO-Mitgliedschaft keineswegs die gewünschte Aufwertung Österreichs bedeute, wie man ebenfalls in diesem Krieg habe lernen können. Sie zeichnen das Schreckbild des subalternen NATO-Befehlsempfängers, als welcher Österreich aufgrund seiner geringen militärischen Kapazitäten bloß fungieren könnte, und setzen stattdessen auf die Prolongation des Neutralitätsstatus: Als Neutraler könne man sich glaubwürdiger der Interpretation westlicher Ordnungsansprüche gegenüber betroffenen Befriedungsobjekten widmen und solcherart eine bedeutendere Rolle im europäischen Einigungswerk besetzen.
Deutlich wird in diesem fundierten Meinungsaustausch immerhin, worum es darin eigentlich geht. Beide Positionen arbeiten sich nämlich an ein und demselben nationalen Dilemma ab. Die einen wie die andern wollen an der militärischen Überlegenheit der westlichen Allianz partizipieren; denn alle, die sich nach der Verantwortung für die Nation drängen, definieren Österreichs Anrecht auf „Sicherheit“ so anspruchsvoll und raumgreifend, daß es des Rückhalts in einer weit größeren Erpressungsmacht bedarf, als der Nation allein zu Gebote steht. Im Verhältnis zu eben dieser so ungemein attraktiven Überlegenheit des europäisch-transatlantischen Kriegsbündnisses hat Österreich jedoch wenig zu bieten, was die westlichen Führungsmächte beeindrucken und zur gewünschten Anerkennung und Berücksichtigung österreichischer Interessen bestimmen könnte. Verlauf und Ergebnis des Krieges haben im Gegenteil den klaren Bescheid erteilt, was in der Statuskonkurrenz imperialistischer Nationen wirklich zählt und wie wenig die Wiener Republik, an diesem Maßstab gemessen, letztlich wert ist. Dieser Befund ist nun allerdings überhaupt nicht dazu angetan, die Verantwortlichen in der Definition ihrer nationalen Rechte bescheidener werden zu lassen. Wer immer Österreich regiert, findet dessen Macht zu klein und sucht nach Wegen, sie entscheidend zu vergrößern. Wenn die Parteien sich dann darum streiten, ob der praktisch längst obsolet gewordene Scherz mit der Neutralität mehr Chance oder mehr Hindernis bedeutet, so reden sie zwar an der Sache vorbei; daß sie alle aber an nichts anderem als einem Machtdefizit leiden, darüber lassen sie keinen Zweifel.
Und jenseits ihrer albernen Statusdebatte kennen sie alle auch den einen erfolgversprechenden Weg, die Lücke zwischen der Anspruchshaltung und dem strategischen Gewicht ihrer Nation zu verkleinern. Sie wenden sich dem umfassenderen Problem der relativen Ohnmacht Europas zu, wie sie im Kosovo-Krieg nach allgemeiner Einschätzung so drastisch und peinlich in Erscheinung getreten sein soll, und stimmen ein in den wenig originellen Ruf nach einem größeren militärischen Gewicht Europas und nach mehr Eigenständigkeit ihres Euro-Clubs in Sachen Krieg gegenüber den USA. Als – wenn auch geringfügiger – Teil und Teilhaber der Potenzen Europas hoffen sie von deren Aufwertung auch national zu profitieren. Der Diplomat, der Österreichs einzigen mageren Anteil am Sieg des Westens verkörpert, drückt diesen Konsens so aus:
„Das Positive: Diese Tragödie im Kosovo und Serbien wirkt wie ein Katalysator für den europäischen Einigungsprozeß. Es wurde klar, daß Europa sich nicht mehr hinter den USA verstecken kann. Hier wird sich institutionell und bei den Instrumentarien einiges tun. Klar wurde auch, daß man dem Balkan eine realistische europäische Perspektive geben muß.“ (Petritsch)
Insofern bleibt die Hoffnung, daß die angeschafften Leichen zumindest das „große europäische Friedenswerk“ – und Österreich als dessen südöstlichen Vorposten ein wenig vorangebracht haben!
[1] „L’Autriche, c’est le reste!“ Unter dieses Motto hatte seinerzeit der französische Politiker Clemenceau die Zerschlagung der Donaumonarchie gestellt – nach deren Niederlage im ersten großen vaterländischen Krieg, den Österreich vom Zaun gebrochen hatte, um den Zerfall der Donaumonarchie zu verhindern. Dieser Spruch ist in die österreichischen Schulbücher als Beispiel schlimmer Siegerjustiz eingegangen. Heutzutage und auf der richtigen Seite geht solche Siegerjustiz durchaus in Ordnung. Daß Herr Milosevic das im Namen der Menschenrechte ausgesprochene „Jugoslawien ist das, was übrigbleibt!“ nicht einfach hinnehmen wollte, hat seinem Staat einen Krieg eingetragen und ihm einen Ehrenplatz gleich hinter Hitler und Stalin.