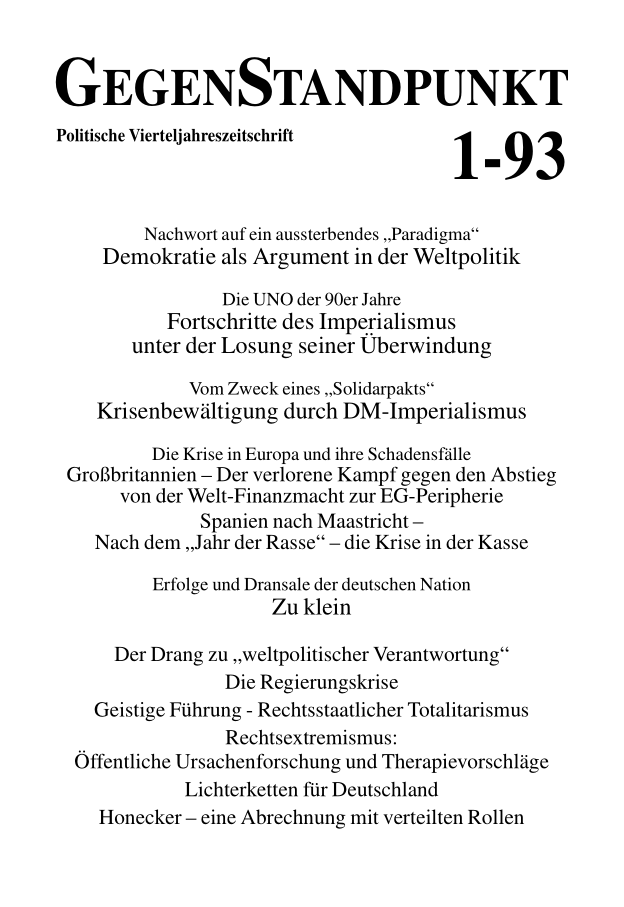Spanien nach Maastricht -
Die Kehrseite von Europas neuestem Wirtschaftswunder
Nach dem „Jahr der Rasse“ – die Krise in der Kasse
Maastricht-Prozess und Krise führen zu einer durchgreifenden Bereinigung des überakkumulierten europäischen Kredits, die Spekulation an den Finanzmärkten setzt eine massive Abwertung von Pfund (s. Teil 1) und Peseta durch. Der bisherige Erfolgsweg Spaniens – um die Aufnahmekriterien der EG zu erfüllen, hatte die Nation eigene, konkurrenzfähige Wirtschaftszweige geopfert und sich bedingungslos zur Expansionssphäre der „Partnerländer“ gemacht – ist damit blamiert: Mit der krisenbedingten Konkurrenz um Zahlungsfähigkeit gelten an den Finanzmärkten neue Gesichtspunkte, die die ehemaligen Zukunftsprojekte jetzt als besonders riskante Spekulation erscheinen lassen, die keinen Kredit mehr verdienen.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Siehe auch
Systematischer Katalog
Gliederung
- Die Gefährdung des Maastricht-Prozesses stößt die Welt auf seinen Gehalt
- Der spanische Weg: Sich der EG total ausliefern, um ihre Expansionssphäre zu werden
- Der spanische Erfolg: Wachstums- und Entwicklungsprojekt der EG geworden
- Die Antwort auf die Krise I: Schuldfragen
- Die Antwort auf die Schuldfrage II: Weiter so!
Die Krise in Europa und ihre
Schadensfälle: Spanien nach Maastricht – Die Kehrseite von Europas neuestem
Wirtschaftswunder
Nach dem „Jahr der Rasse“ – die Krise
in der Kasse
1992 genehmigte sich der spanische Staat eine gigantische Fiesta: Expo in Sevilla, Olympiade in Barcelona, Festival „europäische Kulturhauptstadt Madrid“ – diese drei Großereignisse wurden zusammen mit dem Nationalfeiertag „Dia de la Raza“ am 12. Oktober, dem fünfhundertsten Geburtstag der spanischen Kolonialisierung Amerikas zum Jubeljahr der Hispanidad ausgestaltet. Daß sich der Machtantritt des Felipe González und seiner PSOE just 1992 zum zehnten Mal jährte, durfte auch kein Zufall bleiben: Die sozialdemokratische Nomenklatura gratulierte den Völkern Spaniens nachdrücklich zu ihrem Glück, von einer so kompetenten Führungsmannschaft aus dem Faschismus heraus in die Demokratie, in Nato und EG und schließlich in die Oberliga der kapitalistischen Nationen geleitet worden zu sein.
1993 im Januar liest sich der politische Teil Madrider Tageszeitungen wie ein Polizeibericht –
„Juan Guerra, Bruder des PSOE-Vizes zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Richter läßt Parteizentrale der PSOE durchsuchen. Führende Offiziere der Guardia Civil handelten mit Drogen. Leitender Beamter im Industrieministerium verhaftet. Anklage gegen Provinzpräsident erhoben.“ –
und der Wirtschaftsteil als Sammlung von Katastrophennachrichten:
„Dramatischer Rückgang der Gewinne in der Industrie. Die Regierung friert die Gehälter von 1,5 Mio. Staatsangestellten ein. Rückgang der Investitionen aus dem Ausland. Abzug von Auslandsgeldern. Anstieg der Arbeitslosigkeit auf den Stand von 1982. Inflation wieder bei 6,9% erwartet. Solchaga (Wirtschaftsminister): Die Abwertung war eine nationale Niederlage!“
1993 sieht die Öffentlichkeit die „Erfolge“ des Jahres 1992 in einem ganz anderen Licht: „Adiós al año horrible“ verabschiedet das Nachrichtenmagazin „Cambio 16“ das verflossene Feierjahr und entdeckt auf einmal, daß sich die Fiesta für Spanien nicht gelohnt hat. Aus den 13 Mrd. DM, die Madrid und die Region Andalusien in die EXPO investierten – 1992 noch Beweis der Leistungsfähigkeit und des Zukunftswillens von Staat und Gesellschaft –, werden nun 13 „Pellones“, Synonym für verschleuderte Milliarden, benannt nach dem Direktor der Expo Jacinto Pellón.
Die Olympiade hat dem Organisationskomitee ein Plus eingespielt. Jetzt fragt man sich, ob die Investitionen für Sportanlagen nicht besser in die Sanierung Barcelonas gesteckt worden wären, und ob die olympischen Preissteigerungen für Wohnen und Dienstleistungen die Katalanen nicht noch wesentlich länger an die fünf Ringe erinnern werden als die gewonnen 22 Medaillen.
„Die Krise hat die Fiesta abgebrochen, nach dem Besäufnis kommt der Kassensturz, der alles Positive an 1992 vergessen läßt. Und das kommende Jahr wird noch schlimmer, sagen die Experten.“ (Cambio 16, 4.1.93)
1992 wurde die Konzentration internationaler Repräsentationsveranstaltungen als Beweis dafür genommen, daß Spanien „es geschafft hat“, daß das halbe Entwicklungsland durch EG-Assoziation und Beitritt binnen 20 Jahren endgültig in den Kreis der modernen, europäischen Industriemächte mit weltweiten Rechten aufgerückt ist. 1993 beweisen dieselben Dokumente spanischer Innovations- und Finanzkraft ebenso begriffslos, daß sich da ein armes Land übernommen und knappe Ressourcen für überflüssigen Luxus verpulvert hat. Der Umschwung kam plötzlich. Das Land hatte nicht wie andere EG-Staten schon lange Ärger mit fehlendem Kapitalwachstum und Krise, es bekam die Krise wie aus heiterem Himmel von der internationalen Geldwelt mitgeteilt. Die dänische Ablehnung des Maastrichter Vertrages löste eine völlige Um- und Neubewertung aller bisherigen Erfolge Spaniens aus.
„Nach wenigen Stunden schon begannen die Investoren ihr Geld aus den variablen Renditen abzuziehen. Das nahm die Form einer Kapitalflucht aus den Aktien an, die im Verlaufe des Sommers den Index der Börse (von Madrid) bis auf 200 (von 270) sinken ließ.“ (El País, 13.12.1992)
Auf einmal wurden alle Nachrichten über den Gang der spanischen Wirtschaft als Belege für das Gegenteil dessen genommen, wofür sie am Tag zuvor noch gestanden hatten:
– Das jährliche Durchschnittsdefizit der öffentlichen Haushalte von 25 Mrd. Dollar, bislang Anzeichen einer „dynamischen Wachstumspolitik“, wurde jetzt als bodenlose Verschuldung eines Staatswesens gewertet, das systematisch über seine Verhältnisse gewirtschaftet hat.
– Die Staatsschuldverschreibungen Letras de Tesoro mit ca. 13,5 % Rendite waren bis dato international sehr gefragt. Gestützt auf das internationale Vertrauen in spanische Staatstitel, war die Regierung González 1990 dazu übergegangen, statt der vorher üblichen einjährigen Laufzeit zehnjährige Papiere auszugeben. Am Montag nach dem dänischen Votum stieg die Umlaufrendite in Madrid um über 1 %, und die Kurse für die 10jährigen Staatsschätze (die mittlerweile 45 % der spanischen Staatsschuld ausmachten) sackten dramatisch ab. Vor allem auswärtige Anleger stießen massiv Positionen ab und verweigerten die Abnahme einer Neuedition, die zurückgenommen werden mußte. Erst zwei Wochen später konnte der Staat wieder Zahlungsversprechungen an der Börse plazieren; allerdings nur durch eine Rückkehr zur einjährigen Laufzeit und mit einem um 1 % gestiegenen Coupon.
– Das ganze Jahr 1992 über sank die Neuanlage und stieg die Tendenz zum Abzug von Auslandskapital.
„Von Januar bis Oktober 1992 wurden 276 Mrd. Ptas aus Spanien abgezogen. Das ist ein Drittel mehr allein in diesem Zeitraum als 1990 und 91 zusammengenommen. Bei den Neuinvestitionen ist ein Rückgang um 17,6 % zu verzeichnen.“ (El País, 10.1.93)
„Die deutschen Direktinvestitionen brachen im ersten Halbjahr 1992 auf nur mehr 75 Mio. DM ein. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es noch 1,1 Mrd. DM.“ (Handelsblatt, 21.11.1992)
– Im Gefolge des internationalen Vertrauensverlusts wurde die Peseta im Lauf des Herbstes 92 innerhalb des EWS zweimal abgewertet (um 5 % und 6 %). Die Devisenreserven der Staatsbank, die Anfang 1992 zu den drittgrößten der Welt gehört hatten, schmolzen wie der „Schnee auf der Sierra Nevada“ (Egin, 2.9.1992).
„Die Währungsturbulenzen im EWS haben Spanien nach Angaben des Zentralbankpräsidenten Luis Angel Rojo bisher 15 Mrd. $ gekostet. Vor der Währungskrise verfügte Spanien über Devisenreserven von rund 70 Mrd. $.“ (ebd.)
– Nach der zweimaligen Abwertung hat sich die Wertschätzung der Peseta keineswegs so erholt, daß Spanien wieder internationales Geldkapital attrahieren könnte. Immer noch wird mehr Geld aus Spanen abgezogen als dort investiert; immer wieder sind Notmaßnahmen der Staatsbank zur Verteidigung der Währung nötig.
Die Gefährdung des Maastricht-Prozesses stößt die Welt auf seinen Gehalt
Es ist für die spanischen Europapolitiker tragisch, daß ausgerechnet der Ratifizierungsprozeß des Maastrichter Vertrags zur politischen und Währungsunion in Europa das spanische Wirtschaftswunder zum Offenbarungseid zwang. Wie auf die EG überhaupt, so hat Spanien auch auf ihre Vollendung in der Währungsunion bedingungslos gesetzt. Die Maastrichter Beschlüsse wurden in Spanien – wie übrigens in allen EG Staaten (vielleicht außer Großbritannien und Dänemark) – als neuer Aufbruch zu größerer Wirtschaftskraft und sichererem Kredit in Europa begrüßt. Premierminister González machte sich zu einem der Protagonisten der Währungsunion mit der Perspektive, daß Spanien durch sie die Last des Währungsvergleichs, also der dauernden Sorge um Status und Kaufkraft der Peseta auf dem internationalen Markt, loswerden und als zugriffsberechtigter Teilhaber der neuen Euro-Währung neue Sicherheit für seine Verschuldung und neue Freiheiten darin gewinnen würde. Der Souveränitätsverzicht in Gelddingen, den andere Mitgliedsnationen beklagten, erschien Spanien unerheblich – das Land hoffte, durch die Währungsunion Mittel der Souveränität zu gewinnen. Die Unterschrift unter den Vertrag dokumentierte sowohl die Entschlossenheit der spanischen Regierung, die Integration in die EG ohne Abstriche zu vollenden und dafür alle Bedingungen zu erfüllen, wie auch die Bereitschaft der alten EG-Mächte, Spanien dabei gleichrangig mitmachen zulassen. Man nahm das wie eine Garantie für alle spanischen Schuldscheine.
„Für Spanien stellt der Rahmen des Vertragswerk von Maastricht, das die Angleichung der nationalen Ökonomien in Europa festlegt, eine Sicherheitsgarantie dar für alle, die spanische Anleihen kaufen, die spanische Währung tauschen oder in die spanische Industrie investieren. Das alles wird durch Maastricht berechenbar.“ (Financial Times, 24.6.1992)
Nicht daß die spanischen Europapolitiker die harten Eintrittsbedingungen in die Währungsunion komplett übersehen und gar nicht gemerkt hätten, daß vor die Befreiung vom belastenden Währungsvergleich erst einmal eine politisch organisierte Soliditätsprüfung gesetzt worden war, der jede Eurowährung für sich standhalten, für die jeder Teilnehmer mit nationalen Opfern Schulden- und Inflationslage sanieren mußte. Aber Spanien war es gewohnt, auch harte Bedingungen von Seiten der Hauptmächte der EG als nationale Chance zu nehmen und sie zu erfüllen, um dabei zu sein.
Selbst die Einrichtung des Kohäsionsfonds, für den González heftig und erfolgreich gestritten hatte, nahm Spanien – und die internationale Finanzwelt zunächst ebenso – weniger als das Eingeständnis sogar der europäischen Partner und Konkurrenten, daß Maastricht Bedingungen an die ärmeren „Südstaaten“ stellte, die diese aus eigener Kraft unmöglich würden erfüllen können. Man nahm die erfolgreiche Durchsetzung dieser Finanzhilfe vielmehr als Dokument des Gewichts, das Spanien in der EG hat, und der Bereitschaft der Partner, Spanien bei den großen Aufgaben, die man sich vorgenommen hatte, nicht allein zu lassen.
Das dänische Nein brachte die Ambivalenz dieses europäischen Aufbruchs, über die sich alle seine Protagonisten hinwegschmuggelten, auf den Tisch: die Perspektive einer einzigen gemeinsamen Kreditgarantie – aber erst nach strenger Soliditätsprüfung jedes einzelnen Nationalkredits; die solidarische Hilfe – bei der sehr unsolidarischen Nationalisierung der Schäden, die aus der Streichung und Rückführung unsolider Staatsschulden erwachsen. Kaum lehnten die Dänen in einer Volksabstimmung das europäische Vereinigungsprojekt ab, kaum wurde es fraglich, ob der Fortschritt der Integration überhaupt wie geplant stattfinden könnte, fand prompt die Prüfung der einzelnen EG-Mitgliedstaaten, der kapitalistischen Brauchbarkeit ihres Standorts und der Zuverlässigkeit ihrer Schulden statt, die Europas Regierungschefs auf die Tagesordnung gesetzt hatten. Nur jetzt eben durch den Geschäftsfanatismus der internationalen Geldwelt und nicht, wie sie es geplant hatten, durch den Europäischen Rat und seine Notenbankchefs – politisch beherrscht und mit Kredithilfen abgefedert. Die Finanzwelt hat den Inhalt der Maastrichter Prüfungskriterien nicht dem Vertrag entnommen, sondern der Unsicherheit seiner Realisierung: Im Zweifel, ob aus der Zusammenführung der europäischen Währungen überhaupt etwas werden würde, haben die Devisenhändler und Geldkapitalisten jedes der sich im EWS wechselseitig garantierenden Nationalgelder für sich allein beurteilt, fragwürdige Kandidaten abgestoßen und auf das Geld in Europa spekuliert, das so oder so eine bombenfeste Wertgarantie ist – sei es als Kern der zukünftigen Eurowährung, sei es alleine, wenn aus Europa nichts würde. Im Falle Spaniens, und nicht nur in diesem, erschien ihnen der Kredit, den dieses Land durch die EWS-Garantien genoß, als längst fragwürdige Wechselprolongierung.
Durch die Abwertung der Peseta bekam Spanien bewiesen, daß es ist, was es in den großartigen Feiern seiner Leistungsfähigkeit gerade überwunden glaubte: ein EG-Projekt; ein Standort, der mit allen seinen Qualitäten und Geschäftschancen Objekt ausländischer Spekulation ist, von der alleine abhängt, was aus ihm wird. Getrennt von den Garantien, die Spanien als europäisches Wachstumsprojekt genoß, und beurteilt nach dem, was in Spanien an konkurrenzfähiger Kapitalakkumulation stattfindet, erweist sich, daß es im Vergleich mit den alten EG-Nationen bei weitem kein so erfolgreicher und bei weitem nicht in dem Maß Kapitalstandort geworden ist, wie es schien und wie es in Kreditierungen aller Art schon vorweggenommen wurde.
Der spanische Weg: Sich der EG total ausliefern, um ihre Expansionssphäre zu werden
Mit der Krise, die jetzt das vielgelobte spanische Wirtschaftswunder der 80er Jahre ablöst, bekommt das Land die Quittung für einen eigenartigen Erfolgsweg, der – jedenfalls was Standpunkt und Erfolg der Nation betrifft – bis gestern aufzugehen schien. Seit den späten Tagen Francos, definitiv nach seinem Tod hieß die Option Spaniens: Europa. Der spanische Beitrittsantrag zur EG lautete: Kommt, investiert, benutzt uns – euer Kapital und sein Wachstum, euer Freihandel und Protektionismus sind die einzige Chance Spaniens, in den Rang einer international konkurrenzfähigen Wirtschaftsmacht aufzusteigen! „Europa“ war für die unzufriedenen Kinder des Franquismus gleichbedeutend mit Modernität, Befreiung aus Isolation und Randlage, Aussicht auf Angleichung an die überlegenen nördlichen Nachbarn, Zugehörigkeit zu einem neuen Zentrum der Weltpolitik und der Weltwirtschaft. Dieser spanische Wille, nicht mehr außerhalb der EG Opfer ihres Protektionismus zu bleiben, sondern beizutreten und ihr Entwicklungsprojekt zu werden, traf sich mit einem Expansionsprogramm der erfolgreichen EG-Staaten, die die iberische Halbinsel schon lange als eigentlich zum EG-Raum gehörig betrachteten.
Das Glück, zum Expansionsterritorium des europäischen Kapitalwachstums zu werden, war für Spanien aber nicht so billig zu haben – und die prinzipielle Wechselseitigkeit des Interesses aneinander hat die EG gar nicht daran gehindert, sich gegenüber dem neuen Mitglied erst einmal als ein riesiger Protektionismus zu betätigen, der die Interessen der alten Mitgliedsstaaten zum Gesetz für die neuen machte. Das Land „europatauglich“ machen – das Programm aller Regierungen seit dem Ende des Faschismus – hieß denn auch überhaupt nicht einfach, Landwirtschaft und Industrie produktiver und konkurrenzfähig zu machen, um national die überlegene Konkurrenz aus dem Ausland aushalten und die offenen Märkte schließlich auch nutzen zu können. Spanien europatauglich machen, das hieß vor allem, dem gegen Spanien gerichteten EG-Protektionismus recht zu geben, um ihn loszuwerden. Die auf die Erfüllung der Aufnahmekriterien gerichtete Wirtschaftspolitik machte nicht in erster Linie Wirtschaftszweige konkurrenzfähig, die es nicht waren, sie demontierte welche, die es waren, um nach Europa zu dürfen.
Die Wirtschaftspolitik des Estado español besteht seit zwanzig Jahren in einer einzigen Kraftanstrengung, das ganze Land umzupflügen, um die Bedingungen der EG-Vollmitgliedschaft zu erfüllen. Dieses Werk von Öffnung und Demontage wurde von der Regierung Felipe González konsequent zuende geführt. Der Sozialist setzte alle Härten, die das demokratische Europa für Spanien bedeutete, als die einzig mögliche Alternative zum Faschismus durch.
Von diesem hatte das demokratische Königreich eine Nationalökonomie geerbt,
– mit einer dem Ideal der Autarkie verpflichteten Schwerindustrie und Energieversorgung;
– mit einer Landwirtschaft, die auf den inländischen Markt ausgerichtet und den natürlichen Besonderheiten des Landes angepaßt war, die den Kleinbauern und Tagelöhnern die Subsistenz und dem Grundbesitz eine stattliche Rente gewährte;
– mit einer Tourismusindustrie, die dem Staat die Devisen einbrachte, um die nötigen Importe an Nahrungsmitteln und Rohstoffen vor allem aus Lateinamerika, Nordafrika und den USA zu bezahlen.
Von den Zahlen her verfügte der spanische Staat dabei über erstaunliche Kapazitäten (noch 1970 weltweit der 3. Platz im Schiffbau, mehr Stahl als die meisten EG-Staaten, größte Fischfangflotte Europas, Weltspitze in der Olivenölproduktion etc.). Für die Europäische Gemeinschaft lagen jedoch gerade darin die Hindernisse einer Integration des spanischen Staates. Gegen alle chancenreichen Konkurrenzmittel der spanischen Ökonomie existierten protektionistische Mauern des vereinigten Eurokapitalismus. Spanien stellte seinen radikalen Europawillen dadurch unter Beweis, daß es alle Ausschlußbestimmungen anerkannte und sich bemühte, sie noch vor den Beitrittsverhandlungen zu erfüllen.
Die reconversión industrial setzte mit allen Konsequenzen das Prinzip „europatauglich durch Produktionsabbau“ in die Praxis um.
– Die im INI (Instituto Nacional de Industria) unter staatlicher Regie zusammengefaßten Unternehmen Hunosa (Bergbau), ENDESA (Elektr. Energie), ENSIDESA (Eisen und Stahl), Enfersa (Düngemittel), CASA (Rüstung), AESA (Schiffbau) hatten durch den Ausschluß ausländischer und durch die Benachteiligung privater inländischer Konkurrenz diejenigen Märkte monopolisiert, an denen das europäische Kapital besonders interessiert war. Bei Eisen und Stahl sowie in der Werftindustrie tobten innerhalb der EG selbst Kämpfe um den Abbau von Überkapazitäten; die engagierten Kapitale rangen um Staatssubventionen und EG-Produktionsquoten. EG-Reife hieß also in diesem Bereich „gesundschrumpfen“, mit weniger Masse um so höhere Rentabilität erreichen, wenn möglich privatisieren. Der Staat setzte den Kapazitätsabbau in der Werftindustrie sowie bei Eisen und Stahl unter Einsatz von Gewalt gegen den militanten Widerstand von Arbeitern und Bevölkerung in Asturien, Bizkaia, Valéncia und um Cádiz durch.
– Im Bereich der verarbeitenden Industrie, die im spanischen Staat bis in die sechziger Jahre hinein die Domäne der PYMES (Pequenas y medias empresas = kleine und mittlere Unternehmen) gewesen war, hob Spanien als Vorleistung für den EG-Anschluß schon mit Beginn des Assoziierungsabkommens alle Schranken für Waren aus dem EWG-Raum auf. Ganz bewußt verzichtete man auf den Schutz, den die Staatsgrenze der einheimischen kleinen Industrie bot, und nahm deren absehbaren Ruin in Kauf. Die Regierung Suárez setzte stattdessen auf die Attraktion von Auslandskapital zur „Internationalisierung“ der Wirtschaft. Sie sollte die Konzentration des Kapitals in Spanien beschleunigen und ihre Konkurrenzfähigkeit auf dem europäischen und Weltmarkt steigern. Angesichts der Sicherheit, die die absehbare EG-Mitgliedschaft bot, nahmen Industrielle aus der EG das Angebot an, sie nutzten den spanischen Markt, und manche investierten auch. Namentlich die Lebensmittel- und chemische Industrie, Elektronik und Informatik, Reifen und Gummi und die Automobilindustrie werden nun fast ausschließlich von multinationalem Kapital betrieben. Die Investitionen aus dem Ausland (Spitzenreiter sind hier die Niederlande, gefolgt von Frankreich, Großbritannien und der Schweiz) verursachten massenhaft Pleiten in den Reihen der PYMES. Manche bisherige Produktion unterblieb im Lande ganz, manche regionale Brache trat an die Stelle des früheren Produzierens auf niedriger Produktivitätsstufe. Die als Investitionsanreiz vom Staat eingeräumten Steuerbefreiungen mit jahrzehntelangen Laufzeiten hielten die Vorteile für den Staatshaushalt aus dem Erfolg seiner internationalisierten Wirtschaft in bescheidenen Grenzen und disharmonierten mit der Belastung seiner Sozialkassen durch die permanente Freisetzung von Arbeitskräften, die dank der rationell produzierenden Großkapitale keine neue Verwendung fanden und das spanische Arbeitslosenheer vergrößerten. Es hat sich in den letzten 20 Jahren kontinuierlich bei offiziellen 17-19 % gehalten.
– Um französische und italienische Vorbehalte gegen die Süderweiterung der EG zu besänftigen, hat der spanische Staat auf dem Feld der Landwirtschaft „Strukturveränderungen“ in einem Maße durchgesetzt, daß sich dadurch nicht bloß die Landwirtschaft, sondern gleich das Land selbst mit noch gar nicht absehbaren Konsequenzen verändert hat: Der spanische Anschlußwille und der europäische Erschließungswille rieben sich an dem Umstand, daß die konkurrenzfähigsten Erzeugnisse südlich der Pyrenäen, Olivenöl und Wein, zugleich auf die erbittertste Konkurrenz innerhalb der EWG stießen. Also setzte Madrid Abholzprämien für Olivenbaumbestände aus und offerierte Staatsgelder für die Umstellung auf EWG-konforme Produkte wie Sojabohnen und Sonnenblumenöl. Um im Bereich des Gemüse- und Obstanbaus mit der Treibhauskonkurrenz aus Holland fertig zu werden, subventionierte Madrid in den Jahren vor dem EG-Beitritt die Industrialisierung der Huerta-Agrikultur. Namentlich in der Provinz Almeria wurden statt einzelner Gärten ganze Landstriche unter Wasser gesetzt, mit Plastik überdacht und mit Dünger bestreut, so daß die agrarindustriellen Kooperativen jetzt das ganze Jahr hindurch Apfelsinen und Tomaten ernten können. Mit dem EG-Beitritt haben diese Produkte dank modernisierter Transportwege auch ihre Erfolge im europäischen Geschäft errungen. Die Technik der cultivos enarenados verwandelt jedoch die Böden nach und nach in sterilen Sand, so daß die Tomaten nur noch aus dem Kunstdünger wachsen. Die gigantischen neuen Stauseen in Andalusien, aus denen das Wasser für die Dauerbewässerung kommt, haben den Grundwasserspiegel so abgesenkt, daß außerhalb der Nutzflächen die Wüste wächst, der Wasserbedarf ständig steigt und die Erosion durch Wind und Wetter jedes Jahr 3 % des kultivierbaren Bodens abträgt. Daneben steuert die modernisierte Landwirtschaft einen erheblichen, statistisch nicht berücksichtigten Teil zur Arbeitslosigkeit im Lande bei, nämlich die im andalusischen empleo común dahinvegetierenden jornaleros: Weil nach diesem aus dem Feudalismus überkommenen System die von den Latifundien benötigten Arbeitstage gerecht auf die Köpfe der ortsansässigen Taglöhner aufgeteilt werden, haben große Teile des Landvolks im Süden zwar durchschnittlich nur noch 60 Tage bezahlte Arbeit im Jahr auf dem ständig modernisierten und den EG-Normen angepaßten campo; sie gelten aber nicht als arbeitslos, kriegen als „Saisonarbeiter“ bloß eine Beihilfe aus einem Sozialfond der Regionalregierung, der bei einem Drittel des landesüblichen Stempelgeldes liegt.
– Für die arbeitenden Klassen wurde eine allgemeine Sozialversicherung eingeführt und als größte Errungenschaft des friedlichen Übergangs von der Diktatur des Caudillo zur kapitalistischen EG-Demokratie gefeiert. Der Standortvergleich mit dem fortgeschrittenen Europa entlarvte die Wohltat aber schnell als zu teuer für Spanien und als einen Nachteil in der europäischen Konkurrenz. Seit seiner Einführung wird der Sozialstaat daher kostensenkend „reformiert“. Das besonders liberale Streikrecht und die starke Stellung der Gewerkschaften bei der betrieblichen Mitbestimmung, beides antifaschistische Wiedergutmachung an der Arbeiterbewegung, mit der die junge Demokratie die Werktätigen betörte, werden seit Mitte der 80er Jahre als Konkurrenzhindernisse und mangelnde Europareife diskutiert. Die PSOE nahm den Abfall der parteieigenen Gewerkschaftsgründung UGT in Kauf, und die Regierung hat gegen zwei Generalstreiks der Gewerkschaftsbewegung inzwischen ein neues Betriebsverfassungsgesetz, ein Streikgesetz, eine Kürzung der Arbeitslosenhilfe, einen Ausschluß von „Sozialparasiten“ aus der Altersversorgung und radikale Kontrollen zur Hebung des Gesundheitsstandes bei Arbeitern und Angestellten (Karenztage vor einer Lohnfortzahlung im Krankheitsfall) eingeführt und durchgesetzt.
Am 1. Januar 1986 wurde Spanien endlich Vollmitglied der EG. Dieses Datum signalisierte aber noch lange nicht das Ende der Vorleistungen und der „nationalen Opfer für Europa“. Der Vorteil, nun in Europa zu sein, und am Protektionismus gegen außen zu partizipieren, stellte sich erst ganz langsam und nach einer weiteren Periode des Übergangs ein:
– Mit dem Beitritt waren die spanischen Produktionsstätten von Eisen und Stahl Bestandteil der europäischen Montanindustrie und fielen unter die Quotenregelung der EG. Madrid bekam eine Drei-Jahresfrist eingeräumt, um die Industriereform so zu Ende zu bringen, daß die EG-Normen erfüllt wurden. 1986 begann die zweite Phase der Demontagen bei Eisen, Stahl und Werften und fiel wesentlich radikaler aus als die erste Stillegungswelle Ende der 70er Jahre, weil die Perspektive einer Erhaltung durch die Herbeiführung von Konkurrenzfähigkeit nun entfiel. Frankreich und Großbritannien setzten für drei Jahre Beschränkungen spanischer Ausfuhren aus dem Montanbereich in die EG durch. Den übrigen EG-Staaten eröffnete der Beitrittsvertrag umgekehrt sofort die Möglichkeit, in den spanischen Markt zu exportieren.
– Im landwirtschaftlichen Bereich mußte das Königreich de facto eine 10jährige Stornierung entscheidender Wirkungen des EG-Beitritts akzeptieren, um das Veto von Franzosen und Italienern vom Verhandlungstisch zu kriegen. Der später vereinbarte europäische Binnenmarkt hat diese „Übergangszeit“ verkürzt. Dennoch bleiben auch nach dem 1. Januar 1993 für die spanische Landwirtschaft so wichtige Exportschlager wie Melonen, Ölfrüchte und Pfirsiche noch drei Jahre lang Beschränkungen unterworfen.
Der spanische Erfolg: Wachstums- und Entwicklungsprojekt der EG geworden
Spanien hat seine Souveränität dem Vollzug von Imperativen der EG gewidmet. In lauter souveränen Akten hat dieser Staat Teile seiner Industrie zerschlagen und andere Bereiche von Handel und Wandel, auf denen das nationale Leben beruht hatte, dem Ruin ausgesetzt oder aktiv ruiniert. Dabei wurden massenhaft Existenzweisen vernichtet: Kleingewerbe und Landvolk können nicht mehr leben wie bisher – die neue Weltökonomie der Nation kann sie nicht brauchen. Die Arbeiterschaft, die dem internationalisierten Kapital nun zur Verfügung steht und Lohn bezieht, hat einen höchst zweifelhaften Zugewinn an „Lebensqualität“ zu verzeichnen. Fast 20 % Arbeitslosigkeit bewirken außerdem ein solches Maß an Unsicherheit und Unberechenbarkeit des Auskommens, daß sich glatt eine gewisse Nostalgie für den faschistischen Ständestaat einstellt, wo sich zumindest jedermann für ein Spottgeld besaufen konnte. Aber das alles zählt nicht. Wegen dieser Leute und ihrer Lebensbedingungen ist Spanien nicht der EG beigetreten, an ihrer Lage bemißt die Nation nicht Erfolg oder Mißerfolg ihres Weges.
Was aber den nationalen Standpunkt betrifft, so hat der spanische Staat von der EG durchaus bekommen, was er wollte: Er wurde in ihren Protektionismus einbezogen und verfügt nun über einen echten Euro-Standort für expansionswilliges Kapital. Die politische Garantie, die in der Mitgliedschaft steckt, wurde ergänzt dadurch, daß Spanien am soliden Kredit der europäischen Hauptmächte partizipieren durfte. Die Teilnahme der Peseta am EWS gab Kapitalanlagen und Finanzinvestitionen in Spanien die Sicherheit, jederzeit vergleichbar mit Anlagen in bestem deutschem Weltgeld zu sein. Und schließlich bekommt Spanien, erst einmal richtiges Mitglied im Club, über den EG-Regional- sowie den geplanten Kohäsionsfonds Milliardenbeträge, die dafür sorgen sollen, daß die Nation sich die überlegene Konkurrenz der Partner auch leisten kann, bzw. daß sie erst einmal unabhängig vom Erfolg der Geschäfte deren Voraussetzungen, Verkehrswege und Infrastruktur, also die allgemeine Brauchbarkeit des spanischen Euro-Standorts herstellen kann.
Diese Garantien und Chancen haben funktioniert, Spanien wurde das europäische Wachstumsland; europäisches Kapital expandierte und investierte; und die internationalen Geldhaie spekulierten auf spanisches Wachstum. Spanien verfügte mit solidem Geld und positiven Bilanzen über eine wachsende ökonomische Basis seiner Macht.
Aber der erwünschte Kapitalimport seitens des großen EG-Kapitals – die spanische Regierung feierte den Einstieg von VW bei SEAT als ihren größten Erfolg – ging etwas anders aus, als es sich die spanische Wirtschaftspolitik mit ihrer nationalen Industrieholding INI vorgestellt hatte. Die INI sollte die Staatsindustrie zum Motor der Modernisierung und Konzentration des spanischen Kapitals machen und zwar durch Internationalisierung. Die großen Konzerne, bei denen öffentliche Mittel die Kapitaldecke stellen und für Kreditwürdigkeit bürgen, sollten ausländisches Kapital als Partner gewinnen, um es für sich und ihren nationalen Entwicklungsauftrag zu nutzen. Javier Sala, gegenwärtig Präsident des INI, möchte mit der Staatsindustrie
„als Teilhaber fungieren, der bei einigen Unternehmen einen harten Kapitalkern bildet und so die langfristige Kontinuität ihrer Vorhaben gewährleistet.“
Dieser Absicht staatlicher Investitionslenkung haben sich die dafür ausersehenen ausländischen Konzerne aber nicht dienstbar gemacht. Sie waren nicht bereit, ihr Profitinteresse dem staatlichen Projekt gezielter Steigerung der Produktivität und strategischer Unternehmensallianzen unterzuordnen. Das Kräfteverhältnis sah so aus, daß nicht die spanische Großindustrie das Auslandskapital zu ihrem Entwicklungshelfer machte, sondern umgekehrt eher ihre Glanzstücke zu Zweigniederlassungen europäischer Konzerne wurden. Auch VW tat es bei SEAT nicht unter einer kontrollierenden Mehrheit von 75 %, so daß alle Entscheidungen über Ausbau der Produktion oder Verlagerung von Kapazitäten seit 1985 in Wolfsburg getroffen werden und nicht in Madrid. Das hat noch nicht einmal einen Unterschied gemacht, solange überall immer mehr Autos verkauft werden konnten – noch 1985 war SEAT das Staatsunternehmen mit dem höchsten Defizit, im VW-Mehrheitsbesitz schrieb es bald schwarze Zahlen. Wer sich wen unterordnet und dienstbar macht, zeigt sich in der Krise der Autoindustrie: jetzt, wo sich der europäische Marktführer durch Produktionseinschränkungen zu sanieren versucht, jammert Barcelona, daß die Alemanes zugunsten heimatlicher Produktionsstätten Arbeitsplätze in ihren iberischen Werken „vernichten“.
Mit der Rolle als Wachstums- und Spekulationsprojekt europäischen Kapitals und mit seiner rücksichtslosen Anpassung an diese Rolle hat Spanien einen gefährlichen Erfolgsweg beschritten. Das Land hat sich von ganzen Produktionszweigen entblößt und die nationale Reproduktion vom Stand der Konkurrenz mit ausländischen Unternehmen und anderen Kapitalstandorten Europas sowie von den Berechnungen und damit auch den Krisen- und Konjunkturlagen auswärtigen Kapitals abhängig gemacht. In diesem Land hängt das konjunkturelle Auf und Ab nun etwas mehr vom Zustand der Konjunktur anderswo ab als in anderen Weltmarktnationen. Es macht einen gewaltigen Unterschied, ob in einem kapitalistischen Land, von dessen Boden die meisten und erfolgreicheren Geschäfte ausgehen, wieder einmal überakkumuliert worden ist und die Spekulation auf ewig wachsende Gewinne nicht aufging, oder ob ein Land in die Krise gerät, das ohnehin nur als Spekulationsobjekt und in Erwartung zukünftiger Chancen in die Akkumulation der großen Kapitale einbezogen worden ist.
Der Offenbarungseid Spaniens – wie der der britischen Regierung – stand in dem Augenblick an, als die von „Maastricht“ ausgehende Krise Europas und die Wirtschaftskrise in Europa zusammentrafen. Große Unternehmen wickelten ihre Konkurrenzprobleme mehr in und gegen Spanien ab als an anderen Fronten – ein Beispiel dafür ist die Geschäftspolitik von VW –; das ist das Eine. Zum anderen wandelt sich der geschäftliche Blick auf Spanien überhaupt, wenn die Maßstäbe des Maastrichter Vertrages angelegt werden – und die Bedingungen, unter denen das Land dasteht, solte er Vertrag scheitern, sind auch nicht besser. Im einen wie im anderen Fall steht die Nation nämlich in gewisser Weise alleine da, muß aus eigenen Kräften für ein nationales Geld einstehen, das sich in puncto Staatsschulden, Inflationsrate, Kursstabilität und Zinsen dem Vergleich mit der europäischen Spitzengruppe stellen muß. Damit hieß die Frage an Spanien nicht mehr: Was läßt sich dort mit wachsendem europäischem Kredit noch alles anstellen, sondern umgekehrt: Was taugen die spanischen Zahlungsversprechen, wenn man die Kreditierung und die Geldkapitalanlage vom Ausland her einmal abzieht. Die Nation, deren Blüte ganz und gar auf der vom EWS-System gewollten und genehmigten Ausweitung der Verschuldung beruhte, wird danach geprüft, ob sie ganz alleine für die Schulden geradestehen kann, die die EG dem Land ermöglicht hat.
Kaum wurde Spanien von der internationalen Geldwelt unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, standen kreditfinanzierte Investitionen nicht mehr für die Zukunft des Gewinns, sondern für die Gegenwart der Zahlungsunfähigkeit. Deshalb waren auf einmal Geschäfte keine mehr, die gerade noch Gewinne abgeworfen hatten, viele Rechnungen gingen nicht mehr auf, viele Finanztechniken wurden untragbar, weil das Ausland das Vertrauen in die Spekulation auf Spanien verloren hatte und Geld abzog bzw. zurückforderte.
Die Industrieholding TORRAS und ihr Zusammenbruch im Sommer 1992 ist beispielhaft: Die Kuwaitische Investment Organisation KIO, die der Shaba-Familie oder dem Staat Kuwait – was dasselbe ist – gehört, hatte sich diese Holding seit 1980 für Milliarden Petrodollars von einem prominenten Wirtschaftsmanager zusammenkaufen lassen. Der spanische Staat unterstützte diese beispielhafte „Internationalisierung“, gewährte großzügige Freistellung von der Vermögenssteuer, unbeschränkten Gewinntransfer und sorgte durch sein Engagement für einen ziemlich unbegrenzten Kredit von Torras bei spanischen Banken. Im Sommer erklärte die Holding „plötzlich“ und „überraschend“, daß sie für die Verbindlichkeiten der von ihr gehaltenen Unternehmen nicht mehr einstehen werde. Der Grund für die überraschend verweigerte Schuldenbedienung von Torras war der Rückzug von KIO aus Spanien – mit der Begründung, man sei enttäuscht vom Ertrag der spanischen Investitionen. Als Rückzahlung und Schuldentilgung wurden den Banken nun Aktienpakete der fallierenden Firmen angeboten, deren Kurswert gerade durch die Torras-Probleme ins Bodenlose gesunken waren.
Jetzt will die Regierung von der KIO hinters Licht geführt worden sein und fordert ihre Subventionen zurück; KIO will seinerseits von seinen spanischen Managern betrogen worden sein – und die Banken von beiden.
So setzt die Maastrichter Sorge um den unsolid aufgeblähten Kredit in Europa, und der politische Wille, die notwendige Bereinigung den Nationen als Vorleistung für den Beitritt zur Währungsunion aufzubürden, in Spanien die ökonomische Krise durch. In ganz Europa hat das Kapital überakkumuliert, Spanien muß ein Gutteil davon nun national ausbaden. Deshalb heißt es, Spanien habe sich übernommen.
Die Antwort auf die Krise I: Schuldfragen
Angesichts der Krise ihres Europa-Projekts wird die spanische Nation geradezu selbstkritisch: 20 Jahre lang angepaßt, Land und Leute umgewälzt, und was ist dabei herausgekommen?
„… als unsere Regierenden von heute auf morgen entdeckten, daß sie ihre aufgeschatzten Gelder falsch gezählt hatten, daß es hierzulande kein Geld gab, daß keiner den anderen bezahlte, daß man zur Kurserhaltung der Peseta erst Milliarden ausgeben und sie dann doch abwerten mußte, und wieder Geld für sie ausgeben und sie wieder abwerten mußte wie bei schlechten Weibern; daß die Arbeitslosenzahl sich vervielfachte; daß die Sozialeinrichtungen privatisiert werden mußten; aber daß das letzten Endes eine gemeinsame Anstrengung zu sein hatte – von den einen mehr als von den andern, gewiß –, um die zur Angleichung an Europa vorgesehenen Marksteine zu erreichen. Wir waren schon folgsam geworden: Wir schlossen schon Minen und Stahlwerke und ließen Felder brachliegen, und wir vertilgten die Milchkühe, ja sogar die Kohle; und die Werften und Hochöfen bleiben kalt, und den Fischfang teilten wir ehrlich auf, ohne dem Nachbarn etwas wegzunehmen. Und jetzt – mit einem Schlag in die Fresse, der eigentlich der Vergangenheit angehören sollte, stehen wir ohne alles das da, und auch noch ohne den Gegenwert, ohne die Subventionen der Gemeinschaft.“ (Eduardo Haro Tecglen in: El País Semanal, 27.12.92)
So leidet der spanische Nationalstolz. Und er weiß auch woran:
„Aus Hunnen sind DM geworden, und Lebensraum und Geopolitik, was einmal Hitlers Begriffe waren, werden schließlich Wirklichkeit.“
Für einen Austritt aus Europa plädiert der Mann aber nicht. Weder ihm noch sonst einer politischen Richtung fällt eine nationale Alternative zur EG-Integration ein. Das Projekt bleibt anerkannt. Wenn Spanien dadurch nicht so groß, reich und stark wird wie erhofft, sondern an zwei Tagen um 11 % billiger und auch sonst nicht krisenfest, dann muß irgendwer das gute Rezept verdorben haben.
An Europas Führungsmacht bleibt der Vorwurf aber nicht so recht hängen. Erstens ist das Kräfteverhältnis klar: Spanien braucht Hitlers Hunnen mehr als umgekehrt. Zweitens wäre eine Absage an Deutschland und seine Mark dasselbe wie der Abschied von Europa – den keiner will. Also sucht die Schuldfrage sich andere Täter und findet sie im eigenen Land.
Zum einen die Politiker, denen das demokratisch gereifte Volk sein Vertrauen geschenkt hat, damit sie die Nation modern und erfolgreich machen. Den Erfolg sind sie schuldig geblieben; und das nimmt eine demokratische Öffentlichkeit gleich so, daß sie das Recht der Nation auf Erfolg verletzt haben. Unter diesem Blickwinkel tritt auf einmal als Skandal hervor, was man bislang für eher normal, menschlich und verständlich gehalten hat: In Sevilla hat man die Bruchbuden der Slums wegen des schlechten Eindrucks auf die Expo-Besucher plattgewalzt und aus öffentlichen Mitteln Wohnungen hingebaut; diese sind als Eigentumswohnungen verkauft worden und vornehmlich bei Mitgliedern und Förderern der PSOE gelandet. Die meisten öffentlichen Bauprojekte in der andalusischen Hauptstadt wurden darüber hinaus von Firmen ausgeführt, deren Angebote weit über denen der Konkurrenz lagen – Juan Guerra, Bruder des Vizepräsidenten von Regierung und PSOE, Alfonso Guerra, oder irgendein Verwandter eines anderen Mandatars waren Teilhaber dieser Firmen und verdienten gut. Und so weiter. Beispiele dieser Art gibt es haufenweise. Der Schluß ist klar: Die seit 10 Jahren regierende sozialistische Partei PSOE hat abgewirtschaftet; die meisten ihrer hohen Mandatsträger sind korrupt; gerade daß Felipe González selbst noch eine weiße Weste hat. Aber auch die größte Oppositionspartei gewinnt nicht das Volksvertrauen, das die PSOE verliert; sie ist in illegale Parteifinanzierungsgeschäfte verwickelt. Und nebenbei: Selbst die Polizeitruppe guardia civil ist nicht mehr hart und sauber – sie handelt mit Drogen.
Bei soviel Schlechtigkeit in Amt und Würden muß die Nation sich allerdings auch fragen, was an ihr selber faul ist. Und darüber entwickelt sich ein interessantes Stück politischer Kultur: Die mit sich unzufriedene Nation entdeckt die Tatsache neu, daß sie selber ziemlich zusammengesetzt ist, nämlich so, daß ein Teil den andern, die Zentrale alle Teile und alle Teile die Zentrale als Hindernis des je eigenen Erfolgs entlarven. Da kursiert zum Beispiel, neben jeder Menge schlechter Meinungen über Madrid und umgekehrt über die Peripherie, allen Ernstes das Gerücht, der Anteil der Staatsausgaben am Bruttosozialprodukt wäre deswegen zwischen 1977 und 1991 von 20 % auf 40 % angestiegen, weil sich so viele Provinzpolitiker selbst bedienen dürften. Diese ihrerseits tun etwas für ihr Geld: Streng nach Provinzgrenzen achten sie aufs Wasser, das aus gar nicht natürlichen Gründen knapp ist in diesem trockenen Land. Im Januar 1993 herrscht in 14 Großstädten Wasserknappheit. In Sevilla dreht die Stadtverwaltung ihren Bürgern täglich 12 Stunden das Wasser ab, in Catalunya melden Fabriken Kurzarbeit an wegen Wassermangel, in Valéncia droht Teilen der huerta-Landwirtschaft die Ausdörrung. Dazu erklärt Señor Emilio Eiroa, Präsident der junta in der autonomen Region Aragón, durch dessen Gebiet zufälligerweise der Ebro rinnt, trocken:
„Solange bei uns nicht die Staudämme gebaut werden, die Aragón dringend braucht, können wir nicht mit Sicherheit feststellen, daß wir einen Tropfen Ebro-Wasser mehr abgeben können. Meine Landsleute wären zwar dazu bereit, in der hohlen Hand Wasser nach Andalusien zu tragen, wenn es dort Menschen zum Trinken brauchen. Aber wir denken nicht im Traum an Solidarität mit Regionen, die reicher und mächtiger sind als wir. Die (von der Zentralregierung in Madrid) geplanten Wasserumleitungen sind nicht für Andalusien bestimmt, sondern gehen nach Catalunya und Valéncia.“ (El País, 20.1.93)
So bewährt sich das Schmuckstück der friedlichen Bewältigung des Franco-Faschismus durch die demokratische Monarchie, der estado de las autonomias, der eigens erfunden und eingerichtet worden war, um der Borniertheit der nacionalidades und comunidades einen gesamtstaatsbürgerlichen Dienst abzugewinnen, nämlich freiwillige Zustimmung zum neuen Staat, der ihnen im erklärten Gegensatz zu Francos Nación eigene Rechte gewährt.
Die Antwort auf die Schuldfrage II: Weiter so!
Das alles löst natürlich nicht das eigentliche Problem, wie Spanien erstens ohne allzuviele weitere Beschädigungen aus der Krise herauskommt und zweitens auf längere Sicht den Kriterien von Maastricht genügen kann, die im vergangenen Frühherbst von der Finanzwelt an die Nation angelegt worden sind und unplanmäßig die Währungskrise ausgelöst haben. Zwar ist das Land nach zweimaliger Abwertung der Peseta im EWS geblieben; dessen Kreditgarantie funktioniert also wieder; aber den Staatsschatz hat die Spekulation des Sommers schon dezimiert; und wer sein Geld in Pesetas nachzählt, der spanische Staat selbst vor allem, zählt 11 % weniger nach; weniger als die Konkurrenz, mit der man doch gleichziehen wollte – und an der die Nation sich und ihren Erfolg weiterhin mißt.
Um die Konkurrenz besser zu bestehen, tut der spanische Staat alles, was seine europäischen Konkurrenten derzeit auch tun. Vor allem für seine Kassen, also gegen die Belastung seines nationalen Kredits: Er erhöht die Mehrwertsteuer, die Lohnsteuer, die Gebühren für Dienstleistungen aller Art; am Arbeitslosengeld wird gespart. Hierbei gibt es einige erwähnenswerte Besonderheiten.
So kann sich der spanische Fiskus eine erhebliche Erweiterung seiner Einnahmequellen ausrechnen, wenn er bei seinen Unternehmern und Freiberuflern das Steuerzahlen nicht mehr so großzügig wie bisher deren Ehrlichkeit und eigenen Ermessen überläßt.
„Aus den 1988 von der Kommission für Steuerbetrug des Wirtschaftsministeriums veröffentlichten Daten geht hervor, daß jeder dritte einkommenssteuerpflichtige Spanier keine Steuererklärung vorlegt. So blieben dem Fiskus 1986 45 % der steuerpflichtigen Einkommen verborgen. Die größte Steuerhinterziehung findet sich bei den Einkommen, die aus Kapital, unternehmerischer und freiberuflicher Tätigkeit entstehen. 70 % dieser Einkommen entziehen sich der steuerlichen Kontrolle.“ (Nohlen/Hildenbrand, Spanien, 1992)
Zum stark expansiven Entwicklungsprojekt, das Spanien sein wollte, hat es gepaßt, daß der Staat sich mit dem steuerlichen Zugriff zurückhielt und die Freiheit der Bereicherung nicht mit Steuerpflichten einengte. Jetzt, wo die Sanierung der Staatskasse erste nationale Priorität ist, soll die Einführung einer Steuernummer für jeden Bürger und die Pflicht, sie bei Eröffnung eines Bankkontos vorzuweisen, dafür sorgen, daß kein Gewerbe mehr stattfindet, ohne daß der Staat die Hand dazwischen hat; und eine verschärfte Steuerfahndung erleichtert den Steuerpflichtigen die schwierige Tugend der Steuerehrlichkeit. Aufgedeckt werden soll überhaupt alles, was der Staat bislang als economia oculta geduldet hat – auf 15 bis 20 % des Bruttosozialprodukts berechnet der Fiskus die Wirtschaftstätigkeit, die außerhalb seines Zugriffs vonstatten geht. Und wo er sich nichts holt, da kann der Staat wenigstens beim Sparen zulegen: Wirtschaftsminister Solchaga kürzt die Arbeitslosenhilfe und weist zur Rechtfertigung zynisch darauf hin, daß von der Staatsknete ohnehin niemand leben kann, ihre Kürzung also in Wahrheit bloß eine Form der Besteuerung von Schwarzarbeit sei.
Daneben gibt es noch einen Restposten aus den Frühlingstagen der jungen spanischen Demokratie zu liquidieren: ein freizügiges Streikrecht, das von unorganisierten Belegschaften zum Streiken mißbraucht werden konnte. Das neue Ley de Huelga nimmt sich das Gewerkschaftsdekret der Margaret Thatcher zum Vorbild und findet die Zustimmung der Mehrheitsgewerkschaften UGT und CCOO, die für wilde Streiks schon längst nichts übrig haben.
Die Regierung tut also alles für Spaniens Europatauglichkeit – und zumindest weiß eine demokratische Öffentlichkeit bewiesene Tatkraft zu schätzen und gegen Korruptionsvorwürfe aufzurechnen. Die Wirkung im europäischen Konkurrenzkampf bleibt eine andere Frage. Wenn alle EG-Staaten ihr Volk schröpfen und mehr Geld einsammeln, den Lohn senken und am Lohnersatz sparen, dann können die Geschädigten der EG-Krise ihre Konkurrenzlage kaum verbessern, wenn sie dasselbe tun. Erst recht können sie es sich aber nicht leisten, irgendetwas zu unterlassen und Rücksicht walten zu lassen. Spanien jedenfalls bleibt auf diese Weise seinem „Weg nach Europa“ treu: Es erbringt Vorleistungen auf eine Anpassung, deren Erfolg es gar nicht in der Hand hat, weil darüber die Standortkonkurrenz der Nationen entscheidet.