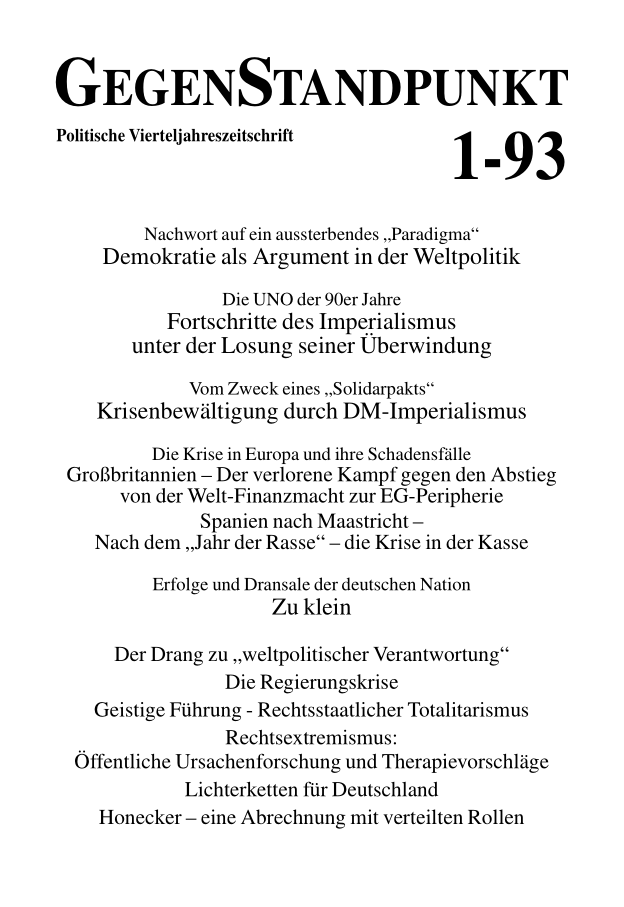Großbritannien
Der verlorene Kampf gegen den Abstieg von der Welt-Finanzmacht zur EG-Peripherie
Maastricht-Prozess und Krise führen zu einer durchgreifenden Bereinigung des überakkumulierten europäischen Kredits, die Spekulation an den Finanzmärkten setzt eine massive Abwertung von Peseta (s. Teil 2) und Pfund durch. Englands Weg in die EG, Thatcher‘s Monetarismus und der EWS-Beitritt unter Major zeigen, dass diese Niederlage in der Währungskonkurrenz keineswegs verfehlten finanz- oder wirtschaftspolitischen Maßnahmen geschuldet war, sondern sich vielmehr dem schlichten Umstand verdankt hat, dass britische Firmen, als „EG-Späteinsteiger“, der kapitalistischen Konkurrenz auf dem gemeinsamen Markt nicht in ausreichendem Maß gewachsen waren.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Siehe auch
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Die Krise in Europa und ihre Schadensfälle: Großbritannien
Der verlorene Kampf gegen den Abstieg von der Welt-Finanzmacht zur EG-Peripherie
Am 16. September 1992, in Großbritannien der „schwarze Mittwoch“ genannt, wurde das Pfund Sterling um 15 bis 20 Prozent abgewertet. Mit einer „Kurskorrektur“ oder „-anpassung“ hatte das nichts zutun; die Geldmärkte setzten einen neuen Wert des Pfundes durch. Massive Stützungskäufe der britischen und deutschen Zentralbank nach dem EWS-Mechanismus waren wirkungslos und wurden – von der britischen Seite auch wegen drohender Erschöpfung der Reserven – eingestellt.
Gescheitert war damit das Programm der Regierung Major, auf Biegen und Brechen den Kurs zu verteidigen, mit dem das Pfund zweieinhalb Jahre zuvor ins EWS eingegliedert worden war. Dieses Programm stand freilich für mehr als die persönliche Marotte des Schatzkanzlers, der über den Beitritt Englands zum EWS Regierungschef geworden war; auch wenn die Sache nach ihrem Fehlschlag gern so gedeutet wurde. Die schlagartige Entwertung der britischen Währung um ein Fünftel gegenüber der D-Mark war der Offenbarungseid über den Anspruch Großbritanniens, in Europa und durchs EWS eine Position der weltwirtschaftlichen Stärke zurückzugewinnen, die die Nation an Europa und – innerhalb der EG – an die Führungsmächte der europäischen Wirtschaft und Gründer des EWS verloren hatte. Gescheitert war dieses Programm schon zuvor, Stück um Stück.
Englands Weg in die EG
1979 gewann Margret Thatcher die Unterhauswahl damit, daß sie die Unzufriedenheit der Nation mit ihren Reichtumsquellen zum zentralen Punkt der politischen Tagesordnung und zum Anlaß einer prinzipiellen wirtschaftspolitischen Wende machte: Seit dem Krieg sei die Nation ein einziger Fehlschlag gewesen, und sie, Mrs. Thatcher, könne die Gelassenheit, ja Selbstzufriedenheit derer nicht verstehen, die den Niedergang der Nation verwalteten.
Dabei waren ja auch ihre Vorgänger nicht untätig geblieben. Auch sie hatten die Staatsmacht dafür eingesetzt, den Gang des kapitalistischen Geschäfts zu beleben und seine nationalen Erträge aufs staatlich Erwünschte zu heben. Die diversen Labour-Kabinette nach dem Krieg hatten hierfür auf das Mittel der progressiven Verstaatlichung der nationalen Industrie gesetzt. Als Unterabteilungen des Staatshaushalts sollten die Industrien den nötigen Kredit zur Aufrechterhaltung, Erweiterung und Rationalisierung ihrer Geschäftstätigkeit erhalten. Mit Staatsschulden, die fehlende Gewinne und fehlendes Zusatzkapital ersetzten, sollte der Umfang der nationalen Produktion, das Niveau von Umsatz und Austausch erhalten und gesteigert werden.
Das Kapital in Großbritannien wurde dadurch allerdings nicht um soviel produktiver, daß es die Konkurrenz mit den Unternehmen anderer Nationen und deren Wachstumsraten für sich hätte entscheiden können; und dieses Ergebnis zehrte an dem Kredit, mit dem der Staat diesen Erfolg herbeiführen wollte, stattdessen aber zunehmend bloß Verluste und Konkurrenznachteile ausgleichen mußte. Das in großen Mengen verausgabte Pfund fiel von 12 DM im Jahr 1950 auf 3,90 DM beim Amtsantritt von Frau Thatcher.
Die Gründe für diese Entwicklung waren denkbar banal: Großbritanniens Wirtschaft war das erste prominente Opfer des Erfolgs der EG. Deren Gründer hatten sich einem Kampfprogramm zur Eroberung des Weltmarkts verschrieben und setzten auf prinzipielle Wachstumsförderung durch einen großen Wirtschaftsraum statt bloß durch einseitige nationale Handelsvorteile. Sie taten sich die Härten einer wirklichen Zollunion rücksichtslos an und ließen nicht zu, daß ihr Fortschritt von ruinösen Wirkungen auf diesen oder jenen Wirtschaftszweig gebremst wurde; durch Protektionismus nach außen sicherten sie sich andererseits den Nutzen dieser Rücksichtslosigkeit. Großbritannien erlebte den Konkurrenzdruck dieses Unternehmens, und es fand dagegen kein adäquates Mittel. Seine Antwort auf die EG, die „kleine Freihandelszone“ EFTA, war vom Standpunkt nationaler Handelsvorteile aus aufgezogen und brachte es daher nie zum völligen Abbau nationaler Handelsvorbehalte und -beschränkungen; sie zwang ihre Mitglieder nie so rücksichtslos zu internationaler Konkurrenzfähigkeit wie die EG; sie erschloß und organisierte nicht wie die EG einen entscheidenden Teil des Weltmarkts und wurde daher auch nicht zu einem konkurrenzfähigen Wachstumsmarkt. Außerhalb der EG, das stellte sich mit deren unbeirrbaren Fortschritten immer deutlicher heraus, waren alle anderen europäischen Wirtschaftsmächte und sogar das Heimatland des Manchester-Kapitalismus auf die Dauer zur Zweitklassigkeit und noch Schlimmerem verurteilt.
Dennoch tat sich Großbritannien mit dem Beitritt nicht leicht; aus politischen und nationalökonomischen Gründen, die für Nationalisten ohnehin nicht auseinanderzuhalten sind. Erstens stellte sich für das Vereinigte Königreich schon der Beitritt als solcher als politisches Opfer dar, als schmerzliche Preisgabe nationaler Souveränität – nicht ohne Grund. Denn das Projekt, gerade durch Abstriche bei der formellen Souveränität an wirtschaftlicher Macht zu gewinnen, war ja gar nicht von ihm ausgegangen; es war von anderen Nationen gewollt und vorangetrieben worden; es war gegen Staaten wie Großbritannien gerichtet, und Großbritannien war dagegen mit seinem europapolitischen Gegenprogramm, der EFTA eben, angetreten. Was für die EG-Gründungsstaaten ein gemeinsamer Aufbruch war und sich auch in diesem Sinne zu bewähren begann, war für England bis zuletzt der Hauptkonkurrent und Gegner geblieben – das Beitrittsgesuch kam insofern dem Eingeständnis einer Niederlage gleich. Zweitens waren mit dem Beitritt tatsächlich nicht bloß nationale Ehrenpunkte berührt, sondern weltweite Wirtschaftsbeziehungen in Frage gestellt, mit denen sich der britische Kapitalismus bislang zwar weniger, aber auf seine Weise auch erfolgreich in der Welt eingerichtet hatte; vom Commonwealth bis hin zu den angloamerikanischen Sonderbeziehungen und zur EFTA. Viel davon mußte der Anpassung an den Protektionismus geopfert werden, den die EG ohne Großbritannien und zum Teil gegen dessen Weltmarktbeziehungen entwickelt hatte, der also zu den Schutzbedürfnissen der englischen Wirtschaft gar nicht paßte; so bedeuteten die Beitrittsbedingungen – ganz anders als bei den Gründungsnationen – eine Schädigung des Neulings. Drittens war das Königreich, bei aller eingestandenen Schwäche in der Konkurrenz gegen die EG, überhaupt nicht bereit, als anpassungsbereiter Schwächling und williges Opfer der von anderen diktierten Beitrittsbedingungen anzutreten. So weit reichte der wirtschaftspolitische Ehrgeiz des EFTA-Gründers schon, daß er die EG durch seinen Beitritt sich und seinen Wachstumsbedürfnissen anzupassen, für seinen nationalen Konkurrenzerfolg zu nutzen gedachte. Die Einordnung sollte durchaus keine Unterordnung sein, eher eine Unterordnung der in der EG üblich gewordenen Rechnungen und Berechnungen unter Bedingungen, die fürs kapitalistische Wirtschaften in Großbritannien günstig gewesen waren. Damit war nicht bloß viel zähes Verhandeln programmiert, sondern auch ein Verdacht bei den Gründungsmitgliedern der EG geweckt: daß der neue Partner gar nicht im gewünschten positiven Sinn beitreten wollte, also unter der Perspektive grenzenloser Konkurrenz im Innern und gemeinsamen Konkurrierens gegen außen, sondern eher in bremsender oder sogar destruktiver Absicht, nämlich mit dem Ziel, den Erfolgsweg zu stören und den Konkurrenzvorteil zunichte zu machen, den sich die alten EG-Partner mit ihrem Zusammenschluß geschaffen hatten. Unter zwar sachfremden, aber allerhöchsten französischen Rivalitäts- und Ehrengesichtspunkten bekam dieser Verdacht seinerzeit durch Präsident De Gaulle recht. Nicht Großbritannien, die EG zögerte den Beitritt um Jahre hinaus, in denen Zusammenschluß, Marktchancen, Kapitalgröße, also die entscheidenden Erfolgsbedingungen des kapitalistischen Wachstums innerhalb der alten Gemeinschaft vorankamen und die britische Wirtschaft davon ausgeschlossen blieb – zu ihrem wachsenden Nachteil.
Der EG-Beitritt, als er dann schließlich zustandekam, brachte nicht die Freisetzung bislang gehemmter Konkurrenzkräfte des in England eingehausten und staatlich geförderten Kapitals. Statt daß britische Unternehmen sich den EG-Markt zunutze machten, wurde mehr der britische Markt von EG-Kapitalisten erobert. Ganze Industriezweige auf der Insel waren gegen diesen Angriff nur durch noch mehr staatliche Hilfe zu erhalten. Und diese Hilfen hatten den Haken, daß sie es immer nicht recht bis dahin brachten, daß die begünstigten Firmen konkurrenzfähig wurden – was freilich nicht an diesen Hilfen lag, allenfalls an ihrer im Endeffekt doch nicht ausreichenden Höhe, nämlich an der überlegenen Wucht der Konkurrenz.
Das war die Lage, in der Frau Thatcher an die Macht kam; mit dem Versprechen, durch eine radikal neue Politik das Blatt zu wenden.
Der Thatcherismus: Radikalismus des gesunden Geldes
Im Rückblick wird dem „Thatcherismus“ vorgeworfen, er habe auf der Insel eine weitreichende „industrielle Verödung“ herbeigeführt. Darunter werden verschiedene Dinge subsumiert: das Verschwinden von Industrie aus einzelnen Landesteilen, das Verrotten von Infrastruktur, Abbau und Schließung von Staatsbetrieben. Margret Thatcher wird angekreidet, geradezu mutwillig Potenzen britischen Wirtschaftens vernichtet zu haben; Potenzen, die nun schmerzlich vermißt würden.
Tatsächlich bestand ein wesentlicher Teil der erfolgreichen Regierungstätigkeit von Frau Thatcher in dem praktisch wahrgemachten Verdacht, die britische Industrie sei so etwas wie ein Wasserkopf; sie würde zäh an veralteten Produktionsweisen festhalten, also unnötig große Kapazitäten mit entsprechend großen Mitarbeiterzahlen unterhalten und auf dem Absatz von Produkten bestehen, die niemand, insbesondere ausländische Käufer nicht, mehr haben wolle. Daß die Labour-Regierungen das negative Urteil des EG-Marktes über Teile der britischen Industrie nicht einfach akzeptiert, sondern Staatsgelder eingesetzt hatten, um sie zu erhalten und erst noch konkurrenzfähig zu machen, das aber erfolglos, diesen Befund verstand die neue Chefin so: Der Staat hätte es der Industrie zu deren und seinem Schaden erspart, sich selbst um ihre Konkurrenzfähigkeit zu kümmern und kaputtgehen zu lassen, was sich nicht aus eigener Kraft durchsetzte. Sie wollte nichts davon wissen, daß die Regierung die Industrie unter ihre Fittiche genommen hatte, weil sie gegen die EG-Konkurrenz einen schweren Stand hatte; vielmehr: Weil der Staat sie beschützt und ihr Härten erspart habe, sei sie unproduktiv geworden. Da mußte „gesundgeschrumpft“ werden.
Und nicht nur das. Nach der neuen herrschenden Meinung hatten die früheren Regierungen mit ihrer kostspieligen Fürsorge für nationale Industrien dem freien Unternehmertum den einzigen Dienst versagt, auf den es wirklich angekommen wäre, nämlich ein zuverlässig stabiles Geld. Die Entwertung des Pfundes zu stoppen, wurde zur obersten wirtschaftspolitischen Priorität erklärt. Ein Hebel dafür fand sich leicht: Gerade weil die Staatsmacht so tief ins Wirtschaftsleben der Nation eingemischt war und so viele Unkosten ihren Haushalt aufblähten, gab es enorm viel zu streichen und zu sparen. Im Glauben, die kreditfinanzierten Staatsausgaben hätten den Außenwert des Pfundes ruiniert, versteifte sich die Thatcher-Regierung auf das Ideal eines schuldenfreien Staatshaushalts; und sie hat dieses seltene Kunststück, wenn auch mit Hilfe einmaliger Privatisierungserlöse, ein paarmal hingekriegt. Und wie zum Beweis für ihre Diagnose war die Geldwelt begeistert, nahm den Willen für die Tat, die Ausgabenstreichung für die denkbar beste Stabilitätsgarantie, spekulierte aufs Pfund – und stoppte seinen Verfall.
Im Endeffekt hat sich diese Politik des „gesundgeschrumpften“ nationalen Produktionsapparats und des durch staatliche Sparsamkeit sanierten Geldes blamiert; aber nicht deswegen, weil dieses Rezept so speziell verkehrt gewesen wäre. Es war nicht richtiger und nicht verkehrter als die protektionistische Schuldenpolitik der Labour-Regierungen. Es ist nur so, daß über den Erfolg der einen wie der anderen Linie gar nicht die Linie entscheidet, sondern – begriffslos, wie die kapitalistische Konkurrenz nun einmal funktioniert – der Erfolg. Konkurrenzfähige Firmen hätten jeden „sozialistischen“ Staatskredit gerechtfertigt, nämlich zu einem Zuwachs an nationalen Reichtumspotenzen gemacht; erfolgreiche Firmen hätten genauso von einer Politik der Streichung des Staatsverbrauchs profitieren können. Umgekehrt lassen konkurrenzunfähige Firmen von den Staatssubventionen die bloße Schuldenlast stehen; sie verwandeln aber auch dann nicht die vom Staat ausgegebene Währung in gutes Geld, wenn der Staat für sich nicht mehr soviel davon beansprucht. Aber solche Banalitäten sind kein Leitfaden für zupackende Wirtschaftspolitiker. Frau Thatcher jedenfalls hatte den Beifall ihrer gesamten Wirtschaftswelt auf ihrer Seite, als sie die Ökonomie ihrer Nation angesichts der unschönen Konkurrenzlage einer unerbittlichen Roßkur unterzog. Die Heilmittel waren im einzelnen:
Reprivatisierung und Gesundschrumpfung der Staatsindustrie
Unter der Vorgabe, daß Industrien in Staatseigentum unproduktiv seien, private dagegen produktiv – so als ob dieser Unterschied am Eigentümer hinge –, hat die Thatcher-Regierung große Teile der verstaatlichten Wirtschaft wieder privatisiert. Damit machte sie keine Fabrik lohnend und konkurrenzfähig, die es nicht war, aber sie vollstreckte das Urteil des Marktes, das ihre Vorgänger im Amt nicht zugelassen hatten: In den Jahren 79 bis 81 setzte sie die schärfste Krise in der britischen Geschichte durch – selbstverständlich mit der Erwartung, daß, wenn die unproduktiven Kostgänger der Nation erst einmal „gesundgeschrumpft“ seien, der überlebende Rest um so produktiver werden und aufblühen würde. Tatsächlich hat der Staat damit lediglich seinen Haushalt saniert und sich vorher benötigte Ausgaben gespart. Ansonsten hat die beschlossene Schrumpfung nichts gesundet und auch die international zurückgebliebene Produktivität der nationalen Wirtschaft nicht gesteigert – außer vielleicht statistisch: Die unproduktivsten Industrien fielen raus und haben den Durchschnitt weniger belastet. In der Realität hat der wirtschaftspolitisch gewollte Wegfall von weiten Bereichen der Staatsindustrie den Kapitalstandort Großbritannien eher geschädigt: Es fehlten den überlebenden Industrien Anbieter und Nachfrager, überhaupt eine ganze Masse von Wirtschaftstätigkeit, die jedes Einzelkapital als Bedingung seiner Akkumulation braucht. Der Qualität Großbritanniens als Kapitalstandort hat die um funktionelle Notwendigkeiten unbesorgte Privatisierung und Schließung von Industrien nicht gutgetan. Die Sicherung allgemeiner Bedingungen des Geschäfts hat gelitten. Doch in der Notlage, daß die nationale Sorge um die Benutzbarkeit von Land und Leuten keine angemessene Benutzung hervorgebracht hatte, entschied sich die Thatcher-Administration radikal für „Deindustrialisierung“: Erst 1987 hat die Industrieproduktion, erst 1989 die Investitionstätigkeit wieder das Niveau der Vor-Thatcher-Zeit erreicht.
Dem Geldwert hat dieser Radikalismus genützt; aus den erwähnten Gründen. Der Beweis, daß eine Sparwut, die den staatlichen Haushaltsbilanzen zugute kommt, auch die Wertbeständigkeit des Kreditgelds sichert, ist dennoch nicht gelungen. Die staatlichen Geldzeichen beziehen ihren Wert eben nicht aus sparsamem Verbrauch, sondern aus erfolgreichem Gebrauch fürs Gewinnemachen. Sicher steht es darum schlecht, wenn viele Geschäfte im Land Verluste machen und nur durch Staatsschulden aufrechterhalten werden. Wenn jedoch die Geschäftsgelegenheiten schlicht weniger werden, steht es auf Dauer nicht viel besser.
Angebotsorientierte Steuerreform
Gerade weil sie die staatlichen „subsidies“, die finanziellen Dienste fürs Kapital einschränkte, bemühte sich Frau Thatcher um Kompensation und sorgte dafür, daß der Staat die Kapitalisten dann auch weniger kostete: Sie schichtete das englische Steuersystem von direkter auf indirekte Besteuerung um. Bei der Einkommenssteuer behauptete sie, Leistung sei bisher bestraft worden, und verlagerte die Belastung weg von den Höherverdienenden auf die Armen, sie senkte die Steuerprogression und die Spitzensätze auf ein bis dahin für unerreichbar gehaltenes Niveau. Den Zwang, öffentliche Ausgaben um jeden Preis zu reduzieren, gab sie an ihre nachgeordneten staatlichen Einheiten, Städte und Gemeinden, dadurch weiter, daß sie die zentrale Finanzierung und damit den Finanzausgleich zwischen reichen und armen Gemeinden strich und dafür die lokalen Behörden mit einer eigenen Steuerquelle ausstattete: Jede Stadtverwaltung, die gewisse Funktionsnotwendigkeiten ihrer Gemeinwesen nicht völlig mißachten konnte, mußte ihre Bürger mit den wahren Kosten ihrer Stadt belasten – und zwar pro Kopf zu gleichen Teilen. Die „Poll Tax“ wurde anhand der Wählerverzeichnisse erhoben – und führte abgesehen vom Ruin und der Verslumung der ärmeren Gemeinden zu Aufständen und dazu, daß sich immer weniger Bürger zur Ausübung ihres demokratischen Privilegs registrieren ließen.
Verbilligung der Arbeit und Kampf gegen die Gewerkschaften
Auch mit der Senkung von Kosten, die der Staat nicht selbst verursachte, konnte er seinen unternehmenden Bürgern dienen. Frau Thatcher machte es zu ihrem größten und bleibenden Verdienst, die mächtigen britischen Gewerkschaften gnadenlos unterdrückt und ihre Macht gebrochen zu haben. Darüber wurden alle gewohnten Ansprüche der Arbeiterklasse, sei sie in Beschäftigung oder arbeitslos, radikal beschnitten. Heute „gehören die Briten entweder zur Mittelschicht oder sie leben in Pappkartons“ (The Economist, 24.10.92). Natürlich nutzt das dem Profit, wenn die Kosten für die beschäftigte und unbeschäftigte Arbeiterklasse sinken; wenn die Unternehmer mit geschlagenen, von massiven Arbeitslosenheeren bedrohten Belegschaften frei umspringen können; wenn weniger Leute für weniger Geld mehr leisten. Ob es aber mehr war, als die Anpassung der einstigen „Arbeiteraristokratie“ Europas an ihre deklassierte Nation, ob die Konkurrenzfähigkeit der britischen Industrie wirklich stieg oder ob sie mit ihrer Extra-Ausbeutung nur ein Überleben in der Unterproduktivität organisierte, das war mit unterbliebenen Lohnerhöhungen, der Senkung des Krankenstands und der Abschaffung von Teepausen eher im letzteren Sinn entschieden. Die Steigerung der Produktivität ist nämlich eine Frage des Einsatzes verbesserter Produktionsmittel, die den Wirkungsgrad der Arbeit erhöhen, und dieser Einsatz hängt ab vom Vorhandensein genügender Massen von anlagewilligem Kapital. Die billigsten Löhne können nicht mit fortgeschrittenen Industrien konkurrieren, die überhaupt nur noch einen Bruchteil der Arbeit pro Produkt anwenden. Der internationale Vergleich läuft über die Kapitalproduktivität und nicht über die absolute Lohnhöhe. Diese ist allenfalls ein Gesichtspunkt für Investoren, neben der Frage der Sicherheit des Geldes, der Infrastruktur, der Ausbildung und Moral der Lohnarbeiter. Inzwischen ist Großbritannien ein Billiglohnland in der EG – und das hat ihm keinen Investitionsboom beschert. Die britischen Arbeiter aber haben gelernt und sind insofern europäisch geworden: daß sie nicht von ihrer Hände Arbeit oder davon leben, was sie den Kapitalisten abtrotzen, sondern vom internationalen Erfolg ihrer Nation, den die nicht hat. Weil es um diesen schlecht steht, sind sie eben zu teuer.
Deregulierung
Wie bei der Abschaffung von Mindestlöhnen, der Relativierung von Tarifverträgen und der Lockerung von Arbeitszeit- und Beschäftigungsvorschriften konnte der Staat auch auf anderen Feldern den Unternehmern Kosten, nämlich Rücksichten ersparen. Bei Umwelt-, Sicherheits- und Qualitätsnormen, beim Gesellschaftsrecht und Kreditwesen hat Frau Thatcher die staatliche Aufsicht und ihre beschränkenden, Kosten verursachenden Auflagen zurückgenommen – freilich um den Preis, daß sie der privaten Profitmacherei gegenüber auch auf die Berücksichtigung des Nutzens der Nation verzichtete, die ihr vorher abverlangt war: Mit Umwelt- und Sozialdumping läßt sich schon das eine oder andere Geschäft auf die Insel ziehen, das ohne Sonderangebot nicht gekommen wäre. Der Raubbau an der Brauchbarkeit der nationalen Natur und Volksgesundheit, verrottende Infrastrukturen, Kanalisation und Verkehrswege aber stellen für die Gegenwart des Profits die Zukunft des kapitalistischen Nationalerfolgs schon auch ein wenig in Frage.
Der Staat, der sich auch aus seiner Verantwortung für den Wohnungsbau verabschiedet hatte, liberalisierte dafür das Geschäft mit den Hypotheken, er schaffte die nationalen Kapitalverkehrskontrollen ab und förderte die internationale Konkurrenz der Banken und Börsenbroker in der City. Das wenigstens war ein echt britischer Konkurrenzvorteil – den deswegen die anderen EG-Staaten bald nachgemacht und damit egalisiert haben.
Gründe und Ende des Thatcher-Booms
Auf seine Weise hat das Programm der Eisernen Lady funktioniert. Von dem sehr niedrigen Niveau aus, auf das die britische Wirtschaft in den Jahren 79 bis 81 gefallen war, gelangen von 83 bis 89 Wachstumsraten weit über dem europäischen Durchschnitt. Im Herbst 89 allerdings lag die Geldentwertung wieder bei 10%, und das Schatzamt machte sich Sorgen um die Stabilität des Pfund Sterling.
„Die Wirtschaft ist in Schwierigkeiten aus einem deprimierend einfachen Grund: Die Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen ist in den vergangenen Jahren viel zu schnell gewachsen. … Die Nachfrage ist angeschwollen“ – diesmal nicht wegen der Staatsausgaben, sondern – „weil die Privatwirtschaft, besonders der Konsument, weniger gespart und viel mehr Schulden gemacht hat als früher. Der Kredit hat sowohl die Inflation als auch das Außenhandelsdefizit hochgetrieben… Mr. Lawson (Schatzkanzler) ist mit einem Angriff auf das Pfund konfrontiert. Er erhöht nun die Zinsen nicht mehr im Interesse einer straffen Geldpolitik; sein jetziger Hauptgrund ist die Verteidigung des Pfundes. Die Schlagzeilen haben folglich erschreckend an die alten Tage der Pfundkrisen erinnert. Die Kritiker der Regierung stellen hämisch fest, daß 10 Jahre Thatcherismus wenigstens ein ökonomisches Gesetz in Geltung gelassen haben: Sobald die Wirtschaft beginnt, in einer anständigen Rate zu wachsen, würgen Zahlungsbilanzschwierigkeiten ihre Expansion ab.“ (The Economist, 14.10.1989)
„Als der Boom des Kredits richtig in Schwung kam, haben die Firmen, die in der Rezession von 79 bis 81 zusammengeschrumpft waren, einfach ihre Preise erhöht, sobald sie an Kapazitätsgrenzen stießen. Von der überhitzten Konjunktur wurden Importe angesogen, um die überschüssige Nachfrage zu decken. Wieder einmal wurden Zahlungsbilanzschwierigkeiten unausweichlich.“ (The Economist, 24.10.1992)
Es ist nicht besonders glaubwürdig, daß die Industrie vor lauter Nachfrage mit dem Produzieren nicht nachgekommen sein soll, so daß die Kaufwilligen leider auf Ausländisches ausweichen mußten. Wenn Neuinvestitionen mitten im Boom nicht für lohnend befunden wurden, dann wird es schon deswegen so gewesen sein, weil sie gegen die ausländische Konkurrenz keine guten Chancen hatten und Geldanlagen im Ausland lohnender erschienen – Mitte der 80er Jahre soll Großbritannien der weltgrößte Exporteur von Geldkapital gewesen sein. Woher dieses exportfreudige Geld stammte, ist auch kein großes Geheimnis: Zum einen hat der Zufall des Nordseeöls und der hohen Ölpreise dem Königreich eine zeitweilige Sonderkonjunktur als europäisches Ölscheichtum verschafft – bis dann der Fall der Ölpreise in der zweiten Hälfte der 80er Jahre die Unzuverlässigkeit des Reichtums offenbarte, der nicht aus der Produktion von Wert, sondern aus dem Verkauf einer Naturbedingung hervorgeht. Zum andern ist natürlich der Boom im Kreditsektor nicht ausgeblieben – allerdings wohl kaum infolge nachlassender Spartätigkeit „des“ Konsumenten: Die Spekulation aufs Pfund war Thatchers Erfolg. Denn immerhin hatte die Politik der Streichung von Staatsausgaben und der Privatisierung die Dämpfung des Kursverfalls der Währung zur Folge, und das britische Pfund erschien wieder brauchbar als Stoff für weltweite Kreditgeschäfte – fast wie in alten Zeiten…
An diesem Aufschwung beteiligte sich der Staat selbst auch, da er sich nun berechtigt sah, von der alten Sparsamkeit – die ja keineswegs als ewige, sondern als aus dem Zwang schlechter Bilanzen heraus geborene Notwendigkeit betrachtet wurde – abzurücken und „zukunftsträchtige Investivausgaben“ vorzunehmen. Zu diesen „Investivausgaben“ gehörte vorrangig die Bezuschussung von in die „Privatisierung“ entlassenen Staatsbetrieben; für die Notwendigkeiten der Rüstung (damals gemessen am Brutto-Sozialprodukt die höchste aller europäischen Nato-Staaten) mußte auch etwas unternommen werden.
So gut sich die Sache auch anließ, sie endete mit besagter Währungskrise und Frau Thatchers mehr oder weniger erzwungenem Rücktritt. Ein kulturkritischer Vorwurf ihr gegenüber lautete, sie habe nur die „Yuppie-Generation“ bedient. Sozialkritische Gemüter ereiferten sich über Zerstörungen in britischen Industrie- und Städtelandschaften. Der Vorwurf der Wirtschaftsfachleute war am fachmännischsten: Sie habe es nicht geschafft, den Zins zu senken, und trotz allem – oder vielleicht deswegen? – zum guten Schluß das Pfund wieder in „Turbulenzen“ gebracht. Was war also gewesen? Die Kreditakkumulation hatte sich eine Zeitlang selber hochgezogen, die von der Thatcher-Regierung geschaffenen ‚Daten‘ zur sicheren Grundlage weiterer Spekulation erklärt – und dann auch wieder damit aufgehört. Die beabsichtigte Verwandlung von Kredit in den allgemeinen, auch die Industrie einschließenden nationalen Aufschwung hatte nicht geklappt. Nicht als ob gar keine Zunahme von Industrieproduktion und Handel stattgefunden hätte; bloß genügte sie nicht der Vorgabe, und die hieß: die europäischen Konkurrenten ein- und überholen. Schließlich war Großbritannien schon seinerzeit nicht in die EG eingetreten, um zum Markt für andere zu werden; und nachdem das doch eingetreten war, hatte Frau Thatcher sich vorgenommen, die eingerissenen Verhältnisse umzudrehen und den Nachweis europäischer Spitzenqualität zu erbringen. Dafür war freilich eine mehr als „gewöhnliche“ Belebung des Geschäfts nötig – und die kam nicht zustande. Die Konkurrenz hat eben auch in der Thatcher-Ära nicht höflich oder gebannt auf England gewartet, sondern mit bereits überlegenen Mitteln ihren Erfolg vorangetrieben.
Das Ergebnis war niederschmetternd für England: Der Anteil am wachsenden europäischen Kapital hatte nicht zu-, sondern abgenommen. Vom „Boom der Thatcher-Jahre“ haben die Konkurrenten mehr profitiert als die britische Wirtschaft selbst. Insofern hat sich die von der Lady entfesselte Kredit-Akkumulation schon gelohnt – in Europa. Die britische Wirtschaft hingegen sah sich erneut dem Zwang zur „Anpassung“ nach unten ausgesetzt. Das Pochen des Königreichs auf eine bestimmende Position im europäischen Verbund wurde darüber zunehmend zur leeren Geste; der Standpunkt des nationalen Eigennutzes, dem Europa sich unterzuordnen hätte, nahm durch seinen Mißerfolg den Charakter des Störrischen an – „I want my money back!“ schrie Mrs. Thatcher bei Verhandlungen über die EG-Beiträge. Daß sie auch für ihre Niederlage die perfekte Charaktermaske abgab, hat die Tory-Partei ihrer Chefin nicht mehr gedankt.
Die Quittung für einen „Monetarismus“ ohne Konkurrenzerfolg: John Major und die zweite Etappe der Währungskrise
Frau Thatcher hatte sich geweigert, ins EWS einzutreten. Sie meinte, für ihre Wirtschaftspolitik könne sie weder die Rechte noch die Pflichten dieses Währungsverbundes gebrauchen.
- Sie wollte das Recht nicht gebrauchen, die eigene Währung durch die Solidität des Blocks mitgarantieren zu lassen. Das hätte für sie erstens bedeutet, eine – wenn auch wohlwollende – Abhängigkeit anzuerkennen. Das hätte zweitens genau die Anstrengung konterkariert, den Nachweis zu erbringen, daß England „auf eigenen Füßen steht“, zur Umwälzung seiner Wirtschaft „aus eigener Kraft“ imstande ist, also besonderes Vertrauen der Geschäftswelt verdient. Sie wagte den Versuch, neben dem EWS, ja gegen es ein international voll taugliches Geschäftsmittel zu re-etablieren.
- Die Pflicht, für andere Währungen mit einzustehen und den eingebauten „Stabilitätszwang“ des EWS mitzutragen bzw. die Mitaufsicht ausländischer Währungsbehörden über den Gebrauch des Pfundes zu erlauben, konnte die britische Regierung auch nicht brauchen. Die von ihr zu neuem Ansehen gebrachte englische Währung behauptete schließlich, so etwas wie der Ausweis der wiedererrungenen Wirtschaftsmacht Großbritanniens – gerade in der EG – zu sein und, endlich wieder, Ansprüche auf Weltgeldqualität anmelden zu können. Für diese Souveränität und den freien Gebrauch der feinen Ware Pfund waren Beistandspflichten etc. nur unnütze Einengungen. Anders als die deutschen Verwalter einer aufsteigenden Weltwährung betrachtete die Thatcher-Regierung Europa eben nicht als ihr Projekt; in die Entwicklung der EG und die Brauchbarkeit der schwächeren Nationalökonomien wollte sie das Pfund, um dessen Stärkung es ihr ging, nie investieren. Ihr Land war ja auch nicht, wie Deutschland, der automatische Nutznießer aller EG-Erfolge.
Die mit dem Fernbleiben vom EWS angestellte Rechnung, die Gemeinschaftseinrichtungen der EG frei nach eigenem Ermessen und so garantiert zum eigenen nationalen Vorteil zu gebrauchen, war nicht aufgegangen. Das EWS stellte sich, bei allen Problemen und Spannungen, als enormer weltwirtschaftlicher Vorteil für die darin aneinander gebundenen Währungen heraus; die D-Mark wurde zur beherrschenden Europa-Währung, die damit verknüpften Geldsorten zu deren gleichwertigen Unterabteilungen, womit sie selber stabil wurden und die D-Mark wiederum als letztgültigen Wertausdruck des gesamten in EG-Europa produzierten und akkumulierenden Reichtums bestätigten. Im Vergleich dazu schwand die Bedeutung des britischen Pfund als Finanzmittel; und der Vorteil zeitweiliger innerer Solidität kam ihm auch noch abhanden, nachdem der Staat mit seinem Programm des Staatsschuldenabbaus ans Ende gekommen, nichts mehr zu privatisieren und nichts mehr zu sparen war – und „trotzdem“ von britischem Boden aus keine Weltmarktanteile zurückerobert worden waren. Der seinerzeitige Schatzkanzler und spätere Premierminister Major mußte eingestehen, daß sein Pfund „in der Krise“ war und außerhalb des D-Mark-Blocks wenig Chancen auf Würdigung als weltweit einsetzbares Geschäftsmittel hatte. Also trat er dem EWS bei und demonstrierte gleich, wie es gemeint war:
- Der auf knapp 3 DM – und damit nach allgemeiner Einschätzung sehr hoch – angesetzte Kurs des britischen Pfund und Majors Schwur, diese Parität bedingungslos zu verteidigen, war die staatsoffizielle Weigerung, eine weitere Entwertung des in britischer Währung fungierenden Reichtums und Minderung der nationalen Kaufkraft zuzugeben, geschweige denn zuzulassen. Die eingetretene Währungskrise wurde so behandelt, wie sie auftrat, nämlich wie ein bloßes Mißtrauensvotum der Geldhändler, das sich mit einer neuen technischen Stabilitätsgarantie beruhigen ließe.
- Die Inanspruchnahme der größeren Bandbreite für Kurs-Schwankungen – wie bei der Lira sollten erst bei 5% statt bei 2% Abweichung nach oben oder unten die Korrekturmechanismen des EWS in Kraft treten – sollte kein Eingeständnis der Währungsschwäche sein wie im italienischen Fall, sondern ein Beweis der Autonomie in Währungsdingen – mitten im Akt der Einordnung in ein Währungssystem um die D-Mark herum.
Tatsächlich war der Schritt ins EWS in beiden Punkten das Gegenteil der demonstrierten britischen Souveränität; er paßte die aufs Geld gerichteten nationalen Ansprüche an die eingerissene Konkurrenzlage an. Doch immerhin, die zwei Jahre bis zum „schwarzen September“ 92 leistete das EWS für Großbritannien durchaus das Erwartbare: Was die privaten Geldanleger den Briten alleine in puncto Wertstabilität ihres Geldes nicht mehr zutrauen wollten, nahmen sie dem Pfund im EWS ohne weiteres ab. Die Zusammenarbeit der Notenbanken unter Führung der D-Mark und ihr Stützungsversprechen trennten die Brauchbarkeit der Euro-Währungen ein ganzes Stück weit von den aktuellen wirtschaftlichen Erfolgen oder Mißerfolgen der Mitgliedsnationen ab und sicherten und erweiterten damit deren Verschuldungsfähigkeit.
Was die europäische Garantie dieses Stücks wirtschaftspolitischer Souveränität den Briten nicht brachte, war der Wiederaufschwung der Geschäfte. Wie hätte das auch gehen sollen? Die Garantieleistungen, die das EWS der britischen Währung, und die Freiheiten beim Kreditschöpfen, die es dem britischen Staat verschaffte, hatten die konkurrierenden Nachbarn schon seit Jahren genutzt, um sich zu bevorzugten Kapitalstandorten in Europa aufzubauen. Daß dieser Vorsprung für England nicht aufzuholen war, das bestätigte die überhaupt nicht enden wollende Rezession auf der Insel. Daß „immerhin“ das Pfund stabil blieb, war da ein schwacher Trost: Was nützt schon ein stabiler Geldwert, wenn das Geld sich nicht gehörig verwertet.
Es ist ja umgekehrt so: Wenn immerzu das in Pfund Sterling bilanzierende Kapital sich schlechter verwertet als das konkurrierender Unternehmer mit anderem Standort und Zahlungsmittel, dann bleibt erstens der kapitalistische Reichtum der Nation nicht, was er war; und dann wird zweitens dessen Geldausdruck zunehmend fiktiv. Der Offenbarungseid darüber, was sich da binnen zwei Jahren schon wieder zu Ungunsten des Vereinigten Königreichs verschoben hatte, wurde im Frühherbst 92 fällig, als die tiefere Bedeutung der einerseits höchst anspruchsvollen, andererseits zunehmend wackligen Perspektive einer europäischen Währungsunion sich den Devisenhändlern mitgeteilt hatte. Die Bedeutung bestand und besteht nämlich darin, daß so oder so, beim Durchmarsch zur Einheitswährung wie beim Scheitern des Einheitsprojekts, eine durchgreifende Bereinigung des überakkumulierten europäischen Kredits fällig wird: eine Entwertung zugunsten einer unbelasteten, bombenfesten neuen Euro-Währung – oder, wenn daraus nichts wird, zugunsten der stärksten unter den vorhandenen, und auf alle Fälle zu Lasten derjenigen Nationen, die im Vergleich der nationalen Kreditgelder schon immer schwächer abschneiden. Daß diese Bereinigung nicht irgendwann, sondern sofort ansteht, konnten die sensiblen Finanzmärkte der auch in Europa sich ausbreitenden Weltwirtschaftskrise entnehmen; da wird nämlich Kapital entwertet, und der Konkurrenzkampf der Nationen geht um die Entscheidung, bei wem mehr und bei wem weniger. Diese Aussicht fordert die Geldhändler schon wieder zu einer Unterscheidung zwischen Staaten und Währungen heraus, und zwar zu genau derselben wie die Maastricht-Perspektive der Flurbereinigung unter den Staatsschulden. Daß beides zusammentraf, Krise und Maastricht, hat die Agenten der kapitalistischen Geldwirtschaft zu einer Spekulation gegen Lira und Pfund Sterling animiert, die selbst durch das Verpulvern des Devisenschatzes der beiden betroffenen Länder und die Schöpfung von D-Mark durch die Deutsche Bundesbank in ähnlicher Größenordnung nicht zurückzuweisen war. Seither ist Großbritannien ein Fünftel weniger wert, und es verbilligt sich weiter.
In England haben sich natürlich sofort Besserwisser zu Wort gemeldet und sich über eine angebliche neue Freiheit der Wirtschaftspolitik gefreut: Man könne doch nun der Wirtschaft helfen, die hohen Zinsen runtersetzen und den Pfundkurs nach eigenem Ermessen einrichten, so nach dem Motto: Bezeichnen wir das frühere „Stützkorsett“ jetzt als „Zwangsjacke“ – die sind wir jetzt los und fühlen uns gleich besser. Das ist natürlich nicht wahr, und zwar nach drei Seiten hin:
- Erstens sind die Mittel dieser Freiheit sowieso sehr kümmerlich. Eine darniederliegende Wirtschaft liegt nicht wegen hoher Zinsen darnieder; das Runtersetzen von Zinsen macht nicht ein Kapital produktiv, das überschüssig ist und sich nicht verwertet. Und der Pfundkurs, der allen Kapitalisten ein besseres Geschäft ermöglicht, muß erst noch erfunden werden: Fällt er, steigt die Importrechnung, steigt er, haben es die Exporteure schwerer. Prosperierendes Kapital hat sich schon längst Mittel und Wege erdacht, sich von Kursbewegungen unabhängig zu machen; nicht prosperierendes wird auch durch eine Kursbewegung nicht angekurbelt.
- Zweitens hat die britische Regierung selbst im Gebrauch dieser bescheidenen Mittel keine freie Hand. Die Kontrolle über den Pfundkurs ist ihr ja soeben durch „die Märkte“ entzogen worden; weder ihre Reserven noch die der Bundesbank waren ausreichend, das fehlende Vertrauen der Geldhändler aufzufangen.
- Drittens und vor allem aber hat die britische Nationalbank erst einmal gigantische Schulden; nicht bei sich selbst, wie es sich für ordentliche Ausgabestellen eines nationalen Kreditgelds gehört, sondern bei ausländischen Gläubigern; sie hat nämlich Schulden, wo eigentlich Reichtum in unanfechtbarer Form, nationaler Schatz hingehört. Die Devisenreserve, über die jeder Staat verfügen muß, um die internationale Geschäftsfähigkeit seiner Gesellschaft verbürgen zu können und selber international geschäftsfähig zu sein, ist weg; an ihrer Stelle verwaltet die britische Nationalbank Kredite, und zwar zunächst einmal die, die die deutsche Bundesbank ihr in jenem September noch im Rahmen der EWS-Beistandspflichten gewährt hat. Ihre internationale Geschäftsfähigkeit selbst ist also vom Ausland, aus Deutschland geborgt. Das geht nicht bloß gegen die nationale Ehre, sondern schon ein bißchen an die Substanz: Die britische Nation, die mit einem weltweit benutzten Finanzmittel in die Weltwirtschaft eingeschaltet ist und seit Jahrzehnten das Programm verfolgt, diese Position zu festigen und auszubauen, sieht sich auf die Notwendigkeit zurückgeworfen, sich die elementare Bedingung für die weltweite Zirkulationsfähigkeit ihrer Währung, einen soliden Staatsschatz, buchstäblich zu verdienen. Und das unter der erschwerenden Bedingung, daß die Schulden, die die verlorenen Reserven – bis auf weiteres – auffüllen, eben Schulden sind, also verzinst und bedient, manche auch nach strengen Regeln zurückgezahlt werden müssen. Gewiß ist Großbritannien nicht mit einem „Schuldnerland“ im drittweltmäßigen Sinn zu vergleichen, das außer Schuldenbedienung überhaupt keinen außenwirtschaftlichen Zweck mehr kennt und gar keine andere Zielsetzung für seine Nationalökonomie mehr zulassen kann und darf. Großbritannien ist allemal noch kreditwürdig, sein Pfund ist noch internationales Zahlungsmittel; für den Devisenbedarf steht seiner Nationalbank der europäische Markt offen, und die Deutsche Bank übernimmt gern die Plazierung einer milliardenschweren D-Mark-Anleihe. Daß das andererseits auf Dauer keine gute Basis für vollgültige und unanfechtbare Geschäftsfähigkeit ist, das hat soeben – Mitte Februar 93 – die japanische Geschäftswelt ihrer britischen Anlagesphäre klargemacht: Ein Standort für fernöstliches Kapital, so der Hinweis, kann die Insel nur bleiben, wenn sie schleunigst in den Garantieverband des EWS zurückkehrt. Auf sich allein gestellt ist das Pfund nichts mehr: Diesem Urteil aus dem Land des Yen hat die Regierung Major sich zu stellen, wenn sie weiterhin dem EWS fernbleibt – was sie mit der leicht durchschaubaren Begründung tut, nicht etwa das Pfund, sondern dieses System wäre aus seinen „Turbulenzen“ noch nicht heraus, und aus dem offenkundigen Grund, daß jeder Kurs, zu dem das Pfund sich der D-Mark wieder anschließen würde, sofort einem gnadenlosen Härtetest durch die ehrenwerte Gesellschaft der Devisenspekulanten unterzogen würde und nur Aussicht auf Bestand hätte, wenn vom in Pfund gemessenen Reichtum noch einmal etliche Prozente glattweg annulliert würden.
Die Staatsmacht in England steht dieser Situation eher ratlos gegenüber. Gleich nach dem Währungs-Desaster wollte die Regierung thatcheristisch etwas für die Bonität ihrer Schulden tun und ihr Budget von weiteren subventionierten Staatsfirmen entlasten. Frau Thatchers große Zechenschließung Mitte der 80er Jahre hatte noch einige Kohlegruben übrig gelassen, die Hälfte davon sollte jetzt folgen. Diesmal hatten Scargills Miners – früher die Staatsfeinde Nr.1 – die Öffentlichkeit gegen die Regierung auf ihrer Seite: Billige Importkohle war auf einmal kein Argument mehr in dem Land, dessen industrielle Basis immer mehr schrumpft, weil so vieles im Ausland billiger gekauft werden kann. Ein Kurswechsel der Regierung setzt jetzt auf Erhaltung eines subventionierten, aber immerhin britischen Bergbaus. Jetzt müssen britische Tories französischen Sozialisten in der EG-Kommission den Bedarf nach Industriepolitik erklären – und kommen sich selbst dabei komisch vor. Die industriepolitischen Gefahren für den Staatskredit wälzt derweil die Fachpresse daheim.
Die monetaristische Ablehnung von Staatsschulden wird von der Regierung Major aber überhaupt für überholt erklärt, der Staat als „Wachstumsmotor“ entdeckt: „It’s time for helicopters and holes in the ground.“ (Financial Times) Was als „wirtschaftspolitisches Konzept“ jetzt vorliegt, beweist allerdings ein weiteres Mal eigentlich nur, daß es in der Wirtschaftspolitik keine Rezepte gibt, geschweige denn solche, die Erfolg garantieren könnten. Chancellor Lamont hat wahrscheinlich selbst gespürt, daß
„die Verlagerung des Schwergewichts weg von der Inflationsbekämpfung hin zu mehr Wachstum, ohne jedoch das Inflationsziel aus den Augen zu lassen“,
kein großer Knüller ist. Und auch wenn er für so revolutionäre Neuerungen wie: die Zentralbank soll häufiger einen Bericht herausgeben und Vorschläge erarbeiten, die Wirtschaftsindikatoren werden auf den neuesten wissenschaftlichen Stand gebracht, das Wirtschaftsministerium ordnet sich Fachleute aus Wissenschaft und Praxis zu, der Zins soll im engen Kontakt mit den Geldmärkten heruntergeschleust werden usw.usf., einiges Lob einheimst, so wird er selber wissen, daß damit das heißersehnte Wachstum nicht zustandekommt. Am Schluß bleibt eigentlich nur eine Hoffnung stehen: Wenn der Kurs jetzt schon so niedrig ist, vielleicht kurbelt das den Export an. Vielleicht. Dummerweise steht jeden Tag in der Zeitung, die „Rezession“ würde weder das Handelsbilanzdefizit abbauen noch die Importe bremsen.
Bleibt noch die Standardweisheit jeder bürgerlichen Regierung: Sie hält sich an ihr Volk und füllt ihre Mittel auf, indem sie mit der Gewalt des Rechts die Taschen ihrer „kleinen Leute“ leert. Allerdings: Kaum kommt der Regierung Major dieser alte Schlager in den Sinn, muß sie sich auch schon ehrlicherweise eingestehen, daß da nicht viel geht. Wenn sie sich daran macht zu „sparen“, also beim Volk nachzuschauen, was dies alles an überflüssigem, die Staatsfinanzen strapazierendem Luxus mit sich herumschleppt, dann stellt sie rasch fest, daß ihre Massen mit solchen Dingen ziemlich wenig belastet und dementsprechend schlecht schröpfbar sind. Der britische Staat hat sein Sozialwesen nie so einnahmenintensiv und ausgabenflexibel wie der deutsche Staat als Nebenhaushalt organisiert, den die Beitragszahler auffüllen und an dem der Fiskus sich nach Bedarf bedient. Und was sich in anderen Nationen an Ausgaben zur Armutsbetreuung noch sparen läßt, das hat Frau Thatcher schon unter großem öffentlichem Beifall gründlichst erledigt; der Regierung Major hat sie da nicht viel übriggelassen.
Neue wirtschaftspolitische Mittel und Wege der Nation sind also auf der ganzen Linie nicht in Sicht. Korrekturen grundsätzlicher Art wären nötig, sind aber bislang noch gar nicht im Angebot. Das ist einerseits die Basis dafür, daß die „gescheiterte“ Regierung Major und Lamont ziemlich unangefochten im Amt bleibt, andererseits zugleich der Grund der Verdrossenheit, mit der die Nation sich, ihre Institutionen und ihre Führung betrachtet – noch nicht einmal an ihrem Königshaus finden die Briten zur Zeit so recht Gefallen, und die Royals, so scheint es, vice versa.
Die britische Regierung steht vor der Lage, daß 1. der europäische Markt inzwischen zu einer Lebensnotwendigkeit auch der britischen Wirtschaft geworden ist, also erhalten bleiben muß; daß 2. aber, wenn Europa fortschreitet, Großbritannien zu einem wirtschaftlichen und politischen Randstaat der neuen föderalen Weltmacht wird; daß 3. die Nation das auch gar nicht verhindern kann, denn mit jedem klaren Nein zum weiteren europäischen Aufbau würde sie sich isolieren, wie schon einmal vom Zentrum ausschließen und um so definitiver zur Peripherie werden; daß sie das 4. aber versuchen muß, ohne sich zu isolieren.
Deshalb muß Großbritannien mitten hinein „in the heart of Europe“, wie Major gerne sagt, um von dort aus das Schmieden der deutsch-dominierten neuen Weltmacht zu boykottieren und dafür in der EG Partner zu finden. So bringt Major den Vertrag von Maastricht nicht offen zu Fall, nutzt aber das dänische Referendum zur Verzögerung und zum Schüren von Zweifeln. Er kündigt das Projekt der Europäischen Union nicht direkt, aber er bemüht sich um eine alternative Ausgestaltung, die den imperialistischen Sinn des deutsch-französischen Vorwärts in ein Rückwärts zur alten EWG umdefinieren würde: für die Zusammenarbeit der Vaterländer gegen den Superstaat, für die Erweiterung der Gemeinschaft gegen ihre Vertiefung, für ein reformiertes EWS gegen die Währungsunion – und wenn man sie doch nicht verhindern kann, für eine britische „opt-out-Klausel“, deren Nutzen über den rein negativen Vorbehalt überhaupt nicht hinausgeht.