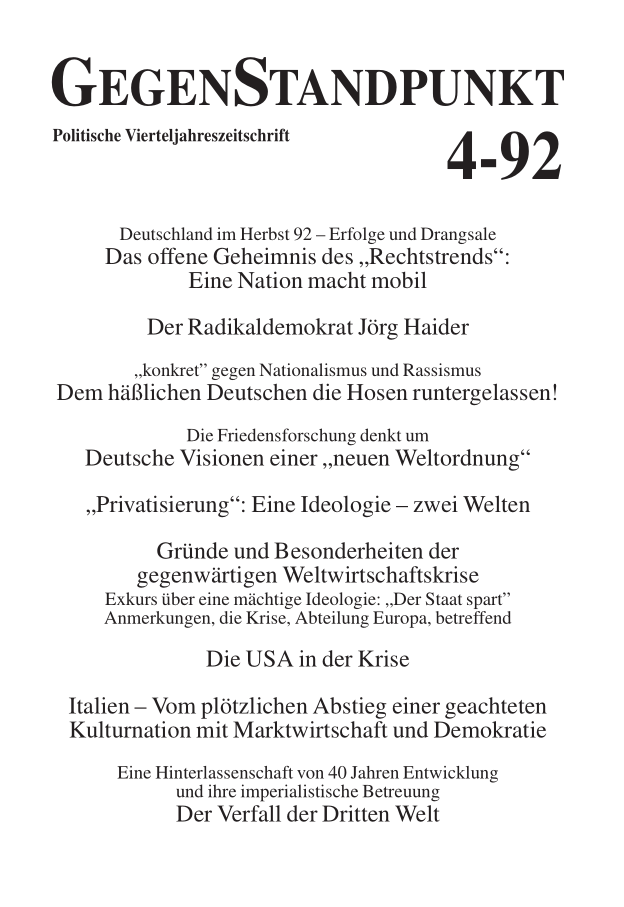Die Krise in Europa und ihre Schadensfälle
Einige Anmerkungen, die Krise, Abteilung Europa, betreffend
Die Krise macht sich fest am Verfall einzelner europäischer Währungen und führt zur Krise des EWS. Ihre Wirkungen stehen im Gegensatz zum Maastricht-Plan, sie offenbart sich nicht bloß als Krise einzelner Gelder, sondern als Abrechnung aller europäischen Gelder gegeneinander, weil überall Krise ist. Aufforderung der deutschen Politik an die anderen, ihre nationalen Ambitionen in Europa aufgehen zu lassen und sich dabei deutscher Führung zu unterwerfen.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Siehe auch
Systematischer Katalog
Gliederung
- 1. Erst fängt sie ganz langsam an.
- 2. Der Fahrplan
- 3. „Sabotage“
- 4. „Solidarität“ – weder geübt noch verweigert
- 5. Ideologie und Wahrheit einer Abrechnung
- 6. Fahrplan durcheinander – aber weiterhin gültig
- 7. „Währungskrise“ – von wegen!
- 8. Die deutsche Politik in der Krise: Europa
- 9. Im Angebot: noch eine friedliche Eroberung
- 10. Nicht-politökonomische Schranken deutscher Überzeugungskraft
Einige Anmerkungen, die Krise, Abteilung Europa, betreffend
1. Erst fängt sie ganz langsam an.
Als im September die ökonomischen Experten nach gründlichem Studium von Sitzungen, auf denen sich die führenden Köpfe der EG trafen, messerscharf schlossen: „Lira und Pfund überbewertet, also Abwertung fällig“, war von einer Krise in Deutschland noch nicht die Rede. Das Wirtschaftswachstum des nächsten Jahres stand noch auf der Höhe des letzten Sachverständigen-Gutachtens, die ausländischen Mitbürger durften wegen gewisser Vorkommnisse an selbigem Wachstum mitarbeiten, und die Mißstände im italienischen und englischen Finanzwesen bezeugten wieder einmal die vorbildlichen Qualitäten der deutschen Marktwirtschaft.
Und doch war die Krise schon da. Sicher, in Frage gestellt war der Kurs der italienischen und englischen Währung. Beschlossen wurde, daß das staatliche und private Eigentum an diesen beiden Geldsorten um etliche Prozent geschwunden war. So etwas kommt schon mal vor. Bloß – gehörten diese beiden Geldsorten nicht irgendwie einem network namens Europa an? War die beschlußfassende Versammlung nicht zu großen Teilen mit Ausländern besetzt? Mit Leuten also, die zusammen mit italienischen und englischen Schatzkanzlern Lira und Pfund als gemeinsames Sorgeobjekt betreuen? Seltsam, wie sich Insider täuschen können, wenn sie wollen. In zwei Mitgliedsländern der EG, die wir Deutsche brauchen und wollen, wird der Notstand der Staatskasse ausgerufen, und die deutsche Regierung samt der ihr verbundenen Öffentlichkeit weigert sich standhaft, eine Zerstörung europäischen Kredits wahrzunehmen. Anscheinend wollten sie nicht wahrhaben, daß sich da eine handfeste Abweichung vom europäischen Fahrplan ereignete, für den sie sich begeistern.
2. Der Fahrplan
Dasselbe Gremium, das sich auf die Abwertung von zwei europäischen Währungen einigte und eine dritte auf spanisch mitgeteilt bekam, hatte sich geraume Zeit zuvor im Holländischen getroffen. Damals stand ihm der Sinn nach der wirtschaftlichen und politischen Einheit Europas. Aus dem Kontinent wollten sie einen Standort verfertigen, auf dem ganz viel Kapital investiert, produziert und verkauft. Einen Standort, in dem ein Geld die Geschäftserfolge mißt und einem Souverän als Waffe gegen gewisse nicht-europäische Standorte dient. Dabei ist den Architekten Europas ein folgenschwerer Einfall unterlaufen. Die Schaffung und Garantie dieses Geldes, unter dem sie sich nichts anderes vorstellen können als einen soliden Nationalkredit, den man den Bedürfnissen des Geschäftsganges entsprechend ausweitet, ohne seine weltweite Kaufkraft zu beeinträchtigen, kam ihnen nicht ganz einfach vor. Denn im Rahmen der EG war zum Zwecke der Erschließung aller Mitgliedsländer durch anlagebereites Kapital mancher Partnerstaat dazu ermächtigt worden, Geschäfte auf seinem Territorium mit Kredit zu fördern, den er sich selbst nicht leisten konnte. Die Gemeinschaft hat die Verschuldungsfähigkeit von Nationen gewährleistet, wo die gewöhnliche Konkurrenz auf gutem Geld bestanden hätte. Dieser den Verwaltern eines europäischen Währungssystems vertraute Sachverhalt ließ sie zu der Überzeugung kommen, daß die inskünftige solide Euro-Währung keinen Korb aus den vorhandenen europäischen Geldern darstellen könne. Die gewaltigen Defizit-Unterschiede bei den europäischen Nationen deuteten sie im Blick auf das Gemeinschaftswerk sehr radikal. Der Vertrag von Maastricht nimmt die Haltung von Konkurrenten gegenüber den Partnernationen ein, bezweifelt, daß bei mehreren Mitgliedern der EG die Verschuldung des Staates seinen Außenhandelserfolgen entspricht – und verlangt eine diesbezügliche Korrektur. Als Bedingung zum Beitritt in die Währungsunion – Wunsch und Wille dazu werden wegen der eingegangenen Abhängigkeiten stillschweigend vorausgesetzt – formuliert der Vertrag die Sanierung der Staatsfinanzen.
Das war zwar alles nicht böse gemeint, aber immerhin die höchstoffizielle Feststellung, daß in Europa zuviel, also zweifelhafte Staatsschulden im Umlauf sind, die als Grundlage für die Konkurrenz gegen den Rest der Welt kaum taugen. Zusätzlich war mit den Beitrittskriterien ausgesprochen, wo und bei wem die Bereinigung unsolider Kredite zu geschehen habe. Die Kandidaten für „Sparpolitik“ sollten die künstlichen Gewichtungen zwischen den europäischen Geldern, die das EWS erzeugt und aufrechterhalten hatte, rechtfertigen. Sie waren aufgefordert, als ideelle Gesamtkapitalisten ihrer Nationen kürzer zu treten, um bei fortgeschriebenen Paritäten, Soll- und Habens-Rechnungen innerhalb Europas in die Währungsunion eintreten zu können. Am guten Willen dazu hat es nicht gemangelt.
3. „Sabotage“
Keiner der Staaten, die im Herbst abwerteten, hat während der Ausarbeitung des Maastricht-Programms gegen imperialistische Anmaßungen Beschwerde eingelegt. In den Bestimmungen des Stufenplans, der zur europäischen Einheit führen soll, haben sie zwar manche Härten für ihr künftiges Wirtschaften entdeckt und um Erleichterungen nachgesucht (Konvergenzfonds z.B.), im wesentlichen aber die wirtschafts„technischen“ Regelungen akzeptiert, die eine an „Stabilität“ orientierte Währungsunion erfordert. Im Willen zur Mitwirkung am Projekt Europa haben diese Regierungen keinen Anlaß für den Vorwurf gesehen, daß ausgerechnet die „schwachen“ Nationen der EG, in der andere so merkwürdig „stark“ geworden sind, für die Stabilität der künftigen Euro-Wirtschaft geradezustehen haben. Sie haben sich zu den Mängeln ihrer nationalen Ökonomie bekannt und sich vorgenommen, das Mißverhältnis zwischen ihrem Schuldenhaushalt und ihrem Bruttosozialprodukt zu bereinigen. Dabei wurde auch kein Gedanken weiter daran verschwendet, welchen Umgang die Erfüllung der Beitrittsbedingungen mit dem Volk daheim einschließt.
Die Wirkung, die ihre Bereitschaft zur Korrektur des nationalen Haushalts auslöste, hat diese Nationalisten dann doch erschreckt – und zur Suche nach Schuldigen angestachelt. Ausfindig gemacht wurden „Spekulanten“.
Das Grundmuster hat Italien durchlebt, bevor es andere nachgemacht und abgewandelt haben. Kaum hatte die Regierung die wegen Maastricht fällige Selbstkritik zum Leitfaden für die kommenden Jahre erklärt und angedeutet, daß schon der im Herbst fällige Haushalt des Landes einige Revisionen bringt, war es passiert. Die Ankündigung, daß da eine mit Staatsbetrieben und Schulden gesegnete Nation solide zu wirtschaften anfängt, also von sich aus die Qualität der von ihr geführten Unternehmen, der von ihr gezeichneten und verzinsten Papiere mit eindeutigem Ergebnis prüft, hat verfangen. Bei all denen, die von Berufs wegen mit Geld in allen Anlageformen handeln. Ohne große Rücksicht auf die „Abwicklung“, die der italienische Staat in aller Form organisieren wollte, haben die „Geldmärkte“ alle mit „Lire“ bedruckten Papiere für verlustverdächtig gehalten und danach gehandelt. Von der staatlichen Reaktion, die in einer Erhöhung des Zinsniveaus bestand, ließen sich diese ominösen Märkte überhaupt nicht beeindrucken – für sie stand fest, daß ein paar Prozent Zinsen nichts bedeuten im Vergleich zum Verlust, den die Zettel mit italienischer Garantie garantiert erleiden würden. Das brachte einen gewissen Rückgang der Nachfrage nach italienischem Kredit in allen Varianten mit sich, und das enorme Angebot der für heikel erklärten Ware ließ die Lira verfallen.
Diese Schande wollten italienische Politiker als erstes ihrem Volk, das einen neuen Inflationsschub – in der Bedeutung: „alles wird schon wieder teurer“ – fürchtete, unbedingt verdolmetschen. Also entstand die Legende von den „Spekulanten“, womit die Geldhändler sämtlicher Börsen gemeint waren, die bislang aus guten, weil berechnenden Gründen die Kurse italienischer Kreditzettel geachtet und hochgehandelt hatten. Außer solchen ideologischen Zerwürfnissen zwischen einem Staat, der sein Recht auf die Kontrolle über seinen Reichtum angegriffen sieht, und einem in der Marktwirtschaft ehrenwerten Berufsstand, der zu kalkulieren versteht, gab es freilich auch noch praktische Konsequenzen.
4. „Solidarität“ – weder geübt noch verweigert
Bevor etwas abgeschafft ist, bleibt es „in Kraft“. Das gilt nicht nur für den Kapitalismus insgesamt, sondern auch für das Europäische Währungssystem. Der Maastrichter Stufenplan hin zur Währungsunion sieht ja ausdrücklich vor, daß die Mitglieder der EG im Rahmen der gemeinschaftlichen Fürsorge für die Brauchbarkeit der nationalen Gelder und Wirtschaften sorgen; daß der Abbau von belastenden Defiziten und lästigen Schulden ohne Störung der gemeinschaftsinternen Geschäftsbedingungen vonstatten gehen soll, so daß auf der Grundlage weiteren Wachstums der Übergang vom Binnenmarkt in die Union gesichert ist. Also kamen die Vereinbarungen des EWS zur Anwendung.
Sie wurden getätigt, die fälligen Stützungskäufe, gemäß dem Regelwerk. Zuerst von Italien und England sowie für ihre Währungen von deutscher Seite. Abgebrochen wurde die Aktion, an deren Gelingen ein beiderseitiges Interesse bestand, weil sie keine Konsolidierung der betroffenen Gelder erbrachte: Die zur Stützung aufgewendeten Summen erfüllten ihren Zweck als politisches Signal für die Anbieter und Nachfrager auf den Geldmärkten nicht, weil sich die von der „künstlichen“ Nachfrage – die Stützungskäufe immer sind – nicht beeindrucken ließen. Deshalb stand auf einmal eine neue Betrachtungsweise dieser Summen an. Bei den währungsgeschädigten Nationen leerten sie den Staatsschatz, dezimierten die Devisenreserven, die für den kontinuierlichen Gang der Geschäfte da sind und den in ihm fälligen Ausgleich der Bilanzen. Bei den deutschen Währungshütern standen die Stützungsausgaben für eine unfreiwillige und der Solidität deutschen Geldes schädliche Vermehrung von dessen Umlaufsmenge.
Der Abbruch der Bemühungen war das Eingeständnis, daß das EWS versagt hatte – so daß wenigstens diesem auch in Deutschland eine „Krise“ attestiert wurde. Auf die Abwertung von Lira und Pfund folgte die der Peseta, und die europäischen Herrschaften nahmen sich vor, die lädierten Währungen eine Zeitlang „den Märkten“ zu überlassen, um sie nach deren Test auf einem niedrigeren, dann aber stabilen Kurs wieder in das System des EWS aufzunehmen.
Diese ziemlich banale Geschichte aus der aparten Welt, in der per Konkurrenz die relative Weltmarkttauglichkeit nationaler Kreditgelder zurechtgerückt wird, konnte allerdings nicht ohne eine gründliche Ventilierung von Schuldfragen abgehen. Denn die politischen Hüter der verfallenden Währungen sahen sich mit einem Mal einer peinlichen Bilanz ausgesetzt; die hatte den Charakter eines Urteilsspruchs, der sich deutlich von den aus dem Streit um Vor- und Nachteile erhandelten Kompromissen in der Gemeinschaft abhebt. Die Verhandlungen, die auf nächtlichen Sondergipfeln zu den Abwertungsbeschlüssen führten, hatten nichts Geringeres zum Ergebnis als die Besiegelung einer nun einmal hergestellten Ungleichwertigkeit.
Das wollten die amtierenden Nationalisten denn doch nicht auf sich sitzen lassen, daß sie als Mitglieder der „G 7“ und Mitgestalter Europas ihren Ländern einen zweitrangigen ökonomischen Machtstatus herbeiregiert haben sollen. Flugs war der negative Ertrag von Jahrzehnten Mitwirkung an den maßgeblichen Händeln der imperialistischen Welt in Schwierigkeiten übersetzt, die auf das Konto derer gehen, die in eigensüchtiger Weise zu Lasten ihrer Partner Geldpolitik betreiben. Die Bundesbank mit ihrer Zinspolitik erfreute sich einige Zeit lang der herzlichsten Invektiven in der italienischen und englischen Öffentlichkeit – und es ist noch nicht einmal ausgeschlossen, daß Urheber und Adressaten solcher Gerüchte an sie glauben. Genauso wie die Bundesbank der Auffassung ist, daß sie mit ihren Zinsen die Geldmenge steuert und die Überlegenheit deutschen Geldes mit ihren klugen Entscheidungen hingekriegt hat.
5. Ideologie und Wahrheit einer Abrechnung
Die für die Finanzen der Nachbarn angeblich so zerstörerische Leistung der Bundesbank ist eine interessierte Erfindung von ausländischen Schatzkanzlern und ihrer Presse. Eine Erfindung, die auch postwendend ihr Dementi mitliefert. Wäre ein nationales Zinsniveau die Waffe, mit der sich zu Lasten anderer Währungen gutes Geld machen läßt, dann hätte Italien mit seinem wesentlich höheren Tasso Ufficiale di Sconto wohl alles bestens geregelt. Die einschlägigen Klagen, denen sich vor allem die englische Finanzwelt angeschlossen hat, wandten sich aber gegen den „Druck“, den das 9,75%-Diktat der Bundesbank auf die Nationalbanken der Partner ausübt. Diese seien zum „Nachziehen“ gezwungen und könnten sich dies nicht leisten. Womit der Grund für die Not auf der einen, die Stabilität auf der anderen Seite schon einmal von der Technik des Dekretierens von Prozenten auf gewisse Voraussetzungen des Haushaltens an der Zinsfront verlegt wäre. Aber der Übergang in die nächste Legende scheint attraktiver zu sein als das Eingeständnis, daß der Vergleich zwischen dem Wert verschiedener Währungen nicht mit den Zinsen entschieden wird, die eine Nationalbank für den Verkehr zwischen sich und den Geschäftsbanken festlegt. Die von Deutschland aus „erzwungenen“ hohen Zinsen behindern den Geschäftsgang in den gebeutelten Ländern – lautet die Fortsetzung der Beschwerde, so daß sich der Laie verwundert, warum die Fachleute der Bundesbank ohne „Politik des leichten Geldes“ der deutschen Wirtschaft und ihrer Mark den besten Dienst meinen erweisen zu können…
Dem Fachmann jener so enorm unabhängigen Behörde in Frankfurt mögen die Albernheiten, die da anläßlich der Währungsturbulenzen im Ausland so Konjunktur haben, runtergehen wie Butter. An die Mär, daß Unternehmer investieren wie die Teufel, wenn die Banken – wg. niedriger Refinanzierungskosten beim Diskont- und Lombardsatz – ihnen billiges Geld borgen, glaubt er ja selber bei Gelegenheit auch. Daß er überhaupt nicht der Demiurg sämtlicher deutschen Wirtschaftswunder ist, dürfte er jedoch in der aktuellen bundesrepublikanischen Geldlandschaft längst gemerkt haben. Mit dem Bemühen, das Verdoppeln und Verdreifachen der umlaufenden Kredite einzuschränken, versucht er gerade den Geldmärkten unterhalb seiner Regie das zu verwehren, was sich die Bundesregierung dauernd – wegen DDR – erlaubt: eine inflationsträchtige Vermehrung deutschen Kreditgelds. Daß die Bundesbank ihre „Geldmengenziele“ ein ums andere Mal verfehlt, wirft auch ein bißchen Licht auf die „Unabhängigkeit“ der vielgepriesenen Behörde. Die Trennung von Ämtern macht eben noch lange nicht unabhängig vom Stoff, über den da entschieden wird.
Das hindert freilich auch den deutschen Wirtschaftsjournalismus nicht, die nationale Borniertheit des europäischen Auslands mit seiner kongenialen Sichtweise zu kontern. Den Beschimpfungen von „Spekulanten“, die den italienischen und englischen Währungshütern die „Stabilität“ versaut haben sollen, wußten sie entgegenzusetzen: „Währungspolitik, insbesondere Wechselkurspolitik läßt sich auf Dauer nicht an den Märkten vorbei betreiben.“ Der Vorwurf sitzt, weil er die Wirtschaftspolitiker des Auslands der Unfähigkeit bezichtigt, Einsicht in die Notwendigkeit des Fetischs aller marktwirtschaftlichen Sykophanten zu zeigen. Und zwar ohne die Spur eines Gedankens daran, daß der grundverkehrte Umgang mit Geld eine Gemeinschaftsleistung der EG gewesen sein könnte, in der die Bundesregierung samt ihrer „BuBa“ eine ansehnliche Rolle gespielt hat. Die haben sich ja ihrer grunddeutschen Überzeugung nach immer unabhängig an die Märkte gehalten, jedenfalls bis zu dem Septembertag, als sie plötzlich ein halbes Prozent heruntergingen mit ihrem Diskontsatz. Da wußten die Geldpatrioten gleich Bescheid und sahen eine „Kapitulation“ der deutschen Geldaufsicht – vor dem Ausland…
Mit seinen – theoretisch betrachtet – recht abwegigen Beurteilungen des Geschehens leistet der gesamteuropäische Sachverstand in seinen nationalen Einfärbungen zwar keinen Beitrag zum Begreifen der Krise. Jedoch ist ihm sein praktisches Gespür für die Qualität der Abrechnung, die da vollzogen wird, nicht abzusprechen. Die einen lauschen der Krise an der Währungsfront den Charakter einer Revision der nationalen Bücher ab, die die bis neulich gültigen und von allen Partnern anerkannten Eintragungen für frisiert erklärt – also die ökonomische Macht ihrer Nation einer radikalen Wertberichtigung unterzieht. Die anderen sind der Auffassung, das müsse sein. Denn nur echtes Wachstum zähle, und zum Wohle Europas wäre die Sortierung zwischen echter und fiktiver Leistungskraft seines Wirtschaftspotentials unbedingt vorzunehmen. Sie sind Fanatiker der lokalisierten Bewältigung der Krise – ganz als ob sie die Verwerfungen im EWS, den Kreditverlust ganzer Partnernationen und den nützlichen Effekt der Aktion dazu höchstpersönlich bestellt und geplant hätten.
6. Fahrplan durcheinander – aber weiterhin gültig
Geplant war aber überhaupt nichts von dem, was jetzt kontrolliert werden muß. Die Geldentwertung, die jetzt in den Mitgliedsländern der EG und zusätzlich in Staaten stattfindet, die ihren Nationalkredit an den europäischen Währungskorb „angebunden“ haben, weicht erheblich von der Marschroute ab, die in Maastricht vorgesehen war. Die an namentlich nicht benannte, aber wohlbekannte Regierungen ausgegebene Parole „Der Staat spart – für Europa!“ verfolgte das Ziel, die Mitgliedsnationen der EG sich den Anschluß an die ökonomische Großmacht „verdienen“ zu lassen – durch die Bereinigung ihrer Haushalte. Sie sollten prüfen, welche ihrer staatlichen Ausgaben „lohnend“ sind und sie unterscheiden von faux frais, die sie sich „nur“ deswegen leisten, weil sie sich als aparter ideeller Gesamtkapitalist für das Funktionieren ihrer Nation auch dort zuständig fühlen, wo die „Subventionierung“ offenkundig ist. In so begriffslosen Vorgaben wie dem Verhältnis von Staatsdefizit und Bruttosozialprodukt war die Aufforderung ergangen, die Freiheit zur Verschuldung durch eine Selbstbeschränkung abzulösen. Und der Nutzen sollte gerechterweise „Europa“, dem zukünftigen, zufallen, weil das alte, die EG, eine Anerkennung und gemeinschaftsinterne Absicherung der schlechten Schulden nicht mehr praktizieren will. Nur zur Vermeidung unerwünschter extremer Folgen dieser „Austerity-Politik“, deren zerstörerische Wirkung auf manche bislang für nützlich erachtete Einrichtungen also bekannt war, stand „die Gemeinschaft“ bereit.
Wie dieser Krisenersatz funktioniert hätte, braucht nun niemanden mehr zu interessieren. „Die Märkte“ haben ihre Pflicht getan und nicht auf die lokale Abwicklung gewartet; sie haben einer Nation nach der anderen die Entscheidung erspart, wie sie durch Manöver im Innern ihre Währung stabil macht, also den status quo erhält, was die internationale Kaufkraft ihrer Währung anlangt. Die schwindet schlicht, der Zwang zum Sparen ist an die Stelle des Willens getreten, europatauglich zu werden. Das mag für die europäische Internationale der Geschröpften keinen großen Unterschied darstellen – für ihre Herren ist es einer.
Der Plan von Maastricht hat keine Stützungskäufe vorgesehen, die einmal 40 Mrd., das andere Mal 60 Mrd. Kredit in verschiedener Denomination – unterwegs ist der als so stabil gepriesene Franc auch noch zum Betreuungsobjekt geworden –, von verschiedenen Nationen und von allen gemeinsam als ECU-Anleihe garantiert, in die Welt setzen. Daß die fristgemäße höchstförmliche Rückzahlung und Verzinsung erledigt sein will, ist klar – die Anmeldung von Bankrotten ist nicht üblich und würde zu der Katastrophe führen, die keiner will. Die so etwas ähnliches wie eine konzertierte Währungsreform, also einen Zusammenbruch des höheren Kalibers erzwingen würde. Die Auffüllung der Währungsreserven bei Italien und England tut not, was – „natürlich“ – durch neue Schulden vollzogen wird, denn der Staat muß schließlich sparen. Da nehmen die Briten plötzlich in bisher ungekannten Ausmaßen ein „Fremdwährungsprogramm“ in Anspruch, das für die Überbrückung von Schwierigkeiten von vergleichsweise lächerlicher Natur erfunden worden war. So garantieren neue Kredite von seiten „der Märkte“ – aller möglichen Geschäftsbanken, die Deutsche Bank vorneweg – inzwischen den Staatsschatz von Rom und London. Damit dem Geldkapital, das in diesen Hauptstädten und um sie herum nach Anlagen sucht, etwas angeboten werden kann, organisieren die Schatzkanzler den Ersatz für die Kapitalflucht gleich selbst; sie handeln – nicht nebenbei und auch, sondern bevorzugt und mangels Alternative – gleich mit deutschen Papieren. Mit deren Händewechsel und Zinssätzen verbinden die Akteure wiederum die verwegensten Vorteilsrechnungen, bis und damit kein Experte mehr die Not wahrnimmt, die all diese außer-ordentlichen Transaktionen gebietet: Es geht um das Funktionieren des Kreditsystems schlechthin, der Tauglichkeit aller möglichen Sorten europäischen Kredits – der darüber eine rasante Vermehrung erfährt.
Da hatten die guten Architekten von Maastricht wohl eher das Gegenteil im Auge. Sie wollten auch nicht eine kollektive Fürsorge für notleidende Währungen und Staatskassen beantragen – genau die aber hat ihnen die „Währungskrise“ aufgezwungen. So daß man im gelobten Land der Ankerwährung schon Bedenken über die Zuträglichkeit der bloß „spekulativen“ Nachfrage nach DM in allen Prägungen hegt. Zu offensichtlich ist der rein negative Grund für den Zuspruch, den das deutsche Geld in Europa erfährt: Die anderen sind und bleiben wacklige Eigentumsgaranten. So ist die „allmächtige“ Bundesbank und das an ihr hängende Geldgeschäft unfreiwillig, ganz ohne eigene Kalkulation, ohne wirtschaftspolitisches „Wozu?“ und nationalbankerische Stabilitäts-Gewinnsucht, in eine Rolle gerückt, die sie sich so nicht vorgestellt hat. Sie ist mit ihrer Mark, von der es immer mehr auf Konten in ganz Europa gibt, verantwortlich für immer mehr Kredit in der ganzen Gemeinschaft. Allerdings nicht als souveräner Hüter eines europäischen Geldes mit dem Markenzeichen „stabil“, sondern als Gläubiger.
Insofern hat die herbstliche Erschütterung der europäischen Währungen dem in Maastricht formulierten Bedürfnis, zwischen schlechtem Kredit hier und gutem Geld da zu unterscheiden, eine Absage erteilt. Die Währungskrise hat den Konstrukteuren der Währungsunion gezeigt, daß die Sorge um die Tauglichkeit von Staatsschulden nicht mehr an die Nationen der EG zurückdelegiert werden kann. Ihre Anstrengungen, die drohende Unbrauchbarkeit ganzer Nationalkredite abzuwenden, bezeugen eben nicht bloß, daß sie nach dem beliebten Motto „pacta sunt servanda“ dem Buchstaben der EWS-Vereinbarungen gefolgt sind. Durch den „Austritt“ von Italien und England aus dem EWS sind zwar Interventionspunkte und -pflichten sistiert worden, nicht aber die Betreuung von Geschäftsmitteln, deren Verfall auch „die anderen“ betrifft. Diese Betreuung erfolgte durch die europaweite Vermehrung von Krediten, die nun als Garantien für die nationalen Staatsschulden fungieren, weil diese – auf die Bilanzen der jeweiligen Garantiemacht gestützt – nichts mehr taugen. So ist über die verschlungenen Wege der kredittechnischen Haftpflicht wenigstens klargestellt, daß die Krise der Währungen eine allgemeine ist, daß auch die Kontraktion des Kredits, wenn es denn schon zu viel davon gibt, überfällig ist.
Daraus haben kundige Menschen in ganz Europa den Schluß gezogen, daß Maastricht erledigt ist. Daß man so mit der Überführung der EG in eine Währungsunion und schließlich in die politische Union nicht fortfahren könne. Man müsse sich einiges Neues einfallen lassen, die Verkehrsformen in der EG, das EWS etc. reformieren. Und zusehen, wie die Nationen – aus denen sich das Europa bislang immer noch zusammensetzt – aus ihren gegenwärtigen Nöten herauskommen.
Nicht so die deutsche Regierung und ihr französischer Partner. Vor allem in Bonn läuft selbst die Einsicht, daß kaum jemand, auch Deutschland mit seiner Mark nicht, die Beitrittsbedingungen wird erfüllen können, auf das glatte Gegenteil hinaus. Mit einem sturen „Jetzt erst recht und schon gleich!“ besteht das wiedervereinigte Deutschland auf der Vollendung der europäischen Einheit. Seitdem man in Bonn offiziell Kenntnis davon genommen hat, wofür und im Verhältnis wozu es zuviel Kredit, also gar nicht stabiles Geld in Europa gibt, hält man dort auch diese Diagnose für einen guten Grund, „den Fahrplan einzuhalten“.
7. „Währungskrise“ – von wegen!
Was die Handlungsbevollmächtigten des nationalen und geschäftlichen Kreditwesens leisten, wie sie mit den komplizierten Instrumenten ihres Handwerks zu Werke gehen, wenn an den Geldhandelsplätzen etwas durcheinander gerät – das ist schon bemerkenswert. Nicht etwa deswegen, weil diese Spezialisten des Geldgewerbes im Unterschied zu gewöhnlichen Menschen sich mit „Multiwährungsfazilitäten“, „Zinstendern“ und „Basispunkten“ auskennen und herumschlagen. Sondern wegen der Sache, um die sie sich kümmern.
Obgleich ein Schatzkanzler, Finanzminister oder Bundesbanker unzweifelhaft seinen Beruf „pro domo“ ausübt, also auf das Geld der eigenen Nation, seine Qualität und Menge achtet, ist diesen Geldpatrioten jeder Erfolg auch ein Problem. Sicher, auch für sie beweist der Angriff der „Märkte“ auf das Geld der anderen und ihre wohlwollende Beurteilung der eigenen Geschäftsmittel einiges: daß im eigenen Land gut gewirtschaftet worden ist, daß auswärts „Mißwirtschaft“ eingerissen ist, daß vor allem sie selbst ihre haushälterischen Pflichten bestens erledigt haben. Doch zusätzlich ist ihnen stets der Standpunkt geläufig, die Folgen jeder Entscheidung in der internationalen Konkurrenz zu bedenken und zu betreuen. Und das nicht nur wegen des sehr schlichten Interesses der Geschäftsbanken, die am nationalen Geld hängen und um die Bedienung und Verzinsung ihrer Kredite fürchten, wenn auswärtige Partner in Schwierigkeiten kommen. An solchen Sorgen entdecken sie ihre Verantwortung für die Fortsetzung der internationalen Geschäftsbeziehungen insgesamt. Im Unterschied zum abstrakten Standpunkt der Konkurrenz, dem das Wegnehmen von Marktanteilen, das Aus-dem-Felde-Schlagen auswärtiger Wettbewerber geläufig ist, ergänzen sie die Pflege des Standorts – hier statt dort, unsere Produktionen statt der von anderen – um eine „Rücksicht“: Sie sind berufsmäßig mit den Bedingungen befaßt, die im Ausland erfüllt werden müssen, damit es als Mittel für die eigenen nationalen Weltmarkterfolge erhalten bleibt. Diese Befassung mit der Brauchbarkeit von konkurrierenden Nationen, die sich auf deren Zahlungsfähigkeit richtet, wenn es um die eigenen Überschüsse geht, ist längst institutionalisiert – in internationalen Einrichtungen wie dem IWF, der Weltbank und, speziell für Europa, im EWS. Als Umgang mit den zu respektierenden Interessen anderer Souveräne hat die Währungspflege, die Einrichtung von Kreditlinien etc. notgedrungen politischen Charakter – diese „technischen“ Erfordernisse des auswärtigen Handels sind ihres Inhalts wegen Gegenstand von Verträgen zwischen Nationen; und umgekehrt sind die Verwalter von Münze und Kredit in all ihren Operationen Beauftragte der nationalen Sache, der „Strategie“ eines Landes. Ihres Amtes walten sie, sobald die entsprechenden Übereinkommen getroffen sind, als Sachverständige des Geldwesens, die in der Anwendung und Erfindung kredittechnischer Verkehrsformen, von „Fazilitäten“ aller Art die Gefahren bannen, die dem auswärtigen Geschäft dauernd drohen.
Auf diesem Feld leisten sie dann recht viel.
Was sie nicht leisten können, erfahren sie dieser Tage wieder einmal drastisch. Ihre Operationen gelten den Wechselkursen, den Fährnissen, die mit schwindenden Staatsschätzen bei den Partnern aufkommen, also der Erhaltung der Zahlungsfähigkeit in der europäischen Gemeinde. Und in ihrer kundigen Behandlung des Geschehens als „Währungskrise“ lassen sie wahrlich keinen Versuch aus, die positive Abhängigkeit der europäischen Nationen voneinander, der eingetretenen Notlage entsprechend, zu organisieren. Daß dabei nationalistische Töne aufkommen, ist ihnen geläufig und dürfte sie auch nicht wundern – immerhin stellen die Entscheidungen, die sie treffen, eine Abrechnung dar. Die Neuordnung des innereuropäischen Kreditwesens, das sie fortschreiben, enthält nun einmal auch den Entzug und die Zuweisung von Bedingungen für die weitere Teilnahme am Welthandelsplatz Europa; Bedingungen, die als Niederlage und Übervorteilung genommen werden. Dennoch bestehen die Geldhüter zu Recht darauf, daß sie den eingetretenen Veränderungen nur entsprechen, sie feststellen und Paritäten wie Kredite den eingetretenen Verschiebungen anpassen. Und in solchen lichten Momenten ihrer Rechtfertigung, in der Zurückweisung von Vorwürfen, die einen nationalistischen Mißbrauch ihrer Macht geißeln, berufen sie sich auf ihre Ohnmacht. Ihre Verfahren erheben die Schwierigkeiten, die Nationen mit der Praktizierung der Gleichung „Kredit = Geld“ haben, zur gemeinsamen Sache. Zu mehr sind sie nicht in der Lage. Daß in der gesamteuropäischen Betreuung der schlechten Gelder die Verlierer ein klein wenig haften müssen für ihre Unterlegenheit, ist sachlich geboten…
Die Macht, die dem Management des zwischenstaatlichen Geldverkehrs zugeschrieben wird, ist jedenfalls nicht sein Verdienst. Sie fällt ihm zu, weil die Konkurrenz der Kapitale die Sieger und Verlierer auch in der Bundesliga der Nationen ermittelt. Die sich da von Berufs wegen mit der „Währungskrise“ befassen, haben selbige nicht bestellt. Sie befassen sich auch nur mit der „Währungskrise“, die sie ohne Rücksicht auf ihre Gründe auf die Tagesordnung setzen. In den lichten Höhen des multikulturellen Schuldenbetriebs vollziehen sie die Krise, die sie weder verhindern konnten noch bereinigen können. Denn auch die Infragestellung des Kredits, der als „Währung“ seinen Dienst tut, erfolgt wegen fehlender Profitproduktion. Eben in den Ländern, wo die Kosten-Gewinn-Rechnung der am auswärtigen Handel teilnehmenden Betriebe – und das sind, dank Europa, in Europa so gut wie alle – dem internationalen Vergleich nicht standhält. Weil die Unternehmen der Nation nicht rentabel genug produzieren, um sich auf dem Weltmarkt auf Kosten ihrer Konkurrenten ihren Gewinn zu verdienen, fallen die Bilanzen der Nation gegenüber dem Ausland so negativ aus. Und die „Geldmärkte“ fällen mit ihren unbestechlichen Angebots-Nachfrage-Kurven das Urteil über die Währung, die der Staat seiner einheimischen Wirtschaft als ihr Geschäftsmittel per Verschuldung zur Verfügung stellt. Als erster erhält in der internationalen Konkurrenz der Staat die Quittung dafür, daß er unter seiner Hoheit Kapitalisten wirken läßt, deren Produkte sich mit denen des Auslands nicht messen können – in bezug auf ihren Gehalt an Kosten und Überschuß. So daß dann der Staat die schlechte Nachricht an seine unternehmenden Lieblingsbürger weiterreichen kann: Sein in Geldentwertung übersetztes Defizit entpuppt sich nachträglich als die Finanzierungsquelle für die Gewinne, die in den Bilanzen der Betriebe vorhanden waren. Die ab sofort aber keine mehr sind, weil die internationale „Kaufkraft“ der schwarzen Zahlen empfindlich reduziert ist…
Wenn, wie es die „Marktwirtschaft“ gebietet, die „maroden Betriebe“ ihre Geschäfte einschränken oder ganz lassen, tragen sie unfreiwillig zur Demonstration der „Ohnmacht“ bei, von der in bezug auf die Geschäftsführer der „Währungskrise“ die Rede war. Sie vermindern das als Kapital fungierende Geld der Gemeinschaft, machen sich als „entfallene“ Zahlungsfähigkeit für alle anderen, auch guten Wirtschaftern bemerkbar – und kommen unter der Rubrik „weggebrochene Märkte“ in ein Sachverständigen-Gutachten. Dem kann der deutsche Kanzler, aber auch die Bundesbank entnehmen, daß nicht nur in Italien, England, Spanien… Krise ist, sondern die ganze vom EWS betreute Gemeinschaft der kapitalistischen Nationen unter einer Überakkumulation leidet. Auch in dem Musterland der imperialistischen Konkurrenz fehlt es an „Wachstum“, wenn es dort ausbleibt, wo sich das deutsche Kapital so rentabel bedient hat.
In solchen Situationen allerdings wird der Umgang mit Geld und Kredit, mit Produktion und Handel ein bißchen „politischer“, als er es gewöhnlich in seiner Handwerks-Natur ist. Denn die Organisatoren von Geld und Kredit leisten ihre Dienste für Import & Export, wenn sie gehen. Sie sind eine leistungsfähige Fachabteilung der Politik, wenn der Welthandel gelingt und Wachstum genehmigt. Gegen seine Störungen bieten sie kein „Rezept“, es sei denn, der Verkehr zwischen den Souveränen weist ihnen neue Aufgaben zu.
So soll es schon vorgekommen sein, daß Nationen in allgemeiner Krise dazu übergegangen sind, das Verhältnis von Schutzzoll und Freihandel an ihren Grenzen neu zu bestimmen. Sie haben sich als Geschädigte des geschäftigen Internationalismus gesehen, auch als Benachteiligte der international geregelten Betreuung des freien Geldverkehrs. Sie sind zur Beschränkung des auswärtigen Handels, auch zur „Devisenbewirtschaftung“ geschritten, weil sie von der Einbindung des nationalen Geschäfts in die Freiheit des Welthandels genug hatten. Die „Abhängigkeit“ von diesem konnten sie nur als negativen Tatbestand lesen, weil sie als Instrument versagt hatte. Die entsprechenden Einschränkungen für das Wirtschaftsleben der Nation haben sie in Kauf genommen; mit dem Ziel, nach einer Phase der inneren Zurichtung dominierend, nicht unterlegen, schrittweise und stets nach sorgfältiger Prüfung wieder die Bühne des internationalen Freihandels zu betreten.
Dergleichen spielt vorläufig in Europa nur die Rolle eines Gespenstes, das es zu verbannen gilt. Geplant ist ein anderes Vorgehen, insbesondere von seiten der überlegenen Wirtschaftsmacht Deutschland.
8. Die deutsche Politik in der Krise: Europa
Die deutsche Regierung hat nicht nur ein Gutachten geschenkt bekommen, das von Nullwachstum und Rezession erzählt. Selbst der Kanzler kann Zeitungen lesen, in denen sich die Berichte über marode Unternehmen/West häufen. Unter ihnen befindet sich das Feinste vom Feinsten im deutschen Wirtschaftswunderladen: VW, Mercedes, Chemiegiganten… Die Ansagen bezüglich Schrumpfung und Kurzarbeit, Schließung und Entlassung bringen täglich die soziale Komponente in die Nachrichten, die zuletzt mit der deutschen Ausländersache gefüllt waren. Jeder, der es wissen will, bemerkt, daß da noch einiges ins Haus steht in Sachen Entwertung von Kapital, daß diese „Rezession“ einiges anrichtet und die vorläufig noch wichtigste Machtquelle dieser Nation, ihre Ökonomie, empfindlich beschädigt.
Und dennoch: Die Linie der deutschen Politik folgt nicht dem Programm einer Krisenbewältigung, sie anerkennt diesen klassischen „Notstand“ des demokratischen Kapitalismus nicht als ihren Leitfaden. Und schon gleich gar nicht anerkennen Kabinett und Opposition die europäische Qualität der Angelegenheit. Die schlechte Konjunkturlage gilt in Deutschland als ein externer Faktor, der hinzugekommen ist und eine längst feststehende Tagesordnung erschwert, aber nicht behindern darf. Nicht die Spur eines Verdachts, die von deutschem Boden ausgehende Geschäftstätigkeit und ihr Gelingen könne etwas mit der Schwäche der Partner zu tun haben, die sich jetzt rückwirkend auch an den deutschen Bilanzen bemerkbar macht. Nicht das geringste Bedenken, ob Deutschland nach der Rezession noch dieselben, das Ausland beeindruckenden Potenzen kommandiert wie vorher. Dieser seine Mittel gar nicht zählende, geschweige denn bezweifelnde „Primat der Politik“ hat inzwischen schon seine Geschichte, seine – in den Augen seiner Verfechter – guten Gründe, sowie einen Inhalt.
Zur Geschichte. Da war neulich eine Wiedervereinigung, aus deren Vollzug die Verantwortlichen eine Sentenz ableiteten: Damit ist die deutsche Verantwortung in der Weltpolitik gestiegen. Natürlich war überhaupt nichts größer geworden, außer eben Deutschland und der Anspruch, quasi proportional zum Zugewinn an Land und Leuten den gewohnten Erfolg deutschen Geldes und Einflusses zu steigern. Als sich herausstellte, daß die „Exportnation“ mit der DDR eher einen Zuwachs an Schulden denn an kapitalwirksamer Basis an Land gezogen hatte, wurde die Behauptung mitnichten zurückgezogen. Sie gilt heute noch, d.h. Deutschland führt sich so auf.
Es stützt sich also auf gute Gründe. Erstens ist diese Nation in Mittellage – auch wenn die Zone nicht gleich funktioniert – weit und breit die größte Wirtschaftsmacht. Eine, die sich wegen des russischen Spielabbruchs auch von niemand in der Gegend etwas gefallen zu lassen braucht. Zweitens hat sie in der europäischen Gemeinschaft ihre Wirtschaftsmacht nicht nur gesammelt, sondern auch dahingehend unter Beweis gestellt, daß sie als Gläubiger von ganz Europa über eine Mark verfügt, mit der sich jeder auswärtige Einmischungs- und Erschließungswunsch verwirklichen läßt. Wenn es sich lohnt – Anträge liegen genug vor.
Der Inhalt: Europa. Will heißen ein neuer Fall von Vereinigung, zwischen Nationen, denen in ihrer gewachsenen Abhängigkeit von deutschen Bilanzen gar nichts anderes übrig bleibt, als nach Maßgabe dieser deutschen Erfolgsrechnung zusammenzuwachsen. Wie gesagt, dieses Programm liegt vor ganz ohne Rücksicht darauf, daß das ursprüngliche Maastricht-Projekt erst einmal eine Krise heraufbeschworen hat, und seine Verfechter lassen sich auch nicht davon stören, daß die Krise und ihr Verlauf die Bestandteile Europas einschließlich ihres einigungsbeflissenen Zentrums nicht so lassen, wie sie sind.
In einer Hinsicht hat sich die Bundesregierung ohnehin eine staatsübliche Reaktion auf Krisen erspart: Das Programm „Der Staat spart“ hat sie schon vorher für die Bewirtschaftung der Zone aufgelegt. Die Gefahr, daß es ihr für ihre Vorhaben an den nötigen Wachstumsraten gebricht, steckt sie lässig weg. Das geht anderen auch so, relativ zu ihnen steht die BRD aber allemal besser da und kann sich auf die Masse des ihr verfügbaren Reichtums verlassen. National und international: Für die Beglückung der Zonis legt sie, nach einem zweijährigen Hinundher von maroden Fehlkalkulationen, ein staatliches Industrialisierungsprogramm auf. In Europa weiß sie sich nach den krisenbedingten Kürzungen der Kapitalkraft anderer Nationen sowieso zuständig. Es ist, als wollten Kohl und die Seinen nur die eine rhetorische Frage loswerden: Wer denn sonst soll mit dem ihm zu Gebote stehenden Reichtum und seinem ehrlich verdienten Kredit die Probleme lösen, die wir in drei Jahrzehnten EG allen aufgehalst haben?
9. Im Angebot: noch eine friedliche Eroberung
Die intransigente Art, mit der von Deutschland aus der Ruf „Europa“ ertönt, während die lieben Partner damit befaßt sind, den nationalen Notstand anzugehen, den ihnen die innereuropäische Konkurrenz in Gestalt einer Krise in den Haushalt geblasen hat, ist bestechend. Da wird bewußt davon abgesehen, daß „die Geschichte“ sich in keinem bedeutenden Punkt mehr an den Fahrplan von Maastricht hält. Es wird in Kauf genommen, daß der Wille einer ganzen Schar von EG-Mitgliedsstaaten, ihre Nation maastricht-gemäß zuzurichten, das Gegenteil angerichtet hat. Deutschland hat gesehen, wie die Konkurrenz in Europa die Fähigkeit seiner Partner – immer noch souveräne Nationen mit eigenen Bilanzen und Völkern, auch mit eigenen Ambitionen – mitzuhalten strapaziert hat; die Bundesregierung weiß, daß die meisten EG-Mitglieder daran scheitern, gemäß der Logik der Preisform die Entschädigung zu ergattern, welche die Verluste rechtfertigt. Und dennoch – aus deutscher Sicht also: deswegen – fordert sie den Willen der EG-Gesellschafter ein, in Europa aufzugehen. In einem Europa, in dem weder das nationale Geld, noch die vielen Ambitionen der noch amtierenden ideellen Gesamtkapitalisten in Sachen Betreuung ihrer Marktwirtschaft, noch die weltpolitischen Interessen ihr Recht haben – es sei denn, sie entsprechen den Leitlinien der neuen Großmacht, die sicher nicht in Athen ausgeheckt werden.
Mit diesem lupenreinen Antrag auf Unterwerfung, der seinen Adressaten mit einer geharnischten Anspielung auf die materielle Lage ihrer Nationen kommt, also eine Revision der eingegangenen Abhängigkeiten für nicht ratsam erklärt, haben die deutsch-französischen Fanatiker der Großmacht Europa einiges in Bewegung gebracht.
10. Nicht-politökonomische Schranken deutscher Überzeugungskraft
Die Losung „Europa“ beruft sich unverhohlen auf ein in sämtlichen europäischen Währungen ausdrückbares Kräfteverhältnis. Damit freilich auch auf die Bereitschaft der zu Europa eingeladenen Nationalisten, das in der EG und unter der Schirmherrschaft des Ost-West-Gegensatzes zustandegekommene Kräfteverhältnis anzuerkennen. Und zwar in dem Sinn, daß sie ihre aktuelle ökonomische Schwäche zum Leitfaden für den Weg ihrer Nation machen. Daß sie keine Alternative mehr wissen, die ihrer Nation offensteht. Das ist nicht nur vermessen, sondern auch sehr bieder gedacht. Die Logik der Erpressung, die sich in ein Angebot kleidet, hat es immerhin mit Souveränen, Inhabern eines Gewaltmonopols und volkstümlichen Anhängern desselben – zumindest im Unterschied zu anderen Ausführungen – zu tun.
Bieder ist die Annahme, daß ganze Nationen ausgerechnet ihr beschädigtes Bruttosozialprodukt wie ein Diktat behandeln, das ihre Entscheidungen festlegt. Niederlagen – sogar solche in Kriegen – sind schließlich schon des öfteren als Auftrag verstanden worden, gewisse Korrekturen am Kräfteverhältnis anzubringen. Das Angebot „Europa“ fordert die Fortsetzung einer Berechnung ein, der die EG-Mitglieder unter zwei Bedingungen gefolgt sind, die es nicht mehr gibt. Der europäische Markt ist – wegen der Krise mit ihren national spezifischen Verwüstungen – kein Mittel für das nationale Wachstum mehr. Vielmehr ein Wirtschaftsbündnis mit denkbar schlechtem Ausgang für einige nationale Bilanzen. Und die Klammer, die einmal „Freier Westen“ hieß und den zweitrangigen Mitgliedern dieser Gruppierung einen soliden Ökonomismus als zur Mitwirkung an der Nato passende Staatsräson geraten scheinen ließ, ist weg. Letzteren Tatbestand sehen die Europa-Fanatiker zwar als die auch ihren Partnern offenstehende Chance an, die sie ergreifen müßten – wollen sie ihnen aber nur um den Preis einer neuen, untergeordneten Mitwirkung eröffnen. Das ist ein Widerspruch, der zu allerlei Widersprüchen im europäischen Leben führt.
Sogar zwischen den beiden Staaten, die von der Krise unbeeindruckt auf Europa dringen, spielt sich da manches ab. In Frankreich muß die Regierung Wähler und Verbände aller Art mit dem Argument gewinnen, ohne die Fertigstellung der europäischen Einheit wäre Deutschland gefährlich und wieder auf dem Sprung, zum mächtigen Feind zu werden. Im Rahmen Europas dagegen wären alle Franzosen Nutznießer deutscher Wirtschaftskraft und als deren Verbündete gegen alle deutschen Übergriffe versichert. In den GATT-Streitigkeiten mit den USA müssen dann die Franzosen erfahren, daß zwar ihre Regierung den Agrarexport unter den bestehenden Bedingungen für ein verteidigenswertes französisches Recht hält, die Bundesregierung darin aber eher einen Unterposten der europäischen Außenhandelsbilanz sieht, für den es sich nicht zu streiten lohnt. Während die deutsche Öffentlichkeit den Freihandel mit den USA für einen Segen hält, der im Namen der industriellen Exporte nicht gefährdet werden dürfe, also gewisse Abstriche beim französischen Agrarexport rechtfertigt, sehen das die Franzosen umgekehrt. Wenn die Agrarexporte aus der Sicht des deutschen „Spiegel“ nicht mehr ausmachen als die Exporte der fünf größten französischen Industriekonzerne, verlegt sich die französische Nation, ihre Bauernschaft schon gleich, auf die umgekehrte Bewertung des Vergleichs.
Solche Dinge wollen also geregelt sein. Andere fangen erst richtig an. Irgendwie haben die Regierenden in der europäischen Provinz nicht nur gemerkt, welcher gemeinschaftsbildende Antrag ihnen da gemacht wird aus Deutschland, sondern auch ihren Untertanen, allen Ständen in ihrer unterschiedlichen Betroffenheit durch die europäische Sache, mitgeteilt. Von den Ausfällen gegen die Bundesbank in den Finanzblättern der Nationen bis zu den einnehmenden Berichten der Boulevard-Blätter über die neue deutsche Welle tut da alles seinen Dienst. Das „Bild der Deutschen im Ausland“ ist keine Ideologie von Klaus Kinkel und den prominenten Berliner Demonstranten. Auf dieses Ding kommt es tatsächlich an. Denn vom diplomatischen Versuch, die Konditionen im Verkehr mit Deutschland zu kritisieren und zu verbessern, über die Klage der Regierung, wegen Deutschland und Europa sei im eigenen Land der eine oder andere Schritt zur Pauperisierung unumgänglich, bis zur Verschiebung des nationalen Parteiengefüges, in das plötzlich neue Nationalisten Einzug halten, um die Leitung der Nation in ganz andere Richtungen zu lenken, ist es nicht weit. Genau das, die Sollizitierung eines anti-deutschen Nationalismus, einer Absage an Europa im Namen der eigenen Nation, und sei es ihrer Ehre, ist die Wahrheit der Sprüche, mit der der deutsche Außenminister sein schweres Los beklagt.
Wie man sieht, geht es ganz gut, auch angesichts einer Krise stur „Europa“ zu verlangen. Die deutsche Außenpolitik hat sich dafür sogar das Argument einfallen lassen, daß dieses Europa, wenn „wir“ es jetzt nicht schaffen, auf Jahrzehnte hinaus verloren ist. Ob diese Rechnung auch aufgeht, ist eine ganz andere Frage. Erstens kommt es sehr darauf an, wie die Krise tatsächlich verläuft. Wieviel also von der Wucht deutschen Kapitals auch und vor allem gegenüber der außereuropäischen Konkurrenz erhalten bleibt. Zweitens sind die europäischen Partner zu einer Entscheidung aufgefordert, die ein Entweder/Oder betrifft, gegenüber dem ökonomische Vor- und Nachteilsrechnungen kleine Fische sind. Drittens also wagt sich der deutsch-französische Europa-Gedanke der Krisenjahre in eine Konfrontation mit europäischen Ausländern, die vom selben nationalistischen Schlag sind wie ihre deutschen Partner, mit denen sie gerade schlechte Erfahrungen machen.
So weit ist es mit dem tendentiellen Fall der Profitrate gekommen.