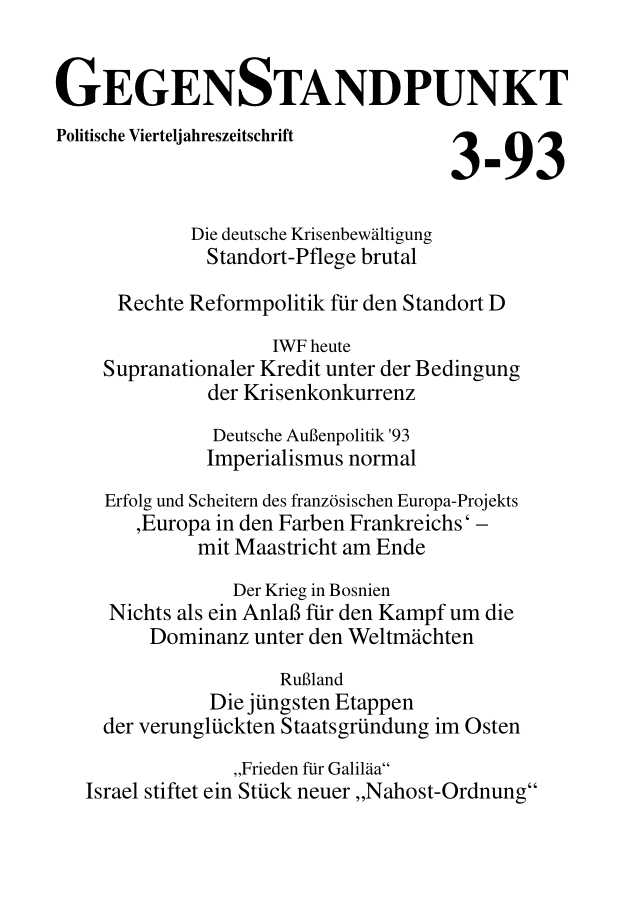Die Krise in Europa und ihre Schadensfälle
‚Europa in den Farben Frankreichs‘ – mit Maastricht am Ende
Durch jahrzehntelange Europa-Politik nach dem Doppelprinzip „mit der BRD und gegen die USA“ steht Frankreich ökonomisch als Juniorpartner im DM-Block, politisch als Atommacht ohne europäische Gefolgschaft da. Angesichts der Wirtschafts- und Währungskrise und eines sich abzeichnenden vereinten Europas unter deutscher Führung verliert Frankreich in Folge von „Maastricht“ relativen Erfolg und verlässliche Perspektive in und mit Europa; ihm wird statt dessen ein Kräftemessen von Deutschland aufgenötigt, das mit zunehmender Macht und Entschiedenheit auf nationalen Interessen besteht, die mit den französischen unvereinbar sind.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Siehe auch
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
- Die zwei Prinzipien der französischen Europa-Politik: mit der BRD gegen die USA
- Bilanz der ökonomischen Erfolge aus drei Jahrzehnten EG: Juniorpartner im DM-Block
- Bilanz der Bemühungen um imperialistische Autonomie: Atommacht ohne Gefolgschaft
- „Maastricht“ und die Folgen: Wendepunkt und Krise des französischen Europa-Projekts
- Zwischenfazit: Die Wahrheit über eine Freundschaft unter Imperialisten
Die Krise in Europa und ihre
Schadensfälle
Erfolg und Scheitern des französischen
Europa-Projekts[1]
‚Europa in den Farben Frankreichs‘ –
mit Maastricht am Ende
Als der französische Staatspräsident Mitterrand nach der epochemachenden EG-Gipfelkonferenz von Maastricht im Herbst 91 eine Volksabstimmung über den dort unterschriebenen neuen Einigungsvertrag der EG-Staaten ansetzte, war er sich der Zustimmung seiner Nation gewiß. Seine Sicherheit beruhte nicht auf Meinungsumfragen, sondern auf einer seit Jahrzehnten verfolgten Staatsräson: Für Frankreichs Politik war „Maastricht“ ein entscheidendes Ziel.
Als wenige Monate später das Referendum ausgezählt wurde, war die Mehrheit für den neuen EG-Vertrag denkbar knapp; und die Regierung, die ihn ausgehandelt und sich damit identifiziert hatte, ist kaum ein Jahr danach, im Frühjahr 93, vom Wähler mit einer vernichtenden Wahlniederlage bestraft worden. Der Grund für Europa-Skepsis und „Regierungsverdrossenheit“ der Nation war weder die ominöse „Brüsseler Bürokratie“ noch der sozialistische „Regierungsfilz“, sondern schon wieder die europäische Staatsräson Frankreichs: Die war mit „Maastricht“ gescheitert.
Die neue Regierung führt mit neuem Elan die alte Politik weiter. Sie hat zu „Maastricht“ keine Alternative und für das damit verfolgte nationale Ziel durchaus noch ein paar Mittel von bedingter Tauglichkeit.
Die zwei Prinzipien der französischen Europa-Politik: mit der BRD gegen die USA
Ein Binnenmarkt mit gemeinsamer europäischer Währung stand nicht auf Frankreichs Programm, weder als die 4. Republik 1951 die Montanunion mit den fünf späteren EG-Partnern einging, noch als 1957 die Verträge über Euratom und EWG unterschrieben wurden; und von einer Schmälerung der nationalen Souveränität wollte der Gründer der 5. Republik schon gleich nichts wissen, als er mit Adenauer die vielgerühmte „deutsch-französische Freundschaft“ schloß. Dennoch: Wenn sich eine Nation, von den Anfängen bis „Maastricht“, mit dem Projekt Europa identifiziert hat, dann ist das Frankreich. Dieser Staat verfügt über einen klaren Grundsatz, nach dem er von Anfang an den Aufbau eines geeinten (West-)Europa betrieben und die jeweils fälligen Fortschritte des Projekts definiert hat, und dieser Grundsatz ist für die Nation essentiell, weil er überhaupt den Leitfaden ihres Imperialismus abgibt. Er läßt sich auf die Formel bringen: mit der BRD – gegen die USA.
1. Gegen die USA – das heißt nicht, daß Frankreich sich im großen „Ost-West-Gegensatz“ der Nachkriegszeit je auf die realsozialistische Seite gestellt oder auch nur neutral verhalten hätte; auch nicht, daß die Nation sich den von Amerika aus eingerichteten Prinzipien der Weltwirtschaft, dem globalen Kapitalismus auf Dollarbasis mit seinen verschiedenen supranationalen Regelungsinstanzen, entzogen hätte. Es heißt allerdings, daß Frankreichs nationale Zielsetzung nie auch nur zum Schein darin aufging oder sich darin aufgehoben fand, die Sache des „Westens“ gegen den „Ostblock“ zu unterstützen und daneben in der Nationalbank weltweit zusammenverdiente Dollar zu lagern, bis man sich mit der eigenen Währung auf allen Märkten des Globus sehen lassen konnte. Nachkriegsfrankreich und dann De Gaulles 5. Republik stellte sich als souveräne Siegermacht durchaus gegen die „sowjetische Gefahr“, zugleich aber auf eine Stufe mit der – aus französischer Sicht „selbsternannten“ – westlichen Führungsmacht, den USA, und fand unter diesem anspruchsvollen Gesichtspunkt an sich selbst gewaltige Defizite: den nationalen Reichtum zu gering, dessen produktive Basis zu schmal, die Reichweite der eigenen Militärmacht zu begrenzt und überhaupt die eigene Souveränität durch den großen Welt-Gegensatz, in den Frankreich eingeordnet war, ohne ihn selbst eröffnet zu haben und bestimmen zu können, unerträglich eingeschränkt. Also verschrieb sich die Nation dem Programm, die Basis ihrer Macht zu verbreitern, die Reichweite ihrer Machtmittel zu vergrößern und so zwischen den verfeindeten „Supermächten“ genügend autonome Macht aufzubauen, um sich von deren Feindschaft und damit vom strategischen Übergewicht der USA zu emanzipieren.
Die „Force de Frappe“, aufgestellt nach dem – auf die gegebene strategische Lage bezogen etwas absurden – Konzept der „Rundum-Verteidigung“ und von keinem französischen Politiker je in Zweifel gezogen, zeugt von dem Willen, die militärischen Voraussetzungen für eine autonome europäische Macht jenseits des „Ost-West-Gegensatzes“ zu schaffen. Der gleiche unbedingte Wille zur nationalen Emanzipation war am Werk, als der erste Präsident der 5. Republik die Kündigung der vom Dollar dominierten kapitalistischen Weltwirtschafts-„Ordnung“ mit seinem Beschluß einleitete, die von der US-Regierung behauptete Gold-Parität des Dollar buchstäblich ernst zu nehmen und Frachtschiffe zur Plünderung des Fort Knox nach Amerika fahren zu lassen. Und bei der Beschwörung der Notwendigkeit, Frankreich von amerikanischer Vorherrschaft zu befreien, hat sich ohnehin kein Nachkriegspolitiker der Grande Nation je Hemmungen auferlegt, schon gar nicht solche von der heuchlerisch-prüden Art, die die bundesdeutschen Machthaber in ihrem berechnenden großdeutschen Revanchismus immer ausgezeichnet hat: Es galt, „Die amerikanische Herausforderung“ (Buchtitel von J.J.Servan-Schreiber) zu bestehen; die Alternative hieß „Europa oder Tod“ (Buchtitel von M. Poniatowsky); usw.[2]
2. Daß Frankreich für die Verwirklichung dieses Vorhabens immer entscheidend auf die BRD gesetzt hat, bedeutet nicht, daß es sich die nationalen Ziele seines größten und wichtigsten Partners zueigen gemacht hätte; und es bedeutet auch nicht, daß man in Paris von vornherein keine Alternativen gehabt, gewußt und auch probiert hätte. Nach Kriegsende hat die neuerstandene Republik zuerst ihr Kolonialreich wiederhergestellt und verteidigt, bis sie sich angesichts verlorener Schlachten, wachsender Haushaltsnöte und zunehmender weltpolitischer Isolierung eingestehen mußte, daß Kolonien in der Welt des freien Welthandels auf Dollarbasis kein taugliches Mittel nationaler Bereicherung mehr waren, stattdessen unter den Bedingungen einer globalen Frontstellung gegen das „sozialistische Lager“ eine kostspielige Last; und trotzdem mochte die Nation speziell von Algerien als transmediterraner „Provinz“ zunächst nicht ablassen, so als hinge ihr Status als Weltmacht von der Fiktion einer doppelten Staatsgröße ab. Was das Verhältnis zum besetzten und alsbald geteilten Deutschland angeht, so war die französische Politik, so sehr sie von Beginn an dem Ideal von Europa als „dritter Kraft“ zwischen Sowjetkommunismus und US-Kapitalismus verpflichtet war, zuerst mehr auf das defensive Ziel gerichtet, den alten Feind an der freien Entfaltung seiner gefährlichen Potenzen zu hindern und ihn dafür in nationenübergreifende Organisationen unter französischer Führung einzubinden. Unter dieser Zielsetzung entstand die erste „Europäische Gemeinschaft“, nämlich für „Kohle und Stahl“ (EGKS oder Montanunion), die die Schwerindustrie der beteiligten Länder, Grundlage aller nationalen Rüstung, einem supranationalen Regime unterwarf, sowie der Plan einer „Europäischen Verteidigungsgemeinschaft“ (EVG), der eine Wiederbewaffnung Westdeutschlands als Gegengewicht gegen die Rote Armee zugestand, aber nur unter einem französisch dominierten Gemeinschaftskommando bis hinauf zu einem gemeinsamen Verteidigungsministerium und bis zur Bataillonsebene hinunter.[3]
Bei dieser defensiven Zielsetzung blieb es aber nicht. Frankreich kalkulierte mit seinem großen Nachbarn – und den anderen Partnern, die man in Paris sicher unter französischem Einfluß wußte – als Hilfsmächten für sein imperialistisches Emanzipationsprogramm. Das Ziel war klar: erstens die ökonomische Basis einer „dritten Weltmacht“ auf europäischem Boden zu schaffen, zweitens für die nötige Reichweite und militärische Durchschlagskraft und strategische Autonomie des von Paris ausgehenden weltpolitischen Ordnungs- und Eingriffswillens zu sorgen. Das Mittel dafür sollte eine europäische Gemeinschaft sein, von der die Grande Nation sich ein genauso verlogenes Bild machte wie alle anderen Teilnehmer, nämlich als von einem freiwilligen Supranationalismus der andern im Sinne und Interesse der eigenen nationalen Zielsetzung. Die Voraussetzung für eine solche Gemeinschaft mit der neugeschaffenen BRD war nach französischer Rechnung dadurch gegeben, daß dieses neue Deutschland nicht bloß besiegt, sondern in seiner Souveränität beschränkt und – dauerhaft, wie es schien – verkleinert war, um seine gesamte östliche Hälfte, und in jeder Hinsicht nach Osten hin blockiert durch den sowjetischen „Eisernen Vorhang“, daher für seine Rückkehr in die Weltpolitik auf den Anschluß an den Westen verwiesen, zu Bedingungen, die dort gesetzt wurden und nicht in Bonn. Die Chance, die Frankreich sich für eine verläßliche Einbindung der BRD in eine nach seinem Interesse definierte europäische Staatengemeinschaft ausrechnete und verfolgte, lag in dem Angebot, das es den Deutschen auf dieser Grundlage – nämlich beschränkter Souveränität und verlorener Größe – zu machen hatte: den Verlust zu kompensieren und Macht und Souveränität zurückzugewinnen als Teilhaber an einer neuen (west-)europäischen Weltmacht; und zwar – anders, als es nach französischer Ansicht im Verhältnis zur amerikanischen Sieger- und Führungsmacht je der Fall sein konnte – als vergleichsweise gleichberechtigter, aktiver Mitgestalter dieses französischen Projekts. Eben die Beschränkung nationaler Souveränität durch den alles übergreifenden und subsumierenden „Ost-West-Gegensatz“, die es selber als Fessel seiner nationalen Ambitionen erlitt, gedachte Frankreich bei den anderen Betroffenen als günstige Bedingung für ein Gemeinschaftsunternehmen zu französischen Bedingungen auszunutzen.
Auf diesem Angebot aus Paris, vor allem an die bundesdeutsche Adresse, ist „Europa“ aufgebaut worden – erst in zweiter Linie auf dem guten deutschen Europa-Willen: Vom besiegten, kaum verhandlungswürdigen Westdeutschland Adenauers hätte kaum die „deutsch-französische Freundschaft“ ausgehen, geschweige denn europaweite Wirkung entfalten können; umgekehrt war die deutsche Bereitschaft, auf das französische Angebot einzugehen, stets durch die Schranken begründet, die, absehbarerweise unabänderlich, der nationalen Autonomie Deutschlands gesetzt waren. Daß sich im Zuge wachsender Erfolge des europäischen Gemeinschaftswerks die Kräfteverhältnisse verschoben, immerzu die BRD mehr an wirtschaftlicher Macht und praktischer Souveränität als Frankreich an imperialistischer Autonomie gewann, das ließ sich, bis „Maastricht“ eben, vom französischen Standpunkt aus noch im Sinne der eigenen Staatsräson verarbeiten. Die für Paris bittere Ironie der Geschichte liegt in ihrem vorläufigen Endpunkt: Mit ihrer nationalen Vergrößerung und der Wiederherstellung ihrer vollen Souveränität macht die durch Europa groß gewordene BRD das französische Projekt kaputt.
Bilanz der ökonomischen Erfolge aus drei Jahrzehnten EG: Juniorpartner im DM-Block
1. Frankreichs Vorhaben, eine europäische Weltmacht aufzubauen, war verbunden mit der Idee eines vermittelnden „dritten Weges“ zwischen Sowjetkommunismus und US-Kapitalismus. Zieht man davon die Ideologie einer besonderen europäischen Mission in Sachen „Konkurrenz der Systeme“ ab, so bleibt jedenfalls das Programm eines „Staatskapitalismus“ eigener Prägung übrig, das den Erfolg im Ringen mit der kapitalistischen Führungsmacht um ökonomische Gleichrangigkeit von vornherein nicht den Wechselfällen der freien Konkurrenz der Kapitalisten überläßt, sondern in staatlicher Regie herstellen will.
Im Rahmen dieser sog. „économie mixte“ galt die erste staatliche Sorge dem national zweckdienlichen Gebrauch des Geschäftsmittels, in dem sich der kapitalistische Reichtum der Nation darstellt, des nationalen Geldes. Gleich nach dem Krieg wurden die wichtigsten Banken und Versicherungsgesellschaften verstaatlicht, um die Ansammlung von Geldkapital in der von der Regierung für nötig gehaltenen Größenordnung zu gewährleisten und die Kreditvergabe im Sinne der staatlichen Wirtschaftsplanung, der in bis heute fortgeschriebenen 5-Jahres-Plänen niedergelegten „planification“ des französischen Wirtschaftswachstums, zu lenken. Der Auf- und Ausbau der industriellen Ausstattung der Nation wurde gleichfalls durch Staatsunternehmen vorangetrieben. Dabei waren für die Entscheidung, wichtige Unternehmen zu nationalisieren, Gesichtspunkte der staatlichen Souveränität maßgeblich, die der sozialistische Wahlkämpfer Mitterrand 1981 ohne Scheu als Mißtrauenserklärung an die Adresse internationalistisch gesinnter Geschäftsleute ausdrückte:
„Ich halte es für gerecht und notwendig, daß eine gewisse Anzahl von Unternehmen verstaatlicht wird, da sie zu Monopolen geworden sind oder sich auf dem Weg dorthin befinden und da sie für die Nation unverzichtbare Produkte herstellen… Sie sollen keine ökonomische und damit auch politische Macht mehr besitzen, die es ihnen erlaubt, in Entscheidungen von nationalem Interesse einseitig zu ihren Gunsten einzugreifen… Wenn das nicht geschieht, würden diese Unternehmen schnell internationalisiert und ihrer nationalen Bestimmung entzogen.“ (Wahlprogramm 1981).
Die bürgerliche Alternative hat vielleicht nicht dieses Mißtrauen, wohl aber den Standpunkt der nationalen Souveränität in der Wirtschaftspolitik voll geteilt und nichts davon aufs Spiel gesetzt, wenn sie im Wechsel mit den Sozialisten auf Privatisierungen gedrungen hat. Beim französischen Wirtschaftsministerium wurde ein Büro für „Fusion und Neugruppierung von Firmen“ tätig. Kapitalbeteiligungen, Unternehmenszusammenschlüsse und Firmenaufkäufe wurden steuerlich begünstigt und unterstützt. Durch das Gesetz zum „groupement d’intérêt économique“ wurden branchenspezifische Zusammenschlüsse und der Anschluß gleichartiger Betriebe an größere Konzerne gefördert, so daß die effektivsten nationalen Industriezweige heute zum Geschäft von zwei bis drei Monopolen geworden sind. Staatliche Investitionen und Auflagen für eine radikale Rationalisierungspolitik sollten den fusionierten Staatsunternehmen die Möglichkeit verschaffen, das Gewicht ihrer Kapitalgröße dann in Europa auch entscheidend zur Geltung zu bringen.
Denn auf Europa hat die französische Wirtschaftspolitik gerade in ihrem Fanatismus der nationalen Autonomie gesetzt und der Gemeinschaft dementsprechend ihre Interessen aufgeprägt. Mit dem Rückhalt bei seinen Euratom-Partnern ist Frankreich zur Weltmacht in der zivilen Nutzung der Kernenergie aufgestiegen; die Unkosten für die nationale Atomwaffe wurden so lohnend gemacht. In der gleichen Absicht, militärischen Fortschritt mit europäisch dimensionierten Geschäftsgelegenheiten zu verbinden, hat Frankreich zusammen mit seinen Partnern eine europäische Konkurrenz zum amerikanischen Flugzeugbau geschaffen – „Airbus“ und „Concorde“ – sowie ein eigenständiges Raketen- und Raumfahrtprogramm – „Ariane“ – auf die Beine gestellt. Für eine autonome Waffenproduktion war der Nation nichts zu teuer; um so mehr hat sie darauf gesetzt, europäische Konsortien dafür zustandezubringen, und ist gemeinsam mit ihren Partnern zum drittgrößten Waffenexporteur der Welt geworden. Auch sonst hat die nationale Industrie, dank gemeinsamem Markt und europäischem Protektionismus, entweder zugemacht oder kapitalistisches Weltniveau erreicht. Der EG-Agrarmarkt wurde zweckmäßig so konstruiert, daß die französische Landwirtschaft durch die in Brüssel verwalteten Subventionen zur modernen Exportindustrie und zum zweitgrößten Agrarexporteur der Welt aufgestiegen ist. So gibt es mittlerweile keinen Geschäftszweig mehr, den Amerika den Europäern voraus hätte und an dem Frankreich nicht beteiligt wäre. Gegen alle Monopole der USA sind europäische Kapazitäten gesetzt worden, von der Plutoniumproduktion über Luft- und Raumfahrt bis zum großflächigen Weizen- und Ölsaatenanbau und sogar bis zum Bananenhandel. Denn im europäischen Rahmen hat Frankreich nicht einmal auf seine Kolonien verzichtet: Als „AKP-Staaten“ hat es sie in die EG eingebracht und sich darüber eine fortdauernde Oberhoheit vor allem über das frankophone Afrika gesichert, deren Kosten zu einem guten Teil Brüssel trägt.
2. Für seinen Europa-Erfolg hat Frankreich allerdings einiges Wichtige aufgeben, vor allem Abstriche an seiner nationalökonomischen Souveränität hinnehmen müssen, um die es ihm doch immer geht; gerade im Vergleich zu und aufgrund des immerwährenden praktischen Vergleichs mit seinem wichtigsten Partner, für den der Aufbau der Europäischen Gemeinschaft zum bemerkenswert geradlinigen Aufstieg beim Geschäft wie in Sachen nationaler Souveränität geraten ist. Was Frankreich in und mit Europa erreicht hat, ist nämlich zunehmend weniger zu seinen Bedingungen zustande gekommen, immer mehr zu denen, die der deutsche Partner gesetzt hat, und deswegen auch mehr zu dessen Gunsten als zum eigenen nationalen Vorteil. In der Welt der EG-Politik hat sich dieser Kampf um Nutzen und Nachteil der Gemeinschaft wie ein Methodenstreit um den staatsnützlichsten Kapitalismus dargestellt: hier ein Protektionismus französischer Machart, der nach außen auf dem Ausschluß lästiger Konkurrenz, vor allem aus USA und Japan, besteht und nach innen auf erfolgreichen Diensten des Kapitals für die staatliche Macht, wobei auch das Instrument der Verstaatlichung undogmatisch Anwendung findet; da der Standpunkt, daß Kapitalisten dann ihre besten Dienste für die Nation erbringen, wenn sie nur nach ihrem Vorteil handeln, alle Staaten frei nach ihrer Kalkulation beurteilen und sich am besten Standort niederlassen. Tatsächlich bestehen alle Beteiligten mal auf der einen, mal auf der anderen wirtschaftspolitischen Maxime, je nach dem, ob sie sich ihres nationalen Erfolges sicher sind oder Anlaß haben, ihn gesetzlich zu verteidigen; insoweit ist die ganze Kontroverse eine Spiegelfechterei nationaler Ideologien. Ein Zufall ist es aber nicht, daß Frankreich sich von seinem deutschen Partner mehr defensiven Protektionismus vorwerfen lassen muß als umgekehrt. Denn Tatsache ist eben auch, daß sich in der freien Konkurrenz der Unternehmen in Europa und von Europa aus entschieden hat, zum überwiegenden Vorteil welcher Nation so frei konkurriert worden ist. In dieser Konkurrenz der Nationen ist Frankreich zweiter Sieger geblieben.
Dabei mußte es für sich genommen noch gar nicht viel heißen, daß die Geschäftserfolge deutscher Unternehmen eindrucksvoller und in der absoluten Masse bedeutender ausfielen als diejenigen, die auf und von französischem Boden aus erzielt wurden – auch die hatten Wachstumsraten zu verzeichnen, die den Nutzen des großen gemeinsamen Marktes der Europäer für alle beteiligten Kapitalisten widerspiegelten. Für die Konkurrenz der Nationen, die mit der EG ja keineswegs aufgehört hat, hatte es aber Folgen, daß die BRD sich – im wesentlichen auf und dank dem europäischen Markt – die Position des „Exportweltmeisters“ erobern konnte; Folgen, die ausgerechnet infolge der schon erwähnten Anti-Dollar-Initiative Frankreichs bestimmend wurden. Präsident De Gaulle hatte auf die zunehmende „Dollarschwemme“, mit der die USA ihren Vietnamkrieg finanzierten, mit einem politischen Angriff auf die Sonderstellung des Dollar als Weltgeld reagiert, an dem alle anderen Währungen ihr letztes, quasi objektives Maß fanden: Für die Dollarbestände der französischen Nationalbank forderte der General die längst nicht mehr eingelöste, offiziell aber immer noch als letzter „Anker“ festgehaltene Gold-Parität der US-Währung praktisch ein und erzwang damit den amerikanischen „Offenbarungseid“, daß der Dollar eben doch kein „echtes“, „objektives“ Weltgeld ist, sondern bloßes Kreditgeld, wie es andere Souveräne, in Frankreich z.B., geradesogut zu drucken verstehen; nicht durch Gold „gedeckt“ und zur Weltwährung erhoben durch nichts als die – nach französischer Meinung angemaßte – konkurrenzlose Übermacht der USA in der kapitalistischen Welt. Die ökonomische Position des Dollar war durch diesen Vorstoß noch nicht erschüttert; er blieb weltweit benütztes, gefragtes und allein für zuverlässig erachtetes Geschäftsmittel und entscheidende Währungsreserve aller am Weltmarkt beteiligten Nationen. Genau darauf kam es nun aber auch für den Dollar an: daß – und in welchem Maß – er sich als universelles Geschäftsmittel und internationale Reservewährung bewährte. Wenn darüber sein Wert im Vergleich mit anderen Währungen in Frage gestellt wurde und verfiel – was bald geschah –, so traf das zwar zunächst einmal die anderen Staaten, deren nationaler Schatz auf diese Weise zusammenschrumpfte. Eben damit wurde aber das Monopol des Dollar als letzte und grundlegende Sicherheit der Weltwirtschaft der Nachkriegszeit außer Kraft gesetzt. Dem politischen Angriff auf die weltwirtschaftliche Ausnahmestellung des Dollar folgte der ökonomische. Auch der ging vom vergemeinschafteten Europa aus – allerdings nicht von Paris und weder mit dem Franc noch zu dessen Gunsten. Zur Dollar-Alternative wurde – zunächst in der EG und, im Rahmen eines Währungsverbundes, für die Partnerstaaten der Gemeinschaft – die Währung der Exportmacht BRD.
Für Frankreich war auch das mit einem Zugewinn verbunden: Der Wert der nationalen Währung, „befreit“ vom festen Bezug auf den US-Dollar als Maß aller kapitalistischen Dinge, war gleichwohl nicht einfach dem „freien Spiel der Marktkräfte“ ausgeliefert, sondern wurde durch die EG-intern festgelegten und stabilisierten Währungsrelationen und den dahinterstehenden Kredit der gesamten Gemeinschaft einschließlich der BRD gesichert. Der Preis dafür war die Unterordnung unter die deutsche „Leitwährung“; eine Unterordnung in dem prinzipiellen Sinn, daß für die Geschäftswelt das in Frankreich zu verdienende Geld seinen eigentlichen Wert und daher auch sein Wertmaß bloß als nationale Unterabteilung des neuen Weltgeldes aus Frankfurt besaß. Die Herstellung dieser neuen Ordnung in den letzten Fragen des nationalen Reichtums – die eben, wie jede imperialistische Ordnung, Unterordnung bedeutet – ging für Frankreich nicht ohne „Friktionen“ ab: Abwertungen des Franc gegenüber der DM wurden fällig, Anträge auf Aufwertung der Mark von Bonn und Frankfurt abgewiesen; zeitweise setzte eine Kapitalflucht aus dem Franc ein, die mit dem gar nicht mehr EG-konformen, defensiven, also erst recht ökonomische Schwäche offenbarenden Mittel der Kapitalverkehrskontrolle bekämpft werden mußte; Währungskredite aus Deutschland mußten erbeten werden. Mit dem Ablauf der Amtszeiten des zweiten deutsch-französischen Politiker-Pärchens nach De Gaulle und Adenauer, Giscard und Schmidt, war die Rangfolge fertig: Europa buchstabierte sich auch für Frankreich als DM-Block, d.h. als gemeinsamer freier Kapitalmarkt, auf dem die deutsche Währung das konkurrenzlose Maß aller Dinge ist und die anderen Nationen um ein günstiges Verhältnis zu diesem Maßstab kapitalistischen Erfolgs konkurrieren.
3. Für das französische Anliegen, mit Europa mehr wirtschaftspolitische Souveränität zu gewinnen, ist dieses Ergebnis, bei allen Vorteilen für das europäische und auch französische Kapitalwachstum, eine Niederlage. Gerade weil es der Nation darum geht, die ökonomische Basis einer Weltmacht herzustellen, muß sie sich nach Vorgaben richten, die von Paris aus noch nicht einmal mitbeschlossen werden. Der Ärger über soviel nationale Fremdbestimmung macht sich in der immerwährenden Beschwerde über deutsche Diktate in Sachen Geld-, Kredit-, Zins-, Kapital- und sonstiger Wirtschaftspolitik Luft: Die würde viel besser gelingen, wenn die „Rahmendaten“ dafür nicht dauernd in Bonn und Frankfurt festgelegt würden.
Von seinem Weg der Partnerschaft mit der BRD ist Frankreich deswegen aber keineswegs abgegangen. Daß es unter den Bedingungen des europäischen DM-Blocks darauf ankommt, das Land zum attraktiven Standort für Kapitalisten herzurichten und denen vor allem ein solides Geschäftsmittel zu bieten, das haben gerade Frankreichs Sozialisten unter Mitterrand, dem deutsch-französischen Freundschaftspartner Kohls, als positive Herausforderung begriffen und ihr Land entsprechend „modernisiert“. So bestimmt seit der letzten größeren offiziellen Abwertung, also seit 10 Jahren die Politik des „franc fort“ das Leben der Nation.
Diese Politik, verbunden mit dem Programm der „désinflation compétitive“, das die Wettbewerbsbedingungen französischen Kapitals unter der anerkannten Vormacht der DM verbessern sollte, hat alle Maßnahmen durchexerziert, die in einem kapitalistischen Gemeinwesen fällig werden, wenn die Staatsgewalt den Imperativ „Sparen!“ auf die nationale Tagesordnung setzt.[4] Dabei sind wenige französische Besonderheiten zu registrieren; allenfalls die methodische, daß der „Sozialismus in den Farben Frankreichs“ manches von Staats wegen durchsetzt, was in Deutschland Sache der autonomen Tarifpartner ist – überaus flexible Arbeitszeitverhältnisse vor allem sowie, damit verbunden, flexible Formen der Unterbezahlung. Die staatlichen Tarifvorgaben sind inzwischen eine Ansammlung von gesetzlich geregelten Ausnahmen vom Normalfall: Das Recht auf befristete Arbeitsverträge, die Möglichkeit zu Gelegenheitsarbeitsverträgen wie das vor allem beförderte Recht auf Teilzeitarbeit sind die modernen Formen, die geschaffene Arbeitslosigkeit zum Druck auf das Lebensniveau der noch Beschäftigten zu benutzen. Die Pflicht der Betriebe, Entlassungen von staatlichen Behörden genehmigen zu lassen, mit der der französische Staat noch eine etwas altmodische Vorstellung von der Grundlage seiner nationalen Größe pflegte, ist bis zur Unwirksamkeit verwässert. Gar nicht originell ist wiederum, daß das alles unter dem ehrenwerten Titel „Kampf der Arbeitslosigkeit“ abläuft.
So ist für Frankreich die Rechnung auf Europa als erweiterte ökonomische Basis französischer Macht aufgegangen – mit dem Haken, daß die gewachsenen ökonomischen Potenzen sich letztlich gar nicht in dem ökonomischen Machtmittel darstellen, auf das der französische Staat freien Zugriff hat, weil er es selber schafft, nämlich in französischem Geld. In dieser entscheidenden Hinsicht existiert der erweiterte Reichtum der Nation als eine von der Macht der DM abhängige Größe; und daß die DM ohne den Franc auch nicht wäre, was sie ist, nützt nichts, weil es gerade auf den Unterschied ankommt zwischen der Währung, die der Unterordnung anderer ihre Qualität als Weltgeld verdankt, und einer solchen, die durch ihre Unterordnung erst für Kapitalisten akzeptabel wird.
Bilanz der Bemühungen um imperialistische Autonomie: Atommacht ohne Gefolgschaft
Frankreich hat von „Europa“ mehr gewollt als einen gemeinsamen Markt. Es hat auch viel dafür getan, die westeuropäische Gemeinschaft zu einer Militärmacht von höchstem strategischem Rang und zur politischen Ordnungskraft mit weltweitem Einfluß zu machen. Am Ende der Nachkriegszeit, vor „Maastricht“, waren Fortschritte zu registrieren, aber noch nichts von dem angestrebten Erfolg.
1. In den Jahrzehnten der alles dominierenden Feindschaft des Westens gegen den Sowjetblock hat Frankreich sich immer der westlichen Weltkriegsgemeinschaft zugerechnet. Es ist immer Nato-Mitglied geblieben; ein Frontwechsel oder auch nur wirkliche Neutralität kamen auch in den Zeitabschnitten nicht in Betracht, als die wahlarithmetischen Berechnungen der Sozialisten den treu zur Nation stehenden Kommunisten eine Regierungsbeteiligung einbrachten.
Auf dieser Grundlage hat Frankreich es zugleich geschafft, seinen vom westlichen Konsens abweichenden Standpunkt zu behaupten: den Willen zu nationaler Autonomie beim militärischen Aufbau und beim weltpolitischen Ein- und Mitmischen und den Anspruch auf strategische Ebenbürtigkeit mit den „Supermächten“. Dafür ist die 5. Republik auf Distanz zur Militärstruktur der Nato gegangen und hat neben dem Bündnis ihre eigene nationale Atomwaffe einschließlich Raketen aufgebaut. Deren Tauglichkeit als autonom wirkungsvoll einsetzbare Abschreckungswaffe – womöglich noch im Sinne einer „Rundum-Verteidigung“, die ihr Begründer De Gaulle zum Auftrag der „force de frappe“ erklärt hatte – mag zwar eine nationalistische Fiktion gewesen sein: Wenn überhaupt, dann hätten Frankreichs Atomraketen als kleiner zusätzlicher Beitrag zum Atomkrieg der Nato losfliegen können; als Einsatzfall war ja ohnehin nicht an irgendwelche noch unidentifizierte Gegner gedacht, sondern an eine womöglich siegreiche Rote Armee im Anmarsch auf das nationale „Sanktuarium“, den französischen Heimatboden. In ihrem Bezug auf die Nato besaß die französische Atomwaffe aber eine wirkliche Bedeutung; wenn auch weniger eine strategische, so doch um so mehr eine politische: Sie war die fortwährende praktische Manifestation eines offensiven europäischen Mißtrauens in die amerikanische Garantie, im Ernstfall für Europa den strategischen Atomkrieg mit seinem militärisch rohen Schlagabtausch über die Kontinente hinweg zu riskieren, so wie er in den Drehbüchern der Allianz vorgesehen war. Frankreich legte so den wunden Punkt der gesamten Nato-Konstruktion bloß – nach französischer Auffassung sogar noch mehr: ihren unheilbaren Widerspruch; denn in Paris fand man es schlicht unglaubhaft, daß eine Weltmacht ihren Bestand für die Rettung eines anderen Staates ernstlich aufs Spiel setzen würde, und erklärte so den „atomaren Schirm“ der USA für ihre europäischen Partner zum leeren Versprechen. Gleichzeitig repräsentierte die nationale Atomwaffe der Grande Nation die einzig stichhaltige und auch realisierbare Alternative; und wenn das französische Arsenal allein am strategischen Kräfteverhältnis noch gar nichts veränderte, so war das nur ein Beweis mehr, wie unerläßlich eine eigene entsprechend größere Nuklearmacht für die Sicherheit der westeuropäischen Nato-Partner war – gerade wenn deren Bedrohungslage so beschaffen war, wie die „Verteidigungs-Weißbücher“ der Allianz sie definierten.
Außerhalb Europas hat Frankreich gleichfalls neben den Fronten, die die Führungsmacht der westlichen Welt im Ringen mit dem sowjetischen Gegner um strategische Positionsgewinne eröffnete, seine eigene Weltordnungspolitik betrieben; mit direkten militärischen Interventionen wie vor allem durch Waffenlieferungen an Regionalmächte, die sich nicht einfach dem einen oder anderen „Lager“ zurechnen wollten. Die Ex-Kolonialmacht blieb der militärische Aufseher über den Großteil der Staaten Afrikas; die Waffenexportnation verschaffte sich mit ihren Militärberatern, dem interessanten Gerät und den dazugehörigen Diplomaten Einfluß auf weitere neu entstandene Souveräne. Auch da ist es nie dazu gekommen, daß Frankreich mit den sowjetischen Antiimperialisten gemeinsame Sache gemacht hätte; deren Einfluß wurde im Gegenteil relativiert und beschränkt, wenn Pariser Waffenhändler ohne große Rücksicht auf amerikanische Sortierungskriterien den von Moskau umworbenen Machthabern ihre Dienste anboten; insofern leistete Frankreich einen Beitrag dazu, daß die um so viele souveräne Mitglieder angewachsene Völkerfamilie unter der richtigen Kontrolle blieb. Das geschah aber ohne amerikanischen oder Bündnisauftrag, oft genug gegen das vorherrschende gesamtwestliche Interesse, Freund und Feind in der übrigen Staatenwelt härter zu scheiden. Und zumindest hielt Frankreich so die Erinnerung wach, daß die Konkurrenz zwischen den kapitalistischen Großmächten mit ihren weltweiten Interessen nicht bloß um Märkte, sondern ebenso um die Zuständigkeit der nationalen Gewalt ausgetragen wird und daß diese Konkurrenz um imperialistische Eingriffsrechte durch die gemeinsame Weltkriegs-Konfrontation mit dem Sozialistischen Lager nicht beendet, sondern allenfalls unterbrochen war.
2. Ein eigenständiger Selbstbehauptungs- und Weltordnungsanspruch Frankreichs blieb also neben der großen Auseinandersetzung des vereinigten Westens mit seinem abweichenden Hauptfeind immer präsent. Diesen Anspruch aber zu europäisieren, also die EG-Partner dahinter zu formieren und ihn entsprechend machtvoller zu realisieren, das hat die Republik mit all ihrem Einsatz nicht geschafft. Es blieb bei einer bloß nationalen Ausnahmestellung Frankreichs auf der Grundlage und im Rahmen der durch die USA bestimmten westlichen Weltordnung.
Mit ihrem Willen zu einer viel weitergehenden imperialistischen Konkurrenz ist die Führungsmacht der Europäischen Gemeinschaft an dem berechnenden Pro-Amerikanismus des Partners gescheitert, auf den es entscheidend angekommen wäre: Die BRD hat sich – seit den ersten Tagen des EVG-Projekts – noch immer an der Seite der USA den meisten Rückhalt für ihre weltpolitische und militärische Rehabilitation und Karriere ausgerechnet. Selbst den – von Frankreich behaupteten oder aufgedeckten – Konstruktionsfehler der Nato-Atomkriegsplanung, die – von Frankreich entlarvte – Lebenslüge der Allianz, nämlich von der Versicherung durch den amerikanischen Atomschirm, haben die Deutschen konstruktiv als inneres Bündnisproblem genommen: Ihre widersprüchliche Position als Nato-Vorposten, an dessen Unverletzlichkeit sich nichts geringeres als der Übergang zum strategischen Atomkrieg entscheiden sollte, haben sie als politisches Instrument eingesetzt, um sich immer wichtiger zu machen, bis hin zur Option auf eurostrategische Atomwaffen auf deutschem Boden, um immer mehr Mitsprache und Mitentscheidungsrecht über die atomare Einsatzplanung der Nato zu gewinnen – und um so auch für die Sowjetunion zum immer wichtigeren Kontrahenten und Verhandlungspartner zu werden. Statt sich durch Frankreichs Mißtrauensvotum aus dem Nato-Verbund herausführen zu lassen, hat die BRD umgekehrt das von Paris aus geltend gemachte europäische Mißtrauen gegen die USA und ihre Garantien ausgenutzt, um ihren Wert für die USA als einmalig vertrauensvoller europäischer Partner in der Allianz zu steigern.
Für Frankreich war damit die Atomwaffe, mit der es im Kreis der westeuropäischen Mächte konkurrenzlos dastand, politisch so gut wie entwertet. Außerdem war der Weg verbaut, die Deutschen und darüber die EG-Partner in eine antiamerikanische Konkurrenz um die gewaltsame Zurichtung der Staatenwelt hineinzuziehen und so eine wirkliche Konkurrenz auf diesem Feld zu eröffnen. Auch da, besonders in Sachen Rüstungsexport, bekam Frankreich es immer mit einem Partner zu tun, der sich an französisch-europäischen Unternehmungen gern beteiligte, aber immer eindeutig als Eckpfeiler der transatlantischen Gemeinschaft, und der damit deren antiamerikanische Stoßrichtung regelmäßig umbog. Statt mit seinen Sonderbeziehungen zur BRD den Rahmen der Nato zu sprengen, wurde Frankreich dadurch eher eingebunden; und Europa wurde als militärisch aktionsfähiges, weltpolitisch eingreifendes autonomes Subjekt des Geschehens nie in Gang gebracht.
„Maastricht“ und die Folgen: Wendepunkt und Krise des französischen Europa-Projekts
Das Vertragswerk von Maastricht und die Verhandlungen, die dahin geführt haben, lassen einen französischen Plan erkennen, das Europa-Projekt über die widersprüchliche Zwischenbilanz hinaus zum beabsichtigten Erfolg zu führen. Der Plan ist gescheitert – Frankreichs Europapolitik geht weiter.
I. Vom Beschluß über die Wirtschafts- und Währungs-Unionin die Wirtschafts- und Währungs-Krise
1. Mit der Wirtschafts- und Währungsunion und dem Zeitplan, nach dem sie – im Zweifelsfall „automatisch“ – eintreten soll, wurde aus französischer Sicht der Plan festgeschrieben, die von Deutschland bestimmte, in DM bilanzierende Wirtschaftsmacht Europas definitiv zu europäisieren, nämlich zur einheitlichen, gemeinschaftlich betreuten und ausgenutzten Grundlage der vereinigten Staatsmächte zu machen. Aufgeschrieben und festgelegt war damit auch, was Frankreich für dieses Ziel sich zumuten wollte, also auch zutraute: ökonomisch zu den Bedingungen mitzuhalten, die der deutsche Erfolg vorgab und die in den berüchtigten „Kriterien“, nach denen sich die EG-Partner für ihre Währungsunion qualifizieren sollen, so wunderbar begriffslos und zugleich zweckmäßig für das Ziel einer Selektion der Starken und Schwachen niedergelegt sind. Frankreich hätte es nicht einmal nötig gehabt zu betonen, daß es diese Eignungskriterien selbstverständlich erfüllte; denn daß eine europäische Währungsunion ohne Frankreich, politisch gesehen, völlig nichtig, weil nichtsnutzig wäre, versteht sich nicht nur für Frankreich von selbst, sondern vom Grund und Zweck des gesamten europäischen Unternehmens her; deswegen waren die Kriterien gleich so definiert, daß Frankreich zu den maßstabsetzenden Teilnehmern gehörte und von vornherein nicht zum Club derer mit der „langsameren Geschwindigkeit“. Zu allem Überfluß hat man in Paris aber gern hervorgehoben, daß, wie die Dinge nach der deutschen Einigung liegen, Frankreich den beschlossenen Anforderungen an die nationalökonomische Solidität der Währungspartner besser genügt als Deutschland selbst, dessen „harte Mark“ durch „Maastricht“ zum gemeinsamen europäischen Besitz werden sollte. Diese Betonung war bereits doppeldeutig genug; immerhin machte sie den Standpunkt deutlich, daß die Herbeiführung der europäischen Union auf dem Feld von Währung und Wirtschaftspolitik zwar eine Kraftanstrengung der Nation erfordert, aber eine aussichtsreiche und daher lohnende.
Schon die Agitation für das Ja der Nation beim
Maastricht-Referendum hat dann gezeigt, daß die
Befürworter des Vertrags diesen Standpunkt
selber nicht mehr vertraten. Ihr Bekenntnis zu Europa
fiel denkbar negativ aus; es operierte mit dem gleichen
Argument wie die Ablehnungsfront: Aus Furcht vor
Deutschland sollte die Nation sich zur Union mit dem
großen Nachbarn im Osten entschließen; nämlich um den
„einzubinden“ und so eine Abhängigkeit, der Frankreich
sowieso ausgeliefert sei, politisch halbwegs in den Griff
zu kriegen.[5]
Faut-il avoir peur de l’Allemagne?
hieß die
entscheidende Referendumsfrage. Offiziell wurde sie
entschieden verneint; in welchem Sinn, das hat der neue
Ministerpräsident recht gelungen ausgedrückt, als er aus
gegebenem Anlaß die Zuverlässigkeit Deutschlands betonte,
indem er Kohl mit Bismarck verglich, also dem großen
Deutschen, der neben Hitler für die schlimmste Niederlage
Frankreichs verantwortlich ist:
„Noch bevor fünf Jahre vorbei sind, wird das vereinigte Deutschland wohlhabend sein, dynamisch und ausgeglichen, die erste Wirtschafts-, Finanz- und Militärmacht des Kontinents. Von Deutschland wird es im wesentlichen abhängen, wie die Architektur Europas aussehen wird, wie die Beziehungen Europas mit den Russen, den Amerikanern und den Japanern gestaltet werden. Kohl ist zu scharfsinnig, als daß er nicht wüßte, daß die Zeit des Auftrumpfens noch nicht gekommen ist… Wer hat seit Bismarck mehr für Deutschland geleistet?“ (G. Balladur, FAZ 31.3.93)
Für die Nöte ihrer Nation haben auch französische Stimmbürger allemal ein offenes Ohr und sind für eine Politik zu haben, die sie wenden will. Wenn aber die Not nationaler Abhängigkeit beschworen wird, nur um die Nation noch enger an die unheimliche Macht zu binden, die ihr ihre Nöte bereitet, dann sind auch mündige Franzosen leicht ein wenig überfordert. Denn dann läuft die Werbung für Europa im Grunde auf das Eingeständnis der Regierenden hinaus, mit ihrer bisherigen Europa-Politik die Nation in ihre Zwangslage gebracht zu haben und nun nicht mehr weiter zu wissen. Und das wiederum ist gleichbedeutend mit dem Bekenntnis, daß aus Europa nie und nimmer das wird, was Frankreich sich damit eigentlich vorgenommen hatte. Für das Programm, mit Deutschland und den andern in Europa zur „Dritten Kraft“ auf dem Globus zu werden, wirbt man nicht mit dem Eingeständnis, ohne europäische Einbindung des Nachbarn zu ohnmächtiger Abhängigkeit verurteilt zu sein. Wer so argumentiert, der gibt zu, daß die Nation bereits ziemlich ohnmächtig abhängig ist; der gibt also bekannt, daß die Geschäftsgrundlage des bisherigen Europa-Politik entfallen, ein Europa im Sinne und Interesse Frankreichs nicht mehr zu haben ist.
2. Was sich geändert hat, so daß das nationale Großprojekt Europa mit einem Mal in einem dermaßen negativen Licht stand, ist für Franzosen kein Geheimnis – die ökonomische Bilanz jedenfalls nicht; die sollte ja gerade durch den gemeinsamen Aufbruch und für die Währungsunion in Ordnung gebracht und endgültig gesichert werden. Geändert, und zwar fundamental, hat sich die französische Sicht des Partners, mit dem zusammen ein für Paris verlockendes Europa entstehen sollte, das spricht die zitierte „Maastricht“-Werbung unumwunden aus; und sie hat sich schlicht deswegen gewandelt, weil der Partner selber nicht mehr der alte ist und jedes hoffnungsvolle Bild widerlegt, das seine französischen Freunde sich von ihm gemacht haben.
Der Präsident aller Franzosen hatte schon gewußt, warum er, international allein und auf verlorenem Posten, gegen die „Wiedervereinigung Deutschlands“ angekämpft hatte: Es war aus klassischer deutsch-französischer Freundschaft geschehen. Das Deutschland nämlich, dem der sowjetische Gegner gratis seine jahrzehntelang zur Utopie degradierten revanchistischen Wünsche erfüllte, das von den Siegermächten hochoffiziell ohne jede Gegenleistung seine volle Souveränität zurückbekam und das im Osten keine Schranke mehr vorfand, sondern lauter dringliche Anträge auf Betreuung, das war von eben diesem Moment an kein Partner mehr, mit dem zusammen Frankreich eine gemeinsame Zukunft als neue Weltmacht planen konnte. Nicht etwa deswegen, weil die vergrößerte Bundesrepublik ökonomisch noch übermächtiger wäre als die alte; gerade in Paris registrierte man im Gegenteil, aber ohne Genugtuung, daß die Bilanzen des neuen Deutschland gar nicht mehr so tief im Plus sind wie vor der Angliederung der DDR. Der Grund dafür ist nämlich eine neue Einstellung der Bonner Regierung zu den Bilanzen, deren positive Gestaltung zuvor praktizierte Staatsräson der westdeutschen Republik gewesen war, viel mehr jedenfalls als ihr ostwärts gewandter nationaler Revisionismus. Daß die BRD jetzt aus nationalen Gründen ganz unökonomisch, geradezu – gemessen an ihrer bisherigen Politik – leichtfertig mit ihrem höchsten Gut, der stabilen DM, umgeht, hat in Frankreich erst recht Eindruck gemacht. Dort konnte man am allerwenigsten den nationalen Fundamentalismus übersehen, der da auf der anderen Rheinseite am Werk ist und der für seine Anliegen erstmals alle weltwirtschaftlichen Rücksichten so entschieden hintanstellt und Einwände vom Standpunkt der „harten Währung“ so politisch zielstrebig in die Schranken weist, wie man es in Paris für das Projekt der dritten Weltmacht Europa schon immer für angebracht gehalten hatte, gegen die Deutschen aber nie hatte durchsetzen können. Daß ein deutscher Kanzler für sein nationales Vergrößerungsprogramm gegen die nationale Ökonomie und unter Strapazierung ihrer „Gesundheit“ politische Prioritäten setzt, wie er und seine Vorgänger es sich für Europa immer verbeten hatten, wo umgekehrt immer der ökonomische Vorteil erstes und einziges politisches Ziel gewesen war, das begriff man in Frankreich so nach und nach als Katastrophe, als Umsturz der Grundlagen und festen Voraussetzungen der eigenen Europapolitik, auch wenn Freund Kohl von einer Kündigung des gemeinsamen Vorhabens nichts wissen wollte, im Gegenteil seinerseits auf unumkehrbare Fortschritte zur Wirtschafts- und Währungsunion drängte. Der unverdrossene deutsche Wille, Europa „fertigzustellen“, erschien viel eher als unheimlich, seit die Macht, die dahintersteht, mit ihrem Zugriff auf die DDR bewiesen hat, wie sehr ihre Priorität beim nationalen Souveränitätsgewinn liegt und was sie unter einer gelungenen Währungsunion versteht und wie sie so etwas handhabt. Deutschlands europäischer Supranationalismus, auf dessen Attraktivität für eine ansonsten zu bleibender Ohnmacht verurteilte Bundesrepublik Frankreich immer gerechnet hatte, erwies sich jedenfalls als eine von Paris aus weder zu steuernde noch auszunutzende nationale Anspruchshaltung, die bisher angestellte Kalkulation damit als französische Lebenslüge. Die Inflation Bonner Dementis, man wolle selbstverständlich kein „deutsches Europa“, konnte die Franzosen überhaupt nicht beruhigen: Auf soviel Dialektik versteht sich der gallische Verstand allemal, daß er aus dem Dementi und den lächerlichen Beteuerungen deutscher Instanzen, man wünsche nichts dringlicher als die eigene gesamteuropäische Einbindung, den deutschen Willen heraushörte, die Hierarchie der europäischen Mächte und ihre Kompetenzen gründlich zur Diskussion zu stellen und durchgreifend zu „klären“, und die damit angesagte politische Zurückstufung der eigenen Nation bemerkte.
3. Nun hat selbst die schlechte, defensive, widersprüchliche „Maastricht“-Werbung dem französischen Wahlvolk noch soviel Eindruck gemacht, daß die Nation gerade noch haarscharf dafür war; doch gibt es in der kapitalistischen Welt unbestechlichere Instanzen. Die meldeten sich, nach dem kaum geglückten Referendum, in Gestalt der europäischen Währungskrise zu Wort. Mit ihrem „Angriff“ auf Lira, Pfund und Peseta stellten die Geld- und Devisenhändler die Zuverlässigkeit der im EWS gültig gewesenen Garantien gegen den Wertverfall nationaler EG-Währungen „nach Maastricht“ auf die Probe; und es kam heraus, daß nicht die optimistische Bekräftigung der bestehenden Paritäten im Maastrichter Vertrag das letzte Wort ist, sondern die Lesart, die den Kriterien für den Beitritt zur geplanten Währungsunion eine Kündigung des bislang gültigen Verbundsystems und die Eröffnung eines Entwertungsverfahrens gegen gewisse nationale Kreditgelder entnimmt.[6] Daß dann auch der Franc „unter Druck“ kam, mag durch die französischen Bilanzen – als beinahe einzige „Maastricht“-gemäß, wie immer wieder betont wurde, um die Spekulation zu „entmutigen“ – noch so wenig begründet gewesen sein: Europapolitisch war es nur konsequent. Spekuliert wurde da nämlich auf die Brüchigkeit der deutsch-französischen Konnexion, auf die Angreifbarkeit des Herzstücks aller Europa-Pläne und insofern auf die Fragwürdigkeit des Europa-Projekts überhaupt, die sich spätestens im Übergang zur Europäisierung der nationalen Währungen herausstellen müsse.
Der Offenbarungseid über das deutsch-französische Gemeinschaftswerk wurde zunächst abgewehrt – denn das wäre die Preisgabe des Franc-DM-Verhältnisses tatsächlich gewesen: das Eingeständnis, daß die beiden Führungsstaaten der EG im Ziel der Währungsunion nicht mehr einig sind, Frankreich auf die Europa-Treue seines deutschen Partners und dessen unbedingten, nicht bloß ökonomisch berechnenden Beistand nicht mehr zählen kann. Aufgehört hat die Spekulation gegen diese Einigkeit und den gemeinsamen Willen zur Währungsunion damit aber nicht. Die freundlichen Interventionen der Bundesbank sind, was die Zukunft des französischen Europa-Projekts nach dem Wegfall seiner politischen Voraussetzungen betrifft, auch nicht viel überzeugender als die paar tausend Franzosen, die das Maastricht-Referendum positiv entschieden haben.
4. Die neue rechte Regierung, stolz auf die von den Sozialisten geerbten Bilanzen und beflügelt von der satten Vier-Fünftel-Mehrheit, die der kritische Wähler ihr beschert hatte, hat das versuchsweise anders gesehen. Mit öffentlich entsprechend interpretierten Zinssenkungen auf Franc-Anleihen hat sie die Probe aufs Exempel gewagt, ob ihr gutes Geld mit seiner geringen Teuerungsrate nicht mittlerweile genauso begehrt wäre wie die durch exzessive Staatsschulden inflationär vermehrte, aus französischer Sicht nur durch übertrieben hohe Zinsen stark gehaltene D-Mark.
Die Spekulation des Juli 93 gegen den Franc hat die Verhältnisse freilich innerhalb weniger Wochen wieder zurechtgerückt und am Ende den Offenbarungseid über die Haltbarkeit des deutsch-französischen Währungsverbunds erzwungen, der bis dahin mehrfach einvernehmlich zurückgewiesen worden war. Neben dem Ergebnis ist dabei die Kontroverse über die passende Inszenierung des Bruchs zwischen Frankreich und der BRD in der Währungsfrage aufschlußreich. Nach dem Plan der Pariser Regierung sollte Deutschland mit seiner „künstlich hochgehaltenen“ DM das EWS – natürlich nur zeitweilig – verlassen und damit öffentlich und politisch werbewirksam eingestehen, daß in der Tat seine Verschuldungs- und Zinspolitik eine ungerechtfertigte und nicht länger zumutbare Belastung seiner EG-Partner geworden sei – so ungefähr im Sinne des eleganten französischen Formulierungsvorschlags:
„Die Wiedervereinigung hat Deutschland zu Entscheidungen geführt, die in ihren Konsequenzen nicht unbedingt und in jedem Augenblick mit allen Interessen aller seiner Partner vereinbar sind.“ (Premier Balladur lt. SZ, 4.8.93)
Auf diese Weise sollte die Bundesregierung die im EWS zurückbleibenden Staaten mit ihrem jeweiligen Kreditgebaren im Hinblick auf „Maastricht“ und die da beschlossenen Stabilitätskriterien ins Recht setzen und die Rückkehr zu festen Wechselkursen mit der DM als ihre wirtschaftspolitische Pflicht anerkennen. Gegenüber einem vom Franc geführten europäischen Währungsverbund hätte sich die BRD gewissermaßen ins Abseits gestellt; nach zweckmäßigen Korrekturen an ihrer Schulden- und Geldpolitik hätte sie den Wiederanschluß an das einstweilen französisch geführte EWS gesucht.
Das war denn doch zu schön, um wahr zu werden. Stattdessen wurde nach deutschem Plan ein „harter Kern“ des EWS, der Währungsverbund von DM und holländischem Gulden, von den übrigen „weichen“ Währungen geschieden, die seither um 15 % von ihrem „Mittelkurs“ abweichen dürfen, bevor die Stützungsverpflichtungen des EWS in Kraft treten. Bei allen Beschönigungen: Die für das alte System konstitutive Zusage der währungsstärkeren Länder, schwächere Euro-Währungen in einem festen Verhältnis zum eigenen Geld und dadurch stabil zu halten, ist damit gekündigt; die im EWS gemeinschaftlich wahrgenommene Sorge um den Wert der EG-Währungen ist voll an die einzelnen Nationen zurückgegeben; um den Wert der nationalen Währungen wird auch in Europa ohne Wenn und Aber konkurriert. Dazu hat der deutsche Finanzminister in seiner bekannt zurückhaltenden Art noch die Klarstellung verabreicht, das Entscheidende am EWS wären ohnehin nie die Interventionspflichten der Nationalbanken im Fall größerer Kursschwankungen gewesen, sondern die Verpflichtung der Mitgliedsländer, eine zunehmend einheitliche und im Ergebnis übereinstimmende Wirtschaftspolitik zu betreiben, die Währungsschwankungen gar nicht erst zuließe – eine Erläuterung, die das Ideal von „Maastricht“ beschreibt, aber weder Absicht noch erst recht die Leistung des alten, mit „Maastricht“ freilich in Frage gestellten EWS wiedergibt; da ging es nämlich durchaus eben um eine europagemeinschaftliche Stabilitätsgarantie für alle Gelder, die sich auf dem Binnenmarkt verdienen lassen sollten, und diese Garantie sollte die bestimmende Vorgabe und verläßliche Grundlage für die nationalen Wirtschaftspolitiken sein.
Nach Lage der Dinge war die regierungsamtliche deutsche Belehrung zudem ein Hohn auf die jahrzehntelange und – aus französischer Sicht – durchaus erfolgreiche Anstrengung der Grande Nation, den deutschen Exportweltmeister in Sachen solider, d.h. am Geldwert als höchstem Kriterium orientierter Wirtschaftspolitik einzuholen und zu überholen. Und zutiefst ungerechtfertigt noch dazu: Ohne bessere „Basisdaten“ als Frankreich, gestützt allein auf die fragwürdigen Ergebnisse einer verwerflichen internationalen Spekulation – so der nationalbewußte Standpunkt links des Rheins –, erteilte die deutsche Regierung ihren Pariser Kollegen den Bescheid, daß von einer hinreichend gleichartigen Wirtschaftspolitik und erst recht von gleichrangigen Ergebnissen der französischen Nationalökonomie noch lange nicht die Rede sein könne. Völlig zu Recht sah man in Frankreich damit jede Solidarität der Deutschen im Hinblick auf eine gemeinsame europäische Zukunft aufgekündigt; ersetzt durch den Willen zu einer Konkurrenz, die jede Nation allein bestehen muß, und zwar explizit gegen die übermächtige DM-Nation; ohne die sichere Aussicht, dann wenigstens im Erfolgsfall die projektierte Wirtschafts- und Währungsunion mit Deutschland zu bekommen, von der man sich Entlastung vom Druck der internationalen Konkurrenz versprechen könnte.
5. Gegen diese Zumutung, von den Deutschen eine Art Kündigung der bisherigen Sonderbeziehungen miteinander hinnehmen zu müssen, hat die französische Seite im Nachhinein theoretisch an die Alternative aus dem Geist der europäischen Einigung erinnert, die es theoretisch ja durchaus auch gegeben hätte: der Währungsspekulation und -krise mit der schlagartigen Vorwegnahme der für 97 ohnehin vorgesehenen Währungsunion zu begegnen. Unterstrichen hat sie damit freilich bloß, wie einseitig ihr Interesse an einer im hergebrachten, französischen Sinn europäischen Betrachtung und „Lösung“ ihrer währungspolitischen Zwangslage war und wie – zumindest im Ergebnis – antifranzösisch die Konzeption, der sie sich fügen mußte.[7]
Praktisch hat die französische Regierung eine Maßnahme ergriffen, mit der sie zum politischen Kern der Sache vorstößt: Sie hat den sog. „Blair-House-Kompromiß“ gekündigt, in dem die EG-Staaten einer Vermittlungslösung im GATT-Streit mit den USA um die Kontingente subventionierter Getreideexporte zugestimmt hatten. Für seinen Rückzug von der gefundenen Kompromißformel hat Frankreich gute ökonomische Gründe: Gerade wenn es im Sinne der Ermahnungen des deutschen Finanzministers darauf ankommt, daß jede EG-Nation ihre Währung im Vergleich zu der der Partner kräftigt, dann kann das Land auf keine Exportchance verzichten; und wenn deswegen andere GATT-Vereinbarungen hinfällig werden und andere EG-Staaten, Deutschland z.B., dadurch Schaden erleiden, so gehört das ja wohl zu den rauhen Sitten der Konkurrenz, die nun doch offenbar in Europa gelten sollen. Dieser zweite Gesichtspunkt ist für die französische Regierung aber wohl mehr schon einer der politischen Erpressung, mit der sie ihren Bonner Kontrahenten beikommen will. Die sollen begreifen, daß sie Frankreich nicht alles zumuten können; daß sie dabei sind, mit ihrer pur von der eigenen nationalen Interessenlage her konzipierten Währungs- und Welthandelspolitik die EG auf Dinge festzulegen, die für Frankreich als – zumindest die eine unentbehrliche – Hauptmacht dieser Gemeinschaft nicht mehr erträglich sind und nicht mehr hingenommen werden. Dabei weiß man in Paris sehr gut, warum und wofür es den Deutschen so sehr auf den GATT-Kompromiß ankommt: Für die steht das Einvernehmen mit den USA auf dem Spiel, das sie für ihre Bewegungsfreiheit als „Exportweltmeister“ genauso unbedingt brauchen wie die EG. Genau das macht aus Sicht der Franzosen den Charme ihres Erpressungsversuchs aus: An einem welthandelspolitischen Unterpunkt zwingen sie Deutschland die allergrundsätzlichste, für das gesamte EG-Projekt konstitutive Entscheidungsfrage auf – Europa mit Frankreich oder USA.
Die Sache ist übrigens heillos, egal wie sie entschieden wird und auch wenn Frankreich sich von seiner ultimativen Anfrage an Deutschlands Europa-Treue wieder zurückziehen sollte. Schon bevor Frankreich mit dem GATT-Streit deutlich macht, daß es ein europa nach den neuen deutschen Maßstäben nicht aushält, hat Deutschland den Standpunkt eingenommen, daß es ein Europa nach den alten französischen Gesichtspunkten nicht mehr verträgt. Deswegen ist der französische Erpressungsversuch schon mehr als zweischneidig: Er stellt die Deutschen vor eine Alternative mit dem Ziel, sie von der Entscheidung abzubringen, die sie im Grunde schon getroffen haben. So beschleunigt die französische Regierung am Ende bloß, was sie vermeiden will.
II. Der Kampf um einen französisch-europäischen Ordnungsstandpunkt und Militarismus in einer Welt ohne „Ost-West-Konflikt“
1.Der Maastrichter Vertrag enthält auch eine Grußadresse, die die Vertragspartner an – im wesentlichen – sich selbst in ihrer Eigenschaft als Mitglieder der Westeuropäischen Union (WEU) richten, jenes Verteidigungsbündnisses der europäischen Nato-Partner, in das die BRD mit ihrer Aufnahme in die Nato eingegliedert worden war, um unbefriedigten französischen Kontrollansprüchen entgegenzukommen, das seither aber neben der Nato überhaupt keine Rolle gespielt hat, vor allem deshalb nicht, weil es nach deutschem und amerikanischem Willen keine Eigenständigkeit entfalten sollte. Auf dieses offizielle Bekenntnis der EG zur WEU als „ihrem“ Militärbündnis hatte Frankreich gedrungen, um die Entwicklung einer autonomen „Sicherheitsidentität“ der Europäer und den Aufbau einer gemeinschaftlichen EG-Streitmacht in Konkurrenz zur Nato einzuleiten. Die Chance dazu schien gegeben, nachdem mit dem Ende der Sowjetmacht der Grund für die feste Verklammerung der deutschen Militärmacht und Sicherheitspolitik mit dem amerikanischen Interesse an Europa entfallen war, die Paris nie hatte aufbrechen können. Daß Europas nationale Interessen sich nicht mehr dem „Ost-West-Gegensatz“ unterordnen müssen, die Optionen der EG-Partner also auch nicht mehr der Strategie ihrer Führungsmacht subsumiert sind, diese neue „Lage“ hielt Frankreich für eine neue Freiheit der westeuropäischen Nationen, die für Europas Emanzipation von den USA zu nutzen wäre. Für dieses Ziel wurde in den Verhandlungen über das Vertragswerk den Deutschen – und Engländern – die einstweilige Klarstellung zugestanden, daß die Wiederbelebung der WEU nicht in Widerspruch zu den Nato-Interessen der Beteiligten stände: Das Bekenntnis der EG zur WEU war für Frankreich ein kleiner Sieg über den deutschen Pro-Amerikanismus, für den Standpunkt europäischer Autonomie, den in den Zeiten der Weltkriegskonfrontation allein Frankreich als unerläßliche Perspektive für freie Europäer hochgehalten hatte.
2. Zu einem durchschlagenden Erfolg ist der französische Vorstoß dann allerdings nicht geraten. Statt jetzt endlich mit Paris gemeinsame Sache zu machen, wo das doch möglich und erlaubt ist, ließen die Deutschen Frankreich spüren, daß sie den Übergang zum projektierten Europa mit gemeinsamem Militär und imperialistischer Ordnungskompetenz nun, wo der Druck der Gegnerschaft gegen den Osten von ihnen genommen ist, endgültig nur zu ihren Bedingungen oder überhaupt nicht machen. Klargestellt haben sie das an dem ersten Fall einer gemeinschaftlichen Ordnungspolitik der Europäer, der von allen Beteiligten als exemplarisch angesehen wurde: am „Fall“ Jugoslawien. Frankreich und seine Partner haben es hier erstmals nicht bloß mit dem berechnenden Pro-Amerikanismus der Deutschen zu tun bekommen, sondern mit deren Standpunkt der voll wiederhergestellten nationalen Souveränität und Ordnungskompetenz, der sich zwar auch der alten Subsumtion unter die Politik der USA entzieht, mindestens ebensosehr aber einer maßgeblich von Paris definierten europäischen Ordnungspolitik und „Sicherheitsidentität“ widersetzt. Frankreich sah sich mit einer entschiedenen deutschen Parteinahme für den Separatismus der slowenischen und kroatischen Teilrepubliken Jugoslawiens konfrontiert; es fand sich herausgefordert, die eigenen diplomatischen und auch militärischen Potenzen als europäische Ordnungsmacht bestimmend ins Spiel zu bringen; es bestand mit seinen Partnern darauf, daß die Überwachung des Kriegsgeschehens im Griff der EG-Mächte blieb. Und es mußte zur Kenntnis nehmen, daß Deutschland für eine französische Ordnungspolitik gar keinen zuverlässigen Rückhalt bietet. Zwar spielt es sich – noch – nicht als Militärmacht in Europa auf, läßt sich aber erst recht nicht als „partner in leadership“ funktionalisieren. Im Beschwerdeton, der alles andere als „Aufbruchstimmung“ erkennen läßt, hat Präsident Mitterrand seinen Landsleuten in seiner Neujahrsansprache 93 diesen Befund über die westlichen Partner mitgeteilt:
„Ich denke, daß Frankreich überall tätig werden muß, wo es schwere Angriffe auf die Menschenrechte gibt, denn wir sind besonders dazu berufen. Frankreich ist dabei an vielen Stellen der Welt vertreten, denn wir sind in der Welt diejenigen, die zuallererst unsere Soldaten opfern – weit vor allen anderen, selbst den größeren und mächtigeren Staaten; ich denke dabei vor allem an die USA… Aber man kann nicht immer nur Ermahnungen entgegennehmen und die Empfehlung: ‚Geht ihr dorthin!‘, die mit soviel Emphase und Dringlichkeit von denen geäußert werden, die nicht hingehen. Deutschland beharrt auf seiner Verfassung, die ihm das verbietet. England hat keine solche Verfassung und kümmert sich dennoch um nichts. Für die anderen gilt dasselbe. Die Vereinigten Staaten wollen (in Jugoslawien) nur in der Luft, nicht auf dem Boden eingreifen. Schlägt man so Aggressoren zurück? Und soll es immer nur Frankreich treffen, vielleicht noch verbündet mit einigen Indern und Afghanen, die Schäden der Weltordnung zu heilen?“ (Le Monde 7.1.93)
3. Gemeinsam mit seiner neuen rechts-konservativen Regierung hat es der alte sozialistische Präsident inzwischen immerhin geschafft, auf dem Balkan den innereuropäischen Konkurrenzvorteil politisch nutzbar zu machen, den sein Land in Sachen militärischer Gewalt – noch – besitzt. Im bosnischen Krieg hat Frankreich sich als Ordnungsmacht mit UNO-Lizenz massiv genug vor Ort etabliert, um mit seinen Offizieren ein gutes Stück weit die Lage zu definieren, auf die sich die offizielle EG-Diplomatie mit ihren „Lösungsvorschlägen“ dann bezieht.[8] Dadurch hat es die Deutschen mit ihrer Politik des Aufmischens ohne wesentliche militärische Einmischung erst einmal weitgehend ausmanövriert und mißt sich mit den USA, die ihre heuchlerische Ermunterung an die Europäer, im eigenen Bereich für Ordnung zu sorgen, immer wieder mit dem deutlichen Vorbehalt versehen, daß eine „Lösung“ ohne amerikanische Bomben unmöglich gerecht, geschweige denn haltbar sein kann. Dagegen setzt Frankreich keineswegs den Standpunkt des Gewaltverzichts, sondern liefert den Amerikanern einen Streit um die Frage, wer ein von beiden Seiten befürwortetes gewaltsames Eingreifen aus der Luft letztlich in Gang zu setzen hat: Nicht die Supermacht in Washington soll das Einsatzkommando geben dürfen; es sollen, mit allem Respekt vor der Entscheidungskompetenz der UNO, die französisch-belgischen Befehlshaber vor Ort sein, die den Bombenhagel in dem von ihnen bestimmten Bedarfsfall abrufen. Was da wie eine militärtaktische Kontroverse inszeniert wird, ist seiner politischen Substanz nach die aktuelle Auseinandersetzung um die imperialistisch alles entscheidende Frage, welche Nation beim Ordnungsstiften und Friedenschaffen das letzte Wort hat.
Dieser Streit hat dadurch noch beträchtlich an politischer Bedeutung gewonnen, daß Frankreich ihn in der Nato führt. Mitterrand hat nicht die Entscheidung gesucht, ob sich die WEU oder womöglich sein Land allein von der UNO zum Eingreifen ermächtigen läßt oder die große Allianz. Ohne große Umstände hat Frankreich seine Truppen dem Nato-Kommando unterstellt und ist gleichzeitig in die zuständigen Entscheidungsgremien des Bündnisses zurückgekehrt, in denen es jahrzehntelang nur mit Beobachtern vertreten war. Dort trägt es seine Kontroverse mit Amerika um die Befehlsgewalt beim gemeinsamen Bombardieren aus und probiert darüber nichts geringeres als eine gründliche Neudefinition des Paktes, den die Partner ja auch nach der Selbsterledigung ihres großen Feindes (einstweilen) um (fast) keinen Preis auflösen wollen. Demnach hätte Frankreich in der neuen Allianz als militärisch gleichberechtigter und politisch gleichrangiger – in gewissen Angelegenheiten wie auf dem Balkan sogar federführender – Partner der USA zu gelten, der mit dem nötigen Kraftaufwand gemeinsame Anliegen erledigt. Die bisherige Ausrichtung der Nato auf das amerikanisch-deutsche Sonderverhältnis wäre außer Kraft gesetzt; die Herstellung und Durchsetzung einer „europäischen Sicherheitsidentität“, also im Klartext einer militärischen Interessengemeinschaft der EG-Staaten gegen(über) Amerika, wäre praktisch wirksam in die Wege geleitet; die Nato würde zum Forum, auf dem ein die EG repräsentierendes Frankreich mit den USA gemeinsam anzupackende Kriegsaufgaben aushandelt. Die Amerikaner werden am Fall Jugoslawien praktisch vor die Entscheidung gestellt, ob sie ihren Kampf darum, auch in einem so erneuerten Bündnis die Führung zu behalten, bis zu dem Punkt führen wollen, daß am Ende womöglich alliierte Bomber die UNO-Mandatstruppen der Verbündeten gefährden, oder ob sie tatsächlich dem französischen Präsidenten die Entscheidungsgewalt über Einsatz oder Nicht-Einsatz des Nato-Knüppels überlassen sollen.
Natürlich enthält auch diese Politik keine Garantie, daß die EG-Partner und unter ihnen derjenige, auf den für Frankreich letztlich alles ankommt, die BRD, sich von Frankreich militärisch und bündnispolitisch repräsentieren, also auch führen lassen. Zumindest stellt die Grande Nation aber, wieder einmal und passend für die neue Zeit, klar, für welches Ziel sie ihre Nachbarn eigentlich als Partner einer europäischen Union zu gewinnen sucht, wie sehr es für dieses Ziel umgekehrt auf Frankreich ankommt – also an wen alle Europäer sich zu halten haben, wenn sie den Willen zur Emanzipation des kapitalistischen Europa von der kapitalistischen Weltmacht ernst nehmen. Der Haken ist nur: Gerade wo Frankreich, mangels Hauptfeind im Osten, die Chance dafür gekommen sieht, ist es dafür auch schon zu spät. Die Deutschen wissen nämlich seit neuestem eine Alternative: sich selber.
Zwischenfazit: Die Wahrheit über eine Freundschaft unter Imperialisten
Nach 40 Jahren Einsatz für eine Großmacht Europa nach französischem Bild wird für Frankreich alles unsicher. Das Erreichte, der funktionierende EG-Zusammenhang – für Frankreichs Ambitionen nie genug, aber ein nützliches Ergebnis und eine sichere Basis seines weitergehenden Programms –, hat seine Verläßlichkeit eingebüßt. Das Projekt, den Durchbruch zur wirtschaftlich und politisch geeinten europäischen Weltmacht zu schaffen, ist, kaum vereinbart, schon als gekündigt anzusehen. Europa in der Gestalt, die es nach den Vorgaben Deutschlands tatsächlich anzunehmen droht, ist für Frankreich unbrauchbar, am Ende gar nicht auszuhalten; wo es noch im Sinne Frankreichs funktioniert, steht Deutschland abseits oder arbeitet dagegen an. Ein deutsches Europa will Frankreich nicht; ein Europa ohne Deutschland will es auch nicht – und macht bereits die Erfahrung, daß der Freund in Bonn so etwas auch gar nicht zuläßt. Also tut Frankreich alles, um den Deutschen doch das eigentlich vereinbarte Europa abzuringen. Dabei muß es Niederlagen einstecken, und von seinen diplomatischen Teilsiegen hat es nicht viel.
So steht Frankreich nach 40 Jahren imperialistischer Partnerschaft im Namen Europas vor der Wahrheit dieses Verhältnisses: dem Kräftemessen mit einem Konkurrenten, der mit zunehmender Macht und Entschiedenheit auf nationalen Interessen besteht, die mit dem Interesse Frankreichs an ihm unvereinbar sind.
[1] Dieser Artikel schließt den Überblick über die krisenhaften Folgen des „Maastricht“-Beschlusses in den wichtigsten EG-Ländern einstweilen ab. Der entsprechende Aufsatz zu Italien findet sich in GegenStandpunkt 4-92, S.159, diejenigen zu Großbritannien in GegenStandpunkt 1-93, S.78 und Spanien in GegenStandpunkt 1-93, S.92
[2] Über die Jahrzehnte
hinweg lauten die Lagebeschreibungen französischer
Weltpolitiker nahezu gleich. Zur Illustration ein paar
Beispiele: Für die Franzosen bleibt es ungewiß,
welche Vorstellungen sich die Vereinigten Staaten von
der Zukunft Frankreichs machen… Man kann nicht den
Eindruck haben, daß die gelegentliche Hilfe, die es von
den USA erfährt, einer entschlossenen Politik
entspricht, eine französische Großmacht
wiederherzustellen.
(De
Gaulle: Mémoires de guerre Bd. 3, S.389) Die
Macht der westeuropäischen Staaten zu stärken, um damit
den neuen Weltverhältnissen gewachsen zu sein und um
der Gefahr begegnen zu können, die uns von der
amerikanischen Supermacht droht. Dafür muß eine
wirkliche Gegenmacht geschaffen werden, die nur die
endgültige Vereinigung Europas möglich machen kann.
(Jean Monnet, 1947)
Europa muß auch politisch geeint werden. Unser
Westeuropa muß ein Ganzes werden, damit es in der Welt
nicht nur zwei Kolosse gibt, die sich gegenüberstehen,
sondern noch eine Ausstrahlung von Kraft und ebenso von
Klugheit. Europa allein kann dieses Element bilden…
Europa muß sich organisieren. Aber eine solche
Organisation verlangt, daß Frankreich die Führung hat
und daß es den Mittelpunkt bildet
. (De Gaulle, 18.5.62). „Zwischen
Washington und Moskau hatte sich ein direkter Dialog
herausgebildet, sehr oft über die Köpfe der Europäer
hinweg… Jetzt steht die amerikanische Supermacht allein
da. Ihr Einfluß hat noch kein Gegengewicht durch die
Macht eines politisch geeinten Europa gefunden… Die
Interessenkonflikte zwischen den großen
Industrieländern verschärfen sich. Der Wegfall der
Drohung eines Weltkriegs mit der Sowjetunion setzt die
Realität von Wirtschaftskriegen zwischen den
entwickelten Ländern frei. Die Härte des Wettbewerbs
wird durch die Wachstumsschwäche der Weltwirtschaft
verstärkt…“ (P. Bérégovoy,
bis zur Wahl 93 Ministerpräsident, Le Monde
7.1.93) Die Zitate belegen zugleich die klare
französische Absicht, „Europa“ zum Vehikel ihres
alternativen antiamerikanischen Imperialismus zu
machen.
[3] Der EVG-Vertrag wurde 1954 vom französischen Parlament abgelehnt, weil Deutsche und Amerikaner in ihrem gemeinsamen Interesse an einem deutschen Nato-Beitrag alle für Frankreich wesentlichen Elemente einer „supranationalen“ Kontrolle über das neue deutsche Militär daraus entfernt hatten.
[4] Das Nötige hierzu ist in dem Artikel zur Weltwirtschaftskrise in GegenStandpunkt 4-92, S.83 nachzulesen; vor allem in dem „Exkurs über eine mächtige Ideologie: ‚Der Staat spart‘“, S.91 ff.
[5] Regierung und
Opposition – damals noch in umgekehrter
Rollenverteilung – waren sich in dieser Sicht der Dinge
und dem entsprechenden defensiven Programm national
einig: Bei einer Ablehnung Europas wird Deutschland
seine historischen und geographischen Neigungen
wiederfinden. Gestützt auf seine triumphierende Mark
würde es sich erneut nach Osten wenden. Für Europa
würde sich Berlin nur interessieren, um ihm seinen
ökonomischen Willen aufzuzwingen. Die Folgen wären
unabsehbar. Es ist noch gar nicht so lange her, daß wir
im Krieg waren.
(M. Rocard,
Sprecher der Sozialistischen Partei) Das
Deutschland von heute hat weder eine Währungsunion noch
eine europäische Zentralbank nötig, um seine
Währungspolitik dem Rest Europas aufzuzwingen und um
auf dem wirtschaftlichen Feld der einzige Partner der
USA und Japans zu sein… Die Ablehnung des
Maastricht-Vertrages würde Frankreich nicht freier
machen; sie würde nur Deutschland erlauben, nach Lust
und Laune zu handeln, ohne Rücksicht auf seine Nachbarn
und Partner, und ohne noch durch irgendeine europäische
Übereinkunft daran gehindert zu werden, seine
dominierende Militär-, Wirtschafts-, Finanz- und
Währungsmacht im Zentrum des Kontinents ausspielen zu
können
. (G. Balladur,
Neogaullist und neuer Regierungschef, Le Monde
21.8.92).
[6] Dazu ausführlich GegenStandpunkt 3-92, S.107: 35 Jahre EG – Teil II: Vom Staatenbündnis zur Staatsgründung; v.a. B. Währungsunion, S.117 ff.
[7] Von dieser neuen deutschen Linie in Sachen Europa handelt der Aufsatz „Außenpolitik 93: Imperialismus normal“ in GegenStandpunkt 3-93, S.107.
[8] Die neuesten Fortentwicklungen des Balkankriegs und seiner imperialistischen Betreuung behandelt der Artikel „Der Krieg in Bosnien. Nichts als ein Anlaß für den Kampf um die Dominanz unter den Weltmächten“ in diesem Heft.