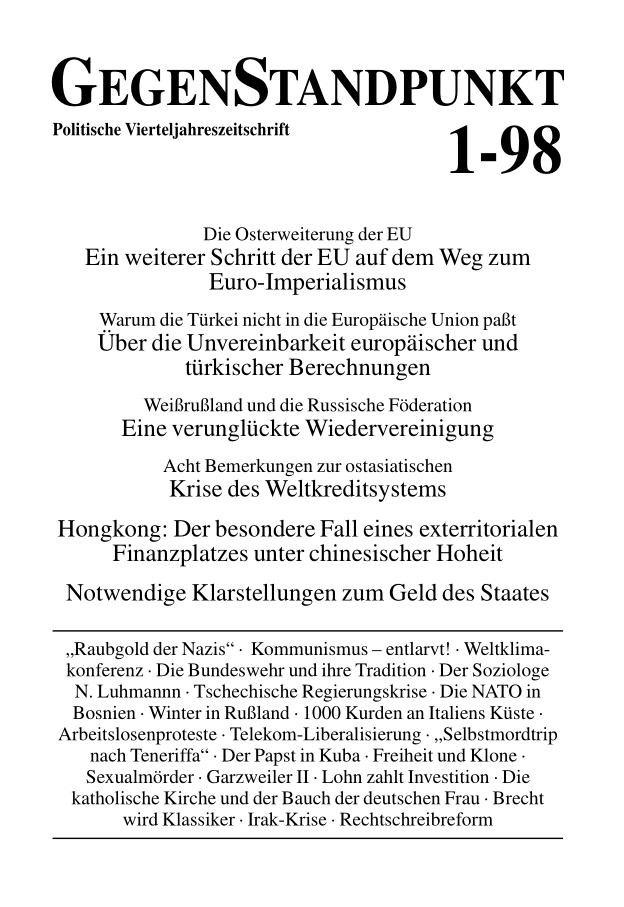Die Osterweiterung der EU
Ein weiterer Schritt der EU auf dem Weg zum Euro-Imperialismus
Die Herrichtung der Transformationsökonomien unter den Ansprüchen des EU-Binnenmarkts / Methode, Erfolge und Perspektiven der bisherigen „Heranführungsstrategie“ im Rahmen der Assoziationsabkommen / Die EU etabliert sich als europäische Ordnungsmacht / Europa richtet sich eine neue Hierarchie von EU-Anhängseln ein und entwickelt Reformbedarf: Schritte auf dem Weg zu einem politischen Subjekt
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Gliederung
- Die Herrichtung der Transformationsökonomien unter den Ansprüchen des EU-Binnenmarkts
- Methode, Erfolge und Perspektiven der bisherigen „Heranführungsstrategie“ im Rahmen der Assoziationsabkommen
- Die EU etabliert sich als europäische Ordnungsmacht
- Die Ost-Erweiterung als eine Etappe der Entmachtung Rußlands
- Atlantische Partnerschaft
- Die Herrichtung der freigesetzten Nationen zu Funktionären einer europäischen Außenpolitik
- Die Einrichtung europa-tauglicher Polizeistaaten
- Europa verlangt die zuverlässige Ausübung der demokratischen Herrschaftstechnik
- Der Anschluß als Bewährungsprobe für die „jungen Demokratien“
- Europa richtet eine neue Hierarchie von EU-Anhängseln ein und entwickelt Reformbedarf: Schritte auf dem Weg zu einem politischen Subjekt
Die Osterweiterung der EU
Ein weiterer Schritt der EU auf dem
Weg zum Euro-Imperialismus
Dezember 97 ist der Beschluß gefallen, daß die EU mit einem ausgewählten Kreis von Kandidaten aus der mittelosteuropäischen Staatenwelt Beitrittsverhandlungen aufnimmt, den anderen Antragstellern wird eine weitere „Heranführungsstrategie“ in Aussicht gestellt.[1] Der interessierten Öffentlichkeit werden zwei einigermaßen disparate Sichtweisen geboten. Einerseits soll es sich nur um eine selbstverständliche, geographisch geradezu logische Fortsetzung der bisherigen EU-Erweiterungsrunden handeln, also darum, das europäische Regime von Milchquoten, Euro-Bananen und Grenzkontrollen auf neue Anhänger auszudehnen. Andererseits um eine Wiedervereinigung von welthistorischem Ausmaß geht, in einer Himmelsrichtung, die bis vor ein paar Jahren aus politischen Gründen versperrt war, nämlich darum
„die letzten Spuren von Jalta von der Landkarte und damit aus den Köpfen der Menschen zu tilgen“. „Geschichte und Geographie hätten in Europa endlich wieder zusammengefunden“ (Kohl, Santer und Juncker, FAZ 15.12.97).
Die EU wird also wieder einmal größer, bekennt sich aber dieses Mal dazu, daß sie mehr als ein bloßes Wirtschaftsbündnis sein will.
An die EU assoziiert sind die mittelosteuropäischen Staaten schon seit einigen Jahren; mit den „Europa-Verträgen“ hat die EU sie schon in allen Hinsichten auf sich als bestimmende Macht umorientiert und ausgerichtet. Aber dieser Status mit seinen „Handelsverflechtungen“ und Anpassungsverpflichtungen, der darin schon erreichte Grad der Anbindung, genügt nicht mehr; der EU ist das Verhältnis offensichtlich zu wenig „stabil“, solange sie die Länder nicht in ihren Club eingemeindet hat. Dieses Projekt hat zwei Seiten: Die Kandidaten werden äußerer Einflußnahme entzogen, indem sie der Union zugeschlagen werden; im ausschließenden Charakter gegen Dritte besteht die negative, nach außen gerichtete Seite der Erweiterung. Was die Seite nach innen betrifft, geht es darum, daß diese Staaten ihre Nationalökonomie, ihr Volk, ihr Militär, ihr gesamtes Staatsinventar unwiderruflich in die EU einbringen, daß ihre Staatsraison ab sofort nur noch als Bestandteil europäischer Rechnungen vorkommt und ihre Herrschaft nach Maßgabe europäischer Interessen ausgeübt wird. Dabei äußern sich die Europa-Politiker unmißverständlich darüber, daß sie den Beitrag dieser Erweiterung umgekehrt proportional zu den bisher üblichen Rechnungsweisen verbuchen: Gemessen an der durchschnittlichen europäischen – sogar an der griechischen – Wirtschaftskraft oder an der verlangten „Stabilität“ von Euro-Geldern, sammelt sich die EU mit ihrem Zugewinn lauter Nieten ein. Der Anschluß geht als eine einzige kritische Musterung vonstatten, mit dem Resultat, daß sie wenig taugen; beim Anlegen der berühmten Kriterien wird nur das vorab feststehende negative Urteil ermittelt – aber eingemeinden will man sie unbedingt. Der Zugewinn, den sich Europa mit seiner Ausdehnung nach Osten verschaffen will, berechnet sich offensichtlich nach anderen Kriterien. Ebenso offensichtlich steht bei dieser Erweiterung nicht auf dem Programm, den Unterschied zu einem assoziierten Hinterhof aufzuheben und die Neuzugänge als gleichrangige Partner anzuerkennen. Was bisherige Erweiterungsrunden noch geprägt hat, der relative Respekt vor Nationen mit einer etablierten National-Ökonomie und traditionellen Interessen, gilt in diesem Fall nicht – darüber geben die ganzen Konditionen des Anschlußprogramms Auskunft ebenso wie die Sprachregelungen der Festreden, die die Vergrößerung der Union als einen Akt von historischer Wiedergutmachung – „Jalta!“ – und europäischer „Hilfe“ würdigen.
Einen Anspruch auf Gleichrangigkeit machen die Staaten auch gar nicht geltend – ihr Beitrittswille hat den Inhalt, aus sich etwas machen zu lassen; alle aus dem östlichen Bündnis entlassenen Souveräne richten ihre nationalen Berechnungen kompromißlos auf eine Zugehörigkeit zu Europa aus. Die Ost-Staaten lassen sich der EU zuordnen, weil sie sich, in die neue Unabhängigkeit entlassen, nach der Auflösung ihrer alten Staatenbeziehungen und wegen des Systemwechsels ziemlich mittellos wiederfinden, in ökonomischer wie politischer Hinsicht. Gleichzeitig treten aber alle anspruchsvoll an. Mit dem Wirtschaftsblock der EU konfrontiert und beeindruckt von dessen Diplomatie aus den Zeiten der Ost-West-Konfrontation, nach der die Öffnung nach Westen der direkte Weg zu einem Wohlstand von westeuropäischen Maß sein sollte, steht das Ziel der neuen Staatskarrieren fest: die Herstellung von weltmarktstauglichen Nationalökonomien und die Absage an östliche Bindungen. Rückwirkend wird das sozialistische Lager, in dem sich die meisten dieser Staaten überhaupt erst zu Industriestaaten entwickelt haben, als von der Sowjetunion erzwungener Ausschluß von einer „europäischen“ Entwicklung verdammt, und auch die negativen Wirkungen der zu Blockzeiten eingegangenen Beziehungen zum Westen, die ansehnlichen Schulden, werden auf das Konto der Zugehörigkeit zur falschen Seite gebucht. Die nationalen Führer sind so fanatisch auf den Anschluß ans erfolgreiche kapitalistische Lager aus, daß sie den RGW wie eine einzige imperialistische Gemeinheit gegenüber ihren nationalen Rechten einordnen und die Anpassung an die Gemeinschaftsordnung der EU wie einen Schritt in eine lichte nationale Zukunft. Daher haben die politischen Macher Alternativen eines national geschützten Wegs zur Marktwirtschaft oder eines dementsprechenden Bündnisses im Osten erst gar nicht in Betracht gezogen. Als Vertreter eines passiven Imperialismus, die sich vorgenommen haben, sich durch auswärtige Benützung auf das Niveau der westeuropäischen Staaten entwickeln zu lassen, gehen sie zu Europa ein erklärtes Unterordnungsverhältnis ein, aber eben um den Fortschritt ihrer Staatsprojekte zu betreiben – als Karrieremittel.
Diese Berechnung, die Tatsache, daß die östlichen Staaten
mit ihren Aufnahmeanträgen um europäische Betreuung
bitten, wird von der EU als Gelegenheit wahrgenommen, die
Anschlußkandidaten in Gestalt von Bedingungen einer
Aufnahme, die sie zu erfüllen haben, auf die im Rahmen
des Bündnisses erwünschten Funktionen festzulegen. Ihnen
Gleichberechtigung, Gleichrangigkeit im Rahmen des
Bündnisses zuzugestehen, kommt nicht in Frage. Dazu
braucht die EU keine Diskriminierung, sie unterwirft die
Staaten vielmehr ihrem acquis communautaire
, d. i.
der Bestand an gesetzlichen Regelungen und Einrichtungen,
den sie sich zugelegt hat, das Völkerrecht der EU. Die
künftigen Mitglieder werden von Europa damit
konfrontiert, daß sie eben diesen acquis zu übernehmen
haben, daß sie sich durch die Erfüllung von
dessen Maßgaben auf das Niveau der heutigen EU
hocharbeiten sollen. Und die nachdrückliche
Demonstration, daß sie gar nicht in der Lage sind, die
europäischen Maßstäbe zu erfüllen, macht den Hauptzweck
der Veranstaltung aus: Der Imperativ beizutreten, ist die
eine Sache; der Bescheid, daß angesichts der Verfassung
dieser Staaten Beitritt nur Unterordnung sein kann, die
andere.[2] Die
formelle Gleichbehandlung ist die Methode, einen neuen
Typus von Ungleichheit unter Mitgliedern einzuführen; die
heutige EU hat mehr Verwandtschaft mit einem Zentrum, das
sich eine Peripherie zuordnet, als mit einem Bündnis, das
sich um neue Teilnehmer erweitert. Mit dieser Erweiterung
macht Europa einen interessanten, nur halb eingestandenen
Fortschritt vom gemeinsamen Markt zur Euro-Ordnungsmacht
– hinsichtlich der europäischen Gesamtökonomie wie
hinsichtlich der europäischen Ordnungsmacht versetzt es
diese Staaten in den Status des Hinterlands.
Die Herrichtung der Transformationsökonomien unter den Ansprüchen des EU-Binnenmarkts
Die EU entwickelt gegenüber den Transformationsstaaten liebevoll eine „Heranführungsstrategie“. Die sieht so aus, daß die EU-Kommission Kriterien aufstellt und deren Erfüllung überprüft, sie geht also von der relativen Unfähigkeit der Kandidaten aus, den Forderungen zu entsprechen und kehrt den Befund in Gestalt laufend erneuerter Ansprüche gegen die künftigen Mitglieder: Der „Entwicklungsrückstand“, den die EU beklagt, und die Lasten, die die EU erwartet, werden an sie als von ihnen zu behebende Probleme zurückdelegiert.
Die „Kriterien“ in der Abteilung Ökonomie, die der
Europäische Rat aufgestellt hat und als Voraussetzung für
den Beitritt erfüllt sehen möchte, fassen sich in den
zwei prinzipiellen Forderungen zusammen, daß (I) eine
funktionsfähige Marktwirtschaft
und (II) die
Fähigkeit, dem Wettbewerbsdruck und den Marktkräften
innerhalb der Union standzuhalten
, gegeben sein
müssen. Was das alles einbegreift, expliziert die
EU-Kommission folgendermaßen:
„(I) Dies wiederum setzt voraus, daß verschiedene Bedingungen erfüllt sind. Angebot und Nachfrage müssen durch das freie Spiel der Marktkräfte ausgeglichen werden; Preise und Außenhandel müssen liberalisiert sein;
– es darf keine nennenswerten Schranken für den Marktzugang (Errichtung neuer Unternehmen) und das Ausscheiden aus dem Markt (Konkurs) geben;
– das Rechtssystem einschließlich der Regelung der Eigentumsrechte muß vorhanden sein; Gesetzen und Verträgen muß gerichtlich Geltung verschafft werden können;
– makroökonomische Stabilität, einschließlich einer angemessenen Preisstabilität und tragfähiger öffentlicher Finanzen und Zahlungsbilanzen, muß erreicht sein;
– es muß ein breiter Konsens über die wesentlichen Elemente der Wirtschaftspolitik bestehen;
– der Finanzsektor muß hinreichend entwickelt sein, um die Ersparnisse produktiven Investitionen zuzuführen…
(II) Zu berücksichtigen ist dabei u.a.:
– ob eine funktionsfähige Marktwirtschaft mit einem ausreichenden Grad an makroökonomischer Stabilität besteht, so daß die Wirtschaftsteilnehmer ihre Entscheidungen in einem Klima der Stabilität und Berechenbarkeit treffen können;
– ob Human- und Sachkapital einschließlich Infrastruktur (Energieversorgung, Telekommunikation, Transport usw.), Bildungswesen und Forschung in ausreichendem Maße zu angemessenen Kosten vorhanden ist und welche künftigen Entwicklungen in diesem Bereich zu erwarten sind;
– inwieweit staatliche Politik und Gesetzgebung die Wettbewerbsfähigkeit über handels- und wettbewerbspolitische Maßnahmen, staatliche Beihilfen, KMU-Förderung usw. beeinflussen;
– Grad und Tempo der Handelsverflechtung mit der Europäischen Union, die ein Land bereits vor der Erweiterung erreicht hat. Dies gilt sowohl für das Volumen als auch die Art des Warenverkehrs mit den Mitgliedstaaten…“
Mit einem „Wirtschaftsprogramm“, an das die Politiker
dieser Länder sich halten könnten, hat dieser Katalog
nicht viel zu tun. Die EU trägt vielmehr ihre
Anspruchshaltung vor: Sie nimmt Maß an ihren
internen Einrichtungen und Funktionsweisen, die
diese Länder „übernehmen“ sollen, um sich zum
EU-kompatiblen Wirtschaftsraum herzurichten. In Gestalt
der „Kriterien“ wird die gar nicht bescheidene Forderung
erhoben, daß sich die Beitrittskandidaten zu einem für
jedes europäische Geschäftsinteresse frei zugänglichen
und auch noch lohnenden Raum
zurechtzureformieren haben, ohne nationale Barrieren, mit
sämtlichen in der EU geltenden Bedingungen, von der
entsprechenden Infrastruktur über technische Normen bis
zu den rechtlichen und wirtschaftspolitischen
Einrichtungen, als exklusiver Vorteil für das
Euro-Kapital. Bemerkenswert daran ist die
Rücksichtslosigkeit, mit der Maßstäbe aufgestellt werden,
die die Neumitglieder einhalten sollen: Die „Kriterien“
sind nichts anderes als das Abziehbild funktionierender
kapitalistischer Nationen der gehobenen Klasse. Die
Beitrittsbedingungen unterstellen und verlangen nicht
mehr und nicht weniger als eine erfolgreiche
Kapitalakkumulation – das aber im Gestus, als sei sie das
Produkt von Richtlinien, an die die Staaten sich nur zu
halten brauchen. Was bei diesen Nationen an
Voraussetzungen dafür gegeben ist, interessiert nicht.
Sie kommen einzig als Potential vor, das sich nach dem
Vorbild der EU herzurichten hat, bzw. – schließlich
wissen die Europa-Erweiterer dann doch ziemlich genau,
was für eine Sorte von Staaten sie vor sich haben – als
eher zweifelhaftes Potential: Das zweite „Kriterium“, die
Fähigkeit, dem Wettbewerbsdruck und den Marktkräften
innerhalb der Union standzuhalten
, beruht
auf eben dem begründeten Zweifel an ihren diesbezüglichen
Fähigkeiten, stellt aber den Gegensatz, den das
Anschlußprogramm gegenüber den Kandidaten aufmacht, wie
eine Bewährungsprobe vor, die sie zu bestehen haben.
Das einschlägige Stichwort heißt „Öffnung“: Angefangen von den Assoziationsabkommen bis zu den heutigen „Heranführungsstrategien“ verlangt Europa von den Anschlußländern, die auf Grundlage des Systemwechsels sich eine nationale Kapitalakkumulation überhaupt erst herstellen müssen, der Konkurrenz des EU-Kapitals auszusetzen: Messen sollen sich auf der einen Seite internationales und vor allem EU-Kapital, durch seinen „Binnenmarkt“ zu entsprechenden Dimensionen aufgewachsen, auf der anderen Seite die Zerfallsprodukte der östlichen Arbeitsteilung. Staatliche Schranken für die Benützung durch auswärtige Geschäftsinteressen haben die Assoziationspartner Zug um Zug einzureißen, sich perspektivisch, aber zunehmend auch jetzt schon, der Mittel nationaler Wirtschaftspolitik zu enthalten, die auf die staatliche Korrektur von Konkurrenzniederlagen zielen – das ist der Inhalt des „acquis communautaire“, was 3 der sogenannten „vier Freiheiten“, „freier Warenverkehr, freier Kapitalverkehr, freier Dienstleistungsverkehr“, betrifft. Im Namen dieser Freiheiten bekämpft Europa in seinem Anschlußgebiet alle erdenklichen Schranken und betätigt seinen Imperativ zur „Öffnung“ im andauernden Verdacht gegen „postkommunistisches Beharrungsvermögen“. Und unter diesen Bedingungen sollen die Objekte dieser Befreiung – so postuliert es der Kriterienkatalog – Erfolge erzielen, die sie als Nationen mit guten Bilanzen und stabilem Geld zu lohnenden Objekten des Anschlusses machen.
Als Mittel des Wirtschaftsaufschwungs sind Prospektion und Niederlassung potenten auswärtigen Kapitals vorgesehen sowie der Zufluß von privatem Kredit. Für ihre Geschäftsfähigkeit als Objekt der Prospektion wird auch etwas getan, Europa begleitet seinen Anspruch auf Öffnung mit Kredit: IWF, Weltbank und die Europa-Banken haben die internationale Zahlungs- und Geschäftsfähigkeit der Reformstaaten garantiert und ihnen damit auch für die Wahrnehmung der interessierten Geschäftswelt den Charakter einer ausgewiesenen europäischen Anlagesphäre verliehen, woran alle nationalen Erfolgsaussichten unwiderruflich geknüpft sind. Dasselbe leisten inzwischen zunehmend die EU-Banken, indem sie von Europa befürwortete Projekte, elementare Voraussetzungen für die Tauglichkeit in Sachen Binnenmarkt finanzieren.
Methode, Erfolge und Perspektiven der bisherigen „Heranführungsstrategie“ im Rahmen der Assoziationsabkommen
„Öffnung“ im Außenverhältnis
In einem überaus ausgewogenen Verhältnis haben die nach der Auflösung des RGW abgeschlossenen Assoziierungsverträge einerseits EU-Konkurrenzinteressen in Rechnung gestellt, die keinesfalls geschädigt werden dürfen. Bei den sogenannten „sensiblen Produkten“, Stahl, Textil- und Agrarerzeugnissen – zufälligerweise sind das dieselben, bei denen sich die Beitrittsstaaten gewisse Exportchancen ausgerechnet hatten – hat Europa auf dem Schutz des EU-Binnenmarkts, auf Einfuhrbeschränkungen durch Quotenregelungen bestanden. Andererseits hat es den Transformationsstaaten „Asymmetrie“ gewährt, d. h. gegenüber der übermächtigen Konkurrenz des in der EU schon etablierten Kapitals die Sonderbedingung eingeräumt, diese Konkurrenz nicht sofort und nicht überall in Anschlag zu bringen: Konditionen der graduellen Öffnung, des schrittweisen Abbaus von Zöllen und nichttarifären Handelshemmnissen, Fristen und Ausnahmeregelungen bei der Zulassung von Auslandskapital, unterschieden nach Branchen. Eben wegen der Rücksichtslosigkeit des Öffnungsprogramms hat es die Übernahmemacht EU auch wieder für nötig erachtet, Rücksichten einzuräumen: Das Verhältnis ist in die Verlaufsform eines dauerhaften Streits überführt worden, bei dem sich Europa die Auslegung der Vereinbarungen, die Entscheidung darüber, was EU-konform, was nicht konform ist, und die Genehmigung von Ausnahmen vorbehält. Logischerweise fallen auch die Erfolge reichlich asymmetrisch aus: die Handelsbilanzdefizite gegenüber Europa in allen diesen Nationen steigen regelmäßig.[3]
Europa besteht auf „Öffnung“ in sehr exklusiver Art; in der anderen Himmelsrichtung ist nämlich das Gegenteil, Abbruch verlangt, weil die europäischen Versöhnungs-Politiker nicht genug vor der gefährlichen „Abhängigkeit“ von russischen Importen warnen können. Bezeichnenderweise ist damit nicht der Handel gemeint, den Europa mit Rußland betreibt, bei dem es sich durchaus nicht vor Abhängigkeit fürchtet. Bei den Beitrittskandidaten aber werden konkurrierende Handelsbeziehungen nicht geduldet: Europa will nicht nur das Geschäft auf sich ziehen, sondern auch das damit verbundene politische Gewicht bei sich konzentrieren und beides der ehemaligen Vormacht Rußland bestreiten. Die Möglichkeit, daß sich Rußland mit Bartergeschäften oder Gewinnen aus Osteuropa konsolidiert, soll ebenso ausgeschlossen werden wie jede Handhabe, über Handelsbeziehungen Einfluß und politische Erpressungen gegenüber den Ex-Verbündeten auszuüben.
Die Aufgabe ist in einer Hinsicht relativ schnell damit
erledigt, daß sich im Rahmen der alten
RGW-Handelsbeziehungen kaum gutes, d.h. weltmarktfähiges
Geld verdienen läßt, auf das die Transformationsstaaten
angewiesen sind. Wirtschaftsgutachten führen
eindrucksvolle Statistiken über die Umorientierung im
Handel
vor – selbstverständlich ohne zu erwähnen,
wieviel an Industrie und sachlichem Reichtum dieser
„Umstellung“ zum Opfer gefallen ist. Abweichungen von der
vorgeschriebenen Linie, Fälle, in denen Betriebe oder
Nationen den Nutzen dieser Kündigung nicht einsehen und
sich mit Bartergeschäften behelfen wollen, werden von
Europa aus zur Ordnung gerufen: Der Fall Bulgarien ist
seit dem Staatsbankrott und Sturz der
„postkommunistischen“ Regierung erledigt, der Fall
Slowakei noch nicht zur Gänze.
„Mitte 96 setzte die Slowakei die EU von ihrer Absicht in Kenntnis mit Rußland Gespräche über ein mögliches Freihandelsabkommen aufzunehmen. Nach Erörterungen in den mit dem Europa-Abkommen eingesetzten Organen änderte die Slowakei ihre Pläne und strebt nunmehr nur noch in einigen Bereichen eine Liberalisierung des Handels an.“
Der problematische Restbestand besteht hauptsächlich in den Energieimporten – „strategische Güter“ par excellence, weil Grundvoraussetzung jeder Volkswirtschaft. Auch da werden Mißverständnisse des Inhalts, mit dem Eintritt ins Reich der Marktwirtschaft sei den EU-Kandidaten nun freier Handel und Wandel erlaubt –
„Zu der Frage der vollständigen Abhängigkeit seines Landes von russischen Öl- und Gaslieferungen sagte Meciar, man werde so lange Handel mit Rußland treiben, wie das für beide Seiten vorteilhaft sei. Wenn das Öl in Rußland billiger sei als in anderen Ländern wie gegenwärtig, dann werde man es dort kaufen.“ (FAZ 26.9.96) –
nötigenfalls mit Nachdruck korrigiert:
„Damit bleibt die Slowakei in bezug auf Brennstoffimporte größtenteils vom politisch instabilen Rußland abhängig. Um diese einseitige Abhängigkeit – die auch politisch für die Slowakei gefährlich werden könnte – zu durchbrechen, ist eine konsequente Diversifizierung der slowakischen Brennstoffimporte dringend notwendig.“ (Werner Weidenfeld (Hrsg.): Mittel- und Osteuropa auf dem Weg in die Europäische Union, Gütersloh 1995, S. 183)
Die einsichtsvollen EU-Kandidaten, Polen, Tschechien, Ungarn haben ihre politische Reife unter Beweis gestellt und sich, rücksichtslos gegen die Kosten, um „Diversifizierung“ bemüht, d.h. den Anschluß an westeuropäische Energienetze hergestellt oder im Verbund mit westeuropäischen Vertragspartnern Garantien gegen Rußland gesucht – so daß inzwischen in einer neuen Variante von Dreiecksgeschäften westliche Energiekonzerne billige russische Energie zu Weltmarktspreisen an die osteuropäischen Staaten weiterverkaufen.[4]
Der andere Problemfall besteht im unseligen atomaren Erbe. In diesem Fall denkt die EU erstens an nichts anderes als an Leib und Leben ihrer Bürger:
„Die Union steht unter dem Gebot des Schutzes von Leben und Gesundheit ihrer jetzigen und künftigen Bürger. Das bedeutet, daß die Bewerberländer uneingeschränkt an den Bemühungen mitwirken sollten, die Nuklearsicherheit in ihrem Land auf internationales Niveau zu bringen.“
Zweitens versteht es sich von selbst, wer das „internationale Niveau der Nuklearsicherheit“ gepachtet hat, so daß diese Staaten nicht auf andere Sorten von Energie umgerüstet, sondern von der RGW-Nukleartechnologie und dieser „gefährlichen Abhängigkeit“ abgebracht werden müssen.[5] Siemens und Framatome muß die Öffnung dieses besonderen Markts gesichert werden, und die EU bietet ihre erpresserische Hilfe an: Den Staaten wird die Entscheidung über Stillegung oder Umrüstung von AKWs mit der Aussicht auf Kredit nahegelegt.
„Die Finanzhilfe gewährenden Institutionen sollten sich mit den einzelnen betroffenen Ländern sobald als möglich über den frühesten praktikablen Termin für die Stillegung der betreffenden Kernkraftwerke und ein Hilfsprogramm zur Ermöglichung dieser Stillegung einigen. Die Programme sollten von der EBWE in enger Zusammenarbeit mit PHARE, EURATOM und der Weltbank aufgestellt werden. Diese Koordinierung sollte auf alle Hilfs- und Modernisierungsmaßnahmen ausgeweitet werden. In Anbetracht der Beträge, um die es geht (etwa 4 bis 5 Mrd. ECU für die wichtigsten Maßnahmen in den nächsten zehn Jahren), wird die Union hierzu nur einen Teil beitragen können.“
„Öffnung“ der „Zentralverwaltungswirtschaft“
Die zweite Abteilung der verlangten „Öffnung“ nimmt sich die Hinterlassenschaft des Sozialismus vor, in der Terminologie der Kriterien:
„Es darf keine nennenswerten Schranken für den Marktzugang (Errichtung neuer Unternehmen) und das Ausscheiden aus dem Markt (Konkurs) geben.“
Verlangt ist der Abbau der Staatswirtschaft – der
grundsätzlichen Wettbewerbsverzerrung
, der
entscheidenden Schranke
für die Segnungen der
freien Konkurrenz, die Europa in seinem Osten einziehen
lassen möchte. In diesem Geist überwachen und
kontrollieren die europäischen Instanzen von Anbeginn bis
heute mit mißtrauischer Aufmerksamkeit das Kapitel der
„Privatisierung“
Der europäische Standpunkt, nach dem sich die Güte von Regierungen daran bemißt, mit welcher Entschiedenheit und Geschwindigkeit sie „privatisieren“, hat mittlerweile den Charakter eines Dogmas angenommen – als handelte es sich im Prinzip um dieselbe grundvernünftige Sache wie die einschlägigen Telekom-Kunststücke in Westeuropa, nur in etwas größeren Dimensionen wegen der Herkunft dieser Nationen aus dem anderen System. In den eingebürgerten Sprachregelungen von „verschleppten“, „aufgeschobenen“ oder „stockenden Reformen“ kommt die von Europa verlangte Umwälzung schon gleich wie ein unhintergehbarer Sachzwang daher, dem sich die Regierungen stellen müssen. Europa besteht in dieser Frage auf Fortschritten, als ob es nur um eine Umdefinition von Staatsbetrieben in Privateigentum durch staatlichen Willensakt ginge. Es trifft auch auf Bereitschaft: Alle diese Staaten bekennen sich zum Programm der Privatisierung – alle wollen schließlich „zurück nach Europa“. Allerdings stoßen sie bei der Verwirklichung des Programms allzu oft auf die Sachlage, daß sie an der Aufgabe scheitern. Es handelt sich schließlich nicht bloß um eine Änderung der Eigentumsform, sondern um Bewährung oder Untergang des Hauptbestandteils überkommener nationaler Produktionsmittel auf dem Euro-Markt. Die Intransigenz der Aufsichtsinstanzen, die sich an der Eigentumsform festmacht und den Verdacht anmeldet, Regierungen wollten insgeheim Staatseigentum aufrechterhalten, zielt auf das europäische Recht auf Konkurrenz und gefährdet damit diese Substanz: Denn die Hindernisse und Schwierigkeiten, auf die die Reformstaaten mit ihrem Willen zur Privatisierung stoßen – gleichgültig, welche Methoden sie sich dafür ausdenken –, beweisen auf ihre Art, daß sich die angestrebte Gleichung von überkommenen Staatsbetrieben und Kapital nicht wahrmachen läßt. Und was die Regierungen beim rigorosen Durchziehen der Alternative „Privatisierung oder Schließen“ zögern läßt, ist der peinliche Umstand, daß dann beim Aufbruch in eine neue nationale Freiheit von ihnen als Industrienationen nicht viel übrig bleibt.
Das erste Hindernis, auf das die Privatisierungsbemühungen treffen, ist das Fehlen einer zahlungsfähigen Nachfrage: In den Nationen ist anlagewilliges und -fähiges Kapital nicht vorhanden, aus eben dem Grund, daß dort die Institution des Privateigentums, die in Kraft gesetzt werden soll, nicht in Kraft war. Auswärtige Kaufinteressen halten sich in Grenzen, reichen jedenfalls bei weitem nicht an die Masse der zu privatisierenden Unternehmen heran, nicht einmal, wenn die zu Schleuderpreisen angeboten werden. Die Redeweise vom „Tafelsilber“, von dem sich die Reformstaaten angeblich nur viel zu zögerlich trennen mögen, kennzeichnet ja umgekehrt eher den Charakter des westlichen Einkaufsinteresses und das darin enthaltene vernichtende Urteil über die Geschäftstauglichkeit ganzer Volkswirtschaften: Die Praktiker der Rentabilität entdecken kaum etwas Gewinnträchtiges, wenige Betriebe, denen sie eine Behauptung auf dem Weltmarkt zutrauen möchten… Sie tätigen einige spektakuläre Einkäufe, während der große Rest im Eigentum der Staatsmacht verbleibt, weil die Staatsbetriebe keine Käufer finden.
Wo sich Käufer einstellen, da ist deren Geschäftskalkulation oft von einer Art, daß sie Staatsinteressen tangiert: Teils ist das Inventar von den Käufern bis zum Grundstücksverkauf ausgeschlachtet worden, und die Betriebe sind darüber aus der nationalen Bilanz verschwunden; teils sind ganze Branchen aufgekauft worden, um sie dichtzumachen und den Markt von von außen zu beliefern. Daher rühren z.B. die von der EU-Kommission als Handelshemmnis monierten Bedenken Polens, seinen Öl- und Treibstoffsektor zu „öffnen“: Auf der deutschen Seite, sofort hinter der Grenze stehen Raffinerien, die aus dem Stand ganz Polen versorgen könnten und das gesamte nationale Geschäft auf sich ziehen möchten.
Daher verbleibt Unternehmensbestand in Staatseigentum. Regierungen wollen das negative Urteil vertagen, sich die Entscheidung offenhalten, in Einzelfällen auch einträgliche Unternehmen als sichere Geldquelle ihrer Haushalte behalten, Interessenten für ein potentielles Geschäft suchen. Die Alternative, von Staats wegen Betriebe zu konkurrenzfähigem Kapital aufzurüsten, trifft auf ein zweites Hindernis: Die Herstellung einer rentablen Produktion, die sich in der europäischen Konkurrenz messen kann, ist ohne Kapitalzuschuß, ohne Kredit, nicht zu haben, aber die Kreditbeschaffung für Programme der „Umstrukturierung“ gerät wieder zu einer Frage der Genehmigung durch Europa. Die nationalen Vorbehalte, daß nicht zuviel Industrie brachgelegt werden darf, werden von dessen Seite teils gebilligt – unter dem Titel der notwendigen, einer Privatisierung vorausgesetzten Umstrukturierung –, teils aber entschieden mißbilligt.
Der polnische Weg
Die polnischen Regierungen haben Unternehmenskonglomerate zu Aktiengesellschaften (Nationale Investmentfonds) zusammengefaßt, sich dafür die europäische Konzession, die Unterstützung der Weltbank und der EU-Banken gesichert, und ihre marktwirtschafliche Linientreue unterstrichen, indem sie westliche Managementgesellschaften in deren Verwaltung hereingebeten haben.
„So ist einigen Großunternehmen eine Umstrukturierung gelungen, obwohl (!) sie in staatlichem Besitz sind.“
Aber auch die Genehmigung ist bedingt und der europäische Vorbehalt bleibt bestehen: Die EU-Kommission beanstandet,
„daß im Falle Polens nicht im selben Maße wie bei anderen Bewerberländern damit gerechnet werden kann, daß politisch bedingte Verzerrungen durch den internationalen Wettbewerbsdruck korrigiert werden können.“
Europa beharrt auf dem Prinzip:
„Privatisierung und ausländische Direktinvestitionen werden wesentlich zur Umstrukturierung beitragen, vor allem in den von Staatsunternehmen beherrschten Sektoren (Chemie, Mineralöl, Bergbau, Telekom und eisenschaffende Industrie),“
und läßt auch nicht im Unklaren, wie die europäischen Maßstäbe für „Umstrukturierung“ aussehen:
„Die polnische Regierung hat sich bisher weniger als die Regierungen anderer Länder bereitgefunden, Lösungen für die von der Umstrukturierung zu erwartenden ernsten regionalen und sozialen Probleme zu finden.“
Der tschechische Weg
Schnell und gründlich die Staatswirtschaft „privatisieren“, indem das Staatseigentum in eine Menge von „Aktien“ umgerechnet und gegen eine geringe Gebühr ans Volk verteilt wird, das läßt sich schon machen. Dadurch wird aber weder die kapitalistische Tauglichkeit, die erwünschte Ertragskraft der in AGs verwandelten Betriebe hergestellt, noch eine nationale Zahlungsfähigkeit, die die Papiere in Kurs hält. Es sind diese Schranken, die sich heute bemerkbar machen und auf denen – nach der Begeisterung über die entschiedene und schnelle Kupon-Privatisierung – die heutige Kritik an der Tschechischen Republik beruht; freilich nimmt diese Kritik sie nicht als Ausdruck desselben Mangels an Kapital, an dem sämtliche Privatisierungsmethoden kranken, sondern schon wieder als mangelnden staatlichen Privatisierungswillen, als „Staatswirtschaft“, und zwar in der perfiden Form einer „versteckten Staatswirtschaft“. Die Diagnose der „Scheinprivatisierung“ hat es mittlerweile zum offiziellen Vorwurf an die Adresse der tschechischen Regierung gebracht:
„. … ist der Staat mit Kapitalanteilen zwischen 30 und 66% der einflußreichste Aktionär der vier Großbanken geblieben. Die OECD hat diesen Umstand in ihrem jüngsten Länderbericht ausführlich kritisiert. Sie verweist darauf, daß die Großbanken nicht nur alle denselben Hauptaktionär haben, sondern auch über Kreuzbeteiligungen miteinander verflochten sind. Denn die von den Banken verwalteten Investitions-Privatisierungs-Fonds (IPF) gehören zu den wichtigsten Anlagefonds und halten seit der Coupon-Privatisierung auch Bankenaktien in ihren Portefeuilles. Gleichzeitig sind diese IPF wichtige Aktionäre in den Industriebetrieben, so daß die Großbanken bei diesen zugleich als Gläubiger und – über die IPF – als Eigentümervertreter auftreten.“ (NZZ, Mitte Juli 97)
Die entschiedene und schnelle Privatisierung
hat
nun zwar aus guten Gründen zu der Eigentumsverteilung
geführt, die heute Anstoß erregt: Daß das durch
politischen Beschluß ins Leben gerufene tschechische
Privateigentum, die ans Volk übertragenen Kupons,
postwendend bei Institutionen, denen der Staat das Recht
auf Geldschöpfung verliehen hat, bei Banken und
Investmentfonds, landet, ist ebenso folgerichtig wie die
Tatsache, daß deutsche Banken die Hauptaktionäre
deutscher Firmen sind. Aber auch in diesem Fall sind
Eigentumstitel noch lange nicht mit
funktionierendem Kapital identisch, was sich dann auf
dieser Ebene als Dilemma der Investmentfonds
herausgestellt hat.[6] Auch hier steht die Scheidung
von rentabel und unrentabel an, was den Besitz der Fonds
betrifft ebenso wie bei den Fonds selber wie bei den
Banken als Eigentümer der Fonds. Von der Politik ist
verlangt, entweder das negative Urteil zu vollstrecken
oder wiederum nach Mitteln zu suchen, das Eigentum
funktionstüchtig zu machen.
Dieses Dilemma wird den tschechischen Marktwirtschaftlern aber nun als möglicherweise böse Absicht zugerechnet, das negative Urteils der Aufsichtsinstanzen steigert sich von: „versteckte Staatswirtschaft“ zu: „Quelle von Korruption und Verbrechen“![7] Das Urteil hat die Spekulation gegen das tschechische Geldwesen dann vollstreckt, die unbestechlichen Instanzen des internationalen Geschäfts haben der tschechischen Republik bewiesen, daß ihr „Modell“ auch nicht mehr wert ist als das wacklige Nationalvermögen der anderen Transformationsländer.[8]
Der slowakische Sündenfall
Hier fällt die europäische Mißbilligung der Privatisierung wiederum genau umgekehrt aus: Dieselben Investmentfonds, die im Fall Tschechiens inzwischen als ein Sumpf von Korruption und versteckter Staatswirtschaft denunziert werden, gelten als Repräsentanten der freien Marktwirtschaft, die Meciars Reformfeindlichkeit zum Opfer gefallen sind:
„In den letzten Jahren war die Wirtschaftspolitik der Slowakei durch einen Mangel an Vorhersehbarkeit und Transparenz gekennzeichnet. Die sprechendsten Beispiele dafür lassen sich im Privatisierungsprozeß finden, wie die überraschende Einstellung des zweiten Kuponprivatisierungsprogramms, die plötzliche Änderung der Rolle der IPF (wodurch diese Fonds beträchtliche Verluste erlitten)[9] und die Tatsache, daß die Privatisierung der Großbanken bereits mehrmals angekündigt und dann wieder verschoben wurde. Auch dem vorgeschlagenen Gesetz über die Unternehmenssanierung mangelt es an Transparenz, da bei der Auswahl der begünstigten Unternehmen politische Erwägungen eine Rolle spielen. Der Gesetzentwurf sieht Möglichkeiten vor, Verbindlichkeiten gegenüber dem Staatshaushalt oder Banken durch ein wenig durchsichtiges Verfahren umzuschulden oder zu streichen, was mit einer beträchtlichen Einflußnahme der Politik verbunden ist.“
Die „intransparenten Direktverkäufe“, ebenso transparent wie die Schmiergeldaffären der Treuhand in der Zone, sind auch transparent genug dafür, daß die EU-Kommission die politische Absicht wahrnimmt und mißbilligt: Das slowakische Bedürfnis, den Besitzstand unter nationaler Kontrolle zu halten, indem die neuen Privateigentümer über ihre Staatszugehörigkeit auf die Funktionsfähigkeit ihres Eigentums für Nation und Staat verpflichtet werden sollen – das ist der slowakische Verstoß gegen den Geist der Marktwirtschaft; als ob nicht zahlreiche marktwirtschaftliche Staaten es in ihrer Vergangenheit für nötig befunden hätten, strategisch bedeutsame Betriebe in ihre Kontrolle und Betreuung zu überführen, um dem nationalen Wachstum dienlich zu sein. Das Urteil lautet: Mißachtung des Privateigentums und zwar in der Lesart: Ausschluß des Auslands.
Rumänien, Bulgarien und Slowenien
kassieren das negative Urteil „verschleppter Reformen“. Auswärtige Geschäftsinteressen an diesen Balkanstaaten fallen – mit Ausnahme der italienischen Mafia – außerordentlich bescheiden aus, so daß die Regierungen der ersten Jahre auf ihren Privatisierungsobjekten im wesentlichen sitzen geblieben sind, d.h. sie haben sich natürlich nicht genügend um die Marktwirtschaft bemüht:
„Bulgariens Fortschritte sind durch das Fehlen einer Verpflichtung zu einer marktwirtschaftlich ausgerichteten Wirtschaftspolitik begrenzt worden.“
Das Urteil wird von den nunmehr auch im europäischen Sinn demokratisch legitimierten Regierungen vollstreckt, wobei die Bedeutung von „Privatisierung“ mit Liquidation weitgehend zusammenfällt.
„Rumänien hat kürzlich Fortschritte bei der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit seiner Wirtschaft gemacht, besonders durch das Herangehen an die Beseitigung größerer Verzerrungen wie etwa niedriger Energiepreise, durch die Beschleunigung der Privatisierung und den Beginn der Liquidation verlustbringender staatlicher Großbetriebe.“
Der Wettbewerbsfähigkeit dieser Nation ist also damit gedient, daß sich ihre Einwohner keine Heizung mehr leisten können. Zusätzlich schließt Rumänien auch noch größere Teile seiner petrochemischen Industrie – eine kleine Ironie der Geschichte: Unter Ceausescu wurde deren Aufbau vom Westen gefördert, um den lobenswerten Unabhängigkeitsdrang gegenüber der sowjetischen Vormacht zu stärken, heute ist das Gerät „unrentabel“. Die „staatlichen Großbetriebe“ sind heutzutage eben überflüssig – im Hinblick auf die Nation, die sich ihre eigene Produktion nicht mehr leisten kann, und im Hinblick auf überlegene westliche Großbetriebe.
Nicht einmal Slowenien, dessen 4 bis 5 Unternehmen nach den Maßstäben des bürgerlichen Rechts einwandfrei Privateigentum sind, kommt der europäischen Kritik aus. Das arbeiterselbstverwaltete Erbe hat es in seinem internen Funktionieren noch nicht zum notwendigen Gegensatz von Arbeit und Eigentum gebracht:
„Jedoch ist die Umstrukturierung der Unternehmen langsam verlaufen aufgrund des Konsenscharakters wirtschaftlicher Entscheidungsprozesse und den Anreizen für Arbeitnehmer wie Manager zur Erhaltung des status quo.“
Marx-Kenntnisse sind nicht vonnöten, damit die europäischen Aufseher entdecken, daß ohne fixierten Klassengegensatz, ohne organisierte Lohnsenkung von echtem Privateigentum nicht die Rede sein kann!
Ungarn
schließlich hat Maßstäbe in der Konkurrenz der passiven Imperialisten um das Wohlwollen der europäischen Schutzmacht gesetzt, verdient in jeder Hinsicht das Kompliment vorbildlichen Gebarens: Konkurse und Betriebspleiten sind unter staatlicher Anleitung in beachtlichem Ausmaß organisiert worden. Beim Verkauf der Staatsbetriebe hat man demonstrativ nicht nach nationalen Lösungen gesucht, sondern den weitestgehenden Ausverkauf nationaler Unternehmen betrieben (begleitet von zahlreichen „Korruptionsaffären“, weil sie angeblich zu Dumping-Preisen veräußert wurden). Angesichts drohender Zahlungsunfähigkeit sind in einer letzten Privatisierungsrunde die Versorgungsbetriebe veräußert worden, so daß die Politik nun die spannende Aufgabe zu bewältigen hat, einerseits der Masse der Bevölkerung irgendwie Licht und Heizung zu ermöglichen, andererseits die Verdienstansprüche der Eigentümer zu bedienen[10] und drittens ihren Haushalt von den Lasten der Sozialzuschüsse zu entlasten.
Welche Techniken die Privatisierungsminister sich auch ausdenken mögen, sie treffen alle auf denselben Gegensatz: Große Teile des behaupteten Nationalvermögens werden dem Anspruch, sich als Kapital zu bewähren, nicht gerecht, folglich steht Brachlegen an – und das in Ausmaßen, daß Staaten ihre nationale industrielle Basis abhanden kommt. Aus dieser Notlage werden sie aber nicht entlassen, weil Europa genau das als Forderung gegen sie erhebt: Mit dem Anschlußprogramm ist der Gegensatz zwischen dem von Europa aus geltend gemachten Gebot, Konkurrenzschranken einzureißen, indem Staatsbetriebe aus dem „staatlichen Schutz“ entlassen werden, und dem Standpunkt nationaler Besitzstandswahrung institutionalisiert. Rücksichten auf den Erhalt nationaler Produktion, die Protektion nationaler Betriebe haben sich vor dem „acquis“ der EU zu rechtfertigen. Dabei kann Europa immer auch auf den Sachzwang verweisen, der von den „ungesunden“ Finanzen der Nationen ausgeht: Eine Staatsverschuldung zugunsten der kapitalistischen Umrüstung gefährdet den ohnehin fragwürdigen Nationalkredit der Staaten; andererseits werden Privatisierungserlöse aus Betriebsverkäufen dringend benötigt, um den Devisenverbindlichkeiten gerecht werden zu können. Im Fortgang des Experiments werden daher Zug um Zug nationale Vorbehalte aufgegeben, als strategisch angesehene Branchen „geöffnet“; um überhaupt Investoren zu gewinnen, wird immer weniger um den Verkaufspreis und die Verkaufskonditionen gestritten, was Investitionen und die Fortsetzung der Produktion betrifft.
Wo und wie auch immer Europa noch „verbliebene“ oder „versteckte Staatswirtschaft“ ausmacht, beim Fondseigentum, bei den NIFs, bei den Banken – der Vorwurf enthält den Zwang zum Bekenntnis, daß nationale Potenzen nicht zur Kapitalisierung taugen und daß die Nationen sich zu ihrer Annullierung zu entschließen haben. Diese negative Seite der Forderung nach Entstaatlichung tritt auch programmatisch auf; die EU-Kommission hat es nicht für überflüssig befunden, eigens die Forderung aufzustellen:
„Es darf keine nennenswerten Schranken für … das Ausscheiden aus dem Markt (Konkurs) geben.“
Die westlichen Befunde in Sachen „marode“ und „unrentabel“ stellen keinen Automatismus dar, sondern sind durch staatliche Hoheitsakte zu vollstrecken; und den Willen dazu traut man den Anschlußstaaten aus gutem Grund nicht ohne weiteres zu. Ausarbeitung und Vollzug von Konkursgesetzen sind ein eigenes Feld der kritischen Überwachung von seiten der europäischen Instanzen.
Derselbe Gegensatz wird auch auf der Ebene des Bankgeschäfts verfolgt. Daß die ebenfalls von der EU verlangte Privatisierung der Banken und die Anpassung an den Binnenmarkt, d.h. die Zulassung von Auslandsbanken, immer wieder zum besonderen Streitfall zwischen Transformationsländern und Aufsichtsinstanzen gerät, erklärt sich aus den heiklen Fragen, die damit verbunden sind: Die banktechnische Entscheidung über den Umgang mit „schlechten Krediten“ ist der Sache nach die Entscheidung über Erhalt oder Vernichtung nationaler Produktion; daß Regierungen sich vermittelt über ihre nationalen Banken ein Moment von Kontrolle darüber vorbehalten wollen, ist ebenso logisch wie ihre Annahme, daß die Konkurrenz von Auslandsbanken das Problem verschärft, indem sie „gute Kredite“ auf sich ziehen und die „schlechten“ den nationalen Banken überlassen. Diese Vorbehalte werden aber von Europa nicht geduldet, sondern, wie in der jüngsten tschechischen Krise, in die Phänomene „Filz und Wirtschaftskriminalität“ umgedeutet und als Auftrag, diese „Mißwirtschaft“ zu beseitigen, an die zuständige Regierung zurückgereicht. Auch hier sind, damit die Verpflichtung auf rentable Produktion durchgesetzt wird, Staatsakte gefordert.
Die Erfolge der Öffnung
Die europäische Begutachtung der Beitrittskandidaten endet in einer Reihe negativer Urteile: Stereotyp wiederholt sich die Kritik daran, daß „noch immer zu wenig Konkurse, zu wenig Arbeitslose“ zu verzeichnen sind.[11] Im Urteil der Agenda haben diese Länder „zu viel“ Landwirtschaft,[12] aber auch „zu viel“ Industrie!
„Industrie… problematisch bleiben die im Vergleich zu der noch immer unzureichenden Inlandsnachfrage große Überkapazitäten in einigen Sektoren.“
So läßt sich der Ruin, der dort angerichtet wird, noch als Argument gegen die Reste von Produktion anführen.[13] Die europäische Erschließung der Länder vollstreckt die negativen Urteile und führt zu einer weitflächigen Ruinierung der produktiven Grundlagen – die Zone stellt eine Art idealer Vorlage dar, dort hat die deutsche Staatsmacht perfekt zur Anschauung gebracht, wie das kapitalistische Grundgesetz der Rentabilität und seine heutigen standortpolitischen Maßstäbe als industrielle Brachlegung vollzogen werden. De-Industrialisierung – die auch bei den sogenannten „erfolgreichen“ Nationen stattfindet, bei den anderen erst recht – wird nicht nur als Wirkung der europäischen Konkurrenz besichtigt, sondern gleich auch noch als Rezept angeboten:
„Auch die Maschinenbauindustrie dürfte in der Lage sein, sich den Bedingungen nach dem Beitritt anzupassen, indem sie Produktionszweige im mittleren Technologiebereich abstößt und sich weiter auf einfachere, arbeitsintensive Ausrüstungen spezialisiert, zumal ihre Zukunft unter anderem davon abhängt, wie lange die Löhne niedrig gehalten werden können und wie rasch die Produktion gesteigert werden kann.“
Was für eine Sorte von Volkswirtschaften Europa damit perspektivisch herstellt, den Status, den es ihnen damit zuweist, nimmt die Agenda vorweg in ihrer vorurteilsfreien Begutachtung, was diese Länder Europa ökonomisch überhaupt zu bieten haben:
„Die beitrittswilligen Länder verfügen über bedeutende natürliche Ressourcen (landwirtschaftliche Flächen, bestimmte Mineralien, Artenvielfalt usw.). Für Verkehr, Energietransit und Kommunikation wird ihre geographische Lage ein Pluspunkt sein. Gleichzeitig wird von dem Erweiterungsprozeß ein erheblicher sektoraler und regionaler Anpassungsdruck ausgehen… In den beitretenden Ländern könnten die Belastungen, die durch den verstärkten Wettbewerbsdruck entstehen, anfangs weiter verbreitet sein und große Teile der Industrie in Mitleidenschaft ziehen, außerdem Landwirtschaft und Fischerei, Dienstleistungen und den audiovisuellen Sektor.“
Das funktionierende Geschäft ist zum größten Teil identisch mit auswärtiger Anlage (20% des gesamten tschechischen Exports verdanken sich z.B. VW-Skoda), und diese Anleger entdecken in der Hauptsache zwei geschäftstaugliche Posten in den Ländern: Rohstoffe und Arbeitskräfte, die enorm billig zu haben sind. Mit der Staatenkategorie, in die Europa seine Neuzugänge einstuft, Rohstofflieferanten und Billiglohnländer,[14] sind die Perspektiven der kapitalistischen Karriere auch in einer anderen Hinsicht relativ klar: Zwar können sie mit dem Kapital einer „grenznahen Produktion“ zum Binnenmarkt wuchern, etliche Lohnveredelungsgeschäfte sind z.B. aus Ostasien „zurück nach Europa“ geholt worden, andere vom Balkan zurück in Friedensgebiete; aber im Prinzip ist diese Kategorie von Staaten überreichlich bestückt.
Der Test, ob und wieweit aus den Staatsindustrien weltmarktfähige Unternehmen zu machen sind, ist im Europa-Programm nicht vorgesehen. Formell überlassen die europäischen Instanzen den Staaten samt ihrem Bankwesen die Entscheidung, wieviel an Betreuung und Kreditierung sie sich leisten wollen und können – aber auch auf dem Gebiet des Kredits steht fest, auf welche Schranken solche Versuche stoßen.
Das zweite Gebot der Qualifizierung zum Binnenmarkt: ein funktionstüchtiges Geldwesen
Die EU-Kommission teilt den Beitrittsländern schließlich auch mit, daß zu den verschiedenen „Bedingungen einer funktionierenden Marktwirtschaft“ gewisse Errungenschaften auf dem Gebiet des nationalen Geldes gehören:
„… makroökonomische Stabilität, einschließlich einer angemessenen Preisstabilität und tragfähiger öffentlicher Finanzen und Zahlungsbilanzen, muß erreicht sein.“
Von Europa aus zu dekretieren: ‚Schafft euch solides
Geld!‘ ist objektiv betrachtet ein Witz. Vom Standpunkt
der EU-Fachleute aber gar nicht; in Gelddingen nehmen sie
wiederum Maß an ihren funktionierenden Einrichtungen. Ihr
Dekret gilt einer Reihe notwendiger, von oben nach unten
durchdeklinierter staatlicher Maßnahmen: Einführung der
„Finanzdienstleistungen“ von Banken und Börsen, „Geld-
und Wechselkurspolitik“… Daß ein staatlich gedrucktes und
von Banken verliehenes Geld in der Wirtschaft
verdient und darüber in Wert gesetzt sein will, wird wie
eine automatische Folge der korrekten geldpolitischen und
geldtechnischen Maßnahmen behandelt. Wie es die
Reformstaaten überhaupt zu einer – in der Solidität eines
Geldes unterstellten – privaten und nationalen
Akkumulation bringen sollen, mit der Frage befaßt sich
die Kommission nicht; schon gar nicht damit, daß sie
dafür lauter negative Bedingungen setzt. Das
Resultat wird ihnen aber abverlangt als eine
weitere Bedingung ihrer Benützbarkeit. Der Gegensatz, daß
sich die Institutionen und Techniken des staatlichen
Geldschöpfens zwar mustergültig einrichten lassen, die
Qualität des Geldes aber von den Mitteln und
Möglichkeiten des Geldverdienens bestimmt wird, macht
sich dann allerdings bemerkbar.
Das Bankwesen: dauerhafter Betreuungsfall
Ein „Finanzsektor“ ist installiert worden, an Banken besteht kein Mangel, die Grenzgebiete sind mit Wechselstuben übersät, aber die von der EU verlangte Dienstleistung –
„der Finanzsektor muß hinreichend entwickelt sein, um die Ersparnisse produktiven Investitionen zuzuführen…“ –
läßt zu wünschen übrig. Wo sollen die „Ersparnisse“
schließlich auch herkommen, die das Bankgeschäft bei sich
zentralisieren und gewinnbringend verleihen soll. Wegen
eben derselben Fährnisse des nationalen Geldverdienens
trifft der Kredit auch auf wenig lohnende
Anlagemöglichkeiten, auf wenige Nachfrager, die
Geschäftserfolge vorweisen können. Je nachdem, ob
staatlicherseits Nachdruck auf gesunde Bankbilanzen oder
auf Erhalt nationalen Geschäfts durch fortgesetzte
Kreditierung gelegt wird, verlegen sich die Banken auf
solide Geschäfte, d.h. vorwiegend solche mit
Staatspapieren, und die Kreditierung der Betriebe
unterbleibt, oder es vermehren sich die nicht
zurückgezahlten Kredite
. Das Problem wird nicht ganz
zutreffend als ein Problem der Menge des Kredits
registriert und tautologisch in das Gebot zum Erfolg auch
in dieser Sphäre übersetzt: Inlandsersparnisse zu
gering
.
Daß die Gründung eines nationalen Geschäftslebens zu
großen Teilen Projekt ist und die erzielten Gewinne nicht
ausreichen, um das Kreditgebäude zu bedienen, schlägt
sich in regelmäßigen Bankenkrisen nieder;
„betrügerische“ und normale Bankrotte sind an der
Tagesordnung (ebenso wie deren Verwandlung in
Korruptionsskandale
, weil lauter
politische Entscheidungen über Abbruch oder
Weiterkreditierung der Bankgeschäfte und der Geschäfte
ihrer Klientel zu treffen sind). Zur Bekämpfung der
chronisch schlechten Qualität des Kredits verlangen die
europäischen Instanzen die Kopie der westlichen
Bankengesetze, was Aufsicht, Mindestreserven,
Einlagensicherung etc. angeht. Die Gesetze lassen sich
zwar beschließen, der Geschäftserfolg aber nicht. Die
Staaten müssen sich daher mit dem gefährdeten
Bankvermögen befassen; im Unterschied zum Umgang mit dem
produktiven Erbe gilt nämlich in dieser Sphäre das genaue
Gegenteil: keinesfalls Stillegung! Hier geht es um die
Herrschaft des Geldes, die unwiderruflich zu verankern
ist. Die Rechtskraft von unbedienten Schulden und
uneinbringbaren Forderungen muß gegen eine
unfähige produktive Grundlage aufrechterhalten, d.h. von
Staatsseite „gesichert“ werden: Durch Operationen wie den
Aufkauf von „schlechten Krediten“ durch den Staat,
versehen mit der Absichtserklärung, sie dereinst durch
Privatisierungserlöse zu tilgen, durch
Bankensanierungsprogramme und Bankfusionen wird neuer
Bankkredit gestiftet. Dessen Anwendung schafft von neuem
Sanierungsbedarf, so daß der „Finanzsektor“ die
staatlichen Hüter dauerhaft mit der Aufgabe konfrontiert,
die Kreditpleiten auf das Format von Einzelfällen zu
beschränken, und dafür die Staatsverschuldung
aufzublähen – nicht wegen der Ausdehnung lohnender
Geschäfte, sondern zur Rettung des Kredits. Weil es dabei
auch darum geht, das nationale Geldwesen als
Elementarbedingung für auswärtigen Zugriff zu sichern,
steuern Weltbank- und EU fallweise Kredite zur
Bankensanierung bei, und die EU-Banken übernehmen bei der
Privatisierung strategische Anteile an nationalen Banken.
„Tragfähige öffentliche Finanzen“
möchte die EU-Kommission bei den Anschlußländern trotzdem gewährleistet sehen, dabei haben diese Haushalte noch viel mehr zu leisten, als die Entwicklung einer Nationalökonomie zu fördern und das Bankwesen auf die Füße zu stellen.
Auf der einen Seite stehen nämlich außergewöhnliche Aufgaben, die sich daraus ergeben, daß die Bedingungen, die die kapitalistische Bewirtschaftung einer Nation unterstellt, überhaupt erst herzustellen sind – und das auf einem Niveau, das die EU mit ihren Anforderungen entscheidend mitdefiniert: eine Infrastruktur, wie sie der Binnenmarkt verlangt, ein Staats- und Beamtenapparat, wie sie die freie Marktwirtschaft verlangt, ein Militär samt Ausrüstung, wie es die Nato verlangt usw. usf… Diesen Aufgaben stehen Einnahmen gegenüber, die aus demselben Grund, daß Nationen mit der Gründung eines kapitalistischen Geschäftswesens befaßt sind, äußerst bescheiden ausfallen. So wird allen diesen Staaten der Kampf gegen die „Schattenwirtschaft“ aufgetragen, um ihr Steueraufkommen zu erhöhen. Bloß handelt es sich dabei um eine Sorte von „Unternehmen“, die, wenn sie gezwungen wird, Steuern zu zahlen, auch schon pleite ist; und dann ist eine Abteilung der vorgesehenen Gewinnerwirtschaftung schon wieder perdu.
Zur Bewältigung des grundsätzlichen Mißverhältnisses zwischen staatlichen Aufgaben und vorhandenen Staatseinkünften werden die Staaten auf die Techniken der Staatsverschuldung verwiesen und auch mit den Künsten der Verlagerung in Sonderhaushalte oder in die Zuständigkeit unterer Staatsinstanzen vertraut gemacht; in ihrem Fall wird die Fragwürdigkeit des Vorgriffs auf künftiges Geschäft allerdings auch gleich mit thematisiert. Nicht daß die EU in Rechnung stellen würde, daß es hier überhaupt erst um die Gründung von nationalem Geschäft geht, und das unter den Konkurrenzbedingungen, die sie diktiert; die Mahnung zur Vorsicht ergeht vielmehr im Hinblick auf längst vorhandene „Ungleichgewichtigkeiten“ der Finanzlage der Reformstaaten. Das Anschlußprogramm erläßt den Zwang zu einer dementsprechenden Staatsverschuldung und verlangt zugleich solides Haushalten, also das Kunststück, die bekannten negativen Wirkungen auf das nationale Geld möglichst nicht eintreten zu lassen, sie zumindest unter Kontrolle zu bringen.
Bei dieser Sorte Staaten fällt das Sortieren zwischen „produktiven“ und „konsumtiven“ Staatsausgaben folglich auch eher außergewöhnlich aus. Die europäischen Agenturen sind auch hier bei der korrekten Unterscheidung behilflich. Schließlich ist Europa in der Rolle des Kreditgebers und Gläubigers von Beginn an mitzuständig für die nationale Haushalts- und Geldpolitik.
Unter dem Gebot der Sparsamkeit müssen auch noch die
letzten Preissubventionen zugunsten der Reproduktion der
Massen entfallen, so daß die Verelendung aus den
geschäftsnotwendigen kapitalistischen Gründen kräftig
vorankommt. Um den Verfallsprozeß unter Kontrolle zu
halten – die einmal dagewesene und für die
Geschäftsprospektion vorgesehene Nützlichkeit des Volks
steht auf dem Spiel –, geraten Elemente von Sozialpolitik
ins politische Programm, deren Finanzierung durch die
Arbeitenden aber von vorneherein nicht machbar ist. Die
Beiträge der kapitalistisch benützten Bevölkerungsteile
fallen lächerlich aus und die absolute Überbevölkerung
viel zu groß. Deshalb ist hier der Sonderfall von außen
finanzierter Sozialstaatsleistungen zu verzeichnen: Die
internationalen und europäischen Kreditagenturen schießen
Kredit für Rentenzahlungen und Sozialkassen zu; als
flankierende Maßnahme für Privatisierungen und
„Umstrukturierungen“ legt die EU Sozialprogramme auf. Mit
der Begründung, daß es dabei um die Akzeptanz der
Reformen
geht, geben die Aufsichtsagenturen zu
Protokoll, daß mit den Völkern ein historisch
einmaliges Experiment veranstaltet wird: In wenigen
Jahren gilt es, die Karriere vom realsozialistischen
Werktätigen zum freien Hungerleider zu bewältigen. Der
unausweichliche Vergleich mit den alten Verhältnissen muß
abgedämpft werden, die Völker sollen politisch
berechenbar bleiben. So kommt der politische Grund des
Sozialstaats zur Sprache: Die staatliche Pflege gilt
nicht den Opfern des Systemwandels, sondern dem sozialen
Frieden, auf den sie verpflichtet werden.[15]
Diese „Hilfe“ entbindet die Staaten selbstredend nicht von der Notwendigkeit von „Reformen“, und die EU-Kommission klagt in allen Fällen über „Reformstau“. Auch diesen Staaten, in denen nur ein Bruchteil der Bevölkerung, und das anerkanntermaßen als Billiglöhner, produktiv angewandt wird, wird das genialische Rezept vorgeschlagen, die Bevölkerung zunehmend auf die Perspektive einer privaten Versicherung festzulegen. Auf diesem Weg sollen sich die Staaten von unbezahlbaren Haushaltsposten entlasten,[16] schließlich gibt es wichtigere, für die diese Staaten ihre fragwürdigen Staatsschulden vermehren müssen. Auch da wird das Mißverhältnis der Aufgaben zu den Staatsfinanzen von Europa anerkannt: Funktionen, auf deren zuverlässige Erfüllung die EU Wert legt, dürfen nicht dem Risiko der nationalen Finanzkraft anheimgestellt werden; im Rahmen von PHARE und anderen europäischen Förderprogrammen werden Kredite und Zuschüsse auch für andere Haushaltsposten zur Verfügung gestellt.
Instabile Nationalkredite als Kandidaten für den Stabilitätspakt
Schließlich erwartet Europa von den Beitrittskandidaten auch, daß sich ihre nationalen Gelder im internationalen Vergleich bewähren:
„– makroökonomische Stabilität, einschließlich einer angemessenen Preisstabilität und tragfähiger Zahlungsbilanzen…“
lautet die Zielvorgabe, mit der die EU dekretiert, daß sie die Defekte behoben sehen möchte, die sie kennt.
Außer der Tschechoslowakei und Rumänien sind alle Reformstaaten schon mit dem Erbe des ehemaligen Osthandels als Schuldnerstaaten zu ihrer neuen Karriere angetreten, ein Status, der sich durch ihre Einordnung in die Weltmarktkonkurrenz nun bei allen zur Normalität verfestigt hat. Handelsbilanzdefizite, das Produkt erfolgreicher Exportoffensiven auswärtigen Kapitals angesichts weniger gut gelingen wollender eigener Exporte, sind die Regel. Der Ausgangspunkt, daß die Staaten ihre internationale Zahlungsfähigkeit nicht garantieren können – der Eintritt in den Weltmarkt ist mit stand-by-Krediten des IWF und der dementsprechenden Aufsicht organisiert worden –, ist dank der geschäftlichen Benützung, die ihnen zuteil wird, dauerhaft fixiert; sie bleiben auf internationalen Kredit und die Anerkennung ihrer Kreditwürdigkeit verwiesen. Auch auf dieser Ebene, dem Vergleich internationaler Geldanlage, werden die Länder also – zwar mit gewissen Garantien von europäischer Seite, der erklärte Zugriffswille der EU und die EU-Kreditierung stellt auch für die Spekulation ein besonderes Datum dar – der Konkurrenz ausgesetzt, indem ihre nationalen Gelder der Bewertung der Finanzmärkte anheimgestellt werden.
Es wird auch auf sie spekuliert, allerdings angesichts bescheidener „solider“ Geldquellen nur auf wenige „Blue Chips“ – um den Zetteln der verschiedenen Privatisierungsmanöver eine Kursbewegung zu verleihen, ist sich das „venture-capital“ der Finanzwelt in der Regel zu schade –, d.h. in erster Linie auf die Staatsschuldtitel. Die dabei getroffenen Entscheidungen fassen die Spekulanten als „erratische Bewegungen“ zusammen, machen daraus einen Vorwurf an das von ihnen selbst fabrizierte Börsengeschäft[17] und lassen sich ihre Skepsis mit besonderen Zinsraten zahlen. Auf diese Weise steigern sie ihre Ansprüche auf Reichtum, der dort gar nicht verdienten wird, steigern also bloß die Auslandsverbindlichkeiten der Staaten.
Das Urteil der Geldmärkte faßt das Mißverhältnis zwischen den wenigen soliden und beständigen Geldquellen der Nationen gegenüber einer staatlichen Geldschöpfung, die aus ihren unabweisbaren Notwendigkeiten heraus wachsende Geldmengen in die Welt setzt, zusammen im Urteil über die relative Geschäfts(un)tauglichkeit ihrer Gelder: Sie stellen die Nationalbanken immer wieder einmal auf die Probe, wie lange sie mit ihren Devisenreserven für einen Währungskurs geradestehen können, und haben einige aktuelle Währungskrisen und drastische Abwertungen zustande gebracht. Polen und Ungarn bewähren sich im Management von „Weichwährungen“ und nehmen regelmäßige, für die Geschäftswelt berechenbare Abwertungen vor, um das nationale Geld als Geschäftsartikel im Angebot zu halten. Der Nationalstolz der Regierung Klaus, seit der Abwertung der Krone zu Beginn der Transformation einen festen Kurs gegenüber Dollar und DM eingehalten zu haben, ist seit Sommer 97 zurechtgestutzt worden. 95 stand Ungarn vor dem Staatsbankrott, der durch IWF- und europäischen Kredit abgewendet und in die Normalität eines Schuldnerstaats zurückgeführt wurde. In einigen Fällen existiert eine auswärtige Zahlungsfähigkeit nur in Gestalt von IWF-Krediten, und den Nationen wird die gänzliche Untauglichkeit ihres Geldes bis hin zum Entzug der Währungshoheit bescheinigt: Bulgarien hat es zum offiziellen Staatsbankrott und Zusammenbruch der inneren Zirkulation gebracht und steht seitdem unter der Verwaltung eines currency boards.[18]
Die Krönung des Anschlußverfahrens besteht nun darin, daß die EU-Kommission eben diesen Staaten, deren Erfolge auf dem Gebiet der Geldqualität in mehr oder weniger stabilen „Weichwährungen“ bestehen, die Perspektive eröffnet, mit ihrem Beitritt die Bestimmungen des europäischen Stabilitätspakts erfüllen zu müssen:
„Alle Mitgliedstaaten, einschließlich der neu beigetretenen Länder, nehmen in vollem Umfang an der Wirtschafts- und Währungsunion teil. Sie betrachten ihre Wirtschaftspolitik als eine Angelegenheit von gemeinsamem Interesse und koordinieren sie (nationale Konvergenzprogramme, Grundzüge der Wirtschaftspolitik, multilaterale Überwachung, Verfahren bei einem übermäßigen Defizit). Sie müssen sich an das Bündnis für Stabilität und Wachstum halten… Schließlich müssen alle Mitgliedstaaten ihre Wechselkurspolitik als Angelegenheit von gemeinsamem Interesse betrachten und in der Lage sein, ihre Wechselkurse nach einem noch zu beschließenden Mechanismus stabil zu halten.“
Es ist nicht so, daß die EU-Kommission nicht wüßte, was für staatliche Finanzverhältnisse sie vor sich hat; sie deutet die Wirkungen des Währungsvergleichs, die sich in Inflationsraten und Abwertungen ausdrücken, nur eben in „Instrumente“ um, auf die die Anschlußkandidaten möglicherweise nicht so schnell verzichten können:
„Während des Aufholprozesses lassen sich Kompromisse zwischen Wechselkursstabilität und Preisstabilität nicht vermeiden. Die Wechselkursstabilität und der Verlust des Wechselkursinstruments können daher für einige Beitrittsländer eine zu große Einschränkung darstellen… In der Tat sind Konzepte wie langfristige Zinssätze und Haushaltsdefizite in den Reformländern nicht unbedingt mit jenen reiferer Marktwirtschaften vergleichbar.“
Dennoch – der Gebrauch dieser „Instrumente“ darf sich nicht störend bemerkbar machen:
„Auch als nichtteilnehmende Mitgliedsstaaten müßten die Beitrittsländer imstande sein, störende Ausschläge der nominalen Wechselkurse und Misalignments zu vermeiden.“
Von Staaten mit einem anerkannt wackligen Nationalkredit, für ihren Verschuldungsbedarf von der EU auf die internationale Finanzwelt verwiesen und umgekehrt von der periodisch auf die Probe gestellt, wieviel Devisenreserven die Nationalbanken überhaupt zur Verteidigung eines Wechselkurses opfern können – von eben diesen Staaten fordert die EU das Kunststück „stabiler Wechselkurse“, „sinkender Inflations- und Zinsraten“. Indem Europa ihnen die Erfüllung des acquis auch in den geld- und währungspolitischen Vereinbarungen auferlegt, schafft es sich neue „Mitglieder“ im europäischen Währungssystem, die von Beginn an als Problemfälle eingestuft sind. Als Staaten, die kaum die vorgesehenen Pflichten von WWU-Mitgliedern erfüllen können, dürfen sie sich in die Peripherie des „harten Kerns“ der Staaten einreihen, die mit dem Euro den entscheidenden europäischen Kredit herstellen wollen und über das Recht verfügen, den weniger tüchtigen Mitgliedern Europas ihre Rechte und Pflichten zuzuteilen.
Die Unterbringung der Neuzugänge im Wirtschaftsbündnis
Gemessen am Geld wie auch an allen anderen Indizien einer „Binnenmarkttauglichkeit“ handelt es sich bei den Beitrittskandidaten um Fälle, in denen nach dem Urteil der EU-Kommission einiges an kapitalistischer Entwicklung „aufzuholen“ ist – diesen Befund verhandelt die EU aber vornehmlich in ihrem internen Streit um die „Lasten“.[19] Die heutige EU lehnt das alte Verfahren ab, mit Erschließungs- und Förderprogrammen die neuen Mitglieder zu brauchbaren Wirtschaftspartnern aufzurüsten. Stattdessen werden die Neuzugänge im Rahmen des gültigen Regelwerks als künftige Kostgänger der EU-Institutionen verhandelt, deren Ansprüche auf EU-Fonds zu begrenzen sind. Zum einen steht fest, daß die Erweiterung ohne eine Aufstockung des Gemeinschaftshaushalts, ohne Erhöhung des Struktur- und Kohäsionsfonds bewerkstelligt werden soll – das anspruchsvolle Programm eines europäischen Geldes wollen sich die Zuständigen nicht durch zusätzliche Ansprüche an europäischen Kredit beeinträchtigen lassen. Aus demselben Grund hat die EU-Kommission beschlossen, daß die europäische Agrarpolitik einer Grundsatzreform bedarf.[20] Zum anderen besteht Europa bei seinen bisherigen „Heranführungshilfen“, PHARE u.a., mit denen die Ausrichtung der Staaten auf die EU untermauert und für eine elementare Grundausstattung nach EU-Bedarf gesorgt wird, ebenso wie bei der künftigen Inanspruchnahme von EU-Fonds auf Garantien, daß seine Gelder nicht versickern.[21] Finanzielle Zuwendungen werden an die Erfüllung weiterer Pflichten gebunden,[22] darüberhinaus sehen die bisherigen Unterstützungsprogramme ebenso wie die regulären Gemeinschaftsfonds die Bedingung vor, jede Inanspruchnahme durch einen Prozentsatz von Eigenmitteln zu rechtfertigen. Schließlich soll das künftige Anrecht auf EU-Gelder 4 Prozent vom vorhandenen BIP nicht überschreiten dürfen – eine Regel, die nur zum Besten der betreuten Staaten erdacht worden ist, weil sie mehr einfach nicht verdauen könnten:
„Um größere Absorptionsprobleme zu vermeiden, sollte das Niveau der jährlichen Hilfe allmählich erhöht werden, wobei der allgemeine und insgesamt auf die Strukturfonds und den Kohäsionsfonds anzuwendende Plafond von 4% des nationalen BIP anzuwenden ist.“ [23]
Der Standpunkt, daß eine florierende Marktwirtschaft
schon vorhanden sein müßte, damit man Zuschüsse für
lohnend befinden kann – das ist der
„Entwicklungs“standpunkt, den das heutige Europa
gegenüber seinen Neuzugängen einnimmt. So unverfroren
geht die EU mit ihren Kriterien zu Werk, reicht das von
der Kommission ausgemachte große wirtschaftliche und
soziale Gefälle
als Problem, das die Kandidaten im
wesentlichen selbst zu bewältigen haben, an sie zurück,
verhandelt die Ansprüche, die sie nach dem Regelwerk des
Bündnisses anmelden dürften, aber als Problem, um das
sich die EU kümmern muß, und führt dementsprechend neue
Beschränkungen ein. Zu den faux frais der Erweiterung, zu
der Tatsache, daß der europäische Zugewinn ganz ohne
Zuschüsse nicht zu haben ist, stellt sich die EU wie zu
einer Last, die sie sich auflädt, und läßt die
interessierte Öffentlichkeit an diesen Sorgen teilnehmen.
Auf diese Weise setzt die Union einen neuen Status für europäische Länder in die Welt, der sie zum bündnis-internen Hinterhof befördert. Auf ihren minderen Grad von Geschäftsfähigkeit festgelegt, auf europäische Fördermittel angewiesen, müssen sich die neuen Mitglieder für jedes europäische Geschäftsinteresse anbieten, für jeden EU-Bedarf zur Verfügung stehen. Die Vertreter der Anschlußstaaten legen trotz gewisser Momente von Enttäuschung keinen Widerspruch ein;[24] man hat sich damit eingerichtet, daß es zur Unterordnung unter die Union keine Alternative gibt, und die Perspektiven, die die EU bereithält, das beste sind, was man bekommen kann:
„Furcht vor einem neuerlichen Souveränitätsverlust, vor einem Wechsel der „Befehlszentrale“ von Moskau nach Brüssel, besteht bisher in den meisten Ländern kaum. Zum einen sei der freiwillige Beitritt ein Akt der Souveränität, zum anderen sei man wegen des eigenen geringen Gewichts und der hohen Außenhandelsverflechtung mit der EU von den Brüsseler Entscheidungen ohnehin betroffen. Da sei es besser, meinte der für Integrationsfragen zuständige ungarische Vize-Staatssekretär Gottfried, als Mitglied seine Interessen selbst vertreten zu können.“ (NZZ 11.12.97)
Die EU etabliert sich als europäische Ordnungsmacht
Anhängern einer europäischen Wirtschaftsmacht mag es
widersinnig vorkommen, Staaten, die nicht allzuviel zum
Euro-Markt beizutragen haben, die umgekehrt als
Zuschußbetrieb Europas verhandelt werden, ins Bündnis
aufzunehmen. Das Unternehmen hat ja auch seine grotesken
Züge, wenn dieselbe EU, die traditionsreichen
Mit-Europäern mit den Maastricht-Kriterien etliche Jahre
hindurch das Recht auf Beteiligung am Euro bestritten
hat, Staaten von ganz anderer zweifelhafter Verfassung
nun unbedingt in die WWU aufnehmen will. Bedenken dieser
Art werden aber offiziell als deplaziert abgewiesen.
Schließlich ist allen Beteiligten klar, daß es bei der
Angliederung um weit mehr als um die Ausdehnung des
Binnenmarkts nach Osten geht. Ihr Vorhaben, das die
EU-Vertreter in Anknüpfung an die traditionsreiche
Verwechslung von Wirtschaftsverkehr mit Hilfe damit
kennzeichnen, daß es keine Armutsgrenzen in Europa
darf
, ist in seiner Substanz, gewußt, gemeint und
programmatisch angezettelt, europäische
Ordnungspolitik. Nicht nur die Marktordnung wird
nach Osteuropa exportiert, sondern Europa etabliert sich
im Zugriff auf diese Länder als Ordnungsmacht. Insofern
stellt deren durch den Systemwechsel bewirkte staatliche
Armut geradezu eine Chance dar, über den bisherigen
Status als Wirtschaftsbündnis, der den Europa-Führern
sowieso schon zu eng und zu beschränkt ist,
hinauszugehen:
„Die Erweiterung um die mittel- und osteuropäischen Länder und Zypern ist für die Union ein Unterfangen von historischer Bedeutung, aber auch eine Chance für Europa, seine Sicherheit, seine Wirtschaft, seine Kultur, seinen Platz in der Welt. Die Ausdehnung des Modells der friedlichen und gewollten Integration freier Nationen auf den gesamten europäischen Kontinent ist ein Garant für Stabilität… Auch auf der internationalen Bühne gewinnt die Union durch den Beitritt neuer Mitgliedsstaaten an Gewicht und Einfluß.“
Bei seinem Vorstoß in eine neue Dimension europäischer Politik knüpft der selbstbewußte Euro-Imperialismus einerseits an seine bisherigen Verfahrensweisen an, bedient sich seiner Institutionen und seines Gewichts als Wirtschaftsbündnis gegenüber den Anschlußkandidaten wie gegenüber Dritten für den Übergang zur dominierenden Vormacht in Europa. Deshalb ist es andererseits bei der Herrichtung der Kandidaten zur Europa-Tauglichkeit mit der Übernahme des acquis in ökonomischer Hinsicht noch nicht getan, sie müssen auch in allen anderen Hinsichten zum funktionellen Bestandteil der neuen politischen Größe Europa gemacht werden.
Die Ost-Erweiterung als eine Etappe der Entmachtung Rußlands
Daß sich Europa mit seiner Erweiterung gegen andere Mächte als Block mit exklusiver Zuständigkeit für den Kontinent etabliert, würdigen die europäischen Festreden als großen historischen Fortschritt:
„‚Die Erweiterung der Europäischen Union wird eine historische Herausforderung und der Beginn einer neuen Ära in Europa sein, welche die Spaltungen der Vergangenheit beendet‘… Wegen der Teilung Europas war die Integration bisher weitgehend auf den Westen des Kontinents beschränkt. Insofern war dieser Prozeß, dessen historisch-politischer Kern die deutsch-französische Aussöhnung war, bisher stets vorläufig und unvollständig…“ (FAZ 13.12.97) [25]
Daß das politische Subjekt von Jalta, das „den Kontinent gespalten“ hat, die Sowjetunion, aus der Weltgeschichte verschwunden, ganz Europa heutzutage von „freien Nationen“ bevölkert ist und auch das heutige Rußland sich zum richtigen System bekennt, zählt nicht – die Aussöhnung, um die es angeblich in Europa geht, macht vor dieser Grenze ziemlich grundsätzlich halt. Die Machterweiterung der EU, mit der sie sich die Vorherrschaft über den Kontinent verschafft, ist darauf berechnet, Rußland aus der europäischen Sphäre auszuschließen. Die EU erhebt Anspruch auf die unmittelbaren „Nachbarn“, Polen, Tschechien und Ungarn, als Glacis, das insbesondere Deutschland aus seiner „Grenzlage“ befreit; sie rechnet strategisch weitergehend auf sämtliche ehemaligen Bündnispartner der Sowjetunion, darüberhinaus auf die ehemaligen baltischen Sowjetrepubliken sowie auf den Balkan-Vorposten Slowenien:
„Die erweiterte Union wird in zunehmendem Maße eine gemeinsame Grenze mit Rußland, der Ukraine, Belarus und der Republik Moldau haben. Außerdem erhält sie einen Zugang zum Schwarzen Meer, was zu engeren Kontakten mit den Ländern des Kaukasus und Zentralasiens führen wird. Die russische Enklave von Kaliningrad wird vom Gebiet der Union umschlossen werden, und mehrere Hunderttausend ethnische Russen, vor allem in Estland und Lettland, werden Bürger der Union. Es ist wichtig, daß die erweiterte Union ihre Beziehungen zu Rußland, der Ukraine und den anderen NUS auf der Basis der Partnerschafts- und Kooperationsabkommen festigt. Zu den neuen Nachbarn der Union gehören auch die Balkan-Staaten. Mehr Stabilität in dieser Region durch eine verstärkte Zusammenarbeit wird daher für die Union ein wichtiges Ziel sein.“
Mit seiner Ausdehnung bis an die russische Grenze bestreitet Europa Rußland jeden verbliebenen Einfluß und besondere Rechte in diesem Staatengürtel, signalisiert aber zugleich ein Interesse an ganz viel „Zusammenarbeit“. So wird die Doppeldeutigkeit der EU-Osterweiterung, die auf einmal wieder gar nichts anderes sein soll als nur ein bißchen Freihandel, berechnend gegen Rußland in Anschlag gebracht: Man beruft sich auf die russischen Interessen an wirtschaftlicher Zusammenarbeit und einem Zugang zum europäischen Markt, um mit einschlägigen Angeboten und Verhandlungen russische Einwände gegen die Erweiterung abzublocken. Während die EU den Ausschluß russischen Einflusses auf Osteuropa vorantreibt, deklariert sie ihre Erweiterung als „offenen“ Prozeß, in dessen Rahmen sich auch Rußland Hoffnung auf eine EU-„Perspektive“ machen darf, was verständlicherweise wegen der Größe des Landes und der Größe seiner Probleme seine Zeit braucht… So legt die europäische Diplomatie den russischen „Partner“ auf die ökonomische Sichtweise fest, um den Vorstoß in der anderen Bedeutung abzusichern. Mit dem Beschluß, die baltischen Staaten in die EU-Erweiterung einzubeziehen, greift Europa schließlich auf die vom heutigen Rußland als „nahes Ausland“ eigens definierte Interessensphäre über. Es schafft sich einen Präzedenzfall für das europäische Recht, sich in die Neuordnung der Staatenwelt der früheren Sowjetunion einzuschalten, und baut sich als gewichtiger Partner von Staaten auf, die ihrerseits Konflikte mit Rußland austragen und russische Interessen bestreiten. Deshalb legt Europa großen Wert auf die Form und hat so viel an „Wirtschaft“ in diese Küstenstreifen hineinorganisiert, um ihnen seine Anerkennung und Bewunderung dafür nicht absprechen zu können, daß sie sich doch glatt in die Nähe einer Erfüllung der Maastricht-Kriterien hochgearbeitet hätten.[26]
Daneben stellt die EU ihre Erweiterung ins Verhältnis zu dem anderen Ausschluß Rußlands, der vermittels der Nato organisiert wird: In der Darstellung der europäischen Diplomatie figuriert sie als das Projekt, auf das es den Europäern in erster Linie ankommt, gemessen an dem sich die Nato-Erweiterung fast wie eine Nebensache ausnimmt. In diesem Sinn haben die guten Europäer Rußland dann abverlangt, sich die angestrebten guten Beziehungen zur EU nicht durch eine Ablehnung der Nato-Erweiterung zu verderben, und sich so mit einer eigenen Erpressungsleistung für den Nato-Vorstoß nützlich gemacht.[27]
Anhänger einer europäischen Weltmacht leiden gerne am komplizierten Vorgehen der EU und halten deren Außenpolitik für unentschlossen und schwächlich – im Vergleich mit einer fertigen Weltmacht nehmen sich die Fortschritte, die ein Bündnis mit seinem Einigungsbedarf in Angriff nimmt, schließlich auch etwas anders aus. Vor lauter Ambition entgeht dieser Kritik allerdings der Sachverhalt, wie erfolgreich die EU mit ihrer Doppel- und Vieldeutigkeit operiert: Sie stellt ihre Angebote als Wirtschaftsbündnis in den Dienst ihrer strategischen Ausweitung, Staaten in der Doppelrolle von Nato- und EU-Mitgliedern befördern beide Erweiterungen, gegenüber Rußland wird der eine große europäische Markt als Perspektive ins Feld geführt und von seiten Frankreichs auch mit einer anti-amerikanischen Note versehen, gegenüber den USA wiederum wird der Ausbau der EU als Dienst an der auch von den USA gewollten europäischen Neuordnung vorgestellt.
Atlantische Partnerschaft
Die EU bemüht sich um die Zustimmung der USA zum Aufbau
einer konkurrierenden europäischen Ordnungsmacht, indem
sie auf den doppelten Nutzen ihrer Erweiterung für die
US-Weltordnung verweist. Für die antirussische Neuordnung
Europas, den „Export von Stabilität“ nach Osteuropa,
liefert die Einbeziehung der Staaten in die EU ein
solides Fundament; und ein europäisches Wachstum als
Motor der Weltwirtschaft muß den USA auch recht sein. Im
Namen ihrer Interpretation begrüßen die USA das Projekt,
Clinton drängt die Europäer zur raschen Erweiterung
ihrer Union
:
„Ein geeintes Europa, das seine internen Barrieren abbaut, ist eine gute Sache für Europa, eine gute Sache für die Vereinigten Staaten und deshalb eine gute Sache für die Welt. Ein wohlhabenderes Europa wird ein stärkeres Europa sein – und ein stärkerer Partner Amerikas.“ (FAZ 30.5.97)
Aus ihren ordnungspolitischen Gründen stellen sich die USA hinter die EU-Erweiterung, machen auch ihre Einwände gegen die Konkurrenztechniken des europäischen Wirtschaftsblocks nicht zum Argument gegen dessen Erweiterung, sondern tragen sie im Rahmen der WTO aus. Sie melden selber Forderungen an, nach denen die EU die baltischen Staten und die Türkei aufnehmen soll, und behandeln die EU in diesem Sinne als ihr strategisches Instrument. Daß die USA den Gesichtspunkt der Mächtekonkurrenz dabei nicht übersehen, sondern mit ihren strategischen Prioritäten exekutieren, machen sie freilich auch deutlich. Auch wenn Europa seine Macht ausdehnt – an der „Partnerschaft“ mit den USA kommt es nicht vorbei. Die USA warnen vor der Gefahr, daß Rußland Amerika aus Europa herausdrängen möchte, und erinnern Europa angesichts dieser „Gefahr“ an seine Schutzmacht, ohne die es seinen Bestand nicht eigenständig sichern kann:
„Ein stabiles, sich vereinigendes Europa, das gleichzeitig stabile und kooperative Beziehungen zu Rußland unterhält, kann nur ein atlantisches Europa sein… Wenn Europa aus dem Atlantischen Bündnis austräte, würde es sich sofort wieder in jener strategisch ungünstigen Lage befinden, die es einmal zu einem Protektorat hatte werden lassen. Daraus folgt, daß die Erweiterung der Nato und die der Europäischen Union der einzige und beste Weg sind, Europa vom Protektorat Amerikas zu seinem echten Verbündeten werden zu lassen.“ (Brzezinski, FAZ 10.11.97)
Der Verweis auf die „strategisch ungünstige Lage“, wegen der Europa nur als „atlantisches Europa“, d.h. in einem kooperativen Verhältnis zu den USA funktionieren „kann“, macht die EU in unmißverständlicher Weise auf das Kräfteverhältnis aufmerksam: Auf dem Umweg über die russische Gefahr teilen die USA Europa mit, daß sie in ihrer Rolle als Militärmacht Nr. 1 und als Führungsmacht der NATO die Oberaufsicht auch über Europa weiterhin beanspruchen.
Die europäischen Mächte stellen den militärischen Rahmen der Nato nicht in Frage – d.h. Deutschland und England weisen einschlägige französische Anträge regelmäßig zurück –, betreiben vielmehr deren Funktionalisierung in ihrem, der US-Rechnung entgegengesetzten Sinn. Sie wollen die Nato als militärischen Unterbau, als Absicherung für ihr Projekt einsetzen, d.h. für eine Politik, die sich zwar manchmal so darstellt, als wollte sie nur einen Club von Kapitalisten organisieren, die aber als Staatenbündnis den Kontinent strategisch umsortieren will – mit und in Konkurrenz zur Nato. Auch der Union geht es um die strategische Zuständigkeit für den Kontinent.
Die Einbindung aller mittel- und osteuropäischen Staaten in das Nato-Programm „Partnership for Peace“ und den Beitritt Polens, Ungarns und Tschechiens zur Nato haben daher auch die europäischen Mächte betrieben. In der anti-russischen Stoßrichtung sind die Interessen von EU und Nato deckungsgleich, so daß sich beide Organisationen wechselseitig heftig zu ihren Fortschritten beglückwünschen. In ihrer Rolle als EU-Führer negieren die europäischen Staatschefs die Nato-Erweiterung nicht, verpassen ihr aber die umgekehrte Lesart, nach der die Nato ihren Weg zur europäischen Vormacht absichern soll. Auch für ihre EU-Erweiterung setzen sie auf die Nato: Wenn sie sich, nicht gerade konfliktscheu, das Abenteuer eines eigenmächtigen Vorgehens im Baltikum erlauben, rechnen sie dabei durchaus auf den strategischen Rückhalt der Nato.
Gleichzeitig stellt sich die EU mit ihrer Erweiterung
auch konkurrenzlerisch zur Nato, betont die Differenz
berechnend gegenüber Rußland und betreibt sie im
Verhältnis zur Nato-Diplomatie gegenüber den
Beitrittsstaaten: Sie hat sich beeilt, mit ihrer
Erweiterung nicht hinter die Nato-Fortschritte
zurückzufallen, nachdem die USA einmal beschlossen
hatten, sich mit der Nato-Erweiterung an die Spitze der
europäischen Neuordnung zu setzen. Auch wenn sich die EU
immer ins Verhältnis zur Nato und deren Führungsmacht
setzen will und muß, kommt es ihr auf die
ausschließende Definition der Ausrichtung dieser
Staatenwelt, auf deren Inbeschlagnahme für die neue
politische Größe Europas an. Europa verfolgt die
Doppelstrategie, die NATO zu funktionalisieren
und Differenzen zu ihr aufzumachen, ohne es
dabei aber zu einem Gegensatz zur Führungsmacht USA
kommen zu lassen. Im Rahmen des militärischen Bündnisses
wirkt es auf Eigenständigkeit hin; die Formel lautet:
Schaffung einer Europäischen Identität in Sicherheits-
und Verteidigungsfragen im Rahmen der Atlantischen
Allianz
. Die WEU ist in die Nato „integriert“, wird
aber auch als militärischer Arm der EU in Betracht
gezogen – eine Entscheidung darüber wird absichtlich
offengehalten:
„Dies bedeutet, daß die Frage einer Kongruenz von EU-, WEU- und Nato-Mitgliedschaft nach wie vor eine offene und heikle Frage ist, deren Beantwortung auch die angestrebte Eingliederung der WEU in die EU beinflussen könnte.“
Auch die Verschränkung, daß die neuen Nato-Mitglieder zugleich auch in der EU und WEU unter europäischer Führung organisiert sind, enthält ein Moment von Ausgrenzung des US-Einflusses in der Nato. Und ebenso ist die Nicht-Deckungsgleichheit ein Schritt in Richtung auf eine exklusive europäische Ordnungsmacht: Die EU verschafft sich neue Mitglieder auch ohne Mitgliedschaft in der Nato, betätigt sich mit der Auswahl der Beitrittskandidaten Estland und Slowenien als Ordnungsmacht auch über den Kreis der Nato-Zugänge hinaus.
Die Herrichtung der freigesetzten Nationen zu Funktionären einer europäischen Außenpolitik
Die strategische Betrachtung Europas, die Definition von Konfliktgebieten, um die sich die Euro-Politiker kümmern müssen, überlassen sie keinesfalls der Nato, bzw. sich selbst in der Nato. Die Europäische Union selbst kalkuliert geopolitisch und befaßt sich mit Resteuropa als Krisengebiet und Ordnungsaufgabe:
„Die geopolitische Lage der EU und ihre Nähe zu Krisengebieten in Ost- und Südeuropa wird sich infolge der Erweiterung ebenfalls ändern.“
Das neue Beitrittsgebiet wird strategisch als Raum betrachtet, für den die EU zuständig ist und der darüberhinaus neue Zuständigkeiten begründet. Deswegen werden die neuen Partner über das Genörgel an ihren rückständigen Wirtschaften hinaus noch in ganz anderer Hinsicht kritisch durchgemustert. Der Blick auf den in eine imperialistische Ordnung erst zu überführenden Raum schließt den außenpolitischen Blick auf die Staaten ein, und der ist sehr anspruchsvoll:
„Bilaterale Auseinandersetzungen, an denen Beitrittskandidaten beteiligt sind, und Probleme im Zusammenhang mit nationalen und ethnischen Minderheiten könnten den Zusammenhalt der EU und ihre GASP (Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik) belasten. Eine Zuspitzung dieser Probleme könnte unabhängig von der Erweiterung eine Gefahr für die Sicherheit der EU darstellen. Der Erweiterungsprozeß dürfte eine Chance bieten, positive Lösungen für Probleme zu finden, die für die Sicherheit ganz Europas eminent wichtig sind.“
Als erstes wird ihnen eine eigenständige Außenpolitik in östlicher Richtung verboten. In dieser negativen Zuordnung fällt das EU-Interesse ganz mit dem der Nato zusammen und definiert das
Verhältnis zur abgedankten Führungsmacht Rußland.
Von den Erweiterungskandidaten wird die tätige Absage an die Hinterlassenschaften von RGW und Warschauer Pakt verlangt, die Umrüstung zu Nato-kompatiblen Partnern; von ihnen werden selbstverständlich die nötigen Anstrengungen erwartet – gleichgültig, welche Sparhaushalte sie aus anderen Gründen vorzulegen haben.[28] Die Vorschriften werden von einigen Nationen begeistert, als Gelegenheit zur politischen Aufwertung gegenüber der alten Vormacht, von anderen, deren Ambitionen in andere Richtungen gehen, eher pflichtschuldig wahrgenommen – die ärgerliche Ausnahme bildet wiederum die Slowakei,[29] deren Chef sich allen Ernstes die Illusion geleistet hat, die Nato-Assoziation mit der Beibehaltung guter Beziehungen im Osten vereinbaren zu können. Die Politik einer „wohlwollenden Neutralität“ gegenüber Rußland verstößt aber gegen Sinn und Zweck der neuen europäischen Friedensordnung:
„Insgesamt ist die slowakische Außenpolitik sowohl durch eine gewisse Selbstüberschätzung ihrer nationalen Möglichkeiten, als auch durch eine spezifische Form eines an Wunschvorstellungen orientierten Doppeldenkens orientiert… veranlaßt sie eine gewisse Selbstüberschätzung zu vorsichtigen Versuchen einer Art taktischer Schaukelpolitik zwischen Ost und West.“ (Weidenfeld a.a.O., S.173ff)
Linientreue ist zweitens im
Fall Jugoslawien
im Einklang von EU- und Nato-Politik verlangt und auch abgeliefert worden. Auch wenn es sich im Ausgangspunkt für die betreffenden Nationen wegen ihrer guten Beziehungen zu Jugoslawien überhaupt nicht von selbst verstanden hat, sich in die anti-serbische Koalition einzugliedern, hat dann doch im Verlauf des Jugoslawienkonflikts keiner dieser Staaten (mit Ausnahme der Slowakei) die Gelegenheit ausgelassen, europäische Zuverlässigkeit zu demonstrieren – auch wenn das abgestellte Kontingent zum Friedenseinsatz in Bosnien bescheiden ausfallen mochte. Ungarn hat seine bis dahin betriebene – mit Rücksicht auf ungarische Bevölkerungsteile in Serbien auf Einvernehmen berechnete – Politik zugunsten seiner Funktion als Nato-Stützpunkt eingestellt. Alle haben den Handelsboykott gegen Rest-Jugoslawien mitgetragen und beträchtliche Verluste in Kauf genommen.
Das Anschlußverfahren bietet andererseits EU-Mitgliedern die Gelegenheit, nationale Sonderinteressen gegenüber den Kandidaten erpresserisch geltend zu machen:
Europäischer Revanchismus
Europa-Reife in außenpolitischen Fragen haben die Nationen auch im Entgegenkommen gegenüber deutschen und italienischen, inzwischen auch österreichischen Ansprüchen bewiesen. Dabei müssen Polen und Tschechien dank ihrer geopolitischen Lage erfahren, daß enorm viel Versöhnungswille auf ihrer Seite, den Deutschland immer wieder mit dem Argument einfordert, daß der Weg nach Europa über die Aussöhnung mit Deutschland führt, mit immer neuen deutschen Forderungen belohnt wird. Den „Schlußstrich unter die Geschichte“ läßt Deutschland nicht zu. Weiter entfernt liegende Nationen, Ungarn und Rumänien, konkurrieren mit vorauseilendem Gehorsam in Sachen Pflege deutscher Minderheiten, Rumänien in seiner schlechten Konkurrenzlage bietet Entschuldigungen für begangene Verbrechen an Rumäniendeutschen an, die Bonn noch gar nicht bestellt hatte, und die Rückgabe von Landeigentum an ausgewanderte Banater Schwaben. Der Landerwerb für Ausländer, wegen des deutschen und italienischen Revanchismus eine prekäre Frage für die betroffenen Nationen, taugt zum besonderen Prüfstein für Unterordnungsbereitschaft: Slowenien mußte seine Aussöhnung mit Italien zustandebringen, ein Vorkaufsrecht bei Immobilien für ehemalige italienische Eigentümer einräumen, und muß noch den Artikel über Eigentumsrechte in seiner Verfassung ändern, um seine Europa-Tauglichkeit unter Beweis zu stellen. Umgekehrt ist Italien mit der Wiedergutmachung von Kriegsverbrechen immer noch nicht zufrieden, und Österreich entwickelt eine deutsche Minderheit in Slowenien.
Der deutsche Nationalismus benützt seine Führungsrolle in Europa, um im Namen deutschen Volkstums und deutschen Eigentums Vorrechte in den Nachbarstaaten zu begründen, Italien und Österreich eifern ihm nach. Was gleichlautende nationale Anliegen betrifft, die die Anschlußländer untereinander und gegen Dritte betreiben, ist von Europa aus das Diktat ergangen, sie europa-dienlich zu regeln.
Nationalismus-Verbot im Verhältnis untereinander und gegen Dritte
Als Hebel zur Aufspaltung des Ostblocks war der Nationalismus der Osteuropäer sehr passend, vom Standpunkt ihrer Aufnahme in die EU muß er unter Kontrolle gebracht werden. Die Europa-Aspiranten müssen sich erst ihre europäische Anerkennung verdienen, indem sie nationale Interessen im Namen europäischer Programme zurückstellen und den Nationalismus ihrer Völker unter Kontrolle halten. In dem Maß, in dem sie ihre nationalen Ambitionen an den europäischer Richtlinien relativieren und in deren Dienst stellen, stellt Europa Ermächtigung in Aussicht.
Völkische und territoriale Anliegen von ihrer Seite werden von Europa als Störquelle definiert.[30] Damit erst gar kein Konfliktpotential ins Bündnis hineingetragen wird, hat Europa seinen „Balladur-Pakt“ in die Tat umgesetzt und flächendeckend nationale Versöhnung in Gestalt von Grenzverträgen und Minderheitenrechten angeordnet. Mehr oder weniger widerstrebend und berechnend werden die Gebote in die Tat umgesetzt. Ungarn unterschreibt noch einmal und endgültig Versailles, Rumänien verzichtet auf heiligen Vaterlandsboden in Moldawien, Polen auf urpolnisches Gebiet in Litauen. Vom Standpunkt der vorweggenommenen Erledigung völkischer Problemfälle aus werden Minderheitenrechte in einem Maß verordnet, wie sie sich jeder EU-Staat verbitten würde. Die Auflagen beleben das zwischen- und innerstaatliche Leben dieser Nationen, rühren revanchistische Ansprüche auf, bringen einige Minderheiten erst auf den Gedanken, sich als solche aufzuführen und politisch zu organisieren, so daß die Volksnation Stoff für ihren unzufriedenen Nationalismus und den Verdacht auf Vaterlandsverrat gegenüber ihren Führern erhält – alles wiederum Material, an dem Europa die EU-Reife und demokratische Leistungsfähigkeit der jeweiligen Regierungen überprüfen kann.
Die jeweiligen Regierungen lassen sich auf die angeordnete „Verzichtspolitik“ mit ihren Berechnungen ein, nationale Ansprüche in EU- bzw. Nato-kompatible zu verwandeln, um sich die Zustimmung dieser Instanzen zu verschaffen. Ob sie damit Erfolg haben oder nicht, entscheidet sich entlang der europäischen Einschätzung ihrer jeweiligen Anpassungsbereitschaft und Nützlichkeit, je nachdem werden Staaten weiter zur Selbstbeschränkung genötigt oder in ihrem nationalen Recht bestätigt.[31] Objekt des deutschen Revanchismus zu sein, verlangt zwar Entgegenkommen gegenüber den deutschen Unverschämtheiten, prädestiniert aber die betreffenden Kandidaten zum Beitritt, und die besondere Zuwendung Deutschlands zu diesen Staaten sorgt darüberhinaus für besondere Beziehungen, für den Ausweis als bessere Anlagesphäre und eine weitergehende Erschließung. Die strategische Bedeutung Polens als Ostseeanrainer, größter und wichtigster Grenzstaat der GUS, wird eigens in Form des „Weimarer Dreiecks“, durch die besondere Zusammenarbeit mit Deutschland und Frankreich gewürdigt; so daß nunmehr Polen nach gelungener „Aussöhnung“ seinerseits Litauen und die Ukraine von Rußland weg und „an Europa heranführen“ und eigene Interessen gegenüber seinen Nachbarn im Osten betätigen darf.[32] Ungarn wiederum kann gegenüber der Slowakei und Rumänien geltend machen, daß der Weg nach Europa über die angeordnete Versöhnung und eine entsprechend entgegenkommende Berücksichtigung ungarischer Ansprüche führt.[33]
Die Einrichtung europa-tauglicher Polizeistaaten
Der europäische Bedarf an „Sicherheit“ ist nicht zuletzt wegen der Befreiung der östlichen Völker enorm gewachsen und der acquis communautaire gerade auf diesem Gebiet in den letzten Jahren detailliert fortgeschrieben worden:
„Der Rahmen für die Tätigkeit der Europäischen Union in den Bereichen Justiz und Inneres deckt im wesentlichen folgende Materien ab: Asylpolitik, Kontrolle der Außengrenzen und Einwanderung, Zusammenarbeit im Zollwesen und polizeiliche Zusammenarbeit zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität, einschließlich des illegalen Drogenhandels sowie Zusammenarbeit der Justizbehörden in Zivil- und Strafsachen… Der Acquis in den Bereichen Justiz und Inneres beinhaltet zudem eine umfassende praktische Zusammenarbeit, Rechtsvorschriften und Maßnahmen zu ihrer konkreten Umsetzung…
Der neue Vertrag bekräftigt das Ziel der Erhaltung und Weiterentwicklung der Union als „Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts“ und macht diese Bereiche, insbesondere den freien Personenverkehr, das Asylrecht und die Einwanderung, zum Bestandteil des Gemeinschaftsrechts… Vor allem hinsichtlich des freien Personenverkehrs sieht der neue Vertrag vor, daß die im Schengener Übereinkommen enthaltenen Bestimmungen in den Rechtsrahmen der Europäischen Union einbezogen werden und dieser Schengen-Besitzstand von jedem Land, das der Europäischen Union beitreten möchte, ohne Einschränkungen übernommen werden muß…
Das Europa-Abkommen enthält Bestimmungen über die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Drogenmißbrauch und Geldwäsche.“
Die Osterweiterung bedeutet die Eingemeindung von sehr viel vorhandener und potentieller Armutskriminalität. Europa verlangt schließlich von seinen Beitrittskandidaten, sich ökonomisch auf den Restbestand von Geschäft gesundzuschrumpfen, der sich als rentabel erweist, und die Masse der ehemaligen Werktätigen in einer Weise abzuwickeln, daß sie dem nationalen Budget nicht zur Last fallen. Mit den Produkten dieser organisierten Verelendung befaßt sich die EU dann unter dem Gesichtspunkt ihrer inneren Sicherheit und entdeckt einen einzigen Nährboden für marktwirtschaftlichen Unternehmergeist an der falschen Stelle:
„Auch wenn das organisierte Verbrechen und die sonstige Schwerkriminalität in der heutigen EU in unterschiedlichem Maße ein Problem darstellen, ist die Natur dieser Kriminalitätsform in den beitrittswilligen Ländern doch eine neue Herausforderung.“
Das ist der Nachteil der Erweiterung vom Standpunkt der Kanther & Co. Umgekehrt erlaubt die Eingemeindung der Staaten aber die Vorverlagerung der Außengrenzen der EU und ihres Sicherheitsregimes.
„Den Reformstaaten Mittel- und Osteuropas will besonders die EU mit fachlichem Rat, aber auch mit Geld beispringen, um die illegale Migration zu bremsen, die oft über deren Territorium läuft.“ (SZ 16.10.97)
Das ist wiederum der Vorteil, weshalb die Sicherheitspolitiker trotz all der Gefahren, die sie beschwören, nicht an die Wiedereinführung des Eisernen Vorhangs denken. Für beide Anliegen ist mehr Polizeigewalt die passende Antwort. Das Europa, das sich „als Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts“ versteht, hat die Einbeziehung der Europa-Aspiranten am weitesten vorangetrieben. In der Prioritätenliste der EU steht der Export von Polizeistaat und Asylgesetzen an vorderster Stelle, als angegliederte Polizeiapparate möchte man die Staaten sogar lieber heute als morgen aufnehmen.[34] In „intensiver Zusammenarbeit“ wird den östlichen Regierungen und ihrem Beamtenapparat beigebracht, wieviel Polizeistaat die Marktwirtschaft braucht. Die europäische Entwicklungshilfe auf dem Gebiet Justiz und Polizei trifft auf völlig unterentwickelte Gewaltapparate, die Hinterlassenschaft des alten totalitären Unterdrückungsstaats, und auf eine konstitutionelle Schwäche der Nationen: Die Staatsbudgets geben die erforderliche Aufstockung des Personals und die Beamtenbesoldung nicht her, die Agenda bescheinigt allen Kandidaten eine weitverbreitete „Korruption“ im Staatsapparat.
Verlangt wird die Exekution europäischer Sicherheitsbedürfnisse, auch wenn das europäische Grenzregime nationalen Interessen zuwiderläuft:
„So wird Polen, das im Zeichen seiner Ostpolitik mit Rußland und Weißrußland visafreien Reiseverkehr eingeführt hat, gegenüber den östlichen Nachbarn wieder Visumszwang einführen müssen. Ungarn wird wiederum gegenüber der Slowakei und Rumänien eine strenge Sicherheit der Grenzen zur Priorität machen müssen, obwohl die großen ungarischen Minderheiten in beiden Nachbarstaaten eigentlich nahelegen, auf eine Durchlässigkeit der Grenzen hinzuwirken.“ (FAZ 15.12.97)
Polen muß seine Ostgrenze nach Schengen-Kriterien beaufsichtigen, auch wenn es dadurch seine nicht unwichtige Einnahmequelle aus dem grenzüberschreitenden Kleinhandel beschädigt. Auf die Finanzlage der Staaten können die europäischen Sicherheitsstandards keine Rücksicht nehmen, bzw. würdigen sie auf ihre Weise: Weil die neuen Aufgaben die Ausstattung der Staaten restlos überfordern, zeigt sich Europa auf diesem Gebiet regelrecht spendabel und finanziert Sicherheitsmaßnahmen, die es für unabdingbar hält, wie die Ausbildung von Polizei und Grenzschutz, unterhält in Budapest eine internationale Polizeiakademie und liefert westliche High-tech wie Nachtsichtgeräte u.ä. für die Beaufsichtigung der Grenzen.
Europa verlangt die zuverlässige Ausübung der demokratischen Herrschaftstechnik
„Der Europäische Rat von Kopenhagen stellte für die mittel- und osteuropäischen Bewerberländer folgende „politischen“ Beitrittskriterien auf: ‚Institutionelle Stabilität als Garantie für die demokratische und rechtsstaatliche Ordnung, Wahrung der Menschenrechte sowie Achtung und Schutz von Minderheiten‘…
Systematisch analysiert werden für jedes Bewerberland die wichtigsten Aspekte des Aufbaus und der Arbeitsweise der staatlichen Verwaltungsorgane sowie die Regelungen zum Schutz der Grundrechte. Die Analyse beschränkt sich nicht auf eine formale Darstellung, sondern versucht abzuschätzen, inwieweit Demokratie und Rechtsstaat tatsächlich funktionieren.“
Die Veranstaltung von „Demokratie“ im europäischen Osten
stellt zum einen die Grundvoraussetzung für die Aufnahme
in Europa dar, insofern als die Kandidaten damit ein für
allemal das Bekenntnis zum richtigen System ablegen und
ihre Abkehr vom falschen mit Brief und Siegel
unterschreiben. Die Kommission will sich aber nicht auf
Lippenbekenntnisse verlassen, sondern wissen,
inwieweit Demokratie und Rechtsstaat tatsächlich
funktionieren
. Verlangt ist Stabilität
: Europa
will sich auf die Ausübung der Funktionen, für die es die
Staaten verplant, auch in der Hinsicht verlassen können,
daß sie vermittels der demokratischen Herrschaftstechnik
in der Parteienkonkurrenz, im Volkswillen und im
Staatsapparat als nationaler Konsens verankert
sind. Und zu einem demokratischen Überbau gehört auch ein
entsprechender Unterbau, der Vollzug des neuen
Staatswillens muß durch entsprechende Organe mit der
nötigen Beamtenroutine gesichert sein. Europa moniert in
allen Abteilungen eine für seinen Bedarf viel zu
schwächliche Exekutive, betreibt unter dem Titel
„Institution building“ eine moderne Form der
Kolonisierung, kümmert sich um die Ausbildung des
entsprechenden Personals und faßt auch den Export
europäischer Beamter ins Beitrittsgebiet ins Auge.
„Stabilität“ ist dann schließlich doch nicht der letztinstanzliche Gesichtspunkt, unter dem die EU-Kommission die Kandidaten durchmustert – gemeint ist immer die politische Substanz: Der europäische Kontrollbedarf rührt schließlich daher, daß das Anschlußprogramm die Regierungen darauf verpflichtet, den nationalen Konsens ganz auf die von Europa verlangten Funktionen, inkl. sämtlicher darin enthaltenen Zumutungen, festzulegen. Ob ihnen das in einem Europa zufriedenstellendem Maß gelingt, diese Frage überprüft die EU-Kommission ganz unsachlich an den Techniken der Demokratie und der Parteienkonkurrenz, so daß auch immer dann ein Mangel an „Demokratie“ und „Stabilität“ zu konstatieren ist, wenn unerwünschte nationalistische Abweichungen angetroffen werden. Der Maßstab „Demokratie“, wie er an die Staaten angelegt wird, ist auch nur die Gleichung für einen funktionellen Nationalismus, für die herrschaftstechnisch garantierte Festlegung ihrer Souveränität auf das Europa-Programm. Bei anerkanntem Versagen oder offener Widerspenstigkeit von Regierungen stellt sich auf seiten Europas daher der Verdacht ein, daß das demokratische System nicht wirklich gewollt wird. In solchen Fällen besteht Europa auf der Korrektur von Regierungslinien und destabilisiert nötigenfalls uneinsichtige Regierungen.
Der Anschluß als Bewährungsprobe für die „jungen Demokratien“
Die demokratischen Techniken werden von den neuen Führern getreulich kopiert, führen aber unter den gegebenen Bedingungen nicht ganz so routiniert und reibungslos zum erwünschten nationalen Konsens. Europa verordnet, nationale Streitfragen in Verhandlungen mit dem nationalen Gegner beizulegen und erstklassige nationale Rechtstitel auf Volk und Territorium zu streichen. Dementsprechend werden die Themen im Inneren hochgekocht, der enttäuschte Nationalismus hat seinen festen Platz als Element der Parteienlandschaft und im politischen Überbau. Europa verlangt die Öffnung und Privatisierung bis hin zum ausländischen Zugriff auf Grund und Boden, so daß die zum Nationalismus befreiten Völker an der Einführung der „Marktwirtschaft“ weniger den nationalen Aufstieg als vielmehr den „nationalen Ausverkauf“ entdecken. Pfaffen, Humanisten und andere Werteträger beklagen die westliche Sittenlosigkeit und kulturell-nationale Entfremdung; die polnische Kirche und Radio Maryja machen Juden in der Brüsseler Kommission und im IWF dafür verantwortlich; ungarische Regierungen müssen die Magyarenverbände im In- und Ausland beschwichtigen. Europa verordnet Aufmerksamkeit gegenüber „extremistischen Strömungen“ und beanstandet immer wieder Zerwürfnisse zwischen den „Institutionen“, Regierungen und Parlamenten, Präsidenten und Regierungschefs, Regierungschefs und Verfassungsgerichten.
Die EU-Kommission, unterstützt von Organisationen wie der OSZE, dem Europarat und diversen NGOs, lobt, daß die Beutevölker, trotz jahrzehntelanger totalitärer Verseuchung, das Geschäft des Wählens zwar schon ganz ordentlich bewältigen:
„Wahlen verlaufen frei und fair und haben 1990 und 1994 einen Machtwechsel ermöglicht… Die Parlamentswahlen von 1991 und 1993 und die Wahl des Staatspräsidenten 1995 waren frei und fair. Der durch sie 1993 und 1995 herbeigeführte Machtwechsel verlief ordnungsgemäß. …“
Aber jeder Wahlkampf ist Gegenstand der europäischen Kontrolle, wieweit es den Konkurrenten um die Macht gelingt, die aus dem Anschlußprozeß resultierenden nationalen Ressentiments wahlkämpferisch zu benützen und wiederum von der Regierungslinie zu trennen. Komplimente (deutsche, natürlich) hat sich der letzte tschechische Wahlkampf verdient, bei dem es Präsident und Regierung gelungen ist, die wesentlichen Konkurrenten dafür zu gewinnen, die „deutsche Frage“ aus der demokratischen Schlammschlacht „herauszuhalten“. Nach der letzten polnischen Wahl, die die Solidarnosc-Allianz mit anti-europäischen Parolen bestritten und gewonnen hat, wurde mit Zufriedenheit vermerkt, wie sich die Sieger darum bemüht haben, schleunigst ihre europäische Ausrichtung unter Beweis zu stellen.[35]
Die Anwälte des besseren, weil menschenfreundlichen Systems erteilen den Regierungen demgemäß auch gewisse Lektionen, wie und in welcher Hinsicht es auf den Volkswillen ankommt, wann z.B. ein Referendum erwünscht ist und wann nicht. In der Slowakei wird der Beschluß, ein Nato-Referendum durchzuführen, für undemokratisch erklärt, dem „Volkstribun“ Meciar wird vorgeworfen, sich mit seiner ablehnenden Haltung zur Nato, die er unzählige Male dementiert hat, hinter der Volksmeinung verschanzen zu wollen. Nachdem das Referendum an mangelnder Beteiligung gescheitert ist, steht das Urteil erst recht fest. In Tschechien wird der Regierungsbeschluß, das Volk nicht mit Fragen zu belasten, von denen es ohnehin nichts versteht, erst einmal auch von außen als Ausdruck politischer Reife gebilligt:
„Die Koalitionsparteien und auch Präsident Havel halten es nicht für angebracht, in komplexen sicherheitspolitischen Fragen das Volk entscheiden zu lassen – dies um so mehr, als im konkreten Fall des Nato-Beitritts ein ablehnendes Verdikt nicht von vornherein ausgeschlossen werden könne.“ (NZZ 9.7.97)
Nachdem sich andere Momente von Mißstimmung eingestellt haben, wird dieser Standpunkt gegen die Regierung gekehrt: Die schlechte Volksmeinung wird ihr als politisches Versäumnis angekreidet, und sie wird dazu beauftragt, für die gehörige Nato-Begeisterung in der Bevölkerung zu sorgen, damit die dann abgefragt werden kann.[36]
Die ökonomischen Härten der Transformation liefern
ihrerseits viel Stoff für die demokratische Bewältigung.
Auch da haben die neuen Demokratien Erfolge vorzuweisen:
Von wenigen Ausnahmen abgesehen, gelingt es, die
Systemfrage aus dem politischen Streit herauszuhalten und
so zu verhindern, daß das Brachlegen der Produktion und
die systematische Verelendung der Völker in ein Urteil
über die Marktwirtschaft ausartet. Die demokratische
Methode besteht erstens darin, die Systemfrage mit Blick
auf das europäische Wohlstandsparadies für erledigt zu
erklären und die nationalen Verwüstungen als
unumgängliche Schritte auf dem Weg dahin zu
sanktionieren; im Blick nach rückwärts kommt der
Sozialismus vor allem unter dem Gesichtspunkt seiner
„Verbrechen“ zur Sprache. Zweitens betreiben die
Verantwortlichen in Politik und Öffentlichkeit die
Bildung des rechtsstaatlichen Urteilsvermögens, das von
der ökonomischen Substanz absieht und sich auf die
Überprüfung der gesetzlich und moralisch sauberen
Handhabung kapriziert. Sie machen ihre Völker mit der
demokratischen Menschenkenntnis und den
Glaubwürdigkeitsmaßstäben vertraut, an der
Führungsqualitäten von Politikern zu bemessen sind.
„Korruption“ avanciert demgemäß zu dem allseits
verwendbaren und verwendeten Titel: Den schon vom
vorhergehenden System zu guten Staatsbürgern erzogenen
Völkern leuchtet viel eher ein, daß der
marktwirtschaftliche Erfolg sich nicht einstellen will,
weil sich dubiose Figuren in Wirtschaft und Politik
privat bereichern, als daß sie auf den Gedanken kämen,
nun die Gesetze des Kapitalismus zu erleben. Die
Verwandlung der allgemeinen Verarmung und
Volksverwahrlosung in Skandale
und Fälle von
Korruption
gelingt so gut, daß sie bei den
auswärtigen Beobachtern zuweilen wieder Sorgen über die
abwesende Stabilität erzeugt. Da nämlich ziemlich viel
Regierungs- und Staatsarbeit, gemessen an der Perspektive
etablierter Marktwirtschaften, „mißlingt“ und
unvermeidlicherweise Staatsfiguren dabei beteiligt sind,
dreht sich zuweilen das Staatsleben nur noch um das Thema
„Korruption“.
In einigen Fällen erklärt Europa das gute Verhältnis zwischen Politik und Marktwirtschaft – in „entwickelten Demokratien“ die Regel – zum Grund für Beanstandungen: Die nationale Privatisierungslinie der Slowakei gilt überhaupt nur als ein Fall von „Korruption“; im Fall des tschechischen Ministerpräsidenten hat es sich wundersam gefügt, daß sich die ganze europäische Mißbilligung schließlich auch noch durch den Vorwurf dubioser Parteispenden bestätigen ließ, die dann als letztes „Argument“ gegen die Regierung Klaus gedient haben. Wenn aber zu oft zu viel Personal ausgewechselt werden muß wie in den baltischen Staaten, moniert Europa, daß die Beständigkeit des Regierens darunter nicht leiden darf. Umgekehrt wird es als Ausweis der Wende zum Besseren gebilligt, wenn in Bulgarien und Rumänien unter dem Titel „Korruptionsbekämpfung“ die Klientel der vorhergehenden „reformfeindlichen“ Regierung aus allen Positionen herausgesäubert wird, um diese mit eigenen Leuten zu besetzen. Das Verfahren geht auch als flankierende Maßnahme für die mit neuer Radikalität aufgelegten Volksverarmungsprogramme in Ordnung, immerhin wird so den Völkern, die sich kaum noch ernähren können, der gerechte Trost zuteil, daß auch den alten Bonzen die Privilegien genommen werden.
Bei der akribischen europäischen Überprüfung kommt die Frage nach dem Geisteszustand der Völker nicht auf bzw. nur in der sehr sachgerechten Form, daß im Fall der Mißbilligung daraus ein Vorwurf an die politischen Macher verfertigt wird. Im Prinzip haben sie bei der politischen Bildung ihrer Völker schon große Fortschritte gemacht hat: Nationale Werte, verfochten mit der nötigen Gehässigkeit, garantieren ein lebendiges öffentliches Leben. Daß das polnische Volk z.B. nichts so sehr erregt wie die von Wahlkampf zu Wahlkampf wieder aufgetischte Frage der Abtreibung, beweist schließlich auch, daß die Nation durchaus im demokratisch erwünschten Sinn zwischen wichtig und unwichtig unterscheiden gelernt hat. Die Völker beherrschen ihre Rolle als Demokraten im wesentlichen – daß sie öfters die Lust am Wählen verlieren und durch mangelnde Wahlbeteiligung Wahlen ungültig machen, spricht nicht gegen sie, sondern gegen Regierungen, die entweder – in Ungarn – ein hyperdemokratisches Quorum erlassen haben oder überhaupt die falschen sind – in der Slowakei. Die wichtigste Bürgertugend beherrschen die Völker, die kritisch überwachte „Nostalgie“, die realsozialistische Vergangenheit betreffend, hält sich an die demokratisch vorgeschriebenen Formen und geht über folgenloses Gejammer nicht hinaus. Umgekehrt kennen sie ihre neuen Rechte und machen sie geltend, wenn ihnen Juden, Zigeuner, Vietnamesen oder andere unerwünschte Ausländer wirklich oder vermeintlich über den Weg laufen. Je nach Bedarf – und der ist im Fall der Behandlung von Russen im Baltikum z.B. nur manchmal gegeben, im Fall der Zigeuner in Tschechien schon öfter – macht die EU-Kommission daraus einen Vorwurf gegen die zuständige Regierung.
An den Methoden der Herrschenden hat die EU-Kommission viel auszusetzen – es sind zwar genau dieselben wie im hochzivilisierten Europa, aber das Regierungsgeschäft ist eben noch nicht so unangefochten wie in den Stammländern der Demokratie, nicht zuletzt wegen der europäischen Aufträge und Einwände. Zwar haben die von der Parteidiktatur befreiten Nationen aus dem Stand ein demokratisches Parteienleben zustandegebracht, aber die Fachleute der Demokratie monieren die Unübersichtlichkeit der Neugründungen, ihre geringe Haltbarkeit und Zerstrittenheit im Hinblick auf die Entwicklung von etablierten Volksparteien, die beständige Mehrheiten garantieren. [37] Weltanschauliche Fehden gehören in das Kapitel der Volksbetörung, dürfen aber die Mehrheitsfähigkeit, die z.B. zum Sturz des slowakischen Premiers gebraucht wird, nicht beeinträchtigen. In den „jungen Demokratien“ stellt sich auch das urdemokratische Bedürfnis ein, daß eine Partei, die an die Regierungsmacht gelangt ist, die Konkurrenz von der Macht ausschließen und deren Aufgabe, die Unzufriedenheit in Wahlstimmen für sich umzumünzen, unmöglich machen möchte. Ebenso ist das Bestreben zu verzeichnen, den Dauer-Wahlkampf der Demokratie über die Monopolisierung von Medien für sich zu entscheiden und in Kohl’scher Manier die demokratische Zustimmung ganz auf die Figur an der Spitze zu konzentrieren. Das trägt dann so unterschiedlichen Figuren wie Walesa, Klaus und Meciar den schlechten Ruf als „Autokraten“ ein, obwohl es vom Gegenteil, vom Bewußtsein gar nicht gefestigter Machtverhältnisse zeugt. Entlang des Verdachts auf zuviel Eigenwilligkeit, auf einen Nationalismus, der sich gegen europäischen Geboten gegenüber widerspenstig zeigt oder zeigen könnte, werden die einschlägigen Praktiken als demokratisch unsaubere Verfahrensweisen protokolliert. Die Intrigen, die wiederum der tschechische Präsident gegen den Regierungschef unternommen hat, gehen einwandfrei in Ordnung – schließlich steht und fällt Tschechien mit dieser „europäischen Integrationsfigur“. Absehbarerweise werden die politischen Eliten ihrer von Europa aus zugeteilten Aufgabe, für „Stabilität“ und zwar einer im Sinn des Europa-Programms zu sorgen, nur in sehr unterschiedlichem Grad gerecht, in dem Maß, in dem ihnen der Weg „zurück nach Europa“ nationale Erfolge beschert, die sie vorweisen können, um die politische Klasse und ihre öffentliche Meinung auf sich zu verpflichten.
Jenseits der besonderen Streitigkeiten, Erfolge und Mißerfolge, die bei der demokratischen Kolonisierung anfallen und beaufsichtigt werden, nimmt die Europäische Kommission eine zusammenfassende, auf sich bezogene Begutachtung des jeweiligen Staatswillens vor: Sind die Nationen „integrationsfähig und -willig“ oder ist das Gegenteil der Fall? In zwei Fällen hat Europa besondere Lektionen für erforderlich gehalten, um das Mißverständnis auszuräumen, daß die Beitrittskandidaten ihre neue Souveränität in nationaler Eigenherrlichkeit wahrnehmen könnten, und um klarzustellen, daß der Anschluß vielmehr nationale Anpassungsbereitschaft, die Unterordnung nationaler Interessen verlangt.
„Der Wille zum Souveränitätstransfer“ [38]
Der erste Fall beruht auf dem anfänglichen Erfolg der tschechischen Nation in der Konkurrenz mit ihresgleichen, personifiziert in der zeitungssprichwörtlichen Klaus’schen Arroganz. In seiner Person hatte es Europa mit einem Produkt seiner Erschließung zu tun, das ökonomischen Erfolg mit dem Recht verwechselt hat, in Europa-Fragen mitentscheiden zu können.
„Befürchtungen hinsichtlich eines Verlustes nationaler Identität werden ebenso hervorgebracht wie Einwände gegen die Industriepolitik und die Sozialcharta der EU… Eine EU, in der alle Länder die gleiche Stimmengewichtung im Ministerrat haben, würde von der Tschechischen Republik bevorzugt.“ (Weidenfeld, a.a.O., S.228/240) –
Diese Einbildung ist korrigiert worden. Der deutsche Kanzler hat der tschechischen Republik demonstriert, daß man mit einer Kopie des englischen Standpunkts zu Europa kein deutsches Wohlwollen erwarten darf – von wegen die EU wäre ein Verein zur Förderung der Wirtschaft und die nationale Souveränität ihrer Mitglieder der oberste Zweck. Klaus durfte mehrere Jahre lang nicht zum Staatsbesuch in Bonn antreten und hat schließlich europapolitische Einsicht gezeigt.[39] Die andere tschechische Einbildung, man hätte den Einstieg in den Weltmarkt und den Erfolg der Nationalökonomie selbst in der Hand und selbst geleistet, ist dann durch die Gesetze der Konkurrenz korrigiert worden. Der Sturz der Regierung Klaus war daher unvermeidlich, und der „Dichterfürst in Prag“ hat die verlangte Botschaft, nach der kleinen Nationen Bescheidenheit ansteht, an seine Volksgenossen weitergereicht.
Der andere Fall ist die Slowakei, bei der das Abweichlertum auf einer Kette von politischen Mißerfolgen im Verhältnis zur EU beruht. In der Begutachtung der Kandidaten erntet die Slowakei als einzige Nation das vernichtende Urteil, daß sie gemessen an den politischen Kriterien ausscheidet:
„. … ergibt sich für die Kommission, daß die Slowakei infolge der Instabilität ihrer Institutionen, deren mangelnder Verankerung im politischen Leben und den Verstößen gegen demokratische Prinzipien nicht in ausreichender Weise die gesetzten Bedingungen erfüllt.“ Insbesondere das „konstante Spannungsverhältnis zwischen der Regierung und dem Staatspräsidenten ist ein Beispiel dafür“.
Europa hat es auch in diesem Fall mit einem
Produkt seiner Politik zu tun: Angefangen von
der Privatisierung über den auswärtigen Handel bis zu
Meciars außenpolitischem Verbrechen mangelnder
Russenfeindschaft – Europa hat bei allen Anlässen und
Gelegenheiten Einspruch eingelegt, die slowakische
Politik also auf die Alternative Unterwerfung oder
Behauptung festgelegt. Das kritisierte
„Spannungsverhältnis“ hat überhaupt gar keinen anderen
Inhalt als den Streit darum, ob sich die slowakische
Politik an die auswärtigen Vorschriften zu akkommodieren
hat – die Linie des Präsidenten – oder sich die
Entscheidungsfreiheit über nationale Machtmittel
vorbehalten muß, wenn sie schon auf kein internationales
Wohlwollen rechnen kann – die Linie von Meciar. In guter
demokratischer Tradition hat der Ministerpräsident nichts
unversucht gelassen, den Vertreter der Gegenlinie im
Präsidentenamt zu disqualifizieren, es ist ihm aber nicht
gelungen, den demokratischen Konsens zugunsten seiner
Auffassung herzustellen – weil Europa das nicht
zugelassen und seine nationalen Gegenspieler aufgebaut
und bestärkt hat. Insofern ist es nicht schwer, Meciar
trotz seiner stabilen Mehrheiten mangelnde
Stabilität
zu bescheinigen: Solange er
regiert, herrscht in der Slowakei per definitionem
„Instabilität“ und die Demokratie ist gefährdet.
Die Kategorie „Postkommunismus“: Zusammenfassung des europäischen Aufsichtsstandpunkts
Seit dem Ableben des Kommunismus beobachtet Europa im
Osten „Postkommunismus“. Dabei handelt es sich nicht um
eine historische Einteilung, wie das „post“ erst einmal
besagt, sondern um ein neues Phänomen, das an den
disparatesten Fällen und Anlässen ausgemacht wird: Setzt
Berisha das Projekt Albanien in den Sand, erklärt sich
das mit seinem „Postkommunismus“, obwohl er kurz zuvor
noch ein „Demokrat der ersten Stunde“ war. Die vorletzte
polnische Regierung hat während ihrer Machtausübung nicht
viel Grund zur Beanstandung gegeben, war aber dennoch
eine „postkommunistische“ und der Sieg der Opposition
über sie dementsprechend gerecht. Es ist fast überflüssig
festzustellen, daß nichts von den Fällen, an denen Anstoß
genommen wird, irgendetwas mit „Kommunismus“ zu schaffen
hat, d.h. damit, daß wirklich Bestrebungen zu verzeichnen
wären, Elemente des realen Sozialismus zu rekonstruieren
(ein anderer Kommunismus ist ohnehin nicht bekannt). Der
Vorwurf ist auf den Nachweis tatsächlicher
kommunistischer Anwandlungen nicht angewiesen, weil er
umgekehrt zu Werk geht: Der europäische Generalvorbehalt
gegenüber den „jungen Demokratien“ operiert mit der
Berufung darauf, daß die Staaten „zurück nach Europa“
wollen; wenn sie bei der Verwirklichung dieses Programms
scheitern oder Widerspruch wegen nationaler Härten
einlegen, wird ihnen das als Verstoß gegen ihren eigenen
Willen ausgelegt, folglich als heimlicher Wille
zum Alten und Rückfall
. Die Frage, ob es am
mangelnden Willen oder der mangelnden Fähigkeit der
Kandidaten liegt, wenn sie es Europa nicht recht machen,
wird mit der Denunziation eines unliebsamen
Nationalismus als „Postkommunismus“ für unerheblich
erklärt.
Akut wird der Verdacht, wenn Europa ein grundsätzlich schlechtes Funktionieren bei der Einführung des neuen Regimes mißbilligt – die vorhergehenden Regierungen in Rumänien und Bulgarien waren einfach „postkommunistisch“ gelagert.
„Rumänien hat bis zu den Wahlen vom Juni 1997 keinen wirklichen Machtwechsel erlebt. Das politische System war lange Zeit durch Praktiken geprägt, die noch aus Zeiten des kommunistischen Regimes stammten.“
Anhaltspunkte zur Bestätigung des Generalverdachts gibt es aber auch woanders immer wieder, weil die Bewältigung des Anschlußprogramms nie so stromlinienförmig vorankommt, wie europäisch gewünscht: „Postkommunistische Beharrungskräfte“ lassen sich in allen gesellschaftlichen Abteilungen als Ursache diagnostizieren. Wenn es nicht die regierende Mannschaft ist, die aus einer realsozialistischen Partei hervorgegangen ist, dann sind es der Offizierskader, der Beamtenapparat, die neuen Bonzen und „roten Manager“ und schließlich auch das Volk, die allesamt aus dem alten System stammen und ihm immer noch verhaftet sind… Schließlich war der ganze Laden ja bis neulich noch realsozialistisch.[40]
Europa registriert auf seine Weise, in welch prekäre Lage das Anschlußprogramm die nationalen Staatsgewalten versetzt: Es wird den prinzipiellen Verdacht auf mangelnde Zuverlässigkeit und fehlenden Willen der dafür zuständigen Regierungen nicht los und besteht damit auf der Alternativlosigkeit der neuen Staatsraison. So kommt ein politisches Phänomen in die Welt, das es nicht gibt, aber zu dem eigentümlichen Status paßt, in den die Länder durch ihre Zuordnung zur EU geraten.
Europa richtet eine neue Hierarchie von EU-Anhängseln ein und entwickelt Reformbedarf: Schritte auf dem Weg zu einem politischen Subjekt
Die Interessen, die Europa an die Anschlußkandidaten anlegt, von Geschäfts- bis zu strategischen Interessen, haben sie in eine Rangordnung von mehr oder weniger EU-tauglichen und EU-geförderten Staaten überführt, die Kandidaten auf die Bewährung in dieser Ordnung festgelegt und alternative Wege oder Bündnisse ausgeschlossen. Gleichzeitig hat das bisherige Verfahren den prinzipiellen politischen Zugriff auf die gesamte Staatenwelt von der Zulassung der Kandidaten zum Bündnis, die Pflichten, die sie zu erfüllen haben, von möglichen zukünftigen Rechten im Rahmen des Bündnisses getrennt. Seitdem die Aufnahme ins Auge gefaßt wird, befaßt sich die EU mit der Frage, zu welchen Rechten sie die neuen Mitglieder überhaupt zulassen will. Der Europa-Wille dieser passiven Imperialisten wird begrüßt, als Hebel der Machterweiterung der Union benützt – umgekehrt definiert Europa ihm nun seine Schranken im Bündnis.
Daß sich mit der Einrichtung eines neuen Hinterhofs die EU in ihrem Charakter wandelt, gesteht sie auf eine sehr EG-gemäße Art ein: Dem Bedeutungswandel, den sie organisiert, will sie auf der Ebene ihrer Strukturen beikommen und erklärt es für unumgänglich, ihre Geschäftsordnung zu reformieren:
„. … in einem größeren und weniger homogenen Europa wird es noch mehr als bisher darauf ankommen, daß die Kommission entschieden für die gemeinsamen Interessen eintritt. Dazu ist es unbedingt notwendig, daß sie ihre Strukturen neugliedert und modernisiert.“
Nachdem die sachliche Hierarchisierung schon eingeleitet ist, kommt es den Zuständigen äußerst unpraktisch vor, den traditionsreichen Unterschied zwischen „gemeinsamen“ und weniger gemeinsamen „Interessen“ in seiner neuen Beschaffenheit auch nur der Form nach einem Bündnisschacher zu überlassen. Die EU will einzelstaatliche Interessen einem Genehmigungsverfahren unterwerfen, die Vereinbarkeit mit dem Programm Europa ist der Test, dem sich das nationale Interesse stellen muß. Dieses Programm soll auf dem Weg der Herstellung einer organisatorischen Hierarchie in der Union erledigt werden. Daher steht die „Reform der Institutionen“ auf der Tagesordnung, Entscheidungsverhältnisse sollen neu eingerichtet, Stimmrechte gewichtet, umverteilt und entzogen werden. Das Bedürfnis nach Hierarchisierung beschränkt sich nicht auf die künftigen Mitglieder, gedacht ist durchaus auch an eine Formalisierung der in der EU schon etablierten Konkurrenzordnung, was deutsche Journalisten bereitwillig nachempfinden, indem sie es kindgemäß mit dem Verhältnis von groß und klein verdolmetschen, als ginge es nicht immer noch um ein Verhältnis souveräner Staaten:
„Schon jetzt haben die kleinen Mitgliedsstaaten ein relatives Stimmenübergewicht, das sich durch die Aufnahme der osteuropäischen Länder verstärken wird.“ (SZ 12.12.97)
Daß sich die gewichtigen Staaten davon freimachen wollen, auf die Zustimmung und Interessen weniger gewichtiger Staaten Rücksicht nehmen zu müssen, ist aber nur die halbe Wahrheit. Den eigentlichen und gemeinten Reformbedarf stellt die Kommission – in der gewohnten EG-Art – vor wie einen weiteren Sachzwang, dem sich das Bündnis zu stellen hat: Das bisherige europäische Verfahren mit seinen Streitigkeiten und Erpressungen soll bei einer noch größeren Anzahl von Mitgliedern schlechterdings nicht mehr funktionieren können.
„Die immer größere Heterogenität von Situationen, Interessen, Sichtweisen und Standpunkten innerhalb der Union könnte zu erheblichen Schwierigkeiten bei der Durchführung und Weiterentwicklung der Unionspolitiken führen, vor allem in Bereichen, in denen Entscheidungen immer noch der Einstimmigkeit bedürfen“
Die Wahrheit ist: Das Leiden an der „Heterogenität“ – der Normalfall eines Staaten-Bündnisses, in dem Souveräne ihre Interessen verfolgen – rührt daher, daß dieses Bündnis sich mit einem imperialistischen Subjekt vergleicht. Daran wird Maß genommen, wenn die Union ihren internen Einigungszwang als Hindernis für die nötige „Einstimmigkeit“ definiert; Europa geht es darum, als handlungsfähiges Subjekt, als Europa „mit einer Stimme“ aufzutreten. Die Suche nach Methoden, wie der Charakter eines Bündnisses im Prinzip gleichberechtigter Staaten zugunsten eindeutiger Führungs- und Unterordnungsverhältnisse zu verändern ist, entspringt dem Bedürfnis nach einem schlagkräftigen Euro-Imperialismus.
[1] Die ersten Beitrittskandidaten sind Polen, Tschechien, Ungarn, Slowenien und Estland sowie Zypern. Zur zweiten Gruppe gehören Bulgarien, Rumänien, Slowakei, Litauen und Lettland.
[2] Die Euro-Politiker
bekennen sich zu ihrem Rigorismus: Wie schon bei
früheren Erweiterungen hat der Europäische Rat
jeglichen Gedanken einer nur teilweisen Übernahme des
acquis ausgeschlossen… Falls der einen oder der anderen
Partei eine solche Ausnahme zugestanden würde, könnte
dies selbstverständlich nicht ohne Kompensationen
geschehen. Ganz allmählich würde so ein Prozeß
einsetzen, der über das Prinzip hinausginge, daß die
Integrationsprobleme schrittweise durch
Übergangsmaßnahmen gelöst werden können, was den
gesamten acquis erheblich verwässern würde. Überdies
würde sich das Problem ergeben, ob die Institutionen
überhaupt Entscheidungen in Politikbereichen treffen
könnten, bei denen es sich nicht länger um eine
gemeinsame Politik handeln würde.
Sie wissen auch,
was sie den Beitrittskandidaten mit der Forderung nach
Übernahme des acquis zumuten, weil die mit einer ganz
anderen Ausstattung antreten als bisherige
Anschlußnationen: Die Übernahme und Umsetzung des
acquis zum Zeitpunkt des Beitritts ist für die
Beitrittskandidaten eine schwierige Aufgabe… Diese
Herausforderung ist weit größer als bei früheren
Erweiterungen. Bei der letzten Erweiterung handelte es
sich um Mitglieder, die bis dahin dem EWR angehörten,
um hochentwickelte Volkswirtschaften, die sich bereits
große Teile des acquis zu eigen gemacht hatten. Das
gilt nicht für die jetzigen Beitrittskandidaten, zudem
hat sich das Gemeinschaftsrecht inzwischen erheblich
erweitert.
(„Agenda
2000“. In einer Reihe von unter diesem Titel
versammelten Dokumenten hat die EU-Kommission im Sommer
97 die Kriterien erläutert, die die antragstellenden
Staaten nach europäischer Auffassung erfüllen müssen,
in umfangreichen Stellungnahmen ihre Bemühungen und
Defizite in allen Unterkapiteln bilanziert, die Auswahl
begründet, mit welchen Staaten Beitrittsverhandlungen
aufgenommen werden sollen, und ihre weiteren
Anschlußstrategien vorgestellt. Alle folgenden, nicht
gekennzeichneten Zitate stammen aus der Agenda.)
[3] Eindrucksvolle
Erfolge hat vor allem der europäische Agrarhandel im
Osten zu verzeichnen: Nicht daß der EU-Agrarmarkt sich
„geöffnet“ hätte, worauf einige Länder gesetzt hatten.
Umgekehrt hat man es dort, auch aus Gründen der
staatlichen Geldnot, mit dem Abbau von
„wettbewerbsverzerrenden Subventionen“ so ernst
genommen, daß die Landwirtschaft nur ein Minimum der in
der EU gültigen Subventionen erhält, während die auf
Weltmarktpreise hinuntersubventionierten EU-Exporte
steigen: Für viele Beitrittskandidaten hat sich die
EU zum wichtigsten Handelspartner für agrarische
Lebensmittel entwickelt und sie sind, Ungarn
ausgenommen, in immer stärkerem Maße Nettoimporteure
gegenüber der EU.
Versuche der Staaten, ihr
Handelsbilanzdefizit einzudämmen und nationale
Produktionszweige zu schützen, werden nicht geduldet:
Die Agenda 2000 listet akribisch die jeweiligen
staatlichen Handelshemmnisse
auf. Ein
slowakisches Gesetz über die Etikettierung von
Lebensmitteln und Mineralwässern stimmt nicht mit dem
Gemeinschaftsrecht überein und könnte sich als
technisches Handelshindernis erweisen.
Polnische
Ausfuhrbeschränkungen für Häute und Felle
erregen
ebenso Anstoß wie mangelnder Eifer bei der
Gesetzesangleichung: Hinsichtlich der Angleichung
der technischen Vorschriften (für die Zertifizierung
von Waren) läßt die Neufassung des polnischen
Gesetzgebungsprogramms einige Zweifel an der
Vollständigkeit des Rechtsangleichungsprozesses
aufkommen…
Daß die Regierungen für die Verringerung
der Außenhandelsdefizite zu sorgen haben, wird ihnen
ausdrücklich zur Pflicht gemacht. Angesichts der
tschechischen Finanzkrise Frühjahr 97 befindet die
EU-Kommission, …daß insbesondere Mittel und Wege
gefunden werden müssen, um den Konsum im Zaum zu halten
und so das Handelsdefizit zu begrenzen…
Aber eben
nicht auf Kosten des freien Handels der EU: …eine
Kautionspflicht, die nicht mit dem Europa-Abkommen
vereinbar ist. Diese Regelung sollte zurückgenommen
werden.
Die EU-Kommission beschränkt sich nicht
darauf zu bilanzieren, wo Streitigkeiten ausgeräumt
worden sind, wo sie noch bestehen, sie zieht
darüberhinaus ihre Rückschlüsse auf nationale und
Regierungslinien: Man registriert, welcher
Staat sich entgegenkommend verhält, welcher immer
wieder solche Streitfragen aufwirft und welcher
Anzeichen von Renitenz erkennen läßt – so geht der
Prozeß der „friedlichen und gewollten Integration“ im
einzelnen vonstatten. Der polnischen Zollpolitik wird
vorgehalten: All dies zeigt eine gewisse Tendenz,
internationale Verpflichtungen und die Bestimmungen des
Europa-Abkommens zu umgehen. Durch eine nach Buchstaben
und Geist konsequente Durchführung des Europa-Abkommens
müßte solchem Druck aber entgegengewirkt werden.
Die Tschechische Republik ist zuversichtlich
hinsichtlich der Fortschritte bei der Erfüllung ihrer
aus der EU-Mitgliedschaft erwachsenden Verpflichtungen
und hat mitunter nur mit einem gewissen Widerstreben
Schwierigkeiten eingestanden und sich um einen
kooperativen Ansatz zu ihrer Behebung bemüht.
Das
„Widerstreben“, personifiziert in Ministerpräsident
Klaus, ist mittlerweile durch dessen Sturz bereinigt.
Der soll sich zwar der Tatsache verdanken, daß sich
wieder einmal eine Regierung „verbraucht“ hat,
allerdings hat Europa einiges zu diesem Verbrauch
beigetragen, indem es seine Regierungslinie samt seiner
Person demontiert hat. Die Europäische Kommission
hatte den Prager Depot-Erlaß damals scharf kritisiert.
Er verstoße gegen den freien Handel und insbesondere
gegen das Assoziationsabkommen. Klaus hatte jedoch der
Öffentlichkeit zuvor erklärt, die Brüsseler EU-Spitze –
die er kurz davor besucht hatte –, habe die Pläne als
problemlos gut geheißen.
(SZ
22.8.97)
[4] Eine weitere
schwierige Hinterlassenschaft ist die
Rüstungsindustrie: Zugeschnitten auf den Bedarf des
Warschauer Pakts handelt es sich nach dessen Ableben um
hoffnungslose „Überkapazitäten“. Das Problem besteht
aber nicht nur darin, daß sich auch dort ein
Produktionszweig „gesundschrumpfen“ muß, sondern in der
gesamten Ausstattung der nationalen Streitkräfte – eine
Frage, die in Verhandlungen mit der Nato und im
Nato-internen Streit um Kostenfragen geregelt wird.
Zwar haben alle Regierungen den Beschluß gefaßt, ihr
Militär nach Nato-Standards umzurüsten, die Kosten
übersteigen aber bei weitem die vorhandenen Mittel. Von
Staat zu Staat steht die Entscheidung an, in welchem
Maß auf die frühere Kooperation zurückgegriffen oder
auf Westimporte umgestellt wird. Das bietet wiederum
Gelegenheiten für die Regierungen, ihre
Anpassungsbereitschaft unter Beweis zu stellen und
Fragen der Kosten und des Erhalts nationaler Industrie
hinter diesen Gesichtspunkt zurückzustellen. Die
Prager mußten einsehen, daß vom natürlichen Volumen und
der geopolitischen Lage her Polen und nicht Tschechien
das Herzstück einer mitteleuropäischen Neuordnung
bilden werde. Ausgerechnet Washington, das der
eigentliche Adressat des Prager Solos war, hat Prag
soeben eingebleut, daß alles, was Polen vorwärtsbringt,
auch den Tschechen nützt… die fast befremdliche
Eilfertigkeit, mit der man nun auf mitteleuropäische
Gemeinsamkeit einzuschwenken sucht. Schon zaubert man
Konzepte für eine gemeinsame Luftverteidigung mit Polen
aus dem Zylinder, läßt eine Kommission prüfen, ob man
nicht besser amerikanische F-16-Flugzeuge kaufen solle,
statt die eigene, äußerst wirkungsvolle MiG-Flotte
sowjetischer Bauart auszubauen… Den Tschechen käme der
Neuerwerb ziemlich teuer: Das Ende der MiG-Umrüstung
brächte tschechische Firmen ums Brot; überdies wäre
wohl auch der Zukauf russischer Waffensysteme und
Ersatzteile endgültig ausgeschlossen. Mit solchen
Käufen hätte man die Milliardenschulden Moskaus bei
Prag verrechnen können (was Ungarn und die Slowakei
längst praktizieren). Also nur Verluste? Der Zugewinn
an politischem Realismus gen Westen und die
Wiederentdeckung der Nachbarn als unentrinnbarer
mitteleuropäischer Heimat ist nicht gering
einzuschätzen.
(Michael Frank,
SZ 22.9.95) In Ausnahmefällen – Tschechien –
bewähren sich Rüstungsartikel als viel zu
weltmarkttauglich; die USA haben prompt die nötigen
Lektionen erteilt, daß in dieser Branche der freie
Handel nicht erwünscht ist. In gewissen Fällen wiederum
bietet vorhandene Spitzen-Technologie, kombiniert mit
dem Angebot, sich darüber einen Markt zu erschließen,
einen Anreiz für westliches Rüstungskapital, sich in
Betriebe einzukaufen und sie nach westlichen Maßstäben
umzurüsten.
[5] Großzügig, wie
Europa nun einmal ist, mag es den Völkern nicht einfach
mit den gefährlichen AKWs den Strom abschalten; sie
über das europäische Stromnetz zu versorgen, wäre
wiederum ganz verkehrt. Woraus folgt, daß das
Geschäftsexperiment, östliche AKWs umzurüsten, die
einzig „sichere“ Lösung darstellt: Auf die
Nuklearindustrie entfallen im Durchschnitt der
Bewerberländer 30% der Elektrizitätserzeugung, in
einigen Ländern bis zu 80%. Die meisten Kernkraftwerke
wurden unter Einsatz sowjetischer Technologie errichtet
und genügen internationalen Sicherheitsnormen nicht.
Sie einfach stillzulegen, wäre keine Lösung, denn sie
stellen nicht alle dasselbe Risiko dar, und die Kosten
für den Aufbau einer alternativen Energieversorgung
wären äußerst hoch… Soweit Kernkraftwerke nach
westlichem Konzept betrieben werden (Rumänien und
Slowenien), sollte die Entwicklung beobachtet werden,
um sicherzustellen, daß den erforderlichen
Sicherheitsnormen Genüge getan wird.
Erforderlichenfalls kann technische Hilfestellung
geleistet werden.
Wenn es möglich ist, die
Sicherheit von in Betrieb oder in Bau befindlichen
Kernkraftwerken nach sowjetischem Konzept so zu
erhöhen, daß internationalen Sicherheitsnormen Genüge
getan wird, so sollte für eine vollständige Umsetzung
entsprechender Modernisierungsprogramme innerhalb von
sieben bis zehn Jahren gesorgt werden.
[6] Sie befinden sich in der Klemme zwischen Zinsversprechen, die sie beim Einsammeln der Kupons abgegeben haben, und mangelnden Einkünften aus ihren Zetteln. Die Masse der Papiere wirft keinen Gewinn ab, der Handel findet nur mit einer Kursbewegung nach unten, d.h. unter allseitigen Verlusten statt. Es drohen Pleiten der Fonds, deren Hauptaktivität in „Liquiditätsbeschaffung“ besteht, etliche Pleiten finden statt in Gestalt von „betrügerischen Zusammenbrüchen“, Fonds verschwinden von der Bildfläche und deren Inhaber auf die Bahamas. Andererseits „retten“ Banken ihre Fonds und geraten dadurch selber an den Rand des Zusammenbruchs.
[7] … daß Korruption
und Wirtschaftskriminalität ein bedrohliches Ausmaß
angenommen haben… ist ein problematischer Filz von
verbundenen Interessen entstanden, dessen
wesentlichster Nährboden in der großen, aber
undurchsichtigen und ungenügend kontrollierten Macht
einiger weniger, noch immer vom Staat kontrollierter
Banken sowie den von ihnen beherrschten
Investitionsfonds aus der Coupon-Privatisierung und in
der fehlenden Transparenz auf den Kapitalmärkten zu
suchen ist… von der Regierung Klaus allzu lange mit dem
Verweis auf die Selbstheilkräfte des Marktes
heruntergespielt worden.
(NZZ
6.5.97)
[8] Die neue Regierung
beweist Einsichtsfähigkeit und beschließt ein Gesetz
zur Trennung von Banken und Investmentfonds:
Gleichzeitig soll die gesamtwirtschaftlich
schädliche Verquickung zwischen den meist von den
Banken kontrollierten Investitionsfonds und der
Industrie aufgebrochen werden. Man habe im Mai von der
Welt einen Nasenstüber bekommen, aus dem alle gelernt
hätten, gesteht Svehla (der Sprecher der tschechischen
Nationalbank)… Novelle zum Bankengesetz… Nach diesem
Gesetz darf sich eine Bank an einer juristischen Person
aus dem Nicht-Bankenbereich nur bis zur Höhe von
maximal 15% ihres eigenen Kapitals beteiligen.
Kumuliert dürfen die Beteiligungen der Bank im
Nicht-Bankenbereich 60% ihres Eigenkapitals nicht
überschreiten… Die Maßnahmen dürften zu massiven
Veränderungen in den Eigentümerverhältnissen von Banken
und Unternehmen führen. Nach Angaben von Svehla sind
sich Nationalbank und Politik bewußt, daß man zur
Umsetzung dieser Riesenaufgabe jetzt nicht nur in
großem Umfang Kapital, sondern auch Manager mit
Fachwissen aus dem Westen benötigt. Beim Verkaufspreis
werde man realistischer sein als in der
Vergangenheit.
(FAZ
1.12.97)
[9] Das erste Gesetz
machte die 2. Welle der Voucher-Privatisierung
rückgängig… Das zweite Gesetz soll die Funktionen der
Investmentfonds beschränken… Mit dem dritten
legislativen Schachzug werden strategisch wertvolle
Unternehmen komplett oder teilweise aus dem
Privatisierungsprozeß ausgeklammert. Das Gesetz
betrifft rund 25 Firmen im Gas-, Kraftwerks-,
Telekommunikations- und Rüstungsbereich… Grundsätzlich
beschneiden alle drei Gesetze die Eigentumsrechte.
(Weidenfeld, a.a.O., S.181)
Dabei kommt es wiederum gar nicht darauf an, ob
überhaupt Geschäftsinteressen vorhanden sind, die diese
Rechte wahrnehmen möchten.
[10] Die
Verschiebung (einer Erhöhung der Energiepreise) führte
zu gewissen Irritationen auf seiten der ausländischen
Investoren im Energiesektor (RWE, Bayernwerk), die fest
mit Preisanhebungen (bzw. zugesicherten Gewinnmargen)
gerechnet hatten. Diese Preisanhebungen werden nun 1997
durchgeführt.
(BMWI-Dokumentation, Wirtschaftslage und
Reformprozesse in Mittel- und Osteuropa, S.49)
[11] So gesehen ist
auch die mit 3 bis 4% niedrige Arbeitslosigkeit weniger
ein Erfolg der Klausschen Reformpolitik als vielmehr
ein Symptom der versäumten Umstrukturierung der
tschechischen Wirtschaft.
(Verlagsbeilage der FAZ, 7.10.97)
[12] Es ist zwar schon
sehr viel an agrarischer Produktion kaputtgegangen:
… liegt die Agrarproduktion in den meisten
Beitrittsländern immer noch weit unter dem Niveau der
Zeit vor Beginn der Transformation
, aber immer noch
nicht genug. Das Armutswesen auf dem Land – die
polnischen Parzellen mit dem Rückfall auf
Subsistenzwirtschaft, in anderen Staaten durch die
Privatisierung von Grund und Boden neu eingeführt,
verschuldete Kooperativen, nur ausnahmsweise
konkurrenzfähig gegenüber EU-Exporten – paßt auf gar
keinen Fall in die EU, die Zulassung zum europäischen
Agrarmarkt ist ausgeschlossen. Ein Bauernlegen größeren
Ausmaßes, d.h. natürlich ein
„Strukturanpassungsprozeß“, ist das Mindeste, was die
EU von ihnen fordert.
[13] Passend dazu
haben Volkswirtschaftler die Theorie der
„Überindustrialisierung“ entwickelt: Verglichen mit
einem Land mit normaler Wirtschaftsstruktur waren Ende
der achtziger Jahre vor allem Polen und die
Tschechoslowakei (ebenso wie Rumänien und Bulgarien)
stark überindustrialisiert. Anders gewendet: Hätten
diese Staaten allzeit ein marktwirtschaftliches System
gehabt, dann wäre ihr Industrieanteil vermutlich
deutlich niedriger gewesen.
(Klaus-Dieter Schmidt: Reif für die EU?
Wirtschaftliche Transformation ohne Wandel? in: Der
Bürger im Staat, 3/97, S.170) Bisher wurde man
vor allem darüber belehrt, daß der reale Sozialismus
eine Mangelwirtschaft war, in der es an allen Stellen
am nötigen Reichtum gefehlt hat; interessant zu hören,
daß Europa das genau andersherum betrachtet.
[14] Es ist kein
Rätsel, welche Geschäftszweige unter dem europäischen
Gebot rentablen Produzierens für die
Beitrittskandidaten überhaupt in Frage kommen, aber
auch da leistet sich die EU-Kommission den Verdacht auf
unerlaubte Konkurrenztechniken: Im sozialen Bereich
sind die Standards in den Bewerberländern im
allgemeinen niedrig, insbesondere was die öffentliche
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz anbetrifft.
Eine zu langsame Anpassung dieses Standards könnte den
einheitlichen Charakter des acquis untergraben und sich
möglicherweise verzerrend auf das Funktionieren des
Binnenmarkts auswirken…
Wie im Bereich der
Sozialpolitik wären nationale langfristige
Entwicklungsstrategien, die auf Wettbewerbsvorteile
aufgrund niedriger Umweltstandards setzen, innerhalb
der Union nicht akzeptabel.
Was für eine
„Verzerrung“: Der Geschäftsvorteil von Billiglöhnern
und der Nicht-Einhaltung von Umweltvorschriften – genau
das, was das westliche Kapital an diesen Ländern
schätzt und benützt! – wird vom Standort Europa
gegenüber diesen Armutsverwaltungen als Regelwidrigkeit
in Anschlag gebracht. Wohlweislich gibt die Kommission
aber keine weiteren Empfehlungen ab, womit sie denn
konkurrieren sollten.
[15] Das Vorbild an
Reformeifer ist auch in diesem Fall wieder Ungarn:
Die Konsolidierungspolitik der letzten zwei Jahre
hatte für die Mehrheit der Bevölkerung einen hohen
sozialpolitischen Preis. Die Reallöhne sanken 1995 und
1996 um etwa 15%. Auch die Renten fielen drastisch.
Dies sollte man allerdings keinesfalls als Leistung der
Marktwirtschaft begreifen: Sicherlich lebte ein
Großteil dieser Menschen schon vorher in versteckter
Armut, die mit Einführung demokratischer Verhältnisse
nun offengelegt wurde.
Fragt sich nur, weshalb
dann, wenn es eigentlich immer schon so war, die Sorge
über die politische Kontrollierbarkeit aufkommt: Die
soziale Lage bleibt gespannt.
Das wiederum erklärt
sich – wissenschaftlich – aus der subjektiven
Wahrnehmung, die sich die Ungarn gegenüber ihrem
früheren objektiven Standard zugelegt hatten: Auch
ist die subjektive Wahrnehmung des sozialen Abstiegs in
Ungarn insofern stark ausgeprägt, als der
Lebensstandard bereits in den 80er Jahren einen trotz
Kommunismus beachtlichen Standard erreicht hatte… Es
entbehrt nicht einer gewissen Ironie, daß die
Sozialisten zu einem drastischen Sparprogramm gezwungen
wurden, um eine dramatische Verschärfung der
Verschuldungskrise zu vermeiden.
Die „Ironie“ soll
wohl darin bestehen, daß „Sozialisten“ tätige Reue
beweisen und eigenhändig ein Volk verarmen, dem es
unter ihrer früheren Herrschaft zu gut gegangen ist.
(BMWI-Dokumentation,
Wirtschaftslage und Reformprozesse in Mittel- und
Osteuropa, S.50f)
[16] Damit ist außerdem der Effekt beabsichtigt, die Zwangsersparnisse der Bevölkerung in „Versicherungen mit Kapitaldeckung“ umzuleiten, damit sie sich dort als Kreditquelle für das erwünschte Wachstum nützlich machen. Die Idee ist ein bißchen zu schön, um wahr zu sein, ist aber auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, den Völkern die alte „Versorgungsmentalität“ abzugewöhnen.
[17] Die
Finanzfachleute beschweren sich einerseits über ihre
eigene „Unstetigkeit“, in letzter Instanz aber darüber,
daß sich die Reformländer nicht zu der soliden
Geschäftssphäre entwickeln, die ihrer Spekulation
Beständigkeit verleihen könnte. Dabei wäre das Rezept
doch ganz einfach zu befolgen: Dieser unstete
Zustrom von Auslandskapital ist für die immer wieder zu
beobachtenden starken Schwankungen an den
Reformländerbörsen verantwortlich. Erst die
Stabilisierung der Inlandsinvestitionen wird hier
stabilisierend wirken. Die Entwicklung der
Inlandsersparnisse, der Aufbau eines effizienten Geld-
und Kapitalmarkts müssen deswegen vorrangig betrieben
werden.
(Verlautbarung einer
von internationalen Kreditagenturen veranstalteten
„Investorenkonferenz“, FAZ 29.1.97)
[18] Ob sich diese
Institution als Methode zur Gesundung nationaler
Finanzen bewährt, kommt ganz darauf an, welche anderen
Interessen an der Nation gegeben sind. Im Fall Estlands
z.B. ist es gelungen, seit 1992 einen festen
Wechselkurs zur DM und die EU-Tauglichkeit der
estnischen Krone zu organisieren. Allerdings weniger
durch die verordnete „Gelddisziplin“ als dadurch, daß
Europa auf Kontingentierungen und andere
Einfuhrbeschränkungen verzichtet: …die hohe
Bedeutung der Lohnveredelung. Die in den
Europa-Abkommen festgeschriebenen Möglichkeiten der
Ausweitung des Handels mit der EU durch Lohnveredelung
(ohne dabei unter eine Quote zu fallen) führen zu einem
verstärkten Engagement vor allem skandinavischer Firmen
auf diesem Gebiet.
(BMWI-Dokumentation: Wirtschaftslage und
Reformprozesse in Mittel- und Osteuropa. Sammelband
1997, S.120) Die europäische Pflege gemeinsam
mit skandinavischen Kapitalzuflüssen und den Erträgen
aus den Geschäften der russischen Mafia und russischem
Rohstoffschmuggel hat dann die estnische Qualifikation
zum EU-Kandidaten gestiftet.
[19] Gleichzeitig
stellen allein die Zahl der Beitrittskandidaten und das
damit verbundene sehr große wirtschaftliche und soziale
Gefälle die Europäische Union vor nie dagewesene
institutionelle und politische Herausforderungen. Ihre
Bevölkerung wird möglicherweise um mehr als ein Viertel
auf nahezu 500 Millionen anwachsen, das Gesamt-BIP
jedoch nur um knapp 5%… Die Osterweiterung würde 100
Mio. Verbraucher zusätzlich bringen, wobei die
durchschnittliche Kaufkraft aber nur rund ein Drittel
derjenigen der derzeitigen Verbraucher in der Union
erreicht… Nach den derzeitigen Regeln wären sämtliche
Regionen der Beitrittsländer förderwürdig im Sinne von
Ziel 1.
– das bedeutet die Berechtigung auf
Fördermittel aus den Strukturfonds, wenn das
Bruttosozialprodukt pro Kopf in einem bestimmten
Prozentsatz unter dem in der EU liegt. Für die Zukunft
schlägt die EU-Kommission die Beschränkung vor, daß
die Unterstützung nur denjenigen Regionen zugute
kommt, deren Pro-Kopf-BIP weniger als 75% des
EU-Durchschnitts beträgt.
[20] Darin sind sich
die europäischen Instanzen ausnehmend einig, daß die
neuen Mitglieder keinesfalls auf die bisher in Europa
gültige Betreuung des Bauernstands Anspruch erheben
dürfen. Weder Europa noch den Beitrittsländern
– darauf legt die EU-Kommission Wert! – wäre
schließlich mit ihrer Aufnahme in den bisherigen
Agrarmarkt gedient: Die gemeinsame Agrarpolitik
(GAP) in ihrer derzeitigen Gestalt auf die
Beitrittsländer zu übertragen, brächte Probleme mit
sich. In Anbetracht des Preisgefälles zwischen den
Beitrittsländern und den im allgemeinen beträchtlich
höheren GAP-Preisen würde, auch wenn sich der Abstand
in einigen Bereichen bis zu den jeweiligen
Beitrittsterminen etwas verringern könnte, selbst eine
schrittweise Einführung von GAP-Preisen leicht
Überschußproduktion hervorrufen… Ihre Überschüsse auf
Drittlandsmärkten abzusetzen, wäre der erweiterten
Union aufgrund der Regeln der Welthandelsorganisation
(WTO) über Exportsubventionen verwehrt. Eine
Übertragung der GAP würde außerdem eine große
haushaltsmäßige Belastung bedeuten, in Höhe von
schätzungsweise rund 11 Mrd. ECU pro Jahr, davon
annähernd zwei Drittel für Direktzahlungen an
Landwirte. Eine starke Anhebung der Agrarpreise und
hohe Direkttransfers an Landwirte würden sich auf die
Beitrittsländer in wirtschaftlicher und sozialer
Hinsicht nachteilig auswirken.
[21] Um Ansprüche auf
Mittel aus diesen Fonds geltend machen zu können,
müssen die künftigen Mitglieder erst einmal sehr viel
Mittel für die Einrichtung der in umfänglichen Kapiteln
über die nötige „Finanzkontrolle“ umrissenen
Staatsorgane, inklusive der Neueinrichtung staatlicher
Unterinstanzen samt Verwaltungsreform etc. aufbringen:
Die Kapazität der Verwaltung und Justiz ist für die
Übernahme; Umsetzung und Durchsetzung des acquis und
für eine effiziente Verwendung der Finanzhilfen, vor
allem aus den Strukturfonds von größter Bedeutung. Es
kommt entscheidend darauf an, daß das Recht der Union
in innerstaatliches Recht umgesetzt wird… Dies wird
vielfach neue Verwaltungsstrukturen sowie gut
ausgebildete und angemessen besoldete Beamte
erfordern.
[22] Gleichzeitig
mit der Intensivierung der Heranführungsstrategie wird
die Unterstützung vor allem finanzieller Art, die die
Europäische Union den beitrittswilligen Ländern und
ihren Programmen zur Vorbereitung auf ihre Pflichten
als künftige Mitgliedstaaten gewährt, ab 1998 stärker
an bestimmte Bedingungen geknüpft werden. Dies wird auf
der Grundlage von bereits eingegangenen Verpflichtungen
oder Zielen geschehen, die zusammen mit den
beitrittswilligen Ländern im Rahmen der Partnerschaft
für den Beitritt genauer festgelegt werden…
[23] Der Beweis dafür,
daß mehr an Förderung nichts nützt, wird folgendermaßen
geführt: Ohnehin kann die EU nicht davon ausgehen,
das gigantische Subventionssystem auf die Neumitglieder
zu übertragen. Die Behörden in den osteuropäischen
Staaten wären schlicht überfordert. Schon jetzt gibt es
bei der Verteilung der PHARE-Mittel, mit deren Hilfe
sich die Kandidaten für den Beitritt fit machen wollen,
erhebliche Managementprobleme. So stehen im Zeitraum 94
bis 99 EU-Gelder in Höhe von insgesamt 6,7 Mrd ECU zur
Verfügung. Doch fast 3 Milliarden konnten bisher nicht
ausgegeben werden, unter anderem, weil es an
förderungswürdigen Projekten in Osteuropa fehlt.
(SZ 11.11.97) Es kommt eben
darauf an, was man an Kriterien für „förderungswürdige
Projekte“ festlegt.
[24] Die Beitrittskandidaten haben einige Kapitel Desillusionierung schon hinter sich. Zu Beginn nimmt vor allem Polen den Standpunkt ein, die Vorreiter der Reform im Ostblock hätten so etwas wie ein Recht auf ihrer Seite, von Europa gefördert und aufgenommen zu werden – der damalige Präsident Walesa hat sich in seiner Enttäuschung darüber, das von einem solchen Recht nicht die Rede war, zuweilen bis zu Drohungen eines alternativen Bündnisses verstiegen. Inzwischen stellt sich die Orientierung auf die EU aber schlicht als Sachzwang dar, an dem keiner der Kandidaten mehr vorbeikann, so daß auch die Enttäuschungen in der Regel europa-dienlich verarbeitet werden.
[25] Auf deutscher
Seite herrscht besondere Genugtuung: Insbesondere
für die Deutschen sei dies ein großer Tag, weil künftig
Deutschland nur noch von Freunden und Partnern umgeben
sein werde.
(FAZ
15.12.97) Schließlich geht das Projekt auch auf
deutsche Initiative zurück, mit der es seinen Nachbarn
den Standpunkt beigebracht hat, sich alternativlos auf
die Linie der deutschen Europapolitik zu verpflichten.
Der deutsche Standpunkt, nach dem Deutschland, gemessen
an seinem wirtschaftlichen „Gewicht“ und seiner
politischen „Verantwortung“, „zu klein“ ist, hat nach
der Wiedervereinigung prompt weiteren Einigungsbedarf
entdeckt – in der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft,
die sich zur Union fortentwickeln soll, und ebenso im
Osten Europas. Deutschland hat die Gelegenheit be- und
ergriffen: Vor sich hat es eine aufgelassene, für sich
ziemlich unfähige Staatenwelt, gegenüber der es immer
schon seine revanchistischen Interessen angemeldet hat,
für deren auswärtige Anerkennung es besondere Hebel
erworben hat und geltend machen kann, nämlich aus dem
Osthandel resultierende Rechte und Mittel als
Haupthandelspartner und -gläubigernation. Deutsche
Leistungen in Sachen Aufweichung und ökonomische
Untergrabung des realen Sozialismus lassen sich nun in
Ansprüche gegenüber den östlichen Nachbarstaaten
ummünzen, die sich nicht auf Minderheiten- und
Grenzfragen beschränken, sondern diese Staaten gänzlich
unter deutsche Kuratel stellen möchten. Die deutsche
Parole, nach der es gilt, aus der Randlage zum
Mittelpunkt Europas aufzurücken, ist die geographische
Metapher für die deutschen Ambitionen, durch östlichen
Zugewinn den europäischen Block und die deutsche
Führungsmacht über ihn zu stärken. Mit dieser Linie hat
sich die Bundesrepublik in Europa durchgesetzt. Der
anfängliche Widerstand Englands und Frankreichs – die
Einwände haben sich auf die ökonomische Unbrauchbarkeit
der Gegend im Verhältnis zu einer EWG berufen – wurde
mit der scheinheiligen deutschen Bitte um „Einbindung“,
damit Deutschland keinen gefährlichen „Sonderweg“ gehen
müsse, überwunden. Die Partner haben die Lage so
begriffen, daß, wenn sich schon deutsche
Sonderbeziehungen und -rechte im Osten nicht verhindern
lassen, sie immerhin im Rahmen der EU so zu
organisieren sind, daß ein Mitreden und Beteiligung
möglich ist. Frankreich, im Namen der
deutsch-französischen Achse und vermittels des
Mittelmeerschachers dafür gewonnen, setzt sich
mittlerweile zusammen mit Deutschland als Vorantreiber
ein, was sich z. B. auch in deutsch-französischen
Sonderbeziehungen zu Polen niederschlägt (Weimarer
Dreieck); Italien ist seinerseits mit parallelen
Interessen im Süden unterwegs. Schließlich leuchtet den
anderen europäischen Imperialisten auch der Weg der
Vergrößerung Europas, das Erfordernis einer
europäischen Ordnungspolitik ein, so daß der Streit um
Erweiterung oder Vertiefung im deutschen Sinn
entschieden worden ist.
[26] Welchen Vorstoß Europa sich damit leistet, ist den Zuständigen, die als erstes Estland eingemeinden, offensichtlich bewußt: Demonstrativ bescheinigt die EU-Kommission den beiden anderen baltischen Staaten, daß sie „ernste Schwierigkeiten haben“ würden, „dem Wettbewerbsdruck und den Marktkräften in der Union mittelfristig standzuhalten“, „verzichtet“ vorerst auf Beitrittsverhandlungen und bindet sie stattdessen in alle möglichen anderen Beziehungen und Verträge ein.
[27] Die
Politikwissenschaft würdigt die Leistung der
EU-Diplomatie bei der Entmachtung Rußlands auf ihre
Weise: Daher rückte für die EU seit 1995 die Frage
in den Vordergrund, wie sie zum Aufbau einer neuen
Sicherheitsarchitektur in Europa beitragen und sich in
die kontroverse Diskussion um die Nato-Öffnung
einschalten könnte. Zwar ist sich die EU bewußt, daß
sie die Nato nicht ersetzen kann. Gleichwohl sieht sie
ihre Aufgabe darin, einer Verengung der Beziehungen
Rußland – Westen auf die militärische Dimension
entgegenzuwirken und sie durch einen intensiven
politischen Dialog und dichte Wirtschaftsverbindungen
wirkungsvoll einzurahmen.
(Heinz Timmermann: Osteuropa: „Drang nach
Westen“ – Möglichkeiten und Hemmnisse, Osteuropa 6/97,
S.539f) „Entgegenwirken“ und „Einrahmen“ ist ja
auch ziemlich dasselbe.
[28] Die in Prag
geborene Albright fordert einen ‚erstklassigen Beitrag‘
des Landes zur Nato. Notwendig seien die Modernisierung
und Anpassung der Streitkräfte an Nato-Standards… habe
die Regierung entschieden, den Verteidigungshaushalt
jährlich um 0,1% des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen.
Die aus der Weltbank geäußerte Sorge, durch erhöhte
Rüstungsausgaben könnten sich die künftigen
Nato-Mitglieder übernehmen und haushaltspolitisch große
Risiken eingehen, hält Suman (stellvertretender
Verteidigungsminister) jedoch für unbegründet.
(FAZ 16.7.97)
[29] Die Slowakei
unterhält gute und enge Beziehungen zu Rußland: So
enthält das Abkommen über militärische Zusammenarbeit
vom 26.8.93 (eines von 70 zwischen der Slowakei und
Rußland geschlossenen Abkommen) die Verpflichtung,
unverzüglich Konsultationen aufzunehmen, falls ein
Vertragspartner seine Sicherheit gefährdet sieht.
[30] Wenn die
Minderheitenprobleme nicht gelöst werden, könnten sie
die demokratische Stabilität beeinträchtigen oder zu
Streitigkeiten mit den Nachbarländern führen. Daher
liegt es im Interesse der Europäischen Union wie auch
der Beitrittsländer selbst, daß vor Vollendung des
Beitrittsprozesses zufriedenstellende Fortschritte bei
der Eingliederung von Minderheiten erzielt werden.
[31] In der
Slowakei dagegen werden diese Rechte zwar prinzipiell
anerkannt, doch stößt die ungarische Minderheit bei der
Ausübung ihrer Rechte auf eine Reihe von Problemen.
Nach der Verabschiedung des Gesetzes über die
offizielle Landessprache und in Ermangelung eines
Gesetzes über die Verwendung der Sprachen von
Minderheiten ist die Wahrnehmung verschiedener Rechte
der ungarischen Minderheit in Frage gestellt. Bestimmte
Entwicklungen der letzten Zeit im Zusammenhang mit
Kürzungen kultureller Subventionen und der
Neueinteilung der Verwaltungsbezirke des Landes geben
Anlaß zu Besorgnis.
Die Probe auf demokratische
Reife in umgekehrter Hinsicht unterbleibt. Die seit 56
in Österreich befindliche ungarische Minderheit und die
Massen polnischer Schwarzarbeiter in Deutschland hat
noch niemand auf ihre europäischen Rechte aufmerksam
gemacht, daß sie eigene Schulen brauchen und auf Ämtern
in ihrer Sprache verkehren können müßten – in
entwickelten Demokratien werden diese Rechte
schließlich auch nicht benötigt! Ein ganz anderer Fall
sind wiederum Estland und Lettland mit ihren russischen
„Minderheiten“. Sie genießen das Verständnis der EU,
daß wegen jahrelanger „Fremdherrschaft“ und der Gefahr
der „Überfremdung“ durch die großen russischen
Volksteile etliche Schikanen angebracht sind, der
Erwerb von Staatsbürgerrechten z.B. an den Nachweis
estnischer und lettischer Sprachkenntnisse gebunden
ist. Auch die Tatsache, daß Estland noch kein
Grenzabkommen mit seinem Nachbarn Rußland abgeschlossen
hat, erklärt die EU nicht zum Hinderungsgrund für den
Beitritt – hier wird Rußland eine absichtliche
Verzögerung des Vertragsabschlusses zur Last gelegt.
[32] „Kutschma zum
viertenmal innerhalb von 7 Monaten mit dem polnischen
Staatschef Kwasniewski zusammengetroffen…
weißrussisch-russische Annäherung… Vor diesem
Hintergrund gewinne Warschau für Kiews Außenpolitik
strategische Bedeutung
, erklärte der ukrainische
Außenminister Udowenko. … nicht träumen lassen, daß
beide Länder ihren Außenhandel von einer Mrd $ im Jahr
95 bereits ein Jahr später auf 1,5 Mrd $ bringen würde.
Polen hat die Ukraine inzwischen als Absatzmarkt
identifiziert und nach westlichem Vorbild eine
Kreditlinie für Exporte in die Ukraine im Umfang von 20
Mio Ecu eröffnet. Über eine engere Zusammenarbeit in
der Rüstungsindustrie und im Agrarsektor wird bereits
seit längerem verhandelt. Rund 700 polnische Joint
Ventures sind in der Ukraine registriert.“ (NZZ 24.1.97)
[33] All das hat man
als „Export von Frieden und Stabilität“ zu begreifen,
in der Begeisterung über Europas imperialistische
Erfolge geraten die Kommentatoren schon einmal außer
sich: „…ein Aussöhnungsprozeß von epochaler Tragweite.
Wie von unsichtbarer Hand geleitet, setzen sich
Staatsmänner in Mittel- und Osteuropa an einen Tisch
und besiegeln mit ihren Unterschriften
Versöhnung
, Verständigung
, Anerkennung
der Grenzen
und gute Nachbarschaft
… Was hat
dieses wahre Feuerwerk der Verständigung und Versöhnung
möglich gemacht?… Balladurs Pakt für Stabilität in
Europa
… Im März 95 wurde er von den
Mitgliedsländern der OSZE verabschiedet. Sein Hauptziel
war es, alle Staaten in Europa auf die einvernehmliche
Regelung von Grenz- und Minderheitenfragen zu
verpflichten. Nicht weniger deutlich war die von der
Nato im September 95 erarbeitete Studie über die
Erweiterung des Bündnisses… Bereinigung von Grenz- und
Nachbarschaftskonflikten… Brüder, in eins nun die
Hände: Das Vermächtnis des russischen Revolutionärs
Radin von 1897 ist der Wirklichkeit näher gerückt – und
das ausgerechnet unter dem vierzackigen blauen Stern.
Wer hätte das gedacht?“ (FAZ
28.5.97) Wer hätte das gedacht, daß Europa und
der Nato die Gelegenheit zur friedlichen Einverleibung
von ganz Mitteleuropa geboten wird, die Gelegenheit,
einer ganzen Reihe von anschlußbedürftigen Staaten die
Bedingungen des Anschlusses zu diktieren. So unsichtbar
ist die Hand denn doch nicht, die dieses Friedenswerk
zustandegebracht hat, im Warschauer Pakt hat es
schließlich auch keine Kriege gegeben. Damals haben die
bezahlten Lobhudler des europäischen Imperialismus
allerdings genau gewußt, daß es sich bei dem Zustand
nur um eine „Friedhofsruhe“ handeln kann.
[34] Angesichts
wachsender grenzüberschreitender Kriminalität hat
Sachsens Innenminister die rasche Aufnahme Polens,
Ungarns und Tschechiens in das Schengener
Fahndungssystem gefordert. ‚Dies käme einem doppelten
Schutz der EU, einer Art zweiten Sicherheitsgrenze
gleich und würde die Voraussetzungen für den
EU-Beitritt dieser Länder verbessern‘.
(SZ 24.10.97)
[35] Das entbindet die westliche Presse nicht von ihrer Verantwortung, nach jedem Regierungswechsel die Neuen mit der obligatorischen Frage zu belästigen, ob sie auch ihre Pflichten in Europa kennen. „Spiegel: Sie müßten eigentlich Hunderte unrentabler Industrieanlagen schließen, gerade auch Bergwerke in Ihrer schlesischen Heimat. Und noch immer arbeitet fast ein Viertel aller Beschäftigten in der Landwirtschaft, in oft wenig produktiven Kleinbetrieben. Sind Sie denn wirklich zu harten Schnitten bereit? Buzek: Wir werden nicht umhin können, Strukturen zu beseitigen, die bisher die freie Marktwirtschaft eingeengt haben. Spiegel: Und in dieser Situation verlangen Sie von ihrer Bevölkerung auch noch Opfer für die Finanzierung des für 1999 beschlossenen Nato-Beitritts? Buzek: Wir haben immer gesagt: Wir Polen sind bereit, diese Kosten zu tragen, und wir sind auch willens, alle nötigen Veränderungen vorzunehmen, um unsere Streitkräfte Nato-kompatibel zu machen.“ (15.12.97)
[36] Auch der
amerikanische Verteidigungsminister Cohen wies darauf
hin, daß sich die Kandidaten um die Zustimmung des
Kongresses ernsthaft durch entsprechende Leistungen
bemühen müßten… Besorgnisse richteten sich insbesondere
auf die Tschechische Republik, deren Bevölkerung
Umfragen zufolge der Nato mehrheitlich skeptisch
gegenübersteht
. (FAZ
4.10.97)
[37]
Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß den
Parteien häufig das Gespür für die politische
Kompromißfindung fehlt.
(Werner Weidenfeld, Hrsg.: „Mittel- und
Osteuropa auf dem Weg in die Europäische Union“,
Gütersloh 1996, S.13)
[38] Forschungsgruppe Europa am Centrum für angewandte Politikforschung der LMU München. Bestandteil eines Kriterienkatalogs, der gemeinsam mit der Europäischen Kommission ausgearbeitet wurde.
[39] Die Regierung
sei bereit, ‚die Form der europäischen Integration so
anzunehmen, wie sie im Augenblick der Aufnahme
existieren wird‘.
(FAZ
24.7.96)
[40] Je nach Sachlage entdeckt Europa seinen Bedarf, diesem Verdacht weiter nachzugehen. Zu Beginn hat man keinen nachdrücklichen Wert auf Kommunistenverfolgung gelegt. Einerseits deshalb, weil die Nationen selber die Modalitäten des Übergangs festgelegt haben; in Polen hat die PVAP ihren freiwilligen Abgang gegen entsprechende Zusicherungen ausgehandelt, in Ungarn hat die Staatspartei den Systemwechsel mit allen Konsequenzen selbst organisiert. Andererseits erschien es den europäischen Instanzen auch gar nicht zweckmäßig, noch mehr an staatlicher Destabilisierung zu erzeugen, als der Übergang ohnehin mit sich gebracht hat, so daß der Europa-Rat auch einmal Einwände gegen das tschechische Lustrationsgesetz als Verstoß gegen die Menschenrechte vorgebracht hat. Inzwischen wird die Materie etwas anders beurteilt: Wenn die Parteienkonkurrenz in Polen das Thema hochkocht, wird auch von außen das Bedürfnis nach einer Gauck-Behörde bestärkt. In Rumänien wird die gesamte Regierungsphase unter Iliescu als Fortsetzung der KP-Herrschaft behandelt, Bulgarien dito, und die Aufräumprogramme der neuen Regierungen werden begrüßt. Im Namen der Demokratie kennt auch Europa die Notwendigkeit von Säuberungen.