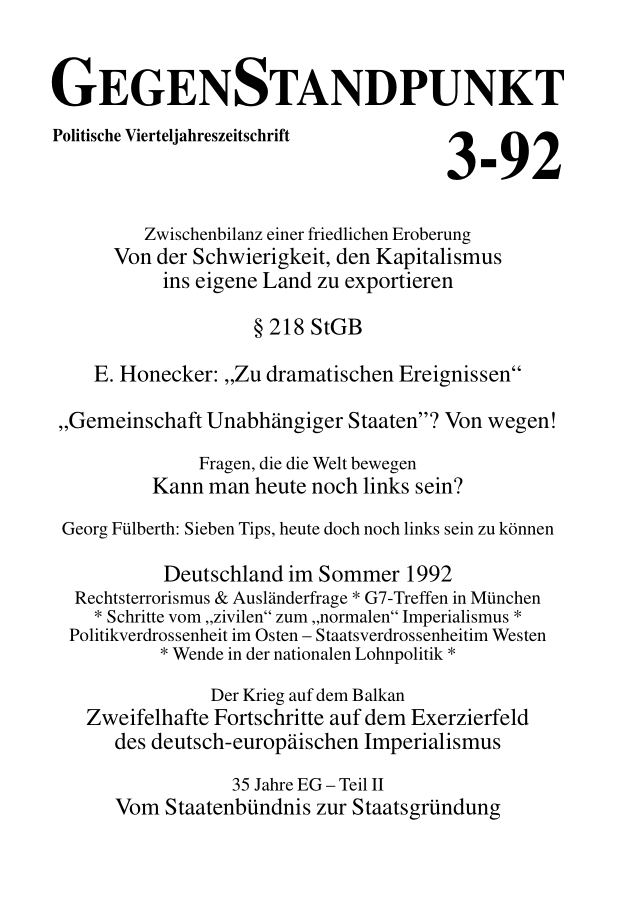35 Jahre EG (Teil II): Vom Staatenbündnis zur Staatsgründung
Fortschritte und Widersprüche eines imperialistischen Projekts
In Abschnitt A das Programm zur „Vollendung des Binnenmarktes“ als entscheidende Wende für Europa: Eurostaaten nicht mehr als souveräne Nutznießer und Setzer der Bedingungen ihres nationalen Kapitalismus, sondern Unterwerfung unter die Geschäftsgrundlagen eines gemeinschaftlichen Gesamtstandortes. Das bedeutet – politisch zu fixierende – Aufgabe von Souveränitätsrechten, die v.a. auch das Programm der Währungsunion betrifft (Abschnitt B), die Schaffung eines Gemeinschaftsgeldes, für das die Nationen um Standortvorteile konkurrieren und „Entschuldungsopfer“ bringen müssen. Diese Herausforderungen werden vorangetrieben, um die Konkurrenz gegen die Weltwirtschafts- und Weltgeldmacht Nr. 1 gewinnen zu können, und stacheln das Projekt der politischen Einheit an (Abschnitt C).
Aus der Zeitschrift
Teilen
Siehe auch
Systematischer Katalog
35 Jahre EG (Teil II)
Vom Staatenbündnis zur Staatsgründung
Fortschritte und Widersprüche eines imperialistischen Projekts
A. „Vollendung des Binnenmarkts“
I.
Was unter diesem Titel in Maastricht bekräftigt wurde und bis Ende 92 im Großen und Ganzen verwirklicht sein soll, ist einerseits die Fortsetzung des Programms, mit dem die Staaten der EG ihren Dienst am kapitalistischen Wachstum – ihrem erklärten Lebensmittel – mehren. Sie beseitigen eine letzte Garnitur von „Handelshemmnissen“, die sie der grenzüberschreitenden Zirkulation von Ware, Geld und Kapital bereiten. Betroffen sind Maßnahmen der nationalen Wirtschafts- und Finanzpolitik, durch die die europäischen Souveräne unter ihrer Hoheit laufende Geschäfte fördern oder einschränken, um sie als Sphäre ihres speziellen Zugriffs auf Reichtum zu erhalten.
Mit diesem Verzicht auf die Schaffung besonderer Handels- und Investitionsbedingungen, die der nationalen Bilanz zugutekommen, vollziehen die EG-Staaten andererseits eine entscheidende Wende im Programm „Europa“. Sie begeben sich des Rechts auf eine nationale, auf Kosten der innereuropäischen Konkurrenz gehende Standort-Politik. Politische Vorteilsrechnungen, die zur unterschiedlichen Behandlung des Kapitals führen, je nach dem Territorium, auf dem es sich lokalisiert hat, zählen nicht mehr – sowohl Schutz als auch Behinderung entfallen als Mittel der Konkurrenz zwischen den Nationen. Für die Geschäftswelt ist Europa ein Standort; sie trifft in allen Mitgliedsstaaten auf die gleichen Geschäftsbedingungen, soweit diese sich politischen Vorschriften für die Qualität von Waren, der Besteuerung und den Gesetzen bezüglich des Umgangs mit Geld und Kredit verdanken.
*
Die Wirtschaftspolitiker der EG kennen und befolgen für ihr Programm, den „Gemeinsamen Markt“ zu einem umfassenden „Binnenmarkt“ weiterzuentwickeln, einen klaren Leitfaden. Sie nehmen den Standpunkt der Privatwelt des Geschäftemachens ein, das sich immer wieder durch die Existenz von Staatsgrenzen innerhalb der EG und durch die verschiedenartigen Regeln und Bedingungen, die hinter der jeweils nächsten Grenze gelten, behindert sieht. Ob die private Geschäftswelt das wirklich so sieht, spielt dabei keine Rolle; die Wirtschaftspolitiker werden ja nicht selber zu Kaufleuten, die je nach der Art ihrer Geschäfte an nationalen Abgrenzungen und Sonderkonditionen allemal auch Vorteile finden. Sie verfolgen vielmehr das politische Projekt, eine europaweite Privatwelt des Kapitalumschlags herzustellen, auf die etwas so Un-Privates und Un-Geschäftliches wie nationale Grenzen und Diskriminierungen einfach nicht paßt. Mit der Borniertheit eines idealtypischen Geschäftsmenschen, der „von der Ostsee bis zum Mittelmeer“ auf keine durch die Verschiedenheit der jeweils zuständigen nationalen Souveräne gesetzten Behinderungen stoßen will, identifizieren sie politische „Hemmnisse“ und schaffen sie aus dem Weg. Dabei spielt es gar keine Rolle, ob die zu revidierenden nationalen Vorschriften tatsächlich mit dem Ziel oder dem Hintergedanken einer Behinderung von Geschäftsunternehmungen aus dem Ausland bzw. einer Bevorzugung des Geldmachens vom eigenen nationalen Boden aus erlassen worden sind oder aus ganz anderen Gründen – es stellt sich sowieso allemal heraus, daß keine Maßnahme, die abgrenzend wirkt, dies nicht auch irgendwie beabsichtigt. Auch nach der mittlerweile abgeschlossenen Abschaffung der Zölle innerhalb der Gemeinschaft und anderer expliziter Ex- und Importbeschränkungen gibt es daher viel zu tun.
- So haben alle zivilisierten Staaten die Erfahrung hinter sich, daß kapitalistische Warenproduzenten, wenn es ihrem Geschäft nutzt und man sie läßt, gefährlichen Schund anbieten, fragwürdige Lebensmittel etwa oder unsichere Elektroartikel. Also haben sie alle Schutzvorschriften erlassen, die ungefähr so umfangreich und umständlich sind wie das kapitalistische Eigentum skrupellos und erfindungsreich – und so unterschiedlich, wie es zum einen von souveränen Behörden nicht anders zu erwarten ist und zum andern bekömmlich erschien für die je hauseigene Lebensmittel-, Elektro- usw. -Industrie. Diese berechnenden Abweichungen bei Normen, Maßen usw. werden nun als pure technische Handelshemmnisse „entlarvt“ und mit einem Kunstgriff entschärft, auf den die Brüsseler Binnenmarktwirtschaftler sehr stolz sind: Was immer ein EG-Land als passende Norm, hinreichenden „Verbraucherschutz“ usw. definiert hat, soll – vorbehaltlich gewisser Gemeinschaftsregeln – auch in allen anderen Ländern als korrekt und ausreichend gelten. Auf diese Weise wird pauschal das erfolgreichste Geschäftsgebaren europaweit ins Recht gesetzt und das kostspieligste Vorschriftenwesen außer Kurs, ohne daß die legendären „Eurobürokraten“ vorab alles vereinheitlichen müßten – die verlassen sich darauf, daß die Konkurrenz schon von ganz allein für ein wachsendes Maß an Einheitlichkeit sorgt.
- Im Finanzgeschäft, das aus Schulden Kapital, also aus einem Minus ein Plus macht, und bei den eigenartigen „Produkten“, die da jedem Geldbesitzer oder Schuldeninhaber angeboten werden, hat die marktwirtschaftsgemäße Staatsaufsicht andere, höhere Werte zu schützen. Hier gehen Schwindel und seriöses Geschäft, Betrug und Dienst am Kunden ziemlich bruchlos ineinander über, weil der Unterschied letztlich nur im Ergebnis liegt – schiefgegangene Kreditgeschäfte waren Schwindel, geglückte Spekulationen seriös. Um so wichtiger nimmt die Staatsgewalt ihren Auftrag, das Eigentum ihrer finanzkräftigen Bürger vor einer Verschleuderung durch Finanzschwindler zu bewahren. Denn schließlich geht es hier nicht bloß um privates Geld und auch nicht nur um den Geschäftserfolg, den die bürgerliche Herrschaft braucht und fördert, sondern um die Seriosität des Schuldensektors insgesamt, aus dem sich der Fiskus mit seinem ungesättigten Finanzbedarf höchstselbst bedient und auf dem er mit seinen Schulden, die den Verbrauch und gar nicht die Mehrung von Reichtum finanzieren, schon für genügend „Geldillusionen“ sorgt. Also werden die Finanzinstitute und ihre Geschäfte staatlichen Richtlinien unterworfen, was die Absicherung ihrer Kreditvergabe durch Eigenmittel, Risikostreuung und eventuell staatliche Garantien, das Geschäft mit ausländischem Geld und die Grenze zwischen Kapitalexport und Kapitalflucht, die Verfügbarkeit von Geldkapital für die „öffentlichen Hände“ des eigenen Landes und anderer Länder u.ä. betrifft – und schon wieder endet die Freiheit eines ganzen Geschäftszweigs an der Staatsgrenze. Also wird im Zeichen des Binnenmarkts alles verboten, was die Partnerstaaten sich haben einfallen lassen, um ihr Kreditgewerbe von vornherein oder vorrangig auf die Bedienung der nationalen Ökonomie und ihres eigenen Finanzbedarfs festzulegen. Und was an nationalen Vorschriften erlassen worden ist, um unseriöse Kreditschieberei zu bremsen, wird europaverträglich gemacht; wieder nach dem Grundsatz, daß die Vorschriften und die Aufsicht eines EG-Landes gut genug für alle sind.
- Zwischen eigener und auswärtiger Geschäftswelt wissen kapitalistische Staaten noch immer zu unterscheiden, wenn sie selbst als Auftraggeber tätig werden, und bevorzugen die eigenen – selbst dort, wo dahinter längst ein auswärts beheimateter Multi steckt. Besondere Sektoren wie der Luft-, Schienen-, Schiffs- und gewerbliche Straßenverkehr oder das Post- und Fernmeldewesen werden gleichfalls besonders geregelt, zugunsten des heimischen „Mittelstands“ oder durch nationale Monopolunternehmen. Mit dem Binnenmarkt wird auch das untersagt und abgeschafft. Ebenso soll die Subventionierung heimischer Industrien ein Ende finden, sofern sie die innereuropäischen Wettbewerbsverhältnisse verzerrt; und die Auslegungsfrage, die damit natürlich aufgeworfen ist, soll nicht mehr national, sondern von einer qualifizierten Mehrheit in den „Räten“ der EG entschieden werden. Gleiches gilt für Notlagen – z.B. der nationalen Zahlungsbilanz –, die ein Partner als Grund für Eingriffe in den grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr geltend machen kann; wo so etwas wiederholt angemeldet wird, übernimmt die Gemeinschaft sogar die Oberaufsicht über die nationale Wirtschaftspolitik, deren Gemeinschaftsverträglichkeit ohnehin in allen Mitgliedsländern durch EG-Organe kontrolliert wird.
In Form zahlreicher neuer Gemeinschaftsregelungen findet also eine ziemlich radikale Selbstkritik der EG-Partnerstaaten statt. Sie stellen nicht bloß die Handelspolitik ihrer Nachbarn, sondern auch ihre eigene und überhaupt alle ihre wohlbegründeten Einwirkungen auf das Geschäftsleben innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs unter den Generalverdacht, sie würden die freie Konkurrenz, das Lebenselement ihrer Kapitalisten und anerkannte Grundlage und Erfolgslinie ihrer Nationalökonomien, national verfälschen. Und sie revidieren die Rechtslage so, daß nicht gerade eine „Deregulierung“ in dem ideologischen Sinn, „der Staat“ hielte sich fortan aus allem heraus, wohl aber in dem Sinn, daß alle Sonderregelungen ihre Bedeutung verlieren, dabei herauskommt.
Mit ihrem Projekt einer europaweiten, von Staatsgrenzen nicht mehr tangierten – „Supra-“ – Nationalökonomie meinen sie es so ernst und sind damit so weit vorangekommen, daß sie sich bereits dem – für sie als noch weiterexistierende Nationalstaaten interessantesten – Folgeproblem der nationalen Besteuerung des nicht mehr nationalen Geschäftsgangs gestellt haben. Mit ihrem grenzüberschreitenden Warenverkehr halten die Staaten es nämlich normalerweise so, daß sie den Verkauf im eigenen Land, nicht aber den Export mit einer Umsatzsteuer belegen – sie besteuern eben prinzipiell den Verbrauch, nicht das Geschäft als solches, und kämen sich mit ihrem Zugriff auf den Warenumsatz als Exporthindernis vor, wenn sie ihren Exportunternehmen die Mehrwertsteuer abnehmen würden; umgekehrt finden sie es gleich doppelt in Ordnung, nämlich gut für den Haushalt und gerecht gegenüber den inländischen Unternehmern, Importware beim Importeur zu besteuern. Die nötigen Bestätigungen – zur Freistellung der Exportware von der Umsatzsteuer wie zur Besteuerung der Importe – finden normalerweise an der Grenze statt; dort soll es nun aber ab 1.1.93 keinen Aufenthalt mehr geben. Die Besteuerung, unterschieden nach exportierter und im Inland verkaufter Ware, findet also in vertrauensvoller Zusammenarbeit zwischen Firmenbuchhaltung und Steuerbehörde statt. Dem Risiko, daß Ware in großem Stil in Ländern mit geringerer Mehrwertsteuerrate aufgekauft und unter Umgehung eines höheren Steuersatzes in anderen Ländern verkauft wird, meinen die EG-Finanzpolitiker mit der Angleichung der Steuersätze – nämlich Mindestsätzen, die die ausnutzbaren Differenzen uninteressant klein machen – genügend vorgebeugt zu haben: Auch steuerlich „wächst“ Europa „zusammen“. Bemerkenswert ist jedoch nicht bloß die Vereinheitlichung der Steuersysteme und -sätze, sondern ebenso der für 1998 geplante nächste Schritt. Ab dann soll nämlich – so als würde damit bloß ein Abrechnungsverfahren vereinfacht – das „Prinzip der Besteuerung im Herkunftsland“ gelten: Vom Exporteur wird wie von jedem Verkäufer die Umsatzsteuer eingezogen, die dieser dem Importeur wie jedem Abnehmer in Rechnung stellt; der Importeur ist also nicht mehr seinem Fiskus, sondern dem fremden steuerpflichtig. Damit entfällt der steuerliche Unterschied zwischen innerstaatlichem und grenzüberschreitendem Handel; auch in dieser fiskalisch entscheidenden Hinsicht findet kein Ex- und Importieren mehr, sondern Binnenhandel statt. Übrigens mit der interessanten Konsequenz, daß „Export“überschüsse und -defizite – die ja in dem Sinn keine mehr sind – die verschiedenen Staatshaushalte – die es ja gleichwohl noch gibt mit ihren nationalen Zugriffsrechten – ganz anders als bisher betreffen: als Steuermehreinnahme bei „export“starken Staaten, als Mindereinnahme in Ländern, die aus anderen EG-Staaten mehr einführen als dorthin verkaufen. So macht der grenzenfreie Binnenmarkt eine ganz neue „makroökonomische Clearingstelle“ und Steuerausgleichsmaßnahmen notwendig – eben weil mit der Vollendung des Binnenmarkts tatsächlich ein Fortschritt stattfindet, der die Grundlagen der üblichen staatlichen Rechnung mit „Mein“ und „Dein“ außer Kraft setzt. Die Zirkulation des kapitalistischen Reichtums wird europäisch, nämlich definitiv grenzenlos – innerhalb der Außengrenzen der EG.
Die verändern damit natürlich auch ein wenig ihren Charakter. Sie beherbergen nunmehr eine Nationalökonomie, die gegenüber dem Rest der Welt – Rest-Europa, den Konkurrenten USA und Japan sowie der übrigen Ländermasse – sämtliche Diskriminierungen aufrechterhält oder einheitlich neu aufbaut, die EG-intern außer Kraft gesetzt werden und deren außenhandelspolitische Bedeutung dabei so schön greifbar wird: von den veterinärmedizinischen Normen über die Reserveverpflichtungen bei Finanzgeschäften bis hin zur Werftensubventionierung und einem europäischen Patentrecht; von allen anderen, in der Gemeinschaft schon seit längerem abgeschafften, nach außen aufrechterhaltenen Handelshemmnissen ganz zu schweigen. Reguliert, abgeschirmt, mit Präferenzen ausgestattet, mit Steuer- oder direkten staatlichen Geldgeschenken bedacht werden die Teilnehmer einer kapitalistischen Konkurrenz, die frei durch ganz EG-Europa tobt, damit neue Erfolgsmaßstäbe setzt und Gewinner von entsprechender kapitalistischer Statur hervorbringt. Und die damit eine politökonomische Basis schafft, um deretwillen die beteiligten Staaten allen Ernstes sich selber als unpassenden, weil zu eng zugeschnittenen politischen Überbau in Frage stellen.
II.
Beendet ist die Konkurrenz zwischen den Partnern damit jedoch überhaupt nicht. Ebensowenig ist das Kapital, das sich in europäischen Landen bewegt, mit dem Binnenmarkt alle politischen Beschränkungen und die leidigen Steuern los.
Vereinbart wurde der Binnenmarkt von souveränen Staaten, die nach wie vor in einer nationalen Bilanz ermitteln, welche ökonomische Macht ihnen aus dem internationalen Geschäft erwächst. Ihr Haushalt, Menge und Qualität ihres Kreditgeldes, ist immer noch Grund und Zweck ihrer internationalistischen Bemühungen; er liefert auch das Maß ihres Erfolgs, den sie mit der Beteiligung am Projekt EG anstreben. Wenn die EG-Nationen den Übergang zum Binnenmarkt vollziehen, dann tun sie es durchaus wie in früheren Etappen der Gemeinschaft nach der Logik eines vorteilhaften Tausches: Für den Verzicht auf wesentliche Instrumente ihrer Standortpolitik rechnen sie sich eine „Entschädigung“ aus; eine allgemeine „Zunahme der Wirtschaftstätigkeit“, an der jeder Staat partizipiert, haben die Supra-Nationalisten genauso im Visier wie eine „Entlastung der öffentlichen Haushalte“. In Aussicht stellen sich die Architekten der Gemeinschaft auch eine Beschränkung der „Inflationskräfte“. Solche Perspektiven ergeben sich aus dem Gesichtspunkt einer nationalen Kosten-Nutzen-Rechnung, in welcher die staatlichen Bemühungen zur Unterstützung national erwünschter Unternehmen, der Aufwand für den Ausschluß schädlicher Konkurrenz als überflüssige Last verbucht werden.
Aufgrund dieser nationalistischen Kalkulation ist es nicht verwunderlich, daß die Wirtschafts- und Finanzministerien der EG-Staaten die Veränderungen des von ihnen verwalteten Wachstums im Vorgriff auf seine neuen Bedingungen registrieren. Sie gehen davon aus, daß die von ihren Eingriffen befreite Konkurrenz der Kapitalisten in Europa in manchen, nicht unerheblichen Fällen Geschäfte beeinträchtigt, als deren angestammte Nutznießer sie sich betrachten. Und sie suchen in der Periode bis zum Inkrafttreten der gemeinsamen Beschlüsse eben diese Geschäftssphären und -zweige als ihre Domäne zu behaupten bzw. zuzurichten. In den Gremien der Gemeinschaft streiten sie um die Zuteilung von Mitteln zur Wahrung des „Besitzstands“, den sie im Rahmen der europäischen „Zusammenarbeit“ unter ihrer Zuständigkeit versammeln konnten. Zudem nehmen sie Einfluß auf die „Harmonisierung“ von Normen, Vorschriften und Steuern, indem sie per Vergleich mit den bislang in ihren Heimatländern gültigen Regelungen die neuen europäischen Bestimmungen so verhandeln, daß diese die von ihnen betreuten Unternehmen und Geldquellen möglichst wenig schädigen.
So betreiben die Regierungen der EG-Staaten beim Einstieg in den Binnenmarkt, der ihnen die Standort-Konkurrenz verwehrt, noch einmal eben diese Konkurrenz. Aber ihr Schacher um Kompromisse, das Preisgeben von Positionen und das Bestehen auf unverzichtbaren Rechten, dreht sich um die Anpassung ihrer Nationen an gemeinschaftlich beschlossene Richtlinien. Sie verhandeln um die Wahrnehmung von Kompetenzen, die sie abtreten.
*
Die Wirtschaftspolitiker der EG verfolgen das Programm einer von der Beschränkung durch Grenzen und einzelstaatliche Sonderregelungen befreiten Privatwelt des Geschäfts; aber das ist eben doch bloß die eine Seite. Sie tun dies, indem sie eine europäische Wirtschaftspolitik betreiben, also Geschäftsbedingungen definieren, Entwicklungsprojekte – am liebsten für zukunftsweisende Industriezweige: Raumfahrt, Biotechnologie, rüstungstechnische Zusammenarbeit…, aber auch für rückständige Zonen – beschließen, eine gesamteuropäisch ausgelegte Infrastruktur in Auftrag geben, ausgewählte Geschäftszweige – nach wie vor vor allem die Landwirtschaft – mit viel Geld rentabel machen usw. Und dabei handeln sie immer auch als Vertreter ihrer eigenen Staaten, also mit dem Ehrgeiz und zutiefst berechtigten Anspruch, für ihr Land die ökonomischen Erfolgsbedingungen zu verbessern und nicht von den andern verschlechtern zu lassen. Bei der Schaffung eines von Eingriffen freien Raums kapitalistischer Akkumulation treten sie für ihre Nationen konkurrierend gegeneinander an.
Der Leitfaden für diesen Konkurrenzkampf ist sehr schlicht: Alle Beteiligten bemühen sich im Zuge der gesamteuropäischen „Deregulierung“ um Regulierungen, die darauf hinauslaufen sollen, die Quellen ihres nationalen Reichtums unter europäische Obhut zu stellen. Wenn die Gemeinschaft beispielsweise nationale Subventionen für notleidende Industriestandorte verbietet, dann sind die Betroffenen einerseits dafür, weil ihnen damit die Einsparung einer unproduktiven Last zugemutet wird; andererseits tun sie als Anwälte ihrer heimischen „Arbeitsplätze“ alles, um für die „Sanierung“ solcher Standorte Gemeinschaftsfonds in Anspruch nehmen zu dürfen – also eigene wirtschaftspolitische Lasten zu europäisieren. Wenn die Gemeinschaft technische Handelshemmnisse beseitigt, wird das allseits begrüßt, weil Exporte einfacher werden und möglicherweise Importwaren manches verbilligen, also der Teuerung entgegenwirken, und überhaupt ein großer Markt besser ist als ein kleiner; gleichzeitig hat jeder für die Festlegung der technischen Handelsbedingungen, die nun europaweit gelten sollen, konstruktive Vorschläge zu machen, die wie von selbst nationale Markenartikel vom Auto bis zum Wein privilegieren, zumindest gegen außereuropäische Konkurrenz. Oder wenn die Gemeinschaft ein grenzüberschreitendes Konkurrieren in bislang national reglementierten Wirtschaftszweigen wie dem Fernverkehr freigibt, dann streiten sich Deutschland, die Niederlande und alle anderen um diejenige europäische KFZ-Abgabe, Straßenbenutzungsgebühr und Mineralölsteuer, mit der das jeweils im eigenen Land ansässige Gewerbe am besten fährt.
Dieser – naturgemäß kleinliche – Kampf um nationale Vorteile aus der großen europäischen Sache gibt immer wieder Anlaß zu Sorgen und Beschwerden über den offenbar nicht auszurottenden nationalen Egoismus der Beteiligten. Abgesehen davon, daß der Ärger von Demokraten, die anders als in Staatskategorien gar nicht denken können, über staatlichen Materialismus albern ist – meistens gilt er sowieso bloß dem der „andern“, ist also selber nationalistisch und sonst nichts –, trifft die Diagnose den Sachverhalt gar nicht. Denn mit ihren Bemühungen, im europäischen Rahmen die nationale Sache zu fördern, bringen die EG-Partner ihr Europa durchaus voran. Im Streit um die Ausgestaltung des Binnenmarkts haben sie auf die prinzipielle Alternative: die Korrektur befürchteter Wirkungen der grenzenlosen Konkurrenz auf die eigene Volkswirtschaft durch nationale Staatserlasse, bereits verzichtet; um genehme EG-Regelungen konkurrieren sie eben deswegen, weil sie ihr Recht auf Sonderregelungen unwiderruflich aufgeben. Und was den Binnenmarkt betrifft, der auf diese Weise zustandekommt, so mag der durch die wechselseitigen Erpressungen der beteiligten Nationen „miß“gestaltet sein – was ja ohnehin bloß heißt, daß er die Interessen mal der einen, mal der anderen nationalen Lobby bevorzugt widerspiegelt. Es ist aber der große Binnenmarkt, der darüber zustandekommt. Und deswegen laufen alle nationalen Interventionen, seine Ausgestaltung betreffend, nur darauf hinaus, das nationale Geschäftsleben an Europa, nämlich an die EG-weit gesetzten Geschäftsbedingungen anzupassen. Im Streit um die Wahrung eigener Chancen gestalten die Nationen sich wieder ein Stück weit um zur europäischen Einheits-Geschäftssphäre.
III.
Der Übergang zum Binnenmarkt markiert einen Umschlag im Verhältnis zwischen nationaler Ökonomie und europäischer Gemeinschaft. Denn das nationale Interesse, von diesem Markt zu profitieren – am innerhalb der EG und auf Kosten der übrigen Welt organisierten Wachstum –, kommt dadurch zum Zuge, daß die Staaten sich den Geschäftsgrundlagen der Gemeinschaft unterwerfen, statt selbst als souveräne Verwalter und Nutznießer die ihnen genehmen Bedingungen der kapitalistischen Konkurrenz zu setzen. Und die politischen Regeln, die die Gemeinschaft für ihre Mitglieder verbindlich macht, betreffen nichts Geringeres als den Modus und damit auch das Maß, in dem sich die beteiligten Nationen an den gesamteuropäischen Geschäften bedienen können, zu deren Förderung sie antreten.
Deswegen gibt es einerseits das Ideal, daß alle zwölf Nationen durch die Ersparnis von – der bisherigen innereuropäischen Standortkonkurrenz gewidmeten – faux frais und durch eine vermehrte Akkumulation in der EG gewinnen. Andererseits den Realismus, daß die künftige Verteilung des Reichtums auf die Mitgliedsnationen nicht gerade gleichmäßig ausfällt. Wie bisher führt die Territorialisierung der Geschäfte, die nun durch keinen „Egoismus“ mehr gesteuert wird, zu unterschiedlichen Resultaten in den Staatskassen. So daß sich für die Staaten die alte und grundsätzliche Frage nach ihren Bilanzen neu stellt – sie müssen schließlich weiterhin als Betreuer ihres nationalen Standortes amtieren. Und sie walten dieses Amtes, das Aufwendungen für Soziales, für die Verzinsung von Staatsschulden, für die Beteiligung am EG-Budget, für das Militärische usw. umfaßt, nach den vertrauten Grundsätzen, die für einen marktwirtschaftlichen Staatshaushalt gelten. Sie verbuchen akkurat Einnahmen und Ausgaben, finanzieren die unabdingbaren Staatsleistungen jedoch per Kredit, was ihnen die Hoheit über das Geldwesen ihrer Nation gestattet. Sie ziehen über die Techniken der Staatsverschuldung einen erheblichen Teil des Reichtums, den ihre europäische Marktwirtschaft hervorbringt, an sich – und zwar nach Maßgabe ihrer Bedürfnisse. Was sich Nationen leisten, weil sie als politische Herrschaft für das Wachstum des Kapitals immer mehr leisten wollen, kommt dann in Form von Inflationsraten und Währungsproblemen auf die Tagesordnung der internationalen Konkurrenz. Denn die ist für die Fortführung lohnender Geschäfte darauf angewiesen, daß die Staaten bei ihrer hoheitlichen Selbstversorgung nicht das Geschäftsmittel, das ihr nationales Geld für sie und andere darstellt, ruiniert. Der von ihnen gestiftete Nationalkredit muß, in wessen Händen er immer vorhanden ist, Zahlungsfähigkeit darstellen. Deswegen haben sich die in Maastricht versammelten Architekten Europas die Sorge um die nationalen Bilanzen auf der Grundlage des Binnenmarktes gleich in doppelter Ausführung auf die Tagesordnung gebracht:
- Für ihren künftigen Haushalt, für ihre ökonomische Macht, haben sie Partei ergriffen, indem sie um die ihnen genehmen politischen Geschäftsregeln sowie um Ausnahmen und Fristen gestritten haben.
- Gegen die Freiheit der Partnerländer, den Binnenmarkt zu nutzen und ihre nationalen faux frais in Gestalt von die Gemeinschaft belastenden Schulden abzuwickeln, sind sie ebenfalls vorgegangen: Laut den Maastrichter Verträgen ist der Binnenmarkt gar nicht als selbständiger und dauerhafter modus vivendi geplant, sondern als eine Übergangsphase zu einem europäischen Wirtschaften, in dem die finanzpolitische Souveränität der Nationen keinen Platz mehr hat.
*
Die EG-Staaten stellen politische Grundlagen fürs kapitalistische Geschäft her, die unterschiedslos in allen ihren Ländern gelten. Das Geschäft, dem sie auf diese Weise zu besseren, zuträglicheren politischen Bedingungen, Sicherheiten und Erfolgsaussichten verhelfen wollen, ist damit ein europäisches. Seine Zuordnung zu dem einen oder anderen nationalen Hoheitsbereich hat im vollendeten Binnenmarkt keine ökonomische Bedeutung mehr. Die Unterscheidung zwischen Politik und Wirtschaft, die jeden modernen Klassenstaat kennzeichnet – die Politik sorgt für die Macht des Geldes; sie auszuüben, ist Sache der Privaten –, wird zu einer realen Scheidung zwischen nationaler Hoheit und supranational-europäischer Ökonomie: Die Gemeinschaft legt fest, was kapitalistischer Reichtum EG-weit vermag; die vermögende Klasse handelt in ihren Unternehmungen, wo immer sie angesiedelt sind, nach gleichen politischen Standortbedingungen; und die Nationalstaaten, die diese Europäisierung ihrer Geschäftswelt organisiert haben, stehen vor einer neuen Aufgabe. Sie müssen sich zum Gang der kapitalistischen Konkurrenz national so ins Verhältnis setzen, daß von deren Erträgen auf sie und ihren Haushalt möglichst viel entfällt.
Es kommt deswegen für alle beteiligten Staaten erstens darauf an, daß vom europäischen Geschäftsleben möglichst viel unter ihrer Steuerhoheit abläuft, also auf ihrem Boden stattfindet bzw. davon ausgeht. Diese Aufgabe ist, so abstrakt formuliert, nicht neu; nationale Wirtschaftsförderung hat schon immer diesen Inhalt. Alle Instrumente der nationalen Diskriminierung sind ihr nun aber genommen. Statt dessen sind die einzelnen Staaten mit einem europaweiten Konkurrenzgeschehen konfrontiert, in dessen Verlauf das Kapital – gemäß den vorgefundenen regionalen Bedingungen – sich seine Schwerpunkte und Randzonen schafft; und zwar nach dem schlichten „Gesetz“, das innerhalb der nationalen Ökonomien eben so wie – letztlich – auf dem Weltmarkt schon immer die Geographie der kapitalistischen Konkurrenz bestimmt hat: Nichts ist für kapitalistische Marktteilnehmer so attraktiv wie ein großer, zahlungskräftiger Markt, also eine Masse erfolgreicher Geschäfte, und nichts so uninteressant wie eine Gegend, in der sonst nichts läuft. Nun fallen solche Standortentscheidungen der Geschäftswelt nirgends mit nationalen Grenzen zusammen; staatlich betrachtet, haben auch die kapitalistischen Zentren ihren Mezzogiorno oder erblich belasteten postsozialistischen Osten; andere EG-Mitglieder sind freilich insgesamt bloß eine Randlage. Alle Europäer stellen sich aber, mit ihrer jeweiligen nationalen Problemlage, derselben Aufgabe, ihr Land möglichst umfassend fürs Kapital und dessen Standortentscheidungen attraktiv zu machen; und zwar mit den Mitteln, die noch ihrer souveränen Standortpolitik überlassen sind: ihren Haushaltsmitteln im wesentlichen. Die direkte „Verzerrung der europäischen Konkurrenz“ durch Subventionen ist zwar verboten – gewisse Beihilfen für Firmenansiedlungen aber erlaubt, sogar von der Gemeinschaft gewünscht und mit unterstützt, und am gerade noch EG-konform hingetrimmten deutschen „Aufschwung-Ost“-Programm ist zu sehen, wieviel an autonomer und rein national orientierter Standortpolitik eine führende EG-Nation sich herausnehmen kann. Das Bedürfnis der Geschäftswelt nach Telefonen und Autobahnen, Flughäfen und entgegenkommenden Bürokraten usw. ist sowieso als berechtigter Anspruch anerkannt und wird von allen Staaten mit Infrastrukturinvestitionen aus Haushaltsmitteln nach besten Kräften bedient. Die Bereitstellung eines gut ausgestatteten Arbeitsmarkts gehört auch dazu, ein wohlausgewogenes Verhältnis zwischen Preis und Leistungsfähigkeit des arbeitswilligen Personals und anderes mehr. Mit allen ihren aufwendigen Bemühungen wirken die engagierten Regierungen natürlich gegeneinander; und jeder Erfolg hebt das Anspruchsniveau der allseits umworbenen Geschäftswelt, erschwert oder entwertet die Anstrengungen der Partner. Für den Verlauf und Ausgang dieser Konkurrenz gilt ein schon wieder sehr schlichtes „Gesetz“: Die bisher schon am besten ausgestatteten Staaten tun sich mit der Verbesserung ihrer Ausstattung am leichtesten; vor den größten Aufgaben stehen diejenigen mit den wenigsten Mitteln. Deren Bemühen um „gebührende“ Anteile am Europageschäft bewegt sich folglich in einem Zirkel: Um dem Staatshaushalt Mittel zu verschaffen, müßten um so größere Mittel ausgegeben werden.
Die „Lösung“ für solche Haushaltsprobleme steht auch schon längst fest: Schulden machen. Mit dem „Verkauf“ von Schuldverschreibungen verschafft eine Regierung sich Zugriff auf die kapitalistisch erwirtschafteten Überschüsse ihrer Nation, anders als bei der steuerlichen Enteignung aber in geschäftsnützlicher Form: Was der Staat sich an Finanzmitteln verschafft und verausgabt, das bleibt daneben den Geldgebern als ihr Vermögen erhalten, wächst sogar staatlich garantiert, wird so neben seiner Verwendung als staatliche Kaufkraft zum privaten Bereicherungsmittel und läßt sich entsprechend frei als Kreditmittel verwenden. Letzteres soll sogar geschehen: Die staatlichen Schulden sollen den Anstoß geben und zugleich das Geschäftsmittel hergeben für neue kapitalistische Unternehmungen, damit ein kontinuierlich wachsender kapitalistischer Überschuß dem Staat auch problemlos gestattet, was er mit seiner Verschuldung zum Sachzwang für sich gemacht hat, nämlich den dauerhaften und wachsenden Zugriff aufs Finanzkapital seiner Nation. Gelingt das nicht, bläst der Staat nur die Masse der von ihm garantierten Vermögenstitel und Zinsansprüche auf, ohne mehr nationales Wirtschaftswachstum in Gang zu setzen, dann werden zwar immer noch die Reichen immer reicher, und die Notenbank registriert eine wachsende Nachfrage nach ihren gesetzlich geschützten Geldscheinen, so als wäre die Masse des zirkulierenden Wertprodukts der Nation gestiegen. Die feinfühlige Finanzwelt allerdings wirft die Frage auf, was die Schuldscheine einer Nation taugen, in der außer dem staatlichen Schuldenstand gar nichts wächst. Und die Frage ist schon so gut wie die Antwort: vielleicht nicht gleich nichts, aber jedenfalls immer weniger. Und dieses Urteil macht nicht bloß für die Regierung das Schuldenmachen immer teurer. Es erstreckt sich auch auf die in dieser Nation zirkulierenden Zahlungsmittel selbst, die immer mehr bloß den staatlichen Zugriff repräsentieren und immer weniger einen kapitalistisch produktiven Reichtum, auf dessen Überschüsse damit zugegriffen werden könnte. Beim Verschulden gilt also schon wieder das schlichte „Gesetz“: Je mehr eine Regierung darauf angewiesen ist, um aus ihrem Land einen Ort für mehr kapitalistisches Wachstum zu machen, um so beschränkter sind ihre Freiheiten und Erfolgsaussichten bei dieser Art der Mittelbeschaffung. Unter den Bedingungen des europäischen Binnenmarkts für Geldkapitalanlagen entfällt überdies das Recht des Staates, seinen Geldbesitzern mit Vorschriften über die Verwendung ihres Vermögens zu kommen – und so zumindest einige verbotene Umwege zur „Kapitalflucht“ aufzuzwingen.
Das Ergebnis der nationalen Konkurrenz um die Standortentscheidungen der kapitalistischen Geschäftswelt innerhalb des politisch vereinheitlichten Geschäftsstandorts EG ist damit absehbar. Das ökonomische Kräfteverhältnis, von dem die Konkurrenz ausgeht, wird nicht in Frage gestellt, wenn es um Erfolge bei der Herrichtung des jeweiligen Landes geht, um die Mittel dafür, um den Zugriff auf Steuern und um die Fähigkeit der Staaten, sich wirtschaftsdienlich zu verschulden. Wo die maßgeblichen Wirtschaftspolitiker der Gemeinschaft nationale Korrekturen am freigesetzten kapitalistischen Konkurrenzkampf im Interesse nationaler Haushaltsbilanzen verbieten, da können sie sich mit gutem Grund darauf verlassen, daß sie nichts als den Status quo festschreiben und jedenfalls kein altbewährtes Verhältnis gefährden oder gar die Rangordnung durcheinanderbringen.
Auf der anderen Seite schließt die Konstruktion des Binnenmarkts jedoch aus, daß die Gewinner des einstweilen noch nationalen Kampfs um Kapitalstandorte und die davon abhängigen steuerlichen und kreditmäßigen Erträge einfach bloß zufrieden ihre Einnahmen verbuchen. Wo nämlich in der EG ein nationaler Haushalt nicht so schön in Ordnung ist und die für nötig erachtete Mittelbeschaffung per Kredit das nationale Zahlungsmittel entwertet, da leidet nicht bloß der zuständige Staat mit seinem Standort-Ehrgeiz. Auch die schöne neue Welt des europaweiten Geschäftemachens insgesamt gerät da in Unordnung. Denn erstens läuft dort, und folglich insgesamt, weniger an gutem Geschäft, als laufen könnte und soll. Und zweitens stellen sich die Erträge eines Teils der europäischen Kapitalakkumulation, solange es die Nationalstaaten mit ihrer Währungshoheit und ihrer Kreditfreiheit noch gibt, in Geldern dar, die das Ergebnis entwerten. Das nationale Maß des Geschäftserfolgs affiziert den Erfolg selbst. Und weil das national angegriffene Ergebnis nicht mehr bloß ein nationales, sondern Teil eines gesamteuropäischen Kapitalwachstums ist, weil, anders gesagt, ein Teil des Binnenmarkts in „schwacher“ Währung abgerechnet wird, beeinträchtigt der Verfall einer Währung eben das Geschäftsleben insgesamt, von dessen grenzenlosem Erfolg alle Partner sich abhängig gemacht haben.
Gegen solche schädlichen Wirkungen des Konkurrenzerfolgs der starken EG-Mitglieder haben die Gemeinschaftsländer seit längerem Vorkehrungen getroffen; durch Wirtschaftshilfen und vor allem durch das Europäische Währungs-System.[1] Das hebt allerdings den entscheidenden Widerspruch nicht auf, daß eine nationalstaatliche Kreditaufnahme für den angestrebten Gesamterfolg der EG einerseits unerläßlich ist, andererseits die Solidität des geschaffenen Reichtums beeinträchtigt. Und Einigkeit über den einzuschlagenden Weg ist erst recht nicht eingekehrt. Die einen fänden es gut, wenn ihre Finanzierungs- und daraus folgenden Währungsprobleme von den Partnern mitgetragen würden, die von der Europäisierung der nationalen Ökonomien am meisten profitieren. Diese verlangen dagegen von ihren schwächeren Partnern „Haushaltsdisziplin“, also den Verzicht auf alle Anstrengungen, die sich für den Rest der Gemeinschaft gar nicht ersichtlich lohnen.
Geeinigt hat man sich in Maastricht darauf, das Problem an der Wurzel zu packen und den Widerspruch eines einheitlichen europäischen Wirtschaftsraums, dessen Erträge in verschiedenen nationalen Währungen abgerechnet und national autonom genutzt werden, zur Währungs-Union hin aufzulösen. Und damit einen Widerspruch und Streit von noch schönerer Art auf die europäische Tagesordnung gesetzt.
B. Währungsunion
I.
Die Vorteile einer einzigen, innerhalb der gesamten EG gültigen Währung pflegen in ziemlich kindischer Manier dargelegt zu werden. Dem gewöhnlichen Volk sagt man allen Ernstes, das lästige Geldwechseln im Urlaub sei dann überflüssig – und die Spekulation auf die Verwechslung dieser Vereinfachung des Reisens mit dem Grund und Zweck der im Maastrichter Stufenplan vorgesehenen Währungseinheit geht weitgehend auf. Die dagegen ins Feld geführten Zweifel fassen sich in dem Antrag zusammen, das gesamteuropäische Geld müsse dann aber auch „hart“ und „stabil“ sein, eben gutes, verläßliches Geld. Das ist freilich auch die Zielsetzung, auf die die Urheber des Planes Wert legen. Mit ihrem zum Vertragstext ausformulierten Argument, der Binnenmarkt sei eine unfertige Sache, wenn ihm nicht die Währungsunion auf dem Fuße folgt, dringen sie auf lauter „technische“ Vorkehrungen für die Schaffung einer sicheren Euro-Währung. Aber gerade die Betonung dieses Moments, samt den von Fachleuten und Laien beigesteuerten Zweifeln, ob durch das im Vertrag vorgesehene Procedere auch wirklich garantiert werden könne, daß jeder künftige Inhaber von ECU auch über schlagkräftigen Reichtum verfügt – gerade die Sorge um die Qualität der Währung verstellt ein bißchen den Blick: auf die Qualität des Projekts, das da in Arbeit ist.
Immerhin wird mit dem Verlangen nach einem europäischen Geld den vorhandenen Geldern Europas eine gewisse Untauglichkeit bescheinigt; und den hoheitlichen Verwaltern und Benutzern dieser Gelder der Entzug der Lizenz angetragen, die sich auf den ökonomischen Kernpunkt ihrer Souveränität erstreckt.
*
Die nächsten Schritte zur Europäischen Wirtschafts- und Währungs-Union bis hin zur Einführung eines gemeinsamen, verbindlichen Zahlungsmittels sind auf Regierungsebene beschlossen; die Ratifizierung des Abkommens ist zwar schon gleich in Dänemark gescheitert, wird aber in den elf anderen Partnerstaaten, als wäre gar nichts, unverdrossen weiter betrieben; und die Deutschen sorgen sich um ihre unvergleichliche Deutschmark. Diese Sorge hat Experten aller Gehaltsstufen befallen: aufstrebende CSU-Minister, das Gewerkschaftsfunktionärsorgan „Die Quelle“, Bildzeitungsleser, Bundesbanker. Angesichts einer fühlbaren, offiziell etwa fünfprozentigen Inflationsrate in den alten Bundesländern fragen sie sich mit allen Anzeichen des Rassismus, ob eine gesamteuropäische Einheitswährung jemals so bombenfest stabil sein kann wie der Geldschein, in dem der westdeutsche Kapitalismus seinen Welterfolg nachrechnet.
Diejenigen Experten, die mit diesem Problem praktisch befaßt sind, haben sich vor allem andern mit größtem Nachdruck für die Forderung engagiert, eine gesamteuropäische Zentralbank, die die im EG-Raum verbindlichen Banknoten ausgibt und deren Wert „hütet“, müßte unbedingt politisch unabhängig sein, freigestellt von der Weisungsbefugnis welchen politischen Organs auch immer, per Gesetz nur dem Ziel der Geldwertstabilität verpflichtet – ungefähr so wie die Frankfurter Bundesbank, deren Kunstwerk in den ersten vierzig Jahren seiner Existenz so vergleichsweise wenig von seinem Wert eingebüßt hat. Dieser Erfolg soll dem neuen europäischen Währungsinstitut vererbt werden, indem man es formell nach deutschem Vorbild konstruiert – eine Dummheit, über die in Europa niemand lacht. Tatsächlich hatten die Frankfurter „Währungshüter“ das Glück, das Geld einer Nation zu verwalten, die sich mit der Währungsreform von allen alten Schulden freigestellt hatte; die, statt mit Kriegsreparationen belastet zu werden, eine Dollargarantie für ihr neugeschaffenes Geld geschenkt bekam; die von ihren Wirtschaftspolitikern und Kapitalisten zur Exportnation zurechtgetrimmt wurde und darin erfolgreich war, weil weltweit zahlungsfähige Nachfrage da war und die Relation zwischen Dollar und DM für die deutsche Wertarbeit sprach; die, statt sich für ihre Weltgeltung zu verschulden, im Hinblick auf künftige Aufrüstung jahrelang einen Haushaltsüberschuß erwirtschaftete; die im entstehenden Europa die Absatzmärkte für ihren Aufstieg zum „Exportweltmeister“ fand… und so weiter. Was in dieser Nation an Kredit geschaffen wurde, bestand aus vielerlei Gründen seine Bewährungsprobe als geschäftstüchtiges Kapital, machte die Unternehmer reich, den Staatshaushalt solide, die D-Mark hart – und die Techniker der nationalen Banknotenversorgung verrückt. Die halten nämlich „ihre“ weltweit gefragte Mark, das letzte Ergebnis eines nationalen Wirtschaftserfolgs, für das Produkt ihrer unglaublich geschickten, rein fachökonomischen, gänzlich unpolitischen Geldversorgungspolitik, ihres raffinierten Jonglierens mit Geldmengen, Offenmarktgeschäften, Diskont- und Lombardsätzen – obwohl sie bis heute nicht wissen, ob sie eigentlich den nationalen Zinssatz bestimmen oder bloß das Ergebnis von Kreditangebot und -nachfrage nachvollziehen. Und obwohl der deutsche Finanzminister seit jeher soviel Schulden macht, wie er an Finanzmitteln benötigt, ohne dabei jemals an der Bundesbank zu scheitern: Daß sie ihm nicht direkt jede Staatsschuldverschreibung in druckfrische DM umwechseln dürfen – sondern nur indirekt… – und daß sie frei nach ihrem Bankiersverstand „Signale“ an den Kreditmarkt geben dürfen, halten die Frankfurter Staatsbanker für das Erfolgsgeheimnis ihrer Währung. Das können sie deswegen gar nicht nachdrücklich genug zur Nachahmung empfehlen. Und sie stoßen damit auf offene Ohren. Ihre Kollegen aus ganz Europa pflichten ihnen bei, weil sie berufsmäßig an derselben Verwechslung von Ursache und Wirkung leiden. Und weil die Führungskräfte des kapitalistischen Systems dessen wirkliche Erfolgsbedingungen sowieso nicht wissen, sondern sich aus guten und schlechten Erfahrungen ideologisch zurechtlegen, sind sie sogar für das „Argument“ zu haben, die Stabilität der geplanten Euro-Währung wäre am besten, wenn nicht überhaupt nur, in Frankfurt am Main mit seiner eindrucksvollen DM-Tradition zu sichern. Diese Standortfrage ist zwar noch nicht entschieden. Der Vertrag von Maastricht erfüllt ansonsten aber alle Formalia einer garantiert, bis hin zur Pensionsregelung für die leitenden Angestellten, politisch unabhängigen Notenbank.
Die Sorgen um ein stabiles Geld sind damit trotzdem nicht geschwunden. Denn unbekannt ist es ja nicht, daß es für den Wert des bestbehüteten Geldes immer noch darauf ankommt, wie erfolgreich es verwendet wird. Zur Kenntnis genommen wird dieser Tatbestand am liebsten in Form von Ideologien über die verschiedenen europäischen Volkscharaktere und ihre mit Breitengrad, Klima und Geschichte verknüpfte „Inflationsmentalität“. Und daraus läßt sich immerhin eine Fassung des „Problems“ ableiten, die den Vorzug hat, die Herstellung einer unverwüstlichen Währung als eine mit genügend gutem Willen lösbare Aufgabe der beteiligten Staaten und ihrer Finanzpolitik erscheinen zu lassen. Nämlich so:
Der berühmte „Kriterienkatalog von Maastricht“ zählt schlicht die Verhältnisse auf, in denen sich für die Experten einer marktwirtschaftskonformen staatlichen Haushaltsführung die Stärke oder Schwäche einer Währung offenbart: Inflationsrate, Außenwert, langfristiger Zinssatz, Finanzlage der öffentlichen Hand. Dann legt er relative Maßzahlen fest, die von allen Partnern erreicht werden müßten, damit eine hinreichende Gewähr für die gewünschte Stabilität der zukünftigen Gemeinschaftswährung gegeben wäre: Eine Inflationsrate nicht höher als 1,5 %-Punkte über derjenigen der solidesten EG-Staaten, die Einhaltung der Bandbreiten im EWS „ohne starke Spannungen“, ein Zinssatz auf langfristige Staatsanleihen nicht höher als 2 %-Punkte über demjenigen der preisstabilsten Mitgliedsländer, und zur Finanzlage ein Staatshaushaltsdefizit von nicht mehr als 3 % des Bruttosozialprodukts und ein Gesamtschuldenbestand der öffentlichen Hände von nicht mehr als 60 % des Bruttosozialprodukts bzw. eine bedeutende Annäherung an diese Maßzahlen von einer schlechteren Ausgangslage her bzw. ihre nur ausnahmsweise Überschreitung. Die Erfüllung oder Verfehlung dieser Maßregeln wird von der EG-Kommission fortlaufend überprüft. Gegen Ende 1996 befinden dann die Regierungen gemeinsam darüber, ob eine Mehrheit von Mitgliedsstaaten ab 1997 mit einer gemeinsamen Währung loslegen kann; falls nicht oder falls keine Einigung zustandekommt, dürfen die Qualifizierten ab 1999 automatisch die Währungsunion beginnen; die Nicht-Qualifizierten bleiben draußen, bis sie den aufgestellten Ansprüchen genügen.
Mit diesen Festsetzungen arrangieren die Gründer einer (supra-)nationaleuropäischen Einheitswährung, so gut sie es eben verstehen, eine Bewährungsprobe für die Nationalökonomien, die mitmachen sollen. Diese Bewährungsprobe betrifft aber nur zum Schein Aufgaben („Hausaufgaben“, wie die regierenden Kindsköpfe es gerne nennen), deren Erledigung in der Macht der beteiligten Regierungen liegt. In der Sache bezieht sie sich auf den tatsächlichen Konkurrenzerfolg der Nationen bei der Schaffung und kapitalistischen Verwendung eines eigenen Geldes; festgemacht an je für sich anerkanntermaßen fragwürdigen Erfolgsindices. Mit Blick auf diese konkreten, „operationalen“ Teilziele wird so getan, als wäre der verlangte Erfolg eine Frage der rechten Methode oder politökonomischen Tugend. Über den Erfolgsweg, den die Partnerstaaten gehen sollen, wird freilich gar nichts anderes angegeben als wiederum das Ziel: Alle Beteiligten beschwören ihre feste Absicht, die aufgestellten Kriterien zu erfüllen. Dabei wissen doch zugleich alle, zumindest jeder für sich, daß jede zu ergreifende Maßnahme mindestens doppeldeutig ist und ihr Ergebnis von der Konkurrenz der in Europa agierenden Kapitalisten und von der konkurrierenden Wirtschaftspolitik ihrer Partner abhängt. Wo z.B. die Zinsen für Staatsschulden überdurchschnittlich hoch sind, da wäre durch Zinssenkungen der Zufluß von Geldkapital, also die Zahlungsbilanz und darüber der stabil zu haltende Außenwert der Währung gefährdet. Wo das Haushaltsdefizit zu groß ist, da ist umgekehrt das Bruttosozialprodukt zu klein und hängt ganz offenkundig wesentlich vom staatlichen „deficit-spending“ ab; seine Verringerung würde die verlangten Relationen also eher verschlechtern – je nach dem, wie die Geschäftswelt darauf reagiert und welche Chancen und Sicherheiten ihr in anderen Ländern der Gemeinschaft geboten werden.
Die aufgestellten „Konvergenzkriterien“ geben eben gar keine Schritte zur angestrebten Angleichung der ungleichen Partner an, sondern „operationalisieren“ bloß das Ideal, alle EG-Staaten sollten mit gleicher Erfolgslage in das Endstadium der Wirtschafts- und Währungs-Union eintreten – und das spätestens 1999, andernfalls später. Dabei reicht selbst dieses Ideal gleicher Erfolge, also Erfolgsbedingungen aller EG-Partner an das Ziel einer Euro-Währung, deren Stabilität vorab gesichert wäre, gar nicht heran. Denn für den Wert des neuen Geldes kommt es ja schon wieder darauf an, wer was mit welchem Erfolg damit anfängt. Deswegen denken die Väter dieser neuen Währung auch schon heftig darüber nach, wie deren Gebrauch durch erwiesenermaßen besonders unproduktive, erfolglose Schuldenmacher, nämlich die Partnerstaaten mit dem schlechteren eigenen Geld, verhindert werden kann. Sie planen Eingriffsrechte der Gemeinschaft in die nationale Haushaltsgestaltung; sie verschwören sich, nie und nimmer ein „überschuldetes“ Mitglied mit „Fremd-“ oder Gemeinschaftsmitteln aus seinem Defizit loszukaufen.
Mit all diesen Maßregeln und Vorkehrungen gestehen die Experten von Maastricht ein, welche Schritte hin zu einem stabilen Euro-Geld überhaupt bloß praktikabel sind. Machbar sind allein negative Vorkehrungen, der Ausschluß für unsolide erachteter Partner vom Gebrauch des neuen Geldes. Zumindest einigen Mitgliedern kann, wenn sie denn überhaupt zur Währungsunion zugelassen werden, ein souveräner Zugriff auf die Finanzmittel des neuen Europa auf gar keinen Fall gestattet werden. Das ist schon die ganze Erfolgsgarantie, die die Schöpfer der Währungsunion sich vorab zu verschaffen wissen.
II.
Welch radikale Veränderung an der Natur der Gemeinschaft mit dem Konzept von Maastricht durchgesetzt werden soll, erhellt aus der praktischen Kritik, der das Europäische Währungssystem – die bislang betriebene Zusammenarbeit in Währungsdingen – unterworfen wird. Daß die Währungs-Union dieses Gemeinschaftswerk nur zu einem konsequenten Ende bringe, stimmt nämlich bloß sehr bedingt, eben in bezug auf den formalen Gesichtspunkt, daß sich die Nationen der EG zu gemeinschaftsdienlichen Maßnahmen im Umgang mit ihrem Kredit und dem der Partner herbeigelassen haben. Diese Maßnahmen hatten für die Finanzpolitik der Länder den Charakter von Verpflichtungen, durch die sie die Wirkungen der Konkurrenz auf die Haushalte und damit Währungen der anderen zum Gegenstand gemeinsamer Betreuung erklärten; insofern haben sie den Gebrauch ihrer währungspolitischen Souveränität eingeschränkt, von der gewöhnlichen Ausnützung der Schwächen abgesehen, die das Geldwesen der europäischen Länder befallen hat in der Gemeinschaft. Sie haben zugunsten der Partnerschaft die souveräne Ausgestaltung ihrer Währungspolitik relativiert; und innerhalb der Gemeinschaft auf die Erhaltung der Zahlungsfähigkeit der Partner geachtet, durch bi- und multilateral sowie – die Schöpfung namens ECU! – gemeinsam garantierten Kredit.
Allerdings stand dieser Selbstbeschränkung ein klar kalkulierter Nutzen gegenüber, der den Souveränen umgekehrt eine Erweiterung ihres ökonomischen Handlungsspielraumes bescherte. Die vereinbarte Mäßigung ihres Konkurrenzgebarens bewirkte schließlich die beabsichtigte Absicherung der Geschäfte gegen die Risiken der Konkurrenz um Kredit – und quer durch Europa nahmen tüchtige Unternehmer diese politisch organisierte Garantie wahr. Sie inszenierten ein Wachstum, an dem sich die Nationen bedienen durften – wie immer unter kräftiger Ausweitung ihres nationalen Kredits, der also unter dem Regime des EWS alles andere als eingeengt wurde. Die in europäischen Landen vollzogene Akkumulation von Kapital, welche mit einer flotten Benützung der restlichen Welt und auf Kosten der USA vonstatten ging, verschafften den National-Ökonomen Europas die Freiheit, die sie meinen.
*
Der Wechselkurs drückt den Wert einer nationalen Währung in einer anderen aus. Das ist ein rechnerisch klares Verhältnis und auch technisch einfach zu realisieren – man tauscht entsprechend. Die politökonomischen Grundlagen dieses schlichten Verhältnisses haben es in sich.
Das Geld, das sich im Wechselkurs eine Bewertung gefallen lassen muß, ist – dort, wo es gilt – selber der definitive Wertausdruck. Es wird nicht bewertet, sondern gibt den Wert jeglichen Reichtums an, der in der betreffenden Nation zirkuliert. Dabei ist es nicht bloß der ideelle Maßstab, der über jedes Gut entscheidet, was es wert ist. Es ist selber der Wert, der in und mit seinem Namen den Gütern und Dienstleistungen einer Volkswirtschaft beigelegt wird. Und damit ist es das ökonomische Ding, um das die ganze Marktwirtschaft sich dreht: Es mißt nicht nur den Erfolg jeglichen Geschäfts – sein Erwerb und sonst nichts ist der gemeinte und erstrebte Erfolg; der Endpunkt, mit dem das Produzieren und Anbieten, Kaufen und Verkaufen immer von neuem und auf größerer Stufenleiter losgeht.
Ganz unangefochten bleibt das nationale Geld als Maß und Inbegriff des nationalen Reichtums freilich nicht. Und zwar deswegen, weil es gewissermaßen als Stellvertreter von sich selbst oder Repräsentant des wahren und eigentlichen Geldes umläuft: als Zahlungsversprechen in Banknotenform, das nicht von selbst, sondern per Gesetz den Rang des verbindlichen Zahlungsmittels und Werts schlechthin innehat. Es ist nämlich das Geschäftsmittel eines Kreditsystems, das den Teilnehmern des nationalen Wirtschaftslebens Geldwert in die Hand gibt und auf dessen verzinstem Rückfluß besteht, ohne daß vorab feststände, daß der verliehene Betrag sich auch wirklich als mehr Geld hervorbringendes Kapital bewährt. Im Falle des wichtigsten Schuldners steht statt dessen von vornherein das gerade Gegenteil fest: Der Staat, der sich das weitaus meiste Geld leiht, konsumiert das Geliehene ganz ungeschäftlich und läßt es dennoch als von ihm garantiertes Geldkapital, als Wert mit Anspruch auf Zinsen, in den privaten Geschäftsbüchern stehen. Wo kommerzielle Schuldner das Scheitern ihres Geschäfts anmelden und mit ihrem sonstigen Vermögen für den vergeigten Kredit geradestehen müssen – oder mit unbegleichbaren Schulden ihren Geldgeber selbst in den Bankrott reißen und Geldwerte durchgestrichen werden müssen, die bis dahin noch Bestandteil des nationalen Wirtschaftswachstums waren –, da verbürgen die „öffentlichen Hände“ wachsende Schulden, die überhaupt keinen, geschweige denn wachsenden Geldwert repräsentieren, sondern gelaufenen Staatskonsum verbuchen. Das drückt auf den Wert der Summen, mit denen das nationale Kreditgewerbe herumwirtschaftet – und stört nicht weiter, solange diese Summen und das damit erwirtschaftete kapitalistische Wachstum selber zunehmen. Es verlieren bloß die nationalen Banknoten, an sich selbst gemessen, im Lauf der Zeit an Wert; der Maßstab schrumpft, gewissermaßen.
Sehr viel radikaler als durch solchen prozentualen Wertverlust wird das nationale Zirkulationsmittel in Frage gestellt, wenn es sein Werk über die Grenzen der nationalen Hoheit, die es garantiert, hinaus tun soll. Seine Geldqualität selbst endet mit der Reichweite der Gesetze, die den nationalen Banknoten diese Qualität zusprechen. Soll nicht auch das nationale Geschäftsleben an den Grenzen stillstehen, so muß sich die nationale Notenbank mit ihren als Geld umlaufenden Zahlungsversprechen gewissermaßen beim Wort nehmen lassen und wirklich „echten“ Wert, also Geld in einer Form vorweisen, in der seine Gültigkeit nicht an staatliche Gesetze von beschränkter Reichweite gebunden ist. Ohne solche Garantie stände der finanzkräftigste Geschäftemacher im Ausland mit leeren Händen da, seine Zahlungsverpflichtungen wären nichts wert; umgekehrt gäbe es im Ausland für die nationale Geschäftswelt nichts zu verdienen, was ihrem Anspruch und Recht auf Geldreichtum Genüge täte. Der „ideelle Gesamtkapitalist“, der Staat, der grenzüberschreitende Geschäfte will, ist mit seiner Zentralbank als Besitzer eines Schatzes gefordert, mit dem er nach außen für die Geldqualität des Geldes einstehen kann, das bei ihm zu verdienen und für das bei ihm einzukaufen ist. Einstehen muß er gegenüber seinesgleichen, anderen Staaten, die ebenso wie er die berechtigten Geldinteressen ihrer Bürger schützen und auf die sichere Seite bringen. Marx’ „Werttheorie“ gilt zwar seit 100 Jahren als widerlegt; aber wenn ein Staat neu in den Kreis der Welthandelsmächte aufgenommen werden will oder die Kreditwürdigkeit eines Mitglieds der Völkerfamilie endgültig hinfällig wird, dann kommen die zivilisiertesten Staaten mit dem feinsten „Plastikgeld“ auf die Sicherheiten zurück, auf die sie auch untereinander keineswegs verzichtet haben, auch wenn sie zahllose Vorkehrungen dagegen getroffen haben, sie täglich vorweisen oder gar mobilisieren zu müssen: Sie bestehen gegeneinander auf Geldwert in seiner rohesten und gerade deswegen garantiert international gültigen Form – Edelmetall.
Darüber hat sich mittlerweile ein gewaltiger Überbau international zirkulierender Zahlungsversprechen aufgetan, die auf nationale Gelder lauten. Die Notenbanken der kapitalistischen Staaten sind längst dazu übergegangen, fremde Währung hereinzunehmen und als echtes Geld zu verbuchen und eigenes Geld auch an ausländische Interessenten zu freier Verwendung herauszugeben, damit das grenzüberschreitende Geschäft nicht am Goldschatz seine Schranke hat. Damit stellt sich freilich das eigentümliche Problem, jedes auswärtige Geld im eigenen und das eigene im fremden zu bewerten, obwohl es doch Wert ist: Maßstab dafür, was alles übrige wert ist, und die dingliche Existenz dieser Eigenschaft.
Das Problem ist lösbar, weil alle am Weltmarkt beteiligten Staaten sich zu dem Bekenntnis entschlossen haben und mit ihrem Staatsschatz auch praktisch den Standpunkt verbürgen, daß alle ihre nationalen Gelder Spielarten ein und desselben, Ausdruck von Wert schlechthin, also qualitativ dasselbe sind. In welchen quantitativen Verhältnissen sich diese sachliche Identität darstellt, ist die immerwährende Gretchenfrage des Weltgeschäfts. Sie wird zunächst einmal von den Stiftern der verschiedenen Währungen, den Staaten, beantwortet; und zwar per Setzung und – es geht ja um Relationen – nach Maßgabe ihres Kräfteverhältnisses: Manche Staaten können erfolgreich diktieren, was fremdes Geld, gemessen an ihrer Devise, allenfalls wert ist; andere können höchstens vorschreiben, für wieviele auswärtigen Devisen sie ihr Geld am liebsten verkaufen würden. Aufs Kräfteverhältnis kommt es hier deswegen an, weil mit dem Wechselkurs der Währungen der Reichtum ganzer Nationen als Teil des gesamten Welt-Reichtums gemessen und bewertet wird und damit eine entscheidende Bedingung für sämtliche grenzüberschreitenden Geschäfte gesetzt ist, die von jeder Nation aus- und in sie hineingehen: wie teuer Importe zu stehen kommen und was sich im Export verdienen läßt; wie machtvoll ein im Land akkumuliertes Vermögen im praktischen Weltvergleich dasteht; wieviel fremdes Geld ins Land kommt und Freiheiten für auswärtige Unternehmungen eröffnet, bzw. wieviel Bedarf an fremdem Geld entsteht und wie es um die internationale Kaufkraft der gesamten Nation bestellt ist. Die entsprechenden Bilanzen, von den nationalen Zentralbanken geführt, schreiben Nutzen und Nachteil fürs nationale Geschäftsleben auf, machen also im Ergebnis deutlich, was die geltenden Wechselkurse an nationalem Wachstum oder Minus mitverschuldet haben – wobei freilich offenbleibt, welches gute oder schlechte Ergebnis welchen Wechselkursen zuzuschreiben ist. Denn deren Wirkungen sind allesamt doppel- bis vierdeutig und ganz davon abhängig, auf was für ein nationales Geschäftsleben sie einwirken.
Sehr viel eindeutiger sind umgekehrt die Wirkungen, die die Außengeschäfte einer Nation auf den Stand ihrer nationalen Währung ausüben: Je nach dem, wie sehr das nationale Geld von auswärtigen Geschäftsleuten als Geschäftsmittel nachgefragt wird – sei es zum Einkaufen im Lande, also für Exportgeschäfte, sei es für eine besonders sichere oder rentable Geldanlage, sei es in der Spekulation auf Wechselkursveränderungen – bzw. wie groß umgekehrt der Drang der einheimischen Geschäftswelt ist, sich auswärtiges Geld zu beschaffen – sei es für Importe, sei es für Geldanlagen anderswo, sei es spekulativ gegen die heimische Währung –, und je nach dem, wie beides sich zueinander verhält, erscheint das Geld einer Nation als zu den gegebenen Wechselkursen zu teuer oder zu billig, „unter-“ oder „überbewertet“. Korrekturen allerdings sind wiederum gar nicht so einfach, weil in ihrer (Rück-)Wirkung gar nicht absehbar; schon gar nicht, wenn andere Staaten eigene „Wechselkursanpassungen“ dagegensetzen. Tatsache ist jedenfalls, daß sich mit und ohne ein-, viel- und allseitige Kursänderungen über die Jahrzehnte freien kapitalistischen Welthandels eine ziemlich eindeutige Hierarchie der Währungen herausgebildet hat, die einige wenige Sorten „guten“ Geldes von den vielen schlechten und immer schlechteren scheidet. Und Tatsache ist außerdem, daß um die wichtigsten Verschiebungen innerhalb dieser Hierarchie, nämlich an ihrer Spitze, heftige Machtkämpfe ausgefochten worden sind.
Deren epochemachendes Zwischenergebnis war die Einigung der wichtigsten Weltwirtschaftsmächte, ihre Währungen gegeneinander „floaten“ zu lassen. Angesichts der Unmöglichkeit, den richtigen, für alle ihre Bilanzen vorteilhaften Wechselkurs zu ermitteln, geschweige denn einvernehmlich festzulegen, und angesichts ökonomischer Kräfteverhältnisse, die ein einseitiges amerikanisches Diktat nicht mehr zuließen, haben die Währungshüter sich darauf besonnen, daß sie mit ihren Geldern und Paritäten doch sowieso alle den privaten Eigentümern der darin gemessenen Werte und deren Geschäftserfolg die besten Dienste leisten wollen. Und selbst wenn das kaum die halbe Wahrheit ist, weil jeder verantwortungsbewußte Staatsmann beim Geld zuerst an seinen Staatshaushalt und an die private Geschäftswelt als dessen Voraussetzung denkt, so haben sie sich doch zu der Konsequenz durchgerungen, die „Ermittlung“ der „passenden“ Austauschverhältnisse den Devisenhändlern zu überlassen. Statt Kursdaten zu setzen, an denen die internationale Spekulation immerzu herumzerrt, sollen doch die Spekulanten aus dem Umfang des grenzüberschreitenden Gebrauchs der verschiedenen Währungen – durch wen und zu welchem Zweck auch immer – das maßgebliche Verhältnis von Angebot und Nachfrage verfertigen und mit ihrer Konkurrenz darüber befinden, in welchen quantitativen Verhältnissen untereinander die verschiedenen Währungen ihre qualitative Gleichheit als Geldwert schlechthin bewähren. Für die Belange und Interessen der „Geschäfts-Welt“, was seither nicht bloß so ein Ausdruck, sondern Realität ist, machen die kapitalistischen Staaten ihre Währung gewissermaßen zum Angebot, das mit den Angeboten aller anderen konkurriert und im Verhältnis zu denen soviel wert ist, wie es den Club der Kapitalisten von seiner Geldqualität überzeugt.
Auf dieser Grundlage ist die Sortierung der Währungen bedeutend vorangekommen. Die Agenten des Kapitals, die hauptberuflich Anlageentscheidungen treffen, ziehen aus den Bilanzen der verschiedenen Nationen sehr viel radikalere Schlüsse als Wirtschaftspolitiker, die um einen für ihre Nation zuträglichen Wechselkurs ringen. Nach dem Grundsatz, daß für ihr Geldkapital nur die beste Währung gut genug ist, quittieren sie Mißerfolge einer Nation mit Vorbehalten gegen deren Geld, die sie sich nur durch besonders gute Geschäftsgelegenheiten wie vor allem überdurchschnittliche Zinsen abkaufen lassen – und eben dadurch gleichzeitig bestätigt sehen, weil die hohen Zinsen, die sie kassieren, ihnen fürs Fortkommen dieser Nation unter Umständen ganz ungünstig erscheinen. Wenn sie mit ihrem Geschäftsgebaren eine Währung im Kurs drücken, reagieren sie auf diesen Effekt mit vermehrter Zurückhaltung; und so weiter. Umgekehrt umgekehrt. Erfolge stiften Erfolge und Mißerfolge weiteren Mißerfolg. So ist der Konkurrenzkampf der meisten Nationen um gebührende Berücksichtigung und angemessene Bewertung ihres Geldes in dem Maße verlorengegangen, wie die D-Mark und der japanische Yen sich zu Weltwährungen aufgeschwungen haben.
Auf die Ergebnisse dieser Konkurrenz haben die EG-Europäer reagiert. Mit der Gründung und dem Ausbau des Europäischen Währungs-Systems (EWS) haben sie die Bewertungsverhältnisse zwischen ihren Währungen dem freien Ermessen der nationenübergreifend disponierenden Finanzkapitalisten entzogen und Austauschkurse festgeschrieben, die um nicht mehr als 2,25 %-Punkte über- und unterschritten werden dürfen. Schon diese Regelung zeigt, daß es sich bei der Festlegung gültiger „Leitkurse“ nicht einfach um die Rückkehr zu gesetzlichen Vorschriften handelt. Vielmehr haben die Beteiligten die bindende Vereinbarung getroffen, auf Wirkungen des freien Geldhandels mit entsprechenden entgegengerichteten Interventionen in das Verhältnis von Angebot und Nachfrage so zu reagieren, daß die Bilanzen und darüber die Wechselkurse immer wieder in Ordnung kommen. Die Partner haben sich also darauf verpflichtet, erlangte Konkurrenzvorteile in der Geldfrage nicht rücksichtslos gegen die anderen auszuspielen, sondern zur Stützung der Schwächeren einzusetzen und so als Mittel für den Fortschritt einer EG-Bilanz zu verwenden. Diejenigen nationalen Gelder, die am meisten Nutzen aus dem EG-weiten Geschäft ziehen, stehen für die weitere Brauchbarkeit der Währungen mit ein, auf deren Kosten sie erstarkt sind. Auf diese Weise bleiben alle EG-Währungen nützliche Geschäftsmittel – und Finanzmittel für die Staaten selbst, die sich freilich auch verpflichten mußten, den Partnern und der Gemeinschaft gewisse Kontrollrechte über ihren Haushalt einzuräumen, wenn sie sich genötigt sähen, den offiziellen Beistandsmechanismus über den kurzfristigen Zahlungsbilanzausgleich hinaus in Gang zu setzen.
So sind die Schuldenberge bei den EWS-Partnern in ansehnliche Höhen gewachsen. Und gleichzeitig hat ihr wechselseitiges Stützungsversprechen der Geschäftswelt immerhin soviel Eindruck gemacht, daß sie die Haltbarkeit des Systems nicht übermäßig auf die Probe gestellt hat. Im Großen und Ganzen hat sie die verbundenen Währungen als ziemlich gleichwertige Denominationen guten Geldes akzeptiert. Die schlechteren staatlichen Schuldner müssen zwar etwas höhere Zinsen zahlen, kamen aber immer problemlos an die Geldmittel, die sie zum Ausgleich ihrer Bilanzen und zur Kurspflege im vorgeschriebenen Rahmen benötigten, und mußten kaum auf die offiziellen, mit wirtschaftspolitischen Auflagen verbundenen Stützungskredite ihrer Partner zurückgreifen. Nach etlichen gemeinsam beschlossenen „Anpassungen“ – einseitige Wechselkurskorrekturen sind im EWS verboten – hat seit Ende der 80er Jahre das „Gitter“ der Wechselkurse zwischen den verbundenen Währungen Bestand.
In Schwung gekommen ist darüber ein spezieller Kreditüberbau auf Basis der Stützungsverpflichtungen der EWS-Partner. Die haben, zunächst einmal ideell, ihre Währungen gemäß ihrem jeweiligen weltwirtschaftlichen Gewicht mit verschiedenen Anteilen in einem „Korb“ zusammengelegt – die DM füllt ihn zu ca. einem Drittel, der Franc zu weniger als einem Fünftel, und so weiter bis hinunter zur Drachme, die ansonsten nicht im EWS eingebunden ist, aber ein knappes Prozent zu dem „Währungskorb“ beisteuern darf – und demgemäß eine Summe aus 80 Pfennig, eineinviertel Franc usw. gebildet, die den Namen ECU trägt. Gedacht war bei dieser „Europäischen Rechnungs-Einheit“ zunächst einmal an ein Symbol oder einen Inbegriff der unverbrüchlichen Währungsallianz der EG-Partner. Eine Verwendung für Zahlungsversprechen, die auf ECU und somit bloß mittelbar und in fester Proportion auf wirkliche Währungen lauten, war fürs Erste nur zwischen den verbundenen Notenbanken vorgesehen, als Kreditüberbau über einen gemeinsamen Fonds aus eigenen Währungen; mit solchen Zahlungsversprechen, „offiziellen“ ECUs, sollten die Notenbanken untereinander bis zu einem gewissen Grad Bilanzen ausgleichen können. Tatsächlich hat in viel größerem und steigendem Umfang die europäische Geschäftswelt von der Chance Gebrauch gemacht, ihre Kredite auf ECU auszustellen, also „private“ ECUs zu schaffen, um die Wertstabilität ihrer Forderungen nicht von einer einzelnen nationalen Währung abhängig zu machen, sondern sich gewissermaßen aller EG-Mächte als Garanten zu versichern. Sie hat „Gitter“ und „Korb“ des EWS samt ECU als Mittel genutzt, um unbefangen und mit größter Sicherheit über die Währungsgrenzen hinweg zu handeln, zu investieren und vor allem Kredit zu schaffen, ohne ruinöse Rückwirkungen ihrer Geldgeschäfte auf die eine oder andere EG-Währung befürchten und als Schranke in Rechnung stellen zu müssen. Dem Finanzbedarf der EG-Staatshaushalte kam das nur entgegen. Nur der Deutschen Bundesbank hat dieser Kreditboom nie recht gefallen, weil sie dadurch ihre wunderbare Mark indirekt und quasi unkontrolliert in Anspruch genommen findet. Tatsächlich hat diese „Privatinitiative“ aber mit dazu beigetragen, um die D-Mark herum einen Währungsblock zu schaffen, von dem keineswegs bloß die schwächeren Währungen profitieren, sondern der umgekehrt der D-Mark in ihrem Vergleich mit dem Dollar und dessen Schwankungen ein noch viel bedeutenderes Gewicht verleiht, als es der „Exportweltmeister“ allein je hingekriegt hätte.
Mittlerweile steht die EG mit ihrem Währungssystem den USA, der alten Weltwirtschaftsmacht der Nachkriegszeit, und Japan, dem anderen Exportweltmeister und kapitalistischen Wachstumszentrum, in der weltweiten Konkurrenz um die besten Bilanzen und das geldwerteste Kreditgeld als ein Block gegenüber, der sich die Führungsrolle in der Weltwirtschaft zutraut. Freilich wandelt sich mit dem Erfolg die Optik. Vom Standpunkt der Macht mit dem größten Binnenmarkt, dem meisten Außenhandel und dem – vielleicht schon – besten Geld gibt es mehr denn je Defizite zu verzeichnen. Dazu gehört alles, was die Schuldenlage verschlechtert – also z.B. der italienische Staatshaushalt – und das Wachstum bremst. Mit ihren schwächeren Partnern kommen die Hauptmächte der EG sich mittlerweile belastet und benachteiligt vor – ein denkbar deutlicher Verweis auf ihren Willen, die Konkurrenz, zu deren Eröffnung sie sich überhaupt als EG zusammengetan haben, allmählich zu gewinnen.
III.
Mit der Freiheit, die das europäische Kreditstützungssystem allen Regierungen der EG verschafft hat, soll es nun ein Ende haben. Der Stufenplan hin zur Währungsunion kommt den Mitgliedsstaaten mit dem Binnenmarkt – mit der 1993 im wesentlichen fertigen ersten Stufe – als einem „Beweis“: dafür, daß sie längst nicht mehr in der ihnen – territorial wie personell – unterstellten „Wirtschaft“ ihr nationales Lebensmittel haben. Daß sie vielmehr von den Leistungen des Kapitals in ganz Europa abhängen und deswegen auch gut daran tun, die einzig wahre Aufgabe wahrzunehmen, die die Fakten des europäischen Fortschritts gebieten. Die Nationalisierung der gesamteuropäisch erzielten Erträge des Kapitals, wie sie in der Bilanzierung in zwölf nationalen Währungen vollzogen wird und in der Verwendung dieser Haushalte für einzelstaatlichen Machtzuwachs noch stattfindet, gilt als überflüssige Behinderung europäischen Wachstums. Die Fortsetzung der bislang genehmigten und partnerschaftlich betreuten Praktiken, was nationalen Haushalt und Kredit angeht, wird als Gefahr für die Quellen und für das Maß europäischer Macht definiert. Die Nationen sollen sich durch ihre Beteiligung an der Währungsunion endgültig zu Teilen eines nationalökonomischen Subjekts herabsetzen, das sich in der weltweiten Konkurrenz gegen die bekannten Wirtschaftsmächte behaupten muß und durchsetzen will.
*
Die EG-Staaten sind bislang, gemäß ihren eigenen Bilanzen, mit einem Widerspruch recht gut gefahren: Sie haben sich supranationalen Gemeinschaftsregeln gebeugt, zentrale Elemente ihrer Hoheit in Wirtschaftsdingen abgegeben, ihre Volkswirtschaften durch die freigesetzte innereuropäische Konkurrenz ummodeln lassen und sogar die souveräne Verwendung ihres Kreditgelds an Erfordernissen eines EG-weiten Währungsblocks ausgerichtet und beschränken lassen, um dadurch die ökonomische Basis ihrer nationalen Macht zu stärken. Sie haben gemeinsame Sache gemacht, um ihre eigene voranzubringen; sind weitreichende Abhängigkeiten eingegangen, um materielle Freiheiten zu gewinnen.
Daß dieses Verhältnis so, wie es ist, nicht fortzuführen sein sollte, ist nicht recht abzusehen. Genau das behaupten aber die Macher und Gestalter Europas, die es wissen müssen. Sie beschwören die Gefahr von Rückfall und Zerfall, wenn es mit der Einigung der Gemeinschaft nicht vorwärts geht. Und zwar in die Richtung, die mit den Maastrichter Beschlüssen über die Wirtschafts- und Währungs-Union vorgezeichnet ist.
Dabei bedeutet diese Union nichts Geringeres als die Umkehrung der bisher gültigen Gemeinschaftslogik. Denn wenn die einheitliche europäische Währung am Ende stehen soll, dann geht es eben nicht mehr darum, daß die Partnerstaaten einander ihren jeweiligen nationalen Kredit garantieren. Es geht um ein neues Monopol auf das Geschäftsmittel schlechthin, mit dem jedes Kapital in Europa seine Vermehrung betreibt und in dem es seine Akkumulation bilanziert; mit dem aber vor allem die nach wie vor souveränen EG-Staaten ihren haushälterischen Geldbedarf decken; dessen Stabilität sie damit angreifen, von dessen Stabilität andererseits ihre nationale Finanzkraft entscheidend abhängt. Die Partnerstaaten haben schlichtweg kein eigenes nationales „Lebensmittel“ mehr; sie partizipieren an einem einzigen Finanzmittel, das für jeden von ihnen nur soviel hergibt, wie sie vorher allesamt an kapitalistischem Wirtschaftserfolg zustandegebracht und an geldwertem Kredit geschaffen haben. Das Verhältnis zwischen gemeinschaftlicher und nationaler Sache kehrt sich um, und zwar gleichermaßen für alle Beteiligten: Die führenden Nationen, die das größere Europa bislang als Freiraum für ihre erfolgreichen Unternehmer und als Betätigungssphäre ihrer starken Währung und zu deren Vorteil genutzt haben, werden in der Währungsunion mit all ihrer kapitalistischen Tüchtigkeit für die Wirtschaftskraft des Ganzen und für die weltwährungsmäßigen Konkurrenzerfolge der Gemeinschaftswährung funktionalisiert. Die schwächeren Partner, die sich mit der Unterordnung unter den von den andern bestimmten Gang der Konkurrenz ihrer nationalökonomischen Überlebensmittel versichert haben, kommen in der Wirtschaftsunion – wenn überhaupt – als die Randzone des euro-kapitalistischen Geschäftslebens vor, die sie abgesehen von ihrer Eigenstaatlichkeit bereits sind – bloß oder immerhin, wie man’s nimmt –; sie zählen nicht mehr als autonome Anspruchsteller, sondern genau mit den paar Beiträgen zum gesamteuropäischen Wachstum, die auf ihrem Gelände eben zustandekommen. Alle Nationen, die bislang – so gut sie konnten und, wie ihre Führer behaupten, erfolgreich – die europäische Vergemeinschaftungsaktion als Mittel für ihren Stand in der Welt ausgenutzt haben, versetzen sich mit ihrer Union in den Status eines unselbständigen Mittels für ein starkes Gesamteuropa; welches damit aufhört, ihre gemeinsame supranationale Sache zu sein, und sein Eigenleben als seine eigene nationale Sache beginnt.
Um mehr vom bisherigen Gemeinschaftswerk geht es also ganz entschieden nicht, wenn mit den Beschlüssen von Maastricht der Fortschritt zur „EWWU“ in allerlei rechtlichen und technischen Details festgelegt wird, so als wäre er nichts als eine fällige Vertiefung der gewohnten segensreichen Beziehungen; es geht um den entscheidenden Übergang zu einem neuen Standpunkt. In all seinen Regelungen liest sich das Vertragswerk zwar als Ausgeburt der bislang praktizierten Vergemeinschaftungs-Technologie der EG – und ist das ja auch; es bleibt auch dabei, daß die gesamte EG-„Souveränität“ um den Rat der nationalen Regierungs- und Staatschefs herum aufgebaut ist. Der Inhalt des Vertrags rückt die Verhältnisse aber in ein anderes Licht: Aus dem erreichten Stand wechselseitiger Abhängigkeit „folgern“ die „hohen vertragsschließenden Parteien“, daß es um bloße wechselseitige Abhängigkeit zwischen souveränen Nationen mit eigener Geldhoheit nicht länger gehen kann.
Wenn dieser Übergang als natürliche und unerläßliche Konsequenz der bisherigen EG-Geschichte dargestellt wird, dann mag das schon so sein. Das heißt dann aber, daß souveräne Staaten das, was die EG-Partner bislang an Gemeinsamkeit zustandegebracht haben, was sie sich an wechselseitiger Benützung und Stützung haben angedeihen lassen, offenbar überhaupt nur dann zustandebringen, wenn sie darüber hinaus wollen. Dann liegt also das Bekenntnis vor, daß die gemeinsame Sache überhaupt nur soweit gedeihen konnte, wie sie gediehen ist, weil der Wille zur Neugründung einer Großmacht leitend war: ein Ziel, das seiner politischen Qualität nach weniger mit einer Allianz als mit einer Eroberung zu tun hat – wobei der Gewinner der Eroberung eben dadurch erst entstehen soll.
IV.
Die „Währungsunion“ zeugt, was die im Vertrag entworfene schrittweise Herstellung einer souveränen Kontrolle über ein europäisches Geld anlangt, davon, wie polemisch der Standpunkt einer neuen Großmacht mit den überkommenen Nationalismen der Mitglieder umspringt.
Mit der Notwendigkeit, die der einen Währung samt dazugehöriger Aufsichtsinstanz zugesprochen wird, ist den nationalen Währungen ihre Brauchbarkeit für die europäische Sache abgesprochen. Die gemeinschaftliche Betreuung der einzelstaatlichen Haushalte, die Gewährung des partikularen Umgangs mit „eigenem“ Kredit ist gekündigt.
Das wird jedoch weniger als Befürwortung eines Eroberungsprogramms ausgesprochen, sondern in die Darstellung des Verfahrens verlegt, das für die Schaffung einer „soliden“ Geldware vonnöten ist. Die „Einladung“ zum Mitmachen ist verbunden mit Beitrittsbedingungen. Und die bezichtigen einige Kreditgelder, die gerade noch Sorgeobjekt gemeinschaftlicher Veranstaltungen waren, mit einem Male der Unsolidität. Nicht als Addition der Bilanzen, in denen veritable Staatsmächte auf den Reichtum zurückgreifen konnten, den sie für ihre Belange brauchten, findet die Währungsunion statt. Sondern von vorneherein als Streichung von gewaltigen Posten aus den europäischen Haushalten, die erklärtermaßen nichts wert sind und für das Kräftemessen im Weltmaßstab nichts taugen, vielmehr als Belastung zu Buche schlagen würden. Vor dem Maßstab europäischen Weltgeldes ist ein flotter Teil des europäischen Kredits in einer Krise. Seine organisierte Entwertung steht an.
*
Es kommt vor, daß Staaten ihre Währung „reformieren“. Der erste Teil dieser Aktion besteht in der Annullierung aller Kredite – d.h. vor allem der Schulden des Staates selbst –, auf die hin die nationale Notenbank ihre Banknoten ausgegeben hat, und dementsprechend der Entwertung dieser Geldzeichen. Der Staat unterzieht seinen Kredit gewissermaßen einer umfassenden Krise, nachdem er sich und seiner Gesellschaft laufend Kredit genehmigt hat, der nur noch längst aufgezehrten, also keinen – geschweige denn kapitalistisch wachsenden – Reichtum repräsentiert, und nachdem er die krisenhafte Entwertung dieses Bergs uneinbringlicher, wertlos gewordener Geldforderungen und Zahlungsversprechungen durch immer neuen Kredit verhindert hat; mit der Folge, daß sein Kredit und die Scheinchen, in denen der umläuft, die nationale Währung, sich „schleichend“, inflationär, entwerten. Mit dem radikalen Einschnitt einer Währungsreform erlöst sich der Staat aus seiner inneren Verschuldung, vernichtet damit freilich auch die in seinem Geld notierten, von seiner Notenbank garantierten Vermögenswerte. Der Zweck dieser Umwälzung besteht in ihrem zweiten Teil: Mit neuen Schulden, die bei der Notenbank als gesicherte Vermögenswerte einlaufen, und neuen Banknoten, die sie darauf ausgibt, geht derselbe Wirtschaftskreislauf, den die Außerkraftsetzung der alten Währung gestoppt hat, von neuem los; ohne die Hypothek des alten Schuldenbergs, insoweit mit gutem, hartem Geld und folglich – dies die Hoffnung und das Ziel des Unternehmens – mit solideren Erfolgen. Ob die sich einstellen, hängt freilich gar nicht von der Währungsreform ab – die „bereinigt“ ja bloß die akkumulierten vergangenen Mißerfolge, stiftet mit dem neuen Geschäftsmittel aber noch keineswegs automatisch neuen Geschäftserfolg. Erfolgreich war z.B. die Schaffung der D-Mark, weil dem bundesdeutschen Kapital gleichzeitig die schönsten Chancen, Dollar zu verdienen, eröffnet wurden; Währungsreformen in Südamerika hingegen schlagen seit Jahrzehnten regelmäßig fehl, weil sie außer dem Geldnamen gar nichts ändern, schon gar nichts an der Auslandsschuld, die den kapitalistisch erzeugten Reichtum der Nation schon enteignet und dessen Geldausdruck entwertet hat, noch bevor er zustandegekommen ist.
Eine Währungsreform, das versichern alle Europa-Experten, soll mit der Schaffung der Europäischen Währungs-Union nicht verbunden sein, für keinen der beteiligten Partner. Zwar wird ein völlig neues Geld geschaffen, das auch mit dem schon existierenden ECU nichts zu tun hat – der ist ja bloß ein „Korb“, eine kompliziert zusammengesetzte Summe aus nach wie vor existierenden und ihr beschränktes Eigenleben führenden nationalen Währungen, wohingegen der neue ECU, Euro-Taler oder wie auch immer an deren Stelle tritt. Und unvergleichlich hart und gut soll dieses neue Geld auch sein, jedenfalls solider als die meisten alten Währungen und mindestens so solide wie die besten. Die Ablösung der alten Währungen durch die neue ist aber als bloße Umrechnung oder Umtauschaktion projektiert, und zwar zu den bereits jetzt im alten ECU festgeschriebenen Relationen, die ab demnächst nicht mehr korrigiert werden dürfen – so als sollte sich in den währungsunierten Ländern außer der Maßeinheit und dementsprechend den Ziffern auf Konten und Preiszetteln, Lohnstreifen und Schuldverschreibungen gar nichts weiter ändern.
Eine Bedingung dafür, daß die Währungsunion so rein technisch als Umbenennungsaktion über die Bühne geht, ist in Maastricht freilich schon aufgestellt worden: Vorab soll die wirkliche und ehrliche Gleichwertigkeit der nationalen Währungen erreicht sein, die dann außer Kurs gesetzt werden. Mit dem „Kriterienkatalog“ wird den Nationen hierfür ein Entschuldungsziel vorgegeben, dem inzwischen und auf absehbare Zeit selbst Deutschland nicht entspricht, andere Nationen noch sehr viel weniger; und mit den flankierenden Zielvorgaben ist festgelegt, daß die verlangte „Sanierung“ der nationalen Finanzen ganz in die Verantwortung der jeweiligen Staaten fällt und kein gemeinschaftliches Hilfsprogramm sein kann, eben weil es ja um die definitive Ertüchtigung der einzelnen Partner, um ihre vollgültige Europatauglichkeit geht. Darüber, wie die Einzelstaaten dieses Ziel erreichen sollen oder können, äußert sich der in Maastricht zum Vertrag gewordene EG-Sachverstand nur in Form ernster Mahnungen zur Haushaltsdisziplin und mit der Drohung, mangelnden Erfolg mit Ausschluß zu quittieren.[2] Fest steht damit auf alle Fälle soviel, daß die gesetzte Bedingung anders als durch ein Stück Währungsreform, und zwar ihr negatives: die von Staats wegen vorzunehmende Entwertung des Kredits, den die nationalen Notenbanken ihrem staatlichen Schuldner gewährt und als nationales Geld in Umlauf gebracht haben, gar nicht zu erfüllen ist. Genau die Kredit- und Währungskrise, die bislang durch das EWS und seine Beistandszusagen für alle Beteiligten verhindert wurde, soll national ins Werk gesetzt und wohlorganisiert so durchgezogen werden, daß es anschließend für die betroffenen Staaten mit dem neuen Euro-Geld neu, ohne „Erblast“ und jedenfalls ohne den 60 % des Bruttosozialprodukts überschreitenden Schuldenberg und dementsprechend solide, weitergehen kann: als Teil Europas, der die Gesamtbilanz auf gar keinen Fall verschlechtert.
Damit ist zum einen zwischen den europäischen Partnern ein Streit eröffnet worden, der mit dem Kompromiß von Maastricht alles andere als beigelegt ist, der aber nach Maßgabe dieses Vertragswerks auch nicht so recht ausgetragen wird, schon gar nicht an der eigentlichen Streitsache.
Da gibt es Staaten, die sich für bedingungslos europatauglich, ja maßstab-setzend halten und den Übergang zu einer Euro-Währung anstreben, mit der sie sich für ihre Vorhaben auf der Welt noch besser ausgestattet sähen als mit ihrem guten alten Geld – ein anderer, Großbritannien, hält sich zwar für optimal qualifiziert im Sinne des „Kriterienkatalogs“, sieht deswegen aber gerade keinen Grund, das nationale Pfund mit einer Kollektivwährung zu vertauschen. Diese Staaten haben den Plan aufgebracht, den Einheitswährungsblock zunächst einmal in verringerter Besetzung aufzumachen und die anderen Partner zu EG-Mitgliedern zweiter Klasse herabzustufen, die den Kampf um einen gleichwertigen nationalen Kredit erst auf eigene Faust gewinnen müssen – dann gegenüber einem erst recht übermächtigen Kerneuropa! –, bis sie am europäischen Kapitalwachstum in seiner dann allein maßgeblichen Geldgestalt voll beteiligt werden. Die Partner aus dem Mittelmeerraum haben sich gegen ein solches „Europa der zwei Geschwindigkeiten“ und ihre drohende Deklassierung zum währungsmäßig abgeschriebenen Hinterland der eigentlichen EG gewehrt; mit dem nicht übermäßigen, irgendwie aber wohl stichhaltigen Argument, daß Europa ohne sie in jeder Hinsicht kleiner wäre als geplant und gewollt. Trotzdem steht, eingepackt in allerlei Beschlußverfahrensregeln, die Drohung der stärkeren Mitglieder im Vertrag, sich Europa notfalls allein zur Währungsunion zurechtzumachen; der Wille der schwächeren Partner, nicht „abgehängt“ zu werden, wird mit einem „Kohäsionsfonds“ bedient, um dessen Ausstattung nun gestritten wird; freilich nicht zu sehr und nicht zu öffentlich, weil keiner der beteiligten Staaten sein Interesse an Europa und den Maastrichter Beschlüssen verlieren soll – diese sind schließlich noch nicht ratifiziert, ganz ernst genommen am dänischen Nein sogar schon gescheitert, was freilich so niemand wahrhaben will. Es wird herumgezerrt über die Frage, wie bindend die festgelegten Kriterien für den Eintritt der und in die Währungs-Union sein sollen, wie weit der politische Ermessensspielraum gegenüber einem ökonomischen „Sachzwang“ reicht, der selber ersichtlich auf nichts als einem politischen Beschluß beruht, wieviel Hilfe andererseits die Staaten mit der schlechteren Bilanz von der EG, d.h. den stärkeren Partnern erwarten und beanspruchen dürfen.
All das dokumentiert, daß die EG-Mitglieder einander, zwecks Vollendung ihrer Gemeinschaft zur Union, ein entscheidendes Stück ihrer bisherigen Gemeinsamkeit gekündigt haben, nämlich in der Frage der Haltbarkeit der nationalen Kreditgelder. Sie haben einen Offenbarungseid abgelegt und einen anderen auf die Tagesordnung gesetzt. Offen eingestanden ist, daß in Europa Gelder zirkulieren, die eigentlich und spätestens im Hinblick auf ein hartes Euro-Geld annulliert gehören; daß also eine kontinentale Kreditkrise ansteht, damit der EG-Block sich anschließend frischen Kredit für ein – vorerst – krisenfreies Kapital- und Schuldenwachstum genehmigen kann. Noch gar nicht ausgemacht, aber überfällig ist die Entscheidung, welcher Nation Geld in welchem Umfang annulliert gehört. Mit einheitlichen Zahlen wie der nationalen Schuldenquote ist diese Entscheidung nämlich keineswegs schon getroffen – was so eine Ziffer bedeutet, wie sie aufs vorgeschriebene Maß zu reduzieren ist, genau daran macht der Streit sich fest. Nicht gerade einfacher wird die Entscheidung dadurch, daß ja wiederum keiner der verantwortlichen Europäer zur Eröffnung der Währungsunion eine Handvoll Staatsbankrotte oder auch nur eine wirklich offiziell durchgezogene nationale Währungsreform haben will. Erst recht aber ist kein Mitgliedsstaat bereit, zu Bedingungen in die Währungs-Union einzutreten, die ihm Sanierungskosten – für die gemeinsame Sache – und den anderen den Sanierungsgewinn – aus der gemeinsamen Sache – einbringen; und daß es so kommen soll, diesen Verdacht hegt jeder gegen jeden, die „Starken“ gegen die „Schwachen“ und umgekehrt. Weil gleichzeitig aber keiner von dem Projekt lassen will, wird – und das auf die nächsten Jahre hinaus, sofern der Maastrichter Vertrag überhaupt in Kraft tritt – auf dessen Grundlage um erlaubte Defizite, unerlaubte Wachstumssubventionen, Beihilfen aus der Gemeinschaftskasse, Anteile an Gemeinschaftsprogrammen, „Anpassungen“ bei den Schulden der andern und Freiheiten bei den eigenen gerungen. Die Zahlungsfähigkeit der Partner wird angegriffen und in Frage gestellt und im eigenen Land das Letzte versucht, um sich doch noch als europataugliche Wachstumssphäre oder gar als unentbehrliche Wachstumslokomotive präsentieren zu können – oder um das unbestritten zu sein.
Deswegen ist zweitens mit Maastricht in den EG-Nationen ein „Verteilungskampf“ neuer Art losgegangen. Zwischen Staat, Kapital und dem regierten und kapitalistisch benutzten Volk muß sich nämlich entscheiden, ob die Nation ein ordentliches Verhältnis zwischen faux frais und Reichtum, zwischen Wachstum der Schulden und Wachstum des Kapitals hinkriegt; ob und wie sehr sie von den schon festgestellten Kreditbereinigungs-, also -entwertungsnotwendigkeiten getroffen wird oder die Partner dafür einstehen lassen kann; und wenn sie denn zur Entwertung ihres fiktiven Nationalvermögens gezwungen ist: wen es wie trifft. Denn gerade dann kommt es darauf an, die nationale „Verarmung“ kapitalistisch produktiv zu machen, womöglich zum Wachstumsschub fürs „gesundgeschrumpfte“ nationale Kapital, das dafür natürlich nicht zu sehr schrumpfen darf: wenn schon gestrichen wird, dann müssen vor allem die unproduktiven „Vermögenswerte“ dran glauben. Es geht daher überall, egal in welcher Lage die einzelne EG-Nation sich sieht, um dasselbe, nämlich erstens um die Revision des „Sozialen“: Was an Lohn verausgabt oder gar von den „sozial Schwachen“ gänzlich unproduktiv aufgezehrt wird, kommt allemal vorrangig als finanzielle Manövriermasse für den Versuch in Frage, die Haushaltslage der Nation zu verbessern und dem Kapital neue Gewinnchancen zu erschließen. An die Politik der Schaffung solcher Gelegenheiten wird zweitens eine Meßlatte angelegt, die zwischen der aussichtsreichen „Anschubfinanzierung“ von europatauglichen Geschäften und der Dauersubventionierung nationaler Erblasten mit neuer Härte unterscheidet.
Bei der Planung und Durchführung der fälligen Streichungen stellt sich, gleichfalls in fast allen EG-Staaten, sehr viel „regionales Ungleichgewicht“ bei den staatlichen Sozial- und Wirtschaftshilfen heraus und deswegen ein innernationaler Streit ein, der mit Klassenkämpfen nicht einmal Ähnlichkeiten besitzt: Das „Europa der Regionen“ meldet sich, und zwar mit allen Anzeichen des sub-nationalistischen Wahnsinns – in Deutschland in Ost-West-Richtung, in Italien als Feindseligkeit des tüchtigen Nordens gegen den Rest mit separatistischen Tendenzen, in Belgien an Sprachgrenzen entlang, in Frankreich als Konflikt zwischen „Stadt“ und „Land“ usw.
Es ist dies die logische andere Seite der supra-nationalistischen Staatsräson, von der die Macher des einigen Europa nicht lassen wollen, um die sie vielmehr den seit langem härtesten – und wenn es nach ihnen geht: definitiv letzten – ökonomischen Konkurrenzkampf ihrer Nationen austragen. Für sie geht es bei der neuen Währung um Sinn und Zweck ihres gesamten Projekts: den Fortschritt vom kopfstärksten Binnenmarkt der Welt zur Führungsmacht überhaupt in den Grundfragen der kapitalistischen Weltwirtschaft, Form und Masse des akkumulierenden Reichtums betreffend. Ohne das mögen sie ihr ganzes schönes friedliches Europa nicht. Womit immerhin deutlich wird, was für ein globales Kampfprogramm sie verfolgen.
C. Die Widersprüche der „ökonomischen Staatsgründung“ in imperialistischer Absicht
Die an der EG beteiligten Staaten haben, ohne sich ernsten oder gar praktisch spürbaren Einwänden auszusetzen, einen Leitfaden befolgt, den sämtliche Sozialwissenschaftler der Demokratie als widerlich-dogmatische, undifferenzierte, marxistische Staats- bzw. Imperialismustheorie zurückweisen, wenn sie ihn gedruckt vorgelegt kriegen.
- Die leidige Frage nach den „Staatsfunktionen“ hat die Créme der Europapolitiker geradezu verblüffend aufgelöst. Es geht darum, möglichst viel „Markt“ zu beaufsichtigen, mehr Kapitalwachstum unter Kontrolle zu haben, also die Produktion von mehr Waren und den Umsatz von mehr Geld zu bewerkstelligen.
- Das Problem der „auswärtigen Beziehungen“, der „internationalen Politik“ erledigen sie mit derselben Antwort: Das Vertragswesen, die EG-Diplomatie zielt auf die Erschließung des 320 Millionen Menschen umfassenden Marktes, auf die Steigerung der auf ihm getätigten Kapitalinvestitionen und -erträge…
- Daß von dieser Art, daheim und auswärts den Reichtum der Nationen zu mehren, der „Wohlstand“ der betreuten einheimischen und auswärtigen Europäer abhängt, wird überflüssigerweise bei der Erläuterung des Projekts ausdrücklich erwähnt. Das beabsichtigte Mißverständnis, vom südlichen Olivenbauern bis zum nördlichen Stahlkocher hätten alle ganz viel vom Gelingen der europäischen Sache, dementieren deren politische Ingenieure ebenso nachdrücklich – mit Statistiken über die Arbeitslosigkeit und den Pauperismus, denen die „Sachzwänge“ im Zuge der Herstellung des großen Marktes Vorschub geleistet haben.
- Das andere Dementi richtet sich gegen das nicht minder propagierte Mißverständnis, die europäische Erledigung von „Staatsfunktionen“ sei eine so einvernehmliche und friedliche Angelegenheit, daß Krieg als Mittel der Politik entfällt. Die gewichtigsten Europapolitiker bestehen darauf, daß ihre Gemeinschaftsleistung ganz viel „Sicherheitspolitik“ als Geleitschutz benötigt. Aber diese uralte Staatsfunktion gehört in die Abteilung „politische Einheit“ Europas. Schon deswegen, weil das Projekt des schönen großen Marktes nicht in Mißkredit geraten soll, wenn jeder sieht, daß es ansehnliche Gewaltfragen beinhaltet. Umgekehrt liest es sich nämlich angenehmer, wenngleich genauso: Die unbestreitbare Güte der Veranstaltung, die im Interesse von Ware und Geld, Arbeitskraft und Kapital den Grenzen das Trennende nimmt, rechtfertigt jede Menge Gewalt zur Sicherung europäischer Rechte.
Von seiten der Manövriermasse, die mit Lohn und Leistung, beim Steuerzahlen, Kaufen und Sparen für das Programm ihrer Staaten geradestehen muß, ist kein nennenswerter Einspruch erfolgt. Ab und zu haben Bauern die Bedrohung ihrer Einkommensquelle zum Anlaß genommen, in heftigen Aktionen ihre Regierung an die Verantwortung, die nationale, für ihre Existenz zu erinnern. Gleich als nationaler Appell an die Pflicht zur Standorterhaltung sind die gewerkschaftlichen Auftritte erfolgt, wenn einmal eine größere Räumung von Arbeitsplätzen stattfand. Der spektakulärste deutsche Fall war Rheinhausen, und er ist wie die Normalität der dauernden „Rationalisierung“, die am einzelnen wie an ganzen Belegschaften das Prinzip „Mehr rentable Leistung, weniger Lohnkosten“ durchsetzt, abgewickelt worden. Die Gewerkschaften – auch die früher noch zu Klassenkämpfen der härteren Art aufgelegten Mannschaften in Italien und England haben ihre Abschlußlektionen gelernt – begreifen sich eben als Faktor der Mitwirkung an den nationalen wie Unternehmensbilanzen, denen sie mit den Notwendigkeiten und Bedürfnissen ihrer Mitglieder nicht in die Quere kommen wollen. Schon wegen der „Abhängigkeit“ der Lohnarbeiter vom Geschäftsgang und den nationalen Konjunkturen ordnen sie ihre Politik diesen unwidersprechlichen Rechengrößen des Kapitalismus unter – und organisieren tüchtig, bisweilen mit nationalistischen Ausfällen gegen ausländische Anleger, die „Betriebe“ von guten deutschen Arbeitern „plattmachen“, deren „Abhängigkeit“ auch von europäischen Kalkulationen mit. So ist der Internationalismus des Kapitals, den die Regierungen ihrer „Wirtschaft“ verordnet haben, einige Jahrzehnte gut vorangekommen, ohne auf den Widerstand der Opfer zu treffen. Was ihm zu schaffen macht, sind denn auch Probleme, die dem Programm „Europa“ selbst entspringen – die ganz in die „Verantwortung“ der Urheber und Nutznießer dieses imperialistischen Aufbruchs fallen. Sie laborieren gerade bei der Vollendung ihres Werks an den Gegensätzen, die sie mit ihren Interessen und der grenzüberschreitenden Freisetzung des Kapitals als ihrem Instrument auf die Tagesordnung gesetzt haben.
a) Fangen wir bei den Protagonisten der Fertigstellung Europas an, die inzwischen Behauptungen ernsten Charakters in die Welt hinaus sagen, ohne näher zu begründen, wie sie darauf gekommen sind. Kanzler Kohl ist sich
„darüber im klaren, daß ohne eine Ratifikation des Maastricht-Vertrages durch die Mitgliedsländer der Gemeinschaft auf die Dauer auch die Europäische Gemeinschaft so nicht weiterbestehen kann. Sie braucht zwingend und existentiell den politischen Rahmen.“ (Rede vom 23. Juli 1992)
Damit wirft er angesichts der Art und Weise, wie John Major vor seinem Parlament die vorläufige Zustimmung zum Programm von Maastricht erläutert hat, einige Fragen auf. Der Chef von England hat daheim nämlich so getan, als stünde eine Vereinigung Europas, die Ablösung der Souveränität der Mitglieder in wesentlichen Dingen durch hoheitliche Instanzen höheren, europäischen Zuschnitts gar nicht an. Und England hat auch versprochen, einige der für den 1. Januar 1993 wg. Binnenmarkt vereinbarten Änderungen schlicht nicht vorzunehmen.
Die erste Frage, die sich da aufdrängt, ist die: Was weiß H.Kohl über den aktuellen Zustand der Gemeinschaft, was der englische Regierungschef nicht weiß? So daß der eine die Unhaltbarkeit der prekären Lage, die Notwendigkeit des Übergangs zu neuen Verkehrsformen erkannt hat, während sich der andere darüber nicht „im klaren“ ist?
Man tut der deutschen Führung wohl nicht allzu unrecht, wenn man ihr eine Analyse der ökonomischen Verhältnisse in der EG nicht zutraut. Leute, die binnen zwei Jahren zweistellige Milliardenbeträge an Schulden auflegen und dann das Risiko einer „Inflation“ mit einer Veränderung gewisser Zinsfüße beseitigen wollen, tun so etwas nicht. Sie halten Finanzpolitik für einen einzigen Kampf gegen Inflation, und das genau in dem Augenblick, wo sie, die Herren der „Geldschöpfung“, die Umlaufsmittel unter ihrem Kreditsystem schlagartig vermehren. Fast möchte man sie fragen, wo der „Warenberg“ bleibt, der ihrer hochtheoretischen Auffassung zufolge immer in passender Dimension dem „Geldberg“ „gegenüberstehen“ muß! Kurz: Diese Akteure der Wirtschafts- und Finanzpolitik können nicht einmal ihre eigene Methode, Geld zu drucken, halbwegs erklären; sie verwechseln andauernd Ursache und Wirkung, und eine gigantische Staatsverschuldung nennen sie „Sparkurs“. Da ist dann kaum anzunehmen, daß sie über die Mängel des europäischen Handels mit Waren, Geld und Kapital Bescheid wissen, die sie durch ein Ding namens „politischer Rahmen“ beheben wollen.
Die zweite Frage, die sich stellt, lautet also: Worum geht es der deutschen Regierung, wenn sie die Unhaltbarkeit des status quo in der EG beschwört und auf die Veränderungen dringt, die in Maastricht aufgesetzt wurden?
Zunächst einmal drücken die Vorkämpfer der Fertigstellung ihre Unzufriedenheit mit dem Erreichten aus. Die durch Freihandel und das Netzwerk des EWS vollzogene Erschließung von 12 Standorten, die miteinander kooperieren und ihre Konkurrenz aushandeln, ist ihnen nicht recht. Das immense „Wachstum“, das gesteigerte Handelsvolumen, der höhere Anteil am Welthandel – all das ist (noch) gar nicht das erfreuliche Ergebnis, das sie gemeint haben. Bei der Besichtigung des Kredits, über den die Mitgliedsstaaten der EG verfügen, sind sie nicht zufrieden über das Maß an Freiheit, das sich diese Nationen durch ihre Zusammenarbeit gesichert haben. Aber nicht etwa aufgrund einer theoretischen Analyse, die ermittelt hätte, daß für die Fortsetzung des europäischen Aufschwungs die Masse des fiktiven Kapitals zu groß ausgefallen sei; sie haben nicht, um es in ihren Kategorien auszudrücken, den konjunkturpolitischen Befund ermittelt, für den gedeihlichen Fortgang des europäischen Geschäfts sei wohl die Geldmenge in zu große Dimensionen gestiegen. Ihr diesbezügliches Urteil geht etwas anders. Insbesondere die deutsche Regierung stellt beim Blick auf die Verteilung der europäischen Haushalte fest, daß Beiträge und zugeteilte Leistung nicht im richtigen Verhältnis stehen; ihre größeren Anteile am EG-Budget sieht sie nicht als Produkt ihrer größeren „Erfolgsbeteiligung“ am Projekt EG, sondern als Mißstand an. Mit den Vorstellungen des „Gebens und Nehmens“ hält sie die Verteilung des europäischen Kredits für schief; ein „Zuviel“ an Kredit will sie schon ausgemacht haben, aber in Gestalt seiner lokalen Größen – bei anderen also! –, um schließlich die Lokalisierung prinzipiell für verfehlt zu halten. Gemeinsam mit Frankreich kleidet Deutschland seine Ansage: „Wir führen die EG auf der alten Geschäftsgrundlage nicht mehr fort!“ in die Form eines Urteils über angeblich unhaltbare Geschäftspraktiken der Gemeinschaft: „Die währungspolitische Zusammenarbeit hat ihre Dienste getan, sie war gut – ihr Ausgangspunkt und Produkt jedoch, die nationalen Bilanzen und Haushalte sind ab sofort kein taugliches Instrument mehr.“
Die dritte Frage betrifft also das „Wofür“ ebenso wie das „Für wen?“ Die letztere Abteilung wird seltsamerweise von denen, die den Vertrag von Maastricht konzipiert und die anderen mit ihrer Währungsunion konfrontiert haben, nicht mit einem laut vernehmlichen „Für uns natürlich!“ erledigt. Kohl rührt die Trommel für den „politischen Rahmen“, die europäische Endlösung, weil „die Europäische Gemeinschaft“ ihn braucht.
Dies ist erst einmal deswegen verlogen, weil die großen Einiger Europas die EG, wie sie geht und steht, gerade überwinden wollen. Wenn die ohnehin „so nicht weiterbestehen“ kann, da sie maßgebliche Mitglieder so nicht weiterführen wollen, kommt sie schwerlich als Auftraggeber in Frage. Zweitens wird der gute Ton des Euro-Imperialismus auch dadurch nicht glaubwürdiger, daß er die Adresse der Macht, die durch die Entmachtung und Unterordnung von gleich mehreren Staaten wächst, mit „Europa“ angibt. Wenn es da nicht höchstförmlich „Reichshauptstadt Berlin mit Nebenstelle Paris etc.“ heißt, so bedeutet das herzlich wenig; die Politik des „Vereinigten Europa“ steht mit seiner Herstellung einigermaßen fest, sie entspricht den Vorstellungen derer, die es so dringend fordern und herstellen wollen. Und am „wie“ dieser Politik besteht auch kein Zweifel – die Richtlinienkompetenz liegt allemal bei denen, von deren Standorten aus die größte Überzeugungskraft der demokratischen Argumente „Geld und Gewalt“ ausgeht. Drittens aber sind diese Konsequenzen des Antrags auf eine friedliche Eroberung, die als „Zusammenschluß“ und nicht als „Anschluß“ stattfinden soll, kein Geheimnis – schon gar nicht in den Hauptstädten des Kontinents.
Und auf die politischen Güterabwägungen der dortigen Souveräne ist trotz der ökonomischen Abhängigkeiten, die sie in der alten EG eingegangen sind, noch lange kein Verlaß.
Dies ist der erste Widerspruch, an dem die ambitionierten Großmachtstifter leiden. Es ist nämlich eine Sache, den erpresserischen Verlockungen nachzugeben, die mit der Teilnahme an den Geschäften eines ökonomischen Riesen verbunden sind. Eine andere ist es, als zum regionalen Bestandteil herabgesetzte politische Untergröße den Grad und die Qualität dieser Beteiligung in die Hände derer zu legen, die auf die Frage „Wofür?“ eine eindeutige Antwort erteilen: Sie wollen das Groß-Europa – wegen der „negativen Besetzung“ dieser Vorsilbe sagen sie sie nur feindlichen kleineren Mächten nach, die klein bleiben sollen –, um die „Herausforderung“ zu bestehen, die ihnen – das ist ihr Begriff vom nächsten Jahrhundert, weil in diesem einiges nicht nach Wunsch gelaufen ist – in Gestalt anderer Großmächte keine Ruhe läßt. Und manchem europäischen Souverän ist der Vorteil des ökonomischen Dabeiseins fraglich, wenn er sein Land zum Instrument dieses „Aufbruchs“ herrichten muß. Andere fragen nach den Kompetenzen, die ihnen im neuen Gebilde verbleiben, auch nach Garantien – dafür, daß in ihrem Unionsland auch ähnlich viel von dem läuft, was jetzt unter ihrer Regie so geht. Kurz: Dieser Versuch einer ökonomischen Staatsgründung steht und fällt mit Entscheidungen von Souveränen, die erst einmal frei berechnend abwägen, bevor sie die staatsmächtige Freiheit des Berechnens abtreten.
b) Eine wesentliche Rolle in diesen Berechnungen spielt die Konstruktion, die unter dem Titel „Währungsunion“ die eine große ökonomische Macht verbürgen soll. Sie ist aus der Sicht der alten wie neuer Mitglieder des europäischen Einigungswerks eine nicht mehr so leicht zu revidierende Zuteilungs- und Entzugsaktion auf dem Feld ökonomischer Ressourcen. Mit ihr werden praktische Urteile über die künftige, eurokapitalistische Brauchbarkeit ganzer Landstriche gefällt – also auch über ihre Benutzung. Wenn die rentable Indienstnahme von Land und Leuten unter das europäische Diktat gestellt wird, dem europäischen Haushalt mit seinem ECU die „Stabilität“ zu verleihen, die für den großmächtigen Handelskrieg mit dem Rest der Welt für nötig erachtet wird, kommt da einiges unter die Räder.
Und das macht den zweiten gewaltigen Widerspruch der ökonomischen Staatsgründung aus: Der Erfolg einer vorweggenommenen Sicherung der Stabilität des Euro-Geldes ist ziemlich zweifelhaft. Daß eine Dezimierung der lokalen Schuldenproduktion zu vollziehen geht, ist unbestritten – dergleichen kommt auch ohne Bedingungen für einen Beitritt zu einer Währungsunion vor, nämlich dauernd durch die Bewegungen des internationalen Kreditmarktes und, in spektakulärer Manier, in Krisen. Fraglich allerdings ist, ob dergleichen als dekretierte „Stabilitätspolitik“ in europäischer Perspektive, als organisierte Streichung von Kredit den erwünschten Effekt hat. Auch wenn sich jetzt schon einige EG-Nationen beflissen daran machen, den „Kriterien von Maastricht“ zu genügen, dürfte die Konsequenz des europaweiten Schlagers „Der Staat spart!“ kaum die gegenteilige Wirkung von Krisen haben! Zumal während der angelaufenen Veranstaltung einerseits flott nach nationalen Bedürfnissen Schulden aufgelegt werden, daß es kracht (die schönsten Zahlen liefert ausgerechnet die BRD mit ihrer Wiedervereinigung, also auf Kosten ihrer „Ankerwährung“), andererseits zur Vermeidung der schlimmsten Folgen die Gemeinschaft neuen Kredit schafft. Daß das Projekt „Währungsunion“ geeignet ist, die längst offiziell leidende Konjunktur des Weltmarkts zu sanieren, glaubt sicher niemand so recht. Daß es in Europa zu einer realen Steigerung des kapitalistischen Geschäftslebens führt, aus dem dann die Großmacht ihr weltweit konkurrenzloses, stabiles Geldwesen, ihre Waffe der Konkurrenz schmiedet, ist erst einmal nur die Absicht. Von der jedoch wegen der zu erwartenden „Schwierigkeiten“ die Architekten der Großmacht nicht lassen.
c) Beeindrucken lassen sie sich zur Zeit eher von anderen Schwierigkeiten, die allerdings auch auf ihr Konto gehen. Sie haben allesamt, ob nun treibende Kräfte in der europäischen Sache oder bereitwillig berechnende Mitmacher, die politische Kultur ihrer Nationen geformt. Und zwar so, daß die Nation, ihre Fortschritte und ihr Bedarf das Argument in jeder politischen Auseinandersetzung sind. Auch ihre Bemühungen um und in Europa haben sie stets mit dem nationalen Interesse begründet – wie jede andere Maßnahme, vom Recht über das Soziale bis zu den Steuern und die Industrie auch. Sie, die einen ganzen Kontinent aufmischen, die deswegen auch die ihnen unterstellte „Gesellschaft“ europa-tauglich herrichten, sind mit neuen Tönen konfrontiert. Sie sehen sich nationalistischen Zweifeln gegenüber, die den Nutzen ihrer europäischen Umtriebe für die Nation in Frage stellen.
Die harmloseste Spielart dieses Volkssports besteht darin, daß aus den Reihen der politischen Parteien, auf Seiten der Opposition der Verdacht geäußert wird, bei der Mitwirkung an der europäischen Einigung würde zuviel an nationalem Besitzstand preisgegeben. Gewöhnlich läuft die Auseinandersetzung mit solchen Anklagen – selbst in Deutschland gibt es Gauweilers, Alt-Finanzminister und Geldpatrioten, die voreilend mit der Bildzeitung den Verlust der schönen starken DM betrauern – ebenso schematisch wie effektiv ab. Die Warnungen werden „ernst genommen“, mit Verweis auf die Sachzwänge des Dabeisein-Müssens zurückgewiesen, schließlich in Vorstöße umgemünzt, mit denen die Regierung in Brüssel die unversehrten Rechte und Ansprüche der Nation wahrt.
Bedenklicher wird der lebendige Patriotismus für die Aktivisten Europas dann, wenn sich der Vorwurf des Verrats am Recht der Nation so bewegt vorträgt, daß die Geschäftsordnung, das Procedere der Politik selbst ins Wackeln kommt. So wenig sich kapitalismusgeschädigte Volksteile in den gemäßigten Demokratien des Kontinents den Klassenkampf einleuchten lassen, um die Täter in die Schranken zu weisen, deren Opfer sie sind, so gründlich beherrschen sie das Aufbegehren der zweiten Art. Die ihnen als Patrioten verabreichten Beschränkungen führen sie darauf zurück, daß ihre Herren anderen, den Falschen jedenfalls, manchen Gefallen tun. Das führt zu häßlichen Tönen, mit denen die einen Europäer ihrer Regierung den Vorwurf machen, sie zugunsten anderer Europäer zu schröpfen und zu vernachlässigen. Manche fassen ihre Vernachlässigung, die durchaus etwas mit der Zurichtung des Landes für Europa zu tun haben mag, noch radikaler auf. Sie werden zu Separatisten in der eigenen Nation, in der sie sich nicht mehr aufgehoben fühlen. Und Leute, die sich zum Sprachrohr solcher Bewegungen machen, sie erst richtig auf die Beine stellen, weil sie in ihnen ein Mittel zu eigener politischer Macht sehen – im Land oder getrennt von ihm –, finden sich allemal. Das bringt die Parteienlandschaft, die Bequemlichkeit des Regierens und bisweilen den ganzen inneren Frieden durcheinander. Und spätestens an der Frage, ob die tätigen und sympathisierenden Ausländerfeinde so gelehrig sind, daß sie den Unterschied zwischen comunitari und extra-comunitari (so der italienische staatstragende Sortenkurs des Rassismus) akzeptieren, ist der auf Freizügigkeit angelegte innereuropäische Nationalismus auf die Probe gestellt.
Anscheinend liegen hier Versäumnisse vor, was die Umerziehung von Nationalisten zu Euro-Nationalisten betrifft. Solange der diesbezügliche Nachholbedarf noch nicht gedeckt ist, werden – ganz ohne die Wiederauferstehung des toten Kommunismus – aus den sozialen Problemen, die Euro-Politiker und Euro-Kapitalisten den dazu vorgesehenen Volksteilen bereiten, staatliche Krisenszenarien. Diesen Widerspruch haben die Franzosen, die mit ihrem Referendum den Konter gegen das Mißgeschick im kleinen Dänemark führen wollen, als europäische Leitungsmacht begriffen. Im Land der Aufklärung hängen Plakate herum, auf denen der Japse und der Ami als die Gegner „wahrzunehmen“ sind, die inskünftig ins Visier auch des Volkes gehören.
d) Von ihrem Vorhaben abbringen lassen sich die Mitglieder des Komitees zur Errichtung einer europäischen Großmacht durch die Hindernisse, die sie für ihr Projekt ins Leben gerufen haben, nicht. Im Gegenteil: Sie rechnen gar nicht damit, daß der Weg von der alten EG über den Binnenmarkt und die Währungsunion bis zur politischen Zentralmacht schrittweise und harmonisch zurückgelegt wird. Sie warten auch gar nicht darauf, daß ihnen ein wohlerzogener, an Europa gewöhnter Volkswille den Auftrag erteilt, in Gottes, Adenauers, de Gasperis, de Gaulles und Churchills Namen die politische Einheit zu verwirklichen. Sie sind schon längst dazu übergegangen, das, was politische Einheit nach innen (noch nicht) ist – ein politischer Souverän für ganz viel Land und massenhaft Leute –, nach außen zu praktizieren.
Die politische Einheit
ist kein Produkt der ökonomischen Staatsgründung. Letztere wird vorangetrieben, aber ausdrücklich als Instrument der Auseinandersetzung mit dem Rest der Welt, die sich die Führungsmächte Europas vorgenommen haben. Alle Mißverständnisse von seiten der an der EG beteiligten Souveräne, es ginge letztlich doch immer noch um die Beförderung des Wirtschaftswachstums im ganzen wie in den schön beflaggten Demokratien, werden praktisch ausgeräumt. Die Vorwegnahme einer europäischen Außenpolitik, die kein Mandat hat, sondern sich ständig eines beschafft, ist der Kunstgriff, durch den die ökonomischen Interessen sämtlicher EG-Mitgliedsländer dem Zweck untergeordnet werden, dem sie von sich aus, in ihrer jetzigen Verfassung noch gar nicht dienen.
Es sind ambitionierte Weltpolitiker, die da eine so gewaltige Eile an den Tag legen. Leute, die im Unterschied zu einem dänischen Volksvorstand oder holländischen Windmühlenverweser im Ende des Kalten Krieges eine Chance und eine Notwendigkeit ausgemacht haben.
Die Chance: Die Unterordnung unter die Weltmacht USA – wegen russischer Bedrohung –, der vielgerühmte Zwang zur Teilnahme am westlichen Wertebündnis ist entfallen. Hören muß man auf die USA nur noch aus einem Grund: ihre Überlegenheit.
Die Notwendigkeit: Der Beistand und Schutz der USA war ebenso wie der eigene Bündniswille ein Werk des mächtigen Feindes im Osten. Die Realisten in Europas Hauptstädten machen sich nämlich keine Illusionen darüber, daß sie, bei aller Liebe zum gewesenen Hauptfeind, immer schon in Konkurrenz zu ihrem Bündnispartner gestanden haben. Und daß der auch umgekehrt die Sache genauso sieht und aus seinen wohlverstandenen eigenen Interessen heraus einen Schutz der in den letzten vierzig Jahren gewachsenen Interessen und Rechte der europäischen Mächte nicht mehr garantiert. Im Gegenteil – die Amis haben eher Probleme damit, die Geschäftsbedingungen, die während der herrlichen Zeiten des immerwährenden Endspiels Nato contra SU eingeführt wurden, zu verlängern. Die lieben Europäer haben sich vorgenommen, diesem Wunsch nicht zu widersprechen, jedoch auch, sich auf den einbindungsbeflissenen Schutzwillen der Amerikaner nicht mehr zu verlassen. Sie haben genug eigene Dinge in aller Welt zu schützen und zu verteidigen, von denen sie wissen, daß sie immer öfter von den amerikanischen Interessen abweichen und gegen sie stehen.
Besagte Eile macht sich geltend in dem gar nicht schlichten Bedürfnis, in sämtlichen weltpolitischen Affären eine „eigene Position“ zu haben und zu vertreten. Europa dementiert seit 1990 unentwegt sein insbesondere von Deutschland aus ebenso unentwegt vorgetragenes Bekenntnis, an der alten Allianz im Grunde nichts ändern zu wollen. Das Bedürfnis, weiterhin Nutznießer einer komplett beaufsichtigten Weltwirtschaft zu sein, also auch als mitwirkende Kraft an der vorläufig unbestreitbaren Weltaufsicht der US-Gewalt zu partizipieren, ist eine Sache. Die andere ist das Bemühen, aus der Rolle des subalternen Mitgestalters der Weltordnung herauszukommen und allmählich auch selbst einiges zu gestalten – an Affären und in Sphären, die sich ganz aus ganz eigenen Interessen heraus definieren.
Der Golfkrieg war der erste Fall, an dem die Welt die Dialektik von Mitmachen und Distanz studieren konnte. Die Verwandlung Jugoslawiens in einen Hinterhof Europas ist der zweite. Das Maß der in Anschlag gebrachten Zuständigkeit hat hier schon andere Dimensionen.[3] Und das Problem, daß es Europa als Staat, als eine Macht über ein Geld, über ein Bruttosozialprodukt, über eine Bürgerbrut … überhaupt noch nicht gibt, war überhaupt keines. Am Fall Jugoslawien haben die Außenpolitiker des alten Kontinents, aus dem sie eine Weltmacht machen wollen, die Bestückung ihres Staats in statu nascendi mit lauter Werkzeugen und Instituten vollzogen, die eine Staatsmacht so braucht. Aus der KSZE, deren K für Konferenz steht, ist ein politisches Subjekt in der „Völkergemeinschaft“ geworden. Die WEU, nie so recht auf die Beine gebracht, steht plötzlich Gewehr bei Fuß. Und das alles unter Anerkennung der USA, denen man im Rahmen der Nato auch noch zu manchem verpflichtet ist, unter Anerkennung der Nato selbst, als deren Teil man sich nach wie vor definiert. Die Mitglieder der EG finden sich dabei unversehens als Kollaborateure in einer weltpolitischen Affäre wieder, die ihren Charakter als Zugriff und Kontrolle vor allem aus deutschem Munde und durch deutsche Diplomatie zugesprochen bekommt. Ob sie je aus eigenem nationalem Interesse ein ähnliches oder gar dasselbe Vorgehen gewählt hätten, spielt da keine Rolle. Zumindest in der Angelegenheit Jugoslawien sind sie – auch wenn sie bei EG immer noch ein bißchen Wirtschaftswachstum im Sinn haben – beitragspflichtige und beipflichtende Mitglieder einer sich emanzipierenden europäischen Großmacht geworden.
Man sieht, die Abhängigkeiten der überkommenen EG lassen sich zu noch viel mehr benützen als zur „Fortsetzung der Zusammenarbeit“. Dieses Interesse taugt noch für die Einbindung in ganz andere „Sachzwänge“. So schaffen gewisse Nationen sich selbst die „Herausforderungen“, vor die sie sich gestellt sehen.
[1] Dazu Punkt B II.
[2] Hierzu Punkt B I.
[3] Siehe den Artikel „Der Krieg auf dem Balkan. Zweifelhafte Fortschritte auf dem Exerzierfeld des deutsch-europäischen Imperialismus“ auf Seite 83 in diesem Heft.