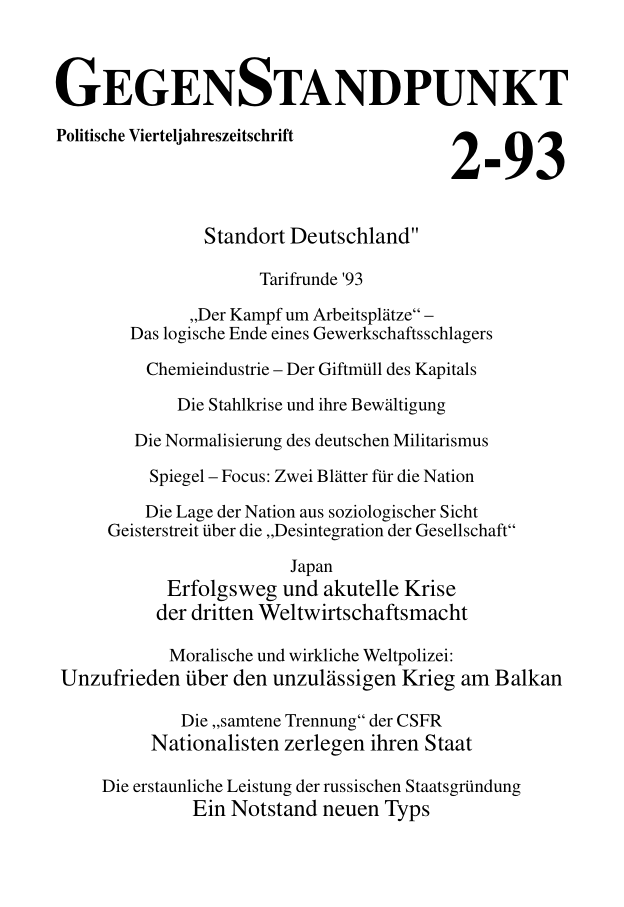Standort Deutschland
Die Anpassung der Lohnfrage an den Standort Deutschland
Lohnsenkungen sind angesagt, d.h. in der Tarifrunde 1993 wird das „historisch-moralische Element von v“ neu definiert. Und noch etwas muss neu geordnet werden, das Tarifwesen. Insgesamt also sehr lehrreich die Tarifrunde, für Wessis wie Ossis.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Siehe auch
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
- I. Tarife ’93 – das „historisch-moralische Element“ von „v“ neu definiert
- II. Der Streit um die Neubestimmung des Tarifwesens
- Der Kampf der Gewerkschaft um ein prinzipielles Recht auf Lohn
- Der Kampf der Unternehmer um ein prinzipielles Recht auf beliebig wenig Lohn
- Die Antwort der Gewerkschaft (1): „pacta sunt servanda“
- Die Antwort der Gewerkschaft (2): Drohung mit Betriebstarifen
- Die Antwort der Gewerkschaft (3): Aktionstage „Gegenwehr“
- III. Die Lehren der Tarifrunde ’93
Standort Deutschland
Tarifrunde ’93
Die Anpassung der Lohnfrage an den Standort Deutschland
Die regierungsamtliche Weisung, daß die Lohnkosten in Deutschland gesenkt werden müssen, ist angekommen, das „Signal“ des ÖTV-Abschlusses von 3,04 % verstanden worden.[1] Sämtliche Tarifabschlüsse 1993 verfolgen das Ziel, den Lohn auf ein standortverträgliches, konjunkturunabhängiges, dauerhaft niedriges Normalmaß zu drücken. Der „Lebensstandard“ der Lohnarbeiter in West wie Ost und die Lohnkriterien wurden neu definiert.
Weitgehend geschah das ohne großes öffentliches Aufsehen – mit einer Ausnahme, dem Streit um die Kündigung der Ost-Stufentarifverträge von 1991 durch die Metall- und Stahlarbeitgeber. Dabei geht es um die Revision der bisher gängigen Tarifvertragspraxis, daß Tarifverträge die Kapitalisten auf Mindestlöhne festlegen. Ganz im Sinne der nationalen Leitlinie, Schranken für die Kapitalakkumulation zu beseitigen, findet hier ein Durchbruch statt: Lohnkorrekturen aus betriebswirtschaftlichen Gründen, also nach unten, sollen jederzeit und trotz existierender Verträge möglich sein.
So negativ die materiellen Folgen der Tarifrunde für die Arbeiter in West wie Ost sind, ein Beitrag zur sozialen Integration der Ostdeutschen in die bundesrepublikanische, sozialpartnerschaftlich geregelte Welt der Arbeit war die Tarifrunde allemal, und das „Bedürfnis“ der Westler „nach Orientierung“ wurde gleichfalls befriedigt. Die Frage, wer welche Ansprüche warum haben darf, wurde eindeutig geklärt.
I. Tarife ’93 – das „historisch-moralische Element“ von „v“ neu definiert
Hochoffiziell hatte der Kanzler befunden, daß die Rezession in Deutschland sich insbesondere den zu hohen Löhnen verdanke, daß der „Aufbau Ost“ bzw. der „Solidarpakt“ Opfer also vor allem bei den Arbeitnehmern erfordere. Entsprechend formuliert waren auch die „wirtschaftlichen Rahmendaten“, die Jahresgutachten des Sachverständigenrates, die Gemeinschaftsgutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute und der Jahreswirtschaftsbericht: Mäßigung an der Lohnfront, auf alle Fälle Lohnerhöhungen unterhalb der Preissteigerungsrate sind oberstes Gebot. Damit war die Sache auch für die Gewerkschaften klar.
Im Westen – Reallohnsenkung muß sein
„Eine tatsächliche monetäre Kompensation dieser Belastungen („der unsozialen Finanzierung der Einigungskosten“) durch entsprechende Lohn- und Gehaltssteigerungen ist mit den herkömmlichen Begründungsmustern gewerkschaftlicher Tarifforderungen nicht vereinbar.“ (WSI 9/92)
Selbstverständlich halten sich die Gewerkschaften an die „Rahmendaten“ – eine andere Begründung für Lohnforderungen als „wirtschaftlich vertretbar“ können und wollen sie sich ohnehin nicht vorstellen. Und in diesem Falle bedeuten die Daten: Rezession heißt Lohn runter, „Aufbau Ost“ solidarische Zustimmung zu den staatlichen Schröpfungsmaßnahmen. Nationale Pflichtvergessenheit lassen sich die Gewerkschaften schon gar nicht nachsagen. Darum würdigen sie den ÖTV-Abschluß (West):
„Interessen-Ausgleich im besten Sinne des Wortes erreicht. Er billigt den Beschäftigten einen Ausgleich der Inflationsrate zu, soweit sie nicht auf Steuer- und Abgabenerhöhungen, insbes. die zum 1.1. in Kraft getretene Mehrwertsteuererhöhung, zurückgeht.“ (HB 8.2.)
Das war doch Ehrensache, daß sich deutsche Arbeiter für die staatlichen Lohnabzüge im Rahmen des Solidarpakts nicht bei den Arbeitgebern schadlos halten. Entschädigen soll die Lohnerhöhung höchstens für die sonstigen Preissteigerungen, deren fiktive Größe findige Gewerkschaftsökonomen als genau den Prozentsatz errechnet haben, den die Wirtschaftsinstitute in diesem Jahr für gerade noch erträgliche Lohnsteigerungen veranschlagten.
Verantwortungsvoll wie sie ist, hat die ÖTV ’93 zudem die sozialen Folgen des niedrigen Lohnabschlusses gleich mitbedacht und nicht vergessen, ihre soziale Ader – in Bezug auf den Fiskus! – herauszustreichen:
„Schließlich beinhaltet er (der Abschluß) mit dem Kindergeldzuschlag für untere Einkommen eine soziale Komponente, die für die besonders von der Inflation betroffenen Einkommensbezieher am unteren Ende der Lohn- und Gehaltstabelle Einkommensverbesserungen bis zu 3,7 % bedeutet, die öffentlichen Kassen aber nur mit 0,04 % belastet.“ (ebd.)
So hat sie dem Umstand Rechnung getragen, daß die unteren Tarifklassen im Öffentlichen Dienst inzwischen an die Grenzen kommen, wo sich Ansprüche auf Wohngeld oder Sozialhilfeleistungen ergeben. Was lag da näher als die Lösung, dem Staat Sozialleistungen zu ersparen, indem der öffentliche Arbeitgeber gleich entsprechend Lohn bei den untersten Einkommensgruppen draufzahlt. Das macht das Ergebnis viel ansehnlicher – die Leute liegen mit ihrem Lohn glatt noch über dem Sozialhilfesatz! – und kostet so gut wie nichts.
Bis auf wenige – kaum abweichende – Ausnahmen haben sämtliche folgenden Tarifabschlüsse (West) die „3“ vor dem Komma. Die Reallohnsenkung wird dabei keineswegs mehr – wie bei früheren Niedrigabschlüssen üblich – als „vorübergehendes Zurückstecken“ mit der Vertröstung auf bessere Zeiten verkauft, sondern als die Einsicht, daß „wir von der Vorstellung Abschied nehmen müssen“, der bisher übliche „Wohlstand“ der Lohnabhängigen in Deutschland ließe sich in Zukunft halten oder wiedererringen.
Ganz im Sinne des Kanzlers hat die Gewerkschaft die Lehre beherzigt, daß die derzeitige besondere Situation der Nation besondere Anstrengungen und Opfer verlangt, und das deutsche Volk darin die Gelegenheit sehen soll, seine Ansprüche grundsätzlich nach unten zu korrigieren. Der bisherige „Lebensstandard“ der Leute kann nicht länger als normal angesehen werden; er war eine Ausnahme, mit der ein für allemal Schluß ist.
Im Osten – die Billigzone muß bleiben
Was die 3 % im Westen, sind die 9 % im Osten Deutschlands; das Gros der Abschlüsse läuft auf diese Zahl hinaus. Die regelmäßige Würdigung dieser Vereinbarungen, daß damit wenigstens ein „Ausgleich für den Anstieg der Lebenshaltungskosten im Osten“ gegeben wäre, ist zwar einerseits – was die stattlichen Preissteigerungen betrifft – ein Gerücht, andererseits eine Klarstellung: Das Versprechen kontinuierlicher Angleichung der Löhne bis zum Westniveau ist passè. Wenn ein Ostler jetzt 70-80 % des Westlohns als Monatsentgelt nach Hause trägt, dann ist das genug in Sachen „Keiner soll es schlechter haben…“ Inzwischen wird öffentlich das Erreichen von 100 % Westniveau auf „frühestens im Jahr 2000“ vertagt.
Dabei wird auch gar nicht verheimlicht, daß die „Lebensqualität“ der Zonis im Vergleich zu den Lohnempfängern in den alten Bundesländern in Wirklichkeit noch viel bescheidener aussieht: Ein Ostler erhält wesentlich weniger Leistungszulagen, Urlaubs- und Weihnachtsgeld; vermögenswirksame Leistungen in der Regel überhaupt nicht; und seine Wochenarbeitszeit beträgt im Schnitt 40 Stunden. (Wenn man den Vergleich in Lohnkosten ausdrückt – die Gewerkschaft kann schon gar nicht mehr anders denken –, errechnet man Lohnkost Ost = ca. 50 % Lohnkost West.)
Laut Tarifvereinbarungen haben sich die Ost-Proleten also mit der dauerhaften Billiglohnzone Ost abzufinden. Die Gewerkschaften mochten sich einfach nicht den betriebswirtschaftlichen Rechnungen der Ost-Unternehmer verschließen, daß ohne Niedriglöhne keine ordentlichen Profite, also auch keine rentablen Unternehmen möglich seien:
„… so bleibt doch richtig, daß sich die ökonomischen Probleme zumindest für einen Teil der Betriebe in dem Maße verschärfen, wie das Tempo der Lohnanpassung zunimmt.“ (WSI 9/92)
Daß der Lohn die Geldsumme ist, von der die Leute leben müssen, ist für die Gewerkschaft bloß dann ein Argument, wenn die Unternehmen ihrer Meinung nach entsprechende Kosten auch verkraften können. Ansonsten hat das Argument zurückzustehen, und die Arbeitnehmer müssen schauen, wie sie mit dem bißchen Geld, das ihnen zugestanden wird, zurechtkommen. Die DGB-Vereine gehen offenbar davon aus, daß es so sein muß und seine Ordnung hat, daß der Lohn, als der zum Kauf von Arbeitskraft verausgabte Kapitalteil – wie Marx analysierte – „v“ ist: die vom Erfolg des Kapitals abhängige Variable. Alles andere wäre ja auch Klassenkampf. Und die Sache mit dem „historisch-moralischen“ Element (Kapital Bd. 1, S. 185) verstehen sie anscheinend als Aufforderung, daß die Arbeiter in Zeiten „nationaler Kraftanstrengung“ die historisch moralische Pflicht haben, mit dem Lohn kräftig nach unten zu gehen.
Ein Problem gab es allerdings in dieser Tarifrunde doch noch: Daß die Tarifpartner 1991 in ihrer Vereinigungseuphorie oder vielleicht auch nur, um die Westwanderung der Ost-Arbeitskräfte zu stoppen, in einigen (wenigen) Branchen Stufenverträge abgeschlossen hatten, die feste Daten für die weitere Angleichung an das westliche Lohnniveau vorsahen. Zwar hatten die umsichtigen Verhandlungsführer Neuverhandlungen für den Fall vereinbart, daß die vereinbarten Steigerungen bei Fälligkeit inopportun erscheinen würden, aber nicht alle Gewerkschaften nahmen diese Klausel als Verpflichtung, den Unternehmervorstellungen bedingungslos zu folgen. Vorbildlich war hier nur die IG Chemie, die die Stufenerhöhung für den Bereich Feinkeramik sofort zurücknahm und stattdessen 9 % vereinbarte. Die IGM leistete es sich hingegen, auf dem formellen Gesichtspunkt zu bestehen, daß ‚Verpflichtung zu Neuverhandlungen nicht Verpflichtung zu Neuabschluß!‘ heißt, und den Antrag auf Revision als unbegründet abzuweisen. Die Antwort der Arbeitgeber hieß Kündigung, und die IGM mußte nun doch wieder zu Neuverhandlungen antreten. Schon vor Streikbeginn machte sie dann deutlich, daß sie die alte Regelung mit der baldigen Angleichung ans Westniveau selber nicht mehr als „realistisch“ ansah. Stattdessen war nur noch die Rede davon, daß das Ergebnis wenigstens die Perspektive „100 % des Westlohns“ offen halten müsse. (Zu diesem Streit, seinem Warum und Wozu, siehe Teil II!)
Lohnangleichung West an Ost
Die Arbeitgeber begriffen die Einigkeit über Billiglöhne Ost gleich als Erpressungsmittel, die Löhne West ebenfalls zu senken. Die Druckarbeitgeber argumentierten in den Tarifverhandlungen (West):
„Die Löhne im Osten seien fest an die Löhne im Westen gekoppelt. Sie liegen bei 75 %, ab dem 1.7.93 bei 80 % des Westniveaus. Deshalb muß nach Meinung der Druckarbeitgeber die Lohnerhöhung im Westen maßvoll ausfallen, um die schwierige Situation in den neuen Bundesländern nicht noch weiter zu verschärfen.“ (HB 12.3.93)
Das Argument war aber auch viel direkter zu haben: Angesichts der Billiglöhne im Osten sei nicht einzusehen, wieso im Westen die Lohnkosten noch so hoch sein sollen. Zudem haben wir eine Krise und dann noch den Solidarpakt. Kurzum: Das bisherige Lohnniveau „paßt nicht mehr in die heutige Zeit“. Das Verhältnis: Löhne West sind der Normalfall, die im Osten der Sonderfall, müsse umgedreht werden. Das Lohnniveau in der ehemaligen Zone erweise sich einerseits als zumutbar und sei im übrigen aus betriebswirtschaftlichen Gründen als Maximum gerade noch vertretbar. Mit den Reallohnsenkungen der diesjährigen 3 %-Abschlüsse gibt man sich auf Unternehmerseite längst nicht zufrieden.
Die Metallarbeitgeber, insbesondere die Autozulieferer, nahmen die letzte Lohnrunde zum Anlaß, bisher gezahlte übertarifliche Zulagen zu streichen. Wo es ging, war die einfachste Tour, bisherige betriebliche Sonderzahlungen mit der Tariferhöhung zu verrechnen. Darüber hinaus kündigte Bosch z.B. die freiwillige Schichtzulage, Essenszuschläge, Jubiläumsurlaub und Kuren. Die IGM merkte sehr wohl, welcher Standpunkt sich hier breit macht, und hielt einen Appell für angebracht:
„Die gegenwärtig zurückgehende Beschäftigung dürfe nicht dazu benutzt werden, daß die in diesem Jahr sehr zurückhaltenden Tarifabschlüsse nicht an die Belegschaft weitergegeben würden.“ (HB 2.4.93)
Vorwürfe wegen ihrer niedrigen Abschlüsse machte sie sich also keineswegs – obwohl höhere Abschlüsse ja der einzige Weg gewesen wären, die Begehrlichkeit der Arbeitgeber zu bremsen. Stattdessen gab sie ihren Mitgliedern Rechtsauskunft und Ratschläge: Einen Anspruch auf „freiwillige“ Leistungen hätten sie nicht, nichtsdestotrotz sei Widerstand angebracht. Es böte sich z.B. an, in der Personalabteilung „massenhaft ‚produktionshemmende‘ ausführliche Gespräche über die Kürzungen zu führen“, die den Unternehmern bestimmt nicht recht wären. Dazu gehöre freilich viel Zivilcourage, und der Erfolg sei außerdem eher zweifelhaft. (Die Arbeiter haben diese Gewerkschaftsauskunft wahrscheinlich noch nicht einmal als Verarschung aufgefaßt.)
Daß 3 % in diesen Zeiten keineswegs die Untergrenze für Tariferhöhungen sind, machten einige der diesjährigen Verhandlungen auch schon deutlich. Immerhin wurden „Leermonate“ diskutabel, vereinzelt auch akzeptiert, und 18-monatige Laufzeiten, bei denen nach 12 Monaten ein Zuschlag von glatt 0,3 % erfolgt, gab es auch bereits (Stahl). Für die Tarifrunde ’94 stellt DIHT-Chef Stihl in Aussicht:
„Aus grundsätzlichen Erwägungen wäre 1994 eine Reduzierung der Tariflöhne richtig. Das Minimum müsse eine ‚Nullrunde‘ sein.“ (WamS 2.5.93)
Nicht nur die Löhne müssen runter, die Arbeitszeit muß wieder verlängert werden. Daß man das verlangen kann, belegt für die Arbeitgeber wieder mal die ehemalige Zone: Dort wird nach wie vor 40 Stunden gearbeitet, obwohl die Arbeitsorganisation auch in den neuen Bundesländern vielfach auf dem modernsten Stand ist. Also erweist sich die Arbeitszeitverkürzung der letzten Jahre als „Marsch in die völlig falsche Richtung“. Von den Vorteilen der Arbeitszeitverkürzung in Sachen Flexibilisierung kann man bei diesen Beschwerden getrost abstrahieren, die sollen nach Wiedereinführung der 40-Stunden-Woche natürlich erhalten bleiben.
Vorgeprescht waren die öffentlichen Arbeitgeber mit der Forderung der Länderfinanzminister nach der Wiedereinführung der 40-Stunden-Woche. Die Textil/Bekleidung-Arbeitgeber setzten nach mit einem Lohn-Angebot auf Basis der Verschiebung der nächsten ausgemachten Arbeitszeitverkürzung. Und schließlich kam die Beendigung der „unhaltbaren“ Standortnachteile durch Kündigung bisheriger Abmachungen ins Gespräch:
„Die im Tarifvertrag vorgesehene Verkürzung auf 35 Stunden pro Woche im Jahr 1995 passe nicht mehr in die Zeit. ‚Wenn die IGM nicht einlenkt, müßten wir notfalls den Tarifvertrag vorzeitig kündigen‘.“ (Kraus, AGV Südwestmetall, SZ 19.4.)
Kein Wunder, daß die Arbeitgeber Oberwasser haben und lauter neue Rechte anmelden, sich bisheriger Verpflichtungen zu entledigen. Ihr Argument „Paßt nicht mehr in die Zeit!“ wird nämlich keineswegs als die Unverschämtheit aufgefaßt, eigene Ansprüche als „unbestreitbare Fakten“ zu verkaufen, sondern hat Gewicht und erfreut sich allgemeiner Wertschätzung. Erstens weil die Politiker sämtlicher Couleur predigen, der Standort Deutschland erfordere weniger Anspruchsdenken; zweitens weil die Öffentlichkeit unisono auf alles eindrischt, was nach „überholtem“ Kampf um Lohnprozente etc. riecht; drittens weil die Gewerkschaft selbst das Argument „Paßt nicht zur gegenwärtigen Lage“ beherrscht:
„Die Mehrheit der Mitglieder (der Großen Tarifkommission) halte den Abschluß für ‚in der Sache zu niedrig‘. Allerdings seien die meisten auch der Meinung, daß ein Streik in der derzeitigen Lage nicht zu vertreten gewesen wäre.“ (Hensche zum Abschluß der IG Druck, SZ 23.4.93)
Für den Erfolg der Nation und die Konkurrenzerfolge deutschen Kapitals hat die Gewerkschaft selber so viel übrig, daß sie der Stimmung im Lande, die nur noch diesen Gesichtspunkt gelten lassen will, nichts entgegensetzen möchte. Früher, als die Wirtschaft nach allgemeiner Ansicht bombig dastand, da konnte man „soziale Gerechtigkeit“ und „Teilhabe am Wirtschaftserfolg“ fordern, aber in der heutigen Zeit…
Solche verantwortliche Zurückhaltung wird aber seitens der Unternehmer nicht gelohnt. Die beschleicht nämlich – nachdem alles, was sie sich wünschen, so glatt akzeptiert wird – die bange Frage, ob sie bislang nicht vielleicht zu zurückhaltend aufgetreten sind. Also rücken sie mit immer neuen Ansprüchen an, auf die sie in der heutigen Zeit ein Recht hätten. So machen sie einen Dauertest darauf, was mit den Gewerkschaften alles geht.
„Betriebsbedingte“ Billiglöhne als Normallöhne
Dabei haben sie im Bereich der EX-DDR einige Erfahrungen gesammelt, was mit – und notfalls auch ohne – Gewerkschaft alles zu machen ist. Dort hat das Argument „Kosten verhindern Investitionen“ manche Belegschaft dazu gebracht, weit unter Tarif und ohne die Konditionen der Manteltarifverträge, wie sie im Westen gültig sind, zu arbeiten. Und die Gewerkschaften haben nicht nur die allgemeinen Lohn- und Arbeitsverhältnisse im Osten ausgesprochen „kostengünstig“ gehalten. Sie waren auch Sonderregelungen sehr aufgeschlossen: Ende 1991 standen in Ostdeutschland 802 Verbandstarifverträge neben 1252 Firmentarifverträgen. Vornehm wird das vom WSI so interpretiert:
„Damit können die wirtschaftszweig-spezifischen sowie die regionalen Strukturen und Besonderheiten sehr differenziert berücksichtigt werden.“ (SZ 1.12.92)
So sehr der deutschen Arbeitnehmervertretung der Standpunkt eigen ist, nicht nur auf das wirtschaftliche Wohl überhaupt, sondern auch auf das spezielle betriebliche Wohl Rücksicht zu nehmen, wenn Lohn und Arbeitsbedingungen festgelegt werden – im Fall der Betriebe Ost war ihr Eingehen auf spezifische Wünsche des Kapitals weniger das Produkt eigener Initiative als die Reaktion auf vollendete Tatsachen, vor die sie die Unternehmer gestellt hatten. Auch „renommierte Firmen“, die im Westen die gute Zusammenarbeit mit dem Sozialpartner zu schätzen wissen, nutzten die Chance, daß der DGB drüben noch nicht die etablierte Instanz ist, die für alle Fragen des Lohns selbstverständlich zuständig ist, und schlugen Sonderlöhne heraus. Die Ost-Töchter wurden nicht Mitglied im Arbeitgeberverband und waren damit nicht an die mit der Gewerkschaft ausgehandelten Flächentarife gebunden. So kamen sie in den Genuß, die Belegschaften mit dem Argument „Hauptsache: ein Arbeitsplatz!“ zu Billiglöhnen und miesen Arbeitsbedingungen erpressen zu können, konnten also schlicht die (kleinen) Ostunternehmen imitieren, die als „Management-buy-out“ oder Privatunternehmen auf Basis niedrigster Löhne ihr Geschäft laufen lassen und eine Marktlücke zu erobern suchen.
Die Gewerkschaften hatten dabei nur die Sorge, durch dieses Vorgehen im Osten aus den Betrieben herausgehalten zu werden und damit ihren Status, für sämtliche Lohnfragen zuständige Mitentscheidungs-Instanz zu sein, dort zu verpassen. Also versuchten sie, bereits vereinbarte Abschlüsse in gewerkschaftlich abgesegnete zu überführen. Auf den formellen Unterschied kam es ihnen so sehr an, daß sie in der Sache zu jedem Kompromiß bereit waren.
Die Kapitalisten entdeckten darin ein wunderschönes Erpressungsmittel, das auch im Westen inzwischen Verwendung findet: Man tritt aus dem Arbeitgeberverband aus, hat damit sämtliche Freiheiten, der Belegschaft mieseste Lohnverhältnisse aufzuzwingen, und bietet anschließend der Gewerkschaft an, auf dieser Basis wieder ins Geschäft zu kommen. Der Vorteile, die der Arbeitgeberverband einem bietet („Solidarfonds“, Aussperrungsmöglichkeiten etc.), geht man so auf Dauer noch nicht einmal verlustig.
Durch die Presse ging z.B. neulich der Fall IBM, deren Manager sich als Konzept, aus den roten Zahlen herauszukommen, zunächst einmal eine Umorganisation der Unternehmensstruktur einfallen ließen. Das bisherige Unternehmen wurde in eine Holding mit wenigen Mitarbeitern umgewandelt, sämtliche Produktionsbereiche als Tochtergesellschaften neu gegründet, die nicht mehr Mitglieder im Arbeitgeberverband sind. In dieser Form tritt die Firma in Neuverhandlungen über Haustarife mit der Gewerkschaft ein und ist sich sicher, längere Arbeitszeiten und neue, für sie günstigere Entlohnungsformen zu erreichen.
So wurden die guten Erfahrungen in der Zone bei den Managern in ganz Deutschland zum Maßstab, an dem sich ihr Einfallsreichtum mißt.
Arbeitsplatz als Lohnbestandteil
In einer Hinsicht sind die Ost-Arbeiter auf alle Fälle vorbildlich: Bei ihnen ist der Arbeitsplatz schon fast Lohn genug:
„In der ostdeutschen Druck-, der Nahrungsmittel- und der Holzindustrie werden – nach Schätzungen – nur noch die Hälfte der Beschäftigten nach Tarif bezahlt, wobei die unterste Grenze das Arbeitslosengeld bildet.“ (FR 13.2.93)
Und mit der Aussicht auf Arbeitsplatz-Surrogate läßt sich ihnen ein Niedrigtarifabschluß als Riesenerfolg verkaufen: Die IG Chemie (Ost) vereinbarte ’93 nicht nur einen Lohnabschluß (1 Leermonat, dann 9 %), sondern gleichzeitig mit den Arbeitgebern und der Treuhand, daß die Arbeitnehmer, die in nächster Zeit im Bereich Chemie zur Entlassung anstehen, 5 Jahre lang in Beschäftigungsmaßnahmen (nach dem neuen § 249 h AFG) für Sanierungsarbeiten weiterbeschäftigt werden.
Die Arbeiter kommen somit in den Genuß von wenig Lohn, ein Großteil von ihnen wird einvernehmlich entlassen, erhält auf einer ABM-Stelle – entsprechend der neuen Regelung – 80 % vom Tariflohn, hat dafür aber eine solche Stelle schon jetzt in Aussicht. Wer will sich da noch beschweren? Für die Unternehmen sieht die Rechnung auch nicht übel aus: Die Löhne sind allgemein schön niedrig, die Entlassungen schon jetzt abgesegnet, Sozialplankosten entstehen keine. Bei solch eleganten Abschlüssen steht der Staat in Form von Treuhand und Arbeitsamt gerne helfend zur Seite.
Der Standpunkt: Beschäftigung ist die Hauptsache, das Einkommen zu vernachlässigen, veranlaßte die Gewerkschaft NGG zu folgendem grandiosen Vorschlag an die Adresse der Treuhand:
„Beschäftigte Ost werden in Nahrungsmittelverarbeitungsbetrieben, die sich nicht lohnen, weiterbeschäftigt und das Arbeitsamt zahlt ihnen Arbeitslosengeld. Die Betriebe könnten z.B. Nahrungsmittel für Rußland verarbeiten, die sonst unverarbeitet hinübergeschickt werden. Für den Staat bedeute das kaum Zusatzkosten, die Arbeitnehmer behielten aber ihren Arbeitsplatz.“ (HB März 93)
Dieser Standpunkt macht sich aber durchaus auch im Westen breit: Mit dem Abschluß des Tarifvertrags im Bergbau wurde „tarifpolitisches Neuland“ betreten. Die IGBE vereinbarte mit den Arbeitgebern 0 % Lohnerhöhung, bei einer Laufzeit von 18 Monaten, dafür sechs zusätzliche Freischichten und Einschränkung der Mehr- sowie Sonn- und Feiertagsarbeit. Grund für den Handel „Lohn gegen Freizeit“ war nicht das gesundheitliche Wohl der Arbeiter, sondern ein Problem der Ruhrkohle AG. Diese hat nämlich beschlossen, bis 1995 20 000 Arbeitsplätze abzubauen, und will das mit möglichst wenig Abfindungszahlungen über die Bühne bringen, die bei förmlichen Entlassungen fällig würden. Die getroffene Vereinbarung hilft dabei, den „Personalabbau zu strecken“ und damit Kosten zu sparen. Hinzu kommt die Lohneinsparung, die durch die Streichung von Samstagszuschlägen – der Samstag ist für bestimmte Bereiche zum Normalarbeitstag erklärt – ergänzt wurde. Nach Ablauf der 18 Monate soll dann mit den Zusatz-Freischichten wieder Schluß sein und das Lohnniveau automatisch um 3 % angehoben werden. Die Arbeitgeber lobten verständlicherweise den Abschluß als Geschenk der Gewerkschaft –
„Die IGBE zeige hier ein gutes Stück Verantwortungsbewußtsein einem Unternehmen gegenüber, das bis 1995 rund 20 000 Arbeitsplätze abbauen müsse. Mit dem Tarifvertrag an der Ruhr werde ein neuer Weg beschritten, der in gemeinsamer sozialpolitischer Verantwortung zum Ziel habe, betriebsbedingte Kündigungen“ – wohlgemerkt: nicht Entlassungen – „zu vermeiden.“ (RAG-Vorstandsvorsitzender Horn, lt. HB 29.3.93) –,
während die IGBE darin mehr einen Dienst an den Arbeitern sah:
Windisch (IGBE): „Wir haben uns auf das Wichtigste konzentriert und für eine bestimmte Zeit Geld in Arbeit umgewandelt. Damit können Entlassungen“ – genauer: Kündigungen, s.o. – „verhindert werden.“ BR Schlegmann: „Wenn man mit Kollegen redet, setzt sich die Einsicht durch, daß ein paar Prozentpunkte Lohn wertlos sind, wenn man arbeitslos ist.“ (WAZ 27.3.93)
Die Unsicherheit, vielleicht ein bißchen länger den Arbeitsplatz zu behalten, die Möglichkeit, sich ein wenig länger um einen alternativen Arbeitsplatz kümmern zu können, bzw. die Aussicht, bis zur Frühverrentung noch arbeiten zu dürfen, entschädigt nach Ansicht der IGBE offensichtlich hinreichend für Lohneinbußen – zumal die ins Auge gefaßten mickrigen 3 % ja ohnehin nicht groß das Portemonnaie gefüllt hätten. So ist schließlich die Bereitschaft der Gewerkschaft, auf nennenswerte Lohnerhöhungen zu verzichten, das schlagendste Argument dafür, daß man sich dann auch gleich mit dem vorläufigen Erhalt des Arbeitsplatzes als hinreichendem Lohn abfinden kann.
In diesem Sinne hat bei BASF vor ein paar Wochen die Ankündigung der Stillegung des Magnetbandbereichs den Betriebsrat des Mannheimer Werks dazu veranlaßt, für die Belegschaft einen „Solidarvertrag“ mit dem Unternehmen abzuschließen, wonach die Arbeiter auf diverse Bestandteile ihres bisherigen Lohns verzichten und die außertariflichen Angestellten eine Nullrunde verpaßt bekommen. Als Gegenleistung für die damit ermöglichte „Reduktion der Personalkosten in den nächsten beiden Jahren um 20 Mio DM“ (HB 16.12.92) verspricht das Unternehmen, in den kommenden 3 Jahren die Produktion in diesem Werk (andere werden dichtgemacht) aufrechtzuerhalten – unter der Voraussetzung, daß 1994 bereits „ein annähernd ausgeglichenes Ergebnis“ vorliegt.
Der Sozialpartner DGB hat also die „Zeichen der Zeit“ erkannt; die Unternehmer müssen als Arbeitgeber hofiert werden; statt Lohnforderungen steht heute die Bettelei um Arbeitsplätze an. Arbeitsplatz-Schaffen/-Erhalten wird als die soziale Tat der Unternehmer angesehen und erfordert – nicht mehr bloß im Osten – die tatkräftige Unterstützung der Arbeitnehmerseite durch Verzicht, Bescheidenheit und Dienstbereitschaft. Wenn auch dieses Angebot nicht ausreicht, Kapitalisten das Geschäft schmackhaft zu machen, dann kann man ja gemeinsam mit den Unternehmern beim Staat um ABM nachsuchen.
Die Politiker nehmen solche Anträge sehr ernst und denken intensiv über „neue Lösungen“ nach. Engholm machte kurz vor seinem Abgang noch einen Vorschlag, der in die Schlagzeilen kam. Dabei kombinierte der Ober-Sozi sämtliche Frechheiten, die derzeit in Sachen Lohn, Sozialleistungen und Dienstbarkeit im Schwange sind, und nannte das „die vermutlich letzte Möglichkeit, den Marsch in die immer inhumanere Zwei-Drittel-Gesellschaft zu stoppen“(FR 28.4.93). Die Debatte um die Einführung untertariflicher betrieblicher Sonderregelungen verarbeitete er zu seinem Vorschlag eines „gespaltenen Arbeitsmarkts“:
„Deutschland müsse sich auf Dauer auf einen gespaltenen Arbeitsmarkt einstellen: ‚einen hochproduktiven Sektor, in dem entsprechend hohe Löhne und Gehälter gezahlt werden können, und einen Sektor, wo die Rationalisierungen nicht greifen und deshalb die Löhne und Gehälter niedriger sind.‘ Das Ziel jedoch, daß jeder die Möglichkeit haben müsse zu arbeiten, dürfe nicht aufgegeben werden.“ (ebd.)
Ihm scheint der ganze Streit zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften offensichtlich zu kleinkariert; seiner Ansicht nach wäre das Kapitalinteresse in einer generellen Regelung, der festen Institutionalisierung eines „Niedriglohnsektors“, am besten aufgehoben. Für deren Legitimation bemüht er den Kalauer von der „niedrigeren Produktivität“. An der ändern auch durchgeführte Rationalisierungen nichts, weil sie ja „nicht greifen“. Wo Niedriglöhne erwünscht sind, muß doch „zu niedrige Produktivität“ einfach vorliegen.
Im übrigen geht es hier um die Treue zu einem Ziel. Das oberste sozialdemokratische Menschenrecht lautet schließlich: „Jeder muß arbeiten dürfen!“ – wer mag da noch knickrig das Geld nachzählen!
Engholm möchte überhaupt die Einstellung befördern, daß ein Einkommen verdient sein muß und Arbeit in erster Linie ein Dienst an der Gemeinschaft ist:
„Statt der Kosten für steigende Arbeitslosigkeit sollten Tätigkeiten zur Verbesserung der Infrastruktur, zur Umweltsanierung und in sozialen Diensten finanziert werden. Dies zahle sich aus, ‚wenn wir bedenken, daß durch diese Arbeit auch Werte geschaffen … und hohe soziale Kosten vermieden werden können‘.“ (ebd.)
Was sich für die Nation auszahlen soll, sollen die Arbeiter, die noch geschröpft werden können, finanzieren:
„Da wir verhindern müssen, daß die Kluft zwischen Arm und Reich in unserer Gesellschaft weiter wächst, werden wir womöglich nicht umhinkommen, das System der sozialen Transferzahlungen so zu verändern, daß aus Steuern und Beiträgen des hochproduktiven Sektors Einkommenssubventionen für den Niedriglohnsektor geleistet werden.“ (ebd.)
So sieht die sozialdemokratische Alternative zur viel geschmähten „Umverteilung von unten nach oben“ der C’ler aus: Der Lohn der „Besserverdienenden“ wird per staatlicher Schröpfung „sozial verträglicher“ gemacht – nach der Devise: Angleichung des Lohns von oben nach unten. Auf ihre sozialdemokratische Soziale-Gerechtigkeits-Tour kommen die SPDler also zum selben Ergebnis wie die Christen und Liberalen: Lohnsenkung muß sein.
So wird zur Zeit das „historisch-moralische Element“ des Lohns in der Nation gründlich verändert. Der bisherige „Wohlstand“ ist zu Ende, der Lohn hat den Bedürfnissen des Kapitals radikal zu entsprechen. Zu diesem Beschluß wird am Ende auch noch ein endgültig unanfechtbarer „Sachzwang“ verkündet:
„Für die Kosten eines deutschen Arbeitnehmers kann man nach Darstellung des Bundesverbandes Groß- und Außenhandel (BGA) 70 Russen, 38 Bulgaren, 18 Polen, 17 Tschechen oder 10 Ungarn beschäftigen.“ „Viele deutsche Firmen mußten in den letzten Monaten erkennen, daß Hongkong quasi vor der Tür liegt. Leistungsfähige Unternehmen aller Branchen übernehmen Aufträge in der Slowakei, Ungarn und Polen, weil die Arbeitskosten um ein Erhebliches niedriger liegen.“ (SZ 8.4.93)
Von solchen Zahlen ist zumindest eine Partei im Lande schwer beeindruckt: die Gewerkschaft. Geradezu kläglich ihr Versuch, mit der umgekehrten Lesart des Sachzusammenhangs von Arbeitslosigkeit und Niedriglohn dagegenzuhalten:
„Billiglohnländer haben die höchste Arbeitslosenrate.“
Sehr viel kraftvoller dagegen die nationalistische Moral, mit der sie darauf besteht, Billigmenschen aus Osteuropa vom guten deutschen Arbeitsmarkt fernzuhalten. Deutsche Politiker sollen gefälligst mit deutschen Gesetzen dafür sorgen, daß deutsche Unternehmen sich dem Standpunkt „Germany first“ verpflichtet fühlen und vorrangig deutschen Arbeitern Arbeitsplätze verschaffen.[2]
Daß sie dabei das ausländerfeindliche Vorurteil „die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg“ ausschlachtet und den Staat explizit ermuntert, seine ausländerfeindliche Gesetzespraxis zu verschärfen, stört sie nicht. Die „Zeit“ erfordert auch das!
II. Der Streit um die Neubestimmung des Tarifwesens
Die Anpassung des Lohns an die Anforderungen des Standorts Deutschland ist 1993 in einträglicher Kooperation von DGB und Arbeitgeberverbänden gelungen, und dennoch gibt’s einen schlagzeilenträchtigen Streit zwischen Gewerkschaft und Arbeitgebern. Steinkühler läßt sich dazu hinreißen, den Unternehmern „nackte Gewinnmaximierung“ und „die Zertrümmerung der Tarifautonomie, eines Pfeilers unseres Sozialstaates“ vorzuwerfen, malt eine „Krise der Demokratie“ an die Wand und droht mit der ganzen Urgewalt seiner Gewerkschaft: „Dagegen waren die Posaunen von Jericho ein leises Winseln“. Was ist da los.
Der Kampf der Gewerkschaft um ein prinzipielles Recht auf Lohn
Hält man sich an die Ost-Arbeiter, die derzeit im Fernsehen Gelegenheit bekommen, den Mund aufzumachen, dann macht sich die Gewerkschaft erstens dafür stark, daß die Ostler endlich mal ein Einkommen erhalten, von dem sie halbwegs ihren Lebensunterhalt finanzieren können. Zweitens tritt sie damit auch für das Recht der Ex-Zonis ein, mit den Westkollegen auf Dauer gleichgestellt zu werden und nicht „Deutsche zweiter Klasse“ bleiben zu müssen.
Was den ersten Punkt betrifft, liegen die vor die Kameras gezerrten Leutchen auf jeden Fall bei der IGM und den anderen DGB-Vereinen ziemlich daneben. Der Hinweis auf die Armut der Anschlußdeutschen taugt der Gewerkschaft zwar zum Ausweis der Berechtigung einer Demonstration und sogar eines Streiks, zu mehr aber auch nicht. Abhilfe zu schaffen, ist nicht ihr Anliegen, das haben sämtliche Tarifabschlüsse dieses Jahres (inklusive der betrieblichen Abweichungsregelungen) hinreichend erwiesen.
Das Argument vom Recht der Ossis auf Gleichbehandlung macht sich gleichfalls gut, besonders wenn es mit vorwurfsvollen Hinweisen auf frühere Gleichstellungsversprechen der Bonner Obrigkeit vorgetragen wird. Die Gewerkschaft hat aber auch diese Sache von Anfang an als sehr relative Angelegenheit behandelt. Schon die bisherige Argumentation, Gleichstellung müsse her, damit im Osten „die qualifizierten Arbeitskräfte nicht abwandern“, zeigte, wie bedingt ihre Parteinahme war. Inzwischen wissen die DGB-Verbände selber, daß dieses Argument fad wird, nachdem die Arbeitslosenzahlen im Westen steigen. Auch die „ordnungspolitischen Erwägungen“, daß zwei Lohnzonen der Wirtschaft nicht gut tun, und die Furcht um „den sozialen Frieden“ erweisen sich zunehmend als langweilige Kalauer der Gewerkschaft, weil die Praxis längst den Beweis erbracht hat, daß die eingerichteten zwei Lohnzonen prima nebeneinander funktionieren und sich die Ostler brav in „ihr Schicksal“ ergeben. Daß an tatsächliche Angleichung ohnehin eigentlich nie gedacht war, haben im übrigen sämtliche neuerdings präsentierten Rechnungen der Gewerkschaften deutlich gemacht, die klarlegen, wieviel Prozent Westlohn 80 % bzw. 100 % im Osten wirklich sind – real nämlich 50-60 %. Diese Differenz war doch wohl schon 1991 bekannt, also der Osten als Lohnsonderzone damals bereits abgehakt.
Der Kampf der Unternehmer um ein prinzipielles Recht auf beliebig wenig Lohn
Die andere Seite setzt schlicht ihr Interesse dagegen, fadenscheinig eingekleidet in die Ausdrucksweise des betriebswirtschaftlichen Sachzwangs. Die Treuhand mag ihre Subventionen nicht erhöhen und entdeckt daher die
„Undurchführbarkeit der Tarifverträge… Föhr (Personalvorstand der Treuhand) sagte: 90 bis 95 % ihrer Unternehmen könnten Lohnsteigerungen von 26 % nicht verkraften.“ (FAZ 26.2.93)
Die anderen möchten auf den besonderen Konkurrenzvorteil niedrigerer Löhne einfach nicht verzichten und kündigen für den Fall, daß es bei der vereinbarten Angleichungsrate bleibt, ihren sofortigen Bankrott an. Weil es um ein klares Interesse geht, das in unserer Gesellschaft sowieso anerkannt ist, werden solche Drohungen auch überhaupt nicht blamiert, wenn der baden-württembergische Gesamtmetallvorsitzende Hundt richtigstellt:
„Löhne seien das geringste Problem. Die Märkte im Westen sind weitgehend verteilt, der Osten braucht neue Märkte, und auch die besten Unternehmen erwerben Marktanteile nicht über Nacht. Solche Probleme aber löst kein Tarifvertrag.“ (SZ 16.4.93)
Unverkennbar ist allerdings, daß das Unternehmerinteresse an Niedriglöhnen im Tarifstreit mit der IG Metall diesmal ganz besonders prinzipiell daherkommt. So fällt z.B. auf, daß Arbeitgeber, die sich gegen die 26 % des IG Metall-Tarifvertrags verwahren, Zahlungen in der Höhe der Chemielöhne (Ost) für „durchaus denkbar“ halten. Dabei ergibt der Blick in die Lohntabellen, daß dadurch die Kostenbelastung der Betriebe annähernd die gleiche wäre wie bei den „ruinösen“ 26 %! Die Chemielöhne in der EX-DDR lagen nämlich von Anfang wesentlich höher als die im Bereich Metall. Offensichtlich wollen die Metall-Arbeitgeber nicht bloß auf tarifvertraglich vereinbarte Billiglöhne hinaus, sondern zugleich auf ein neues Prinzip der tarifvertraglichen Vereinbarung von Billiglöhnen.
Mit der Kündigung des Stufentarifvertrags haben sie sich das Recht herausgenommen, sich aus existierenden Tarifverträgen lösen zu können, wenn sie nicht mehr in ihre betriebswirtschaftlichen Kalkulationen passen. Sie vertreten die Position, Tarifverträge sollten überhaupt nicht mehr Mindestlöhne festsetzen, sondern bloß noch prinzipiell nach unten korrigierbare Richtdaten festlegen. Ihr Ideal ist praktisch der einseitig – nämlich die Arbeitnehmerseite – bindende Tarifvertrag.
Dies ist ein Angriff auf das bisher praktizierte Tarifwesen und die bewährte Sozialpartnerschaft mit der Gewerkschaft, und zwar mit voller Absicht. Die Arbeitgeber wollen sich der Last entledigen, sämtliche Lohnfragen ewig mit der Gewerkschaft aushandeln und sie als Mitverwalter des betrieblichen Wohls respektieren zu müssen. Im Tarifwesen wollen sie künftig alle Freiheiten haben; damit sollen sich die Gewerkschaften endlich einmal abfinden.
Sie meinen, jetzt sei die Gelegenheit da, diese Neuerung durchzufechten. Und darauf kommen sie auch nicht ganz von ungefähr. Seit dem Abschluß der Stufentarife 1991 nörgeln vor allem die Regierenden in Bonn über die Unvernunft solcher Lohnsteigerungen. Die Politiker haben mit ihrem ständigen Gerede von den tariflichen Regelungen in Sachen Lohn und Arbeitszeit als unzumutbaren Beschränkungen für den Standort Deutschland für ein Klima gesorgt, das die Arbeitgeber auf den Geschmack kommen ließ, sich neue Rechtspositionen zu ergattern. Seit die Auseinandersetzungen in der Öffentlichkeit losgegangen sind, reißt die Schützenhilfe aus Bonn nicht ab. So hieß es an verantwortlicher Stelle: Wenn die Tarifpartner sich nicht über die Revision bestehender Verträge einig würden, müsse man gegebenenfalls künftig per Gesetz Öffnungsklauseln in den Tarifverträgen vorsehen.
Über die Treuhand und die Bundesanstalt für Arbeit vertritt die staatliche Administration eine demonstrativ harte Linie. Die Treuhand wies ihre Unternehmen an, 9 % Lohnsteigerungen im Jahr 93 zu veranschlagen, und pfiff sämtliche Betriebsleiter zurück, die angesichts einer guten Auftragslage mit ihren Belegschaften – zur Dämpfung des Streits – betriebliche Zulagen zu den offiziell angebotenen 9 % ausmachen wollten. Die Arbeitslosenbehörde entschied, daß bei der Berechnung ihrer Leistungen – egal wie der Streit ausginge – einfach 9 % Lohnsteigerung zugrundegelegt werden sollte. Die streitenden Parteien und die Schlichter, die eine Lösung durch staatliche Lohnsubventionen ins Gespräch bringen wollten, haben aus Bonn nur eine Antwort gehört: Kein Interesse.
Ausnahmen bilden scheinbar ein paar CDU-Politiker. Biedenkopf tritt wieder mal für die Gleichstellung der Zonis als vollwertige Deutsche an und praktiziert dabei eine gelungene Arbeitsteilung mit seinem Wirtschaftsminister Schommer. Der erklärt nämlich parallel zu Biedenkopfs Verlautbarungen gegenüber der Sächsischen Zeitung:
„Der nahezu einzige Standortvorteil-Ost seien die niedrigen Löhne… Lohnerhöhungen entsprechend der Produktivität, jede Firma solle das bezahlen, was sie ertragen kann… Schließlich stamme die Hälfte der sächsischen Einkommen aus West-Transfergeldern. Und jede Lohnerhöhung beispielsweise in staatlichen Treuhandfirmen müsse vom Steuerzahler, vornehmlich vom westdeutschen bezahlt werden… Schommer warnte vor dem Erreichen der Schmerzgrenze.“ (10.3.93)
Blüm präsentiert sich als Gewerkschaftsfreund und traut sich sogar, gegenüber Unternehmer-Boß Necker frech zu werden. Er wirft ihm vor, mit seinem Plädoyer für Betriebstarifverträge „zündele er seit Monaten an der Tarifautonomie“. Das Lob, das sich allerdings anschließt –
„die branchenbezogenen Tarifverträge hätten sich bewährt, nicht zuletzt deshalb verzeichne Deutschland in der EG die wenigsten Arbeitskämpfe“ (SZ 14.4.93) –,
gilt unübersehbar einer Gewerkschaft, die Arbeitskämpfe meidet, von sich aus ohnehin Verständnis fürs volkswirtschaftlich Vernünftige hat und jede politische Lohnleitlinie ganz autonom berücksichtigt. So geht das Kompliment bruchlos über in eine scharfe Warnung an die Gewerkschaft; und in der sind sich die christlichen Zoni- und Gewerkschaftsfreunde mit denen von der SPD (Thierse & Co) und sämtlichen liberalen Zeitungskommentatoren allemal einig: Ein Streik zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist eine Katastrophe und unverantwortlich. „Auch“ die Gewerkschaft müsse einlenken.
Die Antwort der Gewerkschaft (1): „pacta sunt servanda“
Die Gewerkschaft hat die Kündigung des Stufenvertrags durch die Arbeitgeber mit dem lateinischen Sinnspruch gekontert. Damit liegt sie nun allerdings ein wenig daneben. So etwas Absolutes sind Verträge in der demokratischen Rechtsordnung nämlich gar nicht. Von der anderen Streitpartei muß sie sich aufklären lassen, daß das BGB die Außerkraftsetzung von Verträgen nach der Regel vom „Wegfall der Geschäftsgrundlage“ und den § 306 „Nichtigkeit auf unmögliche Leistungen gerichteter Verträge“ kennt. Ob die Voraussetzungen des einen oder anderen Paragraphen im vorliegenden Fall nach bisher üblicher Rechtsprechung gegeben sind, ist für Juristen sicherlich ein furchtbar spannendes Problem. Die Lösung der Frage ist andererseits sehr einfach. Erstens steht nämlich der Grundsatz fest: Nicht jeder Vertrag muß eingehalten werden. Vielmehr besteht der Staat auf Einhaltung nur der Verträge, die er für zumutbar und seinem System zuträglich hält. Zweitens wird also die Frage, ob der Staat in diesem Falle die Arbeitgeber weiterhin gebunden sehen will oder nicht, nach politischen Opportunitätserwägungen entschieden – sollte sie je zur richterlichen Entscheidung kommen. Und da kann sich die IGM gar nicht so sicher sein, daß sie Recht bekommt.
Weil die Formel „pacta sunt servanda“ keineswegs allgemeingültiges Recht ist, ist Steinkühlers Agitation zu der Frage geradezu lächerlich:
„Wenn das, was die Arbeitgeber im Augenblick trieben, rechtens sei, dann dürften die Bürger ab morgen die Mietzahlungen halbieren, die Steuern kürzen und beim Einkaufen die Zahlung verweigern.“ (Steinkühler, HB 6.4.93)
Der Rechtsstaat sieht darin gar nichts Vergleichbares: Wenn Mieter die Miete nicht zahlen können, fliegen sie natürlich aus der Wohnung, hier gilt nämlich der juristische Merksatz: „Geld hat man zu haben.“ Wenn die Arbeitgeber hingegen sagen, sie könnten die ausgemachten Löhne nicht mehr zahlen, weil sonst der Profit nicht mehr stimme, dann kann der Vertrag durchaus auf eine „unmögliche Leistung“ gerichtet, also nichtig sein. Es kommt auf das politische Interesse an, das dem Recht zugrundeliegt, und das zielt auf die kapitalistische Funktionsfähigkeit des Eigentums. Unter dem Gesichtspunkt unterscheiden sich die angeführten Fälle fundamental.
Die Reaktion der IG Metall wirft darüberhinaus ein bezeichnendes Licht auf das Selbstverständnis dieses Vereins und seine Interessen. Die IGM tut nämlich so, als wären Lohnvereinbarungen ein stinknormaler Vertrag und sie und die Arbeitgeber Rechtssubjekte wie Hinz und Kunz. Sie abstrahiert glatt davon, daß die Grundlage und die Einhaltung von Tarifverträgen Resultat dessen ist, was Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich dank der Machtmittel, die sie haben und bereit sind einzusetzen, gegenseitig abtrotzen. Das gilt selbst noch für die wirtschaftspolitisch ausgewogenen, äußerst verantwortlichen DGB-Abschlüsse – die dabei angefallenen Streiks und Aussperrungen belegen es. Und da stellt sich die Gewerkschaft angesichts der Kündigung bisheriger Abmachungen nicht einmal selber auf die Hinterfüße, sondern rennt vor den Kadi, er möge ihr bestätigen, daß die andere Seite sich an die Abmachungen halten muß. Ganz ohne Not gibt sie eine Ohnmachtserklärung ab und macht sich von der Entscheidung der Gerichte abhängig, ob ihr Interesse gelten soll oder nicht. Offensichtlich will sie auf keinen Fall in den Verdacht des Klassenkämpfers geraten, sie besteht auf der Rolle des ungerecht behandelten verantwortungsvollen Sozialpartners.
Nur, ganz darauf verlassen, daß die Gerichte es schon richten werden, will sich die IGM dann doch nicht. Über mühsame juristische Argumentationsketten ihres Syndikus hat sie herausgefunden, daß sie schon jetzt ein Recht habe, Arbeitskampfmittel anzuwenden. Ihrer Rechtsposition als auf Vertragstreue drängende Partei würde dadurch möglicherweise noch nicht einmal geschadet. Seitdem verfolgt sie die Doppelstrategie: Klage und Streik.
Die Antwort der Gewerkschaft (2): Drohung mit Betriebstarifen
Zum Kontrahenten Gesamtmetall brach die IGM zunächst einmal die diplomatischen Beziehungen ab. Steinkühler ließ verlauten, es lohne nicht, sich mit Vertragsbrüchigen über Verträge zu unterhalten. Als neue Strategie der Gewerkschaft verkündete er:
„Wenn es eine Bedingung für einen Verbandstarif sei, daß über Öffnungsklauseln der Abschluß letztlich doch in das Belieben der Betriebe gestellt werden solle, dann könne die IGM auch sofort mit den Betrieben verhandeln. Dann brauche man nicht den Umweg über einen Tarif mit einem Verband, der den Vertrag doch als unverbindlich ansehe und die Probleme künftig auf betrieblicher Ebene lösen wolle.“ (HB 13.4.93)
Anscheinend hoffte er auf eine erhebliche moralische Wirkung seiner Ankündigung von Betriebstarifverträgen:
„Die Drohung solle ein ‚Signal‘ an die Vorstände in den großen westdeutschen Unternehmen sein. Diese müßten die Funktionäre ihres eigenen Verbandes zur ‚Räson‘ bringen und sie an die Vorteile von Flächentarifverträgen erinnern. Denn das Abrücken von Flächentarifen bringe für die IGM … kurzfristig in einem Arbeitskampf Vorteile, weil sich einzelne Unternehmen nur schlecht gegen die Gewerkschaft zur Wehr setzen könnten.“ (FAZ 14.4.93)
Zunächst erscheint die Drohung der Gewerkschaft einigermaßen verblüffend. Waren es nicht gerade die Arbeitgeber, die auf betriebliche Regelungen der Lohnfrage aus waren? Eine Drohung würde es freilich dann, wenn die IGM die Absicht hätte, „Betrieb für Betrieb“(Steinkühler) ihre Forderungen durchzusetzen, wenn sie zudem bei den Betrieben mit guter Auftragslage anfinge. Gewerkschaftsmacht, gegen solche Betriebe eingesetzt, könnte tatsächlich einiges bewegen.
Das wissen auch die Arbeitgeber, deren Sprecher ankündigen, in diesem Fall gleich den Staat zu Hilfe zu rufen und eine Klage vor dem Verfassungsgericht wegen Verletzung des Art 9, III GG (Koalitionsfreiheit) einzureichen. Sie gehen nämlich davon aus, daß der Staat einen Streik, der sie – indem er einzelne Unternehmen erpreßt – schädigt, schon als Verletzung ihres Rechts auf wirksame kollektive Vertretung ihrer wirtschaftlichen Interessen ansieht und verbietet.
Das von der IGM angekündigte erpresserische Vorgehen paßt allerdings überhaupt nicht zu einer DGB-Gewerkschaft und ihren Interessen. Schließlich ringt sie um den Status des verläßlichen Sozialpartners, der berechtigt ist, die „Lohnfindung“ mitzuveranstalten und mitzuverantworten; deswegen kann sie schlechterdings nicht rücksichtslos gegen die Profitinteressen der Unternehmen auftreten. Es war daher noch nie ihre Strategie, die Unternehmer durch ökonomische Schädigung zu Zugeständnissen zu bewegen. Noch bei jedem Streik wird vor- und nachgearbeitet, damit keine Verluste entstehen. Zur deutschen Gewerkschaftsart paßt es schon eher, Treuhandbetriebe zu bestreiken, die ohnehin nur Verluste machen, so daß die Streikkasse den Unternehmen ein paar Lohnkosten abnimmt. Um Streikbereitschaft zu demonstrieren, langt das ja auch, und mehr als das will die Gewerkschaft noch im heißesten Streik nicht beweisen.
Tatsächlich ist jede ihrer Drohungen mit Bekundungen weitestgehender Kompromißbereitschaft verbunden:
„Tarifverträge dürfen nicht zum Instrument der Beliebigkeit radikalisierter und wildgewordener Arbeitgeber werden… Steinkühler deutete jedoch auch die Verhandlungsbereitschaft der Gewerkschaft an. Er wolle nicht ausschließen, ‚daß es auch ohne Streik noch möglich ist, der Stimme der Vernunft Gehör zu verschaffen‘.“ (FAZ 26.4.93)
Der IGM ist es wichtig, unentwegt zu versichern, sie wolle eigentlich weder diesen an sich völlig „unverantwortlichen“ Arbeitskampf noch „Betriebstarifverträge“. Diese halte sie im Grunde sogar für einen Fehler, weil „Flächentarife“ „ordnungspolitisch“ viel vernünftiger und dem „sozialen Frieden“ viel zuträglicher seien. Sie ermöglichten nämlich eine gesündere Konkurrenzsituation der Unternehmen untereinander und hielten die Tariffrage aus dem betrieblichen Alltag heraus.
Man sieht daran, daß die Gewerkschaft in einem Dilemma steckt. Sie mag gar nicht kämpfen, ist aber mit Angriffen der Arbeitgeber auf ihre Position konfrontiert, die sie auch nicht durchgehen lassen möchte. Inzwischen hat sie sich ganz auf den Punkt zurückgezogen, der ihr das Wichtigste ist: die pure Rechtsfrage, die Rücknahme der „unzulässigen“ Kündigung der Tarifverträge. Und selbst das meint sie – je länger die Auseinandersetzung geht – nicht mehr unbedingt wörtlich.
„Steinkühler deutete an, daß eine schriftliche Stellungnahme der Arbeitgeber, die Kündigung sei eine einmalige Sache gewesen, diese Frage klären könnte.“ (FAZ 4.5.93)
Jeder Zeitungskommentator bemerkte gleich die Wertlosigkeit eines solchen Schriebs, weil er keinerlei rechtliche Bindewirkung hätte. Das hält die IG Metall nicht davon ab, darum zu betteln. Sie will wenigstens ein Signal der anderen Seite, daß ihre Stellung als gleichberechtigte Vertragspartei, mit der man verhandeln muß und will, noch respektiert wird. Wenn ihr das zugestanden wird, ist sie bereit, auch über neue Löhne und alle möglichen betriebsspezifischen Abweichungen mit sich reden zu lassen. Dann ist sie wieder dafür zuständig, und die Arbeitgeber haben ihr Ziel – Tarifverträge mit Blankoschecks für betriebliche Abweichungen, die die Geschäftsführung bloß mit dem Betriebsrat aushandeln muß – nicht durchgesetzt.
Die Antwort der Gewerkschaft (3): Aktionstage „Gegenwehr“
Daß die IGM diesen Prizipienstreit mit den Arbeitgebern durchfechten muß, ist ihr höchst unsympathisch, und eigentlich sieht sie es gar nicht ein. Schließlich geht es ihr um nichts anderes als die Beibehaltung des bewährten bundesdeutschen Systems, die Lohnfrage zu regeln. Und daran müßten die Politiker doch als erste ein Interesse haben.
„Schon vor einem halben Jahr hätte der Bundeskanzler die Initiative ergreifen müssen. Doch im Gegenteil, er hat ja die Arbeitgeber zum Vertragsbruch geradezu ermuntert. Für ein Machtwort des Kanzlers in Richtung Arbeitgeber ist es höchste Zeit. Die wollen nämlich die Tarifautonomie und damit den Sozialstaat aushebeln.“ (Steinkühler, BamS 18.4.93)
Müßte man sich da nicht einmal entscheiden, ob man im Kanzler den Parteigänger der anderen Seite oder das geeignete Instrument für die Durchsetzung der eigenen Interessen sehen will? Steinkühler schafft es, beides gleichzeitig zu denken. Und er hat dabei auch kein Problem, daß der Appell an die Einmischung der Politik ein wenig in Widerspruch zu seiner Parole „Hoch lebe die Tarifautonomie“ steht.
Er und seine Kumpane hoffen einfach inständig, daß sie doch noch den Regierenden und den Arbeitgebern klarmachen können, daß sich die bisherige „ordnungspolitische“ Lösung der Lohnfrage so bewährt hat, daß es keinen Grund gibt, sie aufzugeben. Dafür organisieren sie – und das ist für dieses Anliegen auch die geeignetere Aktionsform – eine ganze Woche „1. Mai“, mit Kundgebungen in mehreren Großstädten und Anzeigenkampagnen in den Tageszeitungen:
„Wir wollen, daß Tarifverträge Grundlage unserer Wirtschaftskraft und Säule unseres Sozialstaates bleiben.
Viele tausend Tarifverträge wurden in den letzten 40 Jahren in Deutschland abgeschlossen. Sie haben Schritt für Schritt die Lebensbedingungen für uns alle verbessert. Die Arbeitsbedingungen, die Sicherheit bei Krankheit, im Alter, bei Arbeitslosigkeit.
Jetzt wissen Sie, warum dieses Thema für uns und für Sie so wichtig ist. Und wozu das rote G auffordert: Gegenwehr. Damit wir uns auf Verträge wieder verlassen können.“ (Anzeige des DGB, SZ 19.4.93)
Daß die plakative Werbung, wie staatstragend ihr Verein sich immer aufgeführt hat, die Arbeitgeber und die Regierungskoalition von ihrem Vorhaben abbringen wird oder daß wenigstens Presse, Funk und Fernsehen gewerkschaftsfreundlicher gestimmt werden, können sie wohl selber kaum glauben.
Der DGB-Boß Heinz-Werner Meyer klingt jedenfalls bei aller krampfhaften Mühe, einen kämpferischen Ton anzuschlagen, leicht resigniert:
„Nur die gemeinsame Gegenwehr aller Gewerkschaften könne verhindern, daß die Tarifautonomie zu einer ‚Restgröße der Marktwirtschaft‘ verkomme. Die Unternehmer und die Bonner Regierungskoalition bereiteten angesichts von Massenarbeitslosigkeit und Milliardendefiziten den Ausstieg aus den sozialen Fundamenten der Marktwirtschaft vor.“ (SZ 26.4.93)
Daß die andere Seite unter Berufung auf Krise und Solidarpakt eine gute Gelegenheit hat, neue Formen des Umgangs mit den Arbeitnehmervertretungen einzuführen, muß er ihr einfach bescheinigen. Um so mehr ist die deutsche Gewerkschaft es sich einfach schuldig, Demos, Kundgebungen und Streiks zu organisieren. In diesem Sinne agitiert sie auch ihr Fußvolk:
„Düvel (sächsischer IGM-Chef) sprach in Zusammenhang mit dem anstehenden Streik von einem ‚Kampf um die Ehre, den wir immer gewinnen werden‘.“ (FAZ 26.4.93)
Mag schon sein. Klar ist aber auch – egal wie der Streit mit den Arbeitgebern letztlich beigelegt wird –, daß die Regierung und die Arbeitgeber ihren Zweck, die Position der Gewerkschaft neu zu definieren, schon jetzt erreicht haben. Die Durchsetzung ihrer Interessen in Lohnfragen geht in Zukunft ein wenig direkter.
III. Die Lehren der Tarifrunde ’93
Materiell hat die diesjährige Tarifrunde den deutschen Arbeitnehmern Einbußen beschert. Das bedeutet freilich nicht, daß sie ihnen nichts gebracht hätte; sie haben nämlich einiges lernen dürfen, die Ostler schon gleich.
Die Bundesrepublikanisierung der Zonis
Erstmals durften sie nach über 60 Jahren an einem legalen Arbeitskampf teilnehmen. Daß das eine ungeheure Erfahrung sein muß, konnte in der Öffentlichkeit nicht genug betont werden. Etwas unter ging der Punkt, was sie dabei eigentlich gelernt haben.
- Die erste Erfahrung ist die, daß das Streiken eine sehr verwickelte Verwaltungsangelegenheit ist und der gewerkschaftliche Kampf als Ritual durchgezogen wird – mit Abstimmungen, aus denen unmittelbar gar nichts folgt; Fristen, die unbedingt beachtet werden müssen; Entscheidungen von oben, wann wo wieviel Arbeit niedergelegt werden darf; telegenen Versammlungen, bei denen der Mann aus der Zentrale seinen Auftritt hat. So lernt das frisch gebackene Gewerkschaftsmitglied/Ost, daß es bei der ganzen Angelegenheit nicht um die Durchsetzung seiner Interessen geht, sondern um Solidaritätsbekundungen mit der Gewerkschaft und deren Problemen. Dafür darf dann auch die eine oder andere Mark geopfert werden, um die das Streikgeld geringer ausfällt als der entgangene Lohn – die Unorganisierten bekommen die Einsicht beigebracht, daß der Mitgliedsbeitrag bei der Gewerkschaft so gut und so wichtig wie jede andere Versicherungsprämie ist.
- Was den eigenen Lohn angeht, muß der Ex-Zoni sich den Standpunkt angewöhnen, daß man nur etwas verlangen kann, wenn die Unternehmen etwas übrig haben. In Zeiten, wo die Aufträge knapp sind, ist schon mal nichts an Lohnzuwachs drin. Im Gegenteil, die Inflation und die Erhöhungen der Abgaben bescheren einem unterm Strich ein Minus. Daß „gute Zeiten“ auch nicht heißt, daß man viel kriegt, lernen die neuen Bundesbürger vielleicht dann später noch.
- Zu lernen gab es weiterhin ein Stück demokratischer Kultur: Man darf schon mal ins Mikro eines Fernsehfritzen sagen, man hätte einfach zu wenig zum Leben – und es folgt überhaupt nichts daraus; weder ein Besuch von der Stasi noch eine müde Mark. Stattdessen werden alle Beschwerden zu wohlausgewogenen volkswirtschaftlichen Rechnungen verarbeitet, bei denen so etwas Banales wie der Lohn in jedem Falle auf der Strecke bleibt.
- Eine Lektion in Sozialpartnerschaft war auch im Programm. Nämlich die: Wenn es um Prinzipien-Fragen geht, wie die Sozialpartnerschaft weiter ausgetragen werden soll, dann ist die Lohnhöhe bei der Gewerkschaft bloß noch als Verhandlungsmasse vorgesehen. Die Zustimmung zu Lohnsenkungen kann ein gutes Mittel sein, um sich vielleicht Anerkennungspunkte beim Kontrahenten zu ertrotzen. Denn die Findung eines tragfähigen Wegs der Sozialpartnerschaft ist das Wichtigste für die deutsche Demokratie.
- Das Anschlußversprechen des Kanzlers „Keinem wird…“ war ein unverzeihlicher Irrtum – das hat jetzt wirklich oft genug in der Zeitung gestanden. Mit „Wahlkampfgerede“ ist er zwar entschuldbar, aber dennoch hat er „unnötige Erwartungshaltungen“ hervorgerufen. Die Gewerkschaften hatten es schwer, sich mit denen auf der Seite ihrer Mitglieder herumschlagen zu müssen. Vielleicht konnten sie wenigstens mit dem Streik den Ossis klarmachen, daß Wohlstand nicht drin ist. Man wird sich wohl noch mit dem Niedriglohnniveau im Osten etliche Jahre abfinden. Aber das ist keine Schande; als willige, billige Leute, die für jede Beschäftigung dankbar sind, können die Ossis erstklassige Bundesbürger sein.
- Ein Arbeitsplatz ist höchstes Glück. Man darf nicht fragen, was man dort verdient oder was der einen an Kraft und Nerven kostet. Ein Arbeitsplatzbesitzer, der unzufrieden ist, ist undankbar, weil er gar nicht würdigt, wieviele ihn darum beneiden und was mancher bereit wäre, dafür an Opfern zu bringen.
- Und eines sollten die Ex-DDRler in dieser Tarifrunde wenigstens gelernt haben: sich mit den Richtigen zu vergleichen, den Polen, den Tschechen… Da können sie froh sein, Deutsche zu sein.
Lehre für Wessis: Abschied von der „Wohlstandsgesellschaft“
Das meiste von dem, was die Ossis erst noch lernen mußten, ist für die arbeitenden Menschen in den alten Bundesländern längst gegessen. Über die Gewerkschaft machen sie sich gar keine Illusionen. Dafür machen sie alles mit, was die ihnen anschafft. Wenn gestreikt wird, „kämpft“ man natürlich und hört sich starke Töne an oder macht selber welche. Wenn 1. Mai gefeiert wird, steigt man in den Bus und läßt sich zur Kundgebung fahren usw. Daß der Lohn diesmal mies ausfallen wird, hat man sich schon gedacht und am Stammtisch bereits prognostiziert…
Doch ein paar Feinheiten gab es schon noch zur Kenntnis zu nehmen:
- So sehr sich die Ossis den ewigen Vergleich mit den Wessis abgewöhnen müssen, so sehr sollen sich die Wessis den mit den Ossis angewöhnen. Der Kanzler mußte es einfach einmal loswerden: Angesichts dessen, was sich drüben abspielt, finde er das Gejammer im Westen empfindungslos!
- Aber nicht nur wegen der Zone, und darum auch gar nicht bloß vorübergehend, müssen die bundesdeutschen Arbeitnehmer einfach einmal lernen, daß „Erarbeiten vor Verteilen“ kommt. Wer meint, es könne mit dem „Wohlstand“ wie bisher weitergehen, ist schief gewickelt.
PS.: Vor mehr als 100 Jahren hat jemand mal ein Gesetz aufgestellt. Er meinte nicht, die Arbeiter sollten sich dran halten, im Gegenteil. Er meinte, so läuft es im Kapitalismus. Wie und über welche verrückten Streitigkeiten sich dieses Gesetz anno 1993 durchsetzt, konnte er natürlich nicht wissen:
„Die industrielle Reservearmee drückt während der Perioden der Stagnation und mittleren Prosperität auf die aktive Arbeiterarmee und hält ihre Ansprüche während der Periode der Überproduktion und des Paroxysmus im Zaum. Die relative Überbevölkerung ist also der Hintergrund, worauf das Gesetz der Nachfrage und Zufuhr von Arbeit sich bewegt. Sie zwängt den Spielraum des Gesetzes in die der Exploitationsgier und Herrschsucht des Kapitals absolut zusagenden Schranken ein.“ (Karl Marx, Das Kapital Bd. I, S. 668)
[1] vgl. zum Thema staatlich verordnete Lohnsenkung GegenStandpunkt 1-93, S.49, „Vom Zweck eines ‚Solidarpakts‘ – Krisenbewältigung durch DM-Imperialismus“
[2] vgl. hierzu in diesem Heft: „Der Kampf um Arbeitsplätze – Das logische Ende eines Gewerkschaftsschlagers“