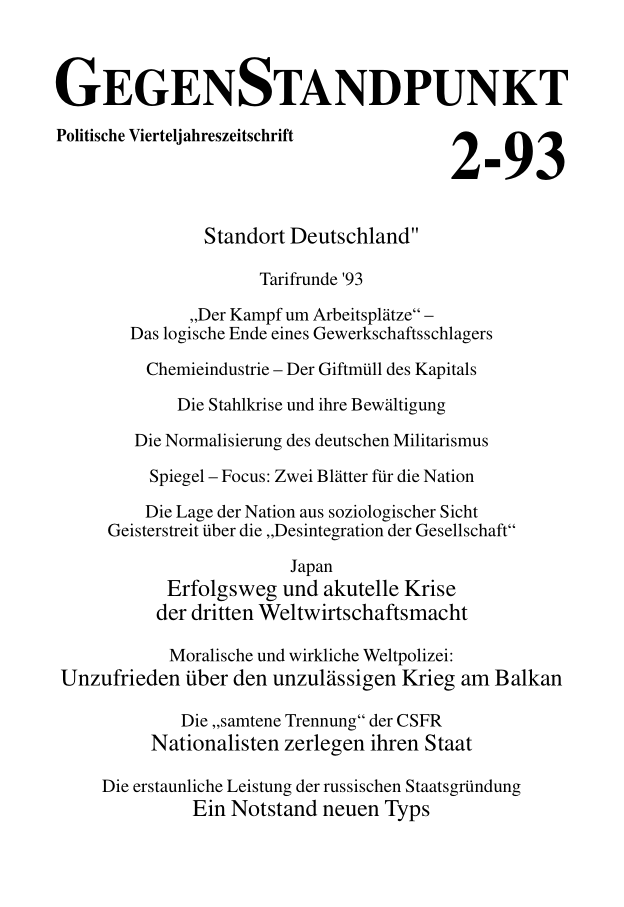Standort Deutschland
Der Chemiestandort Deutschland
Chemieunfälle passieren, weil mit Chemieprodukten Geschäft gemacht wird. Letzteres ist auch für den Normalzustand grenzwertgeprüfter Vergiftung von Land und Leuten verantwortlich. Konsequenz aus Normal – wie Sonderfall alltäglicher Vergiftung: Deutschland muss Chemiestandort bleiben!
Aus der Zeitschrift
Teilen
Siehe auch
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Standort Deutschland
Der Chemiestandort Deutschland
Einen Giftunfall mittlerer Reichweite
hat die Hoechst AG neulich angerichtet. Während ihrer Produktion von Profit, Unterabteilung Farbstoffe, ist ihr ein chemischer Reaktionsprozeß außer Kontrolle geraten, woraufhin etliche Tonnen Giftcocktail per Überdruckventil an die Umwelt weitergereicht wurden und sich auf den nächstgelegenen Frankfurter Stadtteil niederschlugen. Der Boden im Stadtteil wurde symbolisch abgekratzt, eine – so die Presse einhellig – „Mondlandschaft“ hinterlassen; bloß mit dem Unterschied, daß da weiterhin Leute wohnen. Während der Hinweis, daß beim Knall am Rosenmontag sehr wahrscheinlich die Reaktions-bedingungen fürs Entstehen des Seveso-Giftes Dioxin gegeben waren, bisher dem BBU und dem Öko-Institut vorbehalten blieb, besagen auch die amtlich beglaubigten Befunde, daß Hoechsts Giftmix immerhin „schwach krebserregend“ und „erbgutschädigend“ war.
Im Anschluß an die Explosion, in deren Gefolge Schwanheim samt Insassen noch ein Stück über deutsches Normalmaß hinaus vergiftet wurde, ereignete sich bei der Hoechst AG die bekannte „rätselhafte Unfallserie“ mit mindestens einem Dutzend „meldepflichtiger Störfälle“ binnen fünf, sechs Wochen, einem tödlichen Arbeitsunfall und jeder Menge „Schadstoffemissionen“ an die Adresse von Luft und Wasser in dieser Gegend. Die Presse fragt besorgt, wann jene „Serie“ denn endlich abreißen werde, und meldet so das Recht der deutschen Öffentlichkeit auf ein unkatastrophales Normalmaß an Emission an, welches „das Leben in der Nachbarschaft des Chemiegiganten“ lebenswert macht. Und auch wenn der eine oder andere Zeitungs- und Fernsehprofi selbstkritisch anmerkte – nach dem Motto ‚Ja, ja, so sensationsgeil sind wir Journalisten‘ –, daß seine Zunft immer bloß aus Anlaß eines „Störfalls“ des gröberen Kalibers ein vorübergehend gesteigertes Augenmerk auf das Tun und Treiben von dessen Produzenten richtet, daß zu gewöhnlichen Zeiten also nicht etwa die „Unfallserien“, sondern die öffentliche Aufmerksamkeit dafür unterbleibt – das Gerede von der Hoechster „Pechsträhne“ steht (wie auch seinerzeit bei der analogen „Serie“ jener Schweizer Pillendreher und Rheinverpester und neulich bei diversen „Tankerkatastrophen“) ebenso penetrant wie kontrafaktisch für die Auffassung von der Nicht-Notwendigkeit solcher Vorkommnisse. Schließlich will Deutschland sich seine Qualität als Chemiestandort nicht vermiesen lassen.
Von den Notwendigkeiten eines kapitalistischen Chemiestandortes
Eine national voreingenommene Sichtweise gehört nämlich schon dazu, um sich darüber hinwegzusetzen, daß die hierzulande zum normalen Standard gehörende Vergiftung der natürlichen Lebensgrundlagen mitsamt den periodischen „Störfällen“ der mehr katastrophalen Art System hat. Das mit der „rätselhaften“, „einfach nicht abreißenden“ Unfallserie kommt den Leuten, die das Pech haben, in der näheren Umgebung von Hoechst-Werken zu hausen, etwas eigenartig vor, weil sie es eh gewohnt sind, daß sie etliche Sorten der Hoechst-eigenen „Störfälle“ alle paar Tage sehen, riechen und schmecken können. Die Schwanheimer haben den Rosenmontag über noch gefeiert, als der gelbe Segen sich schon über sie ergossen hatte: „Ja klar hat es draußen gestunken, aber das tut es hier gegenüber von Hoechst doch eigentlich immer.“ (die „Zellers aus Schwanheim“ zur SZ, 6./7.3.) Um so mehr ist der Veranstalter, der Chemiemulti vom Main, selber immerzu dafür präpariert, mit den häufigen Folgen seiner kontrollierten „Umweltverschmutzung“ umzugehen. Die Hoechster Betriebsfeuerwehr dürfte zu den erfahrensten „Umweltexperten“ im Lande zu zählen sein. Und immerhin hatte das Krisenmanagement der Firma ziemlich bald einen ziemlich großen Reinigungstrupp im Einsatz, ausgerüstet mit „Astronautenanzügen“ und Atemschutzmasken, was manchem nicht mit solchen Utensilien versehenem Anwohner zu denken gab. Andererseits gibt es aber auch zu denken, wie gesund und gemütlich die Lohnarbeit bei Hoechst sein muß, wenn solche Arbeitseinsätze zwischendurch den Job bei diesem Arbeitgeber anreichern – oder wenn man erfährt, daß der größte Teil des in Schwanheim abgeschabten Giftmülls bis auf weiteres auf Werksgelände zwischengelagert bleibt. Die AG für ihren Teil beweist, daß sie mit „Zwischenfällen“ auch dieser Größenordnung permanent rechnet, durch die Unterhaltung einer Risikoversicherung bei einer eigenen sowie sieben weiteren Assekuranzen von Gerling bis zur Allianz. Der Gerling-Vorstand stuft die wg. Schwanheim anfallende Haftpflicht-Regulierung auf ca. 30 Mio. DM ein (bloß ein „mittlerer Fall“, verglichen mit der Sandoz-Katastrophe, die die Versicherungen 70 Mio. Franken kostete), macht aber schon mal geltend, „daß sich alle Unternehmen, die mit Chemikalien arbeiten, im laufenden Jahr wegen des gestiegenen Aufwandes für Haftpflicht-schäden auf zweistellige Zulagen einstellen müssen“ (FR, 17.3.). So stellen im praktischen Geschäft die Beteiligten klar, daß ihnen die Notwendigkeit des Eintretens von Schädigungen großen Ausmaßes allemal geläufig ist. Und wenn sie im Anschluß an Fälle à la Sandoz und Schwanheim auf interessierte Anfragen über die „Grenzen der Versicherbarkeit des Risikopotentials der chemischen Industrie“ Auskunft geben, dann denken sie locker auch an einen chemischen GAU und halten den genau wie den atomaren für nicht versicherbar – mit dem einleuchtenden Argument, daß die Summen, die da zusammenkämen, sowieso niemand zahlen könnte.
Natürlich ist die Notwendigkeit der „normalen“ Umweltverpestung wie der periodischen Katastrophen, die vom Chemiestandort Deutschland ausgehen, keineswegs in einem allgemeinen „Lebensrisiko Chemie“ begründet. Schließlich geht von „der Chemie“ als solcher kein Sachzwang für nichts aus; die gibt es ja bloß in Gestalt von Fabriken, die Kapitalgesellschaften gehören. Und auch das Deuten auf die „unverzichtbaren“ Segnungen, die jedermann in seiner Eigenschaft als Konsument „der Chemie“ verdankt, macht die Sache mit dem generellen „Lebensrisiko“ nicht gerade plausibler: Wäre wirklich der Standpunkt des Genusses von Produkten der ausschlaggebende, so würde der sich für lebensgefährliche Produktionsverfahren schönstens bedanken. Deren Notwendigkeit kommt allein daher, daß Produktionsprozesse wie Produkte der chemischen Industrie ausschließlich in dem Interesse eingerichtet wurden, mit ihnen ein Geschäft zu machen: aus dem eingesetzten Kapital mehr kapitalistischen Reichtum.
Dieser „Sachzwang“ fordert seinen Preis; logischerweise von „uns allen“ – ein Beitrag zur gesellschaftlichen Verarmung, den ausgerechnet deswegen niemand so einordnet, weil der Schaden allgemein wirkt. Im einzelnen:
Luft, Wasser und Erde dienen als der allerbilligste Abfalleimer für die stofflichen Rückstände, die als „Nebenwirkung“ der beabsichtigten Hauptwirkung, einer profitablen Produktion, immerzu anfallen; und so kommen „wir alle“ dann in den Genuß einer flächendeckenden Ruinierung der natürlichen Lebensgrundlagen. Die Arbeitsmannschaft, die bei Arbeitgebern wie der Hoechst AG ihren Lebensunterhalt verdienen darf, stellt für die Firma einen Kostenfaktor dar, der sich lohnen muß; also wird sie noch etwas direkter allerlei giftigen Substanzen ausgesetzt und im übrigen so eingespannt, daß Arbeits- und sonstige Unfälle programmiert sind. Was schließlich die Werksanlagen und Reaktoren betrifft, so müssen sie natürlich sicher funktionieren, weil Fehlfunktionen Geld kosten – aber eben auch nur darum; so geht also auch der Aufwand für Sicherheit in die Kosten- und Ertragsrechnung des Unternehmens ein und wird, wo er nicht gesetzlich erzwungen wird, gern durch die bekannte unternehmerische Risikofreude ersetzt.
Kurz: Die kapitalistische Rechnungsführung des unbedingt zu optimierenden Verhältnisses von Kostpreis und Profit regiert auch die chemische Großindustrie. Und sie läßt sich keineswegs davon bremsen, daß diese auf der stofflichen Seite mit Prozessen operiert, bei denen die unkontrollierten Folgen ziemlich schnell katastrophenmäßige Ausmaße annehmen.
Nicht, daß die professionellen Begutachter von „Störfällen in der chemischen Industrie“ nicht bisweilen eine Ahnung vom Kern des ungemütlichen Sachverhalts eines kapitalistischen Chemiestandorts befällt. So kommentiert die Süddeutsche Zeitung „das Rätsel von Hoechst“ am 16.3. mit der Frage, ob „wir“ da am Ende „die Folgen der gegenwärtigen Patentweisheit aller Betriebswirtschaft zu spüren bekommen, die da heißt: Personalkosten senken, Leute entlassen, Arbeit verdichten? Von den I.G.-Farben-Nachfolgern zahlt Hoechst in diesem Jahr nach bestem Betriebsergebnis die beste Dividende…“. Wieso bitteschön soll das bloß die „gegenwärtige Patentweisheit aller Betriebswirtschaft“ sein? Der SZ-Schreiber möchte eben doch nicht gegen das Prinzip der Marktwirtschaft angehen, sondern sich gegen alle Erfahrung eine „Weisheit der Betriebswirtschaft“ vorstellen, die ‚effektiv‘ wirtschaftet und dennoch „die Folgen“, die gerade an Schwanheim öffentlich zu bewältigen sind, vermeidet. Und damit ist er gleich wieder mittendrin in der guten Gesellschaft der öffentlichen Meinungsbildner, die – von der Entlarvung, daß Hoechst bisweilen besoffene Gelegenheitsarbeiter anheuert, bis zur Entdeckung, daß eigentlich bloß ein ganz billiger Schalter am Rührwerk gefehlt hätte – alles aufbieten, um der werten AG bloß lauter fahrlässige Versäumnisse und fehlenden guten Willen vorzuhalten, also die Notwendigkeit einschlägiger Vorkommnisse in einem führenden Kapitalstandort zu bestreiten. Womit sie immerhin beweisen, daß die Existenz einer demokratischen Öffentlichkeit, vor der sich nichts verbergen läßt, auch nicht gerade ein Berstschutz gegen die „Umweltkatastrophen“ ist, die sie von Zeit zu Zeit aufgeregt registriert…
Der Staat, der wird’s schon richten…
Dabei gilt die öffentliche Aufregung in erster Linie einer angeblich mangelhaften staatlichen Aufsicht über die chemische Industrie, einem Mangel, den die Politik teils schuldhaft (warum hat sie denn nicht schon längst schärfere Auflagen verordnet!), teils schuldlos (Hoechst hat sogar dem Staat gegenüber gescheite Meldungen unterlassen!) verursacht haben soll. In dieser Sorte Aufgeregtheit äußert sich einerseits die Sehnsucht des braven deutschen Mitmachers, ob ihm nicht wenigstens ausgewachsene Katastrophen erspart bleiben könnten, andererseits eine Art Urvertrauen in den Staat, der mit seiner wohltätigen Macht doch die berufene Einrichtung wäre, den Berstschutz gegen das „Lebensrisiko Chemie“ abzugeben.
Der Sache nach wird mit dieser Auffassung der Bock zum Gärtner gemacht. Der Staat sieht sich schließlich nur deshalb und in zweiter Instanz mit Handlungsbedarf konfrontiert, der die Vergiftung von Land und Leuten betrifft, weil er in erster Instanz den profitdienlichen Umgang mit dem einschlägigen Zeug will, fördert und absichert. Das ist ja wohl kein unabsichtlicher Mißgriff der Politik, wenn Umweltminister aller Parteien nach Schwanheim betonen, sie könnten den Betrieb bei Hoechst nicht mal teilweise zumachen, weil ihre rechtlich bindenden Betriebs-genehmigungen das nicht zulassen. Die Chemieindustrie stellt selber eine wuchtige kapitalistische Branche dar, und ihre prima Geschäftsmittel sind für andere Geschäftemacher unverzichtbar. Auch den Standpunkt des Chemiekapitals, daß aus Kostengründen „die Umwelt“ die billigste „Entsorgungs“-Agentur ist (siehe noch den „Störfall“ im Werk Griesheim: der Überdruck im Kessel wird per Ventil an die Umwelt abgegeben!) und daß an den Beschäftigten wie bei den Produktionsmitteln (incl. „Sicherheitsstandards“) zu sparen ist – auch diesen Standpunkt teilt der Staat. Genau deshalb kriegt er ja das Problem, daß – sei’s per Normalbetrieb, sei’s durch einen größeren „Störfall“ – die weitere Tauglichkeit von Land und Leuten für die gewohnte Fortführung des Ladens namens Deutschland ernstlich Schaden nimmt, der politische Gesamtaufseher über diesen Laden der Ruinierung seines Inventars also gewisse Grenzen zu ziehen hat, damit er weitergehen kann. Diese Grenzen dürfen andererseits ihrem Adressaten, den Subjekten der Marktwirtschaft als der ökonomischen Basis der Nation, wieder nicht zu nahe treten. Heraus kommen beim umweltpolitischen Umgang mit diesem Widerspruch erstens eine Menge staatlicher Kontrollbedarf, zweitens die berühmten „Grenzwerte“, die anhand des überaus flexiblen Maßstabs „Volksgesundheit“ bis hin zu der gesetzten Schranke ziemlich viel Durchschnittsvergiftung legalisieren, und drittens eine Dauerdebatte über den notwendigen Umfang staatlicher Intervention in die Tätigkeit geschäftstüchtiger Fabrikanten, die die ruinösen Folgen dieser Geschäftstüchtigkeit wenigstens zügelt. Der reichlich zynische Umgang mit Land und Leuten, der bei dieser Kombination von kapitalistischer Industrie und staatlicher Umweltfürsorge herauskommt, veranlaßt manchen Umweltschützer, von einem Massenexperiment zu sprechen, dem die Spezies Mensch im Chemiestandort Deutschland ausgesetzt wird. Dabei ist es in Wirklichkeit bloß so, daß durchaus bekannte Schädigungen und Risiken in Kauf genommen werden – zum Wohle „der Wirtschaft“, und sich die Notwendigkeit von Schadensbegrenzung und Vorbeugung immer erst als Folge von Katastrophen einstellt, dann nämlich, wenn sich der Staat in seiner Geschäftsgrundlage als geschädigt betrachtet.
Wenn das Kind wieder einmal in den Brunnen gefallen ist, dann wird wie im Fall Schwanheim der Hoechst AG post festum ganz empört vorgehalten, daß sie noch nicht einmal die genaue Zusammensetzung ihrer Giftmixtur weiß und eine erste vorläufige Studie über davon möglicherweise ausgehende Gesundheitsschädigungen ziemlich verbummelt haben soll. Ja, was denn sonst! Daß dabei Leute Schaden nehmen könnten, ist für die Hoechst AG doch wirklich kein Grund, einen gewinnträchtigen Produktionsprozeß, den sie ausgetüftelt hat, auf die lange Bank zu schieben und am Ende womöglich ganz sein zu lassen. Für dieses Vorgehen hat sie auch die Erlaubnis der Politik, während der Bundesgesundheitsminister ganz genau weiß: Rauchen gefährdet Ihre Gesundheit!
Deutschland muß Chemiestandort bleiben!
Sehr verkehrt also die Ansicht, der Staat (wenigstens der demokratische) sei der passende Adressat für das Anliegen, das Versauen der Umwelt zu verhindern oder doch wenigstens von einem deutschen Seveso verschont zu bleiben. Umgekehrt: Mit den „Standort“-Vorhaben der staatlichen Gewalt, ihre sämtlichen Umweltauflagen eingeschlossen, ist die Notwendigkeit der schleichenden und bisweilen auch akuten Gefährdung von Land und Leuten erst so richtig komplett. Auch das läßt sich der öffentlichen Aufarbeitung von Schwanheim und der Hoechster „Unfallserie“ noch entnehmen: Alle Maßgeblichen äußerten sich ja dahingehend, das eigentlich Besorgniserregende an diesen Vorfällen sei, daß sie das „Vertrauen“ in den „Chemiestandort Deutschland“ in Mißkredit bringen könnten, daß aber genau das nicht in Frage kommen darf, weil Deutschland sich ohne seine Qualität als Chemiestandort nicht in der Welt sehen lassen will. Also versprachen die Verantwortlichen anläßlich einer mittleren Katastrophe, alles zu tun, damit Deutschland seine kapitalistische Chemiebasis erhalten bleibt.
Das war dann dem obersten Hoechst-Chef Hilger schon eine Rundum-Entschuldigung und die Versicherung wert, daß seine Firma künftig aber auch wirklich alle – nämlich alle staatlich vorgeschriebenen – Sicherheitsvorkehrungen einhalten wolle. Die Grünen-Politiker in Wiesbaden und Frankfurt, die bereits bewiesen haben, daß sie die politische Katastrophenbewältigung – die Dialektik von Verharmlosung und dem Winken mit mehr Staatsaufsicht – genau so schön hinkriegen wie Kollege Töpfer, lassen keine Gelegenheit aus, um die Unverzichtbarkeit der Großchemie für eine Nation wie Deutschland zu unterstreichen. Z.B. Joschka Fischer:
„Rechtlich besteht keine Möglichkeit, die Hoechst-Werke hier im Rhein-Main-Gebiet einfach zu schließen. Politisch ist es völlig unvorstellbar, 20 000 Menschen auf Kurzarbeit Null zu setzen… Aus der Chemie werden wir nicht einfach aussteigen. Wir werden ihre Konversion betreiben müssen. Die Chemie ist kein relativ einfaches, kompaktes System wie der Einsatz der Atomenergie zur Stromerzeugung, sondern auf tausend Arten im Alltag präsent.“ (FR 17.3.93)
Auch ein grüner Staatsminister beherrscht die demokratische Kunst, ‚Arbeitsplätze‘ und ‚im Dienste des Verbrauchers‘ zu sagen, wenn er festhalten will, daß vom staatsmännischen Standpunkt aus die chemischen Zeitbomben für die Nation nützlich und notwendig sind; in seinen Augen jedenfalls viel elementarer als die Atomenergie, die er vom Vergleichspunkt ‚Ausstiegsmöglichkeit‘ her als eine ganz simple Sache hinstellt (als hätte er es auf dem Felde schon zu etwas gebracht!). Seine Chemie-„Konversion“ besteht im übrigen im Vorschlag „bundesgesetzlicher Änderungen“ wie „gesetzliche TÜV-Pflicht für Störfallanlagen alle drei Jahre, gesetzliche Organisationsüberprüfung nach drei Jahren“ und dergleichen beruhigenden Maßnahmen mehr.
Mit einer neuen Runde leicht verschärfter Staatsaufsicht sind dann alle Wünsche an die Chemieindustrie abgedeckt und der Chemiestandort Deutschland bewahrt. Ohnehin galt die öffentliche Betroffenheit über Schwanheim und die Folgen nicht zuletzt dem Umstand, daß der geplante Ausbau des hiesigen Chemiestandorts jetzt mit dem Augenschein einer mittleren Katastrophe konfrontiert ist. Die Chemie-Unternehmer müssen sich vorübergehend mit der Peinlichkeit befassen, daß Schwanheim halt so ein bißchen kontrastiert mit ihren gerade aktuellen, ziemlich unbescheidenen Anträgen, der Chemiestandort Deutschland müsse ihnen allerhand viel zu teure, also „überdimensionierte“ Umweltauflagen erlassen und ihnen endlich den Einstieg in das Zukunftsgeschäft mit der Gentechnologie ermöglichen, andernfalls sie sich das Auswandern in Nationen überlegen müßten, die ihrem Gewerbe geneigter gegenüberstehen. Und da ruft ihnen auch „nach Schwanheim“ niemand in Deutschland zu ‚Ab durch die Mitte, lieber heute als morgen!‘. Im Gegenteil: Das würde man in Deutschland erst als die echte Katastrophe auffassen, wenn diese führende kapitalistische Nation keine Chemiefirmen hätte, die mit ihren technischen Fortschritten – „High Chem“ heißt das Stichwort – weltweit der Konkurrenz die Maßstäbe setzen und Geschäftserfolge einfahren, die ganz nebenbei dem nationalen Höchstwert, der „Stärke der D-Mark“, zugute kommen. Ohne ein Chemiegeschäft, das von erstklassigen Multis mit Firmensitz in Deutschland ausgeht, käme diese Nation sich glatt abhängig und durch Ausländer erpreßbar vor – ein deutlicher Hinweis, worum es also politisch geht, wenn das Ausland gefälligst bei „uns“ seinen fortschrittlichen Chemiebedarf einkaufen soll. Dagegen können ein bißchen „allgegenwärtiges Lebensrisiko“ und Schädigung für die Einwohner des Chemiestandorts Deutschland kein Einwand sein.
Zumal der Staat noch mehr aufzupassen verspricht. Seine diesbezügliche Verheißung benützt der grüne Fischer auch noch zu einem argumentativen Sonderangebot, das noch den letzten Idealisten im Land für den Chemiestandort Deutschland einnehmen muß:
„Wir können als Ökologen auch kein Interesse daran haben, eine Arbeitsteilung zwischen Pharmazie und Feinchemikalien in den reichen westlichen Industrieländern und Halbfertigprodukten sowie chemischen Grundstoffen in den Schwellenländern und den Entwicklungsländern zu haben. Das würde unter sozialen und ökologischen Gesichtspunkten Bedingungen in den dortigen Produktionsanlagen bedeuten, die weit unter denen liegen, wie wir sie heute hier haben.“ (FR, 17.3.)
Ja dann! Dann ist der lebensgefährliche Chemiestandort Deutschland auch noch ein gutes Werk, mit dem Inder usw. vor der Versuchung zum Abenteurertum in Sachen „Umweltdumping“ bewahrt werden.
Auf der anderen Seite haben wir für einschlägige Ambitionen von „Schwellen- und Entwicklungsländern“ aber eine großzügige Verwendung entdeckt: als Importeure von deutschem Giftmüll und dergleichen sind sie allemal willkommen. Schließlich macht sich am wuchtigen Wirken des Standorts Deutschland ja durchaus bemerkbar, daß sich Deutschland da auch wiederum ein bißchen zu klein vorkommt.
Zu klein einerseits sowieso für die Wucht des Geschäfts mit chemischen Materialien, die daheim fabriziert werden und wofür die ganze Welt als Abnehmer verplant ist. Etwas klein geraten andererseits für an Ort und Stelle auftretende schädliche Wirkungen der profitablen Produktion; aber da hilft nichts: da muß Deutschland durch, wenn es führender Chemiestandort sein will. Zu klein schließlich auf alle Fälle, was die „Entsorgung“ der giftigen Exkremente der Produktion angeht, die hierzulande in Massen anfallen. Dafür sind minder tüchtige Auslande gerade gut genug. Das betraf früher auch die Ostzone, als die noch Feindesland war. Und ein Stück weit – von Schönberg bis Greifswald – gilt es auch heute noch; denn wenn es schon mit dem „Aufbau Ost“ zum Zusatz-Kapitalstandort hapert, dann können gewisse abgeschriebene Zonen in der Zone sich ja wohl noch als Müllkippe nützlich machen. Andererseits gehört die Zone jetzt eben doch Deutschland, und da empfiehlt es sich vom deutschen Standpunkt aus, den notwendigen un- sowie giftigen Abfall weiter ost-, west- und südwärts zu verschieben. Zwar mögen sich manche Leute für Deutschland schämen, wenn Giftmüll made in Germany in Rumänien und weiß Gott wo auftaucht. Der zuständige Minister sieht das lockerer. Er ist ganz offiziell gegen einen Vorschlag der dänischen EG-Präsidentschaft, die Vorschriften für Müllexporte zu verschärfen. Töpfer sagte, daß „man erst im Februar die ‚Verbringungsverordnung‘ der EG verabschiedet habe, nach der für Giftmüllexporte, die nicht in westliche Industriestaaten gehen, eine schriftliche Genehmigung beider Regierungen vorliegen müsse. Damit sei Sicherheit eigentlich gegeben.“ (FR, 23.3.) Es trifft sich doch auch wirklich zu gut, daß der erfolgreiche Standort Deutschland ganz generell weniger erfolgreiche Nationen umfassend von sich abhängig gemacht hat, so daß die für Devisen, die sie brauchen und nicht haben, bereit sind, den Staatsstandpunkt gegenüber dem Umweltschutz mal anders herum auszulegen: Sie bieten ihr Territorium als Giftabladeplatz für eine erlesene Sorte Exportgüter an, für die sich der Exportweltmeister Deutschland zu klein ist.