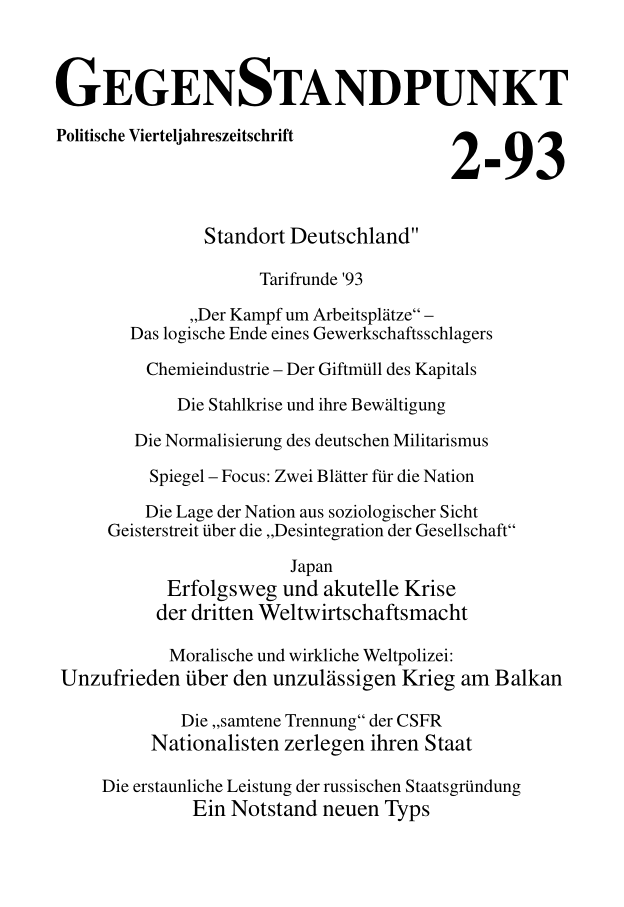Standort Deutschland
Geisterstreit über die „Desintegration der Gesellschaft“
Betätigt sich der freie Wille der Bürger im Standort Deutschland auch so, dass er seinen Beitrag zum Funktionieren „der Gesellschaft“ leistet?! Dankt er dem Kollektiv, dass es ihm Sinn in sein Dasein bringt?! Ist die Soziologie auch ihrer Aufgabe, der Pflege nationaler Gesinnung genügend nachgekommen?! – Das sind Fragen, die die Soziologie so aufwirft …
Aus der Zeitschrift
Teilen
Siehe auch
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Standort Deutschland
Die Lage der Nation aus soziologischer Sicht
Geisterstreit über die „Desintegration der Gesellschaft“
Wenn so ein Geisterstreit unter „namhaften Sozialwissenschaftlern“ in den Feuilletons ausbricht, wie in den letzten Wochen jeweils am Wochenende in der Süddeutschen Zeitung unter der Titelfrage „Wieviel Konsens braucht der Staat?“, so ist das ein komplexes Geschehen. Ausgegangen wird da von befremdlichen Voraussetzungen, die als Selbstverständlichkeiten unterstellt werden; Selbstverständlichkeiten werden bis zur Unkenntlichkeit mystifiziert; und auf dieser Grundlage wird so eifrig debattiert, daß vor lauter Differenzen fast aus dem Blick gerät, worum da gestritten wird. Dabei ist die Fragestellung ziemlich eindeutig. Ob der Gehorsam gegenüber dem Staat nichts zu wünschen übrig läßt, hatte die Redaktion der SZ als Aufsatzthema vorgegeben, und keiner der antretenden Wissenschaftler wollte sich diesem Problem verschließen. Jeder hatte zu diesem Problem – aus wissenschaftlich differenzierter Sicht, versteht sich – etwas beizutragen.
Soziologen machen ihre eigenen Beobachtungen
Sie registrieren gesellschaftliche Umbrüche, die es gar nicht gibt:
„Auf die erste Stufe der bürgerlichen Emanzipation, die Befreiung von den feudalen Abhängigkeiten, sind immer neue Schübe der Lösung von Bindungen gefolgt: Nach den Ständen und den Klassen hat die Freisetzung aus Bindungen heute auch die sozialen Milieus, die Familien, die Ehen und die einzelnen selbst erreicht.“
Sie sehen die Institutionen, Lebensformen, Normen und überhaupt die „sozialintegrativen Strukturen“ der bürgerlichen Gesellschaft in „Auflösung“ begriffen und ihrer Bindungskräfte verlustig gehen und nehmen eine allgemeine Tendenz zur „Desintegration der Gesellschaft“ wahr. Während die einen in dieser Tendenz noch Chancen erkennen und eine Gesellschaft neuen Typs heraufdämmern sehen –
„Hier kündet sich ein neues Verhältnis von Individuum und Gesellschaft an. Gemeinsamkeit kann nicht länger von oben nach unten verordnet, sondern muß frei gefragt, herbeigestritten werden im Durchgang durch das Individuelle.“ –,
haben andere bereits die Gefahr vor Augen, daß die Gesellschaft „auseinanderfällt“ und „in einem Kollaps“ endet. Sie fragen besorgt, ob wir nicht längst „isolierte Eremiten oder Egotripler“ geworden sind, „individualisierte Nullen“ sozusagen. Empirisch verfolgen die kompetenten Sozialwissenschaftler das Treiben orientierungslos gewordener Individuen – „ständig unterwegs in die Toscana, zur nächsten „Beziehung“ oder sonstwohin“ –, die sich auf eigene Faust einen Ersatz für die verlorengegangenen Bindungen suchen. Sie ermitteln, „welche sozialen Beziehungsmuster an die Stelle jener traditionellen Einbindungen getreten sind“. Bahnbrechende Entdeckungen bleiben da nicht aus. Zum Beispiel über „eigeninitiierte soziale Netzwerke in urbanen Ballungsräumen“:
„Bewohner großer Städte haben im Durchschnitt vielfältigere Kontakte zu Freunden, Arbeitskollegen oder anderen Angehörigen von Subkulturen oder Vereinen.“
Das stiftet Hoffnung. Doch andernorts schlägt die Kompensation des allseits bemerkten Bindungsverlusts in „fremdenfeindliche Gewalt“ um. Denn: „Desintegration erzeugt Gewalt“.
So in etwa sehen die Soziologen derzeit die Lage.
Die soziologische Brille
Was man sieht, liegt zuweilen daran, wie man eine Sache betrachtet. Im Fall der Soziologen ist dieser Verdacht schon deswegen naheliegend, weil sie mit einer gewissen Systematik in allem dasselbe erblicken – „soziale Netze“, „Bindungen“, „sozialintegrative Strukturen“, „gesellschaftliche Beziehungen“ usf. Und das in den disparatesten Veranstaltungen, die sie im stinknormalen Kapitalismus vorfinden – in den Klassen und Ständen, in Ehe und Familie, in Recht und Moral, in der Kultur und der Nation, in privaten Freundschaften und sozialen Milieus. Zielsicher erkennen sie noch im letzten Fußballverein ein Miteinander von Individuen. Und zwar ganz ausdrücklich und absichtsvoll durch Nichtbefassung damit, wer da mit wem gemeinsame Sache macht, und worin die besteht. Nur deswegen können sie sich ja auch vorstellen, daß so ein Vereinsbeitritt einen Ersatz für verlorengegangene Klassenzugehörigkeit darstellt, also irgendwie dieselbe Funktion erfüllt. Wie es den Anschein hat, müssen sie ausgerechnet die Abstraktion von Inhalt und Zweck des ganzen Miteinanders für eine Methode halten, die Funktion der jeweiligen Veranstaltung zu erfassen. Jedenfalls bieten sie ihre sachlich etwas dürftige Mitteilung – etwas Gesellschaftliches tut sich – als aufklärende Antwort auf alle Fragen nach Nutzen, Zweck und Grund aller gesellschaftlichen Einrichtungen an:
- Der Nutzen, den die kapitalistische Gesellschaft mit ihren verschiedenen Einrichtungen ihren Mitgliedern bietet, liegt im Sozialen; was soviel heißen soll wie: Sie gibt ihnen eine „Orientierung“, so daß sie sich in dieser Gesellschaft als soziale Wesen betätigen können.
- Das Soziale ist der Zweck dieser Gesellschaft. Sie „integriert“ die Individuen in die Gesellschaft und gewährleistet so die „Stabilität“ der Gesellschaft.
- Das Soziale bringt schließlich das Soziale hervor. Indem sich die Individuen gesellschaftlich betätigen, stiften sie die gesellschaftlichen Zusammenhänge, auf denen die Gesellschaft beruht.
Die Soziologen leisten sich damit eine völlig verkehrte Theorie der Klassengesellschaft.
Wenn sie aus dem für sie offenbar enorm aufschlußreichen Umstand, daß an Klasse und Familie, Moral und allen möglichen sonstigen „sozialen Beziehungen“, die sie im Kapitalismus vorfinden, Individuen mitwirken – und zwar mehrere! –, die gesellschaftsstiftende Funktion dieser Veranstaltungen deduzieren, dann verwechseln sie das Mitmachen in der Klassengesellschaft mit einer Erklärung dieser Gesellschaft. Sie ersparen sich so jede wissenschaftliche Einsicht darüber, wobei die Leute mitmachen, worum es bei Staat, Wirtschaftswachstum, Recht etc. geht, und damit letztlich natürlich auch, was da wie funktioniert.
Wenn sie umgekehrt das Mitmachen der Individuen daraus ableiten, daß ihnen dafür in den segensreichen Einrichtungen der Klassengesellschaft ausgiebig Gelegenheit geboten wird, so ersetzen sie alle sachdienlichen Auskünfte über die Abhängigkeiten, die der Staat stiftet, und über die schlechten Gründe, mit denen sich die Individuen in diese Abhängigkeiten fügen, durch ein konstruiertes Menschenbild, das dem Menschen das Sich-Einfügen, auf soziologisch: „die Orientierung“, als quasi naturgegebenes Grundbedürfnis andichtet.
Dieser Zirkel – durch ihre Beteiligung am Sozialen stiften die Individuen einen gesellschaftlichen Zusammenhang, nach dem sie sich richten können – ist der Grundgedanke der Soziologie und die Methode ihrer Weltanschauung. Mit ihm verhandelt sie das Funktionieren der Klassengesellschaft so, daß sie nicht über die Klassengesellschaft, sondern über das Funktionieren redet. Auf diese Weise befördert sie das Prädikat der betrachteten Sache zum eigenständigen Subjekt. Der Funktionszusammenhang Gesellschaft, den die Soziologie thematisiert – das Soziale mit seinen Bindungskräften –, ist weder der Staat, der die Klassengesellschaft beaufsichtigt, noch sind es die ihm unterworfenen Individuen. Er ist ein funktionalistisch erdachter, hinter dem Rücken der tatsächlichen Subjekte und ihren Absichten wirkender Hebel, der die Unterordnung des Individuums unter das Kollektiv bewirkt. Die Soziologie schafft sich mit der Verselbständigung des gesellschaftlichen Zusammenhangs zum Subjekt eine konstruierte Welt, in der sie nur mehr ihr eigenes parteiliches Interesse an einer gelungenen Subsumtion des Individuums unter die höheren Anliegen der Gesellschaft in Worte faßt und das dann notdürftig als Gesellschaftstheorie kaschiert:
„Netzwerke in urbanen Ballungsräumen ergeben nicht mehr das Bild traditioneller Beziehungsmuster, sie sind keine lokal fest und dicht verbundene Solidargemeinschaften… (Sie) sind eher strukturell offen und nur lose miteinander verknüpfte Beziehungsmuster.“
Ironischerweise, das wird in solchen Einlassungen, in denen vorne, in der Mitte und am Ende des Gedankens das Soziale steht, eindrucksvoll demonstriert, haben die Vertreter der soziologischen Weltanschauung, die sich selbst völlig zutreffend Funktionalismus schimpft, zuallerletzt eine Ahnung davon, warum der kapitalistische Laden funktioniert. Aber in einem muß man dem zitierten Kenner großstädtischer Gebräuche Recht geben: Ist erst einmal alles in Bindungskräfte umgedeutet und sind nur mehr die Thema, dann ist wirklich nur noch die parteiliche Frage angebracht, ob und wie sehr sie halten.
Gesellschaftliche Probleme = soziologische Brille + politischer Standpunkt
Natürlich hält ein Fach, das alles in Bindungskräfte der Gesellschaft auflöst, um die Frage nach deren Haltbarkeit aufzuwerfen, auch alles irgendwie für prekär – überall wird die Gefahr der „Desintegration“ entdeckt. Jeder Soziologe trägt zu diesem allgemeinen, von der Sorge um das Funktionieren des Zusammenhalts getragenen Befund seinen Teil bei, indem er in der Einschätzung der Bindungskräfte zu seiner ganz speziellen Auffassung davon kommt, wo die entscheidenden gesellschaftlichen Probleme zu suchen sind. Was der einzelne für entscheidend hält, welche Bindungen ihm nicht verläßlich vorkommen und welche seiner Auffassung nach mehr Beachtung verdienen, ist ganz seiner Willkür überlassen. Rationell und sachlich läßt sich die Anwendung eines ideologischen Konstrukts auf die Realität ja auch wirklich nicht durchführen. Doch die Willkür, die sich in den verschiedenen Bildern von der Gesellschaft niederschlägt, hat auch ihre Prinzipien. Schließlich bringen die geistigen Facharbeiter ein Instrument parteilichen Denkens in Anschlag, das an ihrer Aufgeschlossenheit gegenüber dem realexistierenden politischen Zusammenhang keinen Zweifel läßt. Es sind die unterschiedlichen politischen Standpunkte, die sich mittels soziologischer Optik in die unterschiedlichen wissenschaftlichen Problemdefinitionen übersetzen. Solche Differenzen sind es, die die Gelehrten zu ihren Debatten ermuntern – in denen sie glatt so tun, als wären ihre Differenzen rein wissenschaftlich begründet. Unter diesem Schein von Wissenschaftlichkeit, der auch hält, solange sie sich einvernehmlich derselben Sache, dem Staat und seinem Gelingen verbunden wissen, ringen sie gemeinsam um die politische Ausrichtung ihrer Disziplin. Und das nicht ohne Erfolg. Sie haben das Problem der Orientierungslosigkeit jedenfalls nicht. Als politisch denkende Zeitgenossen, die den Anliegen ihres Staats und den Problemen, die er aufwirft, stets offen gegenüberstehen, vollziehen sie an ihrer Sicht der Dinge den Standpunkt der Nation und seine Konjunkturen nach. Die „Umbrüche“, die sie in der Gesellschaft feststellen, sind die konjunkturgemäßen Anpassungen, die sie an ihrem Denken vornehmen.
Kaum ruft der Staat seine Krise aus, rufen sie sich zur Ordnung. Sie nehmen selbstkritisch ihre eigenen ideologischen Erfindungen von gestern unter die Lupe; sie warnen vor einem falschen Verständnis des Verhältnisses von Individuum und Gesellschaft, dem sie womöglich in der Vergangenheit Vorschub geleistet haben; und sie sehen sich einvernehmlich zu einer bemerkenswerten Klarstellung herausgefordert: Noch nie waren die soziologischen Konstruktionen als Parteinahme für das Individuum, seine Freiheit und seine Anliegen gemeint. Stets galt ihre Sorge dem Gehorsam des Individuums und dem Problem, wie dieser Gehorsam zu gewährleisten ist.
Von den Problemen der Klassengesellschaft zu den Problemen der Individualisierung
Während in der wirklichen Welt gerade die Einkommen der Arbeiter gesenkt werden, um die Gewinnchancen der Kapitalisten zu verbessern, steht für den Soziologen Ulrich Beck aus München fest, daß die Klassengesellschaft seit längerem der Vergangenheit angehört, abgelöst durch eine „Individualisierung der Gesellschaft“, die der Soziologe als „Grundphänomen der sich entfaltenden Moderne“ zur Kenntnis bringt. Er spart es sich, für seine Auffassung groß zu argumentieren. Um zu bedeuten, daß er den durchgesetzten Stand der Wissenschaft wiedergibt, zitiert er ein paar Ahnväter seiner Disziplin, die ähnliches auch schon behauptet haben, und ist offensichtlich der Ansicht, daß es dann in Ordnung geht, Interpretationsleistungen der Soziologie als hinzunehmende Fakten auszugeben.
Was Beck unterschlägt, ist jede Auskunft darüber, wie die Klassengesellschaft ihren Abgang gemacht hat. Max Weber muß etwas damit zu tun haben, der von Beck in diesem Zusammenhang genannt wird:
„Weber spricht ironisch von der „doppelten Freiheit“ des Lohnarbeiters. Dieser ist befreit von der traditionellen Schollenbindung und vogelfrei am Arbeitsmarkt.“
Die Aussage des Begründers der Soziologie – das sei hier als Bildungselement in die Debatte eingeführt – ist die etwas abgewandelte, soziologische Fassung eines Marx-Zitats:
„Zur Verwandlung von Geld in Kapital muß der Geldbesitzer also den freien Arbeiter auf dem Warenmarkt vorfinden, frei in dem Doppelsinn, daß er als freie Person über seine Arbeitskraft als seine Ware verfügt, daß er andrerseits andre Waren nicht zu verkaufen hat, los und ledig, frei ist von allen zur Verwirklichung seiner Arbeitskraft nötigen Sachen.“ (Karl Marx: Das Kapital. Bd. 1, S. 183)
Marx weist in diesem Zitat darauf hin, daß die im Kapitalismus jedermann geläufige Existenz eines Arbeitsmarkts, auf dem sich Geldbesitzer bedienen, um durch Anwendung anderer Leute Arbeitskraft ihren Geldreichtum zu vermehren, so selbstverständlich gar nicht ist. Die Käuflichkeit der Arbeitskraft beruht auf der Existenz einer Klasse, deren Mitglieder erstens, in den Stand privater Warenbesitzer versetzt, Waren verkaufen müssen, um kaufen zu können, und zweitens, vom gesellschaftlichen Reichtum ausgeschlossen, nichts als ihre Arbeitskraft besitzen. Daß beides, die Anerkennung als Person und der Ausschluß vom gesellschaftlichen Reichtum, das Werk des bürgerlichen Staats ist, war Marx kein Rätsel. Deswegen ist ihm die Hochachtung vor der Freiheit, die die politische Gewalt im Schutz der Person und des Privateigentums gewährt, gründlich vergangen.
Den Zynismus, die Freiheit des Lohnarbeiters als Bindungsproblem zu besprechen, hat Marx nicht besessen. Weder wäre es ihm eingefallen, verschiedene Formen gesellschaftlicher Abhängigkeiten unter dem Gesichtspunkt zu vergleichen, welche das Zusammenhalten von Individuum und Gesellschaft besser gewährleistet, noch hätte er sich dafür hergegeben, den Lohnarbeitern die Empfehlung mit auf den Weg zu geben, sich für die abhanden gekommene „traditionelle Schollenbindung“ einen Ersatz zuzulegen und ihre Klassenzugehörigkeit als einen solchen Ersatz zu verstehen. Das bleibt Soziologen wie Beck überlassen, die die Klasse als eine Form kennen, „Individuen… zusammenzufassen“.
Die erste Glanzleistung der Soziologie besteht also darin, Marx’ Einsichten über Lohn und Kapital funktionalistisch umgedeutet zu haben und so die Kritik der Klassengesellschaft in eine sinnstiftende Interpretation der Klassen als soziale Einrichtungen überführt zu haben. Wenn Beck im Rückblick auf die seiner Ansicht nach vergangenen Tage der Klassengesellschaft besorgt feststellt, daß „die Menschen das, was früher als Klassenschicksal gemeinschaftlich verarbeitet wurde, nun mehr und mehr als individuelles Versagen verkraften (müssen)“, so behandelt er diese Interpretation wie ein soziales Faktum, das den Leuten zu schaffen macht. Er nimmt die Klasse gar nicht als polit-ökonomischen Gegenstand wahr, sondern muß sie für eine Art Selbsthilfegruppe halten, in der die Leute, dem bescheuerten Ratschlag aus einem Lehrbuch für psychologische Lebenshilfe folgend, Techniken des Zurechtkommens mit schlechten Erfahrungen verwirklichen – „gemeinschaftlich“, d.h. sozial und damit gesellschaftsdienlich.
Ihr in bewußt antikritischer Absicht konstruierter Begriff der Klasse als Beitrag zum Funktionieren der Gesellschaft hat die Soziologie jedoch nicht auf Dauer zufriedengestellt, und das hat diese Disziplin Abschied nehmen lassen davon, überhaupt noch von einer Klassengesellschaft sprechen zu wollen. Unter dem real existierenden Systemgegensatz zwischen Freiheit und Sozialismus hat ihr antikritischer Geist ein zweites Mal zugeschlagen und einen theoretischen Fortschritt bewirkt. Daß der Systemfeind – den die parteilich für ihr System denkenden, freien Wissenschaftler im Geiste umstandslos auch zu ihrem gemacht haben! – die westlichen Bastionen der Freiheit als Klassengesellschaften anprangerte, war für die Soziologen der Anlaß, den Begriff der Klasse ganz aus dem Verkehr zu ziehen. Die von ihnen erstellte Diagnose, daß die Klassengesellschaft der Vergangenheit angehört, verdankte sich dem Entschluß, den Versuch gar nicht erst zu unternehmen, die wahrgenommene Anklage gegen die kapitalistischen Staaten sachlich auszuräumen, sondern ihr durch Bereinigung des Vokabulars das Wasser abzugraben. Soziologen wollten plötzlich von diesem feinen Kollektiv nichts mehr wissen und sahen eine neue Zeit anbrechen, in der das emanzipierte Individuum ins Zentrum der Gesellschaft gerückt ist. Damit lagen sie voll im politischen Trend, der die Knechtung des Individuums durch den im Osten herrschenden Kollektivismus verurteilte. Ihr spezifischer Beitrag zur Klärung der ideologischen Fronten bestand darin, die politisch vorgegebenen Frontlinien als Bindungsproblem zu diskutieren. Als „Grundmerkmale einer Klassengesellschaft“ wurden nun der gesellschaftlichen Bindung eher abträgliche, „gesellschaftliche Trennlinien“ (Brock) erkannt, und zu Ehren kam der Gedanke, daß vom Individuum selbst gemachte soziale Bindungen auch und unter Umständen sogar besser halten als vorgegebene Kollektive, in die sich das Individuum einfügen muß.
Soweit die Vorleistungen, auf die sich Beck und seine Kollegen beziehen, wenn sie heute die „Individualisierung der Gesellschaft“ als existentes gesellschaftliches Problem besprechen. Beck weiß heute:
„Individualisierung bedeutet niemals Auflösung, sondern immer Verschärfung sozialer Ungleichheit.“
Der Mann mit dem herausgestellten Faible fürs Soziale hat in Deutschland gewisse „Turbulenzen der Mangelverteilung“ zur Kenntnis genommen, er macht sich Sorgen über zusätzliche Belastungen, denen die Leute ausgesetzt sind, und er kommt zielsicher zu dem Ergebnis, daß das, was sie überfordert, die „Individualisierung der Gesellschaft“ ist, die ihren Mitgliedern den „Zwang“ „zumutet“, ihr Leben nach eigenen Entscheidungen einzurichten. Die Reihenfolge seiner Gedanken, die ihn zu dieser Einsicht geführt haben, hat er sich folgendermaßen zurechtgelegt:
„Erstens öffnet sich die Einkommensschere. Zweitens werden immer mehr Gruppen – mindestens vorübergehend – von Armut und Arbeitslosigkeit betroffen. Drittens folgen diese immer weniger den sozialen Stereotypen und sind daher auch immer schwerer identifizierbar und damit als politische Kraft zu organisieren… Viertens müssen unter Individualisierungsbedingungen die Menschen das, was früher als Klassenschicksal gemeinschaftlich verarbeitet wurde, nun mehr und mehr als individuelles Versagen verkraften.“
Die wirkliche Reihenfolge seiner Gedanken geht etwas anders: Erstens stellt er sich auf den Standpunkt der Sorge um den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Zweitens bezieht er diesen Standpunkt auf die aktuelle Lage und entdeckt die Gefahr, die Leute könnten außer Kontrolle geraten, wenn sie mit den zusätzlichen Anforderungen, die die Klassengesellschaft an sie stellt, nicht mehr zurechtkommen. Er ist so frei, die Probleme, die diese Gesellschaft ihren Mitgliedern bereitet – Armut und Arbeitslosigkeit werden genannt –, als Problem der Gesellschaft mit ihren Mitgliedern zu verhandeln; diese könnten sich, mutmaßt er, zu „irrationalen Ausbrüchen der verschiedensten Art“ hinreißen lassen. Drittens kriegt er angesichts dieser Problemdefinition Zweifel an der Verläßlichkeit der Bindungsinstrumente der Gesellschaft. Wie ihn diese Zweifel auf die „Individualisierung der Gesellschaft“ führen, ist durchaus aufschlußreich dafür, was Soziologen mit diesem Stichwort meinen: Er übersetzt seine Bedenken, die Individuen könnten den an sie gerichteten – und von ihm natürlich weder beurteilten noch kritisierten – Ansprüchen nicht genügen, ganz umstandslos in eine Zustandsbeschreibung der Gesellschaft. Die vernachlässigt es, seinem Bedenken Rechnung zu tragen und die zum Funktionsproblem der Gesellschaft erhobenen Individuen „politisch zu organisieren“. Diesem komplexen Denker ist einfach selbstverständlich, daß mit den Belastungen, denen die Leute ausgesetzt werden, die Ansprüche an die politische Aufsicht über sie wachsen. Viertens reimt er sich diesen Mangel an Einbindung als die eigentliche Belastung der Individuen zusammen. Die belehrt er, daß ihr Problem nicht der Schaden ist, den der Kapitalismus ihnen bereitet, sondern die fehlende „Orientierung“, die es ihnen erlauben würde, sich als funktioneller Bestandteil der Gesellschaft zu benehmen oder wenigstens nicht störend aufzufallen.
Die Wertschätzung, die die Soziologie dem Individuum entgegenbringt, galt noch nie der freien Willensbetätigung, sondern immer schon der gesellschaftlichen Funktion, die sie dem freien Willen zuspricht. Der Streit der Gelehrten dreht sich deswegen auch ganz konsequent nur darum, ob auf ihn als Instrument der selbstvollzogenen Unterordnung Verlaß ist. Wenn Becks Kollege Heiner Keupp, ebenfalls aus München, heute das Recht des Individuums gegen die von Soziologen im Namen einer nicht näher bestimmten „Gemeinschaft“ erhobenen Ansprüche verteidigt, „die von uns bedingungslose Unterwerfung fordert, uns in einem Netz rigider sozialer Kontrollen einfängt und jeden Ansatz von Eigenständigkeit erstickt“, dann eben nicht durch Zurückweisung des politisch motivierten Anspruchs, sondern durch den Hinweis, daß „ein höheres Maß an Eigenentscheidung“ dem Zusammenhalt des Kollektivs dient:
„In den neuen Beziehungsmustern steckt ein hohes Potential an Solidarität und kommunitären Verknüpfungen.“
Er antwortet damit konstruktiv besserwisserisch auf den zeitgeistigen Trend in der Soziologie, der umgekehrt vom Standpunkt der gemeinschaftsstiftenden Funktion aus die Freiheit des Individuums kritisiert, und zwar nicht offen durch ein politisches Bekenntnis zu den Ansprüchen der Nation, die sie beschränkt, sondern soziologisch verquast durch eine Problematisierung der „Individualisierung“.
Von der Krise der traditionellen zur Krise der materiellen Kultur
Eine anderer Soziologe, Ditmar Brock aus Frankfurt, muß die Bundesrepublik mit einem Selbstbedienungsladen verwechseln:
„Wir leben in einer … materiellen Kultur. Das heißt: Wir können auf die Produkte und Dienstleistungen anderer zurückgreifen, bewegen uns in dichtgeknüpften infrastrukturellen Netzen, die uns mit Strom, Information und Unterhaltung versorgen; die globale Kommunikation oder auch eine schnelle Fortbewegung ermöglichen und vieles andere mehr.“
Wie schon Beck hält auch Brock es nicht für nötig, seine Sicht der Dinge zu begründen. Er hält es schlicht für erwiesen, daß gewisse andere „Auffassungen“ von der bürgerlichen Gesellschaft, die es auch einmal gegeben hat, „von der Realität widerlegt“ wurden. Seltsamerweise zitiert er dann doch nicht die Realität, sondern Helmut Schelsky als Urheber der neuen Lehrmeinung, der mit seiner These von der „nivellierten Mittelstandsgesellschaft“, die angeblich auf breiter Ebene Wohlstand unter die Leute bringt, in der Soziologie Furore gemacht hat. Die anderen „Auffassungen“, die damit einfach überholt waren, werden von Brock nur erwähnt, um sie beiseitelegen zu können. Die „Erziehung“ des Menschen zu einem gesellschaftlichen Wesen, schreibt er dazu,
„kann, wie bei Hobbes, über ein staatliches Gewaltmonopol erfolgen oder, wie die Gründergeneration der Soziologie immer wieder betont hat, auf dem sanfteren und zuverlässigeren Wege kultureller Integration.“
So erhält man schließlich doch ein paar Hinweise darauf, welche Interpretationsleistungen Brock hinter sich hat, wenn er die Stromversorgung mit der gesellschaftsstiftenden Funktion betraut, „Menschen in bestimmter Weise miteinander in Verbindung“ zu bringen.
Die Frage, was die bürgerliche Gesellschaft zusammenhält, wurde vor der Erfindung der Soziologie offenbar auch von bürgerlichen Denkern – z.B. von dem erwähnten Hobbes – mit dem durchaus zutreffenden Hinweis auf die staatliche Gewalt beantwortet. Daran erinnert der Soziologe Brock, um eine bahnbrechende Leistung der Gründergeneration seiner Disziplin gebührend herauszustellen: Die Leugnung des staatlich organisierten Zwangszusammenhangs, der in der Soziologie fortan Gesellschaft genannt wurde.
Schon die frühen Soziologen waren beeindruckt vom Gehorsam, den die Bürger ihrem Staat entgegenbringen. Als Anhänger eines reibungslosen Funktionierens des nationalen Kollektivs schätzten sie diese Wirkung der staatlich eingerichteten Abhängigkeiten, in denen sich die bürgerlichen Individuen bewegen, ohne die Ursache des vorgefundenen Gehorsams so recht wahrhaben und beim Namen nennen zu wollen. Aus ihrer Freude darüber, daß die Mitglieder der bürgerlichen Gesellschaft, auch ohne daß eine allgegenwärtige Polizei sie dazu anhält, in der Regel brav ihrer Arbeit nachgehen, heiraten und staatstreue Gedanken pflegen, zogen sie den interessierten Fehlschluß, daß das Mitmachen in diesem Verein nicht auf staatlichem Zwang beruht, sondern ein anderer „Weg“ der „Integration“ dahinterstecken muß. Sie konstruierten ein geistiges Band, das die Vereinsmitglieder jenseits aller Berechnungen – auch im Umgang mit der staatlichen Gewalt – eint, die Contradictio in adjecto einer ideellen Abhängigkeit, in die man hineingeboren wird, der niemand auskommt, aus der die Angehörigen der Nation ihre „Identität“ beziehen und die daher die Gesellschaft umso „zuverlässiger“ zusammenhält: Die Kultur, diese merkwürdige Agglomeration aus Dichtern und Denkern, Herkunft und Sprache, nationalen Sitten und religiösen Gebräuchen, deren gemeinsamer Nenner das Nationale ist, die aber doch nicht den materiellen Staat meint.
Nach dem letzten Krieg – „Schelsky Ende der 50er Jahre“ –, der Deutschland und mit ihm das deutsche Wesen etwas in Verruf gebracht hatte, wollten die Soziologen die Gesellschaft plötzlich nicht mehr so sehen. Sie wollten bemerkt haben, daß „die Stabilität der jungen Bundesrepublik“ auf anderen Bindungskräften beruht als auf einer gemeinsamen deutschen Kultur. Die Beziehungskiste Deutschland sahen sie nun als „Wohlstandsgesellschaft“, zusammengehalten dadurch, daß in ihr die materiellen Berechnungen der Bürger aufgehen. Das entsprach zwar schon damals nicht der Wirklichkeit, aber der Selbstdarstellung eines Staats, der sich als Kriegsverlierer bescheiden geben mußte und sich, sozusagen gezwungenermaßen und sichtlich unzufrieden damit, als Dienstleistungsbetrieb seiner Bürger präsentierte. Darauf machten sich die Soziologen ihren Reim. Hatten sie eben noch darauf beharrt, daß ein Gemeinwesen nur dann wirklich fest zusammenhält, wenn dieser Zusammenhalt nicht von den materiellen Berechnungen der Bürger abhängig, sondern in einem nationalen Geist begründet ist, der die Angehörigen der Nation zusammenschweißt und ihre Einstellung bestimmt, ergab nun die sachkundige Einschätzung der Bindungskräfte, daß auch die Zufriedenstellung „privater Motive“ eine Gesellschaft zusammenhalten kann. Daß sich der soziologische Grundgedanke dem politischen Zeitgeist anpassen ließ, gab wieder einmal beiden recht. Wie sehr dieses Einverständnis klappte, kann man daran sehen, daß die Soziologen mit dem Zustand der Gesellschaft, den sie zeichneten, ungefähr ebenso unzufrieden waren wie der Staat mit seiner Selbstdarstellung. Die „nivellierte Mittelstandsgesellschaft“ war schon zu Schelskys Zeiten eine Warnung davor, daß befriedigte individuelle Bedürfnisse keinen echten Ersatz für nationalen Gemeinschaftsgeist darstellen.
Daß es sich bei der „materiellen Kultur“, in der wir angeblich leben, um ein soziologisches Ersatzkonstrukt für die gesellschaftsstiftenden Leistungen der Kultur handelt, die ihrerseits auf soziologischen Erfindungsgeist zurückgehen, macht Brock auf seine Weise deutlich:
„Ihre Verbindlichkeit entspringt aus der Effizienz: Wir müssen (Hervorhebungen von Brock) uns ihrer Modalitäten bedienen, um private Zwecke überhaupt oder mit einem Minimum an Aufwand realisieren zu können. Die materielle Kultur legt auf technischem Wege fest, wie etwas getan werden muß, und bringt Menschen in bestimmter Weise miteinander in Verbindung.“
In nützlichen Abhängigkeiten sieht Brock den gesellschaftlichen Zusammenhang begründet. Und es ist nicht so recht zu entscheiden, ob seine Sympathie für diese Gesellschaft der Nützlichkeit ihrer Einrichtungen gilt oder den Abhängigkeiten, in denen er mit der berufsbedingten Einfalt des Soziologen „in bestimmter Weise“, d.h. irgendwie, den sozialen Zusammenhang begründet sieht. Das liegt daran, daß er beides nicht unterscheiden mag und die Abhängigkeiten, die er in der bürgerlichen Gesellschaft vorfindet, als technische Sachzwänge der Güterversorgung abhandelt. Mit den „Modalitäten“, denen sich die Bürger anbequemen müssen, um ihren Nutzen verfolgen zu können, und die ihm als bindungsstiftende Kräfte so enorm sinnvoll erscheinen, nimmt er es nicht so genau. Hätte er diese „Modalitäten“ etwas näher betrachtet, wäre er zumindest darauf gestoßen, daß das „Zurückgreifen“ „auf die Produkte und Dienstleistungen anderer“ eine Frage des Preises und der Verfügung über Geld ist, daß die Abhängigkeiten also ökonomischer und nicht technischer Natur sind. Hätte er sich über diesen ökonomischen Sachverhalt auch noch einen Gedanken erlaubt, wäre er darauf gekommen, daß durch diesen Sachverhalt die Realisierung des Nutzens an eine Bedingung geknüpft ist, an der sich die Mär von der Güterversorgung ziemlich relativiert und die auf einen ganz anderen Zweck der Ökonomie verweist: Die „Produkte und Dienstleistungen“ sind Mittel des Geschäfts und bewähren sich in dieser Eigenschaft dadurch, daß sie ihren Preis realisieren. Diejenigen, die sie ihrer nützlichen Qualitäten wegen brauchen und schätzen, erfahren diesen Umstand als den ökonomischen Sachzwang, Geld verdienen zu müssen, was auch in der heutigen „Wohlstandsgesellschaft“ für die Mehrheit bedeutet, sich für fremde Interessen nützlich zu machen. Aber das alles interessiert Brock ja nicht. Ihm genügt der Fehlschluß, daß die Bedingungen, unter denen die Mitglieder der bürgerlichen Gesellschaft ihren Nutzen verfolgen müssen, so etwas ähnliches wie Mittel sind, die irgendwie schon auch den Erfolg des materiellen Interesses gewährleisten, um bei den nützlichen Abhängigkeiten zu landen, die ihm so gefallen. Es braucht ihn auch nicht zu interessieren, wie die materiellen Interessen mit den ökonomischen Abhängigkeiten, denen die Staatsgewalt Anerkennung verschafft, tatsächlich zurechtkommen. Schließlich ist nicht das sein Problem, sondern die Verläßlichkeit des Mitmachens. Unter diesem Gesichtspunkt – also ziemlich relativ – leuchtet ihm der Nutzen der Leute als gehorsamstiftender Hebel ein. Und daß der Gehorsam tatsächlich – wenn auch aus einem ganz anderen Grund – klappt, ist für ihn der letzte Beweis, daß die Leute auf ihre Kosten kommen.
Im Lichte seiner Idee, daß nützlichen Abhängigkeiten die Gesellschaft zusammenhalten, sieht Brock heute die Lage. Auch ihm haben die wachsende Arbeitslosigkeit und die laufenden Einkommensdrückereien in Deutschland zu denken gegeben. Er sieht für einen „erheblichen Teil der Bevölkerung“ den „Zugang zu den wesentlichen Elementen der materiellen Kultur“ verwehrt und die „Grundmerkmale einer Klassengesellschaft“ erneut zutagetreten. Als soziologisch gelehrten Zyniker stört ihn daran, daß die „Integrationsgrundlage der Arbeiterschaft“ dabei flöten gehen könnte, und an diese Einschätzung der Problemlage schließt er ein bemerkenswertes Dokument dafür an, wie soziologische Prinzipientreue und politischer Opportunismus zusammenpassen:
„Die neue gesellschaftliche Trennlinie hängt mit der Verfügbarkeit über die materielle Kultur zusammen. Weil die materielle Kultur in den Industriegesellschaften zu einer universalen Lebensgrundlage geworden ist, sind die Konsequenzen so einschneidend, weil erhebliche Teile der Bevölkerung aus diesem Rahmen zwangsweise herausfallen. Weil sie zumindest teilweise ihre Identität aus den Mechanismen der Wohlstandsgesellschaft gezogen haben und gewohnt sind, ganz selbstverständlich auf verschiedene Leistungen zurückgreifen zu können, müssen sie nun lernen, ihr Leben auf Grundlagen außerhalb der materiellen Kultur umzustellen.“
Notwendig in dem Sinn ist diese Konsequenz nicht. Die Lagebestimmung, daß beträchtliche Teile der Bevölkerung vom Wohlstand ausgeschlossen sind, könnte ja auch zu einer Anklage gegen die kapitalistische Gesellschaft führen. Selbst ein Soziologe, der den Kapitalismus nur als Gesellschaft kennt, könnte von seiner Vorstellung her, daß es nützlich ist, in diesem Verein mitzumachen, und deswegen auch der Verein sein Recht hat, einmal bei der Vereinsleitung vorstellig werden, wenn der Nutzen ausbleibt. Die Einsicht, daß sich dann die Mitglieder umstellen und sich statt ihres Nutzens andere Ziele setzen müssen, damit der Verein seine Grundlage behält, hat Brock aus einer anderen Quelle als seiner Parteinahme für die Wohlstandsgesellschaft. Er hat die Zeichen der Zeit vernommen, die vom Staat gesetzt werden und die von härteren Zeiten künden, in denen so manche materielle Berechnung der Bürger durch staatliches Schröpfen und unternehmerische Kalkulationen zum Scheitern gebracht wird. Das genügt vollkommen, um Brock von seiner soziologisch motivierten Parteinahme für das materielle Interesse Abstand nehmen zu lassen. Er muß dazu nur dem soziologischen Standpunkt treu bleiben und sich Sorgen um die Bindungskräfte der Gesellschaft machen. Diese Sorge macht ihn so flexibel und konjunkturell anpassungsfähig. Wenn die Nutzenrechnungen der Leute von oben gekündigt werden, dann stellt er sich eben um und die Frage, welcher andere Hebel dann den Gehorsam gewährleistet. Die Antwort liegt für ihn auf der Hand: Wenn der Nutzen keine Orientierung mehr bietet, dann müssen die Leute „ihr Leben auf Grundlagen außerhalb der materiellen Kultur umstellen“. Von der materiellen Not, in der sich größere Teile der Bevölkerung im vereinigten Deutschland wiederfinden, läßt sich dieser soziale Denker belehren, daß letztlich doch nur ein ideeller Lohn die Gesellschaft zusammenhalten kann. Seine astreine Ableitung der höheren Werte aus der Notlage derjenigen, die an sie glauben, läßt ihn keinen Moment lang an diesen Werten zweifeln. Ihn bewegt ein ganz anderes Bedenk: Daß sich orientierungslos gelassene Individuen bei ihrer Suche nach einem ideellen Lohn vertun könnten und am Ende – statt den richtigen nationalen Rattenfängern nachzulaufen – die „Nestwärme nationaler Bewegungen“ aufsuchen.
Brock stellt damit klar, daß es Sinnfragen sind, die die Soziologie aufwirft, Fragen des ideellen Nutzens, den sich die Leute zurechtlegen sollen, um auch dann bei der Stange zu bleiben, wenn sie keinen materiellen Grund dafür haben. Als Ersatz dafür haben ihm eine Zeitlang die nützlichen Abhängigkeiten der „materielle Kultur“ eingeleuchtet. Nie war damit gemeint, das Individuum sollte sein Einverständnis mit der Gesellschaft davon abhängig machen, ob sein Nutzen in ihr aufgeht, sondern immer das Umgekehrte, daß auf dieses Einverständnis Verlaß sein muß.
Auch das begründet feine Differenzen in der Soziologie. Während die einen noch dabei sind, ihre Bindungsmechanismen konjunkturgemäß neu zu überdenken und über die Problematik eines Gehorsams zu räsonieren, der auf materiellen Berechnungen beruht, haben andere schon immer gewußt, daß eine Gesellschaft, in der „immer mehr Bürger nichts anderes suchen als ihren privaten Vorteil“, von Übel ist. Henning Ottmann aus Basel, der dieser Auffassung ist, denkt das Kollektiv mehr von der Pflicht her, die man den Leuten vorschreiben muß. Worauf auch seine Kollegen alle hinauswollen, auf ein verbindliches Pflichtenverhältnis, und wofür sie sich mit der Konstruktion von immer neuen Bindungskräften, die den Gehorsam des Individuums verbürgen sollen, geistig in die Bresche schlagen, das sieht er schlicht vernachlässigt. Wenn er die Frage aufwirft:
„Gibt es den Gemeinsinn noch? Oder ist er aus dem Bewußtsein der Deutschen entschwunden, so entschwunden wie die Begriffe Patriotismus, Gemeinschaft oder allgemeines Wohl?“ –,
dann ist das seine Antwort. Ihm muß es vorkommen, als würden seine Kollegen um den heißen Brei herumreden und mit ihren konstruierten Angeboten an die ideellen Berechnungskünste der Individuen die Sache eher verderben. Er will das berechnungslose Pflichtbewußtsein. Bei ihm wird die Soziologie wieder einfach. Außer dem Imperativ zum Dienst an Höherem bleibt ihm wenig zu sagen. Gerade daß er es noch schafft, diesen Imperativ in ein Bedürfnis nach ihm zu übersetzen. Er sieht „die Bedürfnisse des Menschen nach Zugehörigkeit und Solidarität“ auf der Strecke bleiben. Ganz ohne das Moment der Berechnung, auch wenn sie nur mehr in dem Wort Bedürfnis steckt und im Inhalt dieses Bedürfnisses sogleich geleugnet wird, kommt er also doch nicht aus. Ihm bleibt es überlassen, eine bemerkenswerte Klarstellung über die Kategorie der Orientierung und über das in dieser Kategorie definierte soziologische Menschenbild loszuwerden: Wer wie er und wie alle Soziologen die Anliegen der Individuen in das Bedürfnis nach Orientierung auflöst, der betrachtet den Menschen als eine „individualisierte Null“, als eine nichtige Existenz, die erst in der Ausrichtung auf Höheres zu einem sinnerfüllten Dasein gelangt. So faschistisch denken Soziologen, wenn kein faschistischer Staat ihre Disziplin verbietet.
Von der Gefährdung der Wertegemeinschaft zur Gefährdung der demokratischen Streitkultur
Was die Soziologen aneinandergeraten läßt, ist nicht der Gegensatz von Pflicht und Neigung, von berechnungslosem Gehorsam und berechnenden Vorteilsüberlegungen, auch wenn sie in ihren Debatten zuweilen so tun, als hätte die Gegenposition gerade „jeden Ansatz von Eigenständigkeit erstickt“ bzw. umgekehrt einen Aufruf zum Materialismus gestartet. Das kann deswegen nicht gut sein, weil die eine Position, die zur Prüfung der Nützlichkeit der Gesellschaft und ihrer Einrichtungen ermuntert, bei Soziologen nicht vertreten ist, und alle auf der anderen Seite stehen, die vor so einer Prüfung warnt. Sie alle sind Parteigänger der ideellen Werte, in deren Namen sie die Leute auf den Staat verpflichtet sehen wollen. Ihr Streit dreht sich um die höhere Frage, wie die Verbindlichkeit dieser Werte herzustellen ist.
Wenn Ottmann an den Konstruktionen seiner Kollegen den Imperativ zu mehr Gemeinsinn und Patriotismus vermißt, so hält er ihnen den Zweck entgegen, den sie in der Erfindung immer neuer Bindungsmechanismen verfolgen. Sie verfolgen ihn deswegen so, weil sie dem Ideal eines absolut verläßlichen Gehorsams anhängen: So richtig verläßlich wäre der Gehorsam für sie erst, wenn er ein Produkt der Gesellschaft und ihrer Bindungskräfte wäre. Sie treibt der Wunsch nach einer Gesellschaft, die über Hebel und Wege verfügt, das Individuum dahin zu bringen, seine Verpflichtung auf die Gemeinschaft aus freien Stücken und vollen Herzens zu wollen. Daß Ottmann die ganze Durchführung dieses Gedankens nicht paßt, weil er in der soziologischen Funktionalisierung der Freiheit des Individuums und seiner Berechnungen die gegen den individuellen Willen gültige Pflicht nicht wiederentdeckt, hat etwas Unsoziologisches an sich.
Vom Institut für Sozialforschung an der Universität Frankfurt kommt deswegen die in diesem Expertenstreit fällge Zurückweisung. Helmut Dubiel, der sich lässig dem Problem der „Auszehrung verbindlicher Werte“ anschließen kann, ist der Auffassung, daß es sich Leute wie Ottmann mit der Formulierung von Imperativen zu einfach machen. Er belehrt sie wie folgt über den Nutzen soziologischen Denkens:
„Die öffentliche Klage über die Schwindsucht der Werte und der vielstimmige Ruf nach der Stiftung neuer, ist von seltsamer Naivität. Wenn öffentliche Mittel knapp werden, kann der Staat Kredit nehmen. Wenn die öffentliche Moral knapp wird, ist das schwierig. Werte sind ein eigentümlicher Stoff: Sie lassen sich weder stehlen, noch übertragen, noch kreditieren. Und Lebenssinn und Gemeinschaftsverpflichtungen lassen sich auch nicht administrativ verordnen…“
Mit der Verordnung von Gemeinschaftsverpflichtungen ist es nicht getan, meint dieser freundliche Sozialforscher – solange jedenfalls nicht, solange nicht auch gewährleistet ist, daß sich die Individuen daran halten. Und wie das zu gewährleisten ist, darüber eben macht sich die Soziologie ihre Gedanken. Z.B. den:
„Aus dem unmittelbaren Lebenszusammenhang ist uns die Erfahrung vertraut, daß die einzig zuverlässigen Stützen des sozialen Zusammenhangs solche sind, die sich im Zuge ausgehaltener Differenzen und durchgestandener Konflikte erst gebildet haben. Eine solche „Kultur des Konflikts“ (Marcel Gauchet) bezeichnet auch die Integrationsweise moderner Demokratien… Als demokratische erhält sich unsere Gesellschaft eben nicht dadurch, daß alle konfligierenden Gruppen ihre Interessen einem imaginären Wertekonsensus aufopfern. Vielmehr bildet sie das sie zusammenhaltende werthafte Band erst im Prozeß solcher Konfrontationen aus.“
Der Vergleich, den Dubiel zieht, um herauszustellen, was ihm an der Demokratie so einleuchtet, handelt nicht von dem Gegensatz zwischen Aufopfern und Anmelden von Interessen, sondern von alternativen Techniken der Aufopferung individueller Interessen für die höheren Werte des Kollektivs. Man kann ihm nicht zum Vorwurf machen, Illusionen über die demokratische Streitkultur als eine Spielwiese für eine bunte Vielfalt verschiedenartiger Auffassungen, Standpunkte und Interessen zu befördern. Mit diesen Illusionen räumt er gerade auf. Ihm gefällt an der Demokratie, daß die Individuen, mit entgegengesetzten Interessen konfrontiert, zur Relativierung ihres Interesses gezwungen sind. Er schreibt dieses Ergebnis einer „Kultur des Konflikts“ zu und leugnet damit die Quelle des Zwangs, dem sich die Individuen beugen müssen. Daß der Konflikt die von Dubiel so geschätzten konsensbildenden Wirkungen zeitigt, ist nämlich weniger ihm geschuldet als der Gewalt des Staates, der die Individuen dazu anhält, ihre Interessensgegensätze gerade nicht auszutragen, und sie dazu zwingt, ihnen schädliche Interessen praktisch anzuerkennen. Dies einmal beiseitegelassen bzw. als selbstverständlich unterstellt – da macht es sich immer gut, ein wenig über Erfahrungen, die das Leben bereithält, zu räsonieren –, erscheint es fast so, als würden die Individuen nur der Einsicht in die Notwendigkeit folgen, wenn sie ihr Interesse aufgeben. Diesem Soziologen hat es das Ideal eines aus eigener Einsicht vollzogenen und darum umso verläßlicheren Gehorsam angetan. Vom Standpunkt dieses höheren Anspruchs an den Gehorsam – bloßes Mitmachertum verachtet dieser Verehrer selbstbewußter Untertanen sicher – begeistert er sich für die Vorstellung eines „werthaften Bandes“, das den Staat zusammenhält und zu dem sich die Individuen in ihren Konflikten selbst durchringen. Und vom selben Standpunkt aus kommt ihm ein „imaginärer Wertekonsensus“, der den Leuten nur vorgeschrieben und von ihnen gar nicht wirklich geteilt wird, als eine gar nicht zufriedenstellende Angelegenheit vor.
Die Soziologie problematisiert sich selbst
Wenn die Soziologie die Nation als Gesellschaft abhandelt, wendet sie sich der Konstruktion eines Ideals zu. Sie malt den Wunsch aus, die Gesellschaft möge gerade nicht bloß erzwungenermaßen, sondern aus sich heraus in den Individuen die Verpflichtung auf das nationale Kollektiv erzeugen.
Wenn dann ein Soziologe mit der Einsicht aufwartet, daß die Gesellschaft eine Nation ist, und seiner Zunft den Vorwurf macht, diesem Faktum die ihm gebührende Anerkennung zu versagen, dann steht einer Schließung der Fakultät theoretisch nichts mehr im Wege.
Karl Otto Hondrich aus Frankfurt vertritt in einem Artikel für „Die Zeit“ („Wovon wir nichts wissen wollten“) die Auffassung,
„daß gerade die moderne Gesellschaft dem Individuum über seine funktionalen Verflechtungen hinweg, auch Ganzheitsbindungen wie Nation oder Ethnie anbieten müsse“.
Und von diesem völkisch-nationalen Standpunkt aus kommt er zu einer Kritik an den Konstruktionen seiner Kollegen, die umfassender kaum sein kann:
Von einer „unnachsichtigen Modernitätstheorie werden ethnische Gemeinschaftsgefühle zum Absterben verurteilt.“… Ihr zufolge entfallen „für den Typus tatsächlich funktional differenzierter, nun endgültig moderner Gesellschaften die objektiven Grundlagen für dauerhafte ethnische Vergemeinschaftung und systematische ethnische Mobilisierung letztendlich… Das Individuum, das mit seinen Wahlmöglichkeiten schon den alten Klassen- und Milieubindungen den Garaus gemacht hat, bemeistert auch alle anderen kollektivistischen Ansinnen und wird alleiniger Gestalter und Dirigent seiner individuellen Identität.“
Mit seinem Wahn, die Soziologen hätten mit ihren Theorien die Gesellschaft in eine Krise gestürzt, belegt Hondrich eindrucksvoll, daß für Soziologen die Gesellschaft eine Gesinnungsfrage ist und daß sie sich für die Pflege der nationalen Gesinnung zuständig wissen. Er wirft den Soziologen vor, vor ihrer Aufgabe versagt und den nationalen Geist untergraben zu haben. Dabei weiß er ganz gut, wie abseitig dieser Vorwurf ist. Schließlich bringt er das Nationale, dem er in der Soziologie mehr Gehör verschaffen will, selbst als Zusammenfassung all der „funktionalen Verflechtungen“ ins Gespräch, die seine Kollegen erfunden haben. Ihm kann deswegen auch nicht entgangen sein, daß er mit seiner Warnung vor der Gefahr der Zersetzung des nationalen Kollektivs durch die Freiheit des Individuums in der Soziologie nicht ganz einsam dasteht. In Wirklichkeit bilanziert er nur – und zwar völlig korrekt – die Ergebnisse einer Disziplin, die ihre eigenen, zu Gesellschaftsdiagnosen aufgeblasenen Sinnkonstruktionen selbstbewußt als ideologische Instrumente des nationalen Standpunkts einführt, problematisiert und zuweilen auch wieder verwirft. Der komplexe Unsinn, der herauskommt, wenn Soziologen an ihren eigenen Sinnangeboten ans Individuum von der höheren Warte des Kollektivs aus herumproblematisieren, wenn sie gute Gründe fürs Mitmachen anbieten und zugleich den Glauben an diese guten Gründe als eine allzu problematische Grundlage des Gehorsams verhandeln, wenn sie also davor warnen, ihre affirmativen Lügen für die Sache zu nehmen, um die es ihnen geht, zielt selbst auf das abstrakte Bekenntnis zum Staat, das Hondrich vermißt. Er wird schon Recht haben, daß der Gehorsam gegenüber der Nation keine besseren Gründe hat und deswegen letzlich alles Nachdenken über sie den Gehorsam untergräbt.