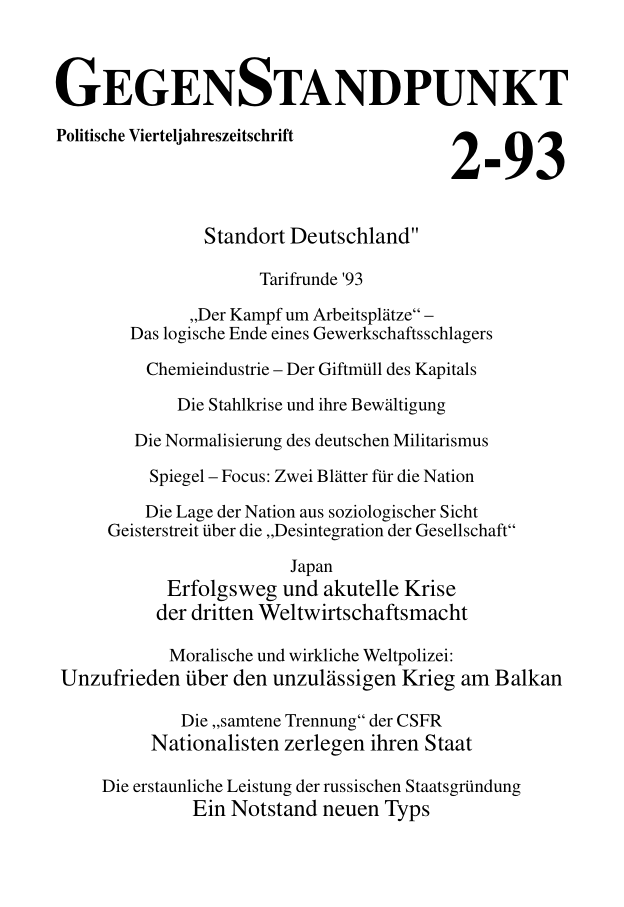„Der Kampf um Arbeitsplätze“
Logisches Ende eines Gewerkschaftsschlagers
Der gewerkschaftliche „Kampf um Arbeitsplätze“ feiert einen Erfolg nach dem anderen: Massenentlassungen gehen über die Bühne – weil unvermeidlich, dafür sozial abgewickelt; der Kampf um die 35-Stunden-Woche – der Einsatz der Arbeiter wird rechnerisch verkürzt, zugleich flexibler und intensiver; Rheinhausen wird gerettet – mit Massenentlassungen; im Osten Massenentlassungen, aber mit sozialstaatlicher Ersatzbeschäftigung; und die Unternehmer werden aufgefordert, mehr für den Standort zu tun – Wirtschaftsimperialismus als Beschäftigungsprogramm.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Siehe auch
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
- 1. „Kampf gegen Massenentlassungen“ – unvermeidliche Arbeitsplatzverluste plus soziale Abwicklung
- 2. „Kampf für die 35-Stunden-Woche“ – ein Jahrhundertbeschäftigungsprogramm in gesamtgesellschaftlicher Verantwortung
- 3. Der Kampf um Rheinhausen – mit Entlassungen den regionalen Standort retten
- 4. Der unterlassene Kampf im Osten – statt verdeckter Arbeitsloser offene Massenentlassungen mit sozialstaatlicher Ersatzbeschäftigung
- 5. Kampf um den „Standort Deutschland“ – Wirtschaftsimperialismus als Beschäftigungsprogramm
Standort Deutschland:
„Der Kampf um
Arbeitsplätze“
Das logische Ende eines
Gewerkschaftsschlagers
Lange Zeit hat sich die Gewerkschaft programmatisch für den „Kampf um Arbeitsplätze“ stark gemacht. Vor einigen Jahren hat sie den Fortbestand des Stahlwerks Rheinhausen als Höhepunkt gewerkschaftlichen Einsatzes gefeiert. Heute, wo im Osten Deutschlands eine ganze Industrielandschaft brachgelegt wird, wo im Westen bei Stahl und anderswo Werksstillegungen beschlossen und rücksichtslos Arbeitermassen ausgestellt werden, wo auch das Vorzeigeobjekt Rheinhausen zugemacht wird – heute verkündet IG Metall-Chef Steinkühler:
„Natürlich sind wir ratlos angesichts der Situation. Wir haben im Moment nichts anzubieten.“
Das ist ein Fortschritt, der ganz in der Logik des gewerkschaftlichen „Kampfs um Arbeitsplätze“ liegt.
1. „Kampf gegen Massenentlassungen“ – unvermeidliche Arbeitsplatzverluste plus soziale Abwicklung
Irgendwann wurde auch im Wirtschaftswunderland Deutschland unübersehbar, daß das gepriesene Wirtschaftswachstum nicht die Beschäftigung aller garantiert, sondern mit laufenden Ausstellungen von Arbeitern und dauerhafter Arbeitslosigkeit einhergeht. Seitdem hat die Gewerkschaft ihre Leute bei größeren Entlassungsaktionen zum Protest antreten lassen. Gewerkschaftler und Betriebsräte haben sich gegen „Massenentlassungen“ gewandt – und am Ende regelmäßig dem geschäftlich notwendigen Stellenabbau zugestimmt. Die Verringerung der Belegschaften wurde mit Sozialplänen, Abfindungen, Vorruhestand und Umsetzungen abgewickelt. Das hat die Arbeitervertretung ebenso regelmäßig als Erfolg gefeiert.
Mit ihren Protestaktionen greift die Gewerkschaft die Entrüstung der vom Arbeitsplatzverlust Bedrohten auf und organisiert sie, ohne sie wirklich zu teilen. Deren Beschwerde, sie hätten dem Unternehmen jahrelang zur Verfügung gestanden und würden jetzt zum Dank dafür auf die Straße gesetzt, zeugt von Unverständnis für die Eigentümlichkeiten des Abhängigkeitsverhältnisses, in das sie mit ihrer Beschäftigung gestellt sind. Der Anspruch, das Arbeitsvermögen würde mit seinem Einsatz für das Unternehmen eigentlich auch einen Rechtsanspruch auf weitere Anstellung erwerben, gegen den sich der Betrieb vergeht, paßt ja gar nicht zu den Beschäftigungsmethoden und Maßstäben, nach denen ihre Arbeit eingerichtet, benutzt oder auch auf sie verzichtet wird. Ein Arbeitsplatz ist keine Pfründe, die ein Arbeiter erwerben und durch seinen Einsatz behaupten und sichern könnte, sondern das Mittel kapitalistischer Betriebe, einen für sie lohnenden Einsatz von Arbeitern zu organisieren. Er repräsentiert die wechselnden Leistungsanforderungen, die von den Besitzern der Produktionsmittel an Arbeitskräfte gestellt werden und an denen die sich zu bewähren haben. Wo diese Abhängigkeit von den Gewinnkalkulationen der Unternehmen nicht gekündigt wird, wo der „Arbeitnehmer“ darauf setzt, „seinen“ Arbeitsplatz auszufüllen, da sind und bleiben Arbeiter Manövriermasse, Objekte und Leidtragende der unternehmerischen Entscheidungen über die kostengünstigste Einrichtung der Produktion.
Das verständnislose und ohnmächtige Gejammer der Betroffenen benutzt die Gewerkschaft, sie vertritt es aber nicht. Sie übersetzt es in den Anspruch, bei den Entlassungen noch ein bißchen Berücksichtigung zu finden. Sie teilt nämlich – und macht daraus auch gar keinen Hehl – grundsätzlich die Auffassung der Gegenseite, daß an den betriebswirtschaftlichen Rechnungen kein Weg vorbeiführt. Dem moralischen Recht auf Arbeit, auf das sich die Lohnabhängigen berufen und das auch die Gewerkschaft unentwegt im Munde führt, stellt sie die „Vernunft“ entgegen, daß an den unverrückbaren Notwendigkeiten betrieblicher Kalkulationen – „leider, leider!“ – nicht zu rütteln ist. Der Anspruch auf einen gesicherten Arbeitsplatz mag noch so berechtigt sein, er bleibt ein frommer Wunsch: denn ohne daß sich Arbeit für ihre Anwender lohnt, gibt es keine Arbeitsplätze. Die Organisatoren der Betroffenheit stellen sich also bei ihrem „Kampf um Arbeitsplätze“ erst einmal voll und ganz hinter die Abhängigkeitsverhältnisse, in die Lohnarbeiter gestellt sind. Der Protest, zu dem sie, wenn schon längst alles abgehakt ist, die Belegschaften antreten lassen, richtet sich gar nicht gegen den Stellenabbau, sondern nur dagegen, daß diejenigen, die nun einmal ihren Arbeitsplatz verlieren müssen, umstandslos ins Arbeitslosendasein gestürzt werden. Den betriebswirtschaftlichen Realismus ergänzt die Arbeitervertretung um den Standpunkt der sozialen Sorge: Die Betroffenen haben ein Anrecht auf Kompensation. Das schließt selbstverständlich gehörige Abstriche ein; aber die nackte Arbeitslosigkeit soll möglichst vermieden, der Übergang zumindest finanziell ein bißchen ausgepolstert werden. Dementsprechend verkauft sie die Umstände, unter denen die Stellenstreichungen schließlich vonstatten gehen – Einstellungsstopp, Frühverrentung, Umsetzungen auf andere Arbeitsplätze, Abfindungen – als ihren Erfolg. „Das Schlimmste“ konnte weitgehend verhindert werden. Wodurch, verschweigen die gewerkschaftlichen Sozialanwälte, die sich offenbar auch Entlassungen ohne alle sozialstaatlichen Umstände vorstellen können, geflissentlich: durch Arbeitslose an anderer Stelle, durch vorgezogenes, also mit Rentenminderung verbundenes Ausscheiden aus dem Arbeitsleben; und durch Entschädigungen, die keine sind. Entschädigt worden ist höchstens die Gewerkschaft: Sie hat sich als Mitgestalter der sozialen Folgen profiliert, als Mitverwalter der Beschäftigungsopfer.
Als solcher unterschreibt sie aber auch nicht umstandslos die fälligen Entlassungen, wenn sie über ein bestimmtes Ausmaß hinausgehen: „Massen“entlassungen sollen nicht unwidersprochen über die Bühne gehen. Deshalb überprüfen die Betriebsräte demonstrativ deren Berechtigung nach geschäftlichen Gesichtspunkten – und liefern dabei Beweise ihrer rückhaltlosen Einsicht in die „Sachzwänge“ des Geschäfts. Von diesem Standpunkt aus üben sie sogar Kritik: In solchen eklatanten Fällen muß etwas schief gelaufen sein; wo massenhaft Arbeitsplätze gestrichen werden, da hat es an der Fähigkeit oder am Willen der Unternehmer gefehlt, ihren Betrieb so zu führen, daß ausreichend Arbeiter gebraucht werden; da liegt nach gewerkschaftlicher Auskunft ein Fall von „Mißmanagement“ vor. Wo die Unternehmer mit Entlassungen ihr Kapitalwachstum befördern, wirft die Arbeitervertretung ihnen dieses normale Geschäftsgebaren also als Fehler vor. Mit dieser Kritik schließt sie sich der unternehmerischen Lüge an, wo entlassen wird, sei eine Geschäftsrechnung nicht aufgegangen. Und sie unterschreibt damit auch gleich die Fortsetzung, daß wegen der unternehmerischen Notlage die Streichung von Arbeitsplätzen und die Steigerung des Ertrags aus der Anwendung der verbliebenen Arbeitskräfte unausweichlich sei: Was die Unternehmer versäumt hätten, das müßten die Arbeiter jetzt ausbaden; Entlassungen wären kein normales Mittel des Geschäfts, sondern zu seiner „Rettung“ immer nur „ausnahmsweise“ unerläßlich – damit sind sie allerdings endgültig unwidersprechlich. Und wenn man sie richtig, nämlich mit den Augen der Gewerkschaft unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten sieht, haben sie sogar ihr Gutes: Dadurch, daß die einen Arbeitsplätze gestrichen worden sind, sind die anderen – „gerettet“ worden.- Bei der nächsten Entlassungswelle wiederholt sich die Prozedur.
So gibt der gewerkschaftliche Protest den Entlassungsopfern moralisch recht, den Unternehmern in der Sache. Dafür, daß beides übereinstimmt, sieht die Arbeitervertretung nur eine Chance: Betriebserfolg und gesamtwirtschaftliches Wachstum – also genau den kapitalistischen Fortschritt, dessen immer anspruchsvollere Maßstäbe dafür sorgen, daß mit immer weniger Arbeit immer mehr Kapital in Bewegung gesetzt wird. Kämpferisch vertritt sie die Hoffnung, das Wachstum möge so vorankommen, daß – nach Möglichkeit – der Bedarf nach Arbeitskräften steigt. So machen Gewerkschaftler Arbeiter praktisch damit vertraut, daß der Erhalt von Arbeitsplätzen nichts ist, worum sich kämpfen läßt.
2. „Kampf für die 35-Stunden-Woche“ – ein Jahrhundertbeschäftigungsprogramm in gesamtgesellschaftlicher Verantwortung
Die Arbeitslosigkeit hat in der BRD in dem Maße zugenommen, wie die Methoden der relativen Mehrwertproduktion – mit weniger Arbeit mehr Ware – gewirkt haben und die Freisetzung von Arbeitskräften nicht mehr wie in der Sonderkonjunktur nach dem Krieg durch eine überproportionale absolute Ausweitung des Geschäfts kompensiert worden ist. Angesichts einer bleibend hohen Arbeitslosenzahl hat die Gewerkschaft Kampagnen für eine generelle Verkürzung der Arbeitszeit eröffnet mit dem Ziel, den Personalbedarf der Unternehmen zu erhöhen. Erreicht hat sie damit, daß der Einsatz der Arbeitskräfte rechnerisch verkürzt wurde, zugleich aber flexibler und intensiver geworden ist – also noch eine Methode, den relativen Mehrwert zu steigern. Daneben hat sie von Unternehmern und Staat beschäftigungspolitische Initiativen verlangt. Das hat sie als Jahrhunderterfolg im Kampf um Arbeitsplätze gefeiert.
Angesichts des „Skandals“ von mehr als 2 Millionen Arbeitslosen sind die Gewerkschaften radikal geworden. Nicht, daß sie sich die Alternative Unterwerfung oder Kündigung des Lohnabhängigkeitsverhältnisses vorgelegt hätten. Sie kennen einen dritten Weg zwischen Unterwerfung und Kündigung – die Ausgestaltung des Abhängigkeitsverhältnisses unter Beschäftigungsgesichtspunkten. In diesem Sinne sind sie radikal geworden mit dem kämpferischen Anspruch, diese Aufgabe nicht allein den Wachstumsfortschritten der Unternehmer zu überlassen. Zur gewerkschaftlichen Vernunft in betriebswirtschaftlichen Dingen gesellt sich die Verantwortung fürs große Ganze, weil der Schaden in den Augen der Gewerkschaft über die Opfer, die sie betreut, weit hinausreicht. Der Geschädigte der um sich greifenden Arbeitslosigkeit ist das Gemeinwesen selbst: Statt daß Beschäftigte der Nation mit ihren diversen Diensten nützen, belasten sie als Beschäftigungslose den Staat; brauchbare Potenzen der Nation liegen dauerhaft brach und sind ein Minusposten in ihren Haushaltsrechnungen; und bei einem wachsenden Arbeitslosenheer ist die Demokratie in Gefahr – siehe Hitler! Die Gewerkschaft denkt bei den Arbeitslosen also nicht an die Probleme, die die Opfer haben; sie argumentiert mit den Problemen, die sie dem Gemeinwesen bereiten oder bereiten könnten. Ein Beweis dafür, daß sie sich um die Opfer der Konjunkturen des Kapitals ausschließlich aus frei gewählter Verantwortung für den sozialen Frieden kümmert.
Den Grund für die massenhafte Arbeitslosigkeit sah die Gewerkschaft in generellen Schwierigkeiten der „Arbeitgeber“, für ausreichend Beschäftigung zu sorgen. Bei dieser Diagnose unterstellte sie stillschweigend, daß mit fortschreitender Rationalisierung ein Arbeitsplatz wachsende Gewinnansprüche repräsentiert und folglich immer weniger Arbeiter immer mehr Kapital in Bewegung setzen. Interpretiert hat sie es umgekehrt: Als Beweis, welchen gewaltigen Aufwand es erfordert, einen Arbeitsplatz zu schaffen. Von daher hat sie es dann sehr verständlich gefunden, wie schwer sich Kapitalisten tun, soviel Wachstum auf die Beine zu stellen, daß Arbeitsplätze erhalten bleiben und vielleicht sogar neue rentable dabei herausspringen. Sie sah sich als Gewerkschaft gefordert, sich dieses gesamtgesellschaftlichen Problems mit anzunehmen.
Ihr Lösungsbeitrag bestand darin, ihren betriebswirtschaftlichen Realismus mit einem volkswirtschaftlichen Idealismus zu verknüpfen: Wenn die Unternehmer ihren Gewinn aus immer weniger Arbeitern herausholen, dann ist Arbeit für die Lohnarbeiter ein „knappes Gut“; und damit es einigermaßen reicht, muß es gesamtgesellschaftlich neu „verteilt“ werden. Die Kapitalisten geben mit ihren Gewinnkalkulationen vor, wieviele Arbeiter sie anwenden. Die Gewerkschaft rechnet das zum vorhandenen gesamtgesellschaftlichen Bedarf an Beschäftigung hoch und behandelt so die kapitalistische Anwendung der Lohnarbeiterklasse wie einen feststehenden Arbeitsfonds, der einfach nicht für alle reicht und deswegen sorgfältig gemanagt werden muß. Und weil das sonst niemand tut, engagiert sich hier die Gewerkschaft mit kämpferischer Politik Um eine bessere Aufteilung der Arbeitskräfte auf den vorhandenen Topf an Arbeitsmöglichkeiten in den einzelnen Branchen und in der ganzen Gesellschaft zu erreichen, kämpften der DGB und seine Untergewerkschaften für eine „Verkürzung der Arbeitszeit“, die die Unternehmer zur Einstellung zusätzlicher Arbeitskräfte bewegen sollte.
Übersehen haben die Anführer dieses „Jahrhundert“programms in Sachen Arbeitszeit den Unterschied zwischen einer gesamtgesellschaftlichen Aufteilung eines fiktiven Beschäftigungstopfes auf eine Masse von Anwärtern und der tatsächlichen Anwendung von Lohnarbeitern gemäß den Geschäftsbedürfnissen dabei allerdings nicht. Bei ihren Arbeitszeitforderungen haben sie auf die Gewinnansprüche der Unternehmer Rücksicht genommen und sie mit Angeboten versehen, den Preis der Arbeit und die Verfügbarkeit der Beschäftigten fürs Kapital günstiger zu gestalten. Das Ergebnis ihres „Kampfes für die 35-Stunden-Woche“ war deshalb auch keine Arbeitszeitverkürzung, die den Beschäftigten Mühen erspart, sondern die Verwandlung der individuellen Arbeitszeit in eine rechnerische Größe. Die ging einher mit Lohnopfern, vor allem aber einer weiteren Auflösung der Festigkeit des Arbeitstages und einer besseren Verfügbarkeit der Belegschaften für die Auslastung der Maschinerie und für wechselnde betriebliche Arbeitsanforderungen. Im Namen der „Solidarität mit den Arbeitslosen“ wurde so das Bedürfnis des Kapitals nach einer Ausdehnung und Verdichtung der gesamtbetrieblichen Arbeitszeit bedient – also keine Arbeit auf mehr Anwärter verteilt, sondern im Gegenteil die bestehende einträglicher und die Arbeitsmannschaft flexibler gemacht. Die neuen Arbeitsplätze existierten bloß in der gewerkschaftlichen Propaganda und ihren Anträgen an Unternehmer und Politik, mehr für Beschäftigungsgelegenheiten zu unternehmen. So bewies die Gewerkschaft mit ihrer Kampagne, daß auch die Schaffung von Arbeitsplätzen nichts ist, wofür sich kämpfen läßt.
3. Der Kampf um Rheinhausen – mit Entlassungen den regionalen Standort retten
Der Vergleich lohnender Kapitalstandorte und Geschäftssphären führt unvermeidlich auch zu größeren Stillegungsaktionen. In der BRD wurden unter anderem Kohle- und Stahlbetriebe aufgegeben, weil und damit das Geschäft woanders besser lief. Dagegen protestierten die betroffenen Belegschaften unter Leitung der Gewerkschaft. „Rheinhausen“ wurde zum Symbol dieses Kampfes für den „Erhalt eines Standorts“. Das Ergebnis fiel weniger spektakulär aus: Die Gewerkschaft hat den radikalen Abbau von tausenden Arbeitsplätzen mitgetragen und dafür das vage Versprechen erhalten, über die endgültige Schließung würde später entschieden und Unternehmer und Politik würden für neue Arbeitsplätze sorgen, soweit es geht. Das war in ihren Augen ein großartiger Erfolg.
Im Fall Rheinhausen hat die Gewerkschaft den Protest der Belegschaft gar nicht angezettelt und schon gar nicht deren Beschwerde geteilt, man könne „ihren“ Betrieb, immerhin ein Stück einer wichtigen nationalen Industrie, doch nicht einfach zumachen und sie auf die Straße setzen. Sie hat den Glauben, es müßte höhere Interessen geben, die für den Erhalt der Arbeitsplätze sprechen, aufgegriffen, um gleich nur noch für solche höheren Gesichtspunkte Partei zu ergreifen. Gegen die betriebswirtschaftliche Rechnung stellte sie eine volkswirtschaftliche Gesamtrechnung. Eine ganze Region war in ihren Augen der Geschädigte: die Wirtschaftskraft des Ruhrgebiets, die Steuereinnahmen der Kommunen, Zulieferer, Einzelhandel… Daß das ganze Leben in diesem Land auf die Vermehrung des kapitalistischen Reichtums ausgerichtet ist, scheint der Gewerkschaft selbstverständlich, so daß sie den kleinen Unterschied zwischen vom Lohnverlust bedrohten Arbeitern, Geschäftsleuten, denen Kunden verloren gehen, Stadt- und Landespolitikern, die in der Konkurrenz um finanzkräftige Unternehmensansiedlungen und Steuereinnahmen ins Hintertreffen geraten, geflissentlich übersieht: Der Einsatz der Arbeitskraft für die Vermehrung des Profits, das Geschäft mit der Nachfrage des Konzerns und dem Lohn der Massen, die politische Teilhabe am wachsenden Geschäft – das alles wird unter dem Titel „Standort“ in eine Gemeinschaft von Betroffenen eingereiht. Die Gewerkschaft kennt eben noch eine höhere Zweckbestimmung des Wachstums als „Beschäftigung“: Das florierende Geschäft ist die Lebensquelle der Nation im Kleinen wie im Großen. Als solche soll es vor Ort erhalten bleiben.
Damit landet sie wieder bei der Einsicht, daß ohne Berücksichtigung der „kurzfristigen“ Profitinteressen die volkswirtschaftliche Rechnung nie und nimmer aufgehen kann. Ohne genügend Gewinnaussichten kann das Kapital seinen Dienst an der Region nicht erfüllen. Also müssen die gewährleistet werden. Die Demonstrationen in und rund um Rheinhausen bekundeten daher das Angebot, dem unternehmerischen Verlangen nach Massenentlassungen und anspruchsvolleren Leistungsstandards am Arbeitsplatz nachzukommen, wenn nur ein Stück regionaler Wirtschaftstätigkeit erhalten bliebe. Andererseits dienten sie der Bittstellerei an die Adresse der Politiker. Die sollten sich dafür stark machen, ein Geschäft zu retten, an dem das Kapital kein dringliches Interesse mehr hatte. So kam es, daß Arbeiter, Bevölkerung und regionale Öffentlichkeit gemeinsam in Düsseldorf und Bonn vorstellig geworden sind, die dortigen Verantwortlichen sollten in ihrem eigenen Interesse das Unternehmen mit politischen Sonderangeboten, Subventionen und Einfluß zur Revision seiner Standortentscheidung bewegen. Daß das den negativen Bescheid an anderer Stelle bedeutete, haben zwar alle gewußt, aber tunlichst verschwiegen. Ihnen ging es ja um „ihre“ Region. Die letzte Entscheidung war damit an die vergleichenden Konzernberechnungen zurückverwiesen. Daß mit einigen tausend Stellenstreichungen ein Reststandort für einige Jahre weiterproduziert hat, verdankt sich bloß dem Zufall, daß die vorgesehene Endabwicklung wegen des einsetzenden Geschäftsbooms um einige Jahre verschoben wurde.
Wegen ihrer Sorgen um die Region, in der ohnehin nach dem Geschmack der Gewerkschaft zu wenig Wirtschaftswachstum stattfindet, wurden neue Ansprüche an die Abwicklung des Unvermeidlichen gestellt: Der Standort sollte geschäftlich entschädigt werden. Deswegen hat die Gewerkschaft auf künftige Standortentscheidungen Einfluß nehmen und Kapital und Politik darauf verpflichten wollen, für „Ersatzarbeitsplätze“ vor Ort zu sorgen. Mit dem Erfolg, daß sie den Unternehmern das billige Versprechen abgerungen hat, bei ihren künftigen Standortüberlegungen die regionale Notlage zu berücksichtigen, und daß die politisch Verantwortlichen ihren Willen bekundet haben, neue Industriebetriebe anzulocken. Diese Überantwortung des Beschäftigungsinteresses an die geschäftliche und politische Standortkonkurrenz hat also Kapital und Politik zu nichts verpflichtet, was sie nicht sowieso gewollt haben. Krupp hat bis heute keinen neuen Arbeitsplatz geschaffen, und die Stadt Duisburg hat ein Industriegelände erschlossen, das es als Standortvorteil Kapitalisten zur Benutzung anbietet. Das regionale Wirtschaftsleben ist eben auch nichts, wofür sich kämpfen läßt.
4. Der unterlassene Kampf im Osten – statt verdeckter Arbeitsloser offene Massenentlassungen mit sozialstaatlicher Ersatzbeschäftigung
Nach der „Wiedervereinigung“ wurde in Deutschland ein ganzes Industrieland geschäftlich für untauglich befunden und weitgehend brachgelegt, ein bisher werktätiges Volk mehrheitlich der Reservearmee zugeschlagen. Überall „Rheinhausen“. Aber gegenüber dem damaligen Protest-Zirkus hat die Gewerkschaft hinzugelernt. Sie erklärt ihre Ohnmacht und wickelt widerspruchslos die Entlassungen mit ab. Statt für Sozialpläne setzt sie sich für staatlich betreute Beschäftigungsgesellschaften ein, in denen Arbeitslose sich zum Arbeitslosentarif betätigen dürfen. Die Erfolgsfeiern bleiben nicht aus.
Wo ein ganzes Land den unbescheidenen Rentabilitätsmaßstäben deutschen Geschäftslebens nicht genügt, da kann, d.h. will die Gewerkschaft nicht widersprechen. Da hat auch in ihren Augen Arbeit keinen Wert, haben Arbeiter also kein Anrecht auf Beschäftigung. Mögen sie bisher noch so viel Brauchbares hergestellt haben; es mangelt ihnen an „Produktivität“; die hat ihr Maß nämlich an der Höhe des Gewinns, der aus der Anwendung der Arbeitskräfte resultiert. Wo das Kapital erst gar nicht zugreift, da sind Massenentlassungen und Standortvernichtung ebenso unvermeidlich wie ein Extra-Billiglohnniveau als Standortangebot ans Kapital.
Realistisch wird die Anwältin „sozialverträglicher“ Abwicklung auch bei der Vermeidung von Opfern. Erwartungen an sozialplanmäßige Entschädigungen sind ohne florierendes Geschäft ebenso verfehlt wie die Hoffnung auf „Ersatzarbeitsplätze“. Dem Kapital will sie die Abfederung der sozialen Folgen weniger denn je aufbürden. Dafür wird sie radikal im Hinblick auf die staatliche Verwaltung der für unvermeidlich angesehenen riesigen Reservearmee. Wenn Millionen geschäftlich nicht gebraucht werden, dann soll wenigstens der Staat, dem diese Millionen überantwortet sind, dafür sorgen, daß ihre Brauchbarkeit erhalten wird. Ein massenhaftes dienstbereites Arbeitsvermögen samt Industrieanlagen, das betrachtet die Gewerkschaft wie die Anschlußpolitiker als eine nationale Ressource, die – wenn schon nicht genutzt – wenigstens für kapitalistischen Zugriff benutzbar sein muß. Daher hat sie sich zur Beratungsinstanz aufgeschwungen, wie man Leute ersatzweise nützlich machen kann, wenn es weder Arbeits- noch Ersatzarbeitsplätze lohnender Natur gibt. Mit ihrem Konzept der „Beschäftigungsgesellschaften“ hat sie die Forderung nach Beschäftigung fallengelassen und statt dessen aus der Arbeitslosenverwaltung ein standortpolitisches Gestaltungsmittel machen wollen, das Arbeitskraft und Oststandorte gleichzeitig in Schuß hält. Erreicht hat sie dabei nur das, was die Sozialpolitiker und die Bundesanstalt für Arbeit sowieso an Alternativen bei der Verwaltung der Massenarbeitslosigkeit geplant und finanziert haben nach dem Motto: Wenn die Arbeitslosen dem Staat schon auf der Tasche liegen, können sie sich auch für ihn ein bißchen nützlich machen. Als Ersatzbeschäftigte in der Regie der Bundesanstalt und Treuhand dürfen die verdeckten Arbeitslosen der freien Marktwirtschaft jetzt ihre ehemaligen Betriebe abmontieren, in ABM-Projekten werkeln und darauf warten, wann sie offiziell in die Arbeitslosigkeit überführt werden. Ihre Beschäftigung bleibt bloßes Ideal ihrer Betreuung; sie sind nichts weiter als Arbeitskraft im Wartestand, der kein Anwendungsinteresse gegenübersteht; ganz ausgeliefert an die Entscheidungen der Politiker, was sie sich ihre Betreuung kosten lassen wollen. Der gewerkschaftliche „Kampf“ findet also nur noch auf dem Feld der Arbeitslosenverwaltung statt, mit Vorschlägen für den sinnvollsten Umgang mit dem kapitalistischen Ausschuß. Protest legt die Gewerkschaft ein, wenn ABM-Gelder gestrichen werden.
5. Kampf um den „Standort Deutschland“ – Wirtschaftsimperialismus als Beschäftigungsprogramm
Jetzt kommt zur Brachlegung des Ostens auch noch die Rezession im Westen hinzu. Das Kapital ergreift die üblichen Krisenbewältigungsmaßnahmen, rationalisiert und entläßt im großen Stil. Für die Stahlbranche wird nicht zuletzt auf deutsches Drängen in Brüssel ein radikales Krisenprogramm mit Stillegungen einzelner Betriebe beschlossen. Die Gewerkschaft gibt sich, wie eingangs erwähnt, ratlos und verbannt öffentlich alle früheren Forderungen nach Vermeidung von Massenentlassungen, Standorterhalt und günstigen Sozialplänen in die Mottenkiste gewerkschaftlicher Politik aus besseren Zeiten. „Rheinhausen“ wird sang- und klanglos verabschiedet, der entsprechende Kampf auch. Statt zum „Kampf um Arbeitsplätze“ ruft sie zum Kampf um den „Standort Deutschland“ auf.
Wer auf Wirtschaftswachstum als einziges Beschäftigungsmittel setzt, der will und kann sich in der Krise den Notwendigkeiten des Geschäfts schon gleich nicht entziehen. Die Gewerkschaft bestätigt deshalb ohne ihre üblichen Umschweife die kritische Geschäftslage und macht den Betroffenen klar, daß die fehlenden Gewinne jetzt jeden Anspruch in Sachen Erhalt oder Schaffung von Arbeitsplätzen verbieten. Rettung der Beschäftigungsgrundlage Kapital steht an, da ist für gewerkschaftliche Forderungen kein Platz. Also streicht sie jetzt ihre kämpferischen Appelle von gestern und macht die Betroffenen gleich von vornherein damit vertraut, daß Massenentlassungen und Werksschließungen „nicht zu verhindern“ sind.
Die Einsicht ins „Unvermeidliche“ fördert bei den
gewerkschaftlichen Vertretern vor Ort, den
Belegschaftsvertretern, prompt eine neue Sorte
Gewerkschaftskampf – die Konkurrenz um ihren
Standort gegen andere. Betriebsräte treten wie
einzelbetriebliche Interessenvertreter gegeneinander an
und verlangen mit Hinweisen auf die Standortvorteile
„ihres“ Werks nachdrücklich, ihren statt anderer
Betriebe weiterzuführen. Der freien Kalkulation der
Konzerne wollen sie nichts in den Weg legen, sondern sie
gegen die „Kollegen“ woanders ausschlagen lassen. Dafür
rücken sie die produktiven Leistungen der
Belegschaften für die Konzernbilanzen gebührend ins
Licht: Eifrig werben sie mit niedrigen Personalkosten,
gelaufenen Entlassungen und erreichten Leistungsstandards
in Rheinhausen und anderswo, natürlich garniert mit der
stereotypen Versicherung, die Arbeiter dürften sich
keinesfalls „gegeneinander ausspielen“ lassen:
„Wir sind in fast allen Belangen besser. Aber im Vorstand werden jetzt die Zahlen hin- und hergeschoben. Plötzlich stehen in Dortmund 500 Beschäftigte weniger auf der Liste. Wir wollen einen neutralen Gutachter. Unter den gleichen Bedingungen, unter denen Hoesch in Dortmund 300 000 Tonnen Stahl macht, machen wir hier 325 000 Tonnen.“ (Betriebsrat Rheinhausen) „Die Kokerei bei Krupp ist veraltet. Ich weiß nicht, wie lange der TÜV das noch mitmacht.“ (Betriebsrat Dortmund) „Rheinhausen ist schon hart durchrationalisiert. Nun könnte die geringe Personalstärke für die Rheinhausener zum Wettbewerbsvorteil gegenüber Dortmund werden.“ (Betriebsrat Rheinhausen)
Das ist also die Wahrheit des Standortarguments: Arbeiter dürfen ihre produktiven Dienste für die Unternehmen ins Feld führen und abwarten, wo und wie diese Leistungen organisiert werden und wo sie nicht mehr gefragt sind, im sicheren Wissen, daß es Tausende von ihnen den Verdienst kostet und dem Rest das Verdienen schwerer gemacht wird. Mehr ist gewerkschaftlich nicht vorgesehen. Die eigenen Standortansprüche von gestern kommen deshalb heute bei der Gewerkschaft in den Ruch des politischen Extremismus:
„Viele denken, wir machen hier denselben Rummel wie 87. Meine Sorge ist, daß sich da ein paar Verrückte auf der Brücke mit dem Spaten kloppen und Autonome wie Rechtsradikale uns zu benützen versuchen.“ (Betriebsrat Rheinhausen)
Auf diese Weise wird den Stahlarbeitern von ihren Vertretern mitgeteilt, daß für sie nur das zu erreichen ist, was in den Vorstandsetagen und in Düsseldorf bzw. Bonn beschlossen wird – natürlich gewerkschaftlich mitbestimmt, wie es sich gehört. Auch auf die früher üblichen Umstände beim Personalabbau brauchen sie nach Auskunft der Gewerkschaft erst gar nicht zu hoffen: Die Belegschaften sind verjüngt, weil durchrationalisiert, der Arbeitsmarkt überfüllt, die Konzernbilanzen rot, die Staatskasse überbelastet. Nach dieser Logik geht jetzt, wo die Notlage von Entlassenen am größten ist, am wenigsten in Sachen soziale „Bequemlichkeit“. So verweist die gewerkschaftliche Opferbetreuungsanstalt auch die „sozialverträgliche Abwicklung“, mit der alle Rationalisierungsmaßnahmen in Ordnung gehen sollen, ins Reich der frommen Wünsche.
Angesichts der Krise verabschiedet sich also die Gewerkschaft von ihrem „Kampf um Arbeitsplätze“. Statt dessen eröffnet sie eine neue, politische Kampffront, in der sich die Beschäftigungsinteressen von Arbeitern endgültig aufgehoben sehen sollen: Deutschland steht auf dem Spiel.
„Es geht nicht um die Gefährdung einzelner Standorte wie etwa Rheinhausen, Dortmund, Finow oder Eisenhüttenstadt. Es geht längst um die Frage, ob der Stahlstandort Deutschland gesichert werden kann. Das ist keine Panikmache. Das ist reale Gefahr und konkrete Aufgabe.“ (Steinkühler, Handelsblatt 16.2.93)
Entweder Deutschland behauptet sich ökonomisch, oder die Gewerkschaft kann nichts mehr tun! Mit diesem nationalistischen Credo verlangt die Gewerkschaft im Namen der Arbeitslosen eine nationale Wirtschaftsoffensive, um die Krise in eine Stärkung der deutschen Wirtschaftsmacht umzumünzen. Dafür bietet sie ihre Unterstützung an und geht mit nationalistischen Vorwürfen, Vorschlägen und Forderungen selber in die Offensive:
– Für den Erfolg deutscher Betriebe gegen ausländische Konkurrenz:
„Nichts tat sich im deutschen Management. Jetzt ist die Krise da. Die Betriebsräte müssen ran… Wir Arbeitnehmer müssen uns stärker in die Produkt- und Modellpolitik, aber auch Preispolitik einschalten, denn davon hängen unsere Arbeitsplätze ab.“ (Gewerkschafter 1/93)
Arbeitsplätze erhält man also dadurch, daß man sich in die Rolle des Unternehmensberaters begibt und den Kapitalisten ihre eigenen Erfolgsideologien – „moderne Unternehmenspolitik“, „lean production“, „Synergieeffekte“, „Preis-Mengen-Strategien“, „eigene, auf unsere Arbeitskultur zugeschnittene Konzepte, um der japanischen Herausforderung zu begegnen“ – um die Ohren schlägt. Ideologien, in denen die Arbeiter nur noch als Kostenfaktor und Manövriermasse unternehmerischer Erfolgsstrategien gegen den Rest der Welt vorkommen.
– Für die Aussetzung der Konkurrenz des Kapitals unter nationalen Vorzeichen:
„Wenn wir der Konkurrenz insbesondere aus Japan etwas entgegensetzen wollen, müssen Strukturen geschaffen werden, die über einzelne Unternehmen hinausgehen.“ (ebenda) „Einzelne Stahlkonzerne dürfen ihr Heil nicht in einem gnadenlosen Vernichtungswettbewerb suchen. Sie müssen sich gemeinsam an der Entwicklung eines nationalen Stahlkonzepts beteiligen.“ (Steinkühler, Handelsblatt 17.2.93)
Die Gewerkschaft vertritt so entschieden den politischen Anspruch auf deutschen Kapitalerfolg, daß sie im normalen Konkurrenzgebaren eine Gefährdung des Kapitalstandorts Deutschland sieht und den Kapitalisten mit ihrem „ruinösen Preiskampf“ unnationale Geschäftsschädigung vorwirft. In diesem Sinne beantragt sie nationale Kartelle, die den „ruinösen Preiskampf“ mit politischer Unterstützung aussetzen, um ihn nach außen umso durchschlagender zu führen.
– Für die Vernichtung von Arbeitsplätzen im Ausland. Dort haben Steinkühler und Konsorten nämlich die Übeltäter entdeckt, die „deutsche Arbeitsplätze“ gefährden:
„Dabei kommt das Unheil weniger aus den Überkapazitäten der EG als vielmehr aus Drittländern, vor allem aus Osteuropa… Ohne Abschottung der Grenzen vor Billigstimporten funktioniert auch das freiwillige Krisenkartell nicht.“ (ebenda)
Dagegen hilft nur die Entschlossenheit der Politik zum Protektionismus – im Namen der ausgebeuteten Armen und „unserer“ Arbeitsplätze:
„Ungehemmter freier Handel ist die moderne Form der Ausbeutung, er hilft der armen Bevölkerung in den Entwicklungsländern nicht und zerstört Arbeitsplätze in den westlichen Industriestaaten.“ (Der Vorsitzende der Gewerkschaft Textil-Bekleidung Arens, Handelsblatt 20.3.93)
Was damals der Gewerkschaft bei ihren 35-Stunden-Wochen-Kampagnen vorgehalten wurde – sie arbeite nur den Japanern in die Hände –, das sieht sie heute genauso und macht sich für die umgekehrte Strategie stark: Mit Handelsbeschränkungen Konkurrenten – das heißt doch wohl im Gewerkschaftsdeutsch „Arbeitsplätze“! – im Ausland vernichten, das Geschäft für Deutschland monopolisieren, also Arbeitslosigkeit exportieren. Dafür fordert sie die Solidarität deutscher Unternehmer und Politiker mit deutschen Arbeitern.
Das fordert sie nicht nur, dafür wird sie auch aktiv. Die IG Bau hat ihren Mitgliedern neben einer Reallohnsenkung eine Abmachung mit den Unternehmern beschert, sich gemeinsam dafür stark zu machen, daß deutschen Firmen Billigkonkurrenten aus dem Ausland vom Hals gehalten werden und der Zugang zu deut-schen Arbeitsplätzen für Polen usw. erschwert wird. Ganz im Sinne des Vorurteils, daß Ausländer uns die Arbeitsplätze wegnehmen, ermuntert sie den Staat, seine ausländerfeindliche Gesetzespraxis zu verschärfen. Unternehmerverband und IG Bau
„fordern gemeinsam von der Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat die vollständige Abschaffung der Werksvertragsregelungen für osteuropäische Bauunternehmen. Ihre Billigpreise und -löhne hätten zu tiefgreifenden Störungen des Baumarktes geführt und bedrohten den sozialen Frieden auf den Baustellen. Stattdessen sollten die osteuropäischen Bauarbeiter künftig befristete Arbeitsverträge zu bundesdeutschen Bedingungen erhalten.“ („Frankfurter Erklärung“, Handelsblatt 31.3.93)
Auf deutschem Standort sollen nur deutsche Unternehmen verdienen, und zwar im Prinzip mit deutschen Arbeitern. Deswegen treten Gewerkschaften heute für „gleichen Lohn für gleiche Arbeit“ ein – als Konkurrenznachteil für ausländische Arbeiter.
– Für rücksichtslose nationale Kapitalförderung. Die gewerkschaftlichen Arbeitsplatzstrategen beherrschen auch die Dialektik von „Hilfen“ für eine notleidende deutsche Industrie und „unerlaubten Subventionen“ anderswo. Sie drängen auf den Einsatz der finanziellen und politischen Macht Bonns, um die anderer Nationen zu brechen:
„Wir brauchen ein politisches Gesamtkonzept für die Zukunft des Schiffsbaus in Deutschland… Bonn muß ausreichende Werfthilfen gewähren und gleichzeitig stärker als bisher auf die Beendigung des internationalen Subventionswettlaufs drängen.“ (Gewerkschafter 1/93)
Subventionen hier statt anderswo, dafür sollen deutsche Politiker sich stark machen und außerdem in Brüssel alle möglichen Töpfe für die Krisenabwicklung in Deutschland reservieren. Lauter Rezepte, mit denen die Gewerkschaft in Bonn sperrangelweit offene Türen einrennt.
– Für deutsche Wirtschaftsmacht. Um eine „leistungsfähige nationale Stahlbasis“ zu schaffen, soll Bonn mit einer geschlossenen nationalen Unternehmerschaft im Rücken in Brüssel „Pförtnerdienste“ leisten und passende „Quoten- und Preisregelungen“ durchsetzen. Daß die deutschen Wirtschaftspolitiker im Vertrauen auf die deutsche Wirtschaftskraft und ihr politisches Gewicht in Brüssel einen etwas anderen Weg gewählt haben, erscheint den Fanatikern eines nationalistischen Krisenpaktes gegen den Rest der Welt glatt als „politische Untätigkeit“. Ob bei Stahl, bei Werften oder bei der Sicherung des „textilen Standorts Deutschland“ – deutsche Arbeitervertreter verlangen ein Machtwort aus Bonn, nach dem sich andere zu richten haben.
Deutscher Wirtschaftsimperialismus, das ist also der zeitgemäße Internationalismus der notorisch ausländerfreundlichen Arbeiterorganisation. Sie überantwortet den Kampf um Arbeitsplätze an die Entschlossenheit der Nation, andere Wirtschaftsmächte zu schädigen, und stellt die Arbeiter vor die Alternative: Verelendung oder rücksichtslose Standortkonkurrenz gegen das Ausland. Von einer Gegenwehr der Arbeiter gegen die Ansprüche des Kapitals hält sie nichts; sie plädiert für die kämpferische Vertretung der Ansprüche der Nation, weil sie nur noch eine unerträgliche Abhängigkeit kennt, die Deutschlands von seinen Konkurrenten. Für „eine druckvolle, weil einheitliche deutsche Interessenvertretung in Brüssel“ und anderswo bietet sie ihre rückhaltlose Mitarbeit an. Das, wofür der Wirtschaftserfolg einmal gut sein sollte, „Beschäftigung“, stellt sie zur freien Disposition, den nationalen Erfolg nicht. Daher kennt und anerkennt sie lohnende Opfer:
„Natürlich wissen auch die Stahlarbeiter, daß manchmal für eine gesicherte Zukunft Opfer notwendig sind. Aber wir wollen endlich wissen, wofür die Opfer gebracht werden sollen. Deshalb fordern wir alle Verantwortlichen zu einer gemeinsamen Stahlpolitik an einen Tisch.“ (Krupp-Betriebsrat Busche)
Mit der Unzufriedenheit der Nation über ihre Wachstumserfolge wird auch das gewerkschaftliche Verlangen nach der Inanspruchnahme der produktiven Dienste der Lohnarbeiterschaft immer nationalistischer. Was Arbeiter verlangen, womit sie überreichlich entschädigt werden können, das sind überzeugende Beweise der politischen Entschlossenheit, daß das Geschäft vom Kapitalstandort Deutschland ausgehen soll, also ihre Bedienung als radikale Nationalisten. Dabei gebärdet sich die Gewerkschaft radikaler als die Politiker selbst. Deutschland 93 ist nicht mehr das Deutschland von gestern! In diesem Geist bestimmen Gewerkschaftsfunktionäre und -politiker in Aufsichtsräten und anderswo über die „notwendigen Opfer“ mit. Kein Wunder, daß die so ausfallen, wie es das internationalisierte Kapital und die nationalen Standortverwalter mit ihren gewachsenen Erfolgsmaßstäben vorsehen.