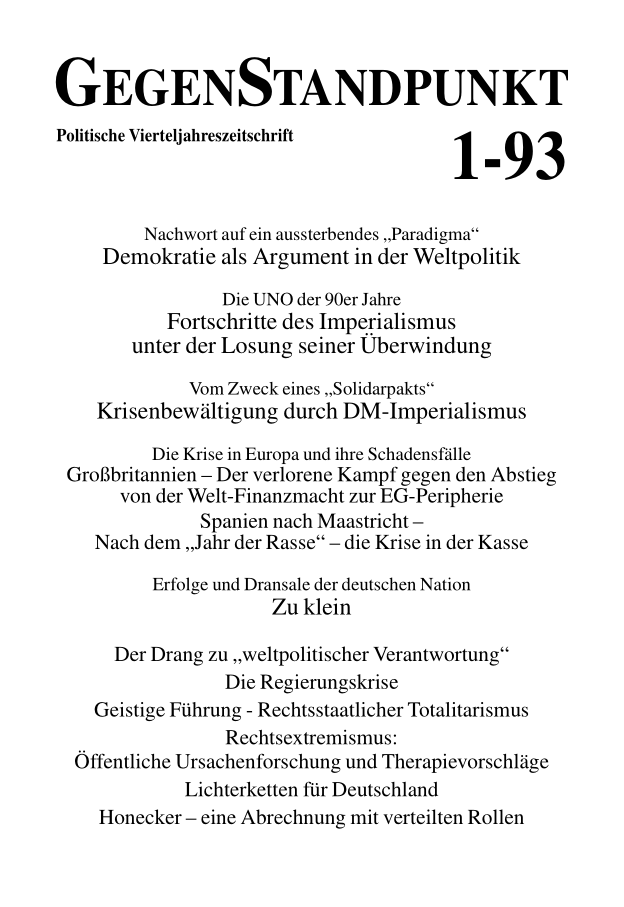Vom Zweck eines „Solidarpakts“
Krisenbewältigung durch DM-Imperialismus
Die Krise gefährdet die deutschen Expansions-Projekte „Aufschwung Ost“ und „Maastricht-Prozess“; die zugehörige imperialistische Diagnose lautet „Standort in Gefahr“. Zu seiner Rettung sind ein „Standortsicherungsgesetz“ und ein „Solidarpakt“ geboten, die mitten in der Krise eine Staatsverschuldung erlauben, mit der man die Krisenkonkurrenz in Europa gewinnen kann. Klar, dass dafür die Bürger einstehen müssen – mit Solidarbeitrag, geringeren Sozialleistungen und Lohnsenkung. Die Gewerkschaft ist konstruktiv.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
- I. Deutschland in Not
- II. „Solidarpakt“: Schulden solide machen, das Kapital zum Wachsen bringen
- „Solidarpakt“
- 1. Alte Schulden – neu besichtigt
- „Föderaler Konsolidierungsplan“
- 2. Standort neu definiert: Deutschland kämpft mit Staatskredit um Märkte
- „industriellen Kerne“
- 3. Vaterlandslose Gesellen neu in die Pflicht genommen
- „Standortsicherungsgesetz“
- 4. Ein deutscher Binnenmarkt für das Fertigmachen der EG
- III. „Der Staat spart“ – an seinen Bürgern
Vom Zweck eines
„Solidarpakts“
Krisenbewältigung durch
DM-Imperialismus
I. Deutschland in Not
1. Bilanz der guten Taten
Unter großem öffentlichen Getöse geht die deutsche Politik ihrer Bevölkerung ziemlich radikal an den Lebensunterhalt. Der allgemein gebilligte gute Grund dafür, daß das so sein muß, heißt: Wegen Schwierigkeiten beim „Aufbau Ost“ und wegen der ökonomischen Krise steht Deutschlands Zukunft auf dem Spiel – sein gutes Geld und seine Qualität als Kapitalstandort müssen gerettet werden. Ab sofort kennt die Politik weder Parteien noch konfligierende Interessen mehr, sondern nur noch Deutsche. Der finanz- und wirtschaftspolitische Staatsnotstand wird ausgerufen, und zugleich werden die Heilmittel zu dessen Bewältigung verkündet: Runter mit den Löhnen und den Sozialausgaben; radikale Beseitigung von „Wachstumshemmnissen“; noch mehr Anstrengungen und Staatskredit für den „Aufbau Ost“.
Was ist da los – was hat dieses Deutschland vor, das die nationale Krise ausruft und zugleich verkündet, sich dadurch in keiner Weise beeindrucken und von nichts abbringen zu lassen, weil die „nationale Bewährungsprobe“ unbedingt siegreich bewältigt werden müsse?
Die deutsche Politik zieht Bilanz in Sachen „Aufschwung Ost“ und „Europa“ und sieht das Gelingen dieser Projekte gefährdet. Mit der imperialistischen Landnahme im Osten hat sich Deutschland die Perspektive des Aufstiegs zur Weltmacht eröffnet; mit dem Vertrag von Maastricht schien das „deutsche Europa“ auf das Schönste in die Wege geleitet – nun zeigt sich, daß der Weg Deutschlands ganz nach oben doch nicht ganz so glatt läuft, wie es sich die erfolgsgewohnte deutsche Führung vorgestellt hat. Bei der Beschaffung der Mittel für die eingeleitete Machterweiterung der Nation tun sich ernste Hindernisse auf; die Reichtumsquellen der Nation, aus denen die Politik ihre Freiheit zur weltpolitischen Ein- und Aufmischung finanziert, sprudeln nicht so, wie sie dafür benötigt und beansprucht werden:
– Die ökonomische Bilanz des DDR-Anschlusses fällt für die Nation negativ aus: Das Projekt, mittels Export von DM die realsozialistische DDR in ein blühendes kapitalistisches Profitvermehrungszentrum zu verwandeln, ist so, wie es ursprünglich konzipiert war, gescheitert. Die Kapitalisten schlagen das politische Angebot neuer Anlagesphären mehrheitlich aus; was an Produktion noch stattfindet, verdankt sich großenteils einem pur politischen Kampf gegen das Abschreiben von Land und Leuten. Folglich bilanziert die Politik statt eines Zuwachses an Kapitalvermehrung auf deutschem Boden, die dem Staat neue Steuerquellen eröffnet und seinen Kredit stärkt, seit einiger Zeit zunehmende „Kosten der Einheit“: Ökonomisch gesehen ist die Zone kein Gewinn für die Bilanzen der Nation, sondern eine Last.
– Die staatliche Rechnung, nach der ein flottes Kapitalwachstum in Deutschland (West) die Mittel für das Voranbringen des Aufschwungs Ost zu liefern habe, geht nicht auf. Im Gegenteil: Die Wirtschaftskrise, so hört man allenthalben, ist jetzt auch in Deutschland „angekommen“. Steigende Arbeitslosenzahlen, Verluste und Pleiten wichtiger Betriebe, schrumpfende Exporte und rückläufige Steuereinnahmen sorgen für zusätzliche „Haushaltslöcher“; die Bundesbank entdeckt neuerliche „Inflationsgefahren“ und warnt vor einer Gefährdung der DM.
– Der Plan, die Euro-Währungen, allen voran die DM, in ein Europa-Geld nach deutschem Strickmuster zu überführen, ist durch die Abwicklung der Krise in Europa nicht gerade befördert geworden. Zwar ist die DM nicht in Gefahr; es waren die lieben „Partner“, die die Entwertung des EG-Kredits auf ihre Kappe nehmen mußten. Aber der Nutzen dieser einseitigen Krisenbewältigung für deutsches Geld und deutsche Politik fällt wenig eindeutig aus. Die nationalen Rettungsprogramme, die in England, Italien etc. jetzt aufgelegt werden, sind praktisch lauter Infragestellungen des Maastricht-Fahrplans; und die schmerzlich empfundene Abhängigkeit von der DM befördert bei den betroffenen Regierungen nicht gerade den Willen zu weitergehendem Souveränitätsverzicht. Diese Lage befördert nicht das Vertrauen in die DM, sondern setzt die Frage in die Welt, worauf deren „Stabilität“ denn eigentlich beruht.
Zusammengenommen muß die deutsche Politik zur Kenntnis nehmen: Statt daß sich die „Deutsche Einheit“ und das „Zusammenwachsen Europas“ als verläßliche Hebel für wachsenden deutschen Reichtum, als gelungene Schritte hin zur Fertigstellung deutscher Weltmacht bewähren, erweisen sich diese Erweiterungsprojekte als Gefährdung für das Programm, dessentwegen sie in Angriff genommen wurden. Für Deutschland und Europa braucht die Nation jede Freiheit des Kredits: Da darf die Frage keine Rolle spielen, ob die Nation sich da irgendetwas nicht leisten kann. Genau diese Frage liegt aber auf dem Tisch, wenn die Nation bemerken muß, daß sich in DM immer mehr bloße Schuldtitel, immer weniger echte, verdiente Kapitalerträge bilanzieren. Für Deutschland buchstabiert sich Krise gerade jetzt als Angriff auf die Erfolgsstrategien, mit denen diese Nation bislang ihren Aufstieg in den Weltmachtrang betrieben hat. Den will die Nation nicht dulden.
2. Deutschland in der Krise – Ideologie und Wahrheit
Staatsnotstand – das heißt in Deutschland nicht, daß der Staat sich gezwungen sehen würde, angesichts gescheiterter bzw. infragegestellter nationaler Projekte seine Ansprüche zu reduzieren. In England etc. mögen geplatzte Kredite, pleitegehende Firmen, ein aus dem Ruder laufender Staatshaushalt und steigende Inflationsraten ja davon zeugen, daß Regierungen „über ihre Verhältnisse gelebt“ haben und lauter Schwindelgeld in die Welt gesetzt haben, das jetzt zurecht entwertet wird; in Deutschland pflegt man unverdrossen das Selbstbewußtsein, als durch und durch solides und leistungsfähiges Gemeinwesen ganz unverschuldeterweise von lauter Krisenwirkungen betroffen zu sein. Erstens kann nicht davon die Rede sein, daß sich Deutschland mit der Zone übernommen hätte; die deutsche Einheit war bekanntlich fällige historische Tat, und die im Gefolge der deutschen Einheit aufgelaufenen Schulden gelten nicht als Ergebnis nationaler Selbstüberschätzung, die jetzt korrigiert gehört, sondern als „Erblast“ von Honecker und Ulbricht. Zweitens sieht man hierzulande die Sache mit der Krise so, daß die „Wachstumsschwäche“ vor allem unserer europäischen Nachbarn dafür gesorgt habe, daß deutschen Exporteuren jetzt Märkte wegbrechen, auf die sie sich bislang sicher verlassen konnten; so daß drittens „Gefahren für unser Geld“ vor allem von denen ausgehen, deren eigenes nichts taugt.
Die Wahrheit der Sache ist, daß gerade die deutsche Politik im Osten und in Europa die Überakkumulation des Kapitals kräftig vorangetrieben hat, deren Wirkungen auf die nationalen Bilanzen deutsche Politiker jetzt beklagen:
– „Solides Finanzgebaren“ gemäß kapitalistischer Logik war es ja nicht gerade, daß der deutsche Staat im Zuge der Einheit Milliarden in den Osten geschoben hat. Mit purem Einsatz der Staatsgewalt wurde da massenhaft zusätzliches Geld in Umlauf gebracht, das in keinerlei Verhältnis zu den bisherigen und künftig zu erwartenden Ergebnissen des nationalen Wirtschaftswachstums steht, sondern pur dem politischen Willen entsprungen ist, östlich der Elbe eine umfassende kapitalistische Akkumulation in Gang zu setzen, also den Kapitalstandort Deutschland per politischem Beschluß auf großer Stufenleiter auszuweiten. Damit wurde zusätzliche Nachfrage für deutsche Unternehmen und Banken geschaffen, an der diese sich munter bedient haben. Bei denen ist das Geld gelandet und hat insoweit seinen kapitalistischen Zweck erfüllt. Die Bezeichnung „Sonderkonjunktur“ für diese staatlich geschaffene Geschäftsgelegenheit wirft allerdings ein bezeichnendes Licht auf die staatliche Gelddruckaktion: Die DM-Vermehrung fand statt zu einem Zeitpunkt, wo die weltweite Überakkumulation von Kapital schon ihre Folgen zeitigte. Im Osten bot sich exportierenden Unternehmen ein staatlich finanzierter „Ersatzmarkt“ für Waren, die sich andernorts nicht mehr gewinnbringend realisieren ließen. Entsprechend sah das Ergebnis aus. Die vom Staat neu in Umlauf gebrachten Gelder vermehrten zwar Gewinne und Kapazitäten westlicher Unternehmen; aber die zusätzlichen Erträge waren gar kein Mittel weiteren Kapitalwachstums, weil anderswo die Märkte nicht wuchsen, sondern schrumpften.
Mit Staatskredit hat also die deutsche Politik die Überakkumulation von Kapital kräftig angeheizt. Sie hat den Kapitalen vom normalen Geschäftsgang und seinen Konjunkturen unabhängige Absatzmöglichkeiten und Gewinne, also eine neuerliche Expansion gegen den Markt finanziert, die jetzt als „Überkapazität“ auf die Bilanzen drückt und rote Zahlen produziert. Warum das weniger „unsolide“ gewesen sein soll als die italienische Tour, mit Staatskredit Firmen zur Weltmarkt-Konkurrenzfähigkeit zu verhelfen, ist nicht abzusehen.
– Auch in der EG hat die deutsche Politik das Ihre zum Vorantreiben der Überakkumulation getan. Erst hat sie sich mit Freuden als Hüter einer „Ankerwährung“ für den Staatskredit der anderen EG-Staaten betätigt, der sich als Mittel für die Versilberung deutscher Exportüberschüsse bewährte. Dann hat Deutschland in Maastricht auf der Prüfung und Konsolidierung solcher „unsoliden“ EG-Währungen bestanden und die Entwertung europäischen Kredits auswärts ausgelöst, also der europäischen Konkurrenz die Folgen der EG-weiten Überakkumulation aufgehalst. Und jetzt bemängeln deutsche Politiker, daß die auswärtigen Märkte mit ihrer zahlungsfähigen Nachfrage nicht ausreichen, um das viele Kapital, das von deutschem Boden aus Gewinnansprüche aufmacht, zu realisieren:
„Gegenüber den Währungen Großbritanniens, Italiens, Spaniens (etc.)… ist die Deutsche Mark seit dem Währungsschock im Spätsommer um 14% gestiegen. Rund ein Viertel des deutschen Exports geht in diese Länder. Damit verliert auch Deutschlands Exportindustrie ihre bislang als unerschütterlich geltende Position. Das Wunderland gerät in Leistungsdefizite.“ (Spiegel 53/92)
So einfach geht die Abwälzung der Krise auf die unterlegenen europäischen Nationen eben doch nicht. Wenn mit EG-Kredit die Expansion in Deutschland angelegten Kapitals befördert wird, dann ist es eben auch dieses Kapital, das „zuviel“ ist, wenn sich der Kredit entwertet. Dann muß eben auch die „Exportnation“ feststellen, daß ihr unerschütterlich leistungsfähiges Kapitalwachstum an Schranken stößt. Und dann muß auch der Hüter der solidesten aller Währungen feststellen, daß eine Gläubigerrolle nur soviel taugt wie die Schuldner, denen man sein gutes Geld geliehen hat. Deutschland mag sich ja noch so sehr darüber beschweren, daß die „Schwachwährungen“ der europäischen Konkurrenz der DM das Solidebleiben schwer machen: Betroffen wird die Nation da abermals nur von Wirkungen ihres eigenen Vorantreibens der Währungskonkurrenz. Das ganze Stützen und Kreditieren der anderen europäischen Gelder unterwirft diese zwar einerseits endgültig der DM; andererseits ist nicht zu übersehen, daß auf diese Weise immer neuer DM-Kredit in die Welt kommt, für den die kreditierten Nationen gar keine verläßliche Kreditbedienung garantieren können – sonst hätten sie sich ja gar nicht erst in DM verschulden müssen. So wird immer mehr DM-Kredit dadurch „gesichert“, daß immer mehr neuer DM-Kredit in die Welt gesetzt wird – ein Schwindel, der nur solange gut geht, wie nicht „die Märkte“ die Frage aufwerfen, wer eigentlich womit für diese vielen neuen Kreditzettel geradesteht.
3. Die neue Herausforderung: „Standort in Gefahr“
Mit ihren ökonomischen Machtmitteln hat die deutsche Politik die Überakkumulation des Kapitals daheim und auswärts vorangetrieben, sie finanziert und an ihr verdient; jetzt bekommt Deutschland die Wirkungen der Krise bei Wirtschaftswachstum und Staatsfinanzen selbst zu spüren. Das heißt für diese Nation allerdings noch lange nicht, daß für sie die gleichen Maßstäbe neuer nationaler Bescheidenheit gelten würden, die sie ihren ärmeren Nachbarn anempfiehlt.
Dort haben nationale Führungen die Lage zu bewältigen, daß ihnen die Freiheit in Geldfragen bestritten ist, sie in der Konkurrenz der europäischen Nationen verloren haben. In Deutschland gerade umgekehrt: Es ist mit seiner DM aus der europäischen Krisenkonkurrenz bislang als Sieger hervorgegangen; ihm ist es bislang gelungen, die Entwertung von Kredit und Kapital auf die Konkurrenz abzuwälzen. Deswegen sieht es sich zu dem selbstgerechten Befund berechtigt, nach dem hierzulande die Krise eigentlich gar nichts zu suchen habe; beim Bilanzieren der nationalen Lage können deutsche Politiker bei sich kein überzogenes nationales Anspruchsdenken entdecken. Vielmehr sehen sie sich zu einer Politik ebenso berechtigt wie befähigt, die sicherstellt, daß die Wirkungen der Krise auf deutsches Wachstum und deutschen Kredit gar nicht erst eintreten. Angesichts schwindender Erträge und steigender Staatsschuld bei der Realisierung der nationalen Projekte kürzer zu treten, kommt für Deutschland nicht infrage. Krise im Westen, ausbleibendes Geschäft im Osten haben kein Hinderungsgrund für das Projekt der Nation zu sein, sich ökonomisch wie politisch als Weltmacht zu etablieren. Also gehen die Politiker in die Offensive: Wer, wenn nicht der Hüter der DM, hat die Mittel, um die Krisenbewältigung zu einer neuen nationalen Erfolgsstrategie zu machen? So sehen deutsche Politiker die Lage; und entsprechend sieht ihr Programm aus.
Dieses Programm faßt sich zusammen in dem Schlachtruf „Standort in Gefahr“.
Da gilt: „Deutschland ist, was immer in diesen Tagen geredet wird, weiterhin eine gute, eine erstklassige Adresse in der Welt.“ Aber auch: „Daß dies so bleibt, setzt voraus, daß wir bei all dem, was positiv zu vermelden ist, nicht die Augen vor jenen Hindernissen verschließen, die den Weg in die Zukunft verbauen könnten.“ Woraus zusammengefaßt folgt: „Jetzt geht es darum, Wachstum zu mobilisieren und die Konjunktur wieder in Schwung zu bringen.“ Denn: „Die deutsche Volkswirtschaft erwirtschaftet jährlich mehr als 3 000 Mrd. DM. Daß angesichts einer solchen Leistungskraft das, was auf uns zukommt, nicht zu leisten sein soll, verstehe ich überhaupt nicht.“ (Kohl vor dem Bundestag 27.11.92)
Das Schlagwort vom „gefährdeten Standort“ umschreibt ein anderes, anspruchsvolleres Programm, als es Nationen – die ideellen Gesamtkapitalisten, die sich um das geschäftliche Wachstum und seine Bedingungen in ihren Grenzen kümmern – normalerweise in Krisenzeiten beschließen. Wenn das vergrößerte Deutschland wie eine einzige Kapitalanlagesphäre betrachtet wird, die sich im internationalen Vergleich auch unter Krisenbedingungen bewähren muß, dann wird damit erstens der noch gar nicht erfolgreich kapitalisierte Osten trotz der „Rezession“ als ein Teil der nationalen Reichtumsquellen reklamiert, der auch und gerade in der Krise Wachstum der nationalen Geschäftstätigkeit garantieren soll. Zweitens bezieht sich die Sorge um „den Standort Deutschland“ auf den Westen als die Basis, die unabhängig von der weltweiten Überakkumulation das Staatsprogramm „Aufschwung Ost“ stützen und tragen soll. Mitten in der Krise wird das Geschäftsleben im Westen an dem neuen, radikaleren Anspruch gemessen, durch steigende Erträge die rücksichtslose Ausweitung des Nationalkredits zu ermöglichen. Die deutsche Politik erkennt also weder die nach allen Maßstäben kapitalistischer Rentabilität eingetretene Niederlage beim Aufschwung Ost an, noch bezieht sie sich auf die in der Krise fällige Reduktion von Kapital und Kredit so, daß sie deren Folgen für Staatskredit und Währung bloß zu bewältigen sucht. Vielmehr stellt sie sich mitten in der Krise auf den Standpunkt, daß das erweiterte Deutschland im Prinzip ein leistungsfähiger Standort ist – wenn alle Beteiligten sich nur am Riemen reißen und mit ganzer Kraft für ihn arbeiten, sparen, sich schröpfen lassen; und wenn die Politik die Sache in die Hand nimmt und die „Wachstumskräfte aktiviert“ – mit neuem Staatskredit.
Unter diesen neuen Anspruch gestellt, muß die Politik dem bisherigen Standort Deutschland, ehemals Exportmusterland mit unerschütterlich gutem Geld, rückwirkend bescheinigen, daß er unter aller Sau ist. Ausbildungszeiten sind zu lang, Löhne sind zu hoch, Bürokratie zuviel, etc. pp. Und wie konnte es dazu kommen? Der Kanzler weiß es:
„Die Erkenntnis, daß dieser Wohlstand und das Wachstum, das eine Voraussetzung für den Wohlstand ist, täglich neu erarbeitet werden müssen, ist in weiten Kreisen abhanden gekommen.“ (ebd.)
Den Fehler läßt sich die Politik gerne nachsagen: Nicht sie hat die Potenzen der Nation über Gebühr in Anspruch genommen, sondern genau umgekehrt. Sie hat die Potenzen, über die die Nation eigentlich verfügt, nicht genügend genutzt – „mobilisiert“, wie der Kanzler zu sagen pflegt. „Verkrustete Strukturen“ waren am Werk, die diese leistungsfähigste aller Nationen daran gehindert haben, die anstehenden Aufgaben erfolgreich zu bewältigen; „Anspruchsdenken“ hat Platz gegriffen, es ist zu wenig gearbeitet, zuviel verdient worden. Rückwirkend muß das ganze Volk sich sagen lassen, daß es nicht rechtzeitig seine Ansprüche auf „Lebensstandard“ den „Herausforderungen“ angepaßt habe, die die Nation zu bestehen hat.
Der Ruf „Standort sichern!“ ist die Ankündigung, daß der „Standort“ ab sofort für mehr und anderes taugen soll. Aus gegen den Markt in die Welt gesetztem Staatskredit soll doch noch Kapital werden. Dafür müssen die nationalen Akkumulationsbedingungen umfassend verbessert werden, um dem Kapital lauter neue Kostenvorteile zu bieten; so soll die Nation mit Wachstum aus der Krise kommen.
Aus „Krise“ zieht die deutsche Politik also einen ganz eigenen Schluß. Krise – das heißt im deutschen Falle nicht, daß zuviel Kredit da ist, um sich als Kapital zu vermehren; daß zuviel Kapital für lohnende Verwertung angehäuft wurde, also Entwertung fällig ist. Die deutsche Nation behauptet glatt: Bei uns ist eigentlich nichts zuviel; bei uns lassen sich lauter neue Gelegenheiten zur Kapitalanlage schaffen – wenn der Staat nur dafür sorgt, daß das Investieren und Produzieren billiger wird. Die deutsche Politik definiert die Krise als pure Kostenfrage des nationalen Standorts und erklärt damit deren Bewältigung zu einer Leistung und Aufgabe des Staates, mit seinen Mitteln neue Quellen der Kapitalakkumulation zu aktivieren. Für dies nationale Projekt, per staatlicher Macht die Kapitalvermehrung auf deutschem Boden konkurrenzlos lohnend, damit Entwertung im großen Stil überflüssig und die DM wieder unbezweifelbar solide zu machen, ist die Solidarität aller Bürger verlangt.
II. „Solidarpakt“: Schulden solide machen, das Kapital zum Wachsen bringen
Zur Bewältigung der nationalen Zukunftsaufgabe hat die Regierung ein Konglomerat von neuen Staatsaufgaben und -ausgaben, von Streich- und Schröpfungsvorhaben, von Investitionszusagen der Unternehmer und Verzichtsbekundungen der Gewerkschaften in die Welt gesetzt und ihm den schönen Namen
„Solidarpakt“
gegeben. Da weiß dann jeder, was ansteht: Der selbstlose Dienst aller Klassen und Schichten an der neuen nationalen Aufgabe ist gefragt, „verteilt“ wird nur noch von unten nach oben, dorthin, wo die Einkünfte der Massen nicht sinnlos „verpraßt“, sondern einem höheren nationalen Zweck als dem Konsum der Massen zugeführt werden. Dabei legt die Regierung schwer Wert auf die Ideologie, nach der es sich bei den geplanten Spar- und Streichaktionen ebenso wie den neu geplanten Ausgaben recht eigentlich um ein Unterstützungsprogramm „reicher“ Wessis für „arme“ Ossis handele. Die Presse, kritisch wie immer, läßt es sich nicht nehmen, die Frage aufzuwerfen: „Wer ist da eigentlich mit wem solidarisch?“ – der Nachweis ist ja billig zu haben, daß bei dieser angeblichen „Umverteilung zwischen West und Ost“ von den „für den Osten“ fließenden Mitteln bei keinem armen Ossi je etwas angekommen ist. Findige Journalisten und Politiker rechnen aus, wieviele dieser Milliarden gar nicht im Osten, sondern in Wirklichkeit wieder im Westen landen – kurz, ein allgemeines öffentliches Herumgemäkel hebt an in der Frage, ob denn die Regierung – bei aller Billigung des Anliegens – zurecht Solidarität einfordert:
„Das Gefühl der Bevölkerung, das Geld fließe im Osten in ein Faß ohne Boden, hat sich bis in die Regierungszentralen der Länder herumgesprochen… ‚Was wollen sie eigentlich mit dem Geld?‘ Dies, so vereinbarten die SPD-Ministerpräsidenten, wollten sie Waigel beim Gespräch mit dem Kanzler in aller Schärfe fragen. ‚Die Bundesregierung erkläre, 100 Mrd. koste die Einheit 1995, und niemand weiß, was damit gemacht werden soll.‘“ (SZ 4.2.93)
So ganz die Wahrheit ist das nicht. Die Regierung macht nämlich gar kein Geheimnis daraus, wem die Solidarität der Nation gilt: dem deutschen Kapitalstandort und dem deutschen Kredit.
1. Alte Schulden – neu besichtigt
Die Regierung hat in ihren Haushalt geguckt und festgestellt, daß da über die Jahre einiges an Schulden zusammengekommen ist. Außerdem steht fest, daß sie jede Menge neue Schulden machen muß und will, um den „Standort Deutschland“ zu „verteidigen“, d.h. das Geschäftsleben, das von Deutschland ausgeht, in großem Maßstab zu erweitern:
„Die finanzielle Erblast des SED-Regimes beträgt 400 Mrd. DM. Ab 1995 werden Bund, Länder und Gemeinden – zusätzlich zu allen anderen weiter bestehenden finanziellen Hilfen – für Zinsen und Tilgung mindestens 40 Mrd. jährlich aufzubringen haben.“ (Kohl auf der Regionalkonferenz in Sachsen-Anhalt, Bulletin der Bundesregierung 5.11.92)
Also muß im Zuge des geplanten Standortaufbaus Ost erst einmal klargestellt werden, daß die alten Schulden dem neuen Projekt nicht im Wege stehen dürfen. Dazu wird ein „Erblastfonds“ eingerichtet und dessen Tilgung teilweise vom Bundeshaushalt auf Länder und Gemeinden abgewälzt – in welchem Umfang, ist derzeit zwischen Bund und Ländern strittig.
Von wegen „Erblast“ – der Notstand der deutschen Staatsfinanzen ist das Produkt des Annexionsprojekts „Währungsunion“, mit dem die DDR dem Kapitalismus unterstellt wurde. Die 400 Mrd. zusätzlicher Schulden, die jetzt im deutschen Haushalt aufgelaufen sind, sind Ergebnis des politischen Wahns, nach dem die Einrichtung von lauter Rechtstiteln auf Ertrag im Osten schon die beste Garantie wäre für ein Sprudeln von Erträgen. Das Stiften solcher Rechtstitel erfolgte, indem die Geldverteilungsverhältnisse, die im realsozialistischen Staatswesen existierten, in ebenso viele DM-Verhältnisse, d.h. in Rechtsansprüche auf Bedienung, Kredit, umgewandelt wurden. Mit „Eröffnungsbilanzen“ wurde die Betriebe zu Kapital, d.h. zum Anspruch auf DM-Überschuß. Die Staatsgelder, mit denen sie vordem ausgestattet worden waren, wurden zu Schulden bei Banken, denen damit rechtsförmig Beteiligung an solchen Überschüssen eingeräumt war. Grund und Boden wurden zu Eigentum mit Wert, der sich kaufen, verkaufen und mit Hypotheken beleihen ließ. Als Eigentümer des DDR-Vermögens und Bürge der Treuhandkredite ist der Staat der Garant der Bedienung dieser Rechtstitel. So war auf einen Schlag wie im goldenen Westen jede DM Mittel des Kreditgeschäfts – und als solches haben sich diese DM auch bewährt. Für die Eigentümer solcher Rechtstitel fungiert der Osten als eine einzige Zinsabwerfmaschine, obwohl sich da gar nichts anderes verzinst als immer neue Staatsschulden – und keiner schimpft aufs „Finanzkapital“, das die Nation so selbstverständlich zur Kasse bitten darf. Warum auch – schließlich ist der feste Glaube, daß die rechtliche Umwidmung von realsozialistischem Land, Volk, Betriebswesen und Geld in lauter kapitalistische Eigentumstitel das Zaubermittel wäre, um das Zerstörungswerk an der realsozialistischen Produktionsweise in ein Aufbauwerk kapitalistisch „blühender Länder“ zu transformieren, die Grundüberzeugung dieses ach so überlegenen „Systems“. Die treibt ja auch im ferneren Osten ihre absurden Blüten. Also versteht es sich auch von selbst, daß die jetzt aufgelaufenen Schulden im Osten kein Ausweis dafür sind, daß da der Staat offenbar eine gewaltige Scheinfirma betreibt, sondern eine haushaltsmäßig zu bewältigende „Erblast“, für deren Finanzierung alle Bürger zur Kasse gebeten werden.
Von wegen also, es könne „nur verteilt werden, was vorher erwirtschaftet worden ist“! (Kohl in der gleichen Rede). Ein nicht unbeträchtlicher Teil der nationalen Gelderträge ist schon längst „verteilt“. Und die Politik legt großen Wert darauf, daß diese Schulden auch bedient werden. Nur dadurch erhalten sie ihren Charakter als Kapital der Banken und verwandeln sich nicht in wertlose Versprechen, die abgeschrieben werden müssen und die Bilanzen des Kreditgewerbes in Unordnung bringen.
Die soliden Füße, auf die der Staat diese aufgelaufenen Schulden jetzt mit der Einrichtung eines „Erblastfonds“ angeblich stellt, bestehen darin, die Tilgung für zwei Jahre auszusetzen und die Kosten auf alle staatlichen Haushalte zu verteilen. Das Ganze nennt sich
„Föderaler Konsolidierungsplan“
und verfolgt eingestandermaßen keinen anderen Zweck, als den Ländern und Gemeinden die Rechnung aufzumachen, welche „Umschichtungen“ sie in ihren Haushalten zur Finanzierung der großen nationalen Sache machen können. Ab 1995 sollen nämlich die Ostländer in den „Finanzausgleich der Länder“ einbezogen werden – womit dieser eine gewisse Umdefinition erfährt. Einst ersonnen für den Zweck, den Ländern mit niedrigerem Steueraufkommen zusätzliche Finanzen für regionale Standortentwicklung zuzuschustern, wird mit ihm jetzt den Ländern im Westen die Rechnung aufgemacht, daß sie ihre bislang geltenden Notwendigkeiten in Sachen Wirtschaftsförderung, Kultur, Soziales etc. an die nationale Notlage anzupassen und vor Ort die „Angleichung der Lebensverhältnisse“ mit dem Osten zu vollziehen haben – allerdings anders herum, als dies bislang propagiert wurde. Daß die Landesherren – gerade angesichts der Wirtschaftskrise – sich da erst einmal sperren, ist klar; schließlich ist von ihrem Standpunkt aus ja nichts überflüssig geworden, was sie sich bisher zur Herstellung regionaler Standortattraktivität vorgenommen haben. Ebenso klar ist aber auch, daß sie schon ihre eigenen Mittel und Wege finden werden, das wirklich Wesentliche in ihren Haushalten von dem zu scheiden, was inzwischen allgemein als Luxus gelten darf. Angefangen haben sie ja schon damit.
So, mit „Erblastfonds“ und „Lastenverteilung“, soll die aufgelaufene Staatsschuld für den Osten die Qualität bekommen, unwidersprechlich solide zu sein. Die Selbstverpflichtung, einen Teil der auf allen Ebenen auflaufenden Revenue ab 1995 auf jeden Fall für die Bedienung dieser Schulden vorweg einzuplanen, soll beweisen, daß der deutsche Staat verantwortlich und umsichtig mit seinen Schulden umgeht und sie nicht einfach „explodieren“ läßt.
2. Standort neu definiert: Deutschland kämpft mit Staatskredit um Märkte
Das ist auch dringend nötig. Denn diese „Haushaltskonsolidierung“ soll ja die Basis abgeben für eine neuerliche Ausweitung des Staatskredits, die es in sich hat:
„Zur Unterstützung des notwendigen wirtschaftlichen Umbaus haben wir das größte Wirtschaftsprogramm in der Geschichte Deutschlands gestartet. Die finanziellen Hilfen übertreffen in ihrer Höhe die Marshallplan-Hilfe für Westdeutschland nach dem 2. Weltkrieg bei weitem.“ (Kohl bei der Regionalkonferenz Sachsen-Anhalt)
Die deutsche Führung hat beschlossen: Das Mittel, um aus der Krise zu kommen, ist die Fortsetzung und Radikalisierung des Programms, mit dem die Überakkumulation des Kapitals herbeigeführt wurde. Staatskredit en masse soll fließen, um unabweisbar gute Geschäftsbedingungen und -gelegenheiten im Osten zu stiften und so mit staatlicher Hilfe Kapitalanlage trotz der allgemeinen „Marktlage“ rentabel zu machen.
Die Mittel für dieses Projekt kommen zunächst einmal sehr konventionell daher: Anhebung der Investitionszulage für ostdeutsche Unternehmen auf 20% (bis 1997 10 Mrd. DM); Aufstockung der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“; mehr Mittel für Existenzgründungen und Wohnungsbau, ein paar Millionen für „industrienahe Forschung.“ Wo immer, wann immer ein Kapital sich entscheidet, eine Produktion im Osten aufzunehmen oder fortzuführen – der Staat sorgt auf jeden Fall dafür, daß seine Produktionskosten konkurrenzlos niedrig sind. Der Witz an diesen Maßnahmen ist allerdings der Zeitpunkt, zu dem der Staat sie beschließt, und die Exklusivität, mit der er Produktionen östlich der Elbe mit diesen Segnungen bedenkt. Schließlich ist das Kapital allerorten gerade dabei, Kapazitäten abzubauen und Produktionen zu streichen, die sich nicht lohnen; gerade da will die Politik durch das Schaffen von Sonderkonditionen die Konkurrenz darum, wo sich das Produzieren überhaupt noch lohnt, zugunsten des deutschen Ostens entscheiden. Die Wirkung, daß Betriebe im Westen zumachen und in den Osten abwandern, ist dabei durchaus einkalkuliert:
„Es häufen sich Meldungen, daß westdeutsche Unternehmen ihre Betriebe schließen, die Mitarbeiter entlassen und in einem der neuen Bundesländer mit Hilfe von Subventionen ein neues Werk errichten… Das Bundeswirtschaftsminsterium dazu: Es ist ein politisch gewolltes Fördergefälle zugunsten der neuen Bundesländer geschaffen worden. Dieses dient dazu, die Wettbewerbsnachteile des Standortes neue Bundesländer im Vergleich zum übrigen Bundesgebiet und zum Ausland auszugleichen… Unerwünschte Mitnahmeeffekte sind nicht zu verhindern. Im übrigen seien für die Auslagerung (im Fall Pfanni AG München) nicht die gewährten Investitionsmittel, sondern die gestiegenen Produktionskosten am Standort München ausschlaggebend gewesen, insbesondere die hohen Kosten der Abwasserbeseitigung.“ (HB 17.12.92)
So kann man es eben auch sagen, daß der „Standort Deutschland“ zu teuer ist – sollen doch die Gemeinden im Westen sehen, wie sie ihrerseits für eine Kostensenkung für „ihre“ Betriebe sorgen! Die Konkurrenz zwischen Standort (West) und Standort (Ost) ist politisch gewollt, weil beide zusammen die Konkurrenz mit dem Ausland bestehen sollen. Der deutsche Staat setzt darauf, daß er mit seinen Mitteln eine Anlage von Kapital in Deutschland erzwingen kann, gerade weil anderswo Kapitalentwertung in großem Stil stattfindet und die anderen EG-Staaten es sich gar nicht leisten können, in eine Subventionskonkurrenz mit Deutschland einzutreten. Für den Zweck gilt die Sonderförderung Ost dann glatt als erzieherische Maßnahme gegenüber dem Standort West, seinerseits alles für die Verbilligung der Kapitalanlage zu tun.
Davon, daß Unternehmen diese Kostensenkungsangebote ergreifen, will sich das staatliche Aufbauwerk im Osten aber nicht abhängig machen. Wo dem Staat das Urteil des Kapitals „Lohnt sich nicht!“ nicht paßt, nimmt er Ost-Betriebe und ihre kapitalistische Herrichtung in eigene Regie:
„Die massive Investitionsförderung wird fortgesetzt und weiter aufgestockt… Wir werden darüber hinaus – da haben wir dazugelernt, das ist wahr – in Gesprächen mit der Treuhand, den Landesregierungen, mit Arbeitgebern und Gewerkschaften dafür Sorge tragen, daß das, was man industrielle Kerne nennt, in den neuen Ländern erhalten bleibt.“ (Kohl vor dem Bundestag)
Mit diesem Projekt der
„industriellen Kerne“
erklärt der Staat die Treuhandbestände an DDR-„Produktionsstätten“, die er bislang bei sich als Last für die staatlichen Bilanzen registrierte, nun zu deren Mittel. Der alte Treuhandauftrag, im Hin und Her von „Privatisieren und Sanieren“ die alten DDR-Betriebe Stück für Stück loszuwerden oder zuzumachen, wird für beendet erklärt. Das, was er bringen sollte, eine Konjunktur des Kapitals im Osten, hat er nicht erbracht; dennoch kommt nicht infrage, die verbliebenen Reste an Produktionsstätten einfach abzuschreiben. An dessen Stelle tritt ein neues Projekt:
„Die bis 1994 noch nicht verkauften, aber grundsätzlich als sanierungs- und privatisierungsfähig eingestuften Treuhandunternehmen – voraussichtlich rund 1400 an der Zahl – sollen nach der Vorstellung der Waigel-Behörde in bis zu 10 Management-KGs zusammengefaßt… und als Holdings organisiert werden, die direkt dem Bundesfinanzministerium zugeordnet werden… Kapitalhilfen zum laufenden Betrieb und Zuführungen zum Eigenkapital kommen dann ab 1995 direkt aus dem Bundeshaushalt.“ (Wirtschaftswoche 5.2.93)
So nimmt der Staat von der Fiktion, die treuhänderische Verwaltung des DDR-Produktionsapparats sei eine vorübergehende Notlösung, bis die private Geschäftswelt endlich ihrem Auftrag zur Kapitalisierung nachkommt, endgültig Abschied und erteilt sich ein paar interessante neue Aufträge. Er betätigt sich nicht mehr nur als ideeller Gesamtkapitalist, der Bedingungen fürs Akkumulieren schafft und die Kapitalisten dann nach ihren Rentabilitätserwägungen entscheiden läßt, wo sie Produktionen dichtmachen oder erweitern, wo sie seine Hilfen in Anspruch nehmen oder links liegen lassen. Er tritt selbst in die Funktion anlagesuchenden Kapitals ein, um Produktion in Gang zu bringen, auch wenn sie sich für private Anleger nicht lohnt. Welche der verbliebenen Betriebe diesen staatlichen Aufwand lohnen, ist damit zwar noch nicht entschieden; darüber geht das Gerangel zwischen Treuhand, Ländern und Bund erst los. Klar ist aber, daß diese Entscheidung allemal eine politische ist, die sich absichtlich frei macht von der Reflexion darauf, was „der Markt“ gerade hergibt.
Den Lieblingsbürgern der Nation ist das gar nicht einfach recht:
„Die von der Treuhand verfolgte Umstrukturierung der ehemaligen DDR-Großchemie… betrachtet die Branche mit Sorge. Es sei zweifelhaft, ob es für die neuen entstehenden Produktionskapazitäten angesichts der Krise in Osteuropa überhaupt einen ausreichenden Markt gebe… Hilger (Präsident des Verbandes der Chemischen Industrie) befürchtet ein „Faß ohne Boden“ und die Verschleuderung von volkswirtschaftlichen Ressourcen.“ (HB 21.1.93)
Und der Wirtschafts-Graf setzt noch eins drauf:
„Lambsdorff kritisierte mit aller Schärfe das vom Kanzler vertretene Konzept der Erhaltung industrieller Kerne… Damit würde nur die Vergeudung von Ressourcen nach dem Muster der Planwirtschaft fortgesetzt. Was erhalten bliebe, wären keine industriellen Kerne, sondern taube Nüsse. … Die Planwirtschaft dürfe nicht durch den Interventionsstaat, die DDR I nicht durch die DDR II ersetzt werden.“ (HB 6.1.93)
Die Herren müssen sich sagen lassen, daß sie da etwas mißverstanden haben:
„Wenn die westdeutsche Stahlbranche den Stahlstandort Eisenhüttenstadt als überflüssig ansieht, sagen wir: Mit EKO steht und fällt eine ganze Region… Und wenn westdeutsche Konzerne meinen, eine Chemieindustrie in Ostdeutschland solle nur als eine Art „Ergänzungswerk“ existieren, dann sagt die Treuhand auch dazu entschieden nein.“ (Vizepräsident der Treuhand Brahms, lt. HB 27.12.92)
Die Beschwerden der Kapitalisten, die weder für ihr Geschäft einen Nutzen in einer neuen, auch noch staatlich betreuten Konkurrenz entdecken können noch einsehen mögen, was es denn der Nation nützen soll, wenn neue Kapazitäten (Ost) bloß Vernichtung von Kapital (West) zur Folge haben, werden von Staatsvertretern ebenso zurückgewiesen wie der Vorwurf der FDP-Liberalen, hier würde sich der Staat unsachgemäß in die Domäne des Kapitals einmischen. Die staatliche Übernahme setzt eben gar nicht auf „Märkte“, die für diese „Produktionen“ da wären – da hätten sie ja dichtgemacht werden müssen. Es soll ausdrücklich das Gegenteil gelten: Mit neuen Kapazitäten sollen neue „Märkte“ erschlossen werden, gegen die Konkurrenz. Dafür sollen neue, mit modernster Technik und Produktionspalette und niedrigen Ost-Löhnen aufgerüstete Werke her:
„Sich von den Ostmärkten zu lösen und in westliche Märkte einzudringen bedeutet, was die Erreichung von Weltmarktstandards als auch moderne Fertigungskapazitäten anbelangt, eine erhebliche Durststrecke. Entscheidend dabei ist, daß den sanierungsfähigen Unternehmen dabei die Luft zum Atmen bleibt“. (Ders.)
Die Konkurrenzlage des Kapitals, die diesen Betrieben „die Luft zum Atmen“, sprich: das lohnende Geschäft bestreitet, ist damit als Kriterium außer Kraft gesetzt. Umgekehrt müssen die schon eingerichteten, „fertigen“ Kapitale (West) zusehen, wie sie sich an den neuen Konkurrenzstandards, die der Staat ihnen aufmacht, bewähren. Ob die staatliche Aufpäppelung neuer Betriebe sich dann als „Verschleuderung volkswirtschaftlicher Ressourcen“ erweist oder als nützliche Investition in Deutschlands Zukunft – das entscheidet sich, wie immer, am Erfolg.
Die Korrektur am alten Treuhand-Auftrag, der ja auch schon seine Mrd. verschlungen hat, heißt also: Wenn schon Geld für die Zone, dann doch gleich „richtig“. Der Staat bezieht sich auf seinen eigenen, für diese Betriebe schon hingelegten Kredit und beschließt, daß der nicht rausgeschmissenes Geld sein soll, sondern im Nachhinein doch noch zu einer Zukunftsinvestition werden kann, wenn er sich nicht vom Investitionswillen seiner Kapitalisten abhängig macht, sondern sich selber als Agent des Aufbaus von zukunftsträchtigen Produktionsstätten betätigt und dafür seine Mittel aufstockt. Der Standpunkt der „Sicherung industrieller Kerne“ hat deshalb auch wenig damit zu tun, daß da früher schon mal DDR-Betriebe waren. Es geht nicht um „erhalten“, sondern alle Produktionsbedingungen werden umgewälzt, einschließlich der Belegschaften, von deren ursprünglicher Zahl minimale Reste übrigbleiben. Die neuerlich fälligen Entlassungswellen gelten denn auch inzwischen nicht mehr als bedauerlicher Nebeneffekt der Sanierung einer maroden Wirtschaft, sondern ausdrücklich als Indiz dafür, daß da jetzt wirklich auch unter staatlicher Regie konkurrenzfähige Unternehmen hingestellt werden.
3. Vaterlandslose Gesellen neu in die Pflicht genommen
Die Entscheidung, im Osten in eigener Regie Kapitalwachstum herbeizuzwingen, ist eine Kritik des Staates am Kapital: Die Erweiterung des Kapitals, die diese vaterlandslosen Gesellen in der Krise nicht machen mögen, macht er eben selbst und konfrontiert sie mit den Konsequenzen. Gleichzeitig läuft im Westen die Krise zu Hochform auf; Großbetriebe verkünden ständig neue Produktionskürzungs- und Entlassungszahlen. Im Fall der Beinahe-Pleite des Klöckner-Konzerns wurde schon einmal in großem Stil die Entwertung von Kapital und Kredit durchgezogen, die der deutschen Wirtschaft jetzt ins Haus steht: Ein deutscher Stahlstandort macht fast ganz dicht, nur das Streichen von 60% des Kredits der Gläubiger und umfassende Liquiditätsgarantien stellen sicher, daß das Unternehmen überhaupt weiter existiert. Zwar wurde dieser „Fall“ noch in reibungsloser Absprache zwischen Staat, Banken, Firmenleitung und Betriebsrat durchgezogen, als wäre er ohne weiteres zu verkraften für die Bilanzen der Kreditgeber; offenbar legt alle Welt viel Wert darauf, daß Zweifel an der Solidität des deutschen Kredits auf keinen Fall aufkommen. Aber gleichzeitig gehen alle, die es wissen müssen, davon aus, daß dies erst „der Anfang“ ist. Schon kündigen Vertreter des Bankgewerbes in Form eines Dementis an, daß ihre eigene Geschäftslage solche Rettungsaktionen für faul werdende Kredite des produktiven Kapitals eigentlich nicht zuläßt:
Sie seien „für die anstehenden Probleme gut gerüstet“ und würden „den Regenschirm nicht zumachen, sobald ein Unternehmen in Schwierigkeiten gerät, falls eine sinnvolle Lösung möglich ist“ (der Präsident der Bayr. Bankenverbandes lt. HB 15.11 92); „für Risiken aus dem Kreditgeschäft müssen nicht unbeträchtliche Vorsorgen gebildet werden“ (Kopper von der Deutschen Bank lt. HB 8.12.92); usw.
Daß in dieser Lage auch allerhand Investitionsvorhaben im deutschen Osten storniert oder rückgängig gemacht werden, versteht sich von selbst, so daß der Staat mit seinem Programm der regionalen Standortsicherung verstärkt gefordert ist.
Die Politik nimmt dies nicht zuletzt in der Form zur Kenntnis, daß ihre Verschuldung wegen rückläufiger Steuereinnahmen und größerer Beanspruchung von allerlei „Töpfen“ weiter wächst, wird aber dadurch in ihrem Kurs nicht irre. Sie verhandelt die Krise als bloß vorübergehenden „Einbruch“ bei Kapitalwachstum und Gewinnen, dem die Politik am besten dadurch beikomme, daß sie dem Kapital in Ost wie West beim Kostensenken unterstützt. Z.B. indem sie ihren produktiven Bürgern einiges an staatlichem Zugriff auf ihren Reichtum erspart. Mit einem
„Standortsicherungsgesetz“
macht der Staat den Unternehmen das Angebot der Senkung der Einkommens- und Körperschaftsteuer und fordert sie auf, diese Maßnahme in seinem Sinne umzusetzen:
„Mit dem Standortsicherungsgesetz erreichen wir die niedrigsten Ertragssteuergesetze seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland. Das ist jenseits aller betriebswirtschaftlichen Rechnungen (wieso jenseits?) ein wichtiges Signal für die Wachstumsorientierung unserer Politik und für den Stellenwert, den wir privaten Investitionen und betrieblichem Wachstum zumessen.“ (Waigel vor dem BDA, Bulletin 16.12.92)
Das Angebot nimmt das Kapital natürlich gerne mit. Es ist durchaus ein zukunftsweisendes Angebot des „Standorts Deutschland“, wenn der Staat Unternehmenssteuern streicht und damit kundtut, daß er sich nicht, wie andere EG-Staaten, von seinen Haushaltskalkulationen zu Rückgriffen auf die Einkünfte derer genötigt sieht, die das Wachstum bewerkstelligen. Ob die Unternehmen deshalb schon im staatlich gewünschten Umfang der Aufforderung „Nun wachst aber auch gefälligst!“ nachkommen, ist natürlich eine andere Frage.
Bei dieser Aufforderung läßt es die Politik aber nicht bewenden. Anders als zu früheren Zeiten will sie für ihr Entgegenkommen von den Unternehmern eine Gegenleistung, die über das bloße „Wachsen“ ihrer Investitionen und Gewinne hinausgeht:
„Ich hoffe, daß wir verstärkt Anstrengungen erleben, daß westdeutsche Großunternehmen einen größeren Teil ihrer Lieferungen aus den neuen Bundesländern beziehen und daß sie sich dazu verpflichten, hier bewußt aus gesamtstaatlicher, patriotischer Gesinnung heraus ihre Aufträge entsprechend zu plazieren“ (Kohl von dem Bundestag) – laut „Spiegel“ ist es „das Ziel der Koalition, daß jeder Westbetrieb 20% seiner Vorprodukte im Osten ordert.“ (51/92)
Kosten- und Ertragsrechnungen – eine Gesinnungsfrage? Das sind schon ziemlich neue Töne von einer politischen Führung, die ansonsten davon lebt, daß deutsches Kapital hinausgeht in alle Welt, sich von überall her seine Produktionsfaktoren nach Maßgabe ihrer Billigkeit besorgt, alle Märkte für sich nutzt und sich weltweit nach Standortkriterien anlegt – ganz vaterlandslos und wie es sich gehört. Das soll das deutsche Kapital auch weiterhin tun – aber eben nicht nur. Deutsche Unternehmer sollen, so der Wille der Politik, sich auf Dienstleistungen für die Nation verpflichten lassen, sich als Wirtschaftsnationalisten betätigen; dafür sagt der Staat ihnen alle Leistungen zu, die ihm zu Gebote stehen.
„Die Wirtschaft“, wie diese Herren zurecht heißen, sieht es gerne, wenn die Profitmacherei so umstandslos zum Dienst an der Nation avanciert, und kennt auch Konditionen, unter denen sie sich die Mahnung der Politik zu Herzen nehmen könnte:
„Die Wirtschaft machte deutlich, daß sie das Zustandekommen eines Solidarpaktes wünsche und davon ausgehe, daß in den weiteren Verhandlungen die Kürzung der Sozialausgaben beibehalten, der Mißbrauch sozialer Systeme intensiver bekämpft, keine zusätzlichen Steuern beschlossen und am Standortsicherungsgesetz festgehalten werde… Die Wirtschaft kündigte an, sie werde trotz der verschlechterten konjunkturellen Lage alles daran setzen, an ihren bisherigen Investitionsplanungen festzuhalten. Alle Bereiche zusammen planen für 1993 Investitionen in Höhe von 130 Mrd. DM in Ostdeutschland… Die deutsche Kreditwirtschaft wird ihren Beitrag zum Privatisierungsprozeß in den östlichen Bundesländern erheblich steigern.“ (Gemeinsame Erklärung des Bundeskanzlers und der deutschen Wirtschaft zum Solidarpakt, Bulletin 27.1.93)
Als Opfer einer „konjunkturellen Lage“ weisen die Herren über Kosten und Erträge vorsorglich darauf hin, daß ihre Rechnungen sich ziemlich nationalismusfernen Gesichtspunkten verdanken und es so gesehen ein einziges Zugeständnis von ihnen ist, wenn sie sich dem staatlichen Ansinnen dennoch aufgeschlossen zeigen. So ganz die Wahrheit ist das nicht: Kapitalisten kennen nämlich derzeit durchaus eigene gute Gründe, auf Deutschland als Standort zu setzen, wenn es denn derzeit schon darum geht, wo Kapazitäten abgebaut, wo gesichert und wo für die nächste Expansion des Geschäfts umgerüstet werden. Erstens ist das Staatsprojekt der Aufmöbelung des Ostens ein einziges Angebot an die nationale Geschäftswelt: In dem Umfang, in dem der Staat selbst zum Ausgangspunkt für Aufträge und Gewinne wird, ist es wichtig, da an vorderster Front dabei zu sein, zumal die Politik manches dafür tut, daß aus seinen Vorhaben Aufträge für heimische Firmen werden. Falls das Projekt scheitert, wird man dann wieder mit lauter Horrornachrichten über Filz und Geldverschieberei zwischen Staat und Wirtschaft versorgt werden. Und zweitens gilt dies erst recht, wenn ein Staat wie Deutschland, also die europäische Führungsnation und Wirtschaftsmacht, so ein Vorhaben mitten in der Krise aufmacht, daß das Angebot mit seinen Zukunftsaussichten und Risiken einige Spekulation wert ist. Da fällt noch jedem deutschen Multi ein, daß hier schließlich das Hauptgeschäft läuft, mit dem sich DM verdienen und in DM Kredit ziehen läßt. Zumal auch noch die Sicherheit besteht, daß die Kapitalisten mit ihrer Forderung nach staatlicher Senkung der Kosten für das nationale Arbeitsvolk bei der Politik offene Türen einrennen: Die hat ja schon von ihren eigenen Programm her den Standpunkt in die Welt gesetzt, daß dem Kapital das Gewinnemachen in Deutschland wirklich nicht zuzumuten sei, wenn die ganze Nation in Sachen Lohn und Soziales über ihre Verhältnisse lebt. So passen die Rechnungen des Staates und die seiner Wirtschaft im großen und ganzen dann doch wieder ganz gut zusammen.
4. Ein deutscher Binnenmarkt für das Fertigmachen der EG
Mit dem Programm „Standort Deutschland“ kommt in die staatliche Wirtschaftspolitik ein Moment der Autarkie. Ausweitung der Kapitalanlage in Deutschland, statt und gegen andere Kapitalstandorte, heißt das Programm. Die „Exportnation“ nimmt den Umstand, daß deutsche Unternehmen ihre Warenmassen auswärts nicht mehr realisieren können, nicht als Signal dafür, daß der Staat sich dieser „Lage“ dann eben anbequemen muß, daß sein Dienst am Kapital darin zu bestehen habe, ihm beim „Gesundschrumpfen“ und beim Neuanfang unter die Arme zu greifen. Vielmehr stellt er sich explizit auf den gegenteiligen Standpunkt: Für seine Ansprüche, als Basis seines ausgeweiteten Kredits hat das Kapital zu wachsen. Angesichts einer Lage, in der das Investieren in und Exportieren nach den anderen EG-Staaten nicht mehr sichere Quelle deutschen Kapitalreichtums und deutscher Kreditvermehrung ist, besinnt sich der Staat darauf, daß die Masse Kapitalreichtum, die auf seinem Territorium akkumuliert, immer noch Grundlage und Quelle der Überschüsse ist, die sich auswärts in Kapital verwandeln lassen und seinen Kredit zu Geld machen. Deutschland nimmt für sich ein Stück Unabhängigkeit von der Weltkonjunktur in Anspruch: Mit deutschem Geld soll zu schaffen sein, was den anderen EG-Staaten verunmöglicht wurde, nämlich „aus eigener Kraft“ wieder die gute DM zu werden, die sie einmal war.
Das ist allerdings auch der Widerspruch des Projekts. Der deutsche Staat setzt mitten in der Überakkumulation neu und radikalisiert auf Ausweitung; praktiziert also den Zirkel, daß zur Sicherung einer wachsenden Verschuldung noch mehr Verschuldung her muß. Es tut dies ausdrücklich gegen die anderen europäischen „Standorte“, die zugleich die bevorzugten Käufer der auf diese Weise neu in den Welt kommenden Warenmassen aus Deutschland sein sollen. Der Standpunkt „Kapitalentwertung – nicht bei uns!“ will nicht zulassen, daß eine Wirtschaftskrise in Deutschland die DM entwertet; er will die erreichte Vormachtstellung des deutschen Geldes in der EG sichern. Und das macht er, indem er die schon mit Maastricht eingeschlagene Strategie, die Krisenfolgen auf die anderen EG-Staaten abzuwälzen, fortsetzt und radikalisiert.
In der EG ist diese Kampfansage durchaus angekommen; Beschwerden darüber fallen allerdings ziemlich matt aus. Die EG-Kommission sieht sich bemüßigt, einmal anzufragen, ob das deutsche Programm wirklich so gemeint ist, wie es daherkommt: Sie
„hat erstmals ein wettbewerbsrechtliches Verfahren gegen die Berliner Treuhandanstalt wegen der Preispolitik eines von ihr betreuten Unternehmens eingeleitet… Die Kommission sei zu dem Schluß gekommen, daß die von der Treuhand zur Verfügung gestellten Darlehen und Bürgschaften von Buna mißbräuchlich eingesetzt würden… Im Bundeswirtschaftsministerium heißt es, die ostdeutschen Unternehmen würden fortlaufend darauf hingewiesen, daß ihnen gewährte Beihilfen nicht zu wettbewerbswidrigen preispolitischen Aktivitäten führen dürften.“ (HB 23.12.92)
Unverdrossen hält die EG-Kommission daran fest, daß es sich bei dem Ost-Aufmöbelungsprojekt um einen im Prinzip „EG-konformen“ Beitrag zur Entwicklung des Gesamt-Standorts handele, der unter dem Gesichtspunkt des im EG-Kontext wettbewerbsrechtlich Zulässigen begutachtet gehöre. Und die deutsche Regierung macht die Fiktion mit, als sei nicht das ganze Ostprojekt auf eine „Preispolitik“ berechnet, die die EG-Konkurrenz vom Markt verdrängt. Sie hat dafür gesorgt, daß die neuen Länder in das Regional- und Strukturprogramm aufgenommen und mit Milliarden aus den entsprechenden Töpfen gefördert werden. Sie läßt sich von der EG „Subventionen“ genehmigen, etwa für Opel in Eisenach, als sei ein völlig neues Autowerk auf deutschem Boden dasselbe wie ein Mittel zur „Standortverbesserung der europäischen Autoindustrie“. Was soll die EG-Kommission auch sonst machen? Schließlich hat sich Deutschland mit dem DDR-Anschluß von Anfang an auf den nationalistischen Standpunkt gestellt, daß es sich mit den EG-Partnern über Bedeutung und Konsequenzen dieses Projekts für Europa nicht verständigen müsse, und hat zugleich ganz selbstverständlich beansprucht, daß hinzugekommene DDR-Kapazitäten, etwa in der Landwirtschaft, quasi automatisch lauter neue deutsche Anspruchsberechtigungen auf EG-Gelder eröffnen. Die deutsche Vormachtstellung in Europa hat erzwungen, daß kein EG-Staat es sich leisten konnte, sich dagegen aufzulehnen. Das ist jetzt erst recht der Fall, wo Deutschland darauf pochen kann, daß die anderen EG-Staaten mit ihren Nationalkrediten mehr denn je von DM-Garantien abhängen.
Die geplante Erweiterung des Standorts Deutschland ist ganz auf die Vollendung des Projekts Europa berechnet; auf eine Zukunft, in der Deutschland Teil – und zwar der gewichtigste Teil – eines einigen Europa sein soll. Neue, zusätzliche Kapazitäten in Deutschland sollen Ausweis dessen sein, daß sie woanders nicht gebraucht werden; der Binnenmarkt Deutschland soll bestimmen, was wo im Binnenmarkt Europa noch lohnend produziert wird. Wenn die Frage aufkommt, wo sich in Europa das Investieren und Produzieren lohnt, was in Europa noch an Kapazitäten in dieser oder jener Branche benötigt wird, was dichtzumachen ist, soll die Antwort im Prinzip immer schon feststehen, weil es in Deutschland schon alles gibt, und zwar auf dem modernsten Stand. Das künftige Europa hat seinen entscheidenden Standort, seinen weltweit gültigen Kredit in Deutschland – also will Deutschland auch befugt sein zu entscheiden, wie, unter welchen Konditionen und in welcher Form, dieses Europa zustandekommt.
Damit soll zugleich die Herstellung dieser Einheit Europas unwidersprechlich gemacht werden, indem so den EG-Partnern praktisch vorgeführt wird, daß ihnen gar nichts anderes übrigbleibt, als sich diesem deutschen Europa ein- und unterzuordnen.Das ist jedenfalls das politische Ideal, das Deutschland mit dieser neuen Mobilisierung seiner ökonomischen Potenzen verfolgt. Es verfolgt es allerdings mit Mitteln, die ein einziger Widerspruch sind, solange es dieses Europa noch nicht gibt. Indem die deutsche Politik für die Ausweitung der Produktionskapazitäten in Deutschland sorgt, bestreitet sie ja nicht nur anderen Standorten die Erwirtschaftung der Kaufkraft für die in Deutschland produzierten Warenüberschüsse. Sie greift damit zugleich die Ertragsrechnungen der EG-Partner an, die ihre nationale Zahlungsfähigkeit ja immer noch in eigenem Geld, auf Basis eigenen Wachstums und Kredits bilanzieren. So untergräbt Deutschland selbst die Währungen der anderen EG-Staaten, denen es dann wieder mit neuem DM-Kredit unter die Arme greifen muß, damit nicht der gesamte Kreditüberbau der EG ins Wanken kommt. Solange die unterschiedlichen Erträge der verschiedenen EG-Standorte noch als Basis von lauter nationalen Einzelabrechnungen dienen, fungieren sie eben nicht als mehr oder minder gewichtiger, positiver Beitrag zu einer gesamteuropäischen Bilanz, deren Zentrum in Deutschland liegt, sondern werden als mehr oder weniger taugliche nationale Bilanz im Währungsvergleich bewertet. Die Nationalkredite der Standortverlierer geraten „unter Druck“, werden also entwertet und wirken damit als lauter Beschränkungen und Unsicherheitsfaktoren für die Herstellung eben dieses einheitlichen Wirtschaftraums und EG-Kredits, auf den es den Deutschen ankommt. So macht Deutschland den anderen europäischen Nationen die Entscheidung auf, ob sie sich zu Europa erpressen lassen wollen: Sie müssen sich die Frage vorlegen, ob sie sich das Festhalten an Souveränitätsvorbehalten noch leisten können, wenn ihnen die Hoheit über ihr Geld abhanden kommt, und sollen sich deshalb unabhängig von nationalen Vorteils-Nachteils-Rechnungen zur Aufgabe ihrer Souveränität entschließen. Damit liegt auf dem Tisch, wie wenig Europa ein konsensmäßig abzuwickelndes Einigungswerk, wie sehr es ein Eroberungsprojekt ist. Das ist aber auch der Haken am deutschen Vorgehen: Die ökonomische Erpressung der Rest-EG beruht darauf, daß Deutschland über politische Zwangsmittel, die anderen zur Souveränitätsaufgabe zu zwingen, eben nicht verfügt. Gerade deshalb tut diese Nation alles, um diesen Mangel zu kompensieren.
III. „Der Staat spart“ – an seinen Bürgern
Ob das deutsche Programm geht, wird sich herausstellen. Dessen Macher haben jedenfalls ein Bewußtsein vom politökonomischen Abenteurertum ihres Kurses: Das beweist ihr dauerndes Mahnen zur Sparsamkeit, ihr unablässiger Streit um die Notwendigkeit oder Überflüssigkeit dieser oder jener Ausgabe oder Kürzung. Sie haben sich nun einmal zur Praktizierung des Zirkels entschlossen, nach dem wegen ihrer Schulden Wachstum her muß und für das Wachstum mehr Schulden her müssen. Wegen dieser Strapazierung des Nationalkredits kommt es ihnen gegenüber den mißtrauischen Beobachtern dieses Kurses in den Chefetagen der internationalen Finanz- und Politwelt sehr auf den Beweis an, daß die deutsche Politik alle ihre Vorhaben rigide dem Gesichtspunkt eines soliden Entsprechungsverhältnisses von Verschuldung und bezweckter Vermehrung nationaler Erträge unterordnet. Gerade weil der Staat mit seinen Schulden Geschäfte lohnend machen will, die es derzeit nicht sind, demonstriert er, daß sein Umgang mit dem Kredit sich wirklich nur diesem Zweck verdankt; daß er kein überflüssiges Geld verausgabt, seinen Kredit wachstumsfördernd einsetzt und ihn deswegen berechtigterweise in Anspruch nehmen kann.
Als ein Mittel, dieser Beweisabsicht Glaubwürdigkeit zu verschaffen, gilt seit geraumer Zeit die „Zinspolitik“ der Bundesbank. Im Hin und Her von Schwindel und Vertrauensbildung hat man sich darauf geeinigt, den Bundesbankzinsen neben der Funktion, Geldkapital nach Deutschland zu attrahieren, den Charakter eines „Signals“ dafür zuzusprechen, daß es der deutschen Politik mit ihrem Anliegen ernst ist, die Stabilität der DM zu „verteidigen“ – ob die Zinshöhe irgendeine von den Wirkungen zu verantworten hat, die man ihr anhängt, ist dafür ziemlich unerheblich.
So unerläßlich die Politik diesen Beweis offenbar findet – auch jetzt, wo die „Konjunktur einbricht“, sieht sich die Bundesbank ja durchaus gehalten, ihren „Stabilitätskurs“ beizubehalten –; auf die Überzeugungskraft solcher eher ätherischen Gebilde mag sich die Politik überhaupt nicht verlassen. Mit ihrer Haushaltsgestaltung macht die Regierung den Standpunkt praktisch wahr, daß das ganze Volk sich als Mittel der Währungs- und Standortpflege zur Verfügung stellen muß, wenn das nationale Projekt klappen soll. Der Staat, der sich in seinem Verschuldungswesen keine Schranken auferlegen will, entdeckt bei seinen Massen gleich doppelt den Ansatzpunkt für die Behebung der Nöte, die seine wachsenden Schulden und das sinkende Wirtschaftswachstum, das sie tragen soll, mit sich bringen. Wenn öffentlich allen Ernstes der Lohn in Deutschland zum Grund für die Krise und die staatlichen Finanzsorgen erklärt wird, dann verdankt sich diese Diagnose dem Rezept, mit dem der Staat seinen Sorgen begegnet: Das Einkommen der Massen wird unter dem Gesichtspunkt neu besichtigt, was es als Finanzierungsquelle des staatlichen Haushalts noch alles hergibt – und wieweit es sich als Kost der Unternehmer senken läßt.
Die erste Hälfte dieses Programms besteht darin, die Revenue der Massen für immer mehr staatliche Einnahmen haftbar zu machen und sie für die Bewältigung von immer mehr bislang von staatlichen Kassen erledigten Aufgaben neu zu beanspruchen. Echt verdientes Geld wird im wachsenden Umfang der individuellen Konsumtion entzogen und zur Finanzierung des Staatshaushalts herangezogen. Nicht, weil die Politik etwa meint, mit diesen Zusatzeinnahmen ließen sich die Mrd. Staatsschulden abzahlen; die wachsen ja gleichzeitig weiter. Sondern um das Verhältnis von Einnahmen und Schulden zu verbessern, also zum Beleg, daß diese Schulden solide sind, weil der Staat daneben wirklich alles an Einnahmequellen ausschöpft, was ihm im Lande ohne Schaden für das Wachstum zu Gebote steht: Der sichere Zugriff auf diese Geldquellen soll die Solidität all der Gelder verbürgen, die sich bloß dem staatlichen Willen verdanken, über mehr Zahlungsfähigkeit zu verfügen, als er verfügt. Beim Schröpfen der Bürger kommen durchaus stattliche Summen zusammen. In dem Umfang benötigt die Politik dann schon mal keinen zusätzlichen Kredit; also kann sie auch guten Gewissens noch welchen auflegen. Den gleichen Zweck verfolgen die Kürzungen bei den Sozialausgaben. Der Staat beschließt, daß diese in der bisherigen Höhe für Standortpflege und Wachstum nicht nötig sind. Also können sie wegfallen und beweisen schon dadurch die Gediegenheit eines Haushalts, der keine überflüssigen Geldmittel für die Massenbetreuung verschleudert. Womit der Staat der Frage, inwieweit solche entfallenden Dienstleistungen an seinem Arbeitsvolk – Kindergärten, medizinische Versorgung u.ä – für die Funktionsfähigkeit seiner Massen irgendwie „nötig“ seien, erledigt: Die Leute müssen zusehen, wie sie mit der neuen Lage zurechtkommen.
Der zweite Teil des Programms besteht darin, das nationale Lohnniveau für die alles entscheidende Standortbedingung auszugeben und auf ihre Verbesserung zu dringen. Von Staats wegen wird für eine Senkung der Löhne und Gehälter gesorgt. In dem Bereich, wo der Staat als öffentlicher Arbeitgeber selbst zuständig ist, sowieso. Zugleich will die Politik mit dem Abschluß im öffentlichen Dienst Leitlinien für alle Sparten vorgeben, wo das Kapital noch mit den Gewerkschaften über neue Tarife verhandelt. Der Staat sichert dem Kapital jede Unterstützung zu bei der Durchsetzung des Standpunkts, daß es beim Lohn von den Lohnbeziehern nichts an Ansprüchen anzumelden gibt, sondern umgekehrt das Kapital neue Ansprüche aufmachen und darüberhinaus alte Abmachungen außer Kraft setzen muß: beispielhaft in den Tarifverhandlungen in der Metallindustrie (Ost). So soll per politischem Beschluß die Verarmung der Massen der Hebel sein, um ein nationales Projekt zum Erfolg zu führen, das unsolide ist wie nur was.
Dies das Wozu des deutschen Sparprogramms am Volk. Der Wirtschaftsimperialismus Deutschlands liefert die zwingenden und öffentlich anerkannten Gründe für das Spar- und Standortverbesserungsprogramm in Sachen Lohn, das unter dem Firmenschild „Die Nation in Not!“ läuft. Mit seinen einschlägigen Maßnahmen und Techniken betätigt sich das erweiterte Deutschland als Klassenstaat, der alle Lebensverhältnisse der doppelt dienstbaren Lohnarbeiterklasse umwälzt.
1. Die Einkommen der Bürger – Geldquelle des Staates
Seit der Staatsnotstand ausgerufen ist, steht eines unverbrüchlich fest: Das deutsche Volk lebt über seine Verhältnisse. Dieser Befund verträgt sich offenbar problemlos mit den gleichzeitig auf allen Kanälen breitgetretenen Schilderungen der Armut, mit der beträchtliche Teile eben dieses Volkes inzwischen zurechtzukommen haben. Das ist insofern kein Wunder, als die Sache umgekehrt gemeint ist: Alle, die noch in Lohn und Brot sind oder sogar noch ein wenig darüber, haben auf jeden Fall noch etwas abzugeben und sollen sich dazu aus „Solidarität“ bereitfinden.
Soweit die Moral. Die ist ziemlich durchgesetzt, aber von der macht sich der Staat wie immer überhaupt nicht abhängig; er macht sie zwangsweise wahr. Er befindet sich ja in der glücklichen Lage, in seiner Steuerhoheit über alle Hebel zu verfügen, den Leuten soviel Geld aus der Tasche zu ziehen, wie er benötigt. Es gibt keine ökonomische Tätigkeit, die der Staat nicht schon kassenmäßig ins Auge gefaßt und zur Grundlage von Einnahmen gemacht hätte. Jetzt mustert er alle seine Steuern streng unter dem Gesichtspunkt durch, welche sich in noch größerem Umfang als staatliche Geldquelle benutzen lassen. Ganz nebenbei zieht er eine alte Sozialstaatsideologie aus dem Verkehr, wonach die gezahlten Steuern der Bürger so etwas wären wie Anspruchstitel auf irgendwelche Dienste, die sie dafür beanspruchen könnten. In der jetzigen Lage steht fest, daß hier nur noch einer Ansprüche stellt, und das nicht zu knapp.
Beim Vergrößern seiner Einnahmen geht der Staat ganz klassenneutral vor. Jeder wird zur Kasse gebeten, nach Maßgabe des Umfangs, in dem er in die besteuerten ökonomischen Transaktionen verwickelt ist:
Da ist zunächst einmal das schlichte Geldverdienen. Das tut fast jeder, also kommt da auch am meisten rein. Eine „Ergänzungsabgabe für Besserverdienende“, zu denen nach staatlichen Diktum die meisten seiner Lohn- und Gehaltsempfänger sowieso gehören, ist da genau das Passende.
Handel und Wandel sind ebenfalls eine schöne Geldquelle, weil denen erst recht niemand auskommt. Daß jeder einkaufen muß, was er braucht, macht den Konsum, vom Staatsstandpunkt aus betrachtet, zu einer ziemlich unbegrenzt belastbaren Geldquelle. Ganz im Unterschied zum Gewinn, dessen ökonomische Funktion für den Standort seinen Nutzen als staatliche Geldquelle ganz erheblich übertrifft (vgl. Teil 1).
Der Standpunkt, daß die Steuerkassiererei da zuschlagen muß, wo erstens viel reinkommt und sich zweitens garantiert keiner dem verlangten Notopfer entziehen kann, ist inzwischen ein weiteres Mal fündig geworden: Autobahngebühr und Mineralölsteuer. Ganz schlicht und zugriffsmäßig macht sich der Staat zunutze, daß die Leute für die Abwicklung ihrer alltäglichen Notwendigkeiten bestimmte Sachen einfach brauchen; also schenkt er sich alle Umwege und besteuert unmittelbar ihren Geldbeutel. So ähnlich muß Maggie Thatcher bei der Einführung ihrer „Kopfsteuer“ auch gedacht haben. Außerdem betreibt er an dieser Stelle eine weit vorausschauende „Strukturpolitik“: Straßen und öffentliche Verkehrsangebote sollen den Charakter eines allgemeinen Gutes, für das der Staat einsteht, auch mit Geld, um seine Benutzbarkeit für jedermann zu gewährleisten, ganz prinzipiell eintauschen gegen ein Dasein als Ware, an der privat verdient wird: neue Anlagemöglichkeiten für Kapital, wo bislang die öffentliche Hand Ausgaben und Haushaltsrisiken verbuchen muß.
Bei der Durchsetzung dieses Schröpfprogramms verzichtet die Politik ganz auf irgendwelche konjunktur- oder sozialpolitischen Reflexionen, wie sie bei früheren Korrekturen in Sachen Steuerpolitik üblich waren. Die Abwägung etwa, ob nicht unter dem Gesichtspunkt der „Kaufkraft“, also der nationalökonomischen Funktion der Konsumeinkommen für die Realisierung von Unternehmensgewinnen gerade in der Krise, dieser staatliche Zugriff auch seine schädlichen Seiten für „die Konjunktur“ haben könne, ist als belebendes Moment steuerlicher Debatten aus der Öffentlichkeit verschwunden. Heutzutage kommt es eben darauf an, daß der Staat über alle Kaufkraft verfügt, derer er habhaft werden kann. Nationaler Konsens ist, daß der Staat wegen seiner Vorhaben das Recht auf jeden Pfennig hat, den er bei seinen Bürgern locker machen kann: Daß er ihnen soviel abknöpft, beweist geradezu die Not, in der er sich befinden muß. Das Glück, auf dem Standort Deutschland zu leben, ist eben ziemlich teuer.
2. Neues vom Sozialstaat
Das Streichen von Posten im Staatshaushalt bzw. in den anderen staatlichen Kassen trifft gar nicht zufälligerweise wieder die, die schon bei den staatlichen Einnahmen gefordert waren. Der Hebel für den Staat, Ausgaben loszuwerden, ist auch hier wieder der Umstand, daß er mit seinem Einsammeln und Auszahlen von Geldern in den Lebensunterhalt der Massen in so großem Umfang eingemischt ist. Mit den Sozialversicherungsbeiträgen hat er ansehliche Lohnbestandteile verstaatlicht und es damit von seinen Kalkulationen abhängig gemacht, wieviel von diesem Geld den Beitragszahlern je wieder zufließt. Und mit Sozialhilfe, Wohngeld usf. fallen weite Abteilungen des ganz normalen, unmittelbar nötigen Lebensunterhalts ganz in die Disposition des States, der frei entscheidet, welche Aufwendungen er in diesen Bereichen für notwendig oder überflüssig hält. Daß diese Kalkulationen mit Bedarf oder gar Bedürfnissen der Betroffenen nichts zu tun haben, weiß irgendwie jeder; sie sind eben die abhängigen „Empfänger“ staatlicher Zuwendungen, die als Wohltaten überhaupt nur durchgehen, weil Leute, die allein nicht einmal die schlichtesten Lebensnotwendigkeiten bezahlen können, ohne sie noch mittelloser dastünden.
Diese wunderbare Einrichtung politisch festgelegter und verwendeter Lohnteile, „Sozialstaat“ genannt, bildet jetzt die Grundlage für die staatlichen Streichaktionen. Der staatliche Standpunkt, daß hier „zuviel“ gezahlt worden sein muß, ergibt sich zunächst einmal ganz schlicht aus dem Befund, daß diese staatliche Aufwendungen ständig gewachsen sind. Ebenso schlicht und undramatisch kommt der „Sparbeschluß“ in diesen Abteilungen daher: Wenn überall der Gesichtspunkt der „Beschränkung auf das unbedingt Notwendige“ regiert, dann muß er ja wohl auch für die Sozialhilfe, das Wohngeld, das BAFög, das Arbeitslosengeld, die Leistungen der Krankenkasse etc. gelten. Also werden die Leistungen in allen Abteilungen abgesenkt. Daß die Beiträge zu den Kassen dabei in voller Höhe weiterfließen oder zusätzlich steigen müssen, versteht sich natürlich von selbst. Die Rentenzahlungen bleiben „tabu“, bis die Regierung sich darauf einigt, daß es „keine Tabus geben darf“; dafür stehen jetzt Beitragserhöhungen bevor…
Unübersehbar gewinnt diese so normal daherkommende Veränderung im Verhältnis von Einzahlungen und Leistungen einfach durch ihren Umfang und die Radikalität, mit der sie alle Bereiche trifft, den Charakter einer Neudefinition dessen, worauf sozialstaatliche Leistungen in Deutschland in Zukunft berechnet sein sollen. Es ist nämlich ein Unterschied, ob der Staat seine Maßnahmen zur Pflege und Betreuung des nationalen Arbeitervolks immer mal wieder nach Konjunktur- und Kassenlage korrigiert, erweitert oder streicht; oder ob er sich grundsätzlich auf den Standpunkt stellt, daß dem Standort, dem hier akkumulierenden Kapital sowie dem Staat selbst der Aufwand für solche Pflege in großem Umfang einfach nicht mehr zugemutet werden kann. Mit seinem Einfall, zwischen den „Arbeitseinkommen“ und den „Lohnersatzleistungen“ müsse wieder ein bemerkbarer Abstand her, um die Kassen vor „Mißbrauch“ zu schützen – schließlich dürfen Arbeitslosengeld und Sozialhilfe kein Ersatzlohn sein –, hat der Kanzlers da ein klares Wort gesprochen:
Erstens ist damit gesagt, daß solche Zahlungen gar nicht mehr als das dienen sollen, als was sie immerhin mal eingeführt worden sind – als Lohnersatz, also sich auch nicht mehr daran orientieren dürfen, inwieweit Leute es schaffen können, mit ihnen eine Übergangszeit zwischen Zeiten zu überbrücken, in denen sie sich selbst einen Lohn verdienen können. Damit schlägt der Staat sich einseitig auf die Seite des Zwangs, den die Zahlung von Hilfsleistungen immer schon an sich hatte. Auf jeden Fall soll gelten, daß jemand, der von solchen Leistungen leben muß („darf“, so sieht es der Kanzler), es sich nicht leisten kann, irgendein Angebot zum Geldverdienen auszuschlagen, das das Kapital ihm unterbreitet, mag es noch so beschissen sein. Wer überhaupt noch kalkuliert, „mißbraucht“. Indem der Staat diesem „Mißstand“ den Kampf ansagt, stellt er sich zu seiner ganzen Armutsregelungsabteilung so, als wäre sie eine Schranke für die freie Verfügung des Kapitals über die Arbeitskraft zu jedem gewünschten Preis.
Dabei kalkuliert die hohe Politik drittens gar nicht mit einem Effekt der Art, daß die zu bedingungsloser Arbeitsbereitschaft Gezwungenen mehrheitlich je überhaupt wieder Arbeit bekämen. Der massenhaften Freisetzung von Arbeitskraft entnimmt er, daß dies der neue Dauerzustand ist, den das Kapital herstellt. In dieser Abteilung pflegt niemand die Vorstellung der Krise als eines bloßen „Einbruchs“, wo mit dem Aufschwung dann auch wieder eine Zunahme von „Beschäftigung“ Platz greifen werde. Die Masse der jetzt Freigesetzten ist überflüssig und bleibt es; also sind die Arbeitslosen auch vom Standpunkt des Staates aus keine nationale Potenz mehr, die man im Hinblick auf die Erhaltung ihrer Brauchbarkeit pflegen und betreuen müsse. Und dementsprechend rücksichtslos stellt sich der Staat auf seinen Haushaltsstandpunkt und beantwortet von da aus die Frage, was der Standort Deutschland im bezug auf die Pflege einer kapitalnützlichen Arbeiterklasse braucht: ein umfassend gesenktes Leistungsniveau.
Sein allseitiges Streichprogramm fragt erst einmal gar nicht danach, ob die Funktionen, die er bislang seinem „sozialen Netz“ zugesprochen, Leistungen, die er sich davon versprochen hat, von „Arbeitsmarktförderung“ bis „Gesundheitsversorgung“, mit seinen Eingriffen noch gewährleistet sind. Das zeigt sich auch an der neue Methode des Kürzens, die Herr Seehofer erfunden und Sparkommissar Waigel prompt nachgeahmt hat. Der Staat rechtet mit den jeweils für das soziale Netz Zuständigen nicht mehr darüber herum, welche Ausgaben sie von Standpunkt ihrer Aufgaben für notwendig oder überflüssig halten. Stattdessen macht er einfach einen Deckel auf den Topf: Die Volksgesundheit darf ab sofort die staatlichen Kassen nicht mehr kosten als 1991; die Bundesanstalt für Arbeit muß in eigener Regie ab 1993 in allen Abteilungen zusammen 1 Mrd. einsparen, um die eigenen Streichprojekte des Finanzministers bei „Lohnersatzleistungen“ abzuwenden. Die Zuständigen dürfen unter sich aushandeln, wie sie es hinkriegen, den staatlichen Sparanforderungen Genüge zu tun – wie man der Debatte um die Verschreibepraxis der Ärzte entnehmen kann, machen sie da gute Fortschritte.
Der Konkurrenzvorteil, den der deutsche Staat heute in seinem sozialen Netz entdeckt, liegt eben ganz woanders als dort, wo er ihn früher angesiedelt haben wollte, wenn er mit der besonders qualifizierten, gut gepflegten und leistungbereiten deutschen Arbeiterschaft als „Standortvorteil“ angab. Heute liegt der deutsche Konkurrenzvorteil in Sachen Sozialstaat darin, daß es hier, verglichen mit Staaten wie Italien, im staatlichen Haushalt so viel zu streichen gibt. Eine Nation, die sich bei der Herrichtung ihrer Arbeiterklasse für sich als Standort mehr geleistet hat, hat eben auch mehr zum Streichen, wenn das nationale Konkurrenzprojekt es verlangt. Also gilt die besondere deutsche Variante sozialstaatlicher Betreuung, die früher als Ausweis der besonderen Qualität dieses Standorts galt, heute gerade umgekehrt als Beleg dafür, daß hier vieles wegkann. Was natürlich bleibt, bzw. noch steigt, ist der sozialstaatliche Zugriff auf große Teile des Lohns.
Theoretisch mag einem ja die Vorstellung einigermaßen absurd vorkommen, die Milliarden, die der Staat derzeit für seine nationalen wie weltweiten Vorhaben raushaut, wären durch das Einsparen von ein paar DM bei den trostlosen Figuren, denen er eine Existenz als Sozialhilfeempfänger verpaßt hat, irgendwie zu kompensieren. Die Politik sieht die Sache aber nicht so. Für sie zerfallen die staatlichen Aufgaben gemäß dem, was sie sich vorgenommen hat, zielsicher in Notwendiges und Überflüssiges: Weil Notwendiges nicht leiden darf, muß dort gestrichen werden, wo Überflüssiges Platz gegriffen hat. Beispielhaft aus dem Munde des notorischen Menschenfreundes Klose (SPD), der anläßlich der Kürzungen im Bundeswehretat den schönen Satz losließ: „Der Verteidigungsetat ist nicht eine allgemein verfügbare Sparkasse.“ (SZ 8.2.93) Der Lebensunterhalt der Massen dagegen schon, und zwar genau deshalb, weil der Staat erstens soviel davon über seine Kassen abwickelt und dieses zweitens so nicht mehr will. Der Zynismus der Politik liegt eben nicht darin, daß sie, wie es heißt, den „Sozialstaat abbaut“ und schon wieder einmal eine ganze Menge Leute ärmer macht. Er liegt in den Maßstäben, von denen aus in unserer schönen Gesellschaft sortiert wird danach, wem allerhöchstens Mittel zum Überleben, wem jede Freiheit der Verfügung über Reichtum zusteht. Die sind überhaupt nicht neu; sie werden allerdings derzeit entsprechend den politischen „Prioritäten“ radikalisiert.
Die jeden neuen Beschluß begleitende öffentliche Gerechtigkeitsdebatte geht deshalb auch ziemlich an der Sache vorbei. Daß die „Belastungen“, die „wir alle“ zu bringen haben, vor allem die treffen, die sowieso wenig haben, ist nämlich kein Fehler des Systems, sondern gerade sein Witz. Der Reichtum der Nation war noch nie zum Verfressen da, und wenn man schon geschluckt hat, daß „Investitionen“ ein einziger Dienst an denen sind, die sich für den Profit abrackern dürfen, ist es ziemlich blöd, sich hinterher zu beschweren, daß die staatlichen Anstrengungen für den Standort vor allem die treffen, die nichts zum Investieren haben.
Die Politiker entnehmen dem allseitigen Gemäkel um die Frage, ob die „nötigen Opfer“ auch wirklich immer die „Richtigen“ treffen, zielsicher das nationale Einverständnis mit ihrem Programm und leisten sich auf der Grundlage gelegentlich den Luxus, einem dieser Gerechtigkeitsgesichtspunkte recht zu geben. So macht es sich z.B. gut, die Idee von „Studiengebühren“ für das Recht auf Zutritt zu den höheren Bildungsanstalten der Nation kurz in die Debatte zu werfen und dann höchst feierlich unter allgemeinem Protestgeschrei wieder aus dem Verkehr zu ziehen: Der Standpunkt, daß ein Hochschulstudium heutzutage nicht die Verwirklichung eines „Rechts auf Bildung“, sondern ein staatlich gewährtes Privileg ist, für das die Privilegierten eigentlich zu blechen hätten, bleibt auf jeden Fall mal stehen. Die C-Parteien lassen es sich auch nicht nehmen, ihre berühmte Familienfreundlichkeit durch das Rückgängigmachen der geplanten Kürzung des Kindergeldes für 100.000-Mark- und mehr Verdiener zu unterstreichen; Familien „aller Klassen und Schichten“ dürfen dankbar sein.
Von wegen also, das deutsche Sparprogramm zeuge von einer „sozialen Schieflage“! Als Klassenstaat bewährt sich der Staat gerade da, wo er die ganze Nation ohne Unterschied der Stände für seine Vorhaben in die Pflicht nimmt. So ist auf jeden Fall gewährleistet, daß von dem Ärmsten am meisten reinkommt; und daß „die Reichen“ dabei „immer reicher werden“, ist auch nicht gerade eine Kritik am System: Als „Arbeitsplatzschaffer“ sind diese „Reichen“ ja dann wieder bestens angesehen!
3. Lohn runter – von Staats wegen
Der Staat legt ein gewaltiges Steuererhöhungs- und Streichprogramm auf – und stellt sich gleichzeitig auf den Standpunkt, daß die Löhne und Gehälter, an denen er sich in steigendem Maße bedient, im Interesse des Standorts umfassend gesenkt werden müssen. Im Unterschied zu Steuern und Sozialausgaben fällt das Festlegen von Löhnen allerdings nicht in seine Regie, sondern in die der Tarifpartner, die sich ihre Autonomie nicht nehmen lassen. Das hat aber noch keine Regierung gehindert, ihren Standpunkt geltend zu machen und die Interessen der Arbeitgeber zur nationalen Leitlinie in der Lohnfrage zu machen. So auch diesmal – und noch ein bißchen mehr.
Es ist Krise, allenthalben werden Leute entlassen, die Löhne werden gedrückt, die Gewerkschaft sieht es ein – „konjunkturgerecht“ waren die frei ausgehandelten deutschen Lohnabschlüsse schon immer. So war es aber noch nicht, daß die lohnsenkenden Wirkungen der Krise, noch bevor sie tarifvertraglich besiegelt sind, regierungsoffiziell begrüßt werden. Nach der Erkenntnislage des Bundeskanzleramts ist die gegenwärtige Krise eine Folge der Kosten, nämlich der Lohnkosten – und somit der schlagende Beweis, wie sehr das berühmte „wir alle“ in der Vergangenheit „über unsere Verhältnisse gelebt“ hat. Also müssen die Löhne runter, grundsätzlich und auf breiter Front, soll „das Wachstum“ wieder in Gang gebracht und dauerhaft gesichert werden. Wenn die Löhne sinken, so ist das also nicht im Sinne früherer Ideologien ein zeitweiliges Zurückstecken, dem der Aufschwung bei Beschäftigung und Löhnen um so direkter auf dem Fuß folgt, je bescheidener alle Herabstufungen eingesteckt werden. Diesmal ist die Krise der Einstieg in die längst überfällige Zurückführung der Löhne auf ihr standortverträgliches, dauerhaftes und konjunkturunabhängiges Normalmaß.
Wo das ungefähr zu liegen hätte, läßt sich im Sinne des west-östlichen Solidarpakts am besten dort ermitteln, wo die Nation gerade mit Billiglöhnen einen ganz neuen zusätzlichen deutschen Kapitalstandort aufbaut – auch wenn es damit nicht recht vorangehen will, woran schon wieder die viel zu hohen Billiglöhne im Osten schuld sind. Daraus folgen nämlich zwei Beweise: Erstens darf das Lohnniveau in den neuen Bundesländern auf keinen Fall dem im Westen angeglichen werden; wo Derartiges vereinbart wurde, ist neu zu verhandeln; denn sonst kriegt die Nation ihre fest eingeplanten „Kernindustrien“ dort drüben nie hin. Zweitens muß das Lohnniveau im Westen dem im Osten angeglichen werden ; denn der neue Standort setzt natürlich gültige Maßstäbe, nicht zuletzt was die Lohnkosten betrifft, für die in Deutschland Arbeit zu haben ist.
Das ist die Lohnleitlinie, die der deutsche Staat für den Rest der 90er Jahre ausgibt. Und nicht nur ausgibt. In seiner Eigenschaft als Arbeitgeber hat er zur Eröffnung der Tarifrunde den Einstieg ins Gesundschrumpfen des Kostenfaktors Arbeitskraft maßstabsetzend vorgemacht. Da wurde klargestellt, daß Tarifrunden heutzutage ausschließlich und höchst offiziell dazu dienen, Lohnsenkungen abzusegnen. „Inflationsausgleich“ kommt nicht infrage; da würde der Staat ja glatt mit der anderen Hand wieder ausgeben, was er gerade mit der einen hereingeholt hat:
„Es ist davon auszugehen, daß die Lohnentwicklung („Entwicklung“ ist gut!) im öffentlichen Dienst einen spürbaren Beitrag zur Konsolidierung der öffentlichen Haushalte erbringen wird.“ (Waigel)
Diese Sorte Lohnabschluß ist den Gewerkschaften in anderen Branchen damit zur dringlichen Nachahmung empfohlen.
So stellt der deutsche Staat wegen seiner Projekte klar, wie die Sache mit dem internationalen Vergleich der Arbeitslöhne immer schon gemeint war: Doch nicht so, daß deutsche Arbeiter wegen ihrer vom Kapital organisierten Leistung sich auch in Sachen proletarischer Kaufkraft vergleichsweise besser gestellt fühlen können. Vielmehr so, daß sie sich die Frage gefallen lassen müssen, ob sie es denn überhaupt verdienen, das „deutsche Lohnniveau“. Das Aufwerfen dieser Frage ist schon so gut wie die Antwort: Natürlich nicht! Die Einsicht stiftet der Staat höchstpersönlich, wenn er zusätzlich zu seinen sozialstaatlichen Sparprogrammen mit seiner politischen Vorreiterrolle die Krisenwirkungen programmatisch vorwegnimmt. Er macht sich zum Oberanwalt der lohnsenkenden Effekte einer steigenden Reservearmee, gibt den in die „politische Landschaft passenden“ Abschluß vor und bietet dem Kapital damit Handhaben, seine Lohnverhandlungen unter dieser Vorgabe zu führen.
Im Namen des Staatsnotstands verändert die politische Gewalt also mit den ihr zu Gebote stehenden Methoden das historisch-moralische Element des Lohns, das, was der Arbeiterschaft gewohnheitsmäßig, von der obersten Gewalt anerkannt und in großen Lohnteilen unmittelbar politischen organisiert, an „Lebensstandard“ zugestanden wird. Und sie ändert damit die Grundlage, auf der deutsche Arbeiter gewerkelt, zu ihrem Staat gehalten und den sozialen Frieden gewahrt haben; statt der Vorstellung, daß es Arbeitern im erfolgreichen Deutschland – vergleichsweise – nicht schlecht geht, ist nämlich die neue Auffassung verlangt, daß das Leben in Deutschland auch in Ordnung geht, wenn es mit dem Lebensstandard nicht mehr so weiter geht.
4. Der Beitrag der Gewerkschaften
Bei seinem Programm setzt der Staat wie selbstverständlich auf die Arbeitervertretung, die bei der Regelung des Lohns ein gewichtiges Wörtchen mitzureden hat. Die deutsche Einheitsgewerkschaft ist damit nicht nur herausgefordert, sondern vor allem erst einmal blamiert. Schließlich hat sie bisher stets darauf verwiesen und nach allgemeiner Auffassung auch darauf verweisen können, daß sie mit ihrer Politik der sozialpartnerschaftlichen Lohnfindung für ihre Mitglieder immerzu mehr erreicht hat als die Radikalen anderswo mit ihrem Konfrontationskurs: Zumindest im Prinzip und auf lange Sicht hat sich – so die Gewerkschaft – die Lage der arbeitenden Klasse enorm verbessert, und selbst in schweren Zeiten hat sie dafür gesorgt, daß keine bleibende Verschlechterung eintritt. Jetzt fliegt offiziell und programmatisch der ganze Schwindel auf, daß der konstruktive Mitbestimmungskurs der DGB-Gewerkschaften die Garantie für ein zufriedenstellendes Auskommen der deutschen Arbeiterschaft ist, daß sich also Kompromißbereitschaft und die Orientierung an gesamtwirtschaftlicher Vernunft auf jeden Fall lohnt. Es wird offenkundig, daß sich umgekehrt das, was der Arbeiterschaft zugestanden wurde, nach dem gerichtet hat, was die Wirtschaft und die Verwalter der Nation für brauchbar gehalten haben. Und daß, wenn diese Instanzen es für nötig halten, grundlegende Abstriche fällig werden, kurz: stillhalten sich nicht lohnt, also auch nie gelohnt hat.
Die Gewerkschaft reagiert prompt und zwar so, daß sie alle Leitlinien, Gesichtspunkte und Argumente, mit denen sie bisher Lohn gefordert, gerechtfertigt, ausgehandelt und angepriesen hat, umstellt, nämlich auf das politische Ansinnen einstellt. Anklagen, Bedenken und Forderungen, die Gewerkschaftler in besseren Zeiten vorgebracht haben, haben ausgerechnet jetzt, wo der Lohn in großem Stil bestritten wird, bei ihr keine Konjunktur mehr. Ausgerechnet jetzt will sie dem Staat den Vorwurf, er stelle mit seinen Beschlüssen den sozialen Frieden aufs Spiel, ersparen. Weitgehend verstummt ist das Schlagwort von der Kaufkraft, auf die Lohnarbeiter ein Anrecht haben und auch im Interesse der Wirtschaft verfügen müßten. Das laute Verlangen nach Beschäftigung, das früher bei Entlassungen regelmäßig angemeldet wurde, wird angesichts von nie gekannten Arbeitslosenzahlen merklich leiser; Rheinhausen findet nur noch als Karikatur statt, wo hundertfach Betriebe stillgelegt und massenhaft entlassen wird. Auch das Schlagwort von der neuen Armut, mit der die Gewerkschaft sich keinesfalls abfinden könne, hat da, wo der Umfang der Armut wächst wie nie, keinen großen Platz mehr auf der gewerkschaftlichen Mängelliste. Selbst die Beschwerden über unternehmerische Lohndiktate, die der Gewerkschaft in früheren Zeiten schon einmal einen Streik wert waren, um zumindest den Anspruch auf Berücksichtigung der berechtigten Arbeiterforderungen zu demonstrieren, werden marginal, wo diese Diktate gleich aus den politischen Führungsetagen ergehen. Wo die Lüge, Nation und Lohn würden sich dank gewerkschaftlicher Mitwirkung erfolgreich versöhnen lassen, von der Politik aufgekündigt wird, da will sich auch die Gewerkschaft nicht mehr für dieses Programm stark machen, das bis gestern für sie sprechen sollte. Sie streicht mehr oder weniger stillschweigend ihre einschlägigen Bemühungen und propagandistischen Veranstaltungen. Die Anwälte sozialer Gerechtigkeit schlagen sich jetzt ganz auf die Seite der nationalen Not, der sich das gewerkschaftliche Fordern und Mitbestimmen anzupassen hat; auch wenn damit Lohnabschlüsse zur Normalität werden, die jeder bisherigen gewerkschaftlichen Erfolgsoptik – Kaufkraft gestärkt, Inflation ausgeglichen, Produktivitätsfortschritte verteilt, Unternehmeranschlag abgewehrt, zumindest aber den „Reallohn“ gesichert! – ins Gesicht schlagen. Kaum ergeht vom Kanzleramt das politische Verlangen nach einem „Solidarpakt“, entnimmt sie dem, daß sie als politischer Partner auf allerhöchster Ebene gefragt ist, und findet sich ohne große Umstände bereit, den ganz und gar einseitigen „nationalen Konsens“ in Sachen Solidarität mitzutragen.
Die Gewerkschaft sieht sich nämlich gleich doppelt als verantwortliche Arbeitervertretung gefordert: durch die ökonomische und durch die national ausgerufene Krisenlage. Erstens entdeckt sie an den Millionen Entlassenen, an den Lohnsenkungs- und Leistungsteigerungsmaßnahmen der Kapitalisten nichts als die Schwierigkeiten der Arbeitgeber, zu beschäftigen und Lohn zu zahlen, also die Gefährdung des Standorts Deutschland. Da sie den Lohn als einen dem Arbeiter gerechterweise zustehenden Teil des nationalen Wirtschaftsertrags betrachtet, der an den Wachstums- und Konkurrenznotwendigkeiten des Kapitals seine Grenzen findet, entnimmt sie den Klagen der Unternehmer und Daten der Wirtschaftsgutachter, daß gegenwärtig nichts zu „verteilen“, also auch nichts zu fordern geht. Zweitens bemerkt die Gewerkschaft am Radikalismus des staatlichen Zugriffs und Angriffs auf den Lohn nichts als die umfassende staatliche Notlage, seinen Haushalt und dessen ökonomischen Quellen betreffend. Den politischen Lohngeboten entnimmt sie daher auch die weitergehende Einsicht, daß es gegenwärtig überhaupt mit der gewerkschaftlichen Freiheit vorbei ist, den Lohn selbstverantwortlich an die Konjunktur des Kapitals anzupassen. Statt dessen gelten höhere Notwendigkeiten, denen die Lohnfrage bedingungslos untergeordnet werden muß: Es muß gespart und Wachstum gesichert werden, und beides geht nicht ohne gewerkschaftliche Lohnzurückhaltung. So buchstabiert die Gewerkschaft die Gleichung von Lohn und Nation jetzt strikt andersherum: Ohne nationalen Erfolg verliert auch die Arbeiterschaft ihr Recht auf die sozialen Errungenschaften, die ihr das gewerkschaftlich mitgestaltete Gemeinwesen bisher gewährt hat. Wenn die deutschen Arbeitervertreter noch etwas einklagen, dann den Vollzug der gemeinschaftlichen Krisenbewältigung – den konsequenten Aufschwung Ost, die Sicherung des Standorts Deutschland, die Konsolidierung des Staatshaushalts. Das alles als Dienst, den die Nation der Arbeiterschaft für deren eingesehene Opfer schuldig ist.
Auf einem besteht eine deutsche Arbeitervertretung allerdings nach wie vor: „Die Tarifautonomie darf nicht angetastet werden.“ Daß diese Autonomie kein Opfer ausschließt, hat die ÖTV in den Lohnverhandlungen mit dem politischen Arbeitgeber bewiesen. Sie hat mit dem Abschluß den staatlichen Zugriff abgesegnet und auf jede Kompensation beim Lohn verzichtet. Das dem staatlichen Verhandlungspartner abgelauschte Ergebnis hat sie dennoch als einen Sieg gefeiert: „Die Tarifpartner haben bewiesen, daß sie in der Lage sind, die Schwierigkeiten ohne politische Eingriffe selber zu meistern.“ So feiert Wulff-Matthies den richtungsweisenden Nachvollzug eines politischen Dekrets: Die Gewerkschaft hat dem staatlichen Diktat den Charakter einer freien Abmachung gegeben. Wahrlich eine interessante Lesart gewerkschaftlicher „Autonomie“. Egal, was der Staat diktiert – die gewerkschaftliche Autonomie ist kein Einspruch mehr dagegen, also auf alle Fälle gewahrt. Was Kommunisten diesem Herzstück gewerkschaftlicher Politik bösartig nachgesagt haben, preist dieser Verein jetzt ausdrücklich als seine Existenzberechtigung. So macht die deutsche Einheitsgewerkschaft den sozialen Frieden krisenfest.