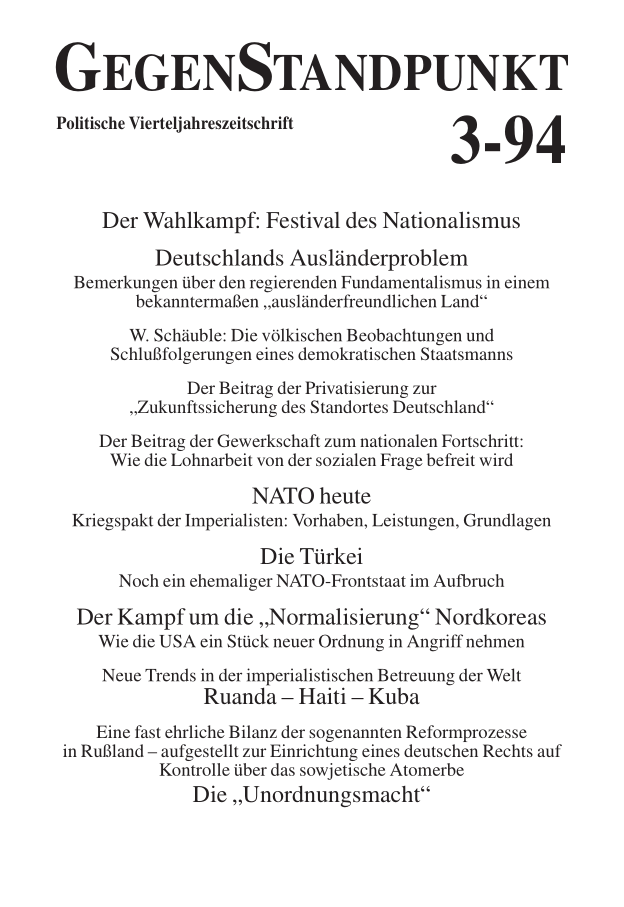Die Türkei
Noch ein ehemaliger NATO-Frontstaat im Aufbruch
Die Türkei arbeitet an ihrem imperialistischen Aufstieg: vom Militärstaat und Entwicklungsprojekt im Dienste der Nato als Frontstaat gegen die SU zur Regionalmacht mit eigenen Kalkulationen und Berechnungen in Nahost (Irak, Griechenland, Balkan, Armenien / Aserbeidschan). Dabei kommen ihr eine heftige Wirtschaftskrise, die Autonomiebestrebungen ihrer kurdischen Bevölkerung und eine fundamentalistische Opposition in die Quere. Die Türkei reagiert mit Notstandsprogrammen, die ihr die Betreuung durch den IWF nicht erspart, und einer Eskalation des Kurdenkriegs. Die Nato-Bündnispartner stehen skeptisch zum türkischen Aufbruchnationalismus und drängen auf eine stärker Einbindung: EU und / oder WEU?
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
- 1. Die alte Türkei: Militärstaat und Entwicklungsprojekt im Dienste der NATO
- Ein Militärstaat wird ins Militärbündnis für ‚Freiheit statt Sozialismus‘ eingebaut
- Politökonomische Affären eines „Schwellenlandes“ in der NATO und Hinterlandes der EG
- Die Türkei und die EG/EU: eine ziemlich einseitige Beziehungskiste
- Das „Kurdenproblem“: Ergebnis des „Entwicklungsdefizits“ im Inneren
- 2. Nach dem Ende des Kalten Krieges: die Türkei arbeitet an ihrem imperialistischen Aufstieg
- 3. Die Türkei und ihre aktuellen Krisen
- 4. Ein vorläufiges Fazit, die Türkei und ihre Bündnispartner betreffend
Die Türkei
Noch ein ehemaliger NATO-Frontstaat
im Aufbruch
„Wenn wir heute keine schweren Fehler machen, wird das 21. Jahrhundert das Jahrhundert der Türkei.“ (Turgut Özal)
Was man in letzter Zeit über die Türkei zu hören bekommt, ist zwiespältiger Natur.
Da erfährt man auf der einen Seite: Diese Nation, die bislang im Bereich der maßgeblichen Mächte dieser Welt nicht gerade eine Hauptrolle gespielt hat und bei uns hauptsächlich als Heimat vieler Gastarbeiter und Gastgeber vieler Touristen bekannt ist, hat sich neuerdings nichts Geringeres vorgenommen als den Aufstieg zur regionalen Vormacht in einem Gebiet, das geopolitisch den gesamten Süden der ehemaligen UdSSR umfaßt. Seit dem Auseinanderfallen Jugoslawiens tritt die Türkei auch auf dem Balkan als Schutzmacht aller Moslems auf und bietet Bodentruppen gegen die Serben an, die von den Hauptaufsichtsmächten dann aber nur sehr zögerlich in Anspruch genommen werden. Die alte Regionalkonkurrenz mit dem NATO-Bündnispartner Griechenland läßt Ankara (wie umgekehrt auch Athen) bis hin zu Kriegsdrohungen in der Ägäis wieder aufleben, was nun wirklich keiner der westlichen Hauptnationen in den Kram paßt. Bei der amerikanischen Abrechnung mit Saddam Hussein hingegen macht sich die Türkei zunächst als Aufmarschbasis gegen den Irak ausgesprochen nützlich und läßt dann Ambitionen auf den irakischen Norden erkennen, die besagten Hauptnationen wiederum zu weit gehen. An allen diesen Fronten ist jedenfalls der heutigen Türkei deutlich anzumerken, daß sie an dem Projekt arbeitet, zur Vormacht über ihre gesamte nähere und sogar weitere Nachbarschaft aufzusteigen und damit eine ungleich größere Bedeutung in der Konkurrenz der Staaten zu gewinnen als bisher.
Auf der anderen Seite macht die Türkei Schlagzeilen mit inneren Zuständen, die allen Ernstes die Frage aufkommen lassen, wie es mit der Haltbarkeit dieser ambitionierten Nation bestellt ist. Anno 94 kämpft die Türkei mit einer Dauerwirtschaftskrise, deren Ausmaße in Sachen Inflation und Auslandsverschuldung die Politiker in Ankara selber warnende Vergleiche mit lateinamerikanischen Verhältnissen ziehen läßt. Als innere Opposition macht sich immer nachhaltiger eine islamische Fundamentalistenmannschaft bemerkbar, die die „laizistische“, prowestliche Ausrichtung der modernen Türkei bekämpft. Im gesamten Südosten führt ihre Armee mit hohem Einsatz Krieg gegen aufständische Kurden, muß also sogar um den Bestand der angestammten Reichweite ihres Gewaltmonopols kämpfen. Schließlich wird der laufend erneuerte türkische Antrag auf künftige Mitgliedschaft in der Europäischen Union von dieser Union nach wie vor, aber immer deutlicher zurückgewiesen.
Was ist los mit dieser Nation?
1. Die alte Türkei: Militärstaat und Entwicklungsprojekt im Dienste der NATO
Die Türkei unterhält, auch heute noch, mit 850.000 Mann die zahlenmäßig zweitstärkste Wehrmacht aller NATO-Staaten; von Abrüstung nach dem Ende des Kalten Krieges ist dort weit und breit nichts zu sehen. Daß das Militär die letztendliche Garantiemacht der türkischen Staatsräson auch nach innen hin ist, hat es nicht nur zu Zeiten der Staatsgründung erwiesen, sondern auch mit bisher drei Militärdiktaturen seit dem 2.Weltkrieg. Und auch in der gegenwärtigen inneren Krisenlage trauen kundige Kommentatoren dem Militär ohne weiteres einen neuen Putsch zur Rettung der Nation zu. Nun sind für gewöhnlich die Nationen, die über das wuchtigste Gewaltpotential gebieten, zugleich diejenigen mit der größten ökonomischen Macht; Standort von weltmarktfähigem Kapital zu sein und die Fähigkeit zur gewaltmäßigen Beaufsichtigung anderer Staaten zu besitzen, sind in der imperialistisch eingerichteten Welt die sich ergänzenden Qualitäten tonangebender Nationen. Im Falle der Türkei ist hingegen von einer politökonomischen Potenz, die mit der militärischen Ausstattung dieses Staates Schritt gehalten hätte, wenig zu sehen. Der wiederholte Einsatz des Militärs nach innen zur Rettung der gefährdeten Staatsräson beweist vielmehr, daß die Benutzung von Land und Leuten für ein kapitalistisches Geschäftsleben keinesfalls mit der Selbstverständlichkeit funktioniert, die es dem politischen Souverän gestattet, sein Innenleben zivil zu gestalten, d.h. sich auf die staatsdienliche Betätigung der durch Justiz und Polizei in genehme Schranken gebannten Privatinteressen sowie auf den dazugehörigen staatsbürgerlichen Gehorsam zu verlassen und sein Militär für die Aufgabe zu reservieren, die ihm in gefestigten Nationen zukommt – den Schutz der Souveränität nach außen. Diesem Befund läßt sich zwar durchaus der politische Wille der Macher der türkischen Nation entnehmen, selber über die auf Geschäft und Gewalt gegründete Staatsräson der erfolgreichen Mächte verfügen zu können; mindestens genau so aber, daß diese Nation es zu einer autonomen Verfügung über Geld und Gewalt gar nicht gebracht hat, sondern von auswärtigem Interesse an ihr, von Diensten, die sie mächtigeren Staaten erweist, abhängig geblieben ist. Oder andersherum: Dank der Rolle, die sie in den Berechnungen insbesondere der USA gespielt hat, lebt die Militärmacht Türkei bis heute über ihre Verhältnisse.
Ein Militärstaat wird ins Militärbündnis für ‚Freiheit statt Sozialismus‘ eingebaut
Als Staat in ihrem heutigen Umfang ist die Türkei das Resultat des von ihrem viel größeren Vorgänger mit verlorenen Weltkriegs Nr.1 samt diverser anschließender Waffengänge. Dieser Staat hatte sich zunächst britischer und französischer Kolonialambitionen zu erwehren und rivalisierende politische Projekte Marke Griechenland und Armenien kleinzukriegen, was auch seinerzeit nicht ohne großangelegte ethnische Säuberungen abging und der Türkei zwei – gegenwärtig aktualisierte – völkische Erbfeindschaften eingebracht hat. Die militärische Führungsgarnitur der Türkei, die den Kampf für einen eigenständigen, souveränen Staat befehligt hatte, nahm dann als einziger funktionstüchtiger Machtfaktor auch die innere staatliche Neugründung, den Aufbau eines modernen Nationalstaats, in die Hand. Unter ihrem ersten Anführer Kemal Pascha, der nach einem Jahrzehnt Herrschaft mit dem Ehrennamen „Türkenvater“ dekoriert wurde, hat sich die Türkei dem neuen Staatsprogramm verschrieben, den maßgeblichen imperialistischen Mächten nachzueifern und deren Vorsprung als Standorte kapitalistischer Industrie und schlagkräftiger Gewalt aufzuholen. Dafür hat Atatürk daheim die Überreste der alten Staatlichkeit samt Feudalverhältnissen und islamischem Rechtssystem rigoros zerschlagen und unter dem seinerzeit durchaus honorigen Titel „Etatismus“ ein politisch angeleitetes Entwicklungsprogramm aufgezogen, das die Landwirtschaft aus ihrer Rückständigkeit führen und der neu etablierten Nation eine industrielle Basis verschaffen sollte. Zur Überwindung des ‚Entwicklungsdefizits‘ konnte und wollte sich der Staat nicht auf die Garantie privaten Eigentums und die Bereitstellung von kapitalistischen Geschäftsbedingungen beschränken und betrieb sein Modernisierungsprojekt in eigener Regie. Der Kemalismus stiftete auf diese Weise zwar eine Art stofflicher Grundausstattung und eine aufs Geldverdienen festgelegte Gesellschaft mit wenigen Nutznießern und vielen auf Anwendung ihrer Arbeitskraft angewiesenen armen Leuten, aber noch lange keine konkurrenzfähige Nationalökonomie samt einem Nationalkredit mit internationaler Geschäftsfähigkeit.
Angesichts dieser Lage war die Nachfolgegeneration türkischer Militärs, Staats- und Geschäftemacher nach dem nächsten großen imperialistischen Waffengang aufgeschlossen für ein Angebot von Seiten der überlegenen Mächte des Westens, das ohnehin ziemlich alternativlos daherkam: Für ihre Funktion als Aufmarschgebiet gegen den neuen Hauptfeind der versammelten imperialistischen Nationen unter Führung der USA wurde der Türkei ein Stück von den führenden Staaten verbürgte Zugehörigkeit zum engeren Kreis des „Westens“ und Teilhabe an seinen Leistungen – Waffen, Kapital und Kredit – in Aussicht gestellt.[1] Auf diese internationalistische Alternative zum „etatistischen“ Weg des Aufstiegs ist die Türkei dann auch eingestiegen und zum NATO-Partner und später zum EG-Daueraspiranten geworden.
Damit wurde die türkische Militärmacht einer neuen Zweckbestimmung zugeführt und so ihre Fortexistenz gesichert. Die Türkei hatte, obwohl erst im Februar 45 auf Seiten der Anti-Hitler-Koalition in den Krieg eingetreten, während der Kriegsjahre eine Million Leute unter Waffen gehalten; die Benutzung türkischen Menschenmaterials für militärische Belange wurde nun, sogar mit mehr und besserem Gerät, fortgeführt, indem die Türkei sich als Frontstaat des Westens gegen die SU nützlich machte. Sie trug das Risiko der militärischen Bedrohung durch die sozialistische Weltmacht, die der Türkei seit deren „Westintegration“ feindlich gegenüberstand. Aber sie gewann dadurch, daß sie Land und Leute dem imperialistischen Kriegsbündnis an der zweitwichtigsten Front zur Verfügung stellte, Zugang zu den Mitteln der Herrschaft, die in der modernen Welt etwas zählen, nämlich zu Waffen und Geld der Hauptmächte; allerdings nur so weit, als diese es für die Funktionstüchtigkeit ihres Frontstaats für nötig erachteten. Das Interesse der NATO und ihrer Vormacht USA an einem schlagkräftigen und gesicherten militärischen Vorposten Türkei war und blieb die Grundlage für dieses „Schwellenland“, was seine umfangreiche Ausstattung, aber auch was die Schranken für seine eigenmächtigen Ansprüche angeht. Die Türkei wurde zum NATO-Stützpunkt und zum amerikanischen Stationierungsort aufgebaut; der türkische Militarismus wurde mit der Lizenz zur Unterhaltung einer höchst umfänglichen Armee und deren bis heute andauernden Bezuschussung bedient, sowie mit Gerät vor allem aus den USA und der BRD bedacht. Darüberhinaus unterhält die Türkei inzwischen eine nicht unbeträchtliche, mit NATO-Hilfe zustandegekommene heimische Rüstungsproduktion. Die türkischen Versuche, diese Militärmacht auch zu ganz eigener Machterweiterung zu nutzen, wurden freilich durch die NATO zugleich entscheidend beschränkt. Als die Türkei dem Regionalkonkurrenten Griechenland auf Zypern und in der Ägäis die Machtfrage gestellt hat, haben die überlegenen NATO-Mächte auf Unterordnung Ankaras unter die Bündnisdisziplin bestanden und die rücksichtslose türkische Durchsetzung verhindert.
Politökonomische Affären eines „Schwellenlandes“ in der NATO und Hinterlandes der EG
Was zweitens die kapitaltaugliche Ausstattung der Türkei angeht, so läßt sich zwar keineswegs bestreiten, daß dort unter der Standortbedingung „NATO-Mitglied“ ein Stück „Standortentwicklung“ im Sinne einer Bereitstellung von Geschäftsbedingungen und -perspektiven stattgefunden hat. Auf gewisse Errungenschaften, die als Symbole türkischen Fortschritts gelten, sind die dortigen Staatsführer ganz stolz; so hat Präsident Özal noch kurz vor seinem Ableben den riesigen Atatürk-Staudamm, der der Energiegewinnung und einer agrarindustriellen Erschließung der Region in großem Maßstab dienen soll, mit viel Pomp eingeweiht, und die Türkei leistet sich sogar die Eigenentwicklung von Erdsatelliten. Andererseits hat es dieses „Entwicklungsland im NATO-Bündnis“ bei weitem nicht zu einer umfassenden, dem „internationalen Wettbewerb“ standhaltenden nationalen Akkumulation gebracht, also zu einer Nationalökonomie, die dem Staat Türkei die notwendigen Mittel seiner Macht verläßlich eintragen würde.
Dies zeigt sich vor allem anderen daran, daß die Benutzung türkischer Arbeitskraft in großem Umfang gar nicht in der Türkei und zugunsten dort akkumulierenden Kapitals stattfindet, sondern in der EG, vor allem in Deutschland, also zum Vorteil anderer Staaten, deren Geschäftswelt aus dem Import türkischer Arbeitskraft Kapital schlägt (und sie bei geänderter Konjunkturlage wieder abstößt). Die Türkei ist daran nur insofern beteiligt, als die Überweisungen von Gastarbeitern einen dringend benötigten Beitrag dazu leisten, daß ihr Herkunftsstaat an weltmarkttaugliches Geld herankommt, welches ihm seine heimische Akkumulation gar nicht einträgt.[2] Die Ausrichtung der türkischen Ökonomie auf den Weltmarkt hat nämlich mehr Konkurrenzunfähigkeit der türkischen Ökonomie aufgedeckt als Konkurrenztüchtigkeit erzeugt und in der türkischen Wirtschaftspolitik für ein ewiges Hin und Her zwischen Aufwendungen für die „Staatswirtschaft“ und Förderung der „Privatwirtschaft“ gesorgt. Oft genug haben türkische Regierungen den für ihren Geschmack viel zu geringen Erfolg ihrer Staatsbetriebe konstatiert, wie umgekehrt die mangelnden Angebote seitens des internationalen Kapitals, ihren Laden zu „entwickeln“, so daß der Staat sich dann verläßlich an Erträgen bedienen kann. So haben sie nie darauf verzichtet, daß bestimmte Bereiche national erforderliche Standortbedingungen sind, und haben sie mittels politischem Kredit zu etablieren oder zu sanieren versucht – und bekamen deren Unterlegenheit im Vergleich der weltweit agierenden Kapitale darüber präsentiert, daß auch diese Projekte laufend mehr staatliches Geld verschlungen haben und der Staatskredit weiter inflationiert wurde. In der (Un-)Tauglichkeit einer nationalen Währung zur Abwicklung aller Sorten von Geschäft – mit produktivem Kapital, mit Kredit und mit staatlichen Schuldzetteln – faßt sich eben die Bilanz der Geschäftswelt über einen Standort von Kapital zusammen; insofern erhielt die türkische Wirtschaftspolitik in der notorischen „Instabilität“ ihrer Währung, bei der jährliche Entwertungsraten von 70% eher die Regel als die Ausnahme darstellen, attestiert, daß die türkischen Anstrengungen, das Land zum Kapitalismus zu befähigen, gar keinen nationalen Kapitalstandort mit einem erfolgreichen Geschäftsleben zustandegebracht haben, welches wiederum dem Kredit der Nation die Qualität von gültigem Wert hätte verschaffen können. Die Türkei sah sich auch ökonomisch auf Dauer von den Kalkulationen der westlichen Vormächte abhängig; ihr politökonomischer Spielraum blieb beschränkt dadurch, was der Frontstaat seinen Bündnispartnern an internationalen Krediten und Aufbauhilfen wert war.
Ein Unbrauchbarwerden ihres Frontstaats kam für die Hauptmächte nicht in Frage. Die NATO-Mitgliedschaft und (seit 1963) EG-Assoziierung hat der Türkei bei ihren Währungs- und Zahlungsbilanzproblemen zwar Kredit gesichert, das Land aber nicht saniert, sondern zum bleibenden Betreuungsfall gemacht, dessen wirtschaftspolitische Souveränität keineswegs wuchs, sondern laufend beschränkt blieb. Die Verschuldung bei privaten und staatlichen Kreditgebern im Ausland wurde Zentralproblem der türkischen Finanz- und Wirtschaftspolitik; und dies konnte ihr aus der Sicht ihrer Betreuer, die sich bereits 1962 eigens in einem „OECD-Hilfskonsortium für die Türkei“ zusammengetan hatten (Mitglieder u.a.: BRD, USA, Frankreich, der IWF und die Weltbank), unmöglich selber überlassen bleiben. Vor allem die BRD übernahm den Auftrag, sich speziell um die Erhaltung stabiler Verhältnisse im südöstlichen Frontstaat zu kümmern, was die Federführung bei den periodisch fällig werdenden Währungsstützungs- und Umschuldungsaktionen einschloß. Im Jahre 1979 z.B. war eine „Feuerwehraktion“ darüber fällig geworden, daß die Gläubiger der Türkei auf tatsächlicher Bezahlung von Schulden bestanden und so die Zahlungsunfähigkeit dieser Nation herbeiführten. Der damalige Schatzmeister der CDU nahme die „Rettungsaktion“ in die Hand, und sie endete damit, daß die Türkei den bekannten IWF-Richtlinien für staatliche Problemfälle im imperialistischen Lager unterstellt wurde.[3] Das bewirkte eines jedenfalls sehr gründlich: einen Verarmungsschub für die Bevölkerung; die Reallöhne waren 1990 um die Hälfte niedriger als 1980. Kurz darauf fand ein Militärputsch statt, mit dem die einzig funktionstüchtige Institution im Land die politische Staatsrettung der Türkei in Angriff nahm. Die Generäle wollten die vor allem dank starker gewerkschaftlicher und linker Umtriebe diagnostizierte „Unregierbarkeit“ des Landes beheben, wobei freilich die etablierten Staatsparteien und die Faschistenpartei gleich mit verboten wurden. Daß die Militärdiktatur mit ihrer Gewalt die Erfüllung des IWF-Regimes erzwang, macht allerdings den Widerspruch einer abhängigen Staatsräson deutlich: Die nationalistischen Militärs, die sich mit den ihnen zu Gebote stehenden Gewaltmitteln als die wahren Hüter und Wächter türkischer Souveränität erachten, wenden sie im Sinne der Auflagen an, die die auswärtigen Aufseher der Türkei vorschreiben. Ein weiteres Stück Preisgabe finanz- und wirtschaftspolitischer Souveränität sollte dem Vorankommen der Türkei Beine machen; dazu gab es für die führenden Nationalisten dieses Geschöpfs der NATO seinerzeit keine Alternative. Sie machen sich für den Bestand der Nation stark, indem sie ihr ein- und untergeordnetes Mitmachen bei einer Weltordnung sicherstellen, die von ganz anderen Mächten bestimmt wird.
Die Türkei und die EG/EU: eine ziemlich einseitige Beziehungskiste
Den Anpassungskurs an die politökonomischen Auflagen der Hauptsubjekte des Weltmarkts, den die Militärdiktatur und ihre stufenweise „demokratisierten“ zivilen Amtsnachfolger seit 1980 einschlugen und der mit internationalen neuen Kreditgarantien honoriert wurde, haben die türkischen Machthaber in der Folgezeit mit verstärkten Bemühungen um Anschluß an die Europäische Gemeinschaft fortgesetzt. Sie gedachten auf diese Weise offensiv der Problemlage zu begegnen, daß es dem „Schwellenland“ Türkei trotz machtvoller Teilhabe am westlichen Kriegsbündnis immer noch nicht gelungen war, die Schwelle zum Kreis der wenigen maßstabsetzenden Staaten zu überspringen. Die Aufnahme von Spanien, Portugal und vor allem des Regionalrivalen Griechenland in die EG machte, anders ausgedrückt, auch den Regierungen in Ankara die Dialektik von abhängigen Souveränitäten an der Peripherie der westeuropäischen Weltmacht deutlich: Wer vom Nutzen ausgeschlossen bleibt, den die Zusammenlegung der Akkumulationssphären führender kapitalistischer Nationen herbeiführt, hat gegen deren Wucht keine Chance; die Mitgliedschaft bei der europäischen Gemeinschaft verlangt einerseits Unterordnung unter deren Internationalismus bzw. dessen Definition durch die EG-Vormächte, verspricht aber auch die Mitbestimmung bei den Plänen und Taten dieser aufstrebenden Weltmacht und erweiterten Zugang zu ihren Mitteln zugunsten der Entwicklungsabsichten des eigenen Standorts. Die Türkei reichte 1987 offiziell den Antrag auf Vollmitgliedschaft ein mit der Perspektive, sich – so ähnlich wie Spanien, vor allem aber in Konkurrenz zu Griechenland – als bevorzugtes Entwicklungsprojekt der EG zu etablieren und auf diese Weise endlich die entscheidenden Fortschritte zum kapitaltauglichen Standort zustandezubringen. Sie mußte dann aber die Erfahrung machen, daß die EG/EU sich gar keine weiteren „unentwickelten“ Kandidaten leisten will, sondern, seit Maastricht hochoffiziell, mehr und mehr eine Sortierung Europas betreibt: in eigentliche Beiträger zur politökonomischen Weltgeltung Europas und nur bedingt taugliche, mehr oder weniger zurückzustufende Kostgänger dieses Projekts. Wo die Türkei da einsortiert gehört, war für die Macher der kapitalistischen Weltmacht Europa keine Frage. Bereits 1989 bekam Ankara von der EG-Kommission ausgerichtet, daß mit der Beratung des türkischen Beitrittsantrags vor 1993 noch nicht einmal angefangen werden könne:
„Als wirtschaftliche Gründe führte der Bericht u.a. die geringe Produktivität der türkischen Landwirtschaft und Industrie an, die hohe Bevölkerungszunahme und die damit zusammenhängende wachsende Arbeitslosigkeit, die Nichteinhaltung von Grundsätzen freier Marktwirtschaft im Stahl- und Textilsektor und eine Unterstützungsbelastung für die EG, die ein Vielfaches der z.B. Portugal und Griechenland gewährten Unterstützungen ausmachen würde. Weiter wurden soziale und politische Gründe angeführt. Erwähnt wurden dabei u.a. … das Minderheitenproblem (ohne die Kurdenfrage namentlich zu nennen), ein mögliches Blockieren der EG-Politik durch politische und kulturelle Gepflogenheiten sowie durch wirtschaftliche Eigeninteressen und schließlich auch der Ägäiskonflikt mit Griechenland sowie die Zypernfrage.“ (Deutsches Orient-Institut, Nahost Jahrbuch 1989, S.156f)
Alle eigenen Mängel in Sachen imperialistischer Tauglichkeit, deren Beseitigung sich die Türkei vom EG-Beitritt verspricht, werden von der EG umgekehrt als Hindernisse eines Beitritts der Türkei aufgeführt: Sie soll sich aus eigener Kraft erst einmal für Europa qualifizieren, statt ihm zur Last zu fallen; sie bringt der EG bloß lauter Konfliktstoff, aber keinen Nutzen ein; sie steht überhaupt im Verdacht, mit ihren „politischen und kulturellen Gepflogenheiten“ die EU-Politik zu untergraben – deutlicher konnte die Zurückweisung der Berechnungen der Türkei auf Überwindung ihrer Problemlagen mittels EG von Seiten der EG-Kommission kaum noch ausfallen. Und daran hat sich seither nichts geändert, jedenfalls nicht zugunsten Ankaras.[4]
Das „Kurdenproblem“: Ergebnis des „Entwicklungsdefizits“ im Inneren
Der zwiespältigen Erfolgs- wie Problemlage des imperialistisch ambitionierten, dabei aber von äußeren Interessenten abhängigen europäischen Randstaates ist auch Genese und Verlauf des „Kurdenproblems“ geschuldet, das die Türkei hat (und vor allem ihren Kurden bereitet!). Mit der endgültigen Grenzziehung fielen der Türkei 1923, ebenso wie dem Iran, dem Irak und Syrien, in ihrem Südosten einige Millionen Kurden zu – die Folge davon, daß ein überlegenes Machtinteresse fehlte, um dem Versuch kurdischer Politiker, im Gefolge der Neudefinition der Landkarte nach dem 1.Weltkrieg einen eigenen Staat zu machen, zum Erfolg zu verhelfen. Der westlichen imperialistischen Vorbildern nacheifernde Kemalismus, der „Einheitsnation und Einheitssprache“ an die Spitze seines Katalogs von Staatsdoktrinen stellte, definierte von Anfang an die geerbte kurdische Minderheit, immerhin 20% des türkischen Staatsvolks, zu einem separatistischen Risiko, dem er u.a. mit dem Verbot, die kurdische Sprache offiziell zu benutzen, und mit der Niederschlagung etlicher Aufstände im Kurdengebiet zu Leibe rückte. An dieser ethnischen Sortierung hat sich bis heute nichts geändert.[5] Die obrigkeitliche Definition der Kurden als „Bergtürken“ bescheinigt einerseits diesem Menschenschlag herablassend seine Minderwertigkeit gegenüber der Mehrheit des eigentlichen, verläßlichen Staatsvolks, bekräftigt andererseits die Rechtmäßigkeit des staatlichen Anspruch auf seine bedingungslose Unterwerfung unter die türkische Herrschaft in Ankara. Diese hat Leuten mit kurdischer Herkunft das Angebot zur „Integration“ gemacht: Sie dürfen beim türkischen Laden mitmachen, wenn sie ihren Schwur auf die türkische „Einheitsnation und Einheitssprache“ tun, so daß es Generäle, Minister und Großgrundbesitzer kurdischer Abkunft gibt; umgekehrt entdeckt die Obrigkeit unausweichlich an allen Ecken und Enden das verbotene Streben nach „kurdischer Identität“ und begegnet ihm mit den unausrottbaren Generalverdacht, es handle sich um staatszersetzende Bestrebungen.
Die diversen Anläufe zu einer imperialistischen „Entwicklung“ haben es mit sich gebracht, daß die türkischen Machthaber ihren in der Staatsdoktrin der völkischen Einheit vorliegenden Anspruch auf ein fügsames und nützliches Menschenmaterial selber gar nicht – und schon gar nicht überall auf ihrem Territorium gleichmäßig – in die Tat umzusetzen vermochten. Die Türkei hat es bei der „Entwicklung“ ihres Landes zu einem Standort von Kapital keineswegs zu einer flächendeckenden ökonomischen Benutzung von Land und Leuten gebracht, der die politische Gewalt durch ihre Aufsicht nur ihren normalen Verlauf zu sichern bräuchte; sie hat es nicht zum überall zur Normalität gewordenen „stummen Zwang“ kapitalistischer Verhältnisse gebracht, die, sozialstaatlich flankiert, den Großteil der Bevölkerung fürs Wachstum der Wirtschaft einspannen und damit die praktische Homogenität eines Staatsvolks erst herstellen, dem der Zustand geregelter Benutzung samt Angewiesenheit auf die Leistungen des nationalen Gewaltmonopols zur selbstverständlichen Gewohnheit jeder Lebensgestaltung geworden ist. Daß dieser national nützliche Zustand in weiten Teilen der Türkei und vor allem im kurdischen Siedlungsgebiet nicht erreicht ist, liegt keineswegs daran, daß die türkischen Regierungen an diesem Bestandteil ihrer Hoheit überhaupt nicht interessiert gewesen wären. Sie konzentrierten sich allerdings – sowohl in bezug auf die staatlich in Gang gesetzten Industrialisierungsprojekte als auch bei den Bemühungen um die Attraktion auswärtigen Kapitals – auf die Gegenden, die in Sachen Standortbedingungen bereits etwas zu bieten hatten, so daß umgekehrt für die unentwickelten Abteilungen des „Entwicklungslands“ Türkei kaum etwas abfiel. Das politische Ideal der „gleichmäßigen Entwicklung“ blamiert sich eben auch nach seinem regionalen Aspekt, wenn Ziele und Mittel von „Entwicklung“ darauf abstellen, Standort von Kapital zu werden.
Die türkische Regierung erhielt in den abgeschriebenen Regionen allein ihre Gewalt aufrecht; und daß schon in „friedlichen“ Zeiten einiges davon aufgeboten werden mußte, zeigt sowohl die Notwendigkeit, die staatliche Ordnungsfunktion nicht durch Polizei, sondern durch die paramilitärischen Einheiten der Gendarmerie zu gewährleisten, als auch der Umstand, daß über die kurdischen Provinzen quasi permanent Kriegsrecht verhängt war, und die Staatsgewalt sich entsprechend abschreckungsmäßig aufführte, um sich Respekt zu verschaffen. „Geschützt“ werden dadurch nicht bloß keine kapitalistischen, sondern überhaupt keine staatlich geregelten Benutzungsverhältnisse, unter denen sich die Bevölkerung irgendwie hätte nützlich machen und dadurch erhalten können. Das hat sie jedoch nicht davor bewahrt, daß ihre Lebensverhältnisse dem Diktat des Privateigentums unterworfen wurden. Das agrarisches Grundeigentum, das Bauern in meist jährlichen Pachtverträgen den Boden zur Bebauung überläßt gegen Ablieferung der Hälfte des Ernteertrags (oder was eben der Grundbesitzer als seinen gerechten Anteil ansieht) in Naturalien oder Geld (sog. Halbpacht), hat nur wenige Leute in regelmäßige Dienstverhältnisse genommen und so für permanente „Landflucht“ gesorgt. Ob andererseits Leute, die aus Geschäften ihr Einkommen beziehen, ausgerechnet die türkische Währung als zuverlässige Quelle ihres Gewinns ansehen und nicht lieber die nahen Grenzen zum Nahen Osten für ihren Handel nutzen, ist eben auch die Frage. So bemerkt als allererster der türkische Staat selbst, daß ihm der südöstliche Teil seines Territoriums keine Steuern abwirft, und begegnet diesem Teil seiner Gesellschaft mit dem gebotenen Mißtrauen, was Schmuggel, Rauschgiftrouten etc, ganz generell also die Mißachtung seiner staatlichen Souveränität angeht. Und weil er bei der offiziellen Sprachregelung, daß es in der Türkei keine Kurden gäbe, selbst gar nicht den Unterschied der völkische Zugehörigkeit vergißt, betrachtet er die Grenzübertritte von beispielsweise viehzüchtenden Nomaden mit entsprechendem Argwohn und sieht sich zu entsprechenden Grenzsicherungsaktionen veranlaßt.
Wenn Ankara tatsächlich einmal ein „Entwicklungsprojekt“ der größeren Güteklasse für diese Gegend in die Welt setzt, ist das auch kein Deckchenstricken. Das Südostanatolien-Projekt (GAP), bei dem 21 Staudämme zur Energieerzeugung, Bewässerungsanlagen und unterirdische Kanäle gebaut werden, um mit dem Wasser von Euphrat und Tigris „die Kornkammer des Mittleren Ostens“ entstehen zu lassen, verdankt sich höheren Berechnungen als „der Schaffung von Arbeitsplätzen“ für arme Menschen in bislang abgeschriebenen Gegenden. Es soll der Erzeugung von landwirtschaftlichen Produkten für den Export dienen und so die Landwirtschaft der Region auf eine geschäftsmäßig konkurrenzfähige Basis stellen und so der Türkei Steuern und Devisen einbringen. Bevor jemand, der in dieser Gegend daheim ist, von diesem Großprojekt sich in den neu einzurichtenden Eigentumsverhältnissen dienstbar machen kann, wurden dort erst einmal Hunderte von Dörfern beseitigt. Deren Bewohner wurden dafür mit Entschädigungssummen bedacht, die allenfalls die Kosten fürs Abwandern deckten. Im Gegenzug gehen die Pläne der Regierung dahin, diese Gegend zu türkisieren, indem neben den Großplantagen auch noch Siedler aus dem Westen der Türkei ansässig gemacht werden. Die politökonomische Rücksichtslosigkeit paart sich mit der völkisch-nationalistischen Zurücksetzung der Kurden und dem Bedürfnis nach einer Sicherung der Staatsgebiets unter ethnischen Gesichtspunkten. Die regionalen Rivalen Syrien und Irak sehen sich der Drohung ausgesetzt, vom Nachbarn buchstäblich das Wasser abgegraben zu bekommen. Die Türkei legt nicht nur aus eigener Hoheit die Wassermenge fest, die der Euphrat noch führt, wenn er die Landesgrenze überschreitet; an dieser Wasserader hängen weite Bereiche des Lebens dieser Länder. Ankara nutzt die Hand am Wasserhahn auch gleich noch diplomatisch, um den nahöstlichen Anrainern Respekt vor den türkischen Regionalvormachtplänen beizubringen, und droht schon mal mit dem Abschneiden der Wasserzufuhr.
Die türkische Regierung tritt also einem Teil ihrer Untertanen, die sie in den kurdischen Siedlungsgebieten lokalisiert und schon an der Sprachverwendung dingfest macht, gar nicht als eine unverzichtbare und darin für private Berechnungen auch benutzbare Lebensbedingung gegenüber, sondern hauptsächlich als destruktive Gewalt, die herkömmliche Lebensweisen ruiniert, ohne für aushaltbaren Ersatz zu sorgen, die das selber mit völkischen Unterscheidungen untermauert und die dennoch bedingungslose Fügsamkeit fordert und nach Kräften erzwingt. Wenn Kurden dieses Verhältnis, das die türkische Staatsgewalt zu ihnen eingeht, ihrerseits im Lichte des ja auch ihnen zugänglichen zeitgenössischen politischen Verstandes mit seinen völkischen Gesichtspunkten deuten, dann kommt ihnen die auf Imperialismus ausgerichtete Herrschaft aus Ankara wie eine Fremdherrschaft vor, die Kurdistan wie eine Kolonie behandelt. Die Leute im Kurdengebiet müssen gar nicht die Konsequenz ziehen, durch bewaffneten Widerstand von der fremden Herrschaft loskommen zu wollen, um sich wegen ihrer Volkszugehörigkeit dem tätigen Generalverdacht der Zentralgewalt auf nationale Unzuverlässigkeit ausgesetzt zu sehen. Wo solcher Widerstand sich organisiert, womöglich noch vom Ausland gesponsort wird, da haben die türkischen Nationalisten freilich den in ihren Augen schlagenden Beweis dafür, daß die Türkei sich eines Anschlags gegen ihr elementares Recht auf Land und Volk erwehren muß. Also schlagen sie militärisch zu und schaffen so zusätzliche Gründe dafür, daß die Anlässe fürs Zuschlagen nicht entfallen; es sei denn per Endsieg.
2. Nach dem Ende des Kalten Krieges: die Türkei arbeitet an ihrem imperialistischen Aufstieg
Die Berechenbarkeit einer Weltlage, in der über 40 Jahre lang der Gegensatz der verbündeten Imperialisten zur realsozialistischen Weltmacht mit ihrem Block alle Affären auf der Welt dominiert und eingeordnet hat, ist vorbei, seit die Sowjetunion abgetreten ist. Seither wird die politische Landkarte im Ringen einer Vielzahl von alten und von etlichen neu dazugekommenen Staaten um die Gestaltung der neuen Lage zugunsten des jeweils eigenen Nationalismus neu sortiert. Die Republik Türkei macht da keine Ausnahme, ganz im Gegenteil: Sie mischt nach besten Kräften mit.
Von Betroffenheit über eine Entwertung früher gültiger politischer Kalkulationsgrundlagen war jedenfalls innerhalb der politischen Führung Ankaras von Anfang an überhaupt nichts zu bemerken, dafür um so mehr vom politischen Willen zur Ausnutzung der in ihren Augen durch die Abdankung der SU eröffneten Gelegenheit zum Aufstieg zur Vormacht in der jetzt kommunismusfreien Nachbarschaft. Ihre Antwort auf die Herausforderung der neuen Weltlage besteht im Aufbruch zu einem Imperialismus eigener Provenienz, dessen Reichweite geopolitisch „von der Adria bis zur chinesischen Grenze“ veranschlagt wird.[6] Die eingangs zitierte Äußerung des vorletzten Staatspräsidenten Turgut Özal steht wie der ganze Mann programmatisch für die Entschlossenheit der führenden türkischen Nationalisten, den Umsturz der früher gültigen Aufteilungs- und Kräfteverhältnisse, der ihnen eine ganz neue, neuerdings zugängliche politische Nachbarschaft beschert hat, als Chance für die Perspektive einer von Ankara ausgehenden regionalen Hegemonie wahrzunehmen.[7] Seinen heimischen Laden sah Özal als für diesen Fortschritt gut gerüstet an. Mit dem selbstverständlichen Fortbestand der NATO über den Exitus ihres östlichen Widerparts hinaus blieb die militärische Potenz der Türkei ungeschmälert erhalten. Und durch den Umstand, daß die Türkei in den 80er Jahren eine Weile als Muster einer funktionierenden IWF-geleiteten „Anpassung an die Erfordernisse der modernen Weltwirtschaft“ galt und wieder eine gewisse internationale Kreditwürdigkeit besaß, sahen Politiker vom Schlage Özals sich berechtigt, von der Türkei als dem „künftigen Japan des Mittleren Ostens“ zu schwärmen und den Aufstieg ihres Staates zum Paten über die politische Nachbarschaft auf ihre Fahnen zu schreiben. Einem Staat, der die Hegemonie über eine ziemlich ausgreifend definierte „Region“ für sich ins Feld führen kann, sollten schließlich im Rahmen der fortbestehenden Bündnisbeziehungen die etablierten Weltmächte viel mehr Respekt und neue Berücksichtigung zollen müssen.
Dies das Anspruchsniveau des türkischen Nationalismus heute. Den neuen Gepflogenheiten seiner bisherigen westlichen Bündnispartner haben die türkischen Politiker ja unschwer die Aktualität von Bestrebungen entnehmen können, die sich an einer Neuaufteilung der Welt zu schaffen machen, die um die Errichtung von Zonen möglichst exklusiven Einflusses und die Etablierung von Aufsichts- und Ordnungsbefugnissen gegenüber nachrangigen Staaten ringen. Und sie haben dieser neuen Konkurrenz Notwendigkeit und Chance entnommen, aus den bisherigen Bündnisbeziehungen hinaus- und in den Rang einer eigenständigen regionalen Vormacht hineinzuwachsen. Diesem nationalen Aufbruchswillen erscheint daher die alte weltpolitische Konstellation, in der die Türkei als NATO-Frontstaat eine über seine eigenen nationalen Möglichkeiten hinausgehende Rolle gespielt hat, wie ein einziges Hemmnis nationaler Rechte und Ambitionen, aus denen sich die Türkei jetzt befreien muß, will sie ihr Vorankommen in der Hierarchie der Staatenwelt sichern.[8] Daß sie dabei auf die Kalkulationen und die Mittel anderer und vor allem mächtigerer Nationalismen stoßen, wissen die Machthaber in Ankara selbstverständlich. Sie stellen es in Rechnung, lassen sich davon aber nicht abhalten, sich im Interesse der türkischen Nation in die sie betreffenden Fälle einzumischen, an denen um neue Zuständigkeit und Unterordnung konkurriert wird.
Der Krieg gegen den Irak und die Entdeckung der Kurden als weltpolitische Manövriermasse
Die Definition der „neuen Weltordnung“ leiteten die USA mit einer passenden Machtdemonstration ein, mit dem Krieg gegen den Irak wegen unerlaubter Wiedervereinigung mit Kuwait; Saddam Husseins Vorpreschen bei der Neugestaltung der politischen Landkarte nahm Washington zum Anlaß, seinen Anspruch auf Oberaufsicht der ganzen restlichen Welt gewaltsam zur Kenntnis zu bringen. In Hinsicht auf die noch existierende Sowjetunion unter Gorbatschow kam das US-Vorgehen gegen den Irak genaugenommen einem letzten und entscheidenden Test gleich, ob die einstige sozialistische Weltmacht sich definitiv von ihrer Rolle als machtvoller Bremse für die imperialistische Zuständigkeit über den Globus verabschiedet hatte; einen Test, den die Perestroika-Führer bekanntlich zur vollen Zufriedenheit der USA bestanden. Insofern konnten diese sich auf den anderen Aspekt ihres mit dem Golfkrieg verfolgten Anliegens konzentrieren, allen übrigen Staaten die Kompetenz der USA als „einziger verbliebener Supermacht“, also konkurrenzloser Aufsichtsbehörde für anstehende Weltordnungsfragen nahezubringen. Sie taten dies mit dem Angebot an die „Staatenfamilie“, sich via UNO als eingeordnete Mit-Macher des US-Krieges gegen den Irak zu betätigen.
Die Türkei unter Präsident Özal hat die amerikanische Klarstellung gegenüber dem Irak, daß unbefugtes Aufsteigertum von der führenden imperialistischen Nation mit der Höchststrafe geahndet wird, nicht bloß als das gründliche Ausschalten eines ihrer Hauptkonkurrenten in Sachen Hegemonie in Mittelost geschätzt, sondern darüber hinaus als gute Gelegenheit genommen, als regionaler Sonderverbündeter der USA die Reichweite ihrer eigenen Macht zu steigern. An der von der Weltmacht Nr.1 aufgemachten Front war schließlich die Türkei schon wieder ein wichtiger Frontstaat, an dessen verläßlicher Teilnahme die Veranstalter des Kriegs gegen Bagdad großes Interesse haben mußten. Die Türkei bot sich geradezu begeistert an zur Eröffnung einer zusätzlichen Angriffslinie im Norden des Irak; als gestandener Militärstaat gedachte sie ihren Gewaltapparat ins Spiel zu bringen, um daraus, als wertvoller Verbündeter der Anti-Saddam-Koalition, ein Recht auf erweiterte Einflußnahme bei der Definition der regionalen Machtverhältnisse geltend zu machen. Zwar wurde der NATO-Bündnisfall ausgerufen (man erinnert sich, daß u.a. die BRD eine Jagdbomberstaffel und Abwehrraketenbatterien auf den NATO-Stützpunkt Incirlik verlegte) und damit ein Stück militärischer Bündnismacht ganz im Sinn der Türkei mobilisiert. Deren Machthaber waren dann aber etwas enttäuscht darüber, daß einerseits der Golfkrieg durch seine Hauptmacher von der saudischen Front aus so blitzsauber erledigt wurde, andererseits Saddam Hussein den Krieg an der Türkei-Front gar nicht annahm, sondern seine Scud-Raketen gegen Saudi-Arabien und Israel abschoß – der ganz große türkische Einstieg in den ersten Hauptfall von „neuer Weltordnung“ also doch ausfiel.
Dafür entdeckte man in Ankara am Krieg gegen den Irak einen anderen Faktor, um sich entschiedeneren Einfluß auf die eigene Nachbarschaft zu sichern – ausgerechnet die Kurden, deren türkische Abteilung man selber drangsalierte. Schon während der Operation „Desert Storm“ hatte die Anti-Irak-Koalition die irakischen Kurden im nördlichen Teil dieses Landes zum Widerstand gegen Bagdad ermutigt, um die Niederlage des Saddam-Regimes auch auf diesem Wege zu befördern. Nach erfolgter „Befreiung Kuwaits“ nahm die Entdeckung des „unterdrückten kurdischen Volkes“ durch die imperialistischen Hauptmächte einen weiteren Aufschwung. Im schiitischen Süden und im kurdischen Norden des Irak wurden im Namen der UNO große „Sicherheitszonen“ eingerichtet; seither ist das irakische Kurdengebiet der Hoheit Saddams faktisch entzogen.[9] Daß das Kurdengebiet des Irak quasi seinem souveränen Herren abgenommen und dem Zugriff auswärtiger, an der Etablierung eigener Ordnungsbefugnisse arbeitender Mächte überantwortet wurde, wurde von den türkischen Politiker als Chance aufgefaßt, dort im türkischen Sinne entscheidend mithineinzuregieren und damit zugleich die verschiedenen Kurdenfraktionen zu spalten und den PKK-Kämpfern und ihrem Anhang die Rückzugsgebiete im Irak abzuschneiden. Deswegen präsentierte Özal sich im Jahre 91 zwischendurch als Schutzherr auswärts verfolgter Kurden und stellte dafür daheim sogar so etwas wie ein Stück Anerkennung eines eigenen Kurden-Volkstums in Aussicht.[10] Mit dieser Politik brachten es die türkischen Chefs immerhin zu einigen Befugnissen bei der UN-Kontrolle des abgetrennten irakischen Nordens. Und seit geraumer Zeit läßt Ankara seine Armee ganz routinemäßig die PKK-Kämpfer in deren Rückzugsräume jenseits der Grenze verfolgen und behandelt diese Gegend Iraks immer wieder wie türkisches Hoheitsgebiet. Umso mehr macht es der Türkei zu schaffen, daß die türkischen Kurden aus dem berechnenden neuen Interesse der Hauptmächte am Autonomiewunsch irakischer Kurden die umgekehrte Konsequenz wie Ankara gezogen, darin eine Chance für den Erfolg der kurdischen Sache gesehen und ihre Anstrengungen gesteigert haben, die türkische Herrschaft loszuwerden, so daß die türkischen Befehlshaber beträchtliche Teile ihrer Wehrmacht statt als Mittel für türkische Aufstiegsambitionen zur Verteidigung der türkischen Hoheit über einen ganzen eigenen Landesteil heranziehen müssen, um nicht selber betroffen zu sein vom Zerfall etablierter Nationen in ethnisch begründete Teilstaaten.[11]
Die „befreiten Turkvölker“ und der Konflikt Armenien/Aserbaidschan
An anderer Stelle hat sich die Türkei dann ganz autonom – nicht bloß unter amerikanischem Oberkommando mitmachend, sondern im Sinne einer eigenständigen Ordnungskompetenz – in der Region ins Spiel zu bringen versucht: bei den neuen, überhaupt nicht konsolidierten Staatswesen, die aus der realsozialistischen Konkursmasse hervorgegangen sind. Sie sieht sich durch das Ende des sowjetischen „Völkergefängnisses“ nämlich selber befreit: zum Zugriff auf lauter Gebiete, die irgendwie „türkisch“ sind, nach moderner türkischer Herrschaftslogik also von Ankara und Istanbul aus betreut gehören.[12] Dem neuen Ehrgeiz der Türkei als Regionalvormacht für diverse „Turkvölker“ – neulich noch: Sowjetrepubliken im Süden der UdSSR – stellt sich die Sowjetunion nachträglich wie ein einziges, und das einzige Hindernis dar, das diesem imperialistischen Naturrecht der Türkei mehr als 60 Jahre lang im Weg stand. In diesem Geist hat die Türkei nachhaltig in die Konflikte eingegriffen, die die Konstitution neuer Nationalstaaten auf dem Boden der ehemaligen Sowjetunion mit sich brachte. Mit dem Willen zur Erweiterung eigener Machtgrundlagen mischt sich Ankara damit in lauter umstrittene Ordnungsfragen ein; es gibt dort schließlich kein Machtvakuum, das die Türkei besetzen könnte. Die Vorstöße der USA und Europas, die verschiedenen internationalen Institutionen von der UNO bis zur KSZE beaufsichtigend ins Spiel zu bringen, sowie das russische Beharren darauf, daß es sich hier um das „nahe Ausland“ Rußlands, also eine Sicherheitssphäre mit besonderen Aufsichtsnotwendigkeiten und -rechten Moskaus handelt, beweisen ja nur zu deutlich, daß diese Region eine wesentliche Rolle beim Streit um den künftigen imperialistischen Status Rußlands spielt. Türkische Diplomaten und Meinungsmacher verwenden selber gerne das Bild vom „Pulverfaß“, das diese Gegend von jeher und heute erst recht darstelle, freilich nur, um daraus zu folgern, daß die Aufsicht Marke Ankara genau der passende Deckel auf jenes Pulverfaß und ganz im Interesse der verbündeten Oberaufseher sei, die schließlich wüßten, was sie an der Türkei haben. Daß diese Darstellung ziemlich getürkt ist, verdeutlicht der Verlauf der türkischen Verwicklung in den Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan.
Aserbaidschan, Heimat des der Türkei nächstgelegenen „Brudervolks“, erfreute sich von Anfang an besonderer Betreuung aus Ankara und hat seinerseits engen Kontakt gesucht mit der Kalkulation, dank türkischer Aufbauhilfen und deren Beziehungen zum Westen einen Beitritt zur GUS nicht nötig zu haben. Zur Unterhaltung dieser Sorte Völkerfreundschaft tut die Türkei seitdem einiges. Sie kreditiert den Aufbau eines Tourismussektors in Aserbaidschan, baut dort Straßen und liefert Züge und Busse. Eine türkische Firma kümmert sich – wie im übrigen auch in Usbekistan, Georgien, Kasachstan und Kirgistan – um das Telekommunikationsnetz. Vor allem aber macht sich die Türkei nützlich als Vermittler zwischen Interessenten aus den imperialistischen Hauptnationen, die derzeit in den Hinterlassenschaften der SU die Prospektion von brauchbaren natürlichen Reichtümern betreiben, und den Neustaaten in ihrer Nachbarschaft, die ihre „Entwicklung“ mangels anderer Mittel durch die Überlassung ihrer Bodenschätze an westliche Geschäftemacher voranbringen wollen. Vor allem bei Energieträgern sind türkische Fachleute tätig, deren Firmen wiederum wenigstens teilweise ausländischen Multis gehören.[13] Nach dieser Seite hin betrachten die Macher von Politik und Geschäft in den westlichen Hauptstädten durchaus wohlwollend einschlägige türkische Bestrebungen, sofern sie eigenen nützlichen Zugriff auf die neuen Souveräne gewähren, und vergleicht die Berechenbarkeit der Türkei mit in dieser Hinsicht eher unsicheren Kantonisten wie dem „fundamentalistischen“ Iran, der in der Konkurrenz um die Vormacht in dieser Region ja ebenfalls mitmischt, im kapitalistischen Abendland aber ein ziemlich fundamentales Mißtrauen genießt. Da ist es dessen Vormächten schon lieber, wenn türkische Geschäftemacher bei der Exploration wie bei der Förderung vor allem von Erdöl und Erdgas aus Aserbaidschan, Turkmenistan usw. mit von der Partie sind. Bereits die damit verbundene und dem Geschäftlichen übergeordnete Berechnung der selber nur in geringem Umfang Öl fördernden Türkei, sich auf diesem Wege erweiterten Zugriff auf diesen Stoff zu verschaffen, verweist die Oberaufseher dann aber darauf, daß sie es auch bei den Partnern aus Ankara mit ambitionierten Nationalisten zu tun haben und daß deren Kalkulationen vor allem sofort an strategische Verwicklungen heranreichen, die man zur Zeit, an diesem Ort und ausgerechnet durch türkische Einmischung gar nicht haben will. Die Türkei hat schon über die Frage, wie, wohin und über wessen Territorium das Öl aus Aserbaidschan abtransportiert werden soll, einen inzwischen drei Jahre dauernden Streit mit Rußland vom Zaun gebrochen, den die führenden imperialistischen Mächte gar nicht bestellt hatten.[14]
Vor allen Dingen aber sind alle Beziehungen zu Aserbaidschan automatisch davon berührt, daß dieses Land mit seinem Nachbarn Armenien seit dem Endstadium der SU um die Enklaven Berg-Karabach einerseits, Nachitschewan andererseits Krieg führt. Über die Bekämpfung des benachbarten Nationalismus, also gegeneinander und rein destruktiv, definieren die in Gründung begriffene Staaten nämlich, was sie darstellen und ausrichten. Dieser Konflikt zieht sich jetzt an die sechs Jahre lang hin – nicht zuletzt deshalb, weil bislang keine der Aufsichtsmächte, auf die es ankommt, sich seine Beendigung zum Anliegen machen wollte. Das heißt wiederum keineswegs, daß diese Mächte an einer Kontrolle seines Verlaufs desinteressiert wären; das mußte auch die Türkei, die an diesem Krieg stark interessiert ist, bei ihren Versuchen erfahren, seinen Verlauf zu beeinflussen. Die Türkei sah im Krieg Aserbaidschans mit Armenien – der auch die klassisch-rassistische Konstellation Ankaras aktualisiert: hier ein „Brudervolk“, dort der armenische „Erbfeind“ – ihrerseits nämlich eine Gelegenheit, durch Unterstützung Aserbaidschans Einfluß auf eine entscheidende regionale Ordnungsaffäre zu gewinnen. Um ihrem Anspruch Nachdruck zu verleihen, haben die Chefs der türkischen Militärmacht nicht bloß ihren Schützlingen in Baku zivil, beim Nachschub sowie mit Militärgerät, -beratern und -ausbildern unter die Arme gegriffen; sie haben auch ihre eigene Armee massiv und bedrohlich an ihrer Grenze zu dem Staat aufmarschieren lassen, der geographisch und politisch zwischen der Türkei und Aserbaidschan gelegen ist. Das sollte die Führung in Eriwan zum Zurückstecken bewegen und den Aserbaidschanern einen womöglich entscheidenden Vorteil verschaffen.
Diese Absicht Ankaras wurde von den Weltmächten incl. seiner NATO-Verbündeten durchkreuzt. Die Türkei zog ihre an Armeniens Grenze massierten Truppen wieder ab, und muß sich vorderhand damit zufrieden geben, zusammen mit den USA und Rußland einem Ausschuß der KSZE anzugehören, der sich mit dem Fall Armenien/Aserbaidschan befaßt, in Minsk tagt, von einem Schweden präsidiert wird und nun schon eine ganze Weile keine Anstrengungen erkennen läßt, um sein Betreuungsobjekt irgendeiner Sorte Entscheidung näherzubringen, geschweige denn einer im Sinne Ankaras. Der Türkei wird also diplomatisch – auf der Ebene der KSZE, die z.Z. keine so große Rolle unter den diplomatischen Börsen spielt – attestiert, daß sie Interessen an dieser Gegend geltend machen darf, aber entscheidender Einfluß wird ihr gerade bei einem Ordnungsfall verwehrt, bei dem die Türkei selber aktiv geworden ist und immerhin ihr Militär in Stellung gebracht hat, um eine „Lage“ zu definieren. Dafür hat die NATO ihr keine Rückendeckung gegeben und sich nicht in Beschlag nehmen lassen. Zwar wird die Türkei in der Tat nach wie vor und nicht zu knapp vom Bündnis mit Mitteln, vor allem Waffen, ausgestattet, damit sie auch weiterhin im Interesse der Bündnisvormächte die Rolle eines „Bollwerks“ gegen die unberechenbaren Nationalismen in Mittelost wahrnimmt. Aber in dieser Auftragslage ist kein Mandat der führenden NATO-Staaten enthalten, daß Ankara auf eigene Faust einen Krieg im Kaukasus entscheidet und sich selbständig an dem vom Westen auch nach Abdankung der SU verfolgten Ziel der Eindämmung Rußlands und der Kontrolle über die Ordnungsambitionen Moskaus in seinem unruhigen „nahen Ausland“ zu schaffen macht. Zumal man in Washington oder Bonn momentan z.B. noch damit beschäftigt ist, die Balten und Ostmitteleuropäer „an die NATO heranzuführen“, ohne darüber Rußland zu verprellen. Und Moskau ist erklärtermaßen schon seit einiger Zeit mißtrauisch gegen die Ambitionen der Türkei, mit denen diese im Schwarzmeerraum und Mittelasien in ein Konkurrenzverhältnis zu Rußland tritt. Immerhin hat Rußland im Armenien/Aserbaidschan-Konflikt mit diversen „Vermittlungsinitiativen“ bis dahin, daß der russische Verteidigungsminister seine verfeindeten Kollegen empfängt, seinen Anspruch auf eine exklusive Schiedsrichterrolle deutlich gemacht. In diesem Fall wollen ihm die NATO-Maßgeblichen nicht entgegentreten; diese Klarstellung hat die Türkei bei ihrem Test, was sie sich an Einmischung leisten kann, provoziert.
Der Eindruck, den türkische Schutzmachtversprechungen machen, hat darunter etwas gelitten, auch in Aserbaidschan. Immerhin hatte es Ankara 1992 bereits zu so viel Einfluß in Baku gebracht, daß dort in Gestalt eines gewissen Eltschibei ein Freund der Türkei mit einem betont antirussischen Programm an die Macht kam. Nach gravierenden militärischen Rückschlägen gegen Armenien mußte der Türkenfreund abtreten; unter seinem Nachfolger Alijew ist Aserbaidschan der GUS beigetreten. Als die Russen dort dauerhaft „Schutztruppen“ stationieren wollten, hat Alijew dies aber wiederum abgelehnt und kurz darauf einen Freundschaftspakt mit der Türkei geschlossen. Ankara kann sich also weiterhin Hoffnungen machen für sein Programm ‚bestimmender Einfluß auf Aserbaidschan‘.
Das Auftreten auf dem Balkan und der Konflikt mit Griechenland
Auch den Zerfall des sozialistischen Jugoslawien in diverse sich feindselig gegenübertretende Nationalismen reiht man in Ankara ein unter die Gelegenheiten, die die Türkei wahrnehmen kann und muß, um zur respektablen Vormacht über die gesamte Nachbarschaft auch in Europa aufzusteigen – und darüber nicht zuletzt die alte regionale Rivalität mit Griechenland endlich eindeutig zugunsten der Türkei zu entscheiden. Die Führung in Ankara verfolgt diese Gelegenheit nach der Methode, sich an die Kalkulationen der maßgeblichen Ordnungsmächte anzuhängen und diese dann auf deren Linie zu überbieten, soweit sie eine Förderung der bosnischen Moslems einschloß. Wenn die Hauptaufseher des Balkan-Konflikts erst im Zuge ihrer Begünstigung der Separatisten auf der Errichtung eines Extra-Staats Bosnien mit der Kennzeichnung „moslemisch“ bestehen und dieses Gebilde dann eine Weile ungehindert heftigem serbischen Beschuß ausgesetzt ist, dann muß Frau Çiller sich unbedingt in Sarajewo als Mutter aller Moslems präsentieren und die empörende Untätigkeit der Welt angesichts des Völkermords an ihren Glaubensbrüdern anprangern. Wenn das gleichfalls neu in die Welt gesetzte Makedonien und das gewendete Albanien in der Weltöffentlichkeit als mögliche nächste Opfer serbischer Expansionsgelüste verhandelt werden, dann fährt der Türkenchef hin und verspricht, die Türkei werde diese Länder als antiserbische Bollwerke ausrüsten – und als antigriechische dazu; Griechen und Serben stecken ja sowieso unter einer Decke. Wenn die Aufsichtskonkurrenz der Hauptmächte dazu führt, daß die supranationalen Institutionen UNO und NATO ins Spiel gebracht werden, dann faßt Ankara das als Chance zu türkischem Mitschießen unter einem unwidersprechlichen Rechtstitel auf und stellt als erstes NATO-Mitglied der internationalen Streitmacht ein Jagdbombergeschwader mit bestem Gerät zur Verfügung. Wenn sich im Hin und Her der konkurrierenden Weltordnungsmächte schließlich die antiserbische Stoßrichtung durchsetzt, dann trägt die Türkei als einziger Staat begeistert dem UNO-Chef jede Menge türkische Soldaten als Bodentruppen an, auch wenn der sich erst einmal weigert, türkische UNO-Soldaten in Bosnien zu stationieren.
Der UNO-Generalsekretär bringt mit seiner reservierten Haltung ein allgemein geteiltes Mißtrauen gegen Ankaras Balkan-Engagement zum Ausdruck. In diesem Fall wird sogar die Stellungnahme der Serben, die den Türken „Einseitigkeit und permanent negative Tätigkeit“ in Bosnien vorwerfen, nicht umstandslos zurückgewiesen; und der griechische Außenminister meint gar, mit türkischen Bodentruppen werde „der Wolf zum Hirten gemacht“ (SZ 26./27.3.94). Allenthalben wird der Türkei der Vorbehalt entgegengebracht, auf dem Balkan nicht für „Friedenssicherung“, für eine „gerechte Lösung“, für die UNO-Aufträge usw. unterwegs zu sein, sondern bloß, also in unzulässiger Weise Partei zu sein für spezielle türkische Schützlinge und damit für sich selber. Worum es der Türkei tatsächlich geht, wenn sie sich berechnend auf den Internationalismus der Beaufsichtigung der „Balkan-Krise“ bezieht – das wird in ihrem Falle also öffentlich durchschaut und zum Grund für eine zurückhaltende Stellung zu Ankaras Angeboten erklärt. Nicht, daß man sich ihrer nicht bedienen wollte – die Stationierung von 2700 türkischen UNO-Soldaten in Bosnien ist kürzlich angelaufen –, aber eine verstärkte türkische Präsenz und damit Mitsprache auf dem Balkan, die die Türkei mit ihren Angeboten verfolgt, wollen ihr die Hauptaufseher nicht durchgehen lassen; es gelingt ihr nicht, ihre Interessen als Supranationalismus zu definieren. Zwar hat die Türkei mit ihrem Auftreten in der Balkan-Affäre im Prinzip nichts anderes vor als die übrigen Akteure an diesem hochinteressanten Schauplatz des Ringens um die „neue Weltordnung“; nur trifft sie dabei auf die versammelten Oberaufsichtsmächte, von denen keine Neigung zeigt, der Türkei auf dem Balkan Aufsichtsrechte zuzugestehen. Deren Konkurrenz untereinander hat, gerade im nunmehr dreijährigen Konflikt in Ex-Jugoslawien, ja auch derart komplizierte und methodische Verlaufsformen angenommen,[15] daß im Vergleich dazu die Ambition der Türkei, als Schutzmacht bedrängter Glaubensbrüder aufzutreten, geradezu aufrichtig-geradlinig wirkt – aber mit seinem unmittelbar parteilichen nationalen Interesse auch extra verdächtig. Der Kampf um die obersten Etagen der Weltherrschaft spielt sich hingegen als das Mit- und Gegeneinander eines Kollektivs von Schiedsrichtern ab, angesichts dessen es tatsächlich ganz sachfremd wäre, wenn Amis, Russen oder Deutsche bloß ein instrumentelles Interesse an eindeutigen Schutzmachtverhältnissen zwischen einem Patron und seinem Klienten in Anschlag brächten. Freilich bringen es die Unberechenbarkeiten dieser Sorte Ordnungskonkurrenz auch mit sich, daß die promoslemische Parteilichkeit der Türkei auch einmal zur Kalkulation eines der Oberaufseher passen könnte; daß also Ankara mit seiner hartnäckigen Scharfmachertour in der Balkanfrage ein Stück der erwünschten Aufwertung doch noch zufällt – immerhin drohen die USA inzwischen ja schon laufend mit der Aufhebung des Waffenembargos gegenüber den Moslems.
Allerdings sind die weiteren Perspektiven Ankaras – in trauter Zwietracht mit dem Erzrivalen Griechenland, für den spiegelbildlich ein bißchen dasselbe gilt – wenig dazu angetan, Verläßlichkeit zu stiften, auch wenn sie den kriegerischen Tönen der letzten Zeit nicht gleich entsprechende Taten folgen lassen. Die türkischen Machthaber sehen nämlich in den neuen weltpolitischen Konstellationen die Möglichkeit, ihren alten Lieblingserbfeind in Sachen bestimmender Einfluß auf die ganze Region zu überflügeln, ihn vom Balkan her einzukreisen und damit die Rivalität mit ihm endgültig zu eigenen Gunsten zu entscheiden. Griechenland antwortet seinerseits auf der passenden Ebene und besteht, wie bei der von Athen hoch gehandelten Makedonien-Frage auf elementaren Rechten der hellenischen Nation insbesondere in der Ägäis. Und schon ist im zivilisierten Europa eine dauerhafte Konfliktlage da, die bereits zweimal, im Januar und im Juni 1994, fast zu Kriegshandlungen geführt hätte.[16] Gerade am Konflikt mit den Griechen, der nun wirklich niemandem im Lager der westlichen Hauptaufsichtsmächte in den Kram paßt, werden die europäischen Ordnungshüter darauf gestoßen, welche Risiken und Unwägbarkeiten vom unkontrollierten Aufstiegswillen einer Nation vom Schlage der Türkei ausgehen. Statt anderswo „Pulverfässer“ beaufsichtigen zu helfen und sich verläßlich einzuordnen, erzeugt sie selber eines, das keiner bestellt hat.
Die bisherige Bilanz der regionalen Aufbruchsanstrengungen der Türkei fällt also nicht gerade zufriedenstellend aus. Ankara hat sich in der Gegend an entscheidenden Stellen eingemischt; aber daß es darüber bestimmenden Einfluß gewonnen hat, davon kann keine Rede sein, geschweige denn, daß darüber der Erwerb tragfähiger neuer Machtmittel und -grundlagen vorangekommen wäre. Das Ideal der türkischen Politiker, die Interessen und Machtmittel des NATO-Bündnisses für die eigenen Emanzipationsabsichten ausnutzen zu können, geht nicht auf. Statt dessen sehen sie sich darauf verwiesen, die Kosten dieses Programms mehr denn je selber zu tragen und sich durch die Mobilisierung der eigenen nationalen Kräfte auch noch gegen die Bedenken und praktischen Einwände der Bündnispartner zu behaupten.
3. Die Türkei und ihre aktuellen Krisen
Um die Mitte des Jahres 94 ist zwar keineswegs das türkische Aufbruchsprojekt vorbei. Vorbei ist aber die geradezu euphorische Aufbruchsstimmung, die seinerzeit Turgut Özal verkörpert hat. Statt dessen schlägt diese Nation sich mit einer heftigen Wirtschaftskrise, mit den nur durch massiven Militäreinsatz zu bekämpfenden Autonomiebestrebungen ihrer Kurden und dem Vormarsch einer die Staatsgrundlagen der modernen Türkei in Frage stellenden fundamentalistischen Opposition herum; der Regierung und ihrer auf jung, dynamisch und aufstrebend gestylten Chefin wird allseits das baldige Abtreten prophezeit, obwohl nach Meinung kundiger Beobachter auch die Opposition „keine überzeugenden Auswege aus der Staatskrise“ zu bieten hat.
Das ist die im Inneren anfallende Bilanz des imperialistischen Großprojekts, das die Türkei sich zugetraut hat; sie resultiert wesentlich aus der zwiespältigen Erfolgslage dieses Projekts, für das die eigene Nation mit ihren beschränkten Ressourcen mit größter Selbstverständlichkeit verplant worden ist. Daß sie sich den nationalen Aufbruch einiges kosten läßt, schlägt natürlich auf die soziale Lage der Türken durch; deren materieller Lohn wird immer weniger wert. Aber auch der patriotische Lohn in Form erfolgreicher nationaler Großtaten läßt zu wünschen übrig. So sieht sich die Regierung nicht nur mit einer fundamentalen ökonomischen Krisenlage, sondern auch mit wachsender nationaler Unzufriedenheit konfrontiert, also vor grundsätzliche innere Souveränitätsprobleme gestellt. Das Aufstiegsprogramm stärkt und eint die Nation nicht, sondern droht sie im Innern zu zerrütten und dadurch anfällig nach außen zu machen.
Die Wirtschaftskrise und der Kampf um die Sanierung der Nationalökonomie per Austeritätsprogramm und IWF
Seit einem knappen Jahr verzeichnet die Türkei eine Wirtschaftskrise, die als „die schlimmste seit zwei Jahrzehnten“ beklagt wird. Erstens bekommt die Türkei ihre Abhängigkeit vom Weltmarkt zu spüren. Wenn da eine weltweite Krise des Kapitals Platz greift, die die konkurrierenden nationalen Standorte von Kapital mit neuer Schärfe einer Sortierung ihrer Tauglichkeit als Mittel des Geschäfts unterzieht; wenn sich im Zuge der Krisenkonkurrenz sogar mächtigere Nationen als die Türkei veritable Staatskrisen einhandeln, dann macht sich für einen Staat vom Rang der Türkei diese Lage auch und erst recht als drastische Entwertung ihrer politökonomischen Potenzen bemerkbar. Daß Ankara sich gerade einen Aufstieg in der Rangordnung der Staaten und damit auch eine entscheidende Verbesserung seiner Standortqualität vorgenommen hat, wird ihm von den geschäftlichen Subjekten des Weltmarkts nicht honoriert. Sie sehen zu wenig Erfolge dieses Projekts; sofern sie es bei ihren Standortkalkulationen überhaupt würdigen, sind sie wahrscheinlich eher der Meinung, daß die Türken sich da übernommen haben.
Zweitens sind die Kosten des türkischen Unternehmens ‚Aufbruch zur Regionalvormacht‘ sowie der Probleme und Rückschläge, die bei seiner Realisierung auftreten, in der Tat enorm. Die neuen zwischenstaatlichen Beziehungen, die von Ankara aus in seine Region angebahnt werden, sind selbst in ihren ökonomischen Abteilungen primär strategische Investitionen, die darauf kalkuliert sind, langfristig andere Staaten in eine egal wie lohnende Abhängigkeit zu bringen. Darüber hinaus sind die Staatsgebilde, die die Türkei da im Visier hat, jetzt und auf absehbare Zeit so wenig zahlungsfähig, daß der größte Teil der ohnehin nur in geringem Umfang stattfindenden Handelsgeschäfte mit der Türkei auch noch als Bartergeschäft abgewickelt wird, also quasi im Verfahren des Naturaltausches. Natürlich kostet auch die laufende Aufrüstung ihrer Armee, mit der die Türkei ihre Regionalvormacht-Bestrebungen durchaus sachgerecht untermauert, viel Geld. Für den Militärstaat Türkei, der dank seiner NATO-Rolle die letzten vierzig Jahre mit auswärtiger Hilfe über seine Verhältnisse gelebt hat, ist das kein Einwand gegen die laufende Aufrüstung; die ist schließlich eine ausschlaggebende ‚Zukunftsinvestition‘ für seine Rolle als Aufsichtsmacht in Mittelost. Soweit seine NATO-Verbündeten darin einen Beitrag Ankaras zu einer befriedeten, d.h. militärisch in Schach gehaltenen Region sehen, stehen sie auch weiterhin für einigen Rüstungsbedarf ein, teils durch Schenkung, teils durch die Erlaubnis, daß das türkische Militär im westlichen Ausland zukaufen darf, z.B. Flugabwehrraketen aus Deutschland.[17] Allerdings kann und will sich der Staat darauf nicht beschränken lassen und leistet sich daher das für nötig befundene zusätzliche Arsenal für seine nationale Gewalt auf eigene Rechnung, auch wenn er dabei seine nationale Leistungsfähigkeit im Grund überstrapaziert. Für die Beschaffung der restlichen Gerätschaften sowie für Unterhalt und Einsatz kommen nämlich ansehnliche Summen heraus, zumal ein beträchtlicher Teil dieser Armee dafür eingesetzt wird, um auf dem eigenen Territorium Separatisten im großen Stil zu bekriegen, und sich dieser Einsatz in die Länge zieht und immer größere Mittel bindet. An Inflationsraten, Währungsverlusten und Auslandsschulden bekommt die Regierung vor Augen geführt, daß das nationale Militär auch in einem Militärstaat keinen Reichtum schafft, sondern welchen verpulvert.
Beeindrucken läßt sie sich davon schon, allerdings nicht so, daß sie Abstriche an ihren politischen Aufbruchperspektiven vornehmen würde. Statt dessen bekämpft die Regierung in Ankara den mit ihren Staatsausgaben entscheidend beförderten ökonomischen Notstand mit einem rigorosen Programm der Machart „Der Staat spart!“, „ohne das“ laut Ministerpräsidentin Çiller „der Wirtschaft eine Tragödie nach Art lateinamerikanischer Staaten bevorstehen würde“ (SZ 6.4.94).[18] Mittels „radikaler Sparmaßnahmen, Privatisierung (beim Post- und Fernmeldewesen und staatlichen Energiekonzernen), Steuererhöhungen (für Öl und Brennstoffe um bis zu 90%, für Tee und Alkohol um fast 50%), Entlassungen im öffentlichen Dienst und der Schließung unrentabler Staatsbetriebe“ will Frau Çiller „die türkische Wirtschaft sanieren“ (SZ 6.4.94). Weitere Verarmung der Bevölkerung ist also für die Staatssanierung fest eingeplant; darüberhinaus zahlt Ankara für die Wiedergewinnung seiner Kreditwürdigkeit mit der Brachlegung mancher industrieller Potenzen und Produktionsbedingungen, die nur dank staatlicher Regie und Garantien existiert haben.
Auch in der Türkei bedeutet ein solches Notstandsprogramm alles andere als eine Kapitulation vor der Macht der Umstände, sondern ist wie in anderen „Standorten“ von Kapital und auf imperialistischen Erfolg bedachten Nationen auf die Wiedergewinnung oder Bewahrung der internationalen Zahlungsfähigkeit und politischen Handlungsfreiheit berechnet. Allerdings wird die Türkei dabei nachdrücklich auf ihre bleibenden Abhängigkeiten gestoßen. Auch nach einer anderen Seite hin erinnern die gegenwärtigen Notstandsmaßnahmen der Regierung nämlich an frühere „Feuerwehraktionen“ zur Rettung des Staates Türkei. In dringlichen Verhandlungen mit Weltbank und IWF, die schließlich Çillers Privatisierungs- und Sparprogramm billigten, hat Ankara erreicht, daß es einen Beistandskredit von 742 Mio. $ erhält, der zwar „bei weitem nicht den türkischen Kapitalbedarf deckt, aber die Kreditwürdigkeit Ankaras wiederherstellen und den Weg zu Gesprächen mit internationalen Organisationen und Geberländern über die Gewährung weiterer Darlehen ebnen wird“ (Handelsblatt 6.6.94). Die Türkei erhält also die Rückendeckung von den Beistands- und Aufsichtsinstanzen der kapitalistischen Hauptnationen für zahlungsunfähige Staaten, was bei den heute gültigen Sortierungskriterien gegenüber den Entwicklungsambitionen nachgeordneter Nationalismen durchaus keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Diese Hauptnationen sind interessiert daran, daß Ankara seine Kreditwürdigkeit bewahrt.[19] Umgekehrt ist die Angewiesenheit der Türkei auf den Beistand des IWF ein Hebel, um die türkische Regierung je nach Bedarf auf die ökonomischen, aber auch politischen Stabilitätswünsche seiner Kreditgeber zu verpflichten. Die türkischen Politiker wissen das mit ihrem geschärften Gespür für nationale Beschränkungen nur zu gut und sehen während der jetzigen Verhandlungen mit dem IWF deshalb Gründe dafür, „zu fürchten, der IWF und westliche Regierungen würden Ankara zu Zugeständnissen zwingen – insbesondere in der Kurdenpolitik“ (Handelsblatt 18.5.94). Die Abhängigkeit vom IWF als Material potentieller Erpressungsmanöver, um türkisches Wohlverhalten in Kernfragen der Souveränität sicherzustellen – eine heikle Option im Verhältnis zwischen alten Bündnispartnern.
Das Aufbruchsprojekt hat Ankara also nicht erspart, als ökonomisch zweitrangiger Staat weiterhin abhängiger Betreuungsfall des IWF zu sein. Als solcher zieht es sich die Skepsis seiner Betreuer zu, ob die Regierung Çiller auf die aktuelle Krise mit dem nötigen Durchsetzungsvermögen zu reagieren vermag und ob die fälligen sozialen Härten nicht zur inneren Destabilisierung ausarten. Für diese Skepsis finden sich Anlässe genug.
Islamische Fundamentalisten auf dem Vormarsch
Bei den Kommunalwahlen im März 94 erreichte die islamistische „Wohlfahrtspartei“ (RP), die sich für eine islamische Republik stark macht und Beziehungen zum Iran unterhält, knapp ein Fünftel der Stimmen und blieb damit nicht weit hinter Çillers „Partei des wahren Wegs“ zurück. Sie stellt jetzt in den Metropolen Ankara und Istanbul, wo sie von vielen Bewohnern der Elendsviertel gewählt wurde, die Oberbürgermeister, hat also auf kommunaler Ebene ein entscheidendes Stück Macht erobert und ist damit in die Rolle einer ernsthaften Konkurrenz für die Staatsparteien hineingewachsen.
Dazu, daß diese politische Konkurrenz hoffähig wurde, haben die offiziellen Repräsentanten der modernen Türkei die letzten 15 Jahre allerhand beigetragen, mit ihrer Absicht nämlich, sich der Produktivkraft der Religion als Herrschaftsmittel zu bedienen. Schon die letzte türkische Militärdiktatur hatte zwecks innerer Stabilisierung der Herrschaft gegen eine starke Linke im Lande probiert, den Islam als staatstragende Gesinnung auszunutzen, also aufzubauen, und z.B. zum ersten Mal in der Geschichte der Republik Türkei Religionsunterricht in den Schulen als Pflichtfach eingeführt. Ihre heutigen Amtsnachfolger präsentieren sich nach innen vermehrt als Wächter einer glaubenstreuen Staatsmoral – so haben sie Salman Rushdie verboten, was ihnen im Westen böse Kommentare eingebracht hat. Nach außen versuchen sie, die Gemeinsamkeit eines – in der alten SU angeblich atheistisch unterdrückten – islamischen Glaubenskollektivs als Beweismittel für die Wohltätigkeit türkischen Einflusses bei den neuen staatlichen Nachbarn zu mobilisieren und mit Zuschüssen zum Moscheenbau Punkte zu machen, sich auf dem Balkan als Schutzherr bedrängter Muslime aufzustellen usw. Über solche Machenschaften haben diese beiden Garnituren türkischer Machthaber im eigenen „laizistischen“ Lande den Nährboden für eine beträchtliche islamische Opposition bereitet, die die ehemalige linke Opposition als Herausforderung des etablierten türkischen Gewaltmonopols und seiner fundamentalen Ausrichtung gründlich abgelöst hat.
Die Fundamentalisten begnügen sich längst nicht mehr mit der Agitation für die Einführung der Scharia als offiziellem staatlichen Rechtssystem, sondern schreiten zu Taten, wo sie können. Kommunale Repräsentanten der RP versuchen qua Amtsgewalt Schleierzwang und dergleichen Zeug zu verordnen, schaden damit nicht ohne Absicht dem Fremdenverkehr und lösen gewalttätige Auseinandersetzungen mit den Anhängern einer westlich orientierten politischen Kultur aus. Türkische Islamisten eröffnen einen regelrechten Kampf um die Neuausrichtung von Bildung und Kultur im Dienste einer Unterordnung des Geistes unter die moralischen Glaubensgebote; sie verüben Attentate auf Schriftstellerkongresse und ermorden Akademiker, die die Fastengebote des Ramadan nicht einhalten. Im übrigen widmen sie sich der Armenspeisung und der Kinderbetreuung in den Elendsquartieren und versuchen mit diesem Beispiel tätiger islamischer Moral ihre soziale Massenbasis zu erweitern. Ihre Weltanschauung deutet die soziale und vor allem die nationale Unzufriedenheit im Lande als Folge des Verrats angestammter und dem heimischen Menschenschlag gemäßer religiöser Werte zugunsten auswärtiger, aus dem Westen importierter Unwerte, wofür sie vor allem die unnationale „verwestlichte“ Politik verantwortlich machen, deren Vertreter mit ihrer unmoralischen Gesinnung am Verfall der Sitten, am Elend der Massen und am ausbleibenden nationalen Erfolg schuldig sind. Mit dieser Sorte „Antiimperialismus“, die einer Politisierung der nationalen Religion entspringt, stellt der Fundamentalismus der gültigen „Westorientierung“ der Republik Türkei eine Quittung nationalistischer Unzufriedenheit aus und kritisiert auf seine Weise, daß weder die alte, ins westliche Lager ein- und ihm untergeordnete türkische Staatsräson noch ihre am imperialistischen Aufbruch orientierte Neufassung dem türkischen Nationalismus ausreichende Erfolgserlebnisse eintragen. Wenn diese Art radikale Opposition im Lande Anklang findet, dann ist die Auseinandersetzung um eine laizistische oder islamistische Staatsdoktrin also keineswegs bloß ein Kulturkampf im Überbau, sondern setzt den Kampf um die gültige politische Ausrichtung dieser Nation auf die Tagesordnung. Nicht bezüglich ihrer expansiven Ausrichtung, schließlich mischt auch der fundamentalistische Iran in der Konkurrenz um regionale Vorherrschaft nach Kräften mit; aber bezüglich der politischen und der politökonomischen Qualität und Orientierung türkischer Erweiterungsabsichten. Und in dieser Hinsicht kommt den imperialistischen Partnern der Türkei ihr herkömmliches, jetzt auf größere Autonomie erpichtes Staatsprogramm immer noch viel berechenbarer vor als eine fundamentalistisch gewendete Herrschaft, und ist es ja auf seine Art auch. Die Erfolge türkischer Fundamentalisten machen daher die Türkei für das Ausland zunehmend suspekt; sie gelten vor allem anderen als Gefahrenbeleg, weil damit gerade die Funktion gefährdet ist, die die Bündnispartner Ankara vor allem anderen zugedacht haben: das Vordringen des Fundamentalismus und den Einfluß der Länder zu bremsen, die sich programmatisch nicht an den nationalistischen Berechnungen der Weltmarkt- und Weltordnungsvorsteher ausrichten wollen.
Die richtliniensetzende politische Elite der Türkei will allerdings keineswegs von ihrem imperialistischen Weg zugunsten eines nationalistischen Gottesstaates abweichen. Sie sieht die Gefahr, die ihren außenpolitischen Bündnis- und Benutzungskalkulationen durch den wachsenden islamistischen Einfluß daheim droht, übrigens nicht nur in Richtung Abendland, sondern selbst in bezug auf die vom Sowjetjoch zum Glauben an Allah befreiten „moslemischen Brudervölker“.[20] Also bringt sie die Mittel staatlicher Repression gegen den aufkommenden inneren Feind in Anschlag: Die Ankläger beim Staatssicherheitsgericht in Ankara ermitteln gegen den RP-Chef Erbakan wegen „Aufwiegelung zur Gewalt“; dieser hatte die baldige Einführung einer islamischen Staatsordnung vorausgesagt; die Türken hätten zu entscheiden, ob dieser Übergang „friedlich oder blutig“ verlaufe (SZ 6.4.94). Andererseits haben die führenden Politiker in Ankara aufzupassen, daß sie dabei den Massenanhang im Griff behalten und überhaupt eine Spaltung ihres Staatsvolks in eine prowestliche und eine proislamische Abteilung verhindern. So etwas kann eine Staatsführung schon gar nicht brauchen, wenn sie sich einen imperialistischen Aufbruch vorgenommen hat.
Genau darin liegt auch die neue Aktualität des „Kurdenproblems“, das die Regierung mit aller Gewalt einer Lösung zuführen will: Auch da geht es um die Sicherung der unangefochtenen Souveränität über das ganze Land, an der der türkischen Regierung mehr denn je gelegen ist.
Die Eskalation des Kurdenkrieges
Seit 1984 betreibt die PKK den bewaffneten Kampf gegen die türkische Zentralgewalt. Ebenso lange wird sie von türkischem Militär bekämpft. Seit gut zwei Jahren hat die Regierung in Ankara den Kampf eskaliert.[21] Daß die Herbeiführung einer Entscheidung dieses Krieges der türkischen Staatsführung dermaßen dringlich vorkommt, hat offenbar gleich zweifach mit ihrer neuen imperialistischen Konkurrenzlage zu tun. Einerseits will sich der türkische Aufbruchswille, der sich Anrainern wie Aufsehern als unverzichtbare Regionalvormacht vorstellt, keine Blöße an einer bislang nicht bereinigten inneren Front geben. Politischer, gar militärischer Widerstand daheim verträgt sich weder mit der Präsentation der Nation nach außen als berufener Führungsmacht noch mit dem gesicherten Zugriff auf die nationale Manövriermasse, die die nötigen Mittel für den beabsichtigten Aufstieg der Türkei hergeben soll. Ein solches Projekt steigert den politischen Bedarf nach unbedingter Zuverlässigkeit der nationalen Gesinnung der Untertanen, also auch das Mißtrauen der Obrigkeit gegenüber abweichender Gesinnung, und erst recht gegen die zur völkischen Minderheit gestempelten Staatsbürger zweiter Klasse ganz erheblich.
Da nützt es der PKK auch nichts, wenn ihr Chef Öcalan von Forderungen nach einem eigenen Kurdenstaat abrückt und nur noch eine türkisch-kurdische Föderation anstrebt, da das Kurdenproblem militärisch nicht lösbar sei. Genau diese „Lösung“ suchen die politischen und militärischen Befehlshaber in Ankara, jede Sorte Kompromiß halten sie für Verrat an der nationalen Sache der Türkei. Sie klagen sechs kurdische Abgeordnete des Hochverrats an, nachdem sie deren kurzfristig zugelassene Partei wieder verboten haben. Sie setzen alle anstehenden Entlassungen aus dem Militärdienst aus, um im Kamps gegen die Kurden erfahrenes Personal im Einsatz zu halten. Als flankierende Maßnahme setzen sie auf den Einsatz von Todesschwadronen, von denen u.a. auch Geschäftsleute beseitigt werden, die des Kontakts mit dem kurdischen Widerstand verdächtigt werden. Über tausend Dörfer in den kurdischen Siedlungsgebieten sind zerstört; die Vertriebenen werden neuerdings in Internierungslagern gefangengehalten. Weil durch solche Großtaten die PKK immer neuen Nachschub an Mitkämpfern erhält, antwortet die türkische Armee mit der Ausweitung ihrer Aktionen und ihres Aktionsgebiets und läßt darüber allmählich jeden Respekt vor dem Territorium seiner Nachbarstaaten beiseite: Der türkische Verteidigungsminister kündigt an, die Region um den Berg Ararat „völlig zu evakuieren“, d.h. zehntausend Kurden zu vertreiben, „und zum militärischen Sperrgebiet zu erklären, um den PKK-Rebellen Schlupfwinkel zu entziehen“, die sich großenteils auf iranischer und armenischer Seite des Ararat-Massivs befinden (FR 4.6.94). So arbeitet Ankara an der „Endlösung“ (Çiller) der Kurdenfrage im Sinne des türkischen Nationalismus.
Andererseits macht die Türkei sich durch den inneren Konflikt mit dem kurdischen Separationswillen ihrerseits angreifbar. Im Frühjahr 92 hat z.B. die BRD den Krieg Ankaras gegen seine Kurden zum Anlaß genommen, um der Türkei an der Verwendung ‚deutscher‘ Waffen gegen türkische Kurden Eigenmächtigkeit vorzuwerfen, die ihr als Empfänger deutscher Militärhilfe nicht zusteht, und sie mit der Bewertung der Kurdenverfolgung als einer für zivilisierte Staatswesen anrüchigen Methode innerer Friedensstiftung diplomatisch zu brüskieren. Im letzten halben Jahr ist auch der US-Kongreß dazu übergegangen, an der Kurdenpolitik der Regierung Çiller herumzudeuteln, und hat im Mai 94 die Militär- und Wirtschaftshilfe „unter Hinweis auf türkische Menschenrechtsverletzungen und die starre Haltung Ankaras in der Zypernfrage“ (FR 30.5.94) gekürzt, weshalb die letzte USA-Reise der türkischen Regierungschefin mit einem mittleren Eklat zu Ende ging. So bekommen die türkischen Politiker zu spüren, daß die Zeiten vorbei sind, wo die NATO sich für die innere Stabilität ihres Frontstaats rückhaltlos stark gemacht hatte. Die türkische Führung zieht daraus die Konsequenz, alles aufzubieten, um die Intaktheit des inneren Gewaltmonopols um jeden Preis wiederherzustellen und damit zugleich auswärtiger Einmischung den Anlaß zu entziehen. Sie hat nicht trotz, sondern wegen der Vorhaltungen aus Bonn, vom Straßburger Europa-Parlament und neuerdings auch aus Washington ihre Kriegführung in den Kurdengebieten nochmals verschärft. Aber eben dadurch liefert sie ihren Bündnispartnern und Oberaufsehern ein paar neue Anhaltspunkte für deren Verdacht, daß sie diese Nation mindestens ebenso als Objekt von Aufsicht wie als Teilhaber am Aufsichtsgewerbe anzusehen haben.
Zwar hat Bonn seinen Einspruch ziemlich schnell wieder fallenlassen, die Waffenlieferungen wieder aufgenommen und später sogar dem dringenden Antrag von Frau Çiller stattgegeben, die PKK auch in Deutschland zu verbieten, sich also der türkischen Definition dieser Partei als terroristischer Organisation angeschlossen. Allerdings mußten die türkischen Politiker dabei erfahren, daß selbst diese Sorte Entgegenkommen aus Bonn für sie noch von zweischneidigem Charakter ist. Im Gefolge von Kanthers PKK-Verbot hat Deutschland nämlich seinen Vorbehalt in der „Kurdenfrage“ gegen Ankara wieder aktualisiert: Die ungeheuerliche Herausforderung, die etliche hundert kurdische Autobahnblockierer für das gast- und ausländerfreundliche Deutschland darstellen, erfordert zu ihrer Bewältigung, daß die schleunigst aus diesem Land rausmüssen; und wenn sie dank ihrer Abschiebung türkischen Folterern in die Hände fallen, dann ist die Türkei uns ja wohl die ausnahmsweise Behandlung der in Deutschland unerwünschten Kurden nach „menschenrechtlichen Mindeststandards“ schuldig und hat von daher neue deutsche Vorhaltungen zu gewärtigen.[22]
Neue Gegensätze in den türkisch-deutschen Sonderbeziehungen
Die an der Kurdenfrage aufgehängten Ordnungsrufe aus Bonn müssen den türkischen Machthabern nicht nur deswegen besonders zu denken geben, weil Deutschland immerhin in Ex-Jugoslawien demonstriert hat, wie weit es seine Vorliebe für Separatisten, die seinen europa- und weltpolitischen Kalkulationen in den Kram passen, zu treiben vermag. Sie betreffen darüberhinaus das entscheidende außenpolitische Sonderverhältnis der Türkei, das aus noch ganz anderen Gründen zu türkischen Sorgen Anlaß gibt. Immerhin ist die BRD im Rahmen der alten NATO-Aufgabenverteilung in die Rolle der ersten Adresse für den südöstlichen Frontstaat hineingewachsen – neben den USA auf dem Waffensektor, vor allen anderen bei der politökonomischen Betreuung und als einziges Land auch durch den jahrzehntelangen und mit allerhand deutsch-türkischen Vertragswerken geregelten Export einer nach Millionen zählenden türkischen Lohnarbeiterarmee ins Land des deutschen Exportweltmeisters. Diese menschlichen Garanten eines vormals positiven deutsch-türkischen Sonderverhältnisses sind – erst einmal ganz ohne türkisches Dazutun – zu einem Problemgegenstand geraten, an dem sich gegensätzliche Ansprüche beider Nationen festmachen. Wenn die deutsche Politik darauf besteht, daß die Kurden wie überhaupt Ausländer, „die ihre Konflikte auf deutschem Boden austragen“, hierzulande völlig untragbar sind, so ist das ja lediglich ein Aspekt einer deutschen Ausländerpolitik, die zunehmend ihre Gastarbeiterkontingente, allen voran die türkischen, unter ökonomischen Gesichtspunkten für viel zu viel und unter völkischen Gesichtspunkten für problematisch bis unerträglich befindet und entsprechend behandelt.[23] Unter diesen Auspizien erfährt Ankara von deutscher Seite erstens, daß für die in Deutschland eingehausten türkischen Landsleute, bisher eine Hauptdevisenquelle des türkischen Staates, keine entsprechende Verwendung mehr existiert; zweitens und vor allem, daß diese türkischen Untertanen, bisher ein Hauptgarant verläßlicher zwischenstaatlicher Beziehungen, jetzt dem nationalen Aufbruch, auf den deutsche Politiker ihr Volk einschwören und umstellen, im Wege stehen. Statt als Grundlage eines positiven Spezialverhältnisses, werden sie von deutscher Seite heute als wachsende Belastung und spezieller Problemfall definiert, der nach politischen Lösungen im deutschen Interesse verlangt. Die türkische Politik bekommt es also damit zu tun, daß die neue Führungsmacht Europas an ein Land wie die Türkei zwar wachsende Ansprüche in puncto Stabilität, politische Zuverlässigkeit und außenpolitische Handlungsfähigkeit stellt, sich aber selber für ganz und gar unzuständig dafür erklärt, ihm dabei behilflich zu sein; daß deutsche Politiker ganz im Gegenteil entschieden darauf drängen, Ankara hätte die deutsche Ausländerpolitik unbeschadet ihrer Auswirkungen auf die Türkei zu ertragen und mitzutragen.
Und das ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, an dem die türkischen Politiker sich ganz neu dieser Mannschaft als Hilfsmittel ihres nationalen Vorankommens versichern möchten. Was ihre ökonomische Brauchbarkeit angeht, so ist Tansu Çiller vor einiger Zeit über das Auslandsfernsehen mit der folgenden Idee für „die Erholung der türkischen Wirtschaft“ an ihre Auslandsbürger herangetreten:
„Man sollte sich einmal vorstellen, jeder der eine Million Bürger, die im Ausland arbeiten, würde 1000 Mark auf türkische Banken überweisen.“ (SZ 16.5.94)
Eine recht verzweifelte Berechnung – ein freiwilliges Notopfer in Deutschland beschäftigter Türken soll die Leistungen ersetzen, die der in der Türkei heimische Kapitalismus seinen politischen Vorstehern versagt –; und ein Vorschlag, der zum deutschen Rückführungsprogramm nun überhaupt nicht paßt, das höchstens die Reihen der Überzähligen in der Türkei anwachsen läßt. Aber auch politisch haben die Auslandstürken aus Ankara eine mit deutschen Perspektiven völlig unvereinbare Deutung erfahren und Rolle zugeschrieben bekommen:
„Der türkische Staatspräsident Demirel hat die in Deutschland lebenden rund 1,8 Millionen Türken aufgerufen, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen. Die türkische sollten sie aufgeben. Beim Empfang einer Delegation des Essener Zentrums für Türkei-Studien sagte Demirel am Wochenende in Ankara, die Türkei könne die Wiedereinbürgerung auf Wunsch vereinfachen. ‚Für die Ausreise von rund 60 bis 70% der etwa drei Millionen Türken in Europa war ich in den 60er und 70er Jahren verantwortlich, weil ich immer eine Lobby in Europa haben wollte‘, sagte Demirel. ‚Mir geht es nicht um bloße Propaganda für die Türkei, sondern darum, daß die Realitäten in unserem Lande weitab von Vorurteilen und falschen Informationen gesehen werden‘.“ (FR 18.4.94)
Eine interessante Deutung ex post. Bisher hat die Türkei in der Frage der Staatsangehörigkeit nämlich eher einen restriktiven Kurs verfolgt – nicht zuletzt in Hinsicht auf die Wehrpflicht gegenüber der Türkei und auf die Devisenüberweisungen ins Heimatland. Heute sollen sie dem Interesse der Türkei ausgerechnet damit dienen, daß sie Deutsche werden, sich aber mehr denn je wie lebende türkische Nationalfähnchen aufführen und Stimmung für die Türkei machen. Die Auslagerung eines nach Millionen zählenden türkischen Volkstums und die Annahme einer fremden Staatsbürgerschaft unter Wahrung ihrer bedingungslosen Loyalität gegenüber ihrem eigentlichen Vaterland soll türkischen Einfluß auf Deutschland sichern und – mit „Lobby“ höflich umschrieben – dessen Führung zu besonderen Rücksichtnahmen auf Ankaras Ambitionen nötigen, als sei damit ein Stück türkischer Staatsräson in die deutsche Politik eingepflanzt. Ein völkisch inspiriertes Aussiedlerprogramm, dem freilich die politische Not noch anzumerken ist. Erstens hält es Ankara für dringend nötig, sich auf diese absurde Weise eines Sonderverhältnisses zu Deutschland zu versichern. Zweitens fürchten türkische Staatsmacher – entgegen der Vorstellung, türkisches Volkstum sei auch in deutschem Staatsbürgergewand eine patriotische Kraft – offenkundig, daß im umgekehrten Fall eine massenhafte Zahl von Heimkehrern in die Türkei gar keine verläßliche und staatstreue Manövriermasse bildet, sondern eher einen potentiellen Zuwachs an Unzufriedenheit, da diese Leute umgekehrt „multikulturell“ infiziert sind. Im übrigen haben die deutschen Politiker in Bonn ihre Antwort auf solche Berechnungen im voraus erteilt. Sie projektieren in der Frage der staatsbürgerlichen Loyalität ihr eigenes, deutsches „Ganz oder gar nicht!“. Schäuble und Herzog jedenfalls haben vorgeschlagen, den in Deutschland aufgewachsenen Ausländern der zweiten Generation die Alternative ‚Entweder Deutscher mit allen Schikanen oder endgültige Aussortierung als Ausländer‘ aufzumachen. Statt daß die türkischen Massen in Deutschland wenigstens dem außenpolitischen Sonderverhältnis zu dem wichtigsten EU-Land eine gewisse Festigkeit geben, vermehren sie tendenziell die zwischenstaatlichen Streitgegenstände.
4. Ein vorläufiges Fazit, die Türkei und ihre Bündnispartner betreffend
Die Türkei stellt sich für ihren europäischen Hauptbündnispartner, für die EU und für die NATO heute insgesamt als ziemlich unberechenbar dar. Das liegt aber nur einesteils an den neuen türkischen Ambitionen. Auf der anderen Seite bekommt es die aufstiegswillige Nation damit zu tun, daß der Standpunkt der Bündnispartner selber um einiges anspruchsvoller geworden ist. Die festgefügte Rollenverteilung innerhalb der NATO, auf die die Türkei rechnen konnte, ist heute auf seiten der NATO-Hauptmächte der laufenden Überprüfung gewichen, wie weit der europäische Randstaat dazu taugt, die NATO-Aufsicht und spezieller den europäischen Einfluß auf die strategisch wichtige und mit ihren Nationalismen unberechenbare Region an der Grenze zu Asien, also zur Ölregion sowie im Süden Rußlands abzusichern: Die Türkei soll sich als verläßliches und zugleich gefügiges Bollwerk westlicher Ordnungsansprüche – und das auch noch in verschiedener nationaler Lesart – bewähren, sie soll militärisch leistungsfähig, im Innern stabil, strikt prowestlich ausgerichtet, zugleich national einsortiert sein, und das alles möglichst weitgehend auf eigene Rechnung. Da kann Skepsis gar nicht ausbleiben: Dieser Staat trägt nicht verläßlich und zugleich untergeordnet zur Lösung von Aufsichtsproblemen bei, sondern ist mit seinem Aufbruchsnationalismus selber zugleich Teil des Problems.
Das Risiko, selber als Objekt von Aufsicht behandelt zu werden, ist für die Türkei also inbegriffen. Zumindest geht die heutige Ausstattung der türkischen Militärmacht im Rahmen der NATO einher mit, relativiert sich daher auch an Bedenken und Vorbehalten, ob die Türkei mit ihren nationalen Anstrengungen noch den Ansprüchen aus Washington und Bonn gewachsen sein kann und ob sie das überhaupt will. Und die Standortpolitik der Mitglieder des kapitalistischen Euro-Blocks, dem auch die aufstrebenden türkischen Politiker der 90er Jahre als Rückversicherung für ihr Regionalvormacht-Anliegen unbedingt angehören wollen, erfährt das Land als bloßer Betroffener, auf den weniger denn je Rücksicht genommen wird, geschweige denn daß ihm Mitspracherechte zugestanden werden.
Für die Auflösung dieses prekären Zustands wurden jüngst von führenden Europapolitikern interessante Absichten geäußert. Einerseits verkündete Wolfgang Schäuble vor christlichen Unternehmern, daß die Türkei nicht EU-Mitglied werden kann, weil sie nicht zum „christlich-abendländischen Kulturkreis“ gehört; fundamentalistischer kann die Absage an Ankaras Wunsch nach Beteiligung an der europäischen Wirtschaftsmacht nicht ausfallen. Andererseits hat sich die Parlamentarische Versammlung der Westeuropäischen Union dafür ausgesprochen, in Abänderung der Bestimmungen des Maastricht-Vertrags auch das Nicht-EU-Mitglied Türkei in die WEU aufzunehmen. Für die Vollendung der Militärmacht Europa kann man sich die spezielle Angliederung des Militärstaats Türkei sehr gut vorstellen. Aber dafür braucht man der Türkei noch lange nicht Zugang zur ökonomischen Weltmacht Europas zu gestatten, wo es der Status eines alternativlos abhängigen Hinterlandes des Wirtschaftsblocks EU doch auch tut! Wie immer die Verlaufsformen der neuen Sorte Konkurrenz unter bewährten Bundesgenossen ausfallen mögen: Aus dem Stoff ist jedenfalls die Völkerfreundschaft der 90er Jahre zwischen der Türkei und ihren Partnern im Westen gemacht.
[1] Nachdem die Regierung Truman sich zu unbedingtem Antisowjetismus entschlossen hatte, ließ sie ihre Flotte im östlichen Mittelmeer aufkreuzen, um der UdSSR per Kriegsdrohung zu bedeuten, daß sie von ihrem auf der Potsdamer Konferenz erteilten Recht, gemeinsam mit der Türkei Bosporus und Dardanellen zu kontrollieren, keinen Gebrauch zu machen habe. Stalin gab nach. So bekam die Türkei eine klare Entscheidungshilfe für ihre Einsortierung in der Nachkriegsordnung, die mit einem US-Einstiegskredit über 100 Mio. $ flankiert wurde. Sie wurde Mitglied von UNO, IWF und Weltbank, erhielt Marshallplan-Mittel und trat 1952 offiziell der NATO bei. Schon 1950 verdiente sie sich den Eintritt durch Entsendung von 4500 Soldaten zur Verstärkung der US-Truppen in Korea. Ihre geostrategische Lage machte sie für die NATO wertvoll: Sie hatte als einziges NATO-Land eine direkte Grenze mit der SU und kontrollierte die beiden Meerengen, die die sowjetische Schwarzmeerflotte vom Mittelmeer trennten. 26 US-Stützpunkte wurden als Horchposten und zur Stationierung von Mittelstreckenraketen gegen die SU eingerichtet. Als Chruschtschow seinerseits auf Kuba entsprechendes Gerät in Stellung brachte, reagierten die USA mit einer Atomkriegsdrohung. Die „Kuba-Krise“ wurde mit einem Kompromiß – dem beiderseitigen Abzug von Mittelstreckenraketen – beendet, der die militärische Bedrohung der USA von Kuba aus erledigt hat, die der Sowjetunion von der NATO-Südflanke aus aber bestenfalls ein Stück relativiert hat.
[2] Während also
türkische Arbeitsemigranten den Akkumulationserfolg
made in Germany quer durch alle Industriezweige
vergrößern helfen, ist die einheimische Akkumulation
der Türkei gekennzeichnet durch die für die
„Schwellenländer“ des modernen Weltmarkts typischen
„Disproportionalitätsprobleme“, die eine „gleichmäßige
Entwicklung aller Sektoren einer modernen
Volkswirtschaft“ immerzu nicht eintreten lassen: Die
Branchenstruktur weist neben einigen staatlichen
Grundstoff- und Schwerindustrien größere Bereiche der
verarbeitenden Industrie in der langfristigen
Konsumgüter- und der Textilherstellung auf. Diese
Betriebe, die oft den großen Holdings zusammen mit
Auslandskonzernen gehören, machen die eigentliche
moderne Großindustrie aus. Daneben existieren eine
Fülle von Mittelbetrieben in der Konsumgüterindustrie
und in der Bauindustrie. In einigen Sektoren, vor allem
bei der Nahrungsmittelverarbeitung, aber auch bei
Textil und Leder, wird von diesen Betrieben, die
meistens eine Größe von 100 – 500 Beschäftigten haben,
ein nennenswerter Teil der Produktion erstellt… Diese
Teilindustrialisierung, das Fehlen des Maschinenbaus
und der übrigen Investitionsgüterindustrien, begründet
die Importabhängigkeit der Akkumulation und ist damit
Grundlage für die Auslandsverschuldung.
(Charles Pauli, Türkei – Hinter
den Kulissen eines Wirtschaftswunders, Frankfurt/M.
1990, S.26f) Die sozialen Folgen einer solchen
Sorte nationaler Akkumulation sehen folgendermaßen aus:
Die offizielle Statistik zählt zwar für 1992 lediglich
1,6 Mio Arbeitslose (Länderbericht
Türkei 1994), die aber anscheinend zusätzlich zu
den aus der permanenten „Landflucht“ herstammenden
Personen die städtischen Slums bevölkern (diese
„Gecekondu“ machen in Ankara 65%, in Istanbul 55% der
bebauten Fläche aus) und sich als Tagelöhner, fliegende
Händler, Kleinhandwerker etc. durchzuschlagen suchen.
Aus den Berg- und Walddörfern ziehen zur Erntesaison
ganze Familien in die Latefundien der Ägäis und der
Çukurova, um sich dort mit Kind und Kegel als
Saisonarbeiter zu verdingen. Klar ist, daß die
Anwendung von Gastarbeitern hierzulande der bei weitem
kapitaldienlichste Einsatz türkischer Arbeitskräfte
ist.
[3] Mancher mag sich
noch an die Feuerwehraktion von Walter Leisler-Kiep
erinnern, der 1979 als Beauftragter der Bundesregierung
die Hauptstädte der westlichen Welt bereiste, um eine
internationale Hilfeaktion in Gang zu setzen, mit der
die Türkei vor dem wirtschaftlichen Kollaps bewahrt
werden sollte… Wenn die Türkei allerdings erwartet
hatte, der Westen würde ihr bedingungslos helfen, so
hatte sie sich getäuscht. Das erste, was der deutsche
Emissär unternahm, war, den über die Türken verärgerten
IWF wieder ins Spiel zu bringen.
(Handelsblatt 16.4.85, zitiert nach Pauli, S.
141)
[4] In kleinen Meldungen
unter ‚Vermischtes‘ berichten deutsche Zeitungen heute,
daß der Türkei noch nicht einmal die gnädig in Aussicht
gestellte Zollunion mit der EU gewährt wird, die Ankara
als Einstieg in die Vollmitgliedschaft interpretiert:
Die zum 1.Januar 1995 geplante Zollunion zwischen
der EU und der Türkei verzögert sich. Die Europäische
Kommission will den EU-Regierungen unter Hinweis auf
die wirtschaftspolitische Entwicklung in der Türkei
empfehlen, die Zollunion zunächst um ein Jahr zu
verschieben. Außerdem soll eine zusätzliche Klausel
gegebenenfalls eine weitere Verzögerung erlauben… Die
derzeitige Wirtschaftskrise und die Verzögerungen bei
der Einführung von gesetzlichen Regelungen ließen es
als zweifelhaft erscheinen, daß die Türkei rechtzeitig
die für eine Zollunion erforderlichen Voraussetzungen
erfüllen könne.
(FAZ
14.7.94)
[5] Siehe z.B. Artikel
89 des türkischen Parteiengesetzes von 1966: Die
politischen Parteien dürfen nicht behaupten, es gäbe im
Land Republik Türkei Minderheiten im Bezug auf
nationale und religiöse Kulturunterschiede oder
Sprachverschiedenheiten. Die politischen Parteien
dürfen nicht das Ziel verfolgen, im Land Republik
Türkei die Volkseinheit zu zerstören, indem sie andere
Sprachen und Kulturen als die türkische Sprache und
Kultur entweder erhalten oder entwickeln oder
vertreten.
Und jeder Schultag in der Türkei fängt
mit dem gemeinsamen Aufsagen des „Eides auf das
Türkentum“ an, der so losgeht: Ich bin Türke,
ehrlich, fleißig, gehorsam; meine Liebe zu meinem Land
und meinem Volk ist größer als die Liebe zu mir
selbst.
Es ist also die Sehnsucht des staatlichen
Gewaltmonopols nach einem garantiert verfügbaren, weil
berechnungslos fügsamen nationalen Menschenmaterial,
die den harten Kern des politischen Rassismus bildet.
[6] Ankara versucht,
eine neue strategisch-politische Bedeutung von der
Adria bis zu den Grenzen Chinas zu gewinnen.
(Bahri Yilmaz, Die Türkei als
regionale Wirtschaftsmacht, Europa-Archiv
24/1993) Dieser Professor für
Wirtschaftswissenschaften aus Ankara verdolmetscht im
übrigen seinen deutschen Kollegen die neuen
Perspektiven des türkischen Nationalismus
folgendermaßen: Nach dem Ende des Ost-West-Konflikts
befürchtete man in Ankara, daß das Land seine bisherige
‚klassische Rolle‘ als Verteidiger der Südflanke der
NATO verlieren, am Rande eines ‚vereinten Europa‘
stehen und die seit dem Zweiten Weltkrieg mühsam
geknüpften Beziehungen mit dem Westen nicht mehr
aufrechterhalten können würde. Aber die Entwicklungen
in der ehemaligen Sowjetunion und auf dem Balkan sowie
im Nahen Osten haben die Bedeutung der Türkei in der
neuen Weltordnung eher verstärkt als geschwächt. Sie
wurde als eine mögliche Regionalmacht aufgewertet und
dadurch erneut in den Blickpunkt der Weltöffentlichkeit
gerückt und muß – unerwartet und unvorbereitet – in
kürzester Zeit wieder in eine Rolle hineinwachsen, die
ihr schon beim Niedergang des Osmanischen Reiches im
Jahre 1918 zufiel: als Regionalmacht die auf einem
Pulverfaß sitzenden Regionen mitzugestalten.
Von
kleinlauten „Befürchtungen Ankaras“, eine europäische
Abseitsstellung betreffend, ist in den vollmundigen
Äußerungen türkischer Chefpolitiker über die
großartigen Zukunftsaussichten ihres Landes sonst
nichts zu spüren; der türkische Universitätsprofessor
tritt im „Europa-Archiv“ aber als wissenschaftlicher
Quasi-Diplomat auf, der für die gebildeten Stände
Westeuropas im besten Politologenjargon ableitet, warum
die neugefaßten imperialistischen Absichten Ankaras
nichts als das notwendige Produkt einer Lage sind, in
die seine Nation nolens-volens „hineinwachsen“ muß.
[7] Auf einer Reise durch vier Balkanstaaten im Februar 92 hat Özal z.B. „die Ansicht geäußert, die Türkei müsse nun entschlossen die Gelegenheit beim Schopf ergreifen, sich als Schutzherr der moslemischen Völker auf dem Balkan zu betätigen und damit zur Führungsmacht der Region aufzuschwingen. Den Balkan-Nachbarn stellte Özal jetzt massive türkische Hilfsprogramme in Aussicht“, dem mazedonischen Präsidenten z.B. „großzügige Militärhilfe und Stromlieferungen“, Albanien, wo schon türkische Militärberater tätig waren, eine Autobahn und Hochspannungsleitungen von Istanbul nach Tirana. (FR 22.2.92)
[8] Der „Neuen
Weltordnung“ ohne Sowjetunion haben die Türken im
übrigen auch die Berufungstitel entnehmen können, mit
denen im späten 20. Jahrhundert nationalistische
Ansprüche angemeldet werden: Die imperialistischen
Elementarkategorien Territorium und Volk, mit denen
Staaten Rechnungen grundsätzlichster Natur
gegeneinander aufmachen, sind in Gestalt anerkannter
Rechtstitel wie „Tradition“, also vergangener eigener
Herrschaft, und „Ethnie“, also quasinatürlicher
völkischer Zusammengehörigkeit, ausgesprochen
zeitgemäß. Die Türkei hat für ihre neuen ausgreifenden
Ambitionen genau wie andere Nationen die entsprechend
fundamentalen Begründungen zu bieten. Aus türkischer
Sicht belehrt uns Prof. Yilmaz hierzu: Drei Gründe
sprechen aus türkischer Sicht für eine enge politische,
wirtschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit mit den
Turkvölkern Mittelasiens und Aserbaidschans: 1. Die
Vorfahren der heutigen Bewohner der Türkei sind im
9.Jahrhundert aus Zentralasien abgewandert. Die Türkei
fühlt sich deshalb ethnisch, sprachlich und religiös
mit den Turkvölkern Mittelasiens eng verbunden…
Klar, eine Völkerwanderung vor 1100 Jahren spricht
heute für die Betreuung Turkmenistans etc. durch Ankara
in Sachen Geld und Gewalt. Andererseits: Rein von der
Logik des politisch respektablen Arguments „Herkunft
und Tradition“ her ist seine türkische Fassung auch
nicht schlechter als das Argument „Wolgadeutsche“ oder
„Siebenbürger Schwaben“. Es schlägt die deutschen Titel
sogar um ca. 500 Jahre.
[9] Daß die dortigen Kurden mit dieser Konstellation auch nicht gerade ihr Glück gemacht haben, zeigt z.B. die Tatsache, daß die beiden politischen Hauptgruppierungen, die dort unter den Führern Barsani bzw. Talabani die „kurdische Selbstverwaltung“ unter sich ausmachten, kürzlich heftig gegeneinander gekämpft haben, weil die „UN-Hilfslieferungen“, die einzige Nahrungsquelle dort, bei weitem nicht für beide Interessenten ausreichen. Ein positives Interesse an einer einheitlichen kurdischen Staatlichkeit existiert eben nicht nur bei keiner der maßgeblichen Nationen, sondern auch nicht bei den konkurrierenden kurdischen Führern. Die Kurden erfahren auch auf diese Weise, daß es für unterdrückte Völkerschaften kein Glück, sondern ein Pech ist, wenn sie weltpolitisch interessant werden.
[10] Versprochen wurde unter anderem die großartige Erlaubnis, in der Öffentlichkeit kurdisch zu sprechen usw. Aus dieser Zeit datiert auch die Existenz etlicher offizieller Kurdenrepräsentanten im Parlament. Ihr Pech, daß die türkische Regierung jetzt wieder ganz die Linie verfolgt, ihre Kurden als das nationale Sicherheitsrisiko Nr.1 zu bekämpfen. Die Abgeordneten wurden, soweit sie nicht untergetaucht sind, vor einem Vierteljahr verhaftet und sind jetzt wegen Hochverrats angeklagt.
[11] Siehe dazu das Kapitel „Die Türkei und ihre aktuellen Krisen – Die Eskalation des Kurdenkrieges“
[12] Mesut Yilmaz,
Vorsitzender der Mutterlandspartei, unter Özal
Regierungschef und z.Z. Oppositionsführer, erteilt über
die Absichten Ankaras folgende diplomatisch gestrickte
Auskunft: In diesem historischen Prozeß geht es
nicht darum, diese neuen Republiken zu beherrschen,
sondern hier handelt es sich um die Erfüllung einer
moralischen Verpflichtung, den Ländern bei der
Neugestaltung zu helfen, und zwar die verbrüderten
Staaten durch technische, finanzielle, kulturelle und
gleichartige Unterstützungen so zu fördern, daß sie
möglichst schnell den Stand zeitgemäßer Staaten
erlangen können. Dies hat jedoch absolut nichts mit dem
uns zeitweise unterstellten Pan-Turanismus zu tun.
(Rede im Deutschen Orient-Institut
Hamburg, FR 28.1.94) Kein Wunder, daß türkische
Politiker, die die von ihnen angestrebte Einflußsphäre
mit der Ausdehnung des ehemaligen osmanischen Reiches
umschreiben, an die Adresse des Auslands
„großtürkische“ Absichten zu dementieren haben.
Schließlich ist ihr Bestreben, ihren Einfluß auf die
Zerfallsprodukte des einstigen sozialistischen Blocks
auszudehen, unüberhörbar und unübersehbar. Die
Kombination aus nationalem Aufbruchswillen und
weitgehender nationaler Mittellosigkeit der neuesten
Mitglieder der Staatenfamilie sucht die Türkei für ihr
regionales Ausgreifen auszunutzen. Sie probiert, dem
dringlichen Bedarf nach elementaren Mitteln der Macht
berechnend und mehr oder weniger parteilich
entgegenzukommen, um darüber die für sie geeignetsten
von den noch überhaupt nicht konsolidierten Staaten
dauerhaft auf die Politik der Türkei auszurichten.
Dabei setzt die Türkei auf die Mittel, zu denen sie es
als Geschöpf von Weltmarkt und -macht gebracht hat: Sie
sucht auf die neuesten Interessenten an
Weltmarktteilhabe und Befreiung vom übermächtigen
russischen Einfluß, die von den entscheidenden
imperialistischen Mächten nicht ihren nationalen
Wünschen entsprechend bedient werden, mit dem
Versprechen Einfluß zu gewinnen, die Türkei würde sie
dank ihrer Sonderstellung diesem Ziel näher bringen.
Zugleich orientiert sie sich an der völkischen
Ausrichtung, mit der sich die Kaukasusrepubliken in
islamische, christliche usw. Nationen ihre neue
Identität geben und Rechte gegeneinander geltend
machen; die Türkei benutzt sie und beruft sich auf sie,
um in zwischenstaatliche Konflikte in ihrem Interesse
einzugreifen und verläßliche Bündnisbeziehungen und
anerkannte Abhängigkeiten auf den Weg zu bringen. Für
diese Staaten bietet sich die Türkei als „Tor zu
Europa“ an, während sie umgekehrt gegenüber den
NATO-Bündnispartnern und der EU die Türkei als „Brücke
nach“ und „Tor zum Mittleren Osten“ ins Spiel bringt
und so ihre Ambitionen in einen Dienst an gemeinsamen
westlichen Interessen darzustellen versucht.
[13] Z.B. wurde 1989
ein „Türkisch-Amerikanischer Unternehmerverein“
gegründet, bei dessen Arbeitsteilung der türkischen
Firma Petrosan, an der US-Kapital beteiligt ist, die
Projektplanung der Ölförderung aus dem Kaspischen Meer
zufällt. Selbstverständlich sind auch deutsche Firmen
in dieser Richtung längst erfolgreich unterwegs. Ein
Beispiel: Der Elektromulti Siemens führt ein
deutsch-türkisches Konsortium an, das in Kasachstan das
erste Gas- und Dampfturbinenkraftwerk des Landes
schlüsselfertig errichten wird…
Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von knapp einer
Milliarde Mark… Finanziert wird das Projekt laut
Siemens gemäß einem Regierungsdekret durch Einnahmen
aus drei Ölvorkommen in der an Bodenschätzen reichen
Region.
(FR 20.7.94)
[14] Die Türkei hat ein strategisches Interesse daran, daß der Abtransport von Öl und Gas – Richtung Westen – über ihr Gelände läuft. Schon 1993 schloß sie mit amerikanischen, japanischen, britischen und aserischen Partnern einen Vertrag über den Bau einer Pipeline, über die Öl aus Kasachstan und Aserbaidschan zur türkischen Mittelmeerküste transportiert werden soll. Abgesehen davon, daß auch das Pipeline-Projekt interessante Ordnungsfragen aufwirft – ein Teil der Trasse muß entweder über den Iran oder über Armenien geführt werden, wobei die US-Partner letzteres favorisieren –, war seine Realisierung bislang am Einspruch Rußlands gescheitert, das die Ölexporte aus den beiden Ex-Sowjet-Republiken weiterhin mit Tankern von einem seiner Schwarzmeerhäfen aus durchgeführt sehen wollte. Nachdem neulich ein von dort kommender Tanker im Bosporus in einen Unfall verwickelt wurde, eine „Ölpest“ der größeren Sorte hinterließ, und damit den schon früher ausgesprochenen Drohungen der Türkei, den Tankerverkehr durch die von ihr kontrollierten Meerengen einzuschränken, eine plausible ökologische Legitimation verlieh, hat Rußland jetzt „erstmals Zustimmung zu den türkischen Pipelineplänen zu erkennen gegeben“. Es stellte damit angeblich „Bedenken zurück, die Türkei wolle mit dem Projekt vor allem mehr Einfluß auf die ehemals sowjetischen Republiken des Kaukasus und Mittelasiens gewinnen“ (FR 11.4.94). Zurückgestellt sind die russischen Bedenken in Wirklichkeit ganz und gar nicht: Anfang Juni haben sich Rußland und Griechenland über den Bau einer Pipeline zur griechischen Hafenstadt Alexandroupolis verständigt; „das Projekt steht in Konkurrenz zu türkischen Plänen für eine Leitung … durch Anatolien zur Mittelmeerküste“ (FR 11.6.94). Diese Affäre ist also ein Musterbeispiel dafür, wie sich die Türkei bei ihren Aufstiegsambitionen notwendigerweise dauernd mit strategischen Kalkülen eines im imperialistischen Sinne gewendeten Rußland anlegt. Dies nötigt Ankara Moskau gegenüber zu einer Dauerdiplomatie, die teils beschwichtigt, teils mit nützlichen Beziehungen winkt – z.B. erhielten türkische Baufirmen zum Ärger Bonns einen Teil der Aufträge zum Bau von Wohnungen für aus Ostdeutschland abgezogene russische Soldaten –, teils drohend die türkischen Bündnisbeziehungen mit den westlichen Hauptmächten in Anschlag bringt.
[15] Siehe dazu den Artikel „Die Paten des ‚Friedens für Jugoslawien‘: Einig in ihrer Konkurrenz um Weltherrschaft“ in GegenStandpunkt 1-94, S.165.
[16] In neuerer Zeit
datiert die griechisch-türkische Rivalität von den
Staatsgründungskämpfen im Anschluß an den 1.Weltkrieg
her: Mit der Vertreibung der Griechen vom
kleinasiatischen Festland und dem Anschluß der meisten
Ägäisinseln, oft sehr nahe zu diesem Festland gelegen,
an Griechenland fing diese herzliche Völkerfeindschaft
an, und entsprechend ging es weiter. Selbst die
beiderseitige NATO-Einordnung hat nicht verhindert, daß
beide NATO-Partner auf Zypern Krieg führten, als 1974
die Athener Militärjunta die Insel an Griechenland
anschließen und die türkische Minderheit vertreiben
wollte und die Türkei darauf mit einer militärischen
„Friedensoperation zum Schutz der türkischen
Volksgruppe“ antwortete, als deren Resultat die nur von
Ankara anerkannte „Türkische Republik Nordzypern“
ausgerufen wurde. Ebenfalls noch während des intakten
Kalten Kriegs, Anfang der 80er Jahre, wäre es um ein
Haar zu einem weiteren Waffengang zwischen diesen
rivalisierenden Regionalmächten gekommen; so wichtig
nahmen beide also schon unter dem gültigen
NATO-Vorbehalt ihren nationalen Aufstieg, der sich auf
Kosten des Nachbarn abspielt. Den Standortvorteil ihrer
EG-Mitgliedschaft nützte die griechische Regierung, wo
sie nur konnte, zur Blockade der türkischen
Europa-Pläne, z.B. durch ihr Veto gegen die Auszahlung
von EG-Beihilfen zur Anpassung der türkischen Industrie
an EG-Normen. Nach Wegfall der alten Bündnisdisziplin
eskaliert die alte Feindschaft wieder, z.B. Anfang 94
in der Ägäis: Glaubt man den Schlagzeilen türkischer
Tageszeitungen, stehen Kämpfe zwischen der Türkei und
Griechenland unmittelbar bevor. ‚Wolken des Krieges‘
sieht das Massenblatt Hürriyet aufziehen, und Günaydin
erwartet ‚Heiße Tage in der Ägäis‘. Anlaß sind die
griechischen Öl-Explorationen östlich der Ägäisinsel
Thassos.
(FR 29.1.94)
Dann listet die Zeitung lauter potentielle Kriegsgründe
auf, die Athen und Ankara gegeneinander ins Feld
führen: Sie streiten „um die Hoheitszonen und
Schürfrechte“. Athen behält sich vor, die
Hoheitszone zu See auf zwölf Meilen auszudehnen. Damit
würde die Ägäis … quasi zu einem griechischen
Binnenmeer, weite Bereiche wären für türkische
Kriegsschiffe tabu.
Das türkische Außenministerium
erklärt, wenn Griechenland seine Hoheitsgewässer in
der Ägäis ausdehne, betrachte die Türkei dies als Casus
belli
. Weiter geht auch der „Streit um den
militärischen Status“ der Inseln. Ankara bestreitet
Athen das „Recht, Truppenkontingente auf den Inseln zu
unterhalten“ und legt Rechtsgutachten vor, wonach diese
„automatisch der Türkei zufallen, wenn Griechenland
seine Soldaten nicht von dort zurückzieht“, was die
Griechen wiederum befürchten läßt, die Türken planten
„eine Annektion von Inseln wie Lesbos, Chios, Samos und
Kos“. Ankara ordnet „massive Tiefflüge von
F-16-Geschwadern über Thassos“ an und treibt die
Feindbildpflege voran: Çiller „verglich den Athener
Premierminister Andreas Papandreou mit dem russischen
Ultra-Nationalisten Vladimir Schirinowskij“; die von
diesen beiden „heraufbeschworenen Gefahren erforderten
eine Stärkung der türkischen Militärmacht“. Und wenn
beide Länder von Bombenanschlägen in ihren
Tourismus-Zentren betroffen werden, dann trauen sie
sich wechselseitig locker zu, daß die auf das Konto
einer Fünften Kolonne des Feindstaats gehen. Nicht
verwunderlich also, wenn „das UN-Waffenregister die
Rivalen am Bosporus als größte Importeure von
Großwaffensystemen ausweist“ (FR
26.5.94).
[17] Die Zahlen sind eindrucksvoll. Laut FR vom 1.2.94 kommt da – auszugsweise! – folgendes zusammen: Die USA lieferten der Türkei 92/93 822 M-60-Kampfpanzer, 180 gepanzerte Kampffahrzeuge M 113, 69 Haubitzen M 110. Aus dem Bonner Außenministerium kriegt Ankara jährlich 86,6 Mio. DM an NATO-Verteidigungshilfe, zuzüglich „Rüstungssonderhilfen“ (seit 1980), darunter U-Boote und Leopard-1-Panzer. Aus NVA-Beständen erhielt die Türkei 300 Radpanzer, 450 Mio. Stück Munition, 100000 Panzerfäuste usw. Im Herbst 92 genehmigte Bonn weitere Lieferungen, u.a. Fregatten, Stinger-Luftabwehrsysteme, 500 Schützenpanzer M 113, 46 Phantom-Aufklärer und 18000 Artilleriegranaten, die der Hersteller als „besonders geeignet für den Bürgerkrieg“ bezeichnet. Die 3000 Mann der türkischen Sondertruppe „Schwarze Käfer“, die derzeit das Kurdengebiet terrorisiert, wurden bei einer ersten Adresse, nämlich der deutschen GSG 9, ausgebildet.
[18] Laut Handelsblatt vom 18.5. und 6.6.94 lauten die einschlägigen politökonomischen Kennziffern zur Jahresmitte folgendermaßen: 107% Inflationsrate; 60% Abwertung der Lira seit Jahresbeginn; Kursstürze an den Börsen, während die Zinssätze um bis zu 1000% in die Höhe gingen; Auslandsschuld 66 Mrd.$; Leistungsbilanzdefizit 6,3 Mrd.$ usw. Seit April sind bereits drei Banken und eine führende Maklerfirma zusammengebrochen. Um dem entgegenzuwirken, wurde die Zentralbank gesetzlich ermächtigt, in Schwierigkeiten geratenen Instituten mit bis zum Doppelten ihres Eigenkapitals auszuhelfen, d.h. den Kreditschwindel auf die Kappe des Staats zu nehmen, so daß der demnächst wohl den nächsten Rekordsatz bei der Inflationsrate wird bilanzieren müssen.
[19] Zu den hier einschlägigen Kalkulationen äußert sich Außenminister Kinkel in einem FR-Interview, nachdem die Reporterin außergewöhnlich keck auf menschenrechtlich gebotenem Abstrafen der Türkei wg. ihres Vorgehens gegen die Kurden beharrt und sich da so einiges vorstellen kann: „FR: Sie könnten Schwierigkeiten im Assoziierungsverhältnis zur EU androhen, laut über wirtschaftliche Sanktionen nachdenken oder den Ausschluß aus der NATO für eine begrenzte Zeit in Aussicht stellen. Kinkel: Mit Verlaub: Das alles finde ich wenig realistisch und hilfreich. Wir müssen bei der Beurteilung eines Landes immer die außenpolitische Gesamtsituation in Rechnung stellen. In der Bundesrepublik leben zwei Millionen Türken, wir haben mit dem Land enge politische, wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen, es ist ein NATO-Bündnispartner, es liegt zwischen Europa einerseits und sowohl den mittelasiatischen Staaten wie auch der islamischen Welt andererseits und hat zusätzliche Bedeutung gewonnen nach dem Wegfall der Ost-West-Auseinandersetzung. Wir haben – und genauso verhalten sich unsere Partner – keine Veranlassung, den freundschaftlichen Kontakt abzubrechen, und wir können das auch nicht einfach tun.“ (FR 9.5.94)
[20] Hierzu
Oppositionsführer Yilmaz in gediegenem
Diplomatenjargon: Als ein moderner Staat der Region,
der in der Form einer säkularen Demokratie regiert wird
und die freie Marktwirtschaft praktiziert, stellt die
Türkei in der Tat insbesondere für die
mittelasiatischen Republiken und andere islamische
Länder wie auch für viele ihrer Nachbarn ein
‚Staatsmodell‘ dar.
Mit Freude registriert man in
Ankara komplementäre Äußerungen wie die des usbekischen
Präsidenten Karimow vom „türkischen Modell für
Zentralasien“. Dieses „Modell“ gilt durchaus auch auf
dem Gebiet der Staatsverfassung und inneren
Ausrichtung, die als „säkulare Demokratie“ für
„islamische Länder“ ausdrücklich vom
fundamentalistischen Glaubensstaat abgegrenzt wird. Die
Rolle der Religion für eine staatstragende Gesinnung
schätzen auch die Ex-Sowjetrepubliken, die sich jetzt
nicht zuletzt das Adjektiv „islamisch“ zulegen; aber
ein fundamentalistisches „Staatsmodell“ sehen sie
mehrheitlich als Hindernis dafür an, „ein moderner
Staat der Region“ zu werden, so daß die meisten
Regierungen die radikalen Islamisten im eigenen Land
bekämpfen. Nur in Tadschikistan war für ein halbes Jahr
eine islamistische Regierung an der Macht, die dann
wieder gestürzt wurde. Die jetzige läßt sich an ihrer
Südgrenze von GUS-, d.h. russischen Truppen vor
Glaubenskriegern aus Afghanistan schützen.
[21] Die Buchhalter auswärts stattfindender Schlächtereien von Amnesty International haben ausgerechnet, daß zwischen 84 und 91 etwa 3000 Leute bei den Scharmützeln zwischen türkischer Armee und kurdischen Rebellen umkamen; auf diese Anzahl bringt es das Türkenmilitär seit 92 locker in jedem Quartal, Tendenz steigend. Nach neuesten Angaben ist anno 94 knapp ein Drittel der türkischen Armee fürs Kurdenmetzeln abgestellt, die Türkei hat heute mehr Soldaten in der Südost-Türkei stationiert als während des Kriegs gegen den Irak. Einschlägige Experten schätzen, daß die Türkei für den Kurdenkrieg im vorigen Jahr 12 Mrd. DM ausgegeben hat und daß seine Kosten derzeit irgendwo zwischen 25 und 50% der türkischen Staatsausgaben liegen.
[22] Dazu ausführlich der Artikel „Die vier Seiten des Kurden-Problems“ in GegenStandpunkt 2-94, S.105.
[23] Vgl. den Artikel „Deutschlands Ausländerproblem“ in diesem Heft.