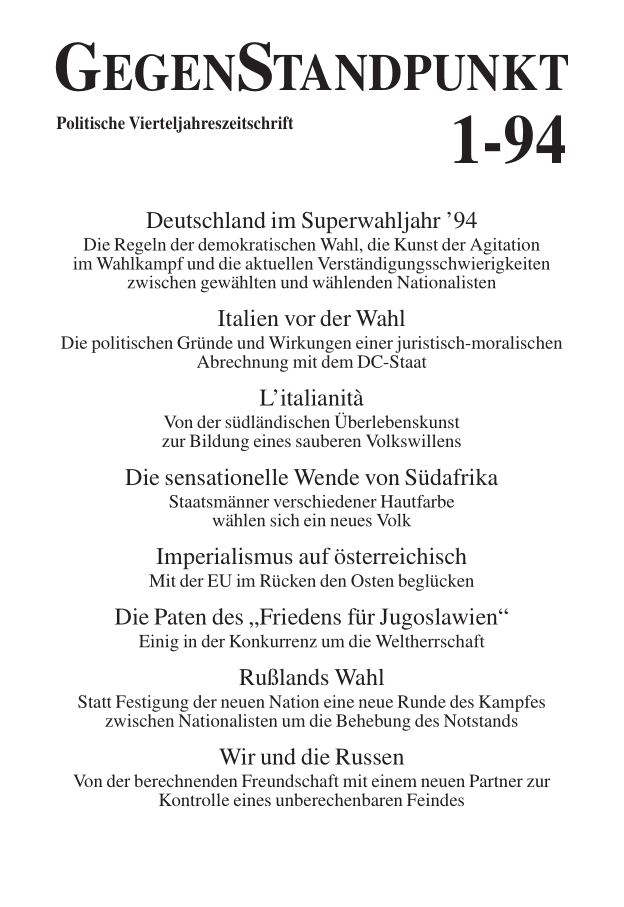Die Paten des „Friedens für Jugoslawien“
Einig in ihrer Konkurrenz um Weltherrschaft
Der Fall Jugoslawien – ein Fall wofür? Sicher nicht für die Sorge um den Zustand von Land und Leuten auf dem Balkan, sondern ein Fall für die Großmacht Europa, das beanspruchte Mandat für europäische Weltmachtpolitik praktisch in Angriff zu nehmen, und ein Fall für die beteiligten Nationen, selbst für die Herstellung des Mandats zu sorgen und zur Großmacht in Europa zu werden. „Fehlende Einigung“ hinsichtlich des Vorgehens gegen Serbien ist da der wohlmeinende Titel für die sich ausschließenden Machtinteressen der selbsternannten Ordnungsstifter.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Siehe auch
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
- Wegen „mangelnder Einigkeit“: Das Gerücht vom „Scheitern“ und „Versagen“ der internationalen Aufsichtsmächte in Jugoslawien
- Gegeneinander, aber einvernehmlich: Probleme einer europäischen Internationale von Aufsichtsmächten
- Die „neue Weltordnung“ und ihre „partners in leadership“: Die Konkurrenz in den Institutionen der Weltaufsicht, mit ihnen und um sie
- Die sichere Perspektive der imperialistischen Konkurrenz: Von wegen „Einigung“ und „Neue Weltordnung“
Die Paten des „Friedens für
Jugoslawien“[1]
Einig in ihrer Konkurrenz um
Weltherrschaft
Für die westlichen Aufsichtsmächte des jugoslawischen Kriegs ist die Drohung mit Bomben auf „serbische Stellungen“ schon seit geraumer Zeit eine politische Option, und auch schon seit längerem weiß die geneigte Weltöffentlichkeit, wofür diese Option gut ist. Sehr nützlich war sie bekanntlich für jene politische „Initiative“, die es in Sachen „politischer Konfliktlösung“ von den USA als Vormacht der NATO gegen ihre europäischen „Partner“ wiederzuerlangen galt, also dafür, diese auf ein „gemeinsames Vorgehen“ unter ihrer Führung festzulegen. Nützlich war sie deswegen aber auch umgekehrt für diese, mittels Ablehnung dieser Option entweder auf einem eigenen, exklusiv europäischen Aufsichts- und Eingriffsrecht über bzw. in Jugoslawien zu beharren oder sich doch zumindest den Weg dafür freizuhalten, mit selbstfabrizierten alternativen „Initiativen“ die anderen auf die eigene politische Linie zu bringen. Vor kurzem ist noch eine Funktion des Bombenkriegs in Bosnien für die Allianz der westlichen Friedensstifter bekanntgemacht worden: Im Namen ihrer „Glaubwürdigkeit“, zur Bekundung ihrer Entschlossenheit, dem von ihnen in Anspruch genommenen Aufsichtsrecht über den Balkan auch die Gewalt nachfolgen zu lassen, die dieses Recht unwidersprechlich macht, haben die alliierten Aufsichtsmächte einvernehmlich erklären lassen, daß sie sich die militärische Eskalation des Krieges schuldig sind. Und auch diesmal entfalten die den Serben angedrohten Bomben ihre politische Wucht in erster Linie und ganz absichtsvoll gegen einen Adressaten, der in den Krieg in Jugoslawien gar nicht eingemischt ist: Wirklich von weltpolitischem Interesse und Belang ist nicht die Frage, ob sich die Serben dem Ultimatum der NATO beugen; sondern ob die Macht, die als Erbe der Sowjetunion mit Vetorecht im Sicherheitsrat sitzt, sich dem westlichen Monopolanspruch auf Weltaufsicht und -kontrolle ernsthaft widersetzt oder nicht.
Obwohl die imperialistischen Mächte selbst so gar keine Zweifel daran aufkommen lassen, daß sie sich durch die Lage in Jugoslawien zuallerletzt zu dem jüngsten gemeinschaftlichen Schritt ihrer Jugoslawienpolitik veranlaßt sehen – auffassen und würdigen soll man ihr Vorgehen ganz anders. Da soll man sich allen Ernstes denken, es wäre unmittelbar nach der letzten Granate auf den Marktplatz in Sarajewo „ein Ruck“ durch alle westlichen Politiker gegangen, der sich aus „tiefer moralischer Betroffenheit“ und „wachgerüttelter politischer Verantwortung“ zusammengesetzt und – endlich und gottlob! – unverzüglich seinen Fortgang in konstruktiven Maßnahmen zur Wahrnehmung letzterer gefunden hätte: „68 unschuldige Opfer“ auf einen Schlag hätten sie einfach nicht mehr ausgehalten.
Nichts davon ist wahr: Die bisherigen Machenschaften und Berechnungen der westlichen Aufsichtsmächte sind ein einziges Zeugnis dafür, daß es ihnen mit ihrer Jugoslawienpolitik gar nicht um Jugoslawien geht, und um die vielzitierte „geschundene Zivilbevölkerung“ dort schon gleich nicht; sondern daß sie am Fall Jugoslawien Ansprüche viel grundsätzlicherer Art geltend machen und sich mit Problemen herumschlagen, die aus diesen erwachsen und die mit dem sich in Jugoslawien nicht einstellen wollenden „Frieden“ nichts zu schaffen haben. Umgekehrt – um welche Ansprüche es der westlichen Aufsichtspolitik geht und an welchen Problemen die wahrgenommene internationale Aufsicht über den Krieg in Jugoslawien tatsächlich „scheitert“: Dafür gibt gerade nicht der Blick auf Jugoslawien und die Konkurrenz der Kriegsparteien vor Ort Auskunft, sondern die Betrachtung von Gegenstand und Verlauf der weltpolitischen Konkurrenz, wie sie unter Nicht-Jugoslawen stattfindet. Deswegen ist in den folgenden Ausführungen zum Thema Jugoslawien von den völkischen Besonderheiten der Südslawen und ihrer „Tradition“ überhaupt nicht die Rede; die Suche nach dem „Hauptschuldigen“ am stattfindenden Gemetzel bleibt gleichfalls denen reserviert, die sie anzetteln, und die Toten von Sarajewo finden nur einmal am Rande Erwähnung.
Wegen „mangelnder Einigkeit“: Das Gerücht vom „Scheitern“ und „Versagen“ der internationalen Aufsichtsmächte in Jugoslawien
Über die Leistungsbilanz der auf dem Balkan engagierten westlichen Allianz für „Frieden“ will sich kein öffentlicher Sachverständiger groß etwas vormachen. Von denselben Regierungen, deren tatkräftige Einmischung in Jugoslawien bekannt ist und die für Zustandekommen und Verlauf des Krieges in ganz praktischem Sinn Verantwortung tragen, hört man Klagen über den „beschränkten Einfluß, den wir auf die jugoslawischen Ereignisse haben“; Zeitungen führen darüber Beschwerde, daß sich der für die Region verordnete Friede dort einfach nicht einstellen will; daß vehement vorgetragene Drohungen, „Aggressionen und Eroberungen keinesfalls tatenlos hinnehmen“ zu wollen, überhaupt nicht verfangen; ja, daß insgesamt das von der Allianz der Friedensstifter geltend gemachte Recht, auf dem Balkan für „Ordnung“ und „Frieden“ zu sorgen, sich praktisch überhaupt nicht Geltung verschaffe und darüber in einer Bekundung schierer „Ohnmacht“ ausarte. Und die gereicht den Mächten, die hinter diesem Recht stehen, natürlich überhaupt nicht zur Ehre, sondern macht sie im Gegenteil reif für den öffentlichen Vorwurf, ziemlich grundlegend an ihren doch so entschieden vorgetragenen Vorhaben zu „scheitern“. Ihren kritischen Impuls beziehen solche Stellungnahmen allerdings nicht aus einer unvoreingenommenen Betrachtung dessen, was die bekannten auf dem Balkan engagierten Aufsichtsmächte zur Wahrnehmung ihres Rechtsstandpunkts „Ordnung“ & „Frieden“ schon alles auf den Weg gebracht haben. Mit dem, was diese Mächte bei ihrem Engagement tatsächlich bewirkt haben und was sie mit ihrem Engagement überhaupt bewirken wollen, befaßt sich dieser kritische politische Verstand nämlich ausschließlich vom Standpunkt eines sehr abstrakten und affirmativen Ideals aus: Er ist so sehr parteilich für den Erfolg des von den Aufsichtsmächten an Jugoslawien angemeldeten Rechts auf Einmischung, daß es ihm ganz gleichgültig ist, was dieses Recht der Sache nach ist und gegen wen es in Anschlag gebracht wird; er ist so fixiert darauf, daß dieser Erfolg sich einfach von selbst versteht und daß dem angemeldeten außenpolitischen Interesse einfach nichts in die Quere kommen darf, daß er im ausbleibenden „Frieden“ auf dem Balkan einen einzigen „Mißerfolg der Jugoslawienpolitik“ entdeckt. Die habe sich nämlich – meint er – ganz diesem ehrenwerten Gut verschrieben und sich darauf verpflichtet, dort unten die entsprechende „Ordnung“ zu schaffen, so daß für ihn aus dem Krieg in Jugoslawien ein einziges Dokument des politischen Versagens derer wird, die als Aufsichtsmächte zwar großartige Absichten verkünden, aber offensichtlich – das beweisen ja wohl die Granaten, die dort noch immer fliegen – außerstande sind, die den Erfolg wirklich sicherstellenden Taten folgen zu lassen.
Als Auftakt zum Entzug des Mandats der Friedensstiftung versteht sich solches freilich nicht. Vielmehr macht sich die affirmative Deutung von Zwecken und Taten imperialistischer Außenpolitik auf die Suche nach den Schuldigen am Ausbleiben einer erfolgreichen Ordnungsstiftung und rundet mit denen die Diagnose vom Versagen der Jugoslawienpolitik ab: Schuld an diesem sei die „Uneinigkeit der Weltmächte“, die sich in Jugoslawien engagieren; wegen ihr sei an entscheidenden Stellen die mit dem „Frieden“ beauftragte UNO immer wieder in ihrer praktischen Handlungsfreiheit gelähmt; fehle es der EG an der nötigen Überzeugungskraft bei ihren gleichfalls dem Zweck „Frieden“ gewidmeten, daher sehr löblichen Bemühungen, „Druck“ auszuüben, und gleichfalls wegen ihr kämen die von der NATO angedrohten Militärschläge über den Status der bloß drohenden Gebärde immer nie hinaus.
Damit ist das Weltbild, mit dem ein Kapitel imperialistischer Politik kritisch kommentiert wird, komplett: Ihm zufolge gibt es eine Reihe von Weltmächten, die jede Menge Verantwortung tragen; vornehmlich für die Herstellung einer Weltordnung, die sich dadurch auszeichnet, daß Frieden und Einvernehmen zwischen allen herrscht, weswegen besagte Weltmächte auch dazu beauftragt sind, diesen Zustand gegebenenfalls herbeizuzwingen, schließlich sind sie ja die Weltmächte; naturgemäß verlangt ihr Dienst an der großen Sache Weltordnung zuallererst, daß zwischen ihnen Frieden und Einvernehmen herrscht, doch kann man davon – im Prinzip jedenfalls – ausgehen: Wenn sie ihre Weltpolitik betreiben, wirken sie ja doch nur in den internationalen Gremien zusammen, in denen es den offiziellen Titeln nach vornehmlich um das zivilisierte Zusammenleben der Völker geht. Aber leider zeigt sich an dem Fall für Weltordnung, welcher Jugoslawien heißt, daß es mit ihrer Gemeinsamkeit überhaupt nicht weit her ist; daß, die dort durchzusetzende Ordnung betreffend, von einem Konsens zwischen ihnen gar keine Rede sein kann; statt dessen muß man konstatieren, daß sie sich pausenlos streiten, untereinander und in den Gremien, in denen sie zusammensitzen; daß nationale Egoismen ausbrechen und regelmäßig die „Ordnungskonzepte“ zu Fall bringen, auf die man sich doch vor kurzem erst geeinigt hatte.
Sicher: Auf eine erstklassige Quelle berufen kann sich auch diese Diagnose der Ursachen für die an ihrem Erfolg gehinderte internationale Aufsicht über Jugoslawien, sind es doch die in ihrem Rahmen tätigen Politiker selbst, die sich wegen „mangelnder Einigung“ ein ums andere Mal bei der Umsetzung ihrer Vorhaben „blockiert“ vorkommen und den Verlust von so mancher „Initiative“ beklagen, die sie in Sachen gemeinschaftlicher Befriedung des Balkans auf den Weg bringen. Doch wäre ausgerechnet diese Quelle eher dazu angetan, ein wenig Zweifel aufkommen zu lassen an der Stichhaltigkeit jener vorgestellten Idylle, in der ein Verein von Weltmächten einig und gemeinsam an einer Ordnung für alle wirkt: Wenn Politiker darüber Klage führen, daß sie sich beim vorgehabten gemeinschaftlichen Vorgehen untereinander nicht einig werden können – stören sie sich dann wirklich daran, daß sie „keine gemeinsame Lösung“ zustandebringen? Oder nicht vielmehr daran, daß sie sich mit ihren jeweiligen Vorschlägen in Sachen „gemeinsamer Lösung“ wechselseitig in die Quere kommen und deswegen nicht einig werden, weil in der Konkurrenz, wer sich womit gegen wen durchsetzt, keiner nachgibt? Wenn sie so sehr hinter „Einigung“ bei ihren unterschiedlichen bis gegensätzlichen Interessen her sind – wollen Politiker dann wirklich diesen selbst- und interesselosen Formalismus als Erfüllung all ihrer Drangsale? Oder meinen sie mit ihrer „Einigung“ nicht vielmehr das Ideal, daß sie selbst erfolgreich unnachgiebig bleiben, sich mit ihren Interessen gegen ihre Kontrahenten behaupten; daß eben nicht sie, sondern die anderen nachzugeben und in das einzuwilligen haben, was ihnen als „Einigung“ vorschwebt – so daß die in Wahrheit gar nichts anderes ist als die Heuchelei von notorischen Erpressern, die auch bei den übelsten Machenschaften einfach nicht davon lassen wollen, an den Nutzen der erfolgreich geschädigten Seite zu denken? Und schließlich: Wenn schon jeder, die politischen Macher wie ihr ideologisches Fußvolk, so sehr auf „Einigung“ zwischen den Parteien aus ist, die für Weltpolitik zuständig sind – soll man sich dann nicht einfach fragen, warum sie nicht zustandekommt? Vielleicht ist ja bei einem Projekt „Weltordnung“, an dem sich konkurrierende Weltmächte zu schaffen machen, „Einigung“ zwischen ihnen das Letzte, was man erleben wird – und das liegt gar nicht einmal nur am mangelnden Einigungswillen der Beteiligten, sondern daran, daß das, worüber sie sich einigen sollen, ihre Einigung ausschließt. Vielleicht ist das einzig Bemerkenswerte – und auch das einzig „Neue“ – an dieser „Weltordnung“, daß unter dem Titel „Einigung“ um sie, also darum gestritten wird, wer sich gegen wen erfolgreich mit dem Anspruch auf Führer- und Gefolgschaft durchzusetzen versteht.
Was diesbezüglich Jugoslawien und das beklagte „Scheitern“ der Weltmächte bei ihrer Jugoslawienpolitik betrifft, so kommt man jedenfalls nicht auf den Grund dieses „Scheiterns“, wenn man ihnen, die Kriegslage vor Ort betreffend, „Versagen“ beim Aushecken einer „befriedigenden gemeinsamen Lösung“ vorwirft: Woran die imperialistischen Mächte in Wahrheit scheitern, ist nicht die Befriedung Jugoslawiens, sondern das, was sie mit ihrem Engagement für den jugoslawischen „Frieden“ für sich verfolgen; und was das ist, klärt die Betrachtung von Verlauf und Gegenstand ihrer Konkurrenz.
Gegeneinander, aber einvernehmlich: Probleme einer europäischen Internationale von Aufsichtsmächten
Die politische Ordnung auf dem Balkan war schon einmal zwischen einigen europäischen Aufsichtsmächten strittig, und gar nicht zufällig hat ihr Streit unmittelbar in die Fronten des I. Weltkrieges geführt. Jede der Nationen, die sich damals für die Arrondierung des Balkans nach Maßgabe ihres eigenen Interesses für zuständig erklärte, sah sich nämlich damit konfrontiert, daß ihr exklusiv beanspruchtes Aufsichtsrecht mit denselben Rechten kollidierte, mit denen ihre Konkurrenten ihre jeweiligen Interessen in der Region verfolgten. Nun sind Kollisionen dieser Art wegen der grundsätzlichen Unvereinbarkeit der Ansprüche, die da aneinandergeraten, und wegen der Subjekte, die hinter diesen Ansprüchen stehen, so umstandslos nicht zu bereinigen, und friedlich-schiedlich schon gleich nicht: Mit dem Rechtsanspruch auf das „Ordnen“ der politischen Lage, den sie selbst erhebt, bestreitet jede einzelne Aufsichtsmacht allen anderen, dasselbe Recht auch für sich in Anspruch zu nehmen, stellt sie also vor die Alternative, sich entweder dieser Bestreitung ihrer Souveränitätsrechte nach außen zu beugen oder sie zur grundsätzlichen Frage der Behauptung ihrer Souveränität zu machen und mit ihren Gewaltmitteln, die sie ja eigens dafür unterhält, für die Wahrung ihrer Rechte zu sorgen. Bekanntlich haben sich seinerzeit die Nationen für letzteres entschieden und die Entscheidung, welches Recht sich durchsetzt, auf den Schlachtfeldern gesucht.
Auch gegenwärtig ist zwischen einigen selbsternannten Aufsichtsmächten die politische Ordnung auf dem Balkan strittig, und neben dem regionalen Schauplatz hat sich auch an dem, was da zwischen ihnen strittig ist, im Prinzip nichts geändert. Wieder sind es miteinander nicht zu vereinbarende nationale Interessensstandpunkte, wie die „Ordnung“ in Jugoslawien auszusehen habe, die sich gegeneinander aufbauen; wieder werden Rechte auf außenpolitische Einmischung angemeldet, die sich wechselseitig bestreiten und das nationale Interesse, das sich in sie einkleidet, zur existenziellen Frage staatlicher Souveränität machen – nur werden sie diesmal von den betreffenden Mächten so gar nicht verfochten. Diese vertreten zwar ihre nationalen Standpunkte und wollen sich mit ihnen durchsetzen, aber eben nicht gewaltsam gegen ihre Konkurrenten, sondern mit deren Einwilligung; sie sind zwar unnachgiebig, was die Verfolgung ihrer Interessen anbelangt, aber nur insoweit, als sie immer nur auf die Nachgiebigkeit ihrer Kontrahenten erpicht sind und die aufs Nachgeben verpflichten wollen: Alle bemühen sich um „Einigung“ in der Streitfrage, legen also bezüglich der Durchsetzung ihres Interesses Wert darauf, daß sich ihre Konkurrenz diesem freiwillig unterordnet.
Daß sie ihren Streit um die ordnungspolitische Kompetenz in Europa unter dem Titel „Einigung“ austragen, besagt also keineswegs, daß sich die europäischen Aufsichtsmächte bei der Verfolgung ihrer außenpolitischen Anliegen eine gewisse Zurückhaltung auferlegt hätten. Was sich – im Vergleich zu ihren Rechtsvorgängern aus der Periode, die auch nach offizieller Lesart „Imperialismus“ heißt – wie Zurückhaltung ausnimmt, betrifft nicht die Interessen selbst, um die es ihnen geht, sondern allenfalls die gemeinschafts- und einigungsbeflissene Form, in der sie sie durchsetzen wollen. Und selbst das ist bloßer Schein: Die europäischen Imperialisten von heute halten in ihrer Konkurrenz um die Ordnungsstiftung auf dem Balkan nicht sich zurück, sondern legen sich in ihr die eine Verpflichtung auf, sie nicht unmittelbar und offen gegeneinander auszutragen. Und dies ist keine Übung in der Tugend der freiwilligen Selbstbeschränkung, sondern erklärt sich aus dem, worum heute an der Frage der politischen Ordnung in Jugoslawien konkurriert wird.
Den Fall Jugoslawien als Auftrag an ihre eigene politische Ordnungskompetenz haben zuerst Mächte für sich entdeckt, die sich schon seit längerem darauf verstehen, in wesentlichen Belangen ihrer politischen Interessen gemeinsame Sache zu machen. Das Projekt, dem sie sich verschrieben haben, heißt ganz schlicht „Europa“ und soll nach dem Willen seiner Betreiber das recht ambitionierte Vorhaben eines Machtblocks voranbringen, der sich im wesentlichen nur noch an jener bekannten transatlantischen Supermacht zu messen braucht. Dieses Interesse ist in weltpolitischer Hinsicht die Geschäftsgrundlage aller, die zuerst in einer europäischen Gemeinschaft und nunmehr in einer Union zusammen ein Bündnis eingegangen sind, und dieses Interesse ist auch das einzige, was sie eint und zusammenhält: Als Union betreiben die europäischen Imperialisten das Projekt, sich die Rolle einer mit den USA mindestens ebenbürtigen Weltmacht zu erobern, was umgekehrt für jede der an diesem Projekt beteiligten Nationen heißt, daß ihr Weltmachtstatus an die politische Macht und Geltung geknüpft ist, die sie sich im Rahmen dieses Projekts „Europa“ zu erobern versteht. Daher haben alle europäischen Partner den „Ordnungsfall Jugoslawien“ erstens als Fall für die Großmacht Europa entdeckt und wahrgenommen: An ihm galt es das beanspruchte Mandat für europäische Weltmachtpolitik praktisch in Angriff zu nehmen. Und zweitens haben sie Jugoslawien als Fall für sich entdeckt, als Auftrag, selbst für die Herstellung dieses Mandats zu sorgen und darüber zur Großmacht in Europa zu werden.
Begonnen hat die Konkurrenz um die Bestimmung dessen, was „gemeinsame europäische Außen- und Sicherheitspolitik“ zu sein habe, bekanntlich der deutsche Kanzler. Der nahm so kompromißlos für die Anerkennung der jugoslawischen Sezessionisten Partei, weil er auf diesem Wege Deutschland als neue außenpolitische Großmacht in Europa ins Spiel brachte; ihm paßte der eingeleitete Zersetzungsprozeß des jugoslawischen Staates, weil er an ihm einen deutschen Handlungsbedarf für das Ziehen neuer Grenzen auf dem Balkan geltend machen konnte; er schürte den Streit zwischen der Zentralregierung und den abtrünnigen Republiken Jugoslawiens, bis dieser Staat selbst unhaltbar wurde und zerbrach, weil Deutschland so zur geborenen Schutzmacht der Kleinstaaten auf dem Balkan werden sollte, die unter seiner Patronage neu entstehen: Indem es sie überhaupt erst in den förmlichen Rang von souveränen Gewalten erhebt, schafft sich Deutschland politisch souveräne Vasallen, und die Beziehungen zu Geschöpfen dieser Art reichen, da sie die elementare Voraussetzung von deren Souveränität umfassen, um einiges über die Abhängigkeitsverhältnisse hinaus, die Deutschland als die wirtschaftliche Vormacht der EU mit ihren Export- und Kreditbeziehungen ohnehin schon mit Erfolg überallhin unterhält.
Der Status einer politischen Vormacht auf dem Balkan, den Deutschland sich auf diesem Wege zu erkämpfen vornahm, gründet sich dabei aber gar nicht in erster Linie auf diese speziellen Abhängigkeitsbeziehungen, die beinahe zwangsläufig aus der grundsätzlichen Orientierung dieser Staaten auf ihren Sponsor erwachsen. Vielmehr betrifft er jenes Projekt, das ganz ohne unmittelbaren Bezug auf deutsch-nationale Sonderrechte nicht nur so schön supranational „Neuordnung Europas“ heißt, sondern eben auch als supranationales Projekt betrieben wird. Freilich von Bonn aus, und das ist das genuin deutsche Recht, das diese Nation sich herausnahm und am Fall Jugoslawien als erste praktisch in Anschlag brachte: Deutschland maßte sich die Rolle der außenpolitischen europäischen Vormacht an; es betrieb deutsche Außenpolitik, die aber wie von selbst beanspruchte, gesamteuropäisch zu sein, also allen „Partnern“ der EU die Richtlinien ihrer Außenpolitik vordiktierte und sie vor die Alternative stellte, entweder dieses deutsche Recht einer Definition von europäischer Außenpolitik mitzutragen – oder aber das politische Verhältnis selbst in Frage zu stellen, auf dessen Basis es geltend gemacht wird und in dem sie als europäische Unionspartner zu Deutschland stehen.
Ein „deutscher Alleingang“, der überhaupt gar keiner sein will, weil er gleich allen europäischen Mächten die Neuordnung Jugoslawiens in deutschem Sinn auf die außenpolitische Tagesordnung setzt, ist freilich schon ein „Alleingang“ und bleibt als solcher den „Partnern“ überhaupt nicht verborgen. Die bekommen in dem bescheidenen Antrag aus Bonn, deutsche Ordnungsinteressen zur gemeinsamen Linie europäischer Politik zu machen, durchaus den politischen Inhalt des Formalismus einer „gemeinsamen europäischen Außen- und Sicherheitspolitik“ mit und bemerken, daß da von Deutschland am Fall Jugoslawiens die Konkurrenz um die Richtlinienkompetenz der EU nach außen eröffnet worden ist – und entsprechend sieht ihre Antwort aus: Sie lassen sich ihre diesbezüglichen Rechte überhaupt nicht nehmen und greifen ihrerseits in die politische Neuordnung Jugoslawiens ein. Außer Frage steht für Frankreich, Großbritannien und die anderen Mächte der Union, daß sie Deutschland bei seinem „Alleingang“ aus ihrem eigenen Interesse heraus keinesfalls allein lassen dürfen. Dies wäre nämlich die Preisgabe all ihrer machtpolitischen Ambitionen mit, an und in Europa und wäre mit der freiwilligen Selbstbeschränkung identisch, in Zukunft gleich die zweite Garnitur an der Peripherie einer deutschen Hegemoniezone mit Namen „Europa“ zu spielen. Dem von Deutschland beanspruchten Recht, sich über die Vergabe von Lizenzen für Staatsgründungen zur bestimmenden Macht bei der politischen Neuformierung Süd- und Osteuropas aufzubauen, ernsthaft entgegenzutreten, verbietet sich andererseits den Konkurrenten auch. Dies käme nämlich einer Aufkündigung des Gemeinschaftsprojekts „Europa“ und aller weltmachtpolitischen Ambitionen, die sich an es knüpfen, gleich und setzte den offenen Gegensatz zwischen den an diesem Projekt Beteiligten auf die politische Tagesordnung – und daher kommt es, daß die Linie der deutschen Außenpolitik gerade wegen der nationalistischen Berechnungen der Mitmacher im Projekt „Europa“ tatsächlich gesamteuropäischer Konsens wird. Getragen wird der allerdings von eben diesen Berechnungen der deutschen „Partner“, und die laufen selbstverständlich darauf hinaus, alles, was an gemeinschaftlicher europäischer Außenpolitik zustandekommt, für sich, für ihre Macht und ihren Einfluß in Europa zu instrumentalisieren – so daß sich alle europäischen Mächte darauf verpflichten, ihre Konkurrenz, die sich am „Ordnungsfall“ Jugoslawien offenbart, nicht unmittelbar gegeneinander, sondern im Wege einer gemeinschaftlichen Betreuung des Ordnungsfalls Jugoslawien auszutragen: Deutschland vorweg und dann alle in Europa vertretenen nationalen Standpunkte geraten über ihr gemeinsames Interesse, die Auflösung Jugoslawiens als Auftrag an die eigene Ordnungskompetenz vor Ort zu interpretieren und sich darüber als gesamteuropäische Ordnungsmacht zu profilieren, in Gegensatz zueinander. Nur bringen sie ihren Gegensatz nicht offen zur Entscheidung, sondern stufen ihn auf die Rolle eines von vielen Posten ihrer nach wie vor gemeinschaftlichen EU-Politik herab und tragen ihren politischen Kampf um die Hegemonie in Europa fürs erste in ihren Brüsseler Gremien als das Problem aus, sich auf ein gemeinsames außenpolitisches Mandat zu einigen: Die Partner verlagern ihren Streit um die gesamteuropäische Führungsrolle auf eine gewissermaßen methodische Ebene über dem eigentlichen Konflikt, indem sie zunächst einmal diskursiv die „Ordnung“ zu ermitteln trachten, die es im Zuge der gesamteuropäischen Regelung des Ordnungsfalls Jugoslawien überhaupt zu etablieren gelten soll. Das von allen beanspruchte, daher wechselseitig in Abrede gestellte Ordnungs- und Eingriffsrecht wird darüber zur Frage, wer sich gegen wen mit welcher Ordnungsvorstellung durchsetzt und es auf diesem Wege versteht, die Konkurrenz seinem machtpolitischen Interesse unterzuordnen. Wechselseitig getestet wird dabei zwar die Nachgiebigkeit oder die Intransigenz des einen oder anderen „Partners“ bei der einen oder anderen Frage in Sachen Einmischung in Jugoslawien. Aber eben stets unter dem Diktat der Stiftung von Einigkeit zwischen allen streitenden Parteien, und so stehen die konkurrierenden nationalen Interessen gar nicht mehr als solche einander gegenüber, sondern nehmen die Form von Vorschlägen an, die die Definition des Ordnungsbedarfs und der der Region zu verpassenden Ordnung betreffen und hinter denen dann die eine oder andere Nation steht, um sie zur gemeinsamen Linie der Außenpolitik aller zu machen. Einig sind die Konkurrenten sich dabei genau so weit und so lange, wie es das Prinzip ihres gemeinschaftlich vorgebrachten Eingriffs- und Ordnungsrechts betrifft – also können sie sich auch auf die diesbezüglichen abstrakten Rechtstitel einigen: Man macht sich gemeinsam stark für „Frieden“, das „Selbstbestimmungsrecht der Völker“, die „Unverletzlichkeit der Grenzen“, eine „friedliche Konfliktaustragung“ und den „Schutz von Zivilisten“. Darüber hinaus ist man sich im Kreis der an der Definition der gemeinsamen Ordnungsmaßstäbe beteiligten Nationen auch einig, daß man Schlußfolgerungen für das praktische Eingreifen sich von anderen nicht vorschreiben lassen kann, sondern sie ihnen vorzuschreiben hat. Daher streiten sich die vergemeinschafteten europäischen Schutzmächte, welchem der von ihnen ausgemachten Werte an welcher Stelle wie gegen wen zum Durchbruch zu verhelfen sei; welche von den jugoslawischen Kriegsparteien in ihrem Namen zur Raison zu rufen sei und vor allem, mit welchen Mitteln es dies zu bewerkstelligen gelte. Gemeinsame Resolutionen und Beschlüsse kommen durchaus zustande – aber ausschließlich deswegen, weil mit ihnen die „Partner“ auf eine eigene Linie gezwungen werden sollen, und entsprechend sind sie beschaffen: Es sind methodische Kontrollimperative, die gar nicht auf die wirksame Kontrolle der Parteien bezogen sind, gegen die sie sich richten, sondern mit denen sich die europäischen Imperialisten selbst wechselseitig kontrollieren; in denen nationale Interessenstandpunkte, die sich ausschließen, wechselweise versuchen, einander „einzubinden“, das heißt tendenziell unterzuordnen und sich auf diesem Wege von den Beschränkungen zu emanzipieren, die der Zwang zur Rücksichtnahme auf die „Partner“ bei der gemeinschaftlich vollzogenen Kontrolle allemal aufwirft; deren Lebensdauer deswegen ganz von dem „Nachdruck“ abhängt, mit dem eine Nation eine „neue Initiative“ lanciert und einen „Vorstoß zur Konfliktlösung“ – zuerst in eigenem und dann gleich im Namen aller Beteiligten – präsentiert, von dem sie sich mehr verspricht – nicht für die „Lösung“ des Konflikts, sondern für die machtpolitische Rolle, die sie beim Definieren der gemeinsamen Vorgaben spielt.
Am tatsächlichen Eingriffswillen fehlt es dabei wirklich keiner der selbsternannten europäischen Aufsichtsmächte. Auch über die passenden Mittel, den Konflikt für die eine oder die andere Partei und je nach der eigenen Parteinahme zu entscheiden, verfügen sie ganz ohne Zweifel, so daß die üblen öffentlichen Nachreden – „Entschlußlosigkeit“, „Papiertiger“ – vollkommen unangebracht sind. Wenn dennoch eine bemerkliche Differenz existiert zwischen dem von ihnen geltend gemachten Aufsichtsrecht einerseits und der praktischen Kontrolle der Parteien vor Ort andererseits, zwischen dem dringlich angemeldeten Bedarf, gewaltsam „Ordnung“ zu stiften, und den praktizierten gewaltsamen Maßnahmen einer wirklichen Befriedung des Konflikts, so erklärt sich auch dies daraus, wofür Jugoslawien für sie ein Fall ist.
Denn einerseits gebietet es das Interesse einer jeden in Jugoslawien engagierten Ordnungsmacht, im Bedarfsfall auch einzumarschieren und auf diesem Weg die „Ordnung“ zu etablieren, die sie für die Region für angebracht hält. Andererseits verbietet sich genau dies – wenigstens solange, wie man um die Monopolstellung der europäischen Ordnungsmacht noch politisch zu konkurrieren vorhat und daran festhält, die anderen zur freiwilligen Unterordnung unter seinen Führungsanspruch zu bewegen. Nachdem diese aber die schon genannten guten imperialistischen Gründe haben, dasselbe für sich zu versuchen, spitzt sich an der heißen Frage eines militärischen Einstiegs zur Befriedung der Region der Widerspruch zu, der einer gemeinschaftlich abgewickelten Konkurrenz um die Vormachtstellung in Europa nun einmal eigen ist. Da meldet sich eine – nur zufällig die deutsche – Seite recht unbefangen zu Wort und vermeint, daß man – alle gemeinsam also – „die Serben in Knie zwingen muß“ – und erklärt sich im selben Atemzug fürs Zwingen absolut unzuständig, weil deutsche Truppen auf dem Balkan irgendwie unschicklich wären. Die Botschaft, daß die Deutschen gerne das politische Oberkommando über die Ordnungsstiftung hätten, die die anderen dann mit ihren Truppen durchsetzen, kommt natürlich an und wird entsprechend beantwortet: „Nur Staaten, die Truppen stellen, können mitreden,“ heißt der freundliche und auch furchtbar auf Gemeinschaft, bloß eben genau andersherum, erpichte Konter, mit dem das Recht aufs Ordnungsstiften aus dem tatsächlichem Beitrag abgeleitet wird, den man auch tatsächlich zu leisten bereit ist. Der Auftakt zum Einmarsch ist freilich auch das nicht, denn zwar wäre ein entsprechender Auftrag an die eigenen Truppen durchaus des Ende der Frage, wer „mitreden“ darf, aber eben deswegen auch die Aufkündigung des gemeinsamen Aufsichtsprojekts, die keiner der Beteiligten will. Truppen aber bloß als Beitrag zum Stiften einer Ordnung zu stellen, die man selbst gar nicht bestimmt und aus der womöglich bloß die Konkurrenten ihren Nutzen ziehen: Das verbietet die nationale Bilanzierung von Aufwand und Ertrag in Sachen gemeinsames Vorgehen schon gleich.
Die „neue Weltordnung“ und ihre „partners in leadership“: Die Konkurrenz in den Institutionen der Weltaufsicht, mit ihnen und um sie
Wegen ihrer freiwilligen Selbstverpflichtung auf Einvernehmlichkeit beim Austragen ihrer Konkurrenz hindern sich die europäischen Ordnungsmächte so wechselseitig am Vollzug der praktischen Konsequenzen, die ihnen ihr angemaßtes Aufsichtsrecht nahelegt, und üben sich deswegen, ihr unmittelbares militärisches Engagement betreffend, in einer gewissen Zurückhaltung. Auf ihre Konkurrenz selbst erstreckt diese sich freilich nicht, im Gegenteil. Wie es sich für Mächte gehört, die in Europa auf ihre Tour „Frieden“ stiften, weil sie „weltpolitische Verantwortung“ tragen wollen und sich dafür mit ihrem Projekt „Europa“ auf „Einigkeit“ verpflichten, ist für sie der Fall Jugoslawien auch wirklich nur ein Fall: An ihm wird regional begrenzt ein Anspruch aktualisiert, der sich im übrigen auf den ganzen Globus erstreckt und bei dem es um nichts Geringeres als das Monopol der Weltaufsicht und -kontrolle geht. Bei dieser Konkurrenz um die Frage, wer für die Weltordnung überhaupt zuständig ist, treffen sie allerdings unmittelbar auf die weltpolitische Macht, gegen die sie sich als europäischer Block aufbauen – und damit auf gewisse, gleichfalls unter dem verpflichtenden Titel von Einigkeit & Einvernehmen von „Partnern“ stehende Sonderbeziehungen mit dieser, die sie aus ihrer jüngeren Geschichte geerbt haben und die nunmehr zur Überprüfung anstehen.
Die Nationalismen, die zusammen den Verein der Europäischen Union bilden und in dem sie ihre seltsam gebremste Konkurrenz um die „neue politische Ordnung in Europa“ austragen, haben nämlich – solange es die noch gab – schon in der „alten“ Weltordnung eine gewichtige, aber nach zwei Seiten hin beschränkte Rolle gespielt. Sie waren als „Europa“ fest im Lager des „freien Westens“ integriert und insoweit Teilhaber an der von diesem kollektiv ausgeübten Weltaufsicht. Ihre faktische Kontrollmacht über die freiheitliche Weltordnung aber reichte immer nur genau so weit, wie es der sozialistische Block mit seiner Macht zuließ, und das war die erste Beschränkung, mit der sie zu leben hatten. Konkurrenz um die Weltherrschaft hieß für alle Mitglieder des westlichen Wertevereins zuallererst, den großen Feind ihrer Weltordnung zu erledigen; und daraus, daß sie dafür ein Kriegsbündnis eingingen, erwuchs die zweite Beschränkung: Nur indem sie ihre Gewaltmittel dem Oberbefehl einer transatlantischen Vormacht unterwarfen, konnten sie sich mit einigen Aussichten auf Erfolg gegen das östliche System aufbauen. Insoweit war ihre Allianz die Lebensgrundlage ihres Imperialismus und in letzter Instanz für sie daher immer der gewichtigste Grund, alle politischen Streitfälle, bei denen sie als imperialistische Konkurrenten – die sie bei allem ja nach wie vor blieben – aneinandergerieten, einvernehmlich zu lösen.
Mit diesem, in der gemeinsamen Feindschaft gegen einen Gegner des eigenen Systems begründeten Zwang zur Gemeinschaft ist es nunmehr, nach dem Ende der Weltmacht UdSSR, vorbei. Verschwunden ist mit der Sowjetunion auch die feste – und immer in positiver Richtung den entscheidenden Ausschlag gebende – Bezugsgröße bei der Kalkulation der Vorteile, die einem die eigene Unterwerfung unter einen supranationalen Bündniszweck im Vergleich zur damit einhergehenden Preisgabe eigener Souveränität beschert. Keinesfalls auch verschwunden aber sind mit diesem guten Grund, bei der Ausübung ihrer Weltaufsicht sich der Vormacht USA unterzuordnen und als Mächte zweiten Ranges mit ihr gemeinsame Sache zu machen, all die institutionalisierten Abhängigkeiten, in die die imperialistischen Nationen sich im Rahmen ihrer übergreifenden „Partnerschaft“ wechselseitig begeben haben und mit denen sie eine ganze Nachkriegsordnung hindurch groß geworden sind. Und das schafft für die aufstrebenden europäischen Imperialisten neben ihrer Konkurrenz um die Bestimmung eines einheitlichen außenpolitischen Willens Europas zusätzliche Probleme. Wo es den übergeordneten ordnungspolitischen Zweck ihrer Allianz, die Beseitigung eines feststehenden Störenfrieds „ihrer“ Weltordnung, nicht mehr gibt, vielmehr die Definition von „Stör-“ bzw. „Ordnungsfällen“ selbst Gegenstand ihrer Konkurrenz ist, da sehen sie in den überkommenen supranationalen Einrichtungen nur noch das, was die allerdings schon immer waren: Das politische Instrument der Führungsmacht des Westens, mit dem diese ihren Bündnispartnern den gemeinsamen Nenner ihrer Konkurrenz um weltpolitische Macht vorgab und sie sich auf diesem Wege erfolgreich unterzuordnen verstand.
Von deren Diktat wollen sie sich nun freimachen, während die Vormacht umgekehrt selbst natürlich weiter diktieren will, so daß der Bedarf an „Einigkeit“ zwischen den „Partnern“ erheblich wächst. Die geraten nämlich um so mehr aneinander, je ergiebiger sie die supranationalen Gremien, in denen Weltpolitik von den dazu Befugten gemacht wird, als Hebel ihres Einflusses zu nutzen und den Zweck wie die Aufgaben selbst zu definieren versuchen, die ihr(e) Bündnis(se) beim Bau der „neuen Weltordnung“ wahrzunehmen hätten. Und je entschiedener sie dann darauf bestehen, daß die kollektiven Organe ihr Instrument der weltpolitischen Einflußnahme zu sein haben, und zu diesem Zweck versuchen, als Mitglied des Kollektivs den restlichen Mitgliedern die Vorgaben zu diktieren, denen es dann gemeinsam zu folgen gelte, desto dringlicher wird die Forderung nach Unterordnung und lauter der Ruf nach „Einigung“.
Am Fall Jugoslawien begegnen sich die bekannten imperialistischen Mächte also nochmals und ungefähr so oft, wie es Institutionen gibt, in denen sie als Weltaufsichtsmächte in ihrer Konkurrenz gemeinsame Sache machen. In diesen Gremien befassen sie sich dann von neuem mit den Fragen, die aus einem zwar gegeneinander geltend gemachten, aber nicht gegeneinander ausgetragenen Aufsichts- und Eingriffsrecht erwachsen. Und der Zweck, den sie dabei verfolgen, ist ziemlich offenkundig: Jede Nation versucht, ihr eigenes Einmischungsinteresse zur supranationalen Angelegenheit zu machen, also ihre „Partner“ auf einen von ihr definierten Ordnungszweck festzulegen. Und da sie das alle in allen Gremien versuchen, in denen sie ihre weltweite wirtschaftliche und politische Abhängigkeit voneinander betreuen, kommt es dazu, daß aus ihrer Konkurrenz in den Weltaufsichtsbehörden ein Streit wird, welche von diesen Behörden nun zu welchem Eingriff mandatiert wird und von wem: Dieselben Mächte, die sich im Rahmen ihrer supranationalen Europäischen Union wechselseitig auf die Linie, die eine von ihnen vorgibt, festzulegen versuchen, versuchen dasselbe nochmals mit ihrem großen transatlantischen Partner im Verein der NATO, dann auch wieder von diesem Partner getrennt in Gestalt der ersten Gehversuche einer WEU, und an erster Stelle natürlich in der UNO, da diese Behörde nach dem Ende der Sowjetunion von der verbliebenen Weltmacht USA zur höchsten Instanz einer gemeinschaftlich organisierten, aber unter ihrer Führung stehenden Weltaufsicht erklärt wurde. Und bei all diesen Versuchen werden sie den Widerspruch ihres supranationalen Engagements nicht los, ihre Konkurrenten um das Monopol auf Weltaufsicht im Wege einer Einigung auf gemeinschaftliches Vorgehen am Fall Jugoslawien zu einer freiwilligen Unterordnung unter ihren exklusiven Anspruch auf dieses bewegen zu wollen.
Daraus erklären sich dann eben die Absonderlichkeiten der gemeinsam wahrgenommenen Aufsicht über den „Ordnungsfall“, anhand derer kritische Zeitgenossen nur immer das „Versagen“ der versammelten imperialistischen Mächte feststellen mögen.
Ein militärischer Eingriff in den laufenden Krieg findet statt, neben dem Embargo gegen „Restjugoslawien“, das die WEU mit ihren ersten Gehversuchen bewachen darf, und der Kontrolle des Luftraumes, wofür dieselben Mächte als NATO vor Ort sind, hauptsächlich in Gestalt von UNO-Truppen. Die greifen aber ins eigentliche Kriegsgeschehen gar nicht ein, trennen weder die Kriegsparteien voneinander noch verhelfen sie einer Seite zu entscheidenden Kriegsvorteilen. Das sollen sie auch gar nicht, denn hinter ihnen steht nicht der einheitliche Wille eines politischen Subjekts, sondern sie repräsentieren lediglich den Konsens, zu dem die vielen imperialistischen Subjekte in ihrer Konkurrenz allenfalls gelangt sind: Sie symbolisieren das abstrakte Eingriffsrecht einer gesamtimperialistisch geltend gemachten Aufsicht und dokumentieren mit ihrer Präsenz, daß die hinter dieser stehenden Mächte es an prinzipiellem Eingriffswillen auch nicht fehlen lassen. Beides tun sie dann, indem sie inmitten eines laufenden Krieges mit „Schutzzonen“ und „Korridoren“ jedenfalls die Selbstlosigkeit und den abgrundtiefen Humanismus dieses Rechts ihrer Auftraggeber vor Augen führen und der „notleidenden Bevölkerung“ beim Hungern und Sterben helfen.
Eine politische Kontrolle des Krieges
findet gleichfalls statt, und auch die ist so schön von
„mangelnder Einigkeit“ der Kontrolleure bestimmt, weil
die sich ganz nach Maßgabe ihrer Konkurrenz um ihre
Ordnungskompetenz diplomatisch am Krieg zu schaffen
machen. Unter der Regie von UNO und EU werden Landkarten
neu gezeichnet, Staaten ideell zerlegt und mit ethnischen
Zonen, neutralen Korridoren sowie Enklaven unter
internationaler Hoheit versehen und den Kriegsparteien
als Friedenskompromiß unterbreitet, in den sie doch
einwilligen möchten. Ohne große Resonanz bleiben diese
Friedensinitiativen nicht nur deswegen, weil
Kriegsparteien ihre Kriegsziele allemal selbst zu
definieren pflegen, sondern in erster Linie deswegen,
weil die engagierten Aufsichtsmächte keinesfalls
vorhaben, die ideellen Früchte ihres Ordnungswillens,
ihre „Friedenspläne“ und
Vermittlungsvorschläge
auch praktisch, und das
heißt immer: gegen Widerstand
durchzusetzen. Auch in und mit ihrer Diplomatie
konkurrieren sie nämlich in erster Linie
gegeneinander, was so manchen mit großem Hallo
gestarteten „Initiativen“ ein jähes Ende beschert, wenn
ihnen der Rückhalt eines gemeinschaftlich gefaßten und
getragenen Beschlusses von einer oder von mehreren Seiten
entzogen wird. Etwa so, daß eine Konkurrenzpartei unter
Berufung auf die „verfahrene Situation“ und – natürlich:
– auf die Hilfsbedürftigkeit des muslimischen Volkes aus
dem Konsens ausschert, sich verbal zur Partei im Krieg
erklärt und z. B. für die „Aufhebung des Waffenembargos
gegen Bosnien-Herzegowina“ plädiert. So etwas, aber auch
zum richtigen Zeitpunkt wieder ins Gespräch gebrachte
„Luftangriffe gegen serbische Stellungen“ torpediert
erfolgreich den gemeinschaftlich geleiteten
„Verhandlungsprozeß“ – überhaupt nicht unabsichtlich,
denn genau so bestreitet man die Regelungskompetenz
seiner Konkurrenten und stellt sich wieder
exklusiv in der eigenen Befugnis zur
Friedensstiftung vor. Diese wird im übrigen darüber auch
wieder enorm dringlich, denn keineswegs zufällig und auch
nicht ungewollt pflegen Drohungen dieser Art den
Durchhaltewillen der Partei enorm zu beflügeln, gegen die
sie nicht ergehen. Und je mehr Blut fließt, desto
verantwortlicher ist man bekanntlich als Humanist. Dazu
berufen natürlich auch, in der eigenen guten Gesinnung
„initiativ“ zu werden, was dem Völkerschlachten
noch eine Funktion beschert – zur Erbauung am
eigenen imperialistischen Rechtsgefühl kommen die
Massakrierten täglich ins Farbfernsehen.
So treiben die Weltmächte allesamt Jugoslawienpolitik, erklären ihre Zuständigkeit für den Krieg und sich selbst zu den Mächten, die ihn mit ihrer Gewalt zu beenden haben, und insoweit bleiben sie selbst sich überhaupt nichts schuldig. Die praktischen Nachweise ihrer angemaßten Aufsichtsrolle aber führen sie nicht, und insoweit bleiben sie – wiederum ihrem Selbstverständnis nach – durchaus einiges schuldig: Die Taten nämlich, die der von ihnen usurpierten Rolle würdig sind und wirklich mit Gewalt die Ordnung schaffen, die sie wollen. Dazu gelangen sie einfach solange nicht, wie sie daran festhalten, ihre Konkurrenz gegeneinander bei der Befriedung des Balkans als Gemeinschaftswerk zu organisieren, sich somit weigern, ihre jeweiligen Einmischungs- und Ordnungsinteressen allein und damit offen gegeneinander durchzusetzen und die notwendigen Gewaltmaßnahmen ohne berechnende Rücksichtnahme aufeinander in die Wege zu leiten.
Diesen Konflikt zwischen dem von ihnen praktisch wahrgenommenen Aufsichtsrecht einerseits und dem ausbleibenden schlüssigen Nachweis einer auch erfolgreich in die Tat umgesetzten Aufsichtsnahme andererseits nehmen die in Jugoslawien engagierten Mächte dann auf ihre Weise wahr. Allesamt beklagen sie die bittere „Ohnmacht“, die sie bei ihren Maßnahmen der Friedensstiftung erfahren müßten, kritisieren die Folgenlosigkeit ihrer Gewaltmittel vor Ort – und gelangen von da aus zu der Forderung nach einem überzeugenden Beweis ihrer Macht. Konkret durchsetzen wollen sie dabei überhaupt nichts. Die Gewaltmaßnahmen, die sie ins Auge fassen, mögen sich zwar gegen „die Serben“ als den gemeinsam ausgemachten Hauptschuldigen am Ausbleiben des „Friedens“ richten. Aber ihr Zweck ist nicht, mit ihnen gegen „die Serben“ eine „Friedenslösung“ zu erzwingen, sondern viel grundsätzlicherer Art: Sie sind sich den Beweis ihrer Macht schuldig, ihre Gewalt soll endlich ihrem Recht Geltung verschaffen, und diesem Bedürfnis ganz entsprechend kürzen sich ihre außenpolitischen Ambitionen in Jugoslawien auf ihren abstraktesten Grundsatz und Inhalt zusammen: Eigene „Schritte zur Eskalation“ des Kriegs empfehlen sich als Methode, die angemaßte Ordnungskompetenz auch wirklich unwidersprechlich zu machen.
In diesen „Schritten“ – so nett heißen Bomben, wenn Staaten sich um ihre Rechte sorgen – sehen z. B. frustrierte UNO-Generäle aus Frankreich, die entweder die pausenlose „Erniedrigung“ der doch in so hohem Auftrag vor Ort befindlichen Weltgemeinschaft oder die ihrer Grande Nation nicht mehr aushalten mögen, das politische Gebot der Stunde. Aber natürlich auch die auftraggebenden Mächte der UNO selbst, und zwar jede für sich, so daß es schon wieder sehr auf ihre „Einigkeit“ ankommt und die Frage, wer von ihnen mit wem und in welchem Verband in Jugoslawien einmal so richtig gescheit hineinschlagen soll, zum beherrschenden Thema ihrer Beschlußfindung zur gemeinsamen Außenpolitik wird.
Ob sie sich diesbezüglich auf etwas einigen, wird man sehen. Sie jedenfalls waren sich auf ihrer jüngsten NATO – Tagung im Prinzip sehr einig darüber, daß sie um ihrer „Glaubwürdigkeit“ willen Bosnien ein bißchen Luftkrieg schuldig sind. Interessanterweise sind sie auf dieses Vertrauensdefizit nicht bei der Prüfung ihrer Auftragslage im Fall Jugoslawien gestoßen. Bei ihren Bemühungen, die Hinterlassenschaften der Sowjetunion, diese bedingt bis vollständig unbrauchbaren, unhandlichen und unberechenbaren Gebilde des ehemaligen sozialistischen Lagers wirksam ihrer Aufsicht zu unterstellen, haben sie die große Herausforderung für die Zukunft ihrer Allianz und dafür entdeckt, auch weiterhin gemeinsame „Bündnis“-Politik zu machen – und dabei haben sie so ungefähr dieselbe Aufgabe auf sich zukommen gesehen wie in Jugoslawien, freilich in größerem Maßstab. Für die Imperialisten ist Jugoslawien eben nur ein Fall, und sie wissen selbst am besten und sagen es auch frei heraus, wofür Jugoslawien ein Fall ist: Wem Bomben auf „serbische Stellungen“ als Ausweis eigener Glaubwürdigkeit ausgerechnet dann einfallen, wenn er gerade dabei ist, das Aufsichtsgebiet seiner Kriegsallianz nach Osten auszudehnen, der weiß, daß dort die nächsten Etappen in der Konkurrenz der Weltaufsichtsmächte zur Entscheidung anstehen. Der will die Entschlossenheit zur Wahrnehmung des westlichen Monopols auf Weltherrschaft gerade gegenüber der Macht demonstrieren, die von dem alten großen Feind nicht nur die Machtmittel und einen Sitz im Weltsicherheitsrat geerbt hat, sondern schon wieder Anzeichen eines eigenen – russischen diesmal – Behauptungswillens zu erkennen gibt, sich also als neuer großer Feind aufzubauen droht. Und er will zugleich bedeuten, wie er alle diese Ordnungsfälle der „neuen Weltordnung“ im Prinzip in Griff zu nehmen gedenkt: Wie im Fall Jugoslawien eben, in Bündnis & Partnerschaft mit den Konkurrenten, also im Wege von deren Instrumentalisierung für das Interesse, das jeder für sich selbst verfolgt.
Die sichere Perspektive der imperialistischen Konkurrenz: Von wegen „Einigung“ und „Neue Weltordnung“
Der Stoff für die Forderung der „Partner“ nach „Einigkeit“ unter sich wird also nicht ausgehen. Aber umgekehrt wird, solange diese Forderung von ihnen erhoben wird, sich alles andere als „Einigkeit“ zwischen ihnen einstellen, und das hat einen einfachen Grund. Der hat mit Jugoslawien und den Problemen, die es für die beflissenen Stifter von „Frieden“ und „Ordnung“ aufwirft, allerdings nur wieder insoweit zu tun, als an Jugoslawien das Prinzip exekutiert wird, dem die Außenpolitik der imperialistischen Aufsichtsmächte verpflichtet ist und um das sich ihre Konkurrenz dreht. Landläufig bekannt und gleichermaßen für selbstverständlich in Ordnung befunden ist dieses Prinzip unter dem Namen des „außenpolitischen Rechts“, das Nationen für sich beanspruchen. Eher weniger bekannt ist jedoch, was mit diesem Rechtstitel beansprucht wird und worauf sich das Recht erstreckt, wenn es – wie aktuell – bei der Etablierung einer „neuen Weltordnung“ in Anschlag gebracht wird: Nationen, die außenpolitische Rechte verfolgen, nehmen ihr nationales Interesse absolut. Sie erklären ganz prinzipiell ihre Absicht, nichts weniger als die ganze Welt für den Dienst an diesem Interesse benutzen zu wollen, und sie geben zugleich zu verstehen, daß sie dabei keine Hindernisse zu dulden gewillt sind. Sie wissen nämlich, daß die politischen Ansprüche, die sie weltweit anmelden, ein exklusives Zugriffsrecht ihrer Nation auf den Rest der Welt reklamieren und daß sie von ihrem Recht andere Nationen ausschließen, die genau so, wie sie selbst es tun, außenpolitische Rechte in ihrem heiligen nationalen Interesse geltend machen. Da es ihnen allen zusammen um dasselbe Prinzip geht, wonach die Welt ausschließlich ihrem eigenen Nationalinteresse zu dienen hat, bestreiten sie sich wechselseitig das Recht, das sie anmelden; jedes Fitzelchen an „politischem Einfluß“ oder „weltpolitischem Gewicht“, das sie erlangen mögen, geht auf Kosten eines oder aller anderen Konkurrenten um diese heiße Ware, will also auch immer gegen sie erkämpft sein. Und was man in diesem Kampf vermag, entscheidet dann in letzter Instanz darüber, wer sich zu den ganz wenigen Weltmächten rechnen darf, die – wie ihr Name sagt – die Weltherrschaft unter sich ausmachen und den Rest der Staatenwelt kontrollieren.
Um genau dieses Prinzip in seiner ganzen banalen Grundsätzlichkeit dreht sich die gewöhnliche Außenpolitik imperialistischer Mächte, aus deren Erfolgen und Rückschlägen dann das „Kräfteverhältnis“ resultiert, in dem sie zueinander stehen. Da bestimmen sie, so gut sie eben können, die „politischen Verhältnisse“, die auf dem Globus herrschen, indem sie auf Basis von im Grundsatz konsolidierten Machtverhältnissen, wie sie zwischen Souveränen existieren, ihre Macht in einer Weise geltend machen, daß der weiteren Wahrung ihres Einflusses und damit auch des Nutzens, den sie aus ihm ziehen, nichts in den Weg gelegt wird. Und wo die Souveränitätsfrage selbst nicht geklärt oder nicht in ihrem Sinne zufriedenstellend geregelt ist, schaffen sie selbst die allererste und abstrakteste Grundlage der nützlichen Beziehungen, an denen ihnen so gelegen ist: Sie stiften die „politische Ordnung“, die sie benutzen wollen, in Form von souveränen Gewalten, die für sie benutzbar sind. Wenn sich die „politischen Verhältnisse“, die sie mit ihrer außenpolitischen Einflußnahme kontrollieren, ohne ihr unmittelbares Zutun ändern; wenn eine ganze „Weltordnung“ und mit ihr reihenweise Staaten zusammenbrechen, die in ihr ihre Lebensgrundlage hatten; dann sind die imperialistischen Nationen mithin nicht nur mit einer neuen Lage konfrontiert. Vielmehr sehen sie sich in die Pflicht genommen und praktisch herausgefordert. Sie reklamieren ihre Zuständigkeit dafür, die neu entstandene weltpolitische Lage neu zu ordnen, und das heißt, auf diese Lage den Einfluß auszuüben, der sie für ihr nationales Interesse tauglich macht. Und genau so treu, wie die imperialistischen Staaten sich dabei in ihrem Selbst- und Rechtsverständnis bleiben, daß die Welt von ihnen und zu ihrem Nutzen kontrolliert werden muß, so treu bleiben sie dabei auch dem Erfolgsprinzip ihrer bisherigen Außenpolitik: Auch und erst recht dort, wo es der Welt eine „neue Ordnung“ zu verpassen gilt, ist die Gewalt die allererste Produktivkraft für das Zustandekommen des politischen Einflusses, auf den sie es abgesehen haben, und zwar Gewalt in ziemlich elementarer Form.
Doch so einfach beschaffen und geradlinig dieses Interesse imperialistischer Außenpolitik seiner Natur nach ist – es erfolgreich durchzusetzen, will allemal erst noch geleistet sein. Denn dem von jeder imperialistischen Großmacht für sich reklamierten Anspruch, über exklusiv ihr zugehörige politische Einflußbereiche zu verfügen und so die Rolle der „Ordnungsmacht“ im Weltmaßstab wirksam auszuüben, steht nicht nur regelmäßig die „Lage vor Ort“ im Wege, die es für das eigene Interesse erst gewaltsam herzurichten gilt. Durchgesetzt sein will die beanspruchte Großmachtrolle vor allem gegen alle, die „Ordnungsaufgaben“ der genannten Art gleichfalls als Gelegenheit und Auftrag für sich nehmen, aus der eigenen Nation eine Weltmacht zu machen: Verwirklichen läßt sich der eigene Großmachtanspruch nur, wenn man ihn allen anderen praktisch wirksam und möglichst auf Dauer zu bestreiten versteht und ihnen Respekt vor der politischen Einflußnahme aufzwingt, die man im Namen des eigenen nationalen Interesses für geboten hält und ausübt. Und genau dies zeigt der ganze Fall Jugoslawien: Das ist der erste praktische Anwendungsfall dieser Konkurrenz, gewissermaßen die erste Probe davon, wie die „Partner“ der Weltordnung von gestern mit ihren Gewaltmitteln in den Kampf um ihre Neugestaltung einsteigen. Für jede der imperialistischen Mächte ist der Zerfall der bisherigen politischen Ordnung in dieser Region eine Herausforderung ihrer weltweit beanspruchten Ordnungskompetenz und somit ein Fall, an dem es die Konkurrenz um das Monopol auf die politische Beherrschung der ganzen Welt zu eigenen Gunsten ein Stück weiter zu entscheiden gilt. Nur dafür betreiben die Großmächte ihre Jugoslawienpolitik, oder, was dasselbe ist, betreiben in Jugoslawien gegeneinander Großmachtpolitik. Jede einzelne von ihnen erklärt sich zur Instanz der „Neuordnung“ des Balkans, weil diese den Auftakt bildet für die nach dem Zusammenbruch des östlichen Machtblocks insgesamt anstehende Neubestimmung des politischen Kräfteverhältnisses auf der ganzen Welt – und beschneidet damit dieselben Rechte, die ihre Konkurrenten jeweils für sich in Anschlag bringen. Dazu wirkt sie mit politischen und anderen Mitteln auf das Kriegsgeschehen in Jugoslawien ein, dazu versucht sie, ihre Konkurrenten auf „Einigung“, d.h. auf Unterordnung und Gefolgschaft zu verpflichten, um so an diesem Fall ein praktisches Exempel der Rolle zu statuieren, die sie generell und weit über den Balkan hinaus beansprucht: Eine politische Macht zu sein, die bestimmend auf das Einfluß nimmt, was so nett „neue Weltordnung“ heißt, die also über eigene „Machtbereiche“ verfügt, die sie nach ihrem Interesse kontrollieren und über die sie nach Bedarf und eigenem Gutdünken verfügen kann.
Als Ergebnis dieser Konkurrenz von Weltmächten um die Aufteilung der Welt in Zonen ihres politischen Einflusses wird sich also alles andere einfinden als eine „neue Weltordnung“, in der jede der konkurrierenden Mächte ihr Interesse positiv aufgehoben sehen kann, denn der Einfluß der einen schließt den der anderen aus. An die Vorstellung einer gemeinsamen Stiftung dieser „Weltordnung“ halten sich diese Mächte nur solange, wie sie ihre Konkurrenz in dem vergleichsweise zivilisierten Bemühen um diplomatische „Einigung“ untereinander abwickeln, weil sie sich keine Entscheidung zutrauen. Daß dies kein dauerhafter Zustand bleiben kann, ist keine Prognose: Solange es mehr als eine Weltmacht gibt, ist für alle imperialistischen Konkurrenten die Welt überhaupt nicht in Ordnung. Davon ist Jugoslawien erst der Anfang.
[1] Der folgende Artikel befaßt sich ausdrücklich mit der Funktion, die der Krieg auf dem Balkan für die Nationen besitzt, die sich der Pflicht zum Weltordnen verschrieben haben. Es demonstriert die Folgen, welche die als selbstverständlich angesehene Anmaßung ihrer Zuständigkeit für den Zynismus von Weltmächten hat, die ihrem angeblichen Zuschauen jetzt ein Ende bereiten wollen. An anderer Stelle in diesem Buch ist von Tätern und Opfern auf dem jugoslawischen Kriegsschauplatz ausführlich die Rede – allerdings ohne das Verständnis, das die auf Kontrolle und Intervention so erpichten Demokraten auf die Kriegsparteien verteilen.