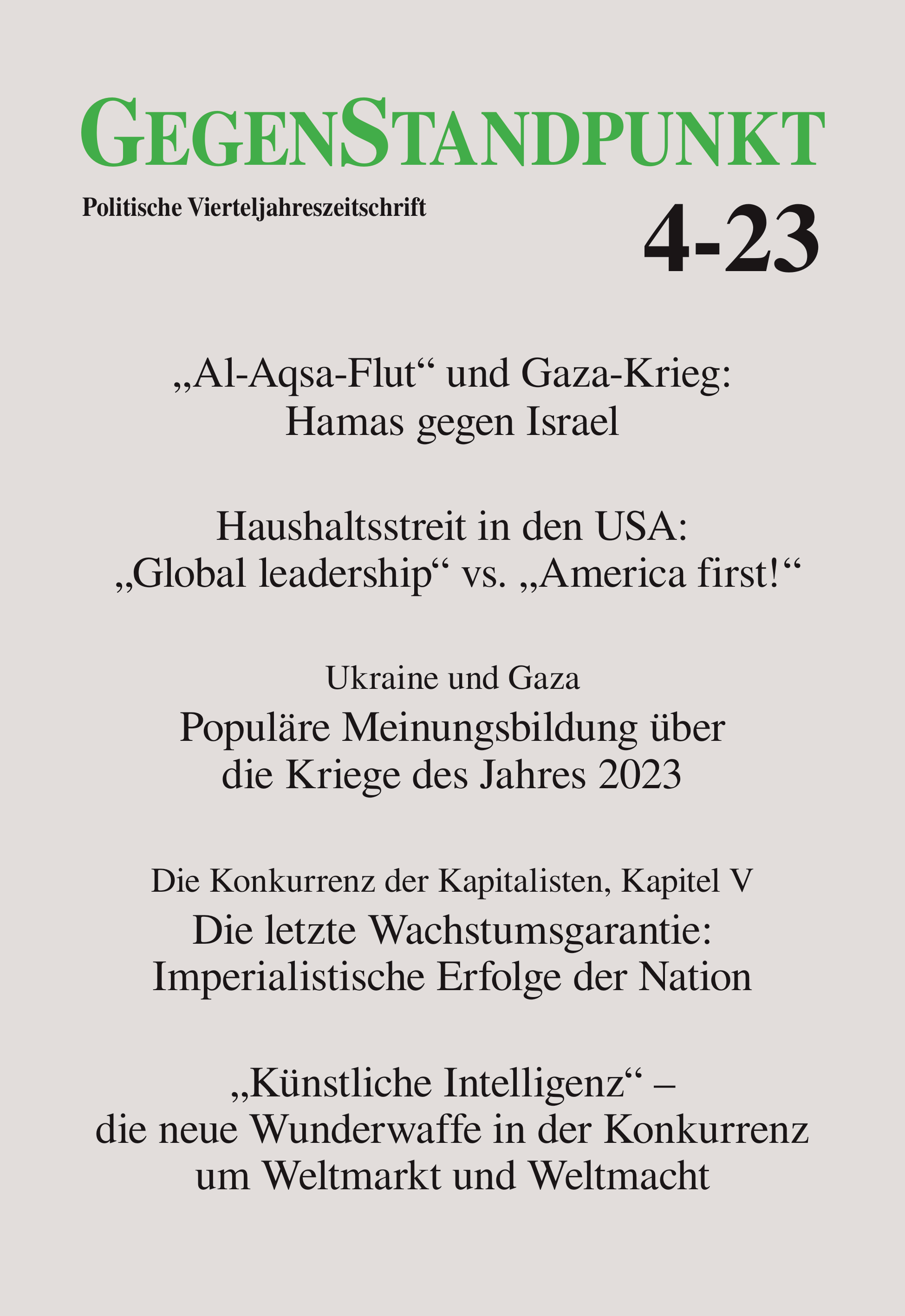Die Konkurrenz der Kapitalisten
Kapitel V: Die letzte Wachstumsgarantie: Imperialistische Erfolge der Nation (§ 25, § 26, § 27)
Es ist vollbracht. Auf der ganzen Welt sind Natur und Mensch zu Produktivkräften des Kapitals hergerichtet. Bis in den letzten Erdenwinkel hinein sind Charaktermasken des Kapitals tätig sowie Massen, die in Abhängigkeit vom Wachstum ihre mehr oder minder nützliche Armut bewältigen. Geschäft und Gewalt wirken unablässig auf die Subsumtion aller Lebensregungen unter das Bedürfnis nach Geldvermehrung hin, die Konkurrenz treibt die maßgeblichen Akteure zur permanenten Reform. Sodass sie immer wieder und überall positive Bedingungen für das unverzichtbare Wachstum vorfinden.
Diese Bemühungen verursachen nicht nur ansehnliche Opfer, die in der gebotenen Differenzierung von den Medien katalogisiert werden. Sie lassen bei den Verantwortlichen auch nicht die Ruhe eintreten, die nötig wäre, die Widersprüche und Schranken zu gewahren, die ihrem Treiben einbeschrieben sind. Selbst wenn sie eine Krise zur Kenntnis nehmen, also einen allgemeinen Einbruch der Geschäfte diagnostizieren, steht für sie fest, dass man ihnen ihre Geschäftsbedingungen verdorben hat, vorenthält.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Siehe auch
Systematischer Katalog
Gliederung
- § 25 Das Recht auf Wachstum und seine Mittel: einerseits verbrieft, andererseits unzureichend eingelöst
- § 26 Der ideale Markt: Besitzstand mit Erfolgsgarantie
- § 27 Die Bedingung für alles: Souveräne Gewalt ...
Die Konkurrenz der Kapitalisten
Kapitel V [1]
Die letzte Wachstumsgarantie: Imperialistische Erfolge der Nation
Es ist vollbracht. Auf der ganzen Welt sind Natur und Mensch zu Produktivkräften des Kapitals hergerichtet. Bis in den letzten Erdenwinkel hinein sind Charaktermasken des Kapitals tätig sowie Massen, die in Abhängigkeit vom Wachstum ihre mehr oder minder nützliche Armut bewältigen. Geschäft und Gewalt wirken unablässig auf die Subsumtion aller Lebensregungen unter das Bedürfnis nach Geldvermehrung hin, die Konkurrenz treibt die maßgeblichen Akteure zur permanenten Reform. Sodass sie immer wieder und überall positive Bedingungen für das unverzichtbare Wachstum vorfinden.
Diese Bemühungen verursachen nicht nur ansehnliche Opfer, die in der gebotenen Differenzierung von den Medien katalogisiert werden. Sie lassen bei den Verantwortlichen auch nicht die Ruhe eintreten, die nötig wäre, die Widersprüche und Schranken zu gewahren, die ihrem Treiben einbeschrieben sind. Selbst wenn sie eine Krise zur Kenntnis nehmen, also einen allgemeinen Einbruch der Geschäfte diagnostizieren, steht für sie fest, dass man ihnen ihre Geschäftsbedingungen verdorben hat, vorenthält. An die Adresse des Staates in seiner Eigenschaft als Standortverwalter gerichtet nimmt sich diese Beschwerde einerseits wie die nachdrückliche Wiederholung all der „Anträge“ aus, die von Kapitalisten an Staaten als ihre Dienstleister so ergehen. Andererseits erinnern diese Anträge die Regierenden an etwas ganz anderes: Angesichts der – von ihnen selbst betriebenen – Internationalisierung des Geschäfts sind sie darauf angewiesen, dass auch unter der Regie anderer Souveräne tätiges Kapital als Quelle ihrer Macht taugt. Während sich Kapitalisten und Spekulanten dank ihrer Mobilität als eine Instanz gebärden, die ihre Gunst auf die ihrem Gewerbe dienlichen Standorte verteilt, befassen sich die solchermaßen geprüften Souveräne mit der Regierungskunst von ihresgleichen, der sie Respekt, Einfluss und Kontrolle zuteilwerden lassen. In dieser Branche fungiert das Kapital als Instrument der Nation, deren Kredit als Waffe, und ihre Waffen verschaffen Kredit.
§ 25 Das Recht auf Wachstum und seine Mittel: einerseits verbrieft, andererseits unzureichend eingelöst
Der Konkurrenzerfolg der Kapitalisten steht und fällt mit den imperialistischen Qualitäten ihrer Nation. Denn wenn alles fertig ist – das Gemeinwesen im Innern wohl geordnet, die Welt fürs Wachstum des kapitalistischen Reichtums im Land zu- und hergerichtet –, ist noch überhaupt nichts fertig. Alle berechtigten Fragen und Forderungen, die die ökonomisch herrschende Klasse zu stellen hat, zusammengefasst: ihr Anspruch auf Erfolg, sind noch oder nun erst richtig offen. Ihre Kritik, der harte Kern und die letzte Wahrheit aller Unzufriedenheit, die die Geschäftstätigkeit der Kapitalisten von Beginn an begleitet, drückt das klar und deutlich aus: Es ist ja schön und gut, dass Natur und Gesellschaft als Ressource für ihre Bereicherung funktionalisiert sind; ob die aber auch funktioniert, wie sie soll, ist zweifelhaft; und das nicht erst dann, dann aber erst recht und ganz offensichtlich, wenn gut eingefädelte Geschäfte misslingen und am Ende Krise eintritt; Risiko bis zur Existenzgefahr fürs investierte Geld besteht immer. Der Staat hat die Macher der Wirtschaft dazu ermächtigt, die Welt als Geschäftsfeld in Gebrauch zu nehmen, hat sie von den Schranken des Wachstums befreit, die er mit seiner begrenzten Größe selbst darstellt; damit hat er ihnen aber die Notwendigkeit eingebrockt, die Konkurrenz gegen ihresgleichen in der ganzen Welt zu bestehen. Er unterstützt sie mit seinen Mitteln, seinem Recht und seinem Haushalt, in ihren Bemühungen um Wachstum und immer mehr Wachstum; deren Schlagkraft hat er damit aber von seinen Bilanzen abhängig gemacht und von Abrechnungen von nationaler und internationaler Reichweite, die selbst die großen Konzerne nicht im Griff haben. Kurz: Die Staatsgewalt setzt ihre Profitmacherei ins Recht; ob sie Profit machen, steht dahin.
Der Grund dieser Unzufriedenheit ist schlicht und einfach: Alle staatlicherseits bereitgestellten Konkurrenzbedingungen sind ebendas und keine Erfolgsgarantie. Genau das ist auch schon der ganze Inhalt der Kritik, die aus dieser Erfahrung folgt und in der die Öffentlichkeit des bürgerlichen Gemeinwesens den Vertretern der Kapitalistenklasse nur recht geben kann. Beurteilt wird der kommerzielle Erfolg der Nation im Lichte des Anspruchs, dass alles gelingt; und der wird durch die wirklichen Ergebnisse – egal ob statistisch ermittelt oder parteilich hochgerechnet, pauschal bilanziert oder an sachgerecht ausgewählten Einzelbeispielen vorgeführt – meist gar nicht und nie wirklich eingelöst. Messlatte sind nicht die mehr oder weniger tauglichen Mittel, mit denen die Staatsmacht ihre Wirtschaft ausstattet und agieren lässt, sondern der Standpunkt, dass die Höchste Gewalt, wenn sie schon pflichtgemäß alles tut, um dem Land und seinem Reichtum sachgemäß zu dienen, und dafür auch Opfer nicht scheut, dann aber auch dafür zu sorgen hat, dass das alles sich lohnt. Die nationale Gretchenfrage heißt: Wie stehen WIR da, in der Staatenwelt und im kritischen Urteil der Weltgeschichte?! Auskünfte über politische Bemühungen und Zwischenergebnisse sind da keine Antwort: Die Nation will Erfolge sehen.
Kapitalistisches Wachstum, national: materieller Inhalt und Zweck des Kampfes der Staaten um ihre Souveränität
Diesen Standpunkt und Anspruch teilt die Staatsgewalt; und sie gibt ihm den imperialistischen Inhalt. Schließlich hat sie mit ihrem Einsatz für den freien Zugriff ihrer kapitalistischen Bourgeoisie auf die heimischen und die Ressourcen der Welt bewusst und zielstrebig nicht bloß ein prominentes Partikularinteresse bedient, sondern Arbeit und Leben ihrer Gesellschaft und ihre eigene materielle Existenz davon abhängig gemacht, dass ihr nationaler Standort die internationale Konkurrenz ums kapitalistische Wachstum besteht. Die erfolgreiche Bereicherung der herrschenden Klasse ist kein vom Gemeinwohl trennbares oder auch nur sinnvoll unterscheidbares Staatsanliegen neben anderen, sondern die Existenzgrundlage von Volk und Herrschaft, ihr Gelingen der erste Inhalt gesicherter nationaler Souveränität. Es ist daher mehr als Heuchelei – oder eine, die die Sache trifft –, wenn die Kapitalistenklasse sich für ihr Recht auf Erfolg und eine entsprechende hoheitliche Erfolgsgarantie auf die Nation als den wahren Inhalt ihres eigennützigen Bemühens beruft.
Es trifft allerdings genauso die Sache, wenn der Staat umgekehrt den Kapitalisten seinen Gesamterfolg im Kräftevergleich der Nationen als den wahren Inhalt und letzten Zweck ihrer marktwirtschaftlichen Wachstumserfolge vorbuchstabiert und sie auch gegen ihre speziellen Sonderinteressen dafür in Anspruch nimmt. Denn für ihn ist das globale Geschäftsleben der zivile Schauplatz seiner Konkurrenz gegen seinesgleichen um die Bewältigung des Widerspruchs, der für ihn aus der Internationalisierung des kapitalistischen Geschäftslebens folgt. Er braucht die Staatenwelt als Quelle des Wachstums, von dem er lebt; gemäß seinen Erfolgsansprüchen nimmt er sie dafür in Gebrauch. Damit macht er sich zugleich davon abhängig, dass die anderen Länder seinen Interessen genügen können und seinen Rechtsansprüchen genügen wollen. Dieser Widerspruch zwischen notwendigem Zugriff auf und Abhängigkeit von Leistungen anderer Souveräne ist für den Staat die entscheidende Herausforderung: Der muss er sich stellen, die muss er im Dienst an seinem nationalen Kapitalismus mit der Gewalt, die er über seinen Standort hat und aus dessen Beherrschung gewinnt, bewältigen. In letzter Instanz geht es bei jedem seiner Eingriffe in die politische Ökonomie seines Landes nicht nur um deren immanent sachgerechte Gestaltung, sondern zugleich um die Kontrolle über die Existenzbedingungen seiner Herrschaft; im Einzelfall zwar immer im Verhältnis zu der Bedeutung, die die Regierung einer strittigen Sache beimisst, im Prinzip aber allemal um nichts Geringeres als die Festigkeit der politischen Macht und insofern um das höchste der politischen Güter: die nationale Sicherheit. Gefordert ist der erfolgreiche Einsatz aller Machtmittel, auch der Macht des Geldes, für die gesicherte Hoheit über alle Bedingungen, von denen der Staat seine materielle Existenz abhängig macht.
Zum Aufgabenkatalog, der sich daraus ergibt, gehört – in aufsteigender Abfolge – als Erstes die politische Beherrschung der freien Weltmärkte, auf denen sich die Konkurrenz der Helden des kapitalistischen Wachstums entscheidet. <§ 26> Die Garantie einer sachgerechten Freiheit der Märkte bedarf zweitens der Absicherung durch einen Gewaltapparat, der keinerlei Behinderung der staatlichen Handlungsfreiheit im Innern zulässt und dem Rest der Welt die vitalen Interessen der Nation nötigenfalls per militärische Abschreckung vorbuchstabiert. <§ 27> Auf der Basis einer solchen Sicherheit wird drittens der Segen des internationalen Kreditgeschäfts zu einem weitgehend vorentschiedenen, dennoch im Normalfall umsichtig, im Ausnahmefall rigide zu führenden zivilen Kampf um Ent- und Aneignung der kapitalistischen Lebensmittel fremder Länder. <§ 28> Dieser Kampf macht, viertens, für alle Länder die Kosten der Freiheit zu einem Härtetest, der im Innern die geltende Staatsräson infrage stellen kann, nach außen hin für die einen die Notwendigkeit eines Umsturzes der herrschenden Kräfteverhältnisse, für andere die eines Monopols auf Weltordnungsmacht auf die imperialistische Tagesordnung setzt. <§ 29> Das ultimative Gewaltverhältnis einer vollendeten Weltherrschaft heißt – zum Fünften – „Weltfrieden“, weil es definiert und dekretiert, was dafür an Kriegen nötig und was nicht erlaubt ist; wie hoch also am Ende die Kosten der Freiheit ausfallen, die der imperialistische Staat die Welt zahlen lässt, damit das globale System der Konkurrenz der Kapitalisten Bestand hat. <§ 30>
§ 26 Der ideale Markt: Besitzstand mit Erfolgsgarantie
Auf den Weltmärkten entscheidet sich die Konkurrenz der Kapitalisten; und nicht nur die. Die nationale Bilanz ihrer Erfolge entscheidet über das Wirtschaftswachstum, absolut und im Verhältnis zu den anderen Nationen, von dem der Staat mit der Öffnung seiner Grenzen fürs kapitalistische Geschäft sich und sein Land abhängig gemacht hat. Auf deren Markterfolg, individuell und kollektiv, kommt es also an für die Überlebens- und Durchsetzungsfähigkeit der Staatsgewalt und für das Gemeinwohl ihrer Klassengesellschaft. Die Weltmärkte dürfen daher nicht bleiben, was sie sowieso nur in der Wahrnehmung der Anwälte und gläubigen Anhänger einer strikten Trennung von Politik und Ökonomie und eines freien Wettbewerbs sind: Sphären eines kommerziellen Kräftemessens mit offenem Ausgang zwischen Unternehmen aus aller Herren Ländern. Zwingend geboten ist ihre Ausgestaltung durch die Staatsmacht gemäß dem Ideal garantierter Erfolge, wie es im Grunde jedem Kapitalisten vorschwebt, wenn er sein Vermögen als Vorschuss aufs Spiel setzt und dabei von der Identität von Produktion und Verkauf, Investition und Rendite ausgeht.
In diesem Ideal ist der Staat sich mit seiner herrschenden Klasse absolut einig. Für ihn geht es hier um die glückliche Auflösung des Widerspruchs zwischen Abhängigkeit und souveräner Herrschaft über seine Existenzbedingungen, in den er sich mit der Internationalisierung der Zugriffsmacht seiner Wirtschaft verwickelt hat. Dementsprechend mustert und handhabt er die Mittel, die die Nation ihm erwirtschaftet: als Instrumente für sein herrschaftliches Recht auf sichere Durchsetzung seiner vitalen Interessen; mit dem Ziel, die Konkurrenz auf dem Weltmarkt, soweit er den braucht und weil er davon abhängt, in den Griff zu kriegen.
Sein Mittel sind als Erstes die Konkurrenzerfolge, die seine Wirtschaft auf den Weltmärkten hingekriegt bzw. zu denen er sie befähigt hat. Das ist zirkulär, unterstellt nämlich immer schon den Einsatz staatlicher Macht im Innern und nach außen und ein Operieren mit dessen Ergebnissen. Aber so funktioniert eben nationaler Kapitalismus, in dem ökonomische und politische Interessen und Potenzen nicht mehr unterschieden sind. Der Staat will also, fördert, stiftet nötigenfalls Konkurrenzmacht durch Fortschritte in Technologie und Produktivität, durch Monopole und schiere Größe des Kapitals unter seiner Herrschaft. Über die Konkurrenzerfolge einzelner Konzerne hinaus braucht und forciert er ein Wachstum in nationalem Maßstab, das nicht bloß mit seiner Rate imponiert, sondern mit dem Übermaß seiner Masse die Weltmärkte okkupiert und die Bewirtschaftung auswärtiger Investitionssphären nicht bloß gestattet, sondern zwingend macht. Wenn der Staat sich dabei nicht einem unbeherrschbaren Sachzwang aussetzt, soweit er vielmehr seine Freiheit wahrt, sich seine Geschäftspartner in der Welt ganz nach eigenem Vorteil auszusuchen, kommt er seinem Ideal einer Erfolgsgarantie für die nationale Benutzung des Weltmarkts schon ziemlich nahe. Für das komplementäre Bemühen, den eigenen Herrschaftsbereich für auswärtige Kapitalisten und andere Staaten interessant bis unwiderstehlich zu machen, erweist sich ebenfalls die Quantität des akkumulierenden Reichtums, aber auch schon die schiere Masse der prinzipiell verfügbaren Reichtumsquellen als wesentlicher Faktor im Qualitätsvergleich der Nationen: Natürlich unter der Bedingung einer einigermaßen flächendeckenden kapitalistischen Benutzung, aber sogar schon in der Perspektive, dass die in Gang kommen soll und kann und beginnt, wird eine Bevölkerungszahl beträchtlicher Größe als Produktivkraft und Kaufkraft verbucht und gibt einen qualitativen Zuwachs an staatlich verfügbarer Wirtschaftsmacht, an Fähigkeit zur Einflussnahme auf die weltweiten Handelsströme her. Hinreichend große Massen von wirklichen und möglichen Proletariern und Konsumenten sind nicht bloß attraktiv; an denen kommen die Kapitalisten der Welt gar nicht vorbei; deswegen die Staaten auch nicht an den Interessen der zuständigen Herrschaft.
Was der Staat in diesem Sinn als seinen weltwirtschaftlichen Besitzstand zu verbuchen hat, setzt er als sein Konkurrenzmittel ein. Als Erstes mit dem Ziel, alles, was seine Wirtschaft international erreicht hat, als sein Recht festzuschreiben. Das ist der erste Leitfaden einer imperialistischen Staatsmacht für alle Abmachungen, mit denen sie den freien Welthandel überhaupt eröffnet. Der dazugehörige zweite ist der diplomatische politische Angriff auf alles, was ihre Kontrahenten an Erfolgen errungen haben und als ihr Recht reklamieren. Nichts vom Stoff und von den Methoden des kommerziellen Verkehrs zwischen den Nationen bleibt da einem irgendwie selbsttätigen Gang der freigegebenen Konkurrenz überlassen. Das fängt an mit der hoheitlichen Einflussnahme auf die Preise, zu denen Waren zwischen den Nationen gehandelt werden, und dem bi- und multilateralen Streit darum – immerhin ergeben sich daraus die berühmten „terms of trade“ –; bei Rohstoffen ist die Aushandlung der Preise überhaupt ein Kräftemessen zwischen Förderländern, die im Wesentlichen ihre exklusive Verfügungsmacht über landeseigene Bodenschätze und sonstige Naturbedingungen zu Geld machen wollen, und Importnationen, dank deren Kaufkraft und in deren Industrien daraus überhaupt erst kapitalistischer Reichtum entsteht. Für kapitalistisch produzierte Waren, mit denen Kaufleute aus verschiedenen Ländern einander Konkurrenz machen, wird um Vergleichbarkeit gestritten, werden Qualitäts- und andere Normen festgelegt, an denen die Konkurrenz sich orientieren muss; werden auch Vorgaben für kostenwirksame Produktionstechniken und ‑bedingungen erlassen, die eingehalten werden müssen, inklusive Regeln für Verfahren zur Ermittlung einschlägiger Kriterien und Daten. Das alte Konzept des Schutzzolls findet da vielfältige Verwendung speziell seitens der fortschrittlichsten Länder, damit ihre Sozial- oder Umweltgesetze nicht am Ende auswärtige Produzenten begünstigen, die nicht unter der Last menschenfreundlicher Rücksichten zu leiden haben. Zwischen gleichrangigen Industrienationen geht es erst recht darum, in zahllosen Details der Normierung von Produkten und Herstellungsverfahren die Diskriminierung fremder Waren durchzusetzen, die eigener abzuwehren; und bevor man zur Sache kommt, müssen natürlich Regularien für die Definition von kontroversen Auffassungen gefunden werden. Regulierung und Deregulierung sind Instrumente zur rechtsförmigen Beherrschung der Weltmärkte, um die es den Staaten geht. Für ihre zähen Kämpfe an dieser zivilen Front gehen sie Bündnisse ein; mit wechselseitigen Verpflichtungen untereinander und gemeinsamen Vorkehrungen zur Diskriminierung Dritter, bis hin zum Ausschluss unliebsamer Konkurrenz von gemeinsamen Märkten durch ganz sachorientierte Maßnahmen wie Zulassungsverfahren und andere „nicht-tarifäre Handelshemmnisse“; die sind eben nicht bloß ein Dienst an privilegierten Unternehmen, sondern Waffen der politischen Verfügung über die Weltmärkte, an denen es alltäglich um Details der allgegenwärtigen nationalen Erfolgsfrage geht. Das Ideal des Freihandels geht darüber nicht verloren. Es existiert in der vornehmen Gestalt der Meistbegünstigung, die die Handelsnationen einander gewähren. Die Praxis dieser „Klausel“, die Realität des diskriminierungsfreien Welthandels, besteht in Schiedsgerichten, die über die Konsequenzen von Vertragsverletzungen zu entscheiden haben und deswegen selbst, nämlich hinsichtlich ihrer Zusammensetzung und ihrer Kompetenzen, ein gewichtiger Streitgegenstand zwischen den auf einseitigen Nutzen bedachten, dafür aber auf Konsens untereinander angewiesenen Parteien sind. Seine höchste Stufe erreicht dieser imperialistische Widerspruch einer einseitig nützlichen einvernehmlichen Weltmarktordnung in der WTO, die dem Dauerstreit der Mächtigen um das Regime über den Welthandel die Form einer weltweit gültigen Rechtsordnung verleiht. Diese Ordnung lebt in der Realität vom höchst ungleich verteilten Erpressungspotential der Mitglieder, organisiert also deren permanentes Kräftemessen; auch dies mit Hilfe von Schiedsgerichten, die so gut funktionieren, wie es den wirklichen Machern der Weltmärkte passt.
Daneben baut der imperialistisch engagierte Staat seine materielle Verfügungsmacht über Handel und Wandel im Weltmaßstab auf und aus; mit allem, was sein Reichtum hergibt. Er baut Handelswege – Häfen, Kanäle, Pipelines –; nicht nur, weil seine Welthändler das brauchen und Bedarf anmelden, sondern um mit einer weltumspannenden Infrastruktur, die ihm gehört – und die auch im Fall ihrer Privatisierung sein politisches Eigentum bleibt, jedenfalls unter seinem Schutz steht –, seine Dominanz über den Welthandel, den gegenwärtigen und jeden zukünftigen, her- und sicherzustellen. Globale Informations- und Zahlungssysteme, die die wichtigen Finanzmärkte miteinander und mit dem Rest der Welt verbinden, gehören dazu, samt Unterwasserkabeln und Satelliten, Technologie und Empfangsstationen, Hardware und Software. Natürlich ist das alles für seine Belange nur so viel wert, wie seine Kontrahenten dabei mitmachen, funktioniert daher so gut, wie die anderen Nationen für ihre Zwecke darauf angewiesen sind, sich unter der Regie der führenden Mächte vernetzen zu lassen. Praktische Dienstleistung fürs globale Geschäftsleben bedeutet auf jeden Fall handfeste Kontrolle über die anderen Staaten, die sich auf den Weltmärkten als die wirklichen Subjekte ihres nationalen Kapitalismus betätigen.
Das Kreditgeld der Nationen ist beides, ungeschieden: die reale Bilanz des nationalen Kapitalismus, so wie sie dem Staat unmittelbar zur Verfügung steht, und das Mittel sowie das Maß aller Mittel, über die er verfügen kann; der Stoff, in dem der Geschäftserfolg der Nation als Recht, nämlich als Zugriffsrecht auf den Reichtum der Welt existiert, und deswegen zugleich die materielle Macht zur Schaffung aller Einrichtungen, die die Staaten für ihren Geschäftsverkehr brauchen. In der Qualität des Geldes existieren zusammengefasst, verdinglicht und quantifiziert der Besitzstand der am Welthandel beteiligten Staaten und die darin enthaltene – tatsächlich sehr bedingte – Erfolgsgarantie.
Die Macht des guten Geldes, der rechtsförmig ordentliche Zugriff auf den Ablauf des Welthandels und die materielle Produktivkraft der Länder, die die Weltmärkte technisch in Gang halten, kommen beispielhaft zusammen in der Konkurrenz der imperialistischen Mächte um die Beherrschung des Weltmarkts für Energie, das absolut unentbehrliche materielle Geschäfts- und Lebensmittel aller Nationen, und erst recht im Ringen um dessen Umstellung von fossilen Rohstoffen auf industriell erzeugte Energieträger. Da wird immerhin schon ziemlich weitgehend über das künftige kapitalistische Schicksal der Welthandelsnationen entschieden; deswegen auch mit ganz viel Nachdruck der „menschengemachte Klimawandel“ wie ein unabweisbarer Sachzwang für diplomatische Überzeugungsarbeit und für Abkommen in Anspruch genommen, die gleich die ganze Staatenwelt auf neue industriepolitische Zielsetzungen im gewünschten Sinn festlegen sollen. Deswegen ist zugleich die Totalrevision dieses Geschäftszweigs am nationalen Standort ein prominenter Fall aus dem Katalog der Aufgaben, die der Staat für seinen Kampf um Weltmarkterfolg im Innern seines Kapitalstandorts zu bewältigen hat. Überhaupt und ganz generell jedoch muss die nationale Wirtschaft mit ihrer Produktivkraft und ihrem überakkumulierten Reichtum in die Lage versetzt und von der Politik darauf ausgerichtet werden, den kapitalistischen Fortschritt auf der Welt mitsamt allen Konsequenzen für den Welthandel und dessen staatliche Subjekte maßgeblich zu bestimmen, mindestens mitzubestimmen; die Anforderungen nur auszuhalten, ist schon zu wenig. Das sind dem Inhalt nach Erfordernisse, auf die die Zuständigen schon in ihrem Dienst an den berechtigten Interessen ihrer Kapitalistenklasse stoßen bzw. von deren Vertretern gestoßen werden. Der Kampf der Nationen um ihre vitalen Interessen, die in der Weltmarktkonkurrenz auf dem Spiel stehen, begründet aber die unbedingte Notwendigkeit, von Staats wegen im eigenen Land mit allen Mitteln für Fortschritt und Konkurrenzmacht mit Erfolgsgarantie zu sorgen. Dafür muss die Klassengesellschaft Weltrekordmäßiges leisten, ihre Arbeits- und Lebensweise bedarfsgemäß umstellen und überhaupt alles mit sich machen lassen. „Sand im Getriebe“, gar so etwas wie Widerstand kann die Staatsmacht da gar nicht brauchen.
Hier ist Kompromisslosigkeit gefragt, also die Nation mit der Frage konfrontiert, wie es im Innenleben der Bürgerschaft um ihre Disziplin und die Festigkeit ihrer Herrschaft, nach außen hin um ihre Wehrhaftigkeit bestellt ist.
§ 27 Die Bedingung für alles: Souveräne Gewalt ...
Damit die Staatsgewalt ihren Dienst am nationalen Kapitalwachstum und für die Beherrschung der Märkte so verrichten kann, wie die Interessen der Nation es verlangen, muss es ihr unbedingt um sich gehen: um die unanfechtbare Hoheit über ihr Volk nach innen; nach außen um die gesicherte Respektierung ihres politischen Willens durch die Regierungen der Länder, von deren Leistungen sie ihre Ökonomie, insofern also auch sich selbst abhängig gemacht hat. Mit dieser Notwendigkeit bekommt das widersprüchliche Verhältnis zwischen Staat und Kapital seine endgültige Fassung: Um seiner herrschenden Klasse zu ihrem definitiven Erfolg zu verhelfen, muss der Staat sich von deren Gewinnansprüchen, von den partikularen Interessen seiner Konkurrenzgesellschaft überhaupt, die er in Kraft setzt und in umfassender Weise hütet, emanzipieren; nicht so, dass er sie negiert, sondern um den Eigennutz und ökonomischen Erfolg seiner Bürger für seine hoheitliche Macht auszunutzen. Dieser Widerspruch erfordert es, das Herrschaftsverhältnis als solches, also das Verhältnis zwischen politischer Gewalt und bürgerlicher Freiheit, eigens zu berücksichtigen und zum Gegenstand staatlichen Handelns zu machen. In den Beziehungen zu den auswärtigen Handels- und Geschäftspartnern der Nation wird in entsprechender Weise das Kräfteverhältnis als solches, der permanente ideelle und der praktische Macht-Vergleich mit den anderen souveränen Standortverwaltungen zum erstrangigen Sorgeobjekt der Politik.
... im Innern: Der Staat mit seinen Gesetzen und seinem Haushalt: Nutznießer und Opfer seiner Dienstleistung
Die kapitalistische Konkurrenzgesellschaft braucht, um zu funktionieren, eine übergeordnete ordnende Gewalt: eine Herrschaft, die allen gegensätzlichen Interessen, also keinem Partikularinteresse als solchem dient, sondern als höchste Instanz von allen Parteien und Akteuren im bürgerlichen Konkurrenzkampf Unterwerfung fordert. Als Quelle der Macht, die er benötigt, um als diese Instanz zu fungieren und allgemeinen Gehorsam durchzusetzen, nutzt der bürgerliche Staat die Konkurrenz seiner Bürger um Gelderwerb, also praktisch das vom systemeigenen Eigennutz getriebene Wachstum des kapitalistischen Reichtums: Aus dem bedient er sich, das braucht er also. Deswegen braucht er aber auch mehr als eine zu bloßer Unterwerfung genötigte Masse von Untertanen: Seine Macht hängt davon ab, dass die Bürger sein materiell anspruchsvolles hoheitliches Regime mit ihrem persönlichen Konkurrenzinteresse, ihrem freigesetzten Materialismus des Gelderwerbs übereinbringen. Der Gehorsam, den er seinen Leuten abverlangt, ist insofern keine einfache Sache: Er muss freiwillig erbracht werden, wie die Gegenleistung zu der Leistung der öffentlichen Gewalt, gegen alle partikularen Interessen das allgemeine Wohl des Konkurrenzsystems durchzusetzen.
Widersprüchlich ist das in mehrfacher Hinsicht.
Die Rechte, die der Gesetzgeber den freien Konkurrenzsubjekten zuteilt, legen deren Interessengegensätze nicht bei, im Gegenteil: Sie heben die systemnotwendigen Kollisionen materieller Art auf das höhere Niveau von Streitigkeiten, in denen die von Staats wegen zur Verfügung gestellte regelnde Gewalt über Siege und Niederlagen bestimmt. Mit dieser Dienstleistung – einem unendlich ausbaufähigen Gesetzeskodex und einem über etliche Instanzen sich selbst kontrollierenden Justizapparat –, die das Gegeneinander der Parteien nicht ausräumt, sondern als Rechtsaffäre reproduziert, macht die Staatsgewalt sich als dritte Partei zum Adressaten der notwendigerweise auflebenden Unzufriedenheit und Kritik; nicht nur einer Ablehnung ihres Eingreifens durch die ins Unrecht gesetzten Privatinteressen, sondern auch seitens der immer nur bedingt erfolgreichen Konfliktparteien. Denn mit den Gesichtspunkten der gesetzlichen Ordnung fällt keines der in Streit geratenen Anliegen wirklich zusammen. Wohltat und Zumutung stehen in einem ebenso widersprüchlichen Verhältnis zueinander, wenn der Staat mit seinem Haushalt seine Klassengesellschaft mit ihren großen Interessengegensätzen bewirtschaftet; und wenn er innerhalb der Klassen und Parallelgesellschaften besondere Konkurrenzinteressen fördert, ist es nicht anders: Er belebt alle vorfindlichen Antagonismen, schafft zusätzliche Streitereien über Bevorzugung und Benachteiligung, sorgt also mit seinen Unterstützungsleistungen zugleich für Unzufriedenheit und Kritik, die zwischen den Adressaten seiner Politik hin- und hergeht und sich von allen Seiten gegen seine Haushaltsführung richtet. Als Fiskus, der dafür seiner Wirtschaft, also ihren großen Machern und kleinen Anhängseln die nötigen Haushaltsmittel entnimmt, macht der Staat sich erst recht keine Freunde unter seiner zum Eigennutz angestachelten Bürgerschaft; die sammelt sich eher hinter der Leitfigur des Steuerzahlers. Entsprechendes gilt durch die gesamte Agenda des bürgerlichen Rechts-, Sozial- und Wirtschaftsstaats hindurch.
Mit seinen einschlägigen Dienstleistungen schafft der also keineswegs die Zustimmung, die er haben will. An der Unzufriedenheit, die er produziert, nimmt er von seinem Herrschaftsstandpunkt und -anspruch aus wahr, dass die Partikularinteressen, die er per Gesetz mit Rechtstiteln versorgt, ermächtigt und beschränkt, mit Haushaltsmitteln fördert und unendlich gerecht zur Kasse bittet, eben doch überhaupt nicht, schon gar nicht automatisch, mit dem Allgemeinwohl in eins fallen, für das er einsteht, geschweige denn mit der Gewalt einverstanden sind, mit der er es durchsetzt; eher suchen sie in seinem Einsatz fürs große Ganze ihren privaten Nutzen. Der Widerspruch des Gehorsams, den er seinen Bürgern als freiwillige Leistung abverlangt, verkehrt sich aus seiner Optik in einen Widerspruch des Dienstes, den er der Gesellschaft leistet: Er läuft Gefahr, sich damit von mächtigen und von ihm selbst ermächtigten partikularen Eigeninteressen, von Lobbys, Verbänden, übergroßen Kapitalgesellschaften oder Gewerkschaften etc. abhängig zu machen, das allgemeine Wohl zu opfern statt zu verwirklichen, am Ende selbst zum Opfer des privaten Eigennutzes zu werden, für dessen Erfolg er sorgt.
Egal, von welcher Seite aus die Politik die Sache problematisiert: Der bürgerliche Staat kommt nicht umhin, kritisch und selbstkritisch auf das widersprüchliche Verhältnis zu seiner Basis zu reflektieren und die auf jeden Fall unbedingt notwendige Einheit der Obrigkeit mit ihrer Bürgerschaft zum Gegenstand, ihre Herstellung und Bewahrung zum Leitfaden seiner herrschaftlichen Tätigkeit zu machen – an deren Inhalt sich ansonsten gar nichts weiter ändert.
Gewaltmonopol, Volk, Leitkultur
Das Erste, was der Staat seinen Bürgern schuldet, also ihnen aufzwingen muss, ist Recht & Ordnung. Dafür unterhält er einen internen Sicherheitsapparat, der mit so gut wie unerschöpflichen Gewaltmitteln allgemeine Gesetzestreue erzwingt. Der zeugt vom Gegensatz zwischen politischer Herrschaft und gehorsamspflichtiger Einwohnerschaft in seiner banalen Elementarform; denn nur deswegen gibt es ihn. Umfang und Ausstattung der Polizei sind zwar auf Störungen der öffentlichen Ordnung abgestimmt, mit denen die Exekutive rechnet. Der ganze Sicherheitsdienst kommt aber nicht als Reaktion auf kriminelle Ausnahmen von der Regel eines friktionslosen gesellschaftlichen Zusammenlebens in die Welt, sondern als notwendige praktische Ansage der Obrigkeit an ihre Landsleute: Er steht absolut für das Verbot privater Gewalt, die also ebenso absolut als normal unterstellt ist; er realisiert die Verstaatlichung der Gewaltverhältnisse, die der kapitalistischen Konkurrenz immanent sind. Ohne jedes Bedenken, damit einen Offenbarungseid über die brutale Normalverfassung der von ihm geschützten Produktions- und Lebensweise zu leisten, präsentiert und rechtfertigt der Staat sein bewaffnetes Gewaltmonopol dementsprechend als unerlässliche Bedingung für ein zivilisiertes Zusammenleben seiner Bürger. Damit bezweckt er andererseits nicht nur zum Schein mehr als bloße Abschreckung, als erzwungenen Respekt und berechnende Gesetzestreue. Ohne vom Zwang, den seine Beamten ausüben, irgendetwas zurückzunehmen, zielt er mit seinem einschüchternden Gewaltmonopol auf Einsicht, nämlich dass die Omnipräsenz seiner Polizeigewalt gut und richtig ist – weshalb Exzesse bei deren Anwendung auch unterbleiben sollen und betroffenen Bürgern Beschwerdewege offenstehen. Sein Sicherheitsapparat soll zwar als nötige Bedingung für, aber nicht als die Nötigung zum bürgerlichen Anstand fungieren und wahrgenommen werden, die er ist; er soll vielmehr als Forderung eines anständigen Bürgergeistes in Erscheinung treten, als erwünschte Lebenshilfe: Polizeigewalt als der bewaffnete Arm staatsbürgerlicher Moral.
Das funktioniert natürlich nicht von selbst. Damit rechnet der freiheitliche bürgerliche Staat auch gar nicht. Der erteilt sich im Rahmen seines Ausbildungswesens, das seinen Nachwuchs für den beruflichen Konkurrenzkampf ausrüstet, einen zusätzlichen Erziehungs- und Bildungsauftrag: Er gewöhnt seinen Bürgern den Standpunkt an, die Welt und auch sich selbst, die eigenen Bedürfnisse und Vorhaben, von den Imperativen einer funktionierenden Gesamtordnung her zu beurteilen und sich für ein größeres Ganzes, letztlich fürs ganz große Ganze der Nation verantwortlich zu fühlen. Die bürgerliche Öffentlichkeit befähigt und ermuntert er dazu, das Publikum mit Informationen aller Art zu versorgen und zu beschäftigen, die ein für alles zuständiges Rechts- und Verantwortungsbewusstsein voraussetzen, bedienen und so zur Selbstverständlichkeit machen. Die Gewohnheit, das große und kleine Weltgeschehen vom Standpunkt eines irgendwie als wichtig anerkannten Kollektivs, eines hochanständigen „Wir“, letztlich von der Fiktion einer nationalen Gemeinschaft aus zu problematisieren und für alles gute Lösungen zu fordern, das macht aus Konkurrenzsubjekten mit gleichem Pass ein Volk, auf das die nationale Herrschaft sich auch in moralischer Hinsicht als ihre Basis beziehen kann. Die Unterscheidung zwischen einem solchen Staatsvolk und anderen, fremden Bürgern ist keine schnöde Rechtsfrage mehr, sondern Sache der nationalen Identität, die den Unterschied zwischen Staatsangehörigkeit und Volkszugehörigkeit ausmacht. Dass es dem Staat dabei um mehr als eine feste Gesinnung geht, wird praktisch am Prozess der Einbürgerung kenntlich, der keineswegs jedem willigen fremdländischen Bewerber gegönnt wird: Verlangt ist am Ende ein Bekenntnis, das kein reversibler Willensakt sein darf, sondern für bedingungslose Verpflichtung auf den Staat steht, subjektiv: für vorbehalt- und berechnungslosen Patriotismus. Was freilich schlecht zu objektivieren ist. Auf jeden Fall sind Ausländer für die Staatsmacht ein Unsicherheitsfaktor; nicht hinsichtlich ihrer bürgerlichen Gesetzestreue, sondern eben in der Frage ihrer absoluten Verlässlichkeit. Die wird bei Einheimischen unterstellt, dementsprechend im Fall staatlichen Bedarfs auch gefordert und auch durch gesetzeswidriges Verhalten nicht unbedingt widerlegt. Viel eher wirft die Zugehörigkeit zu einer Minderheit, die in ihrer gar nicht einmal verbotenen Lebenspraxis von dem Kanon anerkannter Sitten abweicht, den eine kritische Obrigkeit und ihre Follower als Leitkultur veranschlagen, Zweifel an der eindeutigen Antwort auf die nationale Identitätsfrage auf; im Mutterland der bürgerlichen Freiheit können die Angehörigen mancher Communitys ein Lied davon singen. Privat ausgeübter Fremdenhass und Rassismus sind freilich untersagt – nicht zufällig den Volksgenossen, die ganz besonders fest darauf bestehen, als freie Individuen mit der Herrlichkeit des nationalen Kollektivs und seiner der Regierung anvertrauten Macht nahtlos identisch zu sein. Seine Inhalte generiert der Standpunkt des nationalen „Wir“ reichlich, aber auch nicht von selbst: Eine auf Volksbildung im doppelten Wortsinn bedachte Staatsgewalt füttert das vaterländische Bewusstsein mit einschlägigem Bildmaterial, besonders gern, ausführlich, sogar wissenschaftlich mit der teleologisch zur Geschichte der Nation stilisierten Vergangenheit.
Der bürgerliche Staat tut also viel dafür, dass der Status des rechts- und verantwortungsbewussten Bürgers und sittlich integrierten Einheimischen den Leuten, die er als seinen Besitzstand in Anspruch nimmt, „in Fleisch und Blut übergeht“, zur „zweiten Natur“ wird. Misstrauisch bleibt er trotzdem. Er kontrolliert nicht nur mit Justiz und Polizei Taten, die gegen die selbstverständliche Pflicht zur Loyalität – in Deutschland steht dafür das Kürzel FDGO – verstoßen; er unterhält auch – mindestens – einen Geheimdienst, der für Verdacht gegen die Gesinnung der Bürger im Allgemeinen, von Staatsdienern im Besonderen zuständig ist und die Grauzone der Meinungsbildung ausforscht, in der die Gedanken zwar frei sind, aber doch auch gelten muss, dass diese Freiheit nicht freiheitsfeindlich missbraucht werden darf.
Berechtigte soziale Unzufriedenheit und ihre Bewältigung per Demokratie
Nationaler Kollektivismus und sittlicher Konformismus erledigen nicht den materiellen Inhalt der Freiheit, die der Staat seinen Bürgern gewährt: die gewaltträchtigen Interessengegensätze der Konkurrenz ums Geldverdienen und die Kosten ihrer ordentlichen Austragung und Ausgestaltung, die der Staat seinen Leuten in Rechnung stellt. Mit seinen Gesetzen und seinem Haushalt produziert und reproduziert er die heillosen Gegensätze der aufeinander angewiesenen gesellschaftlichen Interessen und den Gegensatz zwischen dem produktiven Eigennutz der Klassen und Konkurrenzsubjekte, den er haben will, und seinem kostspieligen Regime darüber. Inhaltlich ist dieser Widerspruch nicht aufzulösen. Bewältigt, i.e. haltbar fortgeschrieben wird er vermittels der Methode bürgerlicher Herrschaft: Er wird aufgelöst in einen Pluralismus einander relativierender Konzepte, wie gesellschaftlich relevante Interessenlagen eben doch mit den gar nicht zu relativierenden Notwendigkeiten und Anforderungen der Staatsmacht in Übereinstimmung zu bringen wären. Mit Programmen dieser Art – und dem Personal, das sie vertritt – konkurrieren politische Parteien um die Übernahme der Herrschaft und die Ausübung der Ämter, in denen deren Aufgabenkatalog bereits vorliegt. Damit ist bereits klar: Alle Schäden, die die diversen Macher und Opfer der kapitalistischen Konkurrenz zu schlucken haben und mit berechtigter Unzufriedenheit quittieren, fallen nicht der bürgerlichen Staatsmacht und ihrer unerbittlichen Agenda zur Last, sondern den Parteien, die unbedingt diesen Job machen wollen. Alles Kritikable bleibt an denen hängen und ist insofern nicht ganz schlimm, als die die Herrschaft ja „nur“ auf Zeit innehaben, von einer Wahl bis zur nächsten. Die Räson der bürgerlichen Herrschaft selbst bleibt bei der Kritik außen vor, und nicht nur das: Weil die politischen Parteien dazu antreten, mit ihrem Programm dieser Herrschaft zu dienen, ist die nicht nur über jede Kritik erhaben, sondern mit ihren vorgestellten eigentlichen guten Aufgaben die Messlatte aller Kritik; die Norm, an deren befriedigender Erfüllung die Parteien sich mehr oder weniger gut bewähren oder scheitern. An der messen die konkurrierenden Parteien einander und bekräftigen so permanent und in ihren Wahlkämpfen akut die wunderbare Scheidung der Herrschaft auf Zeit, die für alle Übel und alles Misslingen zuständig ist, von den Belangen der Staatsmacht, deren dauerhaftem, unbedingtem Bestand mit jedem Wahlakt zugestimmt wird, egal, wie er ausfällt.
Der Wähler vollzieht mit der Wahl seine uneingeschränkte, unbefristete Zustimmung zur Staatsmacht und ihrer Räson als bedingte, zeitlich beschränkte Zustimmung „bloß“ zur befristeten Herrschaft einer Partei, und das in aller Freiheit, als seinen wesentlichen politischen Freiheitsakt. Er nimmt so die vom demokratischen Staat gebotene Gelegenheit wahr, seine Unzufriedenheit mit allem, was ihm im Berufsleben und aufgrund politischer Entscheidungen widerfährt, zwar nur sehr einsilbig, deswegen auch inhaltlich unbestimmt, dafür methodisch grundsätzlich und im Bewusstsein praktischer Wirksamkeit auszutoben. Mit dem Ergebnis wird der Enttäuschung, die der freien Wahl regelmäßig folgt, der in jeder Hinsicht passende Bescheid erteilt: Die Anhänger des Wahlsiegers bekommen, was ihre materiellen Interessen betrifft, in seltenen Fällen tatsächlich, was sie gewollt, und auf jeden Fall, was sie freiwillig gewählt haben, dürfen fortgesetzten Ärger insoweit also sich selber zuschreiben und sich für die nächste Wahl einen „Denkzettel“ vornehmen. Wer die Verlierer gewählt hat, bekommt mit dem Auszählungsergebnis den verbindlichen Bescheid, dass sein politisiertes Interesse in der Minderheit geblieben und allein deswegen, deswegen aber unbedingt zu Recht ungültig ist, und zugleich den Trost, dass sein Staat im Prinzip auch für seine Wünsche und politischen Vorlieben offen und nur befristet auf die siegreiche Variante von Herrschaft festgelegt ist. Diese rein methodische Relativierung der Macht: die trennbare Verknüpfung der Staatsgewalt mit dem Herrschaftskonzept und -personal einer Partei, leistet die Verabsolutierung der Herrschaft gegen ihre Basis und erzeugt und gewährleistet zugleich für den Staat die Einheit von Führung und Volk, fürs wahlberechtigte Volk die Identität von freiem Willen und Unterwerfung.
Politische Bewegungen für Korrekturen nach links und rechts
Eben das: die Herstellung und periodische Bestätigung der Emanzipation der souveränen Gewalt von und ihrer Einheit mit ihren Bürgern durch freie Parteienkonkurrenz, stößt im bürgerlichen Gemeinwesen auf zwei Sorten Kritik; vertreten von Parteien, die nicht bloß Alternativen innerhalb des Pluralismus politischer Konzepte sein wollen, sondern Bewegungen: Volksbewegungen für Korrekturen einerseits an der Zwecksetzung, andererseits am Verfahren demokratischer Herrschaft.
Radikale Linke bestehen auf dem materiellen Interesse der großen lohnabhängig arbeitenden Mehrheit des Volkes und verurteilen seine Schädigung durch die Ansprüche der Kapital besitzenden Minderheit. Dem bürgerlichen Staat werfen sie die Vernachlässigung dieses Volksinteresses, seine Benachteiligung gegenüber elitären Profitinteressen, seine rechtliche Beschränkung als Unterdrückung vor; seine rechtsförmige Anerkennung nehmen sie als das gültige, in der Praxis allerdings vielfach gebrochene Versprechen einer sozialen Gerechtigkeit, die die kapitalistische Ausbeutung der Arbeit verhindert, nötigenfalls das kapitalistische Eigentum verstaatlicht und die Macht der Kapitalistenklasse eliminiert. Die wirkliche bürgerliche Demokratie, in der sich Parteien mit ihren Staatsprogrammen aneinander relativieren und wechselnde Mehrheiten auf Zeit regieren, ist für sie unfertig, erst noch zu vollenden durch die unrelativierte, dauerhafte Herrschaft der Repräsentanten der arbeitenden Mehrheit: einer sozialistischen Arbeiterbewegung. Deren stolzes Klassenbewusstsein ist der einzig wahre Patriotismus, passend zu einem Land, das die wahrhaftige Heimat der Werktätigen sein will. So, nur so werden Regierungsmacht und Volkswille wirklich deckungsgleich.
Wo einer kommunistischen Linken eine antikapitalistische „volksdemokratische“ Revolution in diesem Sinn gelungen ist, hat sie sich freilich nicht mit der Überzeugungskraft einer proletarischen Mehrheit, sondern in einem Bürgerkrieg bzw. infolge wüster Kriegsergebnisse durchgesetzt; was diese Linken dann geschaffen haben, war die mit Geldgrößen durchgeplante Indienstnahme des vom kapitalistischen Privatinteresse befreiten Volkes durch eine gegen ihre Massenbasis verselbständigte Parteiherrschaft. Diese Alternative zur bürgerlichen Demokratie hat sich mittlerweile weltweit erledigt. Was dem Klassenstaat erhalten bleibt, ist der Standpunkt nicht einer Absage, sondern einer Korrektur seiner Räson; zum einen im Geist der Ideale sozialer Gerechtigkeit, die ohnehin zum moralischen Besitzstand des bürgerlichen Gemeinwesens gehören; praktisch durch eine Sozialpolitik, die die Folgen des kapitalistischen Wachstums für die lohnabhängigen Massen und die Gesellschaft überhaupt sowie für den Staat, der das alles betreut, nicht ungeschehen macht, aber nach Kräften – und auf Kosten der Reichen und „Superreichen“ – mindert. Verlangt wird zum anderen eine konsequente Demokratisierung, eine Mitbestimmung „von unten“, die auch vor der Wirtschaft nicht Halt macht. Zentrales Argument für Reformen in diesem Sinn ist der soziale Frieden, an dem doch der Staatsgewalt selbst gelegen sein müsse: eine mit sich selbst versöhnte Gesellschaft und ein unverwüstlich intaktes gutes Verhältnis zwischen Herrschaft und Bürgerschaft; Ziele, denen mit linker Politik entscheidend besser gedient wäre als durch ein halbherziges soziales Reparaturwesen und die Selbstherrlichkeit einer abgehobenen Elite.
Für die radikale Rechte ist die rechtliche Anerkennung widerstreitender gesellschaftlicher Interessen per se der entscheidende Sündenfall des bürgerlichen Staates. Sie erkennt darin die Billigung von Gegensätzen, die das Volk zerreißen, den unbedingt gebotenen und im Grunde selbstverständlichen gelebten Zusammenhalt der Einheimischen zerstören. Indem er das zulässt, mit seinem Rechtssystem sogar erst herstellt, macht der Staat auch seine Einheit mit dem Volk und die vertrauensvolle Einheit des Volkes mit ihm kaputt. Entsprechend verwerflich ist der Pluralismus von Parteien, die die Spaltung des Volkes politisch repräsentieren und verfestigen. Deren Konkurrenz widerspricht dem für Recht & Ordnung zuständigen hoheitlichen Gewaltmonopol, das doch schon dem Namen nach unteilbar ist und nur als ein einziger Wille funktionieren kann. Als Dauerzustand eingerichtet, tritt sie entzweiend zwischen die eine souveräne Staatsgewalt, auf die es doch ankommt, und das mit sich einige Volk, das darauf ein Recht hat: auf einen Führer, der alle Macht auf sich vereinigt. Demokratische Verfahren, Konkurrenz und wechselnde Mehrheiten, das Prinzip der Herrschaft auf Zeit nehmen dem Volk dieses Recht. Die Kompromisse, auf die das alles am Ende hinausläuft, sind Dokumente der Schwäche: ein Hohn auf die nationale Staatsmacht, die, kompromisslos zum Einsatz gebracht, unwiderstehlich ist; eine Beleidigung des Volkes, das seinen Dienst als Volk doch nicht versieht, um für Parteiinteressen und die Halbheiten eines Establishments in Dienst genommen zu werden, die so unendlich weit unter den Möglichkeiten, Stärken und Rechten der Nation bleiben.
Zumindest in der Tendenz ist dieser rechte Standpunkt den regierenden, den oppositionell mitregierenden und vor allem den als Wählerschaft engagierten Demokraten geläufig und ganz vielen aus dem Herzen gesprochen. Denn worauf rechte Demokratiefeinde als dem obersten politischen Erfordernis bestehen, das ist ja nichts anderes als die Machtfülle, die eine gewählte Regierung für die Dauer ihrer Amtszeit besitzt, in Anspruch nimmt und gar nicht gerne wieder abgibt. Rechtliche Einschränkungen als Behinderung wahrzunehmen und zu umgehen, wo es geht, ist für demokratische Politiker, die die Rechte ihrer Herrschaft in Gefahr sehen und eine nationale Mission haben, selbstverständlich, womöglich eine Verpflichtung, jedenfalls keineswegs schon rechtsradikal. Wenn ein Land hinter seinen selbstgesetzten Zielvorgaben zurückbleibt und wichtige nationale Vorhaben erkennbar scheitern, liegt der Schluss auf Schwäche der Regierung als Ursache auf der Hand; für die demokratische Opposition ist er überhaupt das wesentliche Argument. Die Konkurrenz der Parteien lebt von der kritischen und selbstkritischen Forderung nach immer entschlossenerem hartem Durchgreifen. Und dieses Verlangen hat – vor allem, aber keineswegs nur – in Krisenzeiten das Zeug dazu, sich gegen die Konkurrenz selbst als falsches Verfahren herrschaftlicher Willensbildung und Machtausübung zu richten.
Dafür, für eine Korrektur der Staatsgewalt in diesem Sinn, kämpft die radikale Rechte; mit dem Bemühen um eine Bewegung, die aus dem Status einer politischen Partei unter vielen ausbricht. Wo sie damit Erfolg hat und die Herrschaft erobert, macht sie sehr direkt ernst mit dem Ideal des einigen Volkes und seinem Recht auf kompromissloses Regieren. Mit dem Einsatz ihrer Anhänger und des übernommenen staatlichen Sicherheitsapparats, der endlich zeigen darf, wofür er da ist und taugt, betreibt sie die „Gleichschaltung“ der organisierten Partikularinteressen ihrer ansonsten intakten Klassengesellschaft, der konkurrierenden Parteien vor allem, die Volkserziehung zur totalen nationalen Identität, die Eliminierung aller volksfremden störenden Elemente. Solange der Erfolg auf sich warten lässt – was sich in einer „wehrhaften Demokratie“ durchaus hinziehen kann –, mobilisiert die Rechte ihr gutes Volk gegen die Regierenden als Volksverräter, die Ausländer, Außenseiter, Linke und Luxus-Existenzen – „Kapitalismus“ ist ihnen als Schimpfwort geläufig –, dem Volk entfremdete Intellektuelle und andere zersetzende Elemente gewähren lassen, sogar fördern und hofieren. Und sie werben für die große Alternative für die Nation: für den Schrei der Massen nach dem einen „starken Mann“, der freilich den Nachteil hat, dass der wahre Führer erst durch seinen Erfolg bei den Massen entsteht und nicht schon durch die Proklamation eines Volksbedürfnisses danach.
*
Die bedingungslose Loyalität seiner Bürger, die der Staat als Verwalter eines mit anderen konkurrierenden Kapitalstandorts braucht, beansprucht und mit seinem Gewaltmonopol herstellt, muss sich nicht nur darin bewähren, dass die Ausbeutung der Arbeit und der gesellschaftliche Konkurrenzkampf insgesamt zivil und sozialfriedlich ihren Gang gehen, das Kapitalwachstum gelingt und die Herrschaft selbst an Macht gewinnt. Die entscheidende Bewährungsprobe der bedingungslosen Einheit von Volk und Führung findet da statt, wo die Staatsmacht sich um des nationalen Ganzen willen von den Interessen, denen sie um ebendieses großen Ganzen willen dient, definitiv emanzipiert. Nagelprobe ist die Kriegsbereitschaft der Nation.
... nach außen
In ihrem Umgang miteinander reklamieren die Staaten den „Grundsatz der Nicht-Einmischung in innere Angelegenheiten“. Das ist ein Treppenwitz in einer Welt der grenzüberschreitenden kapitalistischen Konkurrenz – einerseits. Andererseits drückt das den prinzipiellen Vorbehalt aus, mit dem die souveränen Gewaltmonopolisten einander begegnen und der für sie gerade deswegen von höchster Bedeutung ist, weil sie ihre wichtigste „innere Angelegenheit“, das nationale Wachstum, die Basis ihrer Macht, immer mehr, im Endeffekt unwiderruflich voneinander abhängig gemacht haben. Und das eben nicht bloß von den ökonomischen Leistungen, die sie auswärts in Anspruch nehmen und selber anzubieten haben, sondern von dem verlässlichen Willen auswärtiger Souveräne, ihren Ansprüchen Genüge zu tun. Sie bestehen auf der Respektierung ihrer Autonomie und machen so den Widerspruch kenntlich, der in ihrer Praxis der berechnenden Benutzung der Außenwelt für ihre kapitalistische Staatsräson enthalten ist: Als Garanten des nationalen Wachstums brauchen und beanspruchen sie die Herrschaft über die Bedingungen des Geschäfts, von dessen internationalem Konkurrenzerfolg sie leben, und stoßen im gleichlautenden Interesse ihrer Kontrahenten auf die Gegenmacht zu ihrem Anspruch, in deren Gewaltmonopol auf die äußere Schranke ihres eigenen, die sie längst überschreiten. Als Welthandelsmächte sind sie in die politische Willensbildung der anderen „eingemischt“; umgekehrt haben sie mit der Zulassung ausländischen Kapitals in ihrem Herrschaftsbereich den Hütern dieser Kapitalmacht ein Stück Regie über ihr nationales Wirtschaftsleben konzediert.
Diesen Widerspruch in der Räson ihres Staates nehmen die zuständigen Machthaber als Herausforderung wahr: als die Aufgabe, die Beschränkung ihrer autonomen Entscheidungsmacht durch die Notwendigkeiten des grenzüberschreitenden kapitalistischen Wachstums abzuwehren und auf die Willensbildung der Geschäftspartner nachhaltig einzuwirken. Am Inhalt der kommerziellen Interessen und der Notwendigkeiten ändert das nichts, an deren politischem Stellenwert Entscheidendes: Der Staat bezieht alles, was er da treibt, auf sich als die Instanz, die kraft ihrer Hoheit allem, was ihm wichtig ist, die Qualität von Rechten verleiht, deren Durchsetzung er garantiert; und das eben nicht bloß im Innern, sondern auch nach außen, im Verhältnis zu seinesgleichen, die mit demselben hoheitlichen Standpunkt auftreten. In diesem Verhältnis steht von vornherein Recht gegen Recht. Dieser Gegensatz ist mit der wechselseitigen Anerkennung der rechtsetzenden Staatsgewalten als Bedingung ihrer gegenseitigen Ausnutzung eröffnet, nämlich als Streit darum, wie viel das beanspruchte Recht überhaupt wert ist; also wie viel Beeinträchtigung der staatlichen Garantiemacht mit der Etablierung eines grenzüberschreitenden Geschäfts- und Geldverkehrs verbunden und womöglich auszuhalten ist, umgekehrt wie viel Einfluss auf die Politik auswärtiger Souveräne sich damit erreichen lässt. Nach beiden Seiten hin wird die Gewalt, die der Staat dem kapitalistischen Eigentum verleiht und die er auch nach außen hin garantiert, also seine Souveränität als solche zum Gegenstand der Politik.
Dadurch bekommt zum einen der weltweit ausgreifende Dienst der Staatsgewalt an der Konkurrenz der Kapitalisten seine höhere politische Zielsetzung: Zur Durchsetzung der sachlichen Erfordernisse des nationalen Wachstums kommt als übergeordneter Gesichtspunkt und, gegebenenfalls, als praktischer Leitfaden der Gebrauch der damit gesetzten und garantierten ökonomischen Sachzwänge als Instrumente einer Konkurrenz hinzu, in der es um wechselseitige Erpressung zu sicherer Benutzbarkeit des fremden souveränen Willens geht, um nichts Geringeres als die Über- und Unterordnung hoheitlicher Macht unter eine andere. Dieser Kampf erfordert allerdings mehr als den berechnenden Gebrauch der in kapitalistischen Sachzwängen vergegenständlichten staatlichen Gewalt. Es geht um Respekt vor der Gewalt, die aus der kapitalistischen Sache nach außen wirkende Zwänge macht; darum, eigene, autonom gesetzte Rechte als Prämisse in die berechnende Willensbildung anderer Staaten einzubauen und geltend zu machen. Dafür bringt der Staat das Mittel zur Wirkung, das ihm als Herrschaft mit Gewaltmonopol überhaupt autonom zu Gebote steht: sich selbst als Herr über einen Gewaltapparat; einen, der ihn in die Lage versetzt, gegen seinesgleichen direkten Zwang auszuüben. Im Alltag wechselseitiger Benutzung und Nötigung ist diese Fähigkeit stillschweigend unterstellt. Das Militär ist nicht das Mittel der Wahl für den normalen grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr. Der funktioniert aber nur auf Basis eines wie auch immer geklärten Gewaltverhältnisses zwischen den hoheitlich Recht setzenden Souveränen.
Von da nimmt die Außenpolitik der kapitalistischen Nationen ihren Ausgang, und darin hat diese Politik ihren letztlich entscheidenden Inhalt.
Der Staat: Nutznießer und Opfer seines Status in der Staatenwelt
Militärische Gewalt ist schon vonnöten, um ein Land und dessen Bewohner überhaupt gewaltmonopolistisch in Besitz zu nehmen und anderen Staaten den Übergriff auf diesen Zuständigkeitsbereich zu verwehren.[2] Diese Notwendigkeit bleibt als Voraussetzung für den Dienst der Staatsmacht am grenzenlosen Wachstumsbedarf der Kapitalisten bestehen. Mit der weltweiten Entfaltung der Konkurrenz der Kapitalisten und der Unterwerfung der Welt unter deren Interesse durch staatliche Gewalt entfaltet sich der darin enthaltene Widerspruch zwischen dem alle Grenzen überschreitenden kapitalistischen System und seiner Territorialisierung durch die nationalen Souveräne, die es stiften. Mit der letzten Konsequenz dieses Widerspruchs bekommen die Staaten es zu tun, wenn sie gegeneinander auf ihrer Autonomie bestehen, die sie zugleich wechselseitig relativieren, also infrage stellen.
Dabei finden alle Staaten es – nach wie vor – ganz grundsätzlich unerlässlich, ihr Militär mit der Aufgabe der Landesverteidigung zu betrauen. In diesem Punkt sind sie sogar besonders kleinlich: Sie rechnen in Quadratzentimetern, um ihre Kompromisslosigkeit in der Frage ihres räumlichen – darin natürlich eingeschlossen ihres menschlichen – Besitzstands deutlich zu machen. Die Unterstellung, das Interesse an Eroberungen wäre für die bürgerliche Staatenwelt die erste und ernsteste Gefahr, hat sich mit der ziemlich lückenlosen Aufteilung der festen Erdoberfläche in anerkannte Nationalstaaten, dem Ergebnis des Nachkriegszeitalters der Entkolonialisierung, keineswegs erledigt. Wie auch: Von Israel über Pakistan und Indien bis China und Taiwan sind strittige Territorialansprüche größeren Kalibers offen bzw. eröffnet worden; gegensätzliche Hoheitsinteressen richten sich auf Länder aus der Hinterlassenschaft der einstigen Sowjetunion; eine ganze Anzahl von Staaten rechnet Bürger anderer Nationen ihrem eigenen Volk zu und behält sich deren Heimholung vor; Deutschlands „Wiedervereinigung“ ist ein extrem erfolgreicher Extremfall eines solchen Irredentismus. Die Verschiebung von Grenzen ist dennoch nicht der zentrale Kampfplatz, auf dem die Staaten gegen den Widerspruch der Territorialisierung der kapitalistischen Bewirtschaftung des Globus, nämlich gegen die Beschränkung ihres Anteils daran durch fremde Souveränität, angehen. Sie haben sich darauf verständigt, ihre Grenzen anzuerkennen, um ihnen „das Trennende zu nehmen“. Das bedeutet in der Sache die Eröffnung einer räumlich wie qualitativ schrankenlosen, einer universellen und tief in fremde Gemeinwesen eingreifenden Konkurrenz um die Funktionalisierung der anderen anerkannten nationalen Herrschaften für das eigene nationale Interesse, folglich den Kampf um das, was so schön verharmlosend und doch unmissverständlich „Einfluss“ heißt: das Überpowern der eigenmächtigen politischen Willensbildung fremder Souveräne; einen Konkurrenzkampf, dem kein Staat auf der Welt entzogen ist. Deswegen haben alle Staaten ein wirkliches allgemeines, nämlich ein absolutes Sicherheitsproblem; absolut in dem Sinn, dass nicht bloß ihre souveräne Herrschaft über ein Territorium und dessen Inventar infrage steht, sondern ihre Hoheit über die den eigenen Zwecken gemäße Einrichtung ihres Herrschaftsbereichs und darüber hinaus, ihre Freiheit zu herrschaftlicher Zwecksetzung überhaupt, die Räson ihrer Gewalt. Die gilt es zu sichern; das ist die wirklich grundsätzliche Aufgabe ihrer Sicherheitspolitik. Die ist freilich nicht so gut in Quadratzentimetern zu fassen wie die Landesverteidigung; oder anders: Auch der Konkurrenzkampf um die gesicherte Willfährigkeit einer fremden Staatsgewalt kann durchaus mit militärischen Übergriffen auf dessen Gelände geführt werden. Aber dann ist eher das der Zweck, der „Einfluss“ auf einen störenden Herrschaftswillen, nicht die Übernahme der Herrschaft über erobertes Land. Und dafür: für die Sicherstellung des gebotenen Funktionierens fremder Herrschaft, kommt es umso mehr auf eine Militärmacht an, die alles vermag, was nötig ist, um auswärtigen Machthabern die Freiheit autonomer Willensbildung zu nehmen.
Die Notwendigkeit, diesen Gewaltbedarf zu befriedigen, ist die in letzter Instanz entscheidende Herausforderung für das ökonomische Vermögen der Nation: für Masse und Wachstumsrate ihres kapitalistischen Reichtums, die Qualität ihres Kreditgelds, die Reichweite ihres Zugriffs auf Ressourcen unter fremder Hoheit usw. Alles das, was den Status des Landes in der Konkurrenz der nationalen Kapitalstandorte, seinen Stellenwert in der Hierarchie der Wirtschaftsmächte ausmacht, hat im Vergleich der militärischen Potenzen der Staaten seine höhere politische Bewährungsprobe zu bestehen. Dabei ist klar, den Sicherheitspolitikern und Wehrmachtsfunktionären schon gleich, dass diese Aufgabe nie abschließend zu erledigen ist: Jede militärische Errungenschaft macht obsolet, was zuvor Sicherheit gestiftet hat, reproduziert also in verschärfter Form das zu lösende Problem. Mit ihrem Sicherheitsbedarf eröffnen die Staaten folglich ein nie abzuschließendes Ringen um Überlegenheit, das auf Grundlage ihrer ökonomischen Konkurrenzerfolge und Misserfolge und noch viel gründlicher als der kapitalistische Leistungsvergleich Nutznießer und Opfer scheidet. Denn zum einen nötigt dieses Ringen seine Akteure dazu, mit der Gestaltung ihres nationalen Haushalts prinzipiell über ihre ökonomischen Verhältnisse zu leben: Die finden sich verpflichtet, keinen Aufwand zu scheuen, wenn es in der Gewaltfrage um ihre Handlungsfreiheit als Bedingung der Durchsetzung ihrer Staatsräson nach außen geht. Die Handlungsfreiheit, die sie dafür brauchen, verschaffen sie sich nach den Regeln systemgemäßer Haushaltspolitik mit Schulden. Die müssen sie sich nach denselben Regeln allerdings auch leisten können. Dem steht entgegen, dass es sich bei den Kosten des Militärs um reine faux frais der Herrschaft handelt: um unproduktive Kosten für eine Menge Personal und eine Unmenge Material, die für nichts als Zerstörung vorgehalten werden. Der Militärstaat ist so erst recht verwiesen in die Schranken seiner Verschuldungsfähigkeit, die ihm durch die Macht resp. Ohnmacht seines Nationalkredits, greifbar in der Bewertung seines Kreditgelds, gezogen sind. Zum andern sind nicht nur die unproduktiven Gebrauchswerte des Militärs – von den reinen Personalkosten abgesehen – eine kostspielige Sache; noch mehr erfordern ihre Produktion in meist sehr schwankender Menge und ihre permanente Weiterentwicklung einen Kapitalvorschuss aus Haushaltsgeldern, den die wenigsten Nationen zustande bringen. Schon für die berühmten „Gewehrläufe“, aus denen nach einem veralteten Bauernkriegs-Bonmot „die Macht kommt“, sind die meisten Länder auf Lieferanten verwiesen, die an ihnen als staatlich oder staatsähnlich organisierten militärischen Hilfskräften ein Interesse haben. Die so genannten Schwellenländer haben die Schwelle zu einer auch aus Eigenmitteln finanzierten Waffenproduktion meistens überschritten und beleben als Käufer wie auch schon als Anbieter den Weltmarkt für Rüstungsgüter. An das Potential der auch in dieser Hinsicht führenden so genannten Industrieländer reichen sie aber doch nur ausnahmsweise heran, weil die mit ihrem Weltgeld und ihrem technologischen Fortschritt erstens in der Lage sind und zweitens alles dafür tun, einen maximalen Abstand zwischen sich und den Rest zurechnungsfähiger Militärmächte zu legen. Dafür unterhalten sie einen – seit den 50er Jahren kritisch so bezeichneten – „militärisch-industriellen Komplex“, in dem Kapital und Staatsmacht auf ganz speziell produktive Weise zusammenkommen: Der Staat verlangt ein Arsenal, das ihm auf immer höherer Stufe Überlegenheit sichert, und zahlt dafür mit Kredit, den er als Schöpfer eines wirklichen Weltgeldes hat; eine kapitalistische Industrie tut alles, um die Ansprüche ihres staatlichen Auftraggebers vorauseilend zu überbieten und so die schöne, letztlich risikofreie Konkurrenz um unerschöpfliche Haushaltsmittel immer neu für sich zu entscheiden; das Finanzgewerbe findet auf beiden Seiten, bei der Investition in diese staatliche Nachfrage nach wie beim Vorschuss für Herstellung und Perfektionierung von Gewaltmitteln, die optimalen Geschäftsfelder. Die zusätzliche Nachfrage schwächerer Militärmächte, die für so feine Ware immer noch einiges an Kaufkraft zustande bringen, steigert den Gewinn, nützt den staatlichen Bilanzen und ist für die maßgeblichen Staaten vor allem außenpolitisch produktiv, weil ihre Lizenz für solchen Handel ganz partnerschaftlichen – schon wieder: – Einfluss sichert. Im Endergebnis etablieren sich an der Spitze der hierarchisch sortierten Staatenwelt einige wenige maßgebliche imperialistische Subjekte: kapitalistische und militärische Weltmächte, die auf ihrem eigenen Niveau um Selbstbehauptung durch Übermacht konkurrieren, koalieren und streiten.
Sicherstellungs- & Korrekturbedarf, konkret entfaltet
Für den Staat ist sein Status in der Staatenwelt, sein Platz in der Hierarchie der Mächte kein objektiver Tatbestand, sondern eine Herausforderung, mehr als das Erreichte daraus zu machen. In seiner Selbstwahrnehmung mischen sich Nutzen und Opfer, die er dafür bringen muss. Die Bilanz ist für ihn der Ausgangspunkt für die Definition des Rangs in der Rangordnung der Souveräne, der ihm eigentlich zusteht – ein Gesichtspunkt, unter dem das letztlich auf so etwas wie die Nr. 1 hinausläuft, findet sich. Sein Durchsetzungswille nimmt jedenfalls Maß an seinen in die Zukunft weisenden Ansprüchen auf Macht und Anerkennung. Dass er sich seine Erfolgsmaßstäbe selber setzt, ist das Kernstück seiner Souveränität. Im Prinzip.
Konkret und praktisch nimmt der Staat die prinzipielle Herausforderung, seine Macht durch ihre Stärkung zu sichern, als kritisches – freundliches oder konfliktbeladenes – Verhältnis zu bestimmten anderen Staatsgewalten wahr, die ihm nützen sollen und stattdessen oft genug das Leben schwer machen. Mit Blick auf die materielle Substanz seiner diversen Außenbeziehungen sowie auf sein spezielles Kräfteverhältnis zum jeweiligen Kontrahenten, i. e. auf Stand und Mittel wechselseitiger Einflussnahme, teilt er sich seine Interessen ein: Manche definiert er als vital, andere nicht, setzt damit Bedingungen für den geschäftsmäßigen Umgang miteinander und zugleich Geschäftsbedingungen für konkurrierende Kapitalisten, die denen oft gar nicht gefallen. Denn was auch immer in der Sache zur Entscheidung steht: Maßgeblich ist der wechselseitige Anspruch auf Anerkennung des Rechts, das jede Seite ihren Interessen beilegt. In den Verhandlungen, die er führt, bringt der Staat, berechnend abgestuft, sich als Argument ins Spiel: den Respekt, den er der Gegenseite abverlangt. Die Überzeugungskraft dieses Arguments auszutesten, mit dem Ziel, sich durchzusetzen, ist Aufgabe und Betätigungsfeld der Diplomatie. Deren Gegenstand ist alles, was Staaten miteinander zu tun und zu regeln haben, unter dem gar nicht bloß theoretischen Gesichtspunkt, was der eine sich vom andern gefallen lassen muss und nicht gefallen lassen kann. Auf den Grad der Anerkennung bzw. Zurückweisung bezieht sich der Sicherstellungs- und Korrekturbedarf, den die Staaten am Stoff ihrer geschäftlichen Verbindungen, gegebenenfalls bis hinunter zum Preis für einzelne Waren, gegeneinander geltend machen. Darum wird gerungen.
In diesem Ringen nimmt die Kategorie der Ehre einen wichtigen Platz ein. Sie fungiert als Messlatte für den Stand der Beziehungen wie für den Härtegrad der Geltungsansprüche, die der Staat in seinen Verhandlungsgeschäften vertritt; sie bestimmt Wortschatz und Grammatik der Diplomatie. Die materiellen Interessen, deren Erfüllung auf die Art eingefordert wird, sind unterstellt und nicht misszuverstehen, wenn sie im Namen ideeller Werte und der nationalen Würde geltend gemacht werden. Das Quidproquo macht deutlich, wie ernst der Staat die Sache nimmt. Daran angeknüpft werden Erzählungen darüber, was der Nation aufgrund ihrer Leidens- und Erfolgsgeschichte eigentlich zusteht: abhanden gekommenes Gelände und Volk, Wiedergutmachung für erlittenes Unrecht, aber auch Autorität aufgrund früherer Glanztaten usw. Die Botschaft geht vor allem nach innen: Die Bürger sollen mitfühlend, im Ernstfall mitfiebernd gut finden, was die Staatsmacht mit ihnen als Volk in der Welt anstellt. Aber auch im internationalen Geschäftsverkehr der Souveräne sind es klare Mitteilungen an Adressaten, die sich auch zielgenau angesprochen wissen, wenn ein Staat mit seiner Ehrenmitgliedschaft im Club der geläuterten Menschenrechtsverfechter auftritt und Investitionsentscheidungen heimischer Unternehmen in ausgewählten fernen Regionen kritisiert.
Solche hohen Töne werden naturgemäß dann besonders laut und vernehmlich, wenn es im Konkurrenzkampf um gesicherte Anerkennung, also erfolgreiche Durchsetzung der nationalen Staatsräson kommt, wie es kommen muss, nämlich zu gewissen Feindseligkeiten. Sache der Diplomatie ist es ja – unter anderem und ganz besonders –, auf störende Kontrahenten zuzugehen und Konflikte zu schaffen, um sie einer Lösung im eigenen Sinn zuzuführen. Auch wenn die anvisierte Lösung daran scheitert, dass sie gleich darauf angelegt ist, ist auf jeden Fall die Gegenseite daran schuld. Die verstößt gegen das Recht, das nur der eigenen Seite zusteht, ein „unveräußerliches“ womöglich. Damit fordert sie die Macht des Betroffenen heraus, seinem verletzten Recht – wieder – Geltung zu verschaffen. So nötigen sich beide Seiten zu der Berechnung, wie wichtig der Konflikt ihnen ist; ob mit Gewalt, mit welchen Gewaltmitteln und wie viel Gewalteinsatz zu beantworten. Praktisch folgt daraus die Mobilisierung von auswärtiger Unterstützung für die eigene Konfliktlösung, das Austesten der Hartnäckigkeit des Gegners und was sonst so alles den Zustand namens Frieden so furchtbar interessant macht.
In dieser Kunst der Erpressungen und ihrer zweckmäßigen Eskalation, der Gewinnung von Bündnispartnern usw. sind schon wieder die imperialistischen Großmächte führend. Vom Standpunkt gesicherter Überlegenheit, die sie sich zutrauen, entwickeln sie auch für schwerste Fälle Arsenal und Methodik zur Konfliktbewältigung nach dem Muster: Dem Problemstaat müssen für den feindseligen Gebrauch seiner Autonomie Kosten auferlegt werden, die er nicht aushält. Auf unterster Stufe werden Sanktionen erlassen, die darauf abzielen, das ökonomische und militärische Vermögen des Kandidaten zu schmälern, ihn in seinem weltpolitischen Status herabzustufen. Um die durchschlagend wirksam zu machen, werden Bündnisse gebildet, nötigenfalls durch Sekundärsanktionen erzwungen. Auf seiner höchsten Eskalationsstufe verdient sich dieses Vorgehen die Bezeichnung Wirtschaftskrieg, weil es auf die Zerstörung der materiellen Mittel autonomer staatlicher Machtentfaltung zielt. Mit dem Zweck der Entmachtung des Gegners geht die Auseinandersetzung über in einen Unvereinbarkeitsbeschluss, mit dem die militärische Zwangsgewalt ins Spiel kommt, die sich jede Seite schon im Hinblick auf den Feind zugelegt hat, den es jetzt fertigzumachen gilt.
Krieg
Die erste Form, in der der Staat seine Kriegsfähigkeit zum Einsatz bringt, ist die Politik der Abschreckung. Die heißt so, weil schon im Namen die Unterstellung transportiert wird, dass an allen gefährlichen Konflikten der jeweils andere schuld ist, der von der Verübung größerer Missetaten abgehalten werden muss. Sie hat darüber hinaus einen überparteilich guten Ruf, weil gleich mitbehauptet ist, der abschreckenden Macht ginge es nicht nur darum, den Feind an einem als seine böse Absicht unterstellten An- oder Übergriff zu hindern, sondern um die Vermeidung einer womöglich doch fälligen gewaltsamen Auseinandersetzung überhaupt. Dass diese Behauptung sich selbst widerlegt – die behauptete Wirkung unterstellt Überlegenheit der jeweils eigenen Waffen und den unabänderlichen eigenen Beschluss, einen Krieg überhaupt nicht zu vermeiden; die einzige Bedingung, von der dessen Realisierung abhängig gemacht wird, ist die eingesehene Unterlegenheit und die entgegengesetzte Beschlusslage beim Feind, dem man den Willen zum Krieg unterstellt –, hat ihrer Beliebtheit seit den Tagen des altrömischen Kriegsrufs „Si vis pacem, para bellum!“ nicht geschadet. Und die tatsächlich praktizierte Politik der Abschreckung hat unter den regelmäßig vollzogenen Übergängen von der Drohung zum wirklichen Krieg schon gar nicht gelitten; wie denn auch. Diese Politik stellt nämlich die Lüge von der Vermeidung des Krieges als wahrem Zweck seiner unwiderruflichen Androhung vom Kopf auf die Füße: Tatsächlich geht es jeder Macht, die mit Abschreckung operiert, darum, ihr Kriegsziel ohne Krieg zu erreichen; und was das bedeutet, macht die umgekehrte Betonung definitiv klar: Betrieben wird das widersprüchliche Unterfangen, ohne die Durchführung eines Krieges, ohne den Aufwand an Zerstörungsmacht samt Folgekosten und in Kauf zu nehmende eigene Risiken, nicht weniger als das unbedingt gewollte Kriegsergebnis zu erreichen. Deswegen ist wirkliche Abschreckungspolitik – im Unterschied zur einschlägigen Rhetorik – alles andere als eine Kombination aus Aufrüstungsprogrammen und bloßer Drohung im Sinne der Beschwörung eines Eventualfalls. Auf den Gegner werden Waffen gerichtet; die Drohung mit ihrem Einsatz bezieht sich auf die tatsächliche, gegebenenfalls aktiv vorangetriebene Schädigung seiner Macht, die ihm seine Handlungsfähigkeit streitig macht, am Ende nehmen soll. Dafür bedienen sich die Staaten diplomatischer Ansagen und Kampfbegriffe aus dem Formenkreis der nationalen Ehrenhuberei, die dem Gegner den feststehenden Unvereinbarkeitsbeschluss kundtun, ohne ihm gleich offiziell den Krieg zu erklären: Es geht um „Werte“; „gemeinsame“, die ein Kriegsbündnis zusammenhalten; allgemeingültige wie „Frieden“ und „Ordnung“, die von allen, nur vom bösen Feind nicht geteilt werden. Mit Formeln wie „Unrechtsregime“ wird dem die innere Legitimität seiner Herrschaft abgesprochen und damit dem heiligen Grundsatz der Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Souveräne eine förmliche Absage erteilt, insofern die Prämisse internationaler Politik, die wechselseitige Anerkennung als Gewaltmonopolisten, unter Vorbehalt gestellt oder direkt widerrufen. Mit der Praxis gezielter Schädigung, die unter solchen Titeln vorangeht, stellen Staaten, die einander nicht mehr aushalten – wollen –, das Verhältnis eines andauernden kalten Krieges her, dessen Ziel die Entmachtung des Gegners ist. Diese Idylle ist immer nur um ein ausdrückliches letztes Ultimatum vom militärischen Angriff auf die Machtbasis des Feindes – Ökonomie, Kampfmittel, Volk – entfernt.
Verschärfung und „Entspannung“ dieses Verhältnisses – die Formulierung „roter Linien“, das Verstreichen-Lassen von Ultimaten, der Kriegs-„Ausbruch“, am Ende die Kriegsführung selbst – folgen einem Kalkül der verfeindeten Staaten, das vor allem zwei Dinge zueinander ins Verhältnis setzt: den definierten Grad der Unerträglichkeit des Feindes, seiner Staatsräson und seiner Macht, darin eingeschlossen Fort- und Rückschritte beim Vollzug seiner Entmachtung, und das militärische Kräfteverhältnis, darin eingeschlossen die mehr oder weniger selbstkritische Einschätzung des Grades der eigenen Über- resp. Unterlegenheit. Ausgerechnet weil sie, und solange sie noch, so rechnen – Fehleinschätzungen und Übergänge in die Verrücktheit sind außerdem dabei –, wollen die Herren über Krieg und Frieden ihre praktizierte Militanz im Sinne der Abschreckungsideologie als fortgesetztes Bemühen um Kriegsvermeidung gewürdigt wissen. Tatsächlich wird daran das Gegenteil kenntlich: Selbst noch der Übergang zum Vernichten, zum industriell vorgefertigten Töten und Zerstören, eigene Opfer an lebenden und dinglichen Machtmitteln inklusive, ist für den Staat Sache einer Rechnung, die ihre eigene Rationalität hat, nämlich der Räson hoheitlicher Handlungsfreiheit folgt. Der Krieg, wie er zum Dienst der Staatsgewalt an der Konkurrenz der Kapitalisten in letzter Instanz dazugehört, ist kein „Wahnsinn“, sondern ein Unternehmen, das sich lohnen muss – nicht für den Profit der kapitalistischen Geschäftswelt, die ihn ja gar nicht führt und sich auch nicht bestellt, sondern für den staatlichen Gewaltmonopolisten. Denn der betätigt sich gerade da als die Bedingung für alles, wovon sein Volk und er selber leben, wenn er für einen Sieg über seinesgleichen alles Nötige opfert.
Für die Kriege, die in der Welt stattfinden, haben ihre Autoren jeweils besondere, konkrete, natürlich nur gute Gründe. Dass sie solche Kriegsgründe immer wieder finden, hat aber selbst einen allgemeinen Grund. Der liegt in der widersprüchlichen Logik des Dienstes, den der Staat seiner Klassengesellschaft leistet, indem er – von Anfang an und bis zum bitteren Ende – auf deren Kosten alles für sich als deren unbedingte Funktionsbedingung und Erfolgsgarantie tut; einer Logik, nach der auch die Chefs formell anerkannter Staaten handeln, die zwar wenig funktionstüchtigen Kapitalismus zu regieren haben, als moderne Regenten aber so konsequent wie ihre imperialistischen Vorbilder um Anerkennung, Statusverbesserung, Durchsetzung ihrer Herrschaft nach außen ringen. Die besonderen Interessengegensätze, die mit kalten und – am Ende oder von Anfang an – heißen Kriegen ausgetragen werden, sind vielfältig und mögen disparat sein; die Kriegsverläufe erst recht. Aber dass Krieg zum festen Repertoire staatlichen Handelns gehört, als „Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln“, hat im aufgeklärten Zeitalter der zivil verwalteten Verteidigungsministerien, der globalen Rüstungsmärkte und des humanitären Kriegsrechts seine – ohne Weltrevolution ... – nicht totzukriegende Notwendigkeit in dem Widerspruch der Territorialisierung des Welt-Kapitalismus: seiner Schaffung und Entfaltung durch das Zusammenwirken einer Mehrzahl einander ausschließender Gewaltmonopolisten.
Dass es im modernen Imperialismus auf allen Ebenen bis hin zum Krieg um diesen Widerspruch geht, brauchen die großen imperialistischen Konkurrenten nicht zu wissen. In ihrer Konkurrenz kämpfen sie um dessen Überwindung. Deswegen ist in diesem System noch nicht einmal Krieg das letzte Wort.
[1] Eine Übersicht der Kapitel und Paragraphen der „Konkurrenz der Kapitalisten“ findet sich hier.
[2] Siehe § 3, Nach außen, GegenStandpunkt 3-17, S. 130