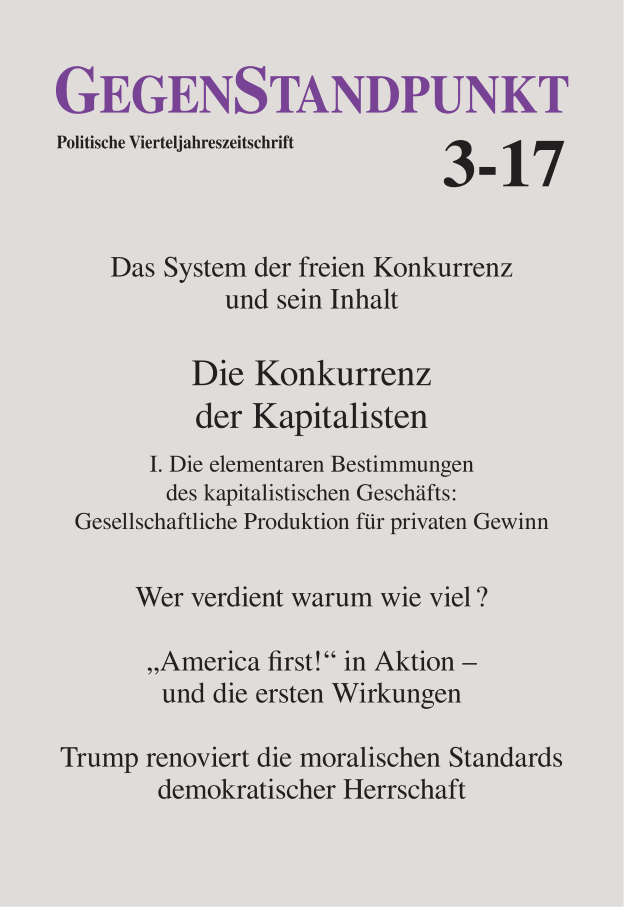Die Konkurrenz der Kapitalisten
Kapitel I: Die elementaren Bestimmungen des kapitalistischen Geschäfts: Gesellschaftliche Produktion für privaten Gewinn
Den Unternehmern wird manche Aufgabe zugeschrieben, einiges an Leistungen abverlangt und auch die Verletzung ihrer Pflichten vorgeworfen. Keine der positiven oder negativen Funktionen, die diesem Berufsstand nachgesagt werden, erfüllt er jedoch, wenn er nicht seine Sache erledigt. Diese besteht darin, dass er das Vermögen vermehrt, über das er verfügt – ganz gleich, ob ihm eine nationale Öffentlichkeit die Schaffung von Arbeitsplätzen zugutehält oder deren Vernichtung zur Last legt, ob er in der Meinung des Publikums die Umwelt schont oder schädigt, ob er zum Wachstum beiträgt oder es gefährdet...
Aus der Zeitschrift
Teilen
Siehe auch
Systematischer Katalog
Gliederung
- § 1 Die Tätigkeit des industriellen Kapitalisten
- § 2 Der Markt
- § 3 Der bürgerliche Staat
- § 4 Der kommerzielle Kredit
- 1. Kontinuität und Effektivität produktiver Geldvermehrung als Liquiditätsproblem und dessen Lösung
- 2. Das Vertrauen auf kontinuierlichen Geschäftserfolg der Konkurrenten als Quelle benötigter Liquidität, also als Mittel zur Herbeiführung des antizipierten Geschäftserfolgs
- 3. Produktivkraft und Risiko des Vertrauens von Gläubigern wie Schuldnern auf die Geschäfte der ganzen Zunft
- § 5 Die staatliche Betreuung der Konkurrenz, die sich des Kredits bedient: Rechtsschutz für das Eigentum, das durch die Verwendung von Zahlungsversprechen als Geld gefährdet wird
- § 6 Notwendig falsches Bewusstsein über Geld, Gewinn, Eigentum, Markt und Staat; gewöhnlich sowie wissenschaftlich
- 1. Grundmuster der Würdigung, die die Einkommensquelle Kapital erfährt: Die Beschwörung von Leistungen, die mit dem Zweck nichts zu tun haben, ihn aber gutheißen
- 2. Die ‚Schattenseiten‘ als Problem: arm/reich, Verteilung, Knappheit/Maßlosigkeit
- 3. Die BWL: Marktwirtschaft als Inventar von Faktoren, mit denen resp. über die ein Unternehmen disponiert, also im Sinne seines „ökonomischen Prinzips“ Entscheidungen zu treffen hat
Die Konkurrenz der Kapitalisten
Kapitel I
Die elementaren Bestimmungen des kapitalistischen Geschäfts: Gesellschaftliche Produktion für privaten Gewinn
§ 1 Die Tätigkeit des industriellen Kapitalisten
1. Geldvermehrung als Zweck der Produktion – Lohnkosten als Schranke der Rentabilität, Arbeitsleistung als ihr Mittel
Den Unternehmern wird manche Aufgabe zugeschrieben, einiges an Leistungen abverlangt und auch die Verletzung ihrer Pflichten vorgeworfen. Keine der positiven oder negativen Funktionen, die diesem Berufsstand nachgesagt werden, erfüllt er jedoch, wenn er nicht seine Sache erledigt. Diese besteht darin, dass er das Vermögen vermehrt, über das er verfügt – ganz gleich, ob ihm eine nationale Öffentlichkeit die Schaffung von Arbeitsplätzen zugutehält oder deren Vernichtung zur Last legt, ob er in der Meinung des Publikums die Umwelt schont oder schädigt, ob er zum Wachstum beiträgt oder es gefährdet...
Der industrielle Kapitalist betreibt die Vermehrung seines Besitzes, indem er die Elemente eines Produktionsprozesses erwirbt – er kauft Rohstoffe und Maschinerie und bezahlt Lohnarbeiter –, den zweckmäßigen Ablauf der Produktion organisiert und die Produkte verkauft. Zweckmäßig sind diese Operationen dann vollführt, wenn der Eigentümer des Unternehmens einen Überschuss über seine Kosten erzielt. Der Teil des Erlöses, der ihm seine Kosten ersetzt, dient zur Erhaltung des Betriebs; durch dessen Fortführung wirft ihm sein Eigentum stetig Gewinn ab, dient ihm als Quelle seines Einkommens. Dieser Überschuss, der wie der getätigte Kapitalvorschuss eine Geldsumme darstellt, dient ihm zur Bestreitung seines Lebensunterhalts, der sich bei ihm wie bei allen anderen Leuten über den Kauf von Waren zum Zwecke ihrer Konsumtion vermittelt. Dabei schließt die Kalkulation des Unternehmers, die auf die Maximierung des Gewinns gerichtet ist, jenseits aller Gerechtigkeitsvorstellungen über eine angemessene Höhe des Lohnes den prinzipiellen Gegensatz zum Einkommen der Lohnabhängigen ein, deren Dienste in Anspruch genommen werden. Dieses Einkommen stellt in der Rechnung des kapitalistischen Betriebs jene Größe dar, die in der Welt des demokratischen Sachverstandes Lohnkosten heißt und mit der größten Selbstverständlichkeit der Rentabilität der Produktion gegenübergestellt wird.
Die Führung des Unternehmens besteht in lauter Maßnahmen zur Herstellung und Steigerung der Rentabilität, die als Zweck des Betriebes zur entscheidenden Eigenschaft aller seiner Momente und Bestandteile wird. Die Betrachtung sämtlicher Elemente des Produktionsprozesses unter dem Gesichtspunkt, inwiefern sie auf Grundlage ihrer Kosten zur Erwirtschaftung von Gewinn beitragen, offenbart dem industriellen Kapitalisten die Sachzwänge seines Gewerbes, denen er zur Sicherung seines Betriebserfolgs gehorchen muss.
Der ebenso elementare wie umfassende Sachzwang, mit dem ein Unternehmen konfrontiert ist, hat in Gestalt eines geflügelten Wortes Eingang in die Kultur des späten Abendlandes gefunden. Mit der Redensart „time is money“ spielt der bürgerliche Verstand auf den ökonomischen Sachverhalt an, dass der Ertrag, den ein Kapitalvorschuss seinem Besitzer abwirft, von der Zeit abhängt, in der die investierte Geldgröße samt Gewinn zurückfließt und erneut angewendet werden kann. Die Umschlagsgeschwindigkeit seines Kapitals entscheidet darüber, wie oft sein Vermögen innerhalb eines bestimmten Zeitraums seine Gewinn bringende Funktion verrichtet. Die Verkürzung der Produktionszeit wie der Zirkulationszeit erhöht also die Rentabilität des Kapitals. Was die Zirkulationszeit angeht, ist der Unternehmer auf die zahlungsfähige Nachfrage nach seinen Produkten angewiesen und darauf aus, den Transport der Ware zur Kundschaft rasch abzuwickeln. Die Verwandlung von Ware in Geld stattet ihn mit der Liquidität aus, die er zur Vermeidung von Unterbrechungen des Produktionsprozesses benötigt. Dessen Bestandteile unterscheiden sich nach der Dauer ihrer Anwendung und damit hinsichtlich des Zeitpunktes, zu dem sie ersetzt werden müssen. Im Interesse der Kontinuität der Produktion bedarf der Geschäftsmann stets „flüssigen Geldes“, um verbrauchte Produktionselemente zu erneuern. Das ist bei manchen erst nach mehreren Umsatzprozessen fällig und kennzeichnet sie als „Anlagevermögen“. Als „Umlaufvermögen“ gelten dem Kapitalisten dagegen die Teile seiner Firma, die er beständig durch neue Kaufakte ersetzen muss. Unter dem Gesichtspunkt der Beschaffung erforderlicher und der Vermeidung unnötiger Liquidität gliedert er schließlich sein gesamtes Vermögen auf, das nebeneinander in Form von Produktionsfaktoren, abzusetzenden Waren und Geld vorhanden ist. Er ist bestrebt, den Übergang von der einen Form in die andere zu beschleunigen, was er im Bereich der Produktion durch die Verkürzung der Produktionszeit bewerkstelligt.
Deshalb erschöpft sich der geschäftsdienliche Umgang mit dem „Produktionsfaktor Arbeit“ auch nicht in der Befolgung der Notwendigkeit, die sich als Zwang zur fristgemäßen Bezahlung der Arbeitskräfte äußert, damit diese die Produktion am Laufen halten. Mit der Entlohnung seines Personals kommt der Unternehmer in den Genuss des Rechts und der Freiheit, die von ihm „geschaffenen Arbeitsplätze“ dem Betriebszweck entsprechend zu gestalten: Je mehr gearbeitet wird, desto schneller schlägt sein Kapital um, wobei die Verkürzung der Produktionszeit einerseits durch längere Arbeitszeit, andererseits durch kürzere Arbeitszeit pro Ware herbeigeführt wird.
Mit der Umschlagsgeschwindigkeit des gesamten Kapitals steigen die ihm entspringenden Überschüsse also in dem Maße, in dem der industrielle Kapitalist seinen Arbeitskräften Leistung abverlangt. Im Umgang mit den von ihm „beschäftigten“ Lohnarbeitern folgt er dem Gebot seiner kaufmännischen Rechnung, der zufolge sich alle Kosten lohnen müssen, in besonderer Weise: Über den Einsatz der Arbeitskräfte stellt er die Rentabilität des Betriebs her. Und die Form der Bezahlung, welche den Lohn der Arbeiter an Arbeitszeit und Leistung bindet, ist das Instrument einer Kalkulation, die den Gewinn zum Maß nicht nur des Einkommens der Lohnabhängigen, sondern auch ihres Dienstes macht. Den Gegensatz, in dem die produktive Geldvermehrung zum Lebensunterhalt der Arbeitskräfte steht, ergänzt der seinen Betrieb planende Unternehmer um einen zweiten: Sein Geschäftserfolg geht auf Kosten der Lebenszeit und der Lebenskraft seiner Arbeiter. Weil seine Überschüsse in dem Grad wachsen, wie er die Arbeitsleistung seiner Belegschaft steigert, liest er am Gewinn des Unternehmens und dem Anteil der Lohnkosten auch die „Arbeitsproduktivität“ ab, mit der sein ganzes Unternehmertum steht und fällt.
Zusatz
Diese Gleichsetzung der Produktivität der Arbeit mit ihrer Wirkung auf die Unternehmensbilanz verrät weniger über den Mangel an theoretischem Unterscheidungsvermögen als über die Aufgabe, die der Arbeit im Kapitalismus praktisch auferlegt wird. So sehr nämlich die Kalkulation mit Kosten und Ertrag auf der Leistung beruht, zu der eine Belegschaft befähigt ist und angehalten wird, so wenig kommt es andererseits darauf an, dass Arbeiter mit möglichst geringem Aufwand an Kraft und Zeit eine hohe Anzahl von Produkten fertigen. Das Geschäftsinteresse, das die Produktivkraft der Arbeit fordert und fördert, ist keineswegs bedient, wenn durch wenig Arbeit viel erzeugt wird. Der Standpunkt der Rentabilität unterwirft die Arbeit einem ihrer Produktivität fremden Maßstab. Während es beim Arbeiten für sich genommen, wenn es produktiv sein soll, darauf ankommt, dass eine Gesellschaft in zweckmäßiger Arbeitsteilung und unter Einsatz von technischem Gerät auf Grundlage wissenschaftlicher Naturbeherrschung mit einem Minimum an Kräfte- und Nervenverschleiß ein Maximum an Ausbildung und Befriedigung von Bedürfnissen zuwege bringt und dabei denen, die die Arbeit tun, ein Höchstmaß an freier Zeit verschafft, verknüpft die kapitalistische Rechnung hier lauter Geldgrößen miteinander: An die Stelle der Bedürfnisbefriedigung setzt sie den Erlös aus dem Verkauf produzierter Ware, auf der anderen Seite an die Stelle einer vernünftigen Arbeitsteilung das Arbeitsentgelt, mit dem die Unternehmen sich eine Betriebsbelegschaft zusammenstellen und ihrem Kommando unterwerfen, also an die Stelle des Arbeitsaufwands den Geldaufwand für Arbeit, sowie an die Stelle technischer Beherrschung der Natur den Geldaufwand für die Aneignung technologischer Errungenschaften und für deren Einsatz als Vorgabe für den Produktionsablauf im Betrieb. Maßgebliches Erfolgskriterium ist dabei der größtmögliche Überschuss des Geldertrags über den nötigen Vorschuss. Deswegen lässt der kapitalistische Unternehmer seine Leute so lange und so intensiv wie möglich produktiv tätig werden; denn in dem Maß, wie verkäufliches Zeug zustande kommt, wirkt die Arbeit als Geldquelle. Ihre Wirkung als Geldquelle für sich, als Gewinnquelle, stellt der Unternehmer her, indem er da, wo er das Sagen hat, in seinem Betrieb, die bezahlte Arbeit und die gekauften technischen Gerätschaften zueinander in ein seinem Zweck gemäßes Verhältnis setzt. Er scheidet wie selbstverständlich zwischen „Arbeit“ als einem betriebseigenen „Faktor“ auf der einen Seite, der gar nichts weiter zum Inhalt hat und beisteuert als kräfte- und nervenzehrende Tätigkeit nach dem Kommando und gemäß den technischen Vorgaben des Betriebs, und auf der anderen Seite allem, was diese Tätigkeit materiell produktiv werden lässt, also erst zu wirklicher Arbeit macht: Alle Produktionsmittel und Produktivkräfte werden gar nicht der Arbeit als ihr Instrumentarium zugerechnet, sondern dem Unternehmen, dem es gehört, als dessen Leistung: dem „Faktor Kapital“ als dessen ureigener Beitrag zum Produktionsergebnis. Dementsprechend wird die Arbeit so bezahlt, als wäre sie für sich genommen tatsächlich total unproduktiv; so nämlich, dass die Belegschaft so lange und so intensiv arbeiten muss, als hätte der Arbeitstag kaum genug Stunden, um den Gegenwert dessen zustande zu bringen, was ein Arbeiter für seinen Lebensunterhalt braucht. Zugleich, das ist die andere Seite der Trennung zwischen der Arbeit und ihrem Inhalt, ihren Mitteln und ihrer Produktivität, wird sie unter die Bedingung gesetzt – andernfalls findet sie gar nicht statt –, in Kombination mit dem „Faktor Kapital“, an den vom Unternehmen eingerichteten Arbeitsplätzen, eine solche Produktivität zu entfalten, dass sie dem Unternehmen ein Mehrfaches ihrer eigenen Kosten als dessen Gewinn hinstellt; in Gestalt verkäuflicher Ware, in der äußerst produktive Arbeit, pro Einheit also ganz wenig bezahlte Arbeit drinsteckt. So geht alle Produktivität aufs Konto des Unternehmens; die Arbeit wird genau dafür bezahlt, die von ihr getrennte, unternehmenseigene gesellschaftliche Produktivkraft, realisiert in Maschinerie und vorgegebenen Betriebsabläufen, zu „beleben“ und für ein insgesamt lohnendes Betriebsergebnis wirksam werden zu lassen. Diesem Zweck entsprechend sieht die Arbeit dann auch aus: Gemäß dem auf maximalen Output programmierten, so weit es geht automatisierten Produktionsprozess wird das, was an menschlicher Tätigkeit noch vonnöten ist, in passgenaue Einzelschritte zerlegt und auf Leistungsdichte getrimmt. Was dabei herauskommt, ist das Gegenteil dessen, was die wesentliche Errungenschaft einer nach ihren eigenen Maßstäben produktiven Arbeit ausmachen würde: intensiver Verschleiß von Kraft und Nerven einen ausgedehnten Arbeitstag hindurch.
Diese unternehmerische Praxis gibt Aufschluss über die Quelle des Gewinns, um den es im kapitalistischen Unternehmen geht. Wenn man sie fragt, dann geben Hauptdarsteller wie Fachleute als dessen Grund den Zuschlag zu den Unkosten des Betriebs an, der dem wagemutigen Eigentümer zusteht und den „der Markt“ aus nicht weiter interessierenden Gründen auch grundsätzlich hergibt. Praktisch geht aber noch jeder Unternehmer davon aus, dass das, was er verdient, in seinem Laden unter seiner Regie erst einmal hergestellt werden muss. Und dort wird sie auch hergestellt: die Differenz zwischen einem Arbeitsentgelt, das von jeglicher Produktivkraft der Arbeit vollständig abstrahiert, nichts weiter als die kontinuierliche Möglichkeit des Tätigwerdens im Dienst des Betriebs, die Reproduktion der Arbeitskraft zum Inhalt hat, auf der einen Seite und auf der anderen Seite dem geldwerten Resultat des Einsatzes der Produktivkräfte der Arbeit, zu denen es die Gesellschaft gebracht und die der Unternehmer sich gekauft hat. Indem der Unternehmer die Arbeit, die er bezahlt, zum unproduktiven Lückenbüßer in seinem produktiv ausgestatteten Betrieb degradiert, macht er sie zu seiner Einkommensquelle.
2. Außerökonomische Voraussetzungen des Geschäfts, das seine Notwendigkeit und seine Macht auf die Leistungen politischer Gewalt gründet
Dass es dem Kapitalisten darum geht, sich zu bereichern; dass er diesem Interesse auf Kosten anderer Leute nachgeht – solche Urteile über den sozialen Charakter des Unternehmers gehen durchaus in Ordnung. Sie sind auch nie widerlegt worden. Stattdessen erfreuen sie sich einer gründlichen Relativierung, die in der Geschichte des Kapitalismus eindeutig als Sieger im Streit um die gerechte Würdigung dieses Berufsstandes hervorgegangen ist. Die Relativierung beruft sich erstens auf einen Sachverhalt, dem zu widersprechen albern ist: In der „Marktwirtschaft“, wie sie geht und steht, hängt so gut wie alles von den Leistungen der Kapitalisten ab, die deswegen auch im Unterschied zu gewöhnlichen Leuten „die Wirtschaft“ genannt werden. Zweitens dient diese tiefe Einsicht nicht als Fortsetzung der Kritik, die im Vorwurf der Bereicherung ausgesprochen ist, sondern als guter Grund dafür, das Geschäft der Kapitalisten in ein rosiges Licht zu tauchen. In tausend Abwandlungen der immergleichen Botschaft – ausgerechnet die reichhaltige Warensammlung und die Arbeitsplätze, welche wir den Unternehmern und sonst niemandem zu verdanken haben, stehen da hoch im Kurs – wird die Unentbehrlichkeit der Dienste beschworen, die dem Bereicherungsdrang von Kapitalisten entspringen. Mit dieser positiven Wende zur Anerkennung des Geschäfts der Geldvermehrung bezeugt der bürgerliche Verstand nicht nur seinen Respekt vor den tüchtigen Leuten, die ihren Besitz in ein Unternehmen stecken und die damit verbundenen Sachzwänge meistern. Die Hochachtung erstreckt sich auch gleich noch auf das Produktionsverhältnis, das in seiner angeblichen Unverrückbarkeit schlicht ein Werk der Gewalt darstellt.
Um die gesellschaftliche Produktion der Geschäftstüchtigkeit von Kapitalisten zu unterwerfen, so dass das Zustandekommen und die Verteilung des Reichtums tatsächlich zur abhängigen Variable der Rentabilität gerät, bedurfte es erst einmal der Etablierung des Privateigentums. Der Staat erhebt die ausschließende Verfügung über sämtliche Mittel der Konsumtion wie Produktion zum geltenden Recht. Und indem er das Geld als verbindliches Maß des Privateigentums in Kraft setzt, legt er seine Gesellschaft auf den Erwerb dieses abstrakten Reichtums fest. Als Mittel, mit dem sich die Bürger Zugang zum stofflichen Reichtum verschaffen müssen, wird es zum Zweck des „Wirtschaftens“ schlechthin. Es trennt nicht nur jedes Bedürfnis von den Objekten seiner Befriedigung – was dem Geld das Kompliment eingebracht hat, dass es den allseitigen Austausch von Gütern ermögliche. Es scheidet auch die Arbeit von ihren Mitteln, die in der Verfügung ihrer rechtmäßigen Besitzer deren Kapital darstellen. Ihnen steht in Gestalt von Arbeitskräften eine soziale Klasse gegenüber, deren Mitglieder den Part des käuflichen ‚Produktionsfaktors‘ Arbeit übernehmen.
Die historische Leistung, durch die sich die politische Gewalt zum modernen bürgerlichen Gemeinwesen geläutert hat, das längst als die einzig wahre Art, Staat zu machen, gilt, ist ihrem ökonomischen Inhalt nach gar nicht hoch genug einzuschätzen. Mit der gebotenen Brutalität hat der Staat die überkommene Produktionsweise zerstört, eine neue Scheidung von gesellschaftlichen Klassen herbeigeführt und alles Arbeiten und Leben der Privatmacht des Geldes untergeordnet. Seitdem ist der Erfolg einer besonderen Klasse, nämlich der mit der Revenuequelle Kapital, identisch mit dem Allgemeinwohl; diesem dient die in die Freiheit der Lohnarbeit entlassene Klasse, weil dieser Dienst das sachlich gebotene wie gesetzlich geschützte Lebensmittel ist. Da mit der Lohnarbeit Sklaverei und feudale Unterjochung höchst zivilisierten Arten der „Beschäftigung“ gewichen sind, wird der Rolle der Gewalt als Geburtshelfer des Kapitals seitens der geschichtsbewussten Elite weniger gedacht. Um so mehr allerdings wird der Staat, dessen Gewalt als erste Produktivkraft des kapitalistischen Geschäfts so wenig gewürdigt wird, für die Fortschritte und Konjunkturen des Geschäfts in Anspruch genommen – als „Rahmenbedingung“.
§ 2 Der Markt
1. Keine Wirtschaftsweise, sondern die Zirkulation des Kapitals
Der traditionelle Name für die Gesellschaftsordnung, in der Kapital – privates Geldvermögen, das sich durch seine Investition in einen Betrieb vermehrt – nicht nur eine Einkommensquelle unter anderen darstellt, sondern in Form eines politisch herbeigeführten Sachzwangs die Maßstäbe in allen ökonomischen Belangen setzt, lautete einmal Kapitalismus. Mit dieser Bezeichnung war nicht nur die Vorstellung von einem gesellschaftlich gültigen Zweck verbunden, dem Arbeit und Wohlstand, Fleiß und Bedürfnisse untergeordnet und verpflichtet sind. Auch die Erfahrung, dass der Dienst an Geld und Profit für die meisten Leute einiges an Opfern mit sich bringt, war stets präsent und gemeint, sooft das „System“ mit einem „-ismus“ gekennzeichnet wurde, der das herrschende Interesse benannte. Dem ist von klugen Sprachreglern, die noch in jedem Wort enttäuschter Bürger den Willen zur Systemkritik, den Aufbruch zum Kommunismus entdeckt haben, ein Ende bereitet worden. Sie haben beschlossen, dass es sich um Marktwirtschaft handelt.
Dieser Name ist sicher gut gemeint. Er vermeidet zielstrebig eine Auskunft darüber, worum es geht. Stattdessen meldet er zurückhaltend an, wie es unter gesitteten bürgerlichen Verhältnissen zugeht. In unserer Wirtschaftsordnung halten wir uns an ein Verfahren, durch das ermittelt wird, was ökonomisch sinnvoll ist. Dieses Verfahren denken wir uns auch als Instanz, und die heißt Markt. Der Respekt vor seinen Befunden unterscheidet uns wohltuend von notorischen Missgriffen der Geschichte, die den Staat mit seinem Plan an die Stelle des Marktes gesetzt haben.
Die Mängel der Umbenennung sind indes nicht zu übersehen. Wer das Motiv für den neuen Namen schätzt – ein entschiedener Systemvergleich soll geliefert werden –, kann auch bemerken, dass das Lob des Marktes ziemlich matt daherkommt. Immerhin wird der Instanz, auf die die Wahl gefallen ist, eine Leistung zugutegehalten, die sich auch anders erledigen lässt. Der Eifer des Vergleichens, der das bessere Verfahren in Wirtschaftsdingen herausstellen will, kommt einfach nicht zu einer Differenz in der Sache. Deshalb haben die von der Überlegenheit des Marktes überzeugten Advokaten auch stets die Vorzüge der Marktwirtschaft durch zusätzliche nützliche Hinweise bekräftigt. Außerökonomische Wohltaten wie die „Freiheit des Individuums“ sind da genauso beliebt wie die energische Aufforderung, den immensen Reichtum zu bewundern, der zustande kommt, wo die Freiheit des Marktes herrscht. Und dass der Markt mit seinem Preismechanismus für die Verteilung von Gütern und Produktionsfaktoren sorgt, also für die Koordinierung in einer auf Arbeitsteilung beruhenden Welt zuständig ist, spricht ebenfalls für ihn.
Außer dem Vorsatz, mit dem sie erstellt wurden, ist an diesen Argumenten nichts glaubwürdig. Man muss schon von der Verteilung des Reichtums, die in der Marktwirtschaft stattfindet, absehen, um einmal den Reichtum, dann aber auch die Tatsache, dass er verteilt wird, zu schätzen. Jedenfalls darf man sich nicht auf die ebenso bekannte Tatsache besinnen, dass das Verteilen der irdischen Güter einen sozial angemessenen Verlauf nimmt, also eine interessante Hierarchie von ganz arm bis steinreich stiftet, aber keineswegs jedem Individuum angenehm ist. Solche Leistungen des Handels lassen sich auch schwerlich preisen, wenn man wie der Volksmund ein ums andere Mal die Beobachtung wiederholen kann, dass der berüchtigte „Marktmechanismus“ die Initiative von leibhaftigen Individuen irgendwie auf das Maß ihres Geldbeutels reduziert; dass die Mehrung des Reichtums nicht durch flotten Austausch zustande kommt, muss der Abnehmer solcher Belehrungen gleich auch noch vergessen. Wenig überzeugend ist schließlich die Feier des Marktes als Antwort auf die Probleme, die sich aus einer zuvor beschlossenen oder irgendwie erfolgten Spezialisierung der Gewerbe ergeben. Die „Allokation“ hat immerhin Privateigentümer als Absender wie als Adressaten, und die „Faktoren“ landen nicht, wo technischer oder sonst ein Bedarf sichtbar wird, sondern dort, wo gezahlt wird. Bisweilen bleiben sie auch liegen.
Die schönen Funktionen, die dem Markt – auf dem Waren, also Produkte des Kapitals, die einen Preis haben, zirkulieren – zugeschrieben werden, erweisen sich allesamt als Produkte der Absicht, vom Kapitalismus nicht zu reden, wenn der erzkapitalistischen Operation des Tausches von Ware gegen Geld die Honneurs bereitet werden. Wenn es den Apologeten der Marktwirtschaft übrigens um das Gelingen der Volkswirtschaft, auf die sie ihr Sorgerecht angemeldet haben, geht, werden sie auch zu forschen „Realisten“. Sie vergessen ihre „Gleichgewichtsmodelle“ und „Theorien der Preisbildung“ ebenso wie ihre Einfälle bezüglich der Vorteile, die sie dem Instrument des Marktes andichten – und schlagen sich auf die Seite des Geschäfts, das sich des Marktes bedient.
2. Konkurrenz um die Erzielung lohnender Preise
Der Zweck des allseitigen Kaufens und Verkaufens hat mit den Erträgen der Forschung deshalb nichts zu tun, weil der Markt nicht der Knappheit der Güter wegen mit Waren beschickt wird, sondern zur Realisierung von reichlichen, in Geld gemessenen Erträgen. Deshalb ist die Höhe des Marktpreises von Bedeutung – nämlich im Verhältnis zu den Herstellungskosten der Ware. Der industrielle Kapitalist setzt als Anbieter von Ware sein Geschäft der entscheidenden Prüfung aus; an der zahlungsfähigen Nachfrage erfährt er, ob er rentabel produziert. Mit dem Teil seines Vermögens, der in Form von Waren zum Verkauf ansteht, tritt er in einen Vergleich mit anderen Anbietern ein, die wie er das Geld der Gesellschaft für die Gewinn bringende Bezahlung ihrer Produkte beanspruchen. Der Erfolg seiner Kalkulation erweist sich als abhängig vom Verlauf der Konkurrenz, die um die Masse und mit dem Marktpreis der verkauften Ware geführt wird.
Dabei findet Konkurrenz zunächst innerhalb der unterschiedenen Sphären der Produktion statt. Gleiche bzw. gleichartige Produkte, deren Gebrauchswert auf dieselben Bedürfnisse abstellt, werden von den Abnehmern schlicht nach dem Betrag verglichen, der auf dem Preisschild steht. Dieser Preisvergleich zwingt alle Anbieter, schon wegen der Verkürzung der Umlaufszeit, höchstens mit denselben Verkaufspreisen anzutreten wie ihre Konkurrenten. Ihr Gewinn, der sich aus der mit der Anzahl von abgesetzten Waren multiplizierten Differenz zwischen Marktpreis und Stückkosten errechnet, ist damit abhängig von ihrer individuellen Produktivität im Verhältnis zu dem Stand der Produktionskosten der gesamten Branche. Ohne Schaden für den Profit – den Unternehmenszweck – steht ein Kapitalist diesen Zwang des Marktes nur durch, wenn er sich aufgrund der Stückkosten den Marktpreis leisten kann, mit dem die übrigen Wettbewerber seiner Sphäre ihre Rentabilität herstellen. Zum anderen findet Konkurrenz auch zwischen den Sphären statt. Die Masse der Waren, die ein Geschäftszweig losschlagen kann, hat ihre Schranke am zahlungsfähigen Bedürfnis der übrigen Sphären bzw. der Konsumenten. Die Nachfrage, auf die ein Kapitalist trifft, ist bedingt einerseits durch das quantitativ umschriebene Bedürfnis nach den Gebrauchswerten, die seine Branche herstellt, andererseits durch das Geld, das diesem Bedürfnis zu Gebote steht – wobei der stoffliche Bedarf sich mit der „Kaufkraft“, die entscheidend ist, keinesfalls zu decken braucht. Der Wettbewerb innerhalb einer Sphäre ist in Verlauf wie Resultat abhängig vom Verhältnis zwischen dem Quantum ihrer zum Marktpreis angebotenen Erzeugnisse und dem gesellschaftlichen Bedarf. An ihrem Absatz erfahren die Unternehmen, dass ihr Gewinn durch die Verteilung des Kapitals auf die verschiedenen Gewerbe bedingt ist, welche die Zahlungsfähigkeit aller anderen für die Realisierung ihrer Waren gegeneinander in Anspruch nehmen. So stellt „der Markt“ dem privaten Geschäft mit den ihm eigenen Kalkulationen die gesellschaftlichen Bedingungen seines Gelingens entgegen. Damit befasst, die Privatmacht seines Geldes zu mehren, lässt jeder Kapitalist für den Markt, zum Zwecke des Verkaufs, produzieren. Andererseits fällt deswegen auch das notorische Verhältnis von Nachfrage und Zufuhr das praktische Urteil darüber, ob und in welchem Maß seine Produktion rentabel ist. Der „Markt“, der zu Recht auch als Synonym für Konkurrenz genommen wird, weil er kein Ort, sondern eben diese Veranstaltung ist, erteilt ex post den Befund über die Leistung kapitalistischer Betriebe, auf die es ihnen ankommt. Im stattfindenden oder unterbleibenden Austausch von Ware gegen Geld wird ermittelt, ob das Geschäft eines ist – und über die auf es verwandten Kosten und Mühen entschieden. Diese Manier, über die gesellschaftliche Notwendigkeit des Einsatzes von Arbeit und Arbeitsmitteln zu befinden, ist wahrlich mit Planung nicht zu verwechseln; und wenn an hohen wie niedrigen Preisen die Brauchbarkeit von Gütern aller Art auf kapitalistisch vorbuchstabiert wird, kommt auch weniger die dem Kapitalismus angedichtete wie von Schöngeistern angekreidete „Zweckrationalität“ zum Vorschein als die banale Rechengröße, die jeden Anflug von Vernunft der Realitätsfremdheit überführt.
3. Angebot und Nachfrage: Vom freien Spiel der Kräfte und seinem Inhalt
Unternehmen, die ihre Waren zu einem Preis losschlagen, der sich rentiert, heißen konkurrenzfähig. Diese zum Inbegriff kapitalistischen Erfolgs gewordene „Eigenschaft“ eines Betriebs hebt zugleich die Tüchtigkeit seines Inhabers bzw. Leiters hervor, allerdings ohne groß auf dessen Leistung einzugehen. Jedenfalls will niemand, der einem Unternehmen „Konkurrenzfähigkeit“ attestiert, gesagt haben, hier hätte einer einen Teil der gesellschaftlichen Produktion samt der davon abhängigen Arbeit zur Befriedigung von Bedürfnissen eben seinem Bedürfnis nach Geld unterworfen. Vielmehr liegt der Akzent auf der Anerkennung dafür, dass es einem Unternehmer gelungen ist, in einer Sphäre zu investieren, deren Erzeugnisse entweder die Kostenrechnung anderer Kapitalisten befördern oder Verbraucherhaushalten die nötige Nachfrage abtrotzen; dass er es geschafft hat, seine Produkte im Vergleich zum Rest der Branche „preiswert“ herstellen zu lassen; kurz: dass die Kalkulation und Organisation seiner Fertigung vor der „Herausforderung“, dem „Druck des Marktes“ Bestand haben.
Der auffällige Kontrast zwischen dem Lob, das sie der Freiheit des Marktes zollen, und der gleichzeitigen Beschwörung des Zwanges, der vom Markt ausgeht, bereitet den Kennern der Marktwirtschaft wenig Schwierigkeiten. Wo sie den Markt mit seinen Geschäftsgelegenheiten vermissen, rufen sie nach ihm und nach Freiheit gleich mit; wo sie bemerken, dass der Markt dem Geschäft Schranken setzt, rechtfertigen und fordern sie sämtliche Maßnahmen, die Kapitalisten ergreifen – müssen! –, um ihren Geschäftszweck gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Insofern nehmen sie auch wieder Abschied von der Legende, wenn es um „das Wirtschaften“ geht, sei der Markt das Verfahren ihrer Wahl. Sie nehmen einfach Partei für den Ertrag, den ein Unternehmer zu erwirtschaften hat, wenn er einer bleiben will, und den er sich im Austausch von Ware und Geld aneignet. Wenn seine Produkte dem Markt keinen Überschuss entlocken, verurteilen gestandene Theoretiker wie Praktiker des überlegensten aller Systeme nicht den Markt, der Produkte, Produktionsstätten und Arbeit für unwirtschaftlich und überflüssig erklärt. Dann tadeln sie die Unternehmen und ihr totes und lebendiges Inventar, weil sie kein Geld machen.
Mit diesem Respekt vor dem Markt ist der schlichte Standpunkt der praktischen Notwendigkeiten eingenommen, die nicht wegen der wohlüberlegten Entscheidung für den hilfreichen Markt anstehen, sondern als Konsequenzen des kapitalistischen Regimes fällig sind.
- Wenn dem Markt die Aufgabe obliegt, über die Realisierung lohnender Preise zu entscheiden, ob ein Produkt den Weg dorthin findet, wo ein Bedürfnis nach ihm besteht, dann ist das Geld auch nicht Mittler zwischen zwei unschuldigen Gewichten namens Angebot und Nachfrage, sondern Zweck und Grund des Austausches.
- Wenn die Bezahlung lohnender Preise den Schiedsspruch über die „Wirtschaftlichkeit“ der Produktion fällt, dann richtet sich die ganze ökonomische Vernunft auch nicht auf die Erzeugung brauchbarer Güter, sondern auf die Herrichtung der Gesellschaft zum Markt, als der sie die Vermehrung von Kapital zu bewerkstelligen hat.
- Wenn auf dem Markt und „um Märkte“ konkurriert wird, dann ist die Sphäre des Austausches nicht nur das Mittel der Kapitalisten, sondern auch die Abteilung ihres Geschäfts, in der sie einander beschränken. Mit ihren besonderen Produktionsbedingungen angetreten, machen sie sich wechselseitig ihren Gewinn streitig; so erst unterwerfen sie sich dem allgemeinen Maßstab der Kapitalvermehrung, dem „-ismus“, dem sie Genüge tun oder auch nicht.
- Der Vergleich zwischen Unternehmen, der in der Zirkulation von Waren und Geld tagtäglich seiner Entscheidung, die in Unternehmensbilanzen beziffert ist, zugeführt wird, verweist die Kapitalisten stets aufs Neue auf die marktgerechte Planung ihrer Produktionsprozesse. Die emphatische Absage an die Planwirtschaft hat den Beschluss zur Folge, die Produktion von Profit minutiös zu organisieren.
- Mit der Herstellung einer gesellschaftlichen Arbeitsteilung, auch mit der Anerkennung einer überkommenen Aufteilung der Produktion, hat diese Praxis nichts zu schaffen. Die einzige Konvention, die zwischen den maßgeblichen Subjekten der Wirtschaft besteht und gilt, ist die Respektierung des Geldes als das
reale Gemeinwesen
der Marktwirtschaft. Über das Geld und nur über es treten sie in Beziehung zueinander; und nach den Bedingungen des Geldverdienens, die sie sich aufherrschen, entscheiden sie ganz ohne weitere Rücksprache mit ihren Konkurrenten, was und wie viel sie wann produzieren lassen. Was auf diese Weise ver- und aufgeteilt wird, sind Kapitalanlagen.
4. Der „Arbeitsmarkt“
Dass nicht die Individualität, sondern das Kapital freigesetzt ist in der freien Konkurrenz, kriegen etwas härter als die Kapitalisten – deren persönliches Geschick öfter zum Risiko ausartet – diejenigen zu spüren, die den Arbeitsmarkt
bevölkern, obwohl der natürlich auch kein Ort, sondern eine Unterabteilung des kapitalistischen Rechnungswesens ist:
- erstens, weil ihre Betätigung in kapitalistischen Betrieben ganz so ausfällt, wie es die gewinnträchtige Gestaltung des Arbeitsplatzes, der „Stelle“, verlangt. Ein Feilschen um einen Tausch zwischen gewissen Portionen Arbeit und dazu passenden Geldsummen ist in kapitalistischen Betrieben nicht üblich, weil mit dem Amtsantritt des Arbeiters an seinem Platz entweder fixiert ist oder nicht, was er für seine Arbeit bekommt; wie die aussieht, ergibt sich in beiden Fällen aus der Kostenrechnung des Unternehmens.
- zweitens, weil ihre Betätigung bisweilen gar nicht nachgefragt wird, während sie als Angebot herumlaufen. Genau dieses Phänomen – und nicht der andere Normalfall der Beschäftigung – ist merkwürdigerweise der Anlass und Gegenstand von Meldungen über den „Arbeitsmarkt“. Ganz als wäre den Marktbeobachtern klar, dass mit dem Markt, auf dem mit Arbeit gehandelt wird, etwas nicht ganz stimmt, bezeichnen sie die Anbieter von Arbeit urplötzlich wieder als „Arbeitssuchende“, um der speziellen Not dieser Spezies von Gewerbetreibenden gerecht zu werden. Dabei ist der seltsame Umstand, dass sich bei der „Ware Arbeit“ so schwer zwischen Anbietern und Nachfragern unterscheiden lässt, nur ein eindeutiges Indiz dafür, dass es diesen Markt gar nicht gibt.
- drittens, weil sie gar nichts außer sich als Arbeitskräfte anzubieten haben, über deren (Nicht-)Anwendung schon wieder das Geld entscheidet, dem sie zur Verfügung stehen müssen, um etwas zu verdienen. Die Ernennung von lauter armen Leuten zu freien Lohnarbeitern, die Einführung eines rentablen Preises für die Ware Arbeitskraft hat zwar viele sachfremde Spekulationen um den gerechten Lohn nach sich gezogen, ansonsten aber nur eine ganze Klasse der bürgerlichen Gesellschaft in den Status einer Ware versetzt. Dass die Handelsobjekte des „Arbeitsmarktes“ auch solche bleiben, ist durch den Preis, der für sie gezahlt wird, garantiert. Das Geld erfüllt konsequent die Funktion des Zirkulationsmittels – es wandert als Element des Kapitalkreislaufs aufs Gehaltskonto der Lohnabhängigen, um zur Erhaltung der Arbeitskraft wieder aus ihm zu verschwinden.
§ 3 Der bürgerliche Staat
Im Innern
1. Ein Gewaltmonopol für die freie Konkurrenz
In fertigen kapitalistischen Gesellschaften kleidet sich die Sorge um gute Geschäfte mit gebetsmühlenhafter Regelmäßigkeit in die Behauptung bzw. Forderung, der Markt habe von staatlicher Einmischung möglichst verschont zu werden. Die etwas einseitige Parole „Markt statt Staat“ – die insbesondere dann ziemlich weltfremd klingt, wenn Politiker, die gerade zu wirtschaftspolitischen Entscheidungen schreiten, sie sich zu eigen machen – bezeugt ein ausgeprägtes Anspruchsdenken. Vom Standpunkt der rentablen Anwendung ihres Kapitals nehmen konkurrenzbeflissene Unternehmer das Wirken der öffentlichen Gewalt vorwiegend als Einschränkung ihrer Freiheit zum gewinnträchtigen Kalkulieren wahr. Zwar versteigen sie sich nie zu Forderungen nach der Beseitigung des Staates, aber aufgrund der ihnen übertragenen „Verantwortung“ für den Gang „der Wirtschaft“ maßen sie sich das Recht an, vom Staat – der ihnen einmal die Konzession zur Vermehrung ihres Eigentums erteilt hat – nicht behindert zu werden. Mit der Gewohnheit, vom Staat zu verlangen, mit der Freiheit des Marktes
Ernst zu machen und sich der Förderung des Geschäfts zu befleißigen, ist freilich auch ein gewisser Verzicht verbunden: Von den alltäglichen und unabdingbaren Leistungen des Staates für die Konkurrenz der Privateigentümer wird in der Diskussion „Staat und/oder Markt“ keine Notiz genommen.
Die erste Leistung des Staates besteht in der Etablierung seines Gewaltmonopols. Politiker, die Gewalt für „kein Mittel der Politik“ halten, verlassen sich ebenso auf den Zwang, zu dem der Staatsapparat befugt ist – bzw. auf den Respekt vor den entsprechenden Mitteln –, wie Kapitalisten sich auf eine Ordnung angewiesen wissen, wobei sie dieses Bedürfnis durchaus mit den übrigen Akteuren des Marktes teilen. Merkwürdigerweise hat der ansehnliche Gewaltbedarf einer Gesellschaft, die sich gerne das Kompliment „frei“ ausstellt, der kapitalistischen Produktionsweise den Ruf eingetragen, sich wohltuend von historischen wie modernen Formen der „Gewaltherrschaft“ zu unterscheiden. Diese Verwechslung der Monopolisierung der Gewalt durch den politischen Souverän mit der Abwesenheit von Gewalt zeugt freilich davon, dass der Genuss der Freiheit, die der Markt bietet, die ständige und unangefochtene Ausübung von Gewalt durch den Staat so nötig hat, dass diese nicht als Unterwerfung, sondern als Dienst anerkannt wird. Die Staatsmacht unterbindet dauernd Gewalt, welche konkurrierende Privatsubjekte bei der Verfolgung ihrer Interessen seitens ihresgleichen zu gewärtigen haben – so dass das Gewaltverbot des Souveräns den Charakter des Schutzes annimmt. Die Staatsgewalt erspart ebenso sehr den Gebrauch von Gewalt für die Durchsetzung von Interessen gegen andere – nach dieser Seite hin kommt das Gewaltmonopol einer Ermächtigung gleich. Beide Wirkungen des staatlichen Gewaltmonopols sind in der bürgerlichen Gesellschaft jedermann geläufig – in den Ge- und Verboten des herrschenden Rechts wird den um ihren Wohlstand bemühten Marktbesuchern vorgeführt, dass sie Bürger sind: Untertanen eines Staates, der ihnen einiges gewährt und manches untersagt, damit sie sich frei betätigen können.
Dass der Staat seinen Bürgern den Gebrauch von Gewalt verbietet, ist notwendig. Aber nicht wegen der Menschennatur, sondern wegen der Natur der Freiheit, die er ihnen gestattet. Der über einige historische Wirren zustande gekommene Beschluss, „Marktwirtschaft“ zu treiben, erschöpfte sich nämlich nicht in der ersatzlosen Streichung der jedem Demokraten verhassten „persönlichen Abhängigkeitsverhältnisse“. Mit der Freiheit zum Gelderwerb begibt sich jedermann in die „unpersönliche“ Abhängigkeit vom Privateigentum, das er braucht, einsetzt und zu mehren sucht, und gerät in Gegensatz zu anderen Privateigentümern, die dasselbe tun. Jede ökonomische Betätigung, vom großen Geschäft über das gewöhnliche Arbeiten bis zum kleinsten Genuss, beruht auf dem Einsatz privaten Besitzes; nach Maßgabe ihres Eigentums, welches ihre Berechnungen bestimmt, gehen die Herren und Statisten des Marktes die Beziehungen ein, die – von Wirtschaftswissenschaftlern bestaunt – nicht nur die Produktion von Reichtümern aller Art bewirken, sondern auch eine Verteilung der einen Art von Reichtum, welche allein zählt: des Geldes, das die Verfügungsmacht über nützliche Güter misst und repräsentiert, die dem Eigentum innewohnt. Um diese Macht geht es bei der Vielfalt von Gebrauchsgütern und Diensten, auf die die Marktwirtschaft so stolz ist: Produziert und geleistet werden sie ja, um verkauft, in Geld – die Macht des Eigentums getrennt von den Produkten, mit denen es entsteht – verwandelt zu werden; Geld brauchen die geschätzten Marktteilnehmer, um an die Konsumartikel heranzukommen, die es reichlich gibt, von denen die Schranke fremder Verfügungsmacht sie aber trennt, bis sie dafür zahlen. So wird die Versorgung der Gesellschaft im Allgemeinen zu einem Dauerkonflikt zwischen Eigentümern ums Geld, genauer: um den Erwerb fremden Geldes. Und deswegen begibt sich die übergroße Mehrheit zwecks Gelderwerb, auf den eigenen Nutzen bedacht und aus freien Stücken, in einen Dienst der besonderen Art, an Eigentümern nämlich, die Angestellte und abhängige Dienstleister für die Vermehrung ihres Eigentums arbeiten lassen und nach Maßgabe dieses Zwecks bezahlen. In deren Händen fungiert Geld als Mittel des Kommandos über fremde Arbeit, der Aneignung der Arbeitsprodukte und der Konkurrenz um deren gewinnbringenden Verkauf. So „vermittelt“ das Geld das Verhältnis zwischen der Verfügungsmacht von „Arbeitgebern“ über Tätigkeit und Lebensunterhalt der Masse der Gesellschaft auf der einen Seite und der produktiven Dienstbarkeit berechnender freier Subjekte für die Bereicherung der Kapitalisten auf der anderen Seite; das Verhältnis also, mit dem über die Mühen der Produktion des Reichtums wie über die Schranken der Teilhabe daran schon prinzipiell entschieden ist.
Das alles ist Grund genug – für die Teilhaber am marktwirtschaftlichen Geschehen, einer regulierenden Aufsicht über ihr Erwerbsleben zu bedürfen, und für die öffentliche Gewalt, sich flächendeckend und intensiv mit dem Geschäftsverkehr ihrer Bürger zu befassen. Schließlich hätte schon die erste Voraussetzung dieser ökonomischen Praxis, die dem Eigentum innewohnende exklusive Verfügungsmacht, keinen Bestand, käme schon gar nicht als Prinzip der gesellschaftlichen Arbeit und Lebensführung in Frage, gäbe es nicht eine omnipräsente höhere Gewalt, die den freien Gebrauch dieser Macht garantiert und die darin beschlossenen Interessengegensätze und Gewaltverhältnisse reguliert. Das Geld und seine Verwendung als Kapital hat zwar keine Staatsmacht erfunden; aber dass die Privatmacht des Eigentums in der dinglichen Gestalt des Geldes „die Welt regiert“, geht nur, weil eine politische Herrschaft, die alle ihre Bürger ihren Gesetzen unterwirft, es so haben will und verbindlich festlegt, was – welcher Stoff oder auch was für ein gegenständliches Zeichen – als Geld gelten soll. Die Gewalt gegen- und übereinander, die der Staat seinen Bürgern verwehrt, gewährt er ihnen in dieser Form; der Klasse der Eigentümer, die die produktive Arbeit der Gesellschaft kommandiert, erspart er die Anwendung von Gewalt, indem er sie zum Gebrauch der Privatmacht des Geldes ermächtigt.
Eben darin besteht die zweite Leistung des Staates: Kraft seines Gewaltmonopols etabliert er neben und getrennt von sich das Herrschaftsverhältnis zwischen der Klasse der „Arbeitgeber“ und der Masse, die denen den Dienst der Bereicherung leistet. Er etabliert dieses Verhältnis als Privatsache derer, die genügend Geld haben, um andere für ihr Eigentum arbeiten zu lassen, wie der vielen anderen, die mangels Eigentum gegen Geld für solche Arbeit zu haben sind. So nimmt er der Kommandomacht der Kapitalisten eben dadurch, dass er sie als natürliche Folge seiner ganz allgemeinen Garantie der Privatmacht des Geldes etabliert, den Charakter eines Herrschaftsverhältnisses, verleiht ihr den Status einer gesetzlich geregelten Sachlage, in der widerstreitende komplementäre Interessen und Berechnungen aufeinander stoßen und private Vereinbarungen zu treffen sind. Sein eigenes Gewaltverhältnis zu seinen Untertanen trennt der Staat eben damit genauso grundsätzlich vom Verhältnis der ökonomischen Benutzung im Allgemeinen, des Kommandos über Arbeit, der Zumessung eines Entgelts, also der praktizierten Ausnutzung der bedürftigen Massen durch kapitalistische Unternehmer im Besonderen ab. Seiner Herrschaft nimmt er so den Charakter der Unterwerfung von Untertanen unter ein übergeordnetes, den Eigeninteressen der Leute abträgliches materielles Interesse, unter Arbeitspflicht und dauernd reproduzierte Armut; zum Inhalt seines Gewaltmonopols erklärt und macht er die ordentliche Einhegung all der Interessenkonflikte, die die diversen Privateigentümer, speziell die mit Kapital und die ohne Geld in ihrem jeweiligen Erwerbsleben, miteinander auszutragen haben. Die Verfügungsmacht des Kapitals über die arbeitende Menschheit hat demnach mit Herrschaft und Gewalt nichts zu tun, weil der Gewaltmonopolist sich alle Befehlsgewalt reserviert und der Erwerbstätigkeit auch der Kapitalisten Regeln verpasst; und aus demselben Grund, nämlich weil er als Schutzmacht dieser Regeln und der an sie gebundenen Bürger auftritt, hat seine Befehlsgewalt mit Herrschaft im Sinne materieller Indienstnahme, gar mit Unterdrückung erst recht nichts zu tun. Was er gewährt und garantiert, ist nichts weiter als die Teilnahme aller an der allseitigen freien Konkurrenz ums Geld: So unterwirft er Land und Leute dem Regime des Kapitals.
2. Freiheit und Gleichheit: Der Schutz von Person und Eigentum
Seinen Bürgern präsentiert sich der bürgerliche Staat mit seinem Gewaltmonopol ausdrücklich als Meister der Zurückhaltung. Vor allem andern bekundet er seinen Respekt vor der Freiheit derer, die er regiert; hinter der Zusicherung allgemeiner Handlungsfreiheit verschwindet völlig seine hoheitliche Handlungsvollmacht, die in solcher Großzügigkeit stillschweigend unterstellt ist. Ebenso verzichtet er auf jede Diskriminierung bei der Erlaubnis für jedermann, sich frei zu entfalten; als Garantiemacht, die jeden freien Willen unter ihren wohlwollenden Vorbehalt stellt, will er von den vielfältigen Unterschieden zwischen seinen Bürgern nichts wissen, die deren Alltag bestimmen. Für ihn sind die Mitglieder seines Gemeinwesens erst einmal und grundsätzlich alle gleich.[1]
Auf den gleichen Respekt, vor ihresgleichen, verpflichtet der Staat seine Bürger, denen er, egalitär und „ohne Ansehen der Person“, allgemeine Handlungsfreiheit gewährt. Das Prinzip all der Regeln und Bedingungen, denen er deren Konkurrenz – in Sachen Gelderwerb und überhaupt – unterwirft, ist eben dieselbe Abstraktion, die er seinem Umgang mit seinen Untertanen zugrunde legt: Für ihn und für die Normierung aller gesellschaftlichen Verhältnisse, aller Beziehungen der Bürger aufeinander, kommt es entscheidend darauf an, dass – unabhängig von allen materiellen Mitteln und Interessen, ungeachtet aller im Geldverkehr eingeschlossenen Friktionen und Abhängigkeiten, jenseits aller Unterschiede in Sachen Aufwand und Ertrag – alle Willensentscheidungen freiwillig erfolgen, frei von Zwang, ohne Gewalt außer der, für die er sorgt. Diese Abstraktion stellt der Rechtsstaat unter seinen Schutz: den Menschen als Person. Bei allem, worüber die Konkurrenzsubjekte verfügen – Bedürfnisse, Fähigkeiten, Körperkräfte, Lebenszeit, Gesundheit, Besitz –, kommt es – dementsprechend – allein darauf an, dass ein jedes Subjekt mit Wille und Bewusstsein darüber verfügt: Der Umstand ist unbedingt zu respektieren, als exklusives Recht. Die gesamte materielle Existenz der Menschen zählt von Staats wegen in einer einzigen Hinsicht, eben als das Material der freien Verfügungen des Subjekts; als dessen Eigentum steht es unter seinem Schutz.
Nur auf Grundlage dieser Abstraktion dürfen, auf dieser Grundlage sollen dann aber auch all die materiellen Arbeits-, Dienst- und Benutzungsverhältnisse stattfinden, die die Bürger in ihrer Konkurrenz um Gelderwerb mithilfe ihrer jeweiligen Mittel mit- und gegeneinander eingehen. Achtung vor der freien Willensentscheidung der jeweils anderen vorausgesetzt, dürfen sie mit allen Mitteln, die als ihr Eigentum anerkannt sind, aufeinander losgehen: Wenn Kapitalisten „Arbeitnehmer“ bezahlen und in ihren Betrieben für ihre Bereicherung arbeiten lassen; wenn Lohnarbeiter gegen Geld auf Zeit einen „Arbeitgeber“ über sich kommandieren lassen; wenn „auf dem Markt“ Konkurrenzkämpfe ausgetragen werden; was auch immer die Menschen treiben: aus Sicht des Staates und nach Maßgabe seines rechtlichen Regelwerks „interagieren“ da Rechtspersonen, die kraft seiner Lizenz und unter seiner egalitär-freiheitlichen Aufsicht über sich und das ihnen zuzurechnende Eigentum verfügen und Abmachungen treffen, die nicht mehr und nicht weniger als den Rechtstatbestand der Freiwilligkeit und der Anerkennung des Geschäftspartners als verfügungsberechtigtes Subjekt erfüllen müssen, um wirksam zu werden. In diesem Sinn mischt sich der Staat mit dem Rechtsinstitut des Vertrags als aufsichtführender Dritter in alle sozialen Beziehungen ein; in dem Sinn nämlich, dass er sie grundsätzlich als potentielle Kollisionen zwischen den Freiheitsräumen auffasst, die er seinen Bürgern gewährt. Deswegen erlässt er Regeln für eine friedliche Koexistenz der Kontrahenten nach dem Kriterium wechselseitiger Achtung als Rechtsperson, verwirft, was er für unvereinbar mit dieser Abstraktion befindet, und setzt seine Autorität als Gewaltmonopolist hinter alle Kontrakte, die seine Billigung finden. Was auch immer da, dem materiellen Inhalt nach, vereinbart sein mag, vom Standpunkt des Hüters aller Verträge wird ohnehin immer nur dasselbe vereinbart, nämlich der Austausch von Verfügungsrechten, die den Partnern als gleichwertig gelten.
3. Ein Rechtsstaat für alle Klassen von Staatsbürgern
Indem die bürgerliche Staatsgewalt ihre Bürger als Personen anerkennt und behandelt, die in ihrem gesellschaftlichen Verkehr miteinander im Grunde alle nur dasselbe wollen, nämlich ihren freien Willen betätigen, ohne dass ihnen ihre Zwecke vorgeschrieben werden, und die dabei alle von demselben Mittel Gebrauch machen, nämlich von dem, was ihnen rechtmäßig gehört, setzt sie das Universum der Konkurrenz ums Geld ins Werk und darüber die kapitalistische Produktionsweise in Kraft, ohne sich irgendetwas davon vorher ausgedacht und Funktionen festgelegt, geschweige denn verschiedenen Funktionsträgern als ihre Lebensaufgabe zugewiesen zu haben – das erledigen die freien Personen nach Maßgabe ihres Eigentums selber. Die erarbeiten sich eigenverantwortlich ihren höchstpersönlichen Lebensweg, verwirklichen damit freilich lauter gar nicht besonders individuelle „soziale Identitäten“ gemäß den Sachgesetzen des Gelderwerbs durch bezahlte Arbeit – durch deren Verrichtung die meisten, durch deren am Markt realisierte Gelderträge die wenigsten, aber Maßgeblichen. Sozialkritiker haben den ursächlichen Zusammenhang zwischen der Erwerbsquelle und den dadurch programmierten so stereotyp unterschiedlichen Lebenswegen immer wieder einmal als Spaltung der Gesellschaft in gegensätzliche Klassen schlechtgemacht; bei einer beträchtlichen Anzahl von Leuten, die für den Geschäftserfolg ihrer „Arbeitgeber“ tätig werden und auf den unteren Rängen der beruflichen und sozialen Hierarchie landen, hat der Appell an sie als Arbeiterklasse, die sich diesen niederen Status nicht gefallen lassen soll, phasenweise Anklang gefunden; die geschäftliche Elite hält sich ohnehin, ganz affirmativ, für erstklassig. Den Rechtsstaat irritiert das aber überhaupt nicht in der Unterscheidung, die er an seinen Bürgern trifft, nämlich an einem jeden zwischen dem „Citoyen“, dem freien und gleichen Rechtssubjekt, und dem „Bourgeois“, dem praktizierenden Konkurrenzsubjekt, das zusehen darf und muss, wie weit es mit seinen individuellen Erwerbs- und Erfolgsmitteln kommt. Natürlich ist dem Gesetzgeber keine der Lebenslagen fremd, in die seine Bürger sich hineinarbeiten. Für sämtliche klassenspezifischen Notwendigkeiten, Interessenkonflikte und Ansprüche bleibt er als Monopolist der gesellschaftlichen Gewalt zuständig. Was aus dem Einsatz der jeweils verfügbaren Mittel im Erwerbsleben für die Personen und den Gebrauch ihres Eigentums folgt, würdigt er rechtlich stets vom Standpunkt der allgemeinen Ordnungsmacht in Form von Regelungen, die allgemein gelten, ganz gleichgültig dagegen, auf wessen Bedarfslage sich Verbote und Gebote überhaupt beziehen. Privilegien für bestimmte Personengruppen gehören ebenso wenig zum regulären Repertoire bürgerlicher Gesetzgebung wie die Diskriminierung von Einzelnen oder Kollektiven; wo dieses Prinzip verletzt wird, beginnen für den Rechtsstaat Willkür und Korruption. Wenn daher anti-sozialkritische Geister den Klassencharakter der kapitalistischen Konkurrenzgesellschaft mit dem schlauen Argument dementieren, dass es doch allemal freie Individuen sind, die sich mit ihrer privaten Lebensführung in die Karrieren einsortieren, die das marktwirtschaftliche Erwerbsleben für seine Akteure bereithält, dann hat der Rechtsstaat ihnen darin schon längst Recht gegeben: Genau so bezieht er sich auf die Mitglieder seiner Klassengesellschaft, bringt seine Ordnung in die flächendeckenden Konkurrenzkämpfe ums Geld – und schließt ganz nebenbei und ganz grundsätzlich jede Alternative dazu aus. Denn eine freie kollektive Willensbildung, ein vernünftiger Konsens über gesellschaftliche Arbeitsteilung und Bedürfnisbefriedigung ist schon der Idee nach die Negation der bürgerlichen Handlungsfreiheit, die der Rechtsstaat gewährt und garantiert. Die Überwindung des Materialismus des Geldes ist als moralische Idee schön und gut, als praktisches Ziel vom Standpunkt des freiheitlichen Rechtsstaats aber identisch mit Kommandowirtschaft und deswegen als Übergriff der Staatsgewalt auf die geschützte Privatsphäre selbstverantwortlicher Bürger verboten. Der Rechtsstaat ist egalitär für alle da, für alle Klassen und Sonderkollektive; so schützt er den Bestand der Klassengesellschaft, die durch die Konkurrenz freier Bürger unter staatlicher Obhut zielsicher und alternativlos reproduziert wird.[2]
4. Die ökonomische Ausstattung der Macht
Der bürgerliche Staat regiert mit Geld. Er zahlt, was er an Diensten braucht und an Gütern verbraucht. Ganz marktwirtschaftskonform nutzt er die Privatmacht des Geldes, um zu beschaffen und schaffen zu lassen, was seine ganz speziellen Konsumbedürfnisse befriedigt – und stellt so den zivilen Charakter seiner Herrschaft praktisch unter Beweis: Er nimmt sich nichts mit Gewalt, sondern kauft ein. Das Geld, das er dafür ausgibt, holt er sich freilich von seinen Bürgern. Er vergreift sich also schon am Eigentum, das er ansonsten garantiert und als die materielle Freiheitssphäre seiner Untertanen respektiert; er macht die Subjekte, die er unwiderruflich zu freien Personen ernannt hat, seiner Herrschaft dienstbar. Er tut das jedoch nach festen allgemeingültigen Regeln in Abhängigkeit vom Gelderwerb, dem seine Bürger nachgehen; im Verhältnis zu deren Konkurrenzbemühungen und -erfolgen, die er gestattet und schützt; also in Verbindung mit dem Dienst, den er ihren materiellen Interessen leistet. Gerade da, wo er seine Konkurrenzsubjekte mit ihrem privaten Erwerbsstreben für sich und seinen Gewaltbedarf in Anspruch nimmt, bekräftigt der bürgerliche Staat auf die Weise den Schein, seine Herrschaft wäre eigentlich gar nichts weiter als eine Dienstleistung, die er zwar nicht verkauft, für die er sich aber zahlen lässt, was sie nun einmal kostet.
Genau so, und deswegen grundsätzlich äußerst skeptisch sehen das vor allem diejenigen seiner Bürger, die als Unternehmer gerne, direkt oder indirekt, am zahlungsfähigen Bedarf ihrer Herrschaft verdienen, die von der Ordnung, die er stiftet, im Wortsinn profitieren und denen auch nach dem Zugriff des Fiskus allemal am meisten übrig bleibt. Wenn die sich in ihrer Eigenschaft als Steuerzahler zu Wort melden, dann verstehen sie sich durchaus nicht als die dienstbare ökonomische Basis, sondern als die maßgeblichen Finanziers der Staatsgewalt. Und als solche finden sie laufend Anlässe zur Unzufriedenheit mit der Bemessung wie der Verwendung ihrer Steuern, weil sie einen nicht auszuräumenden guten Grund zur Unzufriedenheit wissen: Sie haben die Lizenz, ihr Kapital zu vermehren; von ihrem entsprechenden Geschäftserfolg hängt so gut wie alles ab, das Steueraufkommen schon gleich; für den ist jede Summe, die ihnen tatsächlich weggenommen wird – und nicht gleich wieder zufließt –, ein Schaden.
Der offen parteilichen Unzufriedenheit seiner wichtigen Steuerzahler begegnet der Hüter des Allgemeinen mit großem Verständnis. Schließlich verlässt er sich, was die ökonomischen Quellen seiner Macht betrifft, auf den Eigennutz, den er seinen Bürgern gestattet und den die Unternehmer produktiv machen. Er muss nicht anordnen, dass für ihn gearbeitet wird: Alle Mitglieder seiner Klassengesellschaft arbeiten für sich, als Privatpersonen für ihr Geldeinkommen, und zwar nach Maßgabe ihrer Mittel für ein möglichst großes; die Kapitalisten lassen arbeiten, für die Maximierung ihres Gewinns, egal wie groß der schon ist. So kommt im Ergebnis der allgemeinen eigennützigen Erwerbstätigkeit eine wachsende Masse an gesellschaftlichem Geldvermögen zustande: abstrakter, für alle erdenklichen Zwecke verwendbarer Reichtum, von dem der Souverän sich seinen Anteil nehmen und alles das kaufen kann, was er braucht und was herzustellen sich für industrielle Kapitalisten lohnt. Die Produktivkraft des kapitalistisch angewandten privaten Reichtums ist daher für die Staatsgewalt von allgemeinem Interesse und ein zentrales eigenes Anliegen, jeder Abzug davon ein Problem. Ihren steuerlichen Zugriff darauf definiert sie dementsprechend als zwar notwendige, aber zugleich dysfunktionale Belastung, als Unkosten, die auf jeden Fall möglichst gering zu halten sind. Ihre richtige Bemessung und Verwendung ist der bleibende Hauptstreitpunkt zwischen Staat und Steuerzahlern – und in der Demokratie der Lieblingsgegenstand im Macht- und Meinungskampf zwischen Regierung und Opposition...
Nach außen
1. Souveränität nach außen: Territorialisierung des Geschäfts
Jede Staatsmacht hat ihren besonderen Zuständigkeitsbereich; sie ist eine neben vielen anderen. Für die Geschäftswelt hat das ganz unmittelbar die Folge, dass der Umkreis ihrer Tätigkeit, für die hoheitlicher Rechtsschutz unerlässlich ist, auf ein begrenztes Territorium, also die dort verfügbaren sachlichen und menschlichen Ressourcen und die dort greifbare Zahlungsfähigkeit, beschränkt sowie durch die besonderen Interessen und Kompetenzen der darüber herrschenden politischen Gewalt festgelegt ist. Daraus zieht sie einen klaren und eindeutigen Schluss: Die speziellen Umstände, unter denen sie ihrem Beruf der Geldvermehrung nachgeht, haben sich eben dafür als positive Bedingung zu bewähren. Aus den Landesgrenzen folgt für sie, dass der beschränkte Raum für kapitalistischen Gelderwerb exklusiv der ihre ist, ihr Heimatmarkt, auf dem auswärtige Konkurrenten nichts zu suchen haben. Die dort herrschenden Geschäftsbedingungen materieller, institutioneller und sonstiger Art nehmen die Unternehmer keineswegs als „heimatliche“ Naturgegebenheit und Schicksal hin: Die zuständigen Machthaber nehmen sie für ihre nie abschließend zu befriedigende Forderung in Anspruch, Land und Leute für ihren Geschäftsbedarf tauglich herzurichten. Wenn der Staat schon begrenzt ist und dem kapitalistischen Geschäftsbetrieb räumliche Grenzen setzt, dann ist es seine Aufgabe, daraus ein ausschließendes Vorrecht und ein Ensemble von Vorteilen für diesen Betrieb zu machen.
Die erste Forderung, die nach Exklusivität der territorial begrenzten Geschäftssphäre, ist mit der Hoheit der nationalen Staatsmacht schon automatisch erfüllt. Die Gleichheit vor dem Gesetz, die zu den Prinzipien ihres Umgangs mit vernunftbegabten Subjekten gehört, schließt eine ebenso prinzipielle Ungleichheit ein: Die Rechtsstellung der Person mit gesetzlich geschütztem Eigentum kommt ganz von selbst nur den als eigene Staatsbürger anerkannten Landesbewohnern zu, Untertanen fremder Hoheiten – grundsätzlich und erst einmal – nicht. Bürger sind rechtlicher Besitzstand des für sie zuständigen Gewaltmonopolisten; daran lässt der nicht rütteln, vergreift sich umgekehrt auch nicht am menschlichen „Eigentum“ fremder Souveräne; so viel Diskriminierung muss sein, wenn es um Freiheit und Gleichheit geht. Vom normalen Geschäftsgang sind ausländische Kapitalisten als Konkurrenten damit per se ausgeschlossen. Dieses formelle Privileg mit materiellem Inhalt zu füllen, ist vom Standpunkt des Rechtsstaats Sache der konkurrierenden Kapitalisten, fällt unter deren Handlungsfreiheit, aber nicht nur. Zur Freiheit, die der Staat seinen Unternehmern garantiert, gehört durchaus auch, dass die territorialen Schranken dieser Garantie sich nicht als Beeinträchtigung der gewährten Freiheit auswirken. Deswegen zählt es ganz grundsätzlich zu den Aufgaben der bürgerlichen Staatsmacht, das eigene Land und die eigenen Leute so herzurichten, dass sie sich ungeachtet, ja gerade in ihrer Begrenztheit als Kapitalstandort bewähren.
2. Von der Unabhängigkeit des Volkes
Für den bürgerlichen Rechtsstaat sind die Diskriminierung ausländischer Konkurrenten und die Schaffung besonders vorteilhafter Konkurrenzverhältnisse keine Privilegien, die er allein seiner ökonomischen Elite zukommen lassen würde. Die Ausgrenzung von Landesfremden ist ohnehin von vornherein eine völlig klassenneutrale Angelegenheit: Die höchste Gewalt belegt alle ihre Bürger unterschiedslos als ihren exklusiven Besitzstand mit Beschlag, hebt sie mit ihren Schutzgarantien als ihr Volk aus der Gesamtmenschheit hervor. Und zusammen mit den besonderen Konkurrenzverhältnissen in seinem Land und den darauf zugeschnittenen Regeln stellt der Gesetzgeber auch manche landestypischen Anpassungsleistungen der niederen Stände – von den Sitten nachbarschaftlicher Koexistenz bis zur Volksfrömmigkeit – unter seinen Schutz.
Für die große Masse der so privilegierten Landesbewohner hat die erste Dienstleistung, die Ausgrenzung von Ausländern aus dem nationalen Erwerbsleben, praktisch nur die Folge, dass die auswärtigen Standes- und Klassengenossen – im Prinzip und bis auf Weiteres – von der Konkurrenz ums Benutzt-Werden ausgeschlossen sind; einem „Wettbewerb“, der dadurch nicht besser und schon gar nicht weniger widersprüchlich wird. Die Heimat, die der Rechtsstaat schützt und pflegt, besteht für sie im Wesentlichen in den für kapitalistischen Gebrauch hergerichteten Landschaften und den – allemal sehr wandelbaren – Gepflogenheiten des Zurechtkommens, in die die Eingeborenen hineingeboren werden, dem Kodex der jeweils herrschenden Sitten und dergleichen Schönheiten, die mehr zu bornierter Duldsamkeit verpflichten als das Leben erleichtern. Für den Hüter der öffentlichen Ordnung ist vieles davon aber als Beitrag zur Leistungsfähigkeit und -bereitschaft seiner Klassengesellschaft sowie zur nationalen Identität seines Volkes von Interesse und gehört zu den öffentlichen Gütern, für die er auch zuständig ist. In der so zusammenkonstruierten Heimat dürfen die freien Bürger sich nach Geschmack einrichten. Und schon allein der Umstand, dass die mit dem Zuständigkeitsbereich der Staatsgewalt – bzw. mit Unterabteilungen des Staatsgebiets – zusammenfällt, liefert den freien Bürgern Gesichtspunkte der Identifikation mit der Herrschaft, auf deren Gewalt sie als Konkurrenten ohnehin angewiesen und verpflichtet sind.
So verwirklicht sich die Handlungsfreiheit, die der Rechtsstaat seinen Bürgern gewährt, nicht einfach in der eigenverantwortlichen Teilnahme am kapitalistischen Erwerbsleben. Dieser alltägliche Konkurrenzkampf nimmt den Charakter eines exklusiven wechselseitigen Verpflichtungsverhältnisses zwischen der heimischen Obrigkeit und den Bürgern in ihren durch viele Besonderheiten geprägten Lebensverhältnissen an. Die höchste Pflicht der Herrschaft liegt dabei in der Wahrung der ersten, unerlässlichen Bedingung ihrer Wirksamkeit als Schutzmacht des Volkes und seiner Heimat: ihrer nach außen wie nach innen konkurrenzlosen, unanfechtbaren und unangefochtenen Hoheit über Land und Leute. Ihr Schutzobjekt ist die Freiheit der Bürger in ihrer nationalen Exklusivität, also als Privileg des Bürgerkollektivs gegenüber der restlichen Menschheit; darin eingeschlossen die Unabhängigkeit des Volkes von jeder anderen Autorität als der zuständigen eigenen höchsten Gewalt. Die Souveränität, mit der die bürgerliche Herrschaft das Leben ihrer Bürger reguliert, wird zum ersten und entscheidenden Dienst, den sie ihren Untertanen schuldet.
3. Militär
Als Souverän und im Interesse der Unabhängigkeit seines Volkes muss der bürgerliche Staat seine Alleinzuständigkeit für den eigenen Herrschaftsbereich aus eigener Kraft garantieren. Er will und darf sein Gewaltmonopol über Land und Leute nicht von Ermessensentscheidungen anderer Herrschaften abhängig machen. Er kommt daher nicht umhin, seinesgleichen zum Respekt vor seiner Souveränität zu nötigen. Noch jeder Staat findet es deswegen geboten, nach außen mit einem Gewaltapparat eigener Art aufzutreten: einem Apparat, der den Auftrag hat und fähig sein muss, fremde Gewaltmittel wirkungslos zu machen und den eigenen Willen gegen andere Souveräne durchzusetzen. Er schafft sich ein Militär und nimmt dabei nicht an irgendwelchen besonderen Gefährdungslagen, sondern, noch bevor er sich denen widmet und bevor er sich überhaupt konkret gefährdet sieht, an sich selber Maß: an der Größe von Land und Volk, auf die sich seine Hoheit erstreckt, an der Masse des abschöpfbaren Reichtums, den die nationale Marktwirtschaft aus Land und Leuten herausholt, an der Reichweite der grenzüberschreitenden Interessen, die die Nation entwickelt, sowie an dem Recht auf Erfolg und auf Respekt der übrigen Staatenwelt, das er sich zuspricht; das alles ideell zusammengefasst und verabsolutiert in der „Ehre der Nation“. Dementsprechend definiert ein jeder Staat selbst das Anspruchsniveau, auf dem er sich der Aufgabe annimmt, ganz autonom seine souveräne Existenz zu sichern. Daraus ergeben sich dann die diversen Gefahrenszenarios, auf deren Bewältigung er im Besonderen vorbereitet sein muss. Woraus auch folgt, dass ganz grundsätzlich mit den Erfolgen einer Nation der Gewaltbedarf ihres Souveräns zunimmt.
Für dessen Befriedigung nimmt der Staat Land und Leute noch ganz anders in Anspruch als für seine zivilen Herrschaftsdienste. Der kapitalistisch reproduzierte Reichtum der Nation muss in Geldform und an Gebrauchswerten ein Zerstörungspotential hergeben, das dem nationalen Anspruchsniveau genügt. Das nützt vielen Industriellen, kostet aber eben auch viel, belastet also die Quelle der ökonomischen Macht des Staates, die Mehrung des Eigentums. Als freie Personen lernen die Bürger zudem ihre Herrschaft als eine Befehlsgewalt kennen, die das Töten, die definitive Aufkündigung des im bürgerlichen Leben sonst zwingend gebotenen Respekts vor dem Überlebenswillen anderer, ebenso zur Pflicht macht wie die Bereitschaft, im Ernstfall das eigene Leben dranzugeben. Vor dieser Perspektive werden dem normalen Bürger die Phasen, in denen der letzte Einsatz nicht abgerufen wird, als Friedenszeiten lieb und teuer; Regierungen fordern dafür Dankbarkeit ein. Das eine zu Unrecht, das andere ein Hohn: Im Frieden rüsten Staaten auf und schaffen die Konflikte, für deren „Lösung“ sie ein Militär unterhalten; ihr Anspruch auf Gehorsam bis hin zum Töten und Sterben „auf Verlangen“ ist dauernd präsent. Eine ultimative Dienst- und Opferbereitschaft gehört zu den Kosten der Freiheit, die der Rechtsstaat seinem Volk gewährt und bis zum Letzten garantiert.
§ 4 Der kommerzielle Kredit
Mit seiner souveränen Macht garantiert und reguliert der Staat das Kommando des Kapitals über die Arbeit und den Markt als Sphäre der Konkurrenz der Kapitalisten um die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft. Während in der Sphäre der Produktion damit die Freiheit des Kapitalisten ins Recht gesetzt ist, durch günstigen Einkauf und effektiven Einsatz der Arbeitskraft die Rentabilität seines Kapitals herzustellen, ist in der Sphäre der Zirkulation die Konkurrenz freigesetzt, deren Verlauf über die Realisierung lohnender Preise und damit über die bezweckte Leistung der Betriebe entscheidet.
1. Kontinuität und Effektivität produktiver Geldvermehrung als Liquiditätsproblem und dessen Lösung
Geschwindigkeit und Kontinuität des Umschlags des Kapitals, damit Höhe und Sicherheit der Rendite aufs eingesetzte Vermögen hängen mit dem Markt von Bedingungen ab, die der industrielle Unternehmer nicht selbst in der Hand hat. Die Notwendigkeit, die diversen Elemente seines Produktionsprozesses termingerecht zu erneuern, also zu kaufen, macht es erforderlich, die mit den verbrauchten Produktionsmitteln und der bezahlten Arbeit hergestellten Waren rechtzeitig und zum kalkulierten Preis verkauft zu haben, also die Konkurrenz um die beanspruchte Zahlungsfähigkeit kontinuierlich zu gewinnen und das benötigte Geld aus dem Markt herauszuholen.[3] Die Zeitspanne, die dafür zu veranschlagen ist, muss möglichst kurz sein, im Idealfall gegen Null gehen, weil sonst Betriebsvermögen in Gestalt fertiger Ware herumliegt, statt in Gestalt von Produktionsmitteln und zu entlohnenden Arbeitskräften für den erneuten Einsatz als Kapital verfügbar zu sein. So tritt der Umstand, dass das Vermögen des industriellen Kapitalisten immer wieder Geldform annehmen muss, um als Geldquelle zu fungieren, in Gegensatz zu seiner Zweckbestimmung, permanent in voller Größe als Geldquelle zu fungieren.
Dieser Widerspruch stellt sich den kapitalistischen Unternehmern als Liquiditätsproblem dar: als Gefahr einer Geldverlegenheit bei der kontinuierlichen, einer Verzögerung bei der rentablen, also möglichst raschen Nutzung ihrer Geldanlage. Damit ihr Kapital ständig in seinem gesamten Umfang den Dienst verrichtet, auf den sie scharf sind und ein Recht haben, beziehen sie sich – unbeschadet der Konkurrenz, in der sie zueinander stehen – aufeinander als Partner, die eine allen gemeinsame Problemlage ihres Geschäftemachens zu bewältigen haben. Und mit der Lösung, die sie für dieses Problem gefunden haben, geben sie ihrer Gemeinsamkeit einen praktischen Inhalt: Sie nehmen und geben einander Kredit in Form eines Handelswechsels.
Solch ein Wechsel ist eine auf einem Stück Papier dokumentierte, betragsmäßig bestimmte und zeitlich befristete Geldforderung. Diese Forderung resultiert daraus, dass ein Kapitalist als Verkäufer einem anderen Kapitalisten, bei dem die Kontinuität seiner Produktion an nicht vorhandenem Geld fürs Kaufen zu scheitern droht, in einem einseitigen Vertrauensakt Waren gegen ein Zahlungsversprechen liefert. Auf diese Lösung des Problems des Käufers lässt sich der Verkäufer ein, weil er sein komplementäres Umschlagproblem – er will möglichst schnell verkaufen, um seinerseits einkaufen zu können – mit dem entgegengenommenen Zahlungsversprechen löst. Als Käufer tritt er jetzt nicht als einer an, der in gleicher Weise wie sein Schuldner um Stundung nachsuchen muss, sondern als jemand, der mit der Geldforderung etwas Substantielles in der Hand hat. Er verselbständigt das von ihm eingeräumte Zahlungsziel zu einem von diesem Vertrauensverhältnis getrennten, objektiven Ding, dem Wechsel, und nutzt diese Vergegenständlichung des Verpflichtungsverhältnisses zwischen sich und seinem Kunden als Geldersatz gegenüber seinem Lieferanten: als Zahlungsmittel beim Einkauf der von ihm benötigten Ware.[4] Hier und ab da fungiert und zirkuliert dieses papierene Zeichen für noch nicht verdientes, bloß versprochenes Geld zwischen Kapitalisten als „Geld des Handels“, getrennt und unabhängig von jenem Handelsgeschäft, in dem dieser auf dem Wechsel dokumentierte Vertrauensakt seinen Ursprung hatte. Allerdings nicht unbesehen, nur bedingt: Beim Zahlen mit Wechseln hat sich die Gewohnheit herausgebildet, dass derjenige, der einen Wechsel weiterreicht, sich gegenüber seinem Lieferanten persönlich per Unterschrift für die Ursprungsschuld verbürgt.[5]
Das Ganze nimmt sich aus wie eine Technik im Umgang der Kapitalisten mit den verschiedenen Funktionen, die ihr Vermögen zu erfüllen hat. Es ist aber mehr als ein geschickter Kunstgriff.
2. Das Vertrauen auf kontinuierlichen Geschäftserfolg der Konkurrenten als Quelle benötigter Liquidität, also als Mittel zur Herbeiführung des antizipierten Geschäftserfolgs
Der Handelswechsel, die Elementarform des kommerziellen Kredits, dokumentiert nicht bloß ein vertragliches Willensverhältnis zwischen zwei Kaufleuten, ein eingeräumtes Zahlungsziel seitens des Verkäufers, ein Zahlungsversprechen des Käufers. Der Wechsel löst die Leistung einer solchen Vereinbarung, die Hergabe eines Stücks Eigentum gegen eine bloße Willensbekundung des Empfängers, vom Vertrauensverhältnis zwischen den Kontrahenten ab, verselbständigt die auf einen späteren Termin bezogene Zahlungsanweisung zu einem unter Kaufleuten weiter verwendbaren Kaufmittel, so als wäre sie schon so gut wie die darin bezifferte Geldsumme selbst; mit dem Wechsel ist die Zahlungspflicht in ein regelrechtes, wie Geld fungierendes Zahlungsmittel verwandelt. Der Wechselschuldner fungiert nicht als Person, der der Gläubiger sein Vertrauen schenkt, sondern als Repräsentant eines Geschäftsvorgangs, auf den als solchen, objektiv, im Sinne seiner immanenten Zweckbestimmung, über die ursprüngliche zweiseitige Geschäftsbeziehung hinaus Verlass ist. Nicht das kapitalistisch wirtschaftende Individuum, sondern die Logik seiner Erwerbsquelle begründet diese Verselbständigung seiner persönlichen Verpflichtung zum getrennt von ihm für Einkäufe verwendbaren Wertpapier. Unterstellt ist dabei nicht nur die kapitalistische Natur des Geschäfts, das der Schuldner betreibt und für dessen kontinuierliche Fortführung er ein Zahlungsversprechen abgegeben hat. Wie selbstverständlich dokumentiert der Wechsel schon vorab dessen sachgerechten Erfolg: Von der Geschäftstätigkeit, für die der Wechselschuldner sich die nötigen Mittel kauft, die er noch gar nicht bezahlen kann, erscheint auf dem Wechsel nur die Frist, in der es erfolgreich, mit einem ausreichenden Gelderlös, abzuschließen ist; und mit der Qualität des Wechsels als weiterverwendbares Zahlungsmittel wird auch noch von dieser Frist abstrahiert – das Papier repräsentiert tatsächlich, aktuell wirksam, so oft der Wechsel weitergegeben wird, die Geldsumme, die erst nach Fristablauf, zum Fälligkeitstermin, abzuliefern ist. Das Schuldverhältnis, das im Handelswechsel dokumentiert ist, reduziert das damit finanzierte Geschäft auf eine bloße Zeitfrage; und selbst über die setzt der Handelswechsel in seiner Eigenschaft als Zahlungsmittel sich hinweg. Er nimmt den Geschäftserfolg nicht bloß ideell vorweg; er macht die Vorwegnahme real. Freilich nicht unbedingt; zum Fälligkeitstermin ist Zahlung in verdientem Geld gefordert. Doch bis dahin gilt die Gleichung von Pflicht und Pflichterfüllung, von Versprechen und versprochener Summe. Und diese Gleichung tut – wenn nichts dazwischen kommt – ihr Werk, so oft der Wechsel weitergegeben wird: Noch nicht verdientes Geld kauft Geschäftsmittel, die den vorweggenommenen Geschäftserfolg herbeiführen, also das Geld einbringen, das für ihren Kauf gefehlt hat.
Es ist also ein kleines funktionalistisches Wunderwerk, das die Kaufleute mit der Technik des Handelswechsels in die kapitalistische Welt gesetzt haben: Die Kapitalfunktion des Gesamtvermögens eines Kapitalisten, für die es phasenweise an Liquidität mangelt, stiftet unter gleichgesinnten Kaufleuten die Liquidität, an der es mangelt; durch die Funktion der so gestifteten Zahlungsfähigkeit als Teil des Geld abwerfenden Gesamtvermögens, als Kapital, entsteht die Geldsumme, an der es gemangelt hat; diese Summe ist die Einlösung der Zahlungsfähigkeit, durch deren kapitalistischen Einsatz sie geschaffen worden ist. Dabei zeichnet sich diese „Ableitung“ des Geldes aus seiner Funktion im Kreislauf des Kapitalvermögens noch durch die Schönheit aus, dass sie der Geschäftswelt umso gelungener und verlässlicher erscheint, je häufiger der Handelswechsel die Hände wechselt und mit der Unterschrift weiterer als Schuldner haftender Benutzer versehen wird: Praktisch behandeln die schlauen Geschäftsleute die Emanzipation des Handelswechsels als Zahlungsmittel vom ursprünglichen Schuldverhältnis nur einerseits als die ökonomische Natur der Sache, das Versprechen als seine zwar befristete, aber objektive Einlösung; andererseits bleibt diese Gleichung für sie eine nicht bloß vorläufige, sondern relative Angelegenheit, die durch häufige Wiederholung an Objektivität gewinnt. Ihre Praxis macht das Papier – in der Sprache der Insider – immer „geldähnlicher“!
Zusatz
Es ist schon bemerkenswert, dass kapitalistische Geschäftsleute in Sachen Geld, immerhin Inbegriff des Reichtums, um den es ihnen und im modernen Wirtschaftsleben überhaupt geht, bereit sind, den Willen für die Tat zu nehmen und Schuldscheine, die einen Geldmangel dokumentieren, als werthaltiges Papier, wie Geld, zu behandeln. Solcher Geldersatz wirft ein Licht auf die Sache, die er ersetzt: Der Wert des Geldes selbst liegt in der Verfügungsmacht über fremdes Eigentum, die es gewährt; es ist gar nichts anderes als ein gesellschaftliches Verhältnis, nämlich das der Fähigkeit zum Zugriff auf Güter in fremdem Besitz, was im Geld eine dingliche Gestalt und ein quantitatives Maß bekommt. Andererseits fungiert der Ersatz des im Geld vergegenständlichten Eigentumsverhältnisses durch eine bloße aufgeschriebene Vereinbarung nur aufgrund der und im Hinblick auf die Verwendung der fraglichen Summe als Kapital, also als Moment in dem viel bestimmteren gesellschaftlichen Verhältnis der Geldvermehrung, von dem bis jetzt so viel klar ist, dass es der Einsatz geldförmiger Verfügungsmacht für den Kauf von Produktionsmitteln und für das Kommando über Arbeitskräfte ist, was da als Geldquelle wirkt. Der Erfolg dieses gesellschaftlichen Verhältnisses, des mit Geld erkauften Regimes über ein Stück des gesellschaftlichen Produktionsprozesses – und zwar sein Erfolg im Sinne der herrschenden gesellschaftlichen Realität und auf der Grundlage der wie selbstverständlich antizipierte Geschäftserfolg im Einzelfall –, verleiht dem Versprechen des kapitalistischen Schuldners resp. dem Vertrauen seines Lieferanten und weiterer kapitalistischer Gläubiger die Potenz, die den Handelswechsel zum Geldersatz qualifiziert.
3. Produktivkraft und Risiko des Vertrauens von Gläubigern wie Schuldnern auf die Geschäfte der ganzen Zunft
In dem Maß, in dem das Wirtschaften mit Wechseln zur allgemeinen kapitalistischen Übung wird, Kapitalisten einander also gewohnheitsmäßig mit dem „Geld des Handels“ bezahlen,[6] stiften sie untereinander ein neues Verhältnis produktiver Abhängigkeit. Sie begegnen einander nicht mehr nur als Konkurrenten „am Markt“, im „Wettbewerb“ gegeneinander ums zahlungsfähige Bedürfnis nach ihrem Produkt sowie als Käufer und Verkäufer im Streit um einen für sie lohnenden Preis. Neben und zusätzlich zu diesem alltäglichen Kampf um Geschäftserfolg auf Kosten ihrer Kollegen sind sie als Gläubiger und Schuldner positiv miteinander verbunden, nämlich am Geschäftserfolg ihrer kapitalistischen Kunden interessiert und vom erfolgreichen Geschäftsgang einer vorweg gar nicht umschriebenen Reihe von Unternehmungen, letztlich von allgemein gelingender Bereicherung der konkurrierenden Geschäftswelt abhängig. Überindividuell und unpersönlich, allein in ihrer Eigenschaft als kapitalistische Unternehmer – und unbeschadet ihrer professionellen Interessengegensätze –, ermächtigen sie einander zum kontinuierlichen Einsatz ihres Gesamtvermögens als Erwerbsquelle. Ihre eigene Bereicherung machen sie im kommerziellen Kredit zum Mittel und zugleich zum impliziten Zweck der allgemeinen kapitalistischen Gewinnproduktion, zum Teil der Mehrung des Gesamtkapitals ihrer Klasse, das dadurch in seiner ganzen Größe ununterbrochen in Aktion bleibt.
Dieser produktive Kollektivismus der Kapitalisten hat seine Schranke und seinen Preis, fürs Kollektiv wie für die einzelnen Unternehmer.
Die Schranke ist das Verfallsdatum des Vertrauens auf fremden Geschäftserfolg, das im Handelswechsel vergegenständlicht ist und wirksam wird. Dass darin der Erfolg vorausgesetzt, auf eine bloße Zeitfrage verkürzt ist, heißt eben auch, dass die vereinbarte Zahlungsfrist unbedingt einzuhalten ist. Und dass mit der Verwendung des Wechsels als Zahlungsmittel die Erfüllung der Zahlungspflicht praktisch vorweggenommen wird, geht einher mit einem Misstrauen der risikobewussten Konkurrenten, das durch die Übersicherung der zirkulierenden Zahlungsanweisung durch eine Mehrzahl haftender Benutzer beschwichtigt werden will, was freilich zugleich die Zahl der von einem potentiellen Zahlungsausfall Betroffenen vermehrt.
Für den einzelnen Kapitalisten folgt aus der Freiheit in der Verwendung seines Vermögens, die er sich mit der Bezahlung per Handelswechsel verschafft, der Zwang, sein so finanziertes Geschäft zum Erfolg zu führen und rechtzeitig eine hinreichende Summe Geld einzunehmen. War im Ausgangspunkt die Realisierung der produzierten Waren, ihr Verkauf gegen Geld, Schranke der kontinuierlichen Geldvermehrung, und bestand die Überwindung der Schranke darin, sich für diese Kontinuität vom Dasein gültigen Geldes zu emanzipieren, so ist jetzt dieses Geld zu verdienen unbedingtes Gebot des von ihm und seinesgleichen bedarfsgerecht erfundenen Zahlungsinstruments. Mit der Notwendigkeit der Erfüllung der eingegangenen Zahlungspflicht steht schließlich nicht mehr nur ein einzelner Geschäftserfolg, auch nicht mehr nur dessen Kontinuität auf dem Spiel, sondern der Bestand des kontinuierlich gemachten und auf Kontinuität festgelegten Geschäfts selbst. Der Kapitalist steht vor der Aufgabe, sein privates Interesse am Geldverdienen, seinen kompletten dafür eingerichteten Geschäftsbetrieb der Notwendigkeit der pünktlichen Erfüllung seiner Zahlungspflichten unterzuordnen. Der kollektive Zusammenhang, in den er sein Geschäft eingeordnet hat, bestimmt seinen Geschäftszweck: Ab sofort produziert er Waren und verkauft sie, um zahlen zu können. Das bereichert seinen Berufsalltag: Seine Zahlungspflichten wie die entsprechenden Zahlungsfristen muss er mit der gebotenen Sorgfalt abstimmen mit den Zahlungseingängen, die er aus Barverkäufen und der fristgerechten Realisierung von Forderungen gegen seine mit Wechsel zahlende Kundschaft erwartet; sich abzeichnende Liquiditätslücken muss er schließen, indem er geeignete Gegenmaßnahmen ergreift. In diesem Liquiditätsmanagement unterscheidet er auch sein übriges Vermögen fein säuberlich nach Liquiditätsgraden, die ihm anzeigen, wann wie viel flüssig wird oder mit welchen Fristen bzw. welchem Aufwand flüssig gemacht werden kann...
Was für den einzelnen Unternehmer als Schuldner ein Sachzwang zum Erfolg, das ist für die Gesamtheit der Konkurrenten, die mit fremden Zahlungspflichten als Zahlungsmittel hantieren, ein permanentes Risiko. Die Bequemlichkeit, eigene Finanzierungslücken mit entgegengenommenen fremden Schulden zu schließen, macht die schlauen Kaufleute reihum vom Geschäftserfolg anderer abhängig, mit denen sie zugleich in – nicht zuletzt dank dieses Finanzinstruments verschärfter – Konkurrenz stehen. Fremdes Scheitern ist eigener Schaden: Verlierer scheiden nicht sang- und klanglos als Konkurrenten um Zahlungsfähigkeit aus, sondern reißen als zahlungsunfähige Schuldner eine Lücke in die Kette der Zahlungsvorgänge, in der sie Geld schuldig bleiben. Und über die Schädigung anderer stören sie in dem Maß, wie Handel und Wandel über kommerzielle Kreditverhältnisse abgewickelt werden, die miteinander verflochtenen Finanzierungsstränge insgesamt.
Weder Sachzwang auf der einen noch Risiko auf der anderen Seite lassen kapitalistische Unternehmer von ihrer Errungenschaft Abstand nehmen. Aus wohlverstandenem Eigeninteresse tun sie einen fälligen Schritt nach dem andern auf dem vorgezeichneten Weg vom erwerbstüchtigen Individuum zur Charaktermaske ihrer Erwerbsquelle. Dazu gehört, dass sie als die entscheidende gesellschaftliche Klasse im Land die mit ihrem kollektiven Nutzen verbundenen Lasten und Risiken nicht unter sich ausmachen und selber tragen. Aus ihrem Geschäftsgang soll der Staat sich gefälligst heraushalten – für ihre Probleme nehmen sie ihn in Anspruch. Natürlich auch für die des Kredits, den sie einander gewähren.
§ 5 Die staatliche Betreuung der Konkurrenz, die sich des Kredits bedient: Rechtsschutz für das Eigentum, das durch die Verwendung von Zahlungsversprechen als Geld gefährdet wird
Die kapitalistischen Produzenten nehmen die Verzögerung des gewinnbringenden Umschlags ihres Vermögens durch die Notwendigkeiten der Warenzirkulation als Liquiditätsproblem wahr. Das lösen sie mit dem Instrument des kommerziellen Kredits: dem Gebrauch von Zahlungsanweisungen als Zahlungsmittel. Sie leisten sich den Widerspruch, ihr Geschäft, das sie in Konkurrenz gegeneinander betreiben, mit einem Verfahren zu perfektionieren, das ein positives Verhältnis zueinander, ein Sich-Verlassen auf fremde Geschäftserfolge, nicht bloß voraussetzt, sondern vertrauensvoll antizipierte Geschäftserträge der Konkurrenz buchstäblich als Faktum behandelt, freilich nur befristet und mit gleichzeitigem Misstrauen gegeneinander. Als Rückversicherung gegen die prekäre Seite der Abhängigkeit von ihresgleichen, in die sie sich damit begeben, nehmen sie die Institution in Anspruch, von der sie in ihrer Erwerbstätigkeit ansonsten nicht behelligt werden wollen: Das Vertrauen, das sie in die erfolgreiche Geschäftstätigkeit ihrer konkurrierenden Klassengenossen setzen, braucht den Gesetzgeber, der das passende Recht schafft, also die berechnende Solidarität der Kaufleute mit dem gehörigen Quantum allgemeiner Gewalt ausstattet, von der die für ein kapitalistisches Unternehmen unentbehrlichen Rechtsanwälte Gebrauch machen können.
Der bürgerliche Gesetzgeber sieht sich zur konstruktiven Betreuung der antagonistischen Eigentums- und Geschäftsverhältnisse verpflichtet, die den Lebensprozess seiner Gesellschaft bestimmen; und gemäß dieser Aufgabenstellung entdeckt er in der kaufmännischen Errungenschaft des kommerziellen Kredits einen eigenen hoheitlichen Regelungsbedarf. Dass die Kapitalisten untereinander Zahlungsanweisungen als Zahlungsmittel kursieren lassen, überschreitet die Interessengegensätze des „do ut des“, des Kaufens und Verkaufens, die ihm ohnehin schon ein umfängliches Vertragsrecht samt Gerichten abverlangen. Der kommerzielle Kredit geht qualitativ hinaus über das Schuldverhältnis zwischen einem Lieferanten, der für seine Rechnung ein Zahlungsziel gewährt, und einem Käufer, der Zahlung zu einem späteren Zeitpunkt verspricht; ein Verhältnis, das beim Schuldner erstens den redlichen Willen, zweitens die Fähigkeit voraussetzt, bei Fälligkeit zu zahlen, insofern eine unsichere Sache ist und deswegen vom Staat aus einem freien Willensverhältnis in eine gesetzlich geschützte Verpflichtung verwandelt wird. Im Wechselgeschäft geschieht auf dieser Grundlage etwas noch Heikleres: Alle möglichen „Dritten“, die mit dem ursprünglichen Schuldverhältnis zwischen einem momentan illiquiden Käufer und einem auf sofortigen Warenabsatz erpichten Verkäufer gar nichts zu tun haben, benutzen die terminierte Zahlungsanweisung des Gläubigers an den Schuldner als Zahlungsmittel, nehmen sie als solches entgegen, geben sie als solches weiter, hantieren damit wie mit einer Geldsumme. Als Garant des Eigentums und mit seiner Definitionsmacht über das Geld, das Eigentum in seiner allgemein verwendbaren Form ist, ist der Staat damit konfrontiert, dass produktive Kapitalisten ein verbrieftes Willensverhältnis zwischen Fremden als Äquivalent für reale Werte zirkulieren lassen. Nach den strengen Maßstäben seiner rechtlichen Eigentumsordnung wird dadurch das allererste Hauptstück dieser Ordnung und die elementare Interaktion der Marktwirtschaft, der Austausch von Ware gegen Geld, das Bezahlen, nicht gerade zum Glücksspiel, ist aber auch nicht mehr eindeutig der definitive Akt, die abschließende Gleichsetzung von dinglichem Eigentum und abstraktem Äquivalent, also das, worum es beim Kaufen und Verkaufen geht. Zugleich steht der Staat als Schutzherr der kapitalistischen Verwendung von Geldvermögen vor der Tatsache, dass seine kapitalistischen Produzenten eben diese fragwürdige Praxis nicht bloß gut finden und gelegentlich anwenden, sondern als festen, gar nicht mehr entbehrlichen Bestandteil ihres Geschäftsverkehrs handhaben. Die Beschränkung, geschweige denn Unterbindung des Wechselgeschäfts kommt für ihn daher ebenso wenig in Frage wie seine folgenlose Hinnahme. Als Schutzmacht des Eigentums, das im von ihm definierten Geld seine zirkulationsfähige Gestalt hat, wie der Verwendung von Kapital gemäß dem sachgerechten Bedürfnis seiner Eigentümer sieht der bürgerliche Staat sich herausgefordert, eben diesem riskanten, ebenso geschäftsmäßigen wie misstrauischen Vertrauen der kapitalistischen Konkurrenten auf den Erfolg ihrer identischen, aber gar nicht gemeinsamen Sache mit der Autorität seines Gewaltmonopols Recht zu geben, i.e. per Gesetz den Rang einer ordentlichen Funktionsbedingung des marktwirtschaftlichen Lebensprozesses seiner Gesellschaft zuzusprechen.
Die zu der widersprüchlichen ökonomischen Sachlage passende Rechtslage formuliert und dekretiert der Gesetzgeber im Wesentlichen in einem speziellen Wechselgesetz. Darin versieht er die vertragsrechtliche Geltung des Schuldverhältnisses, das sich im Wechsel von seinem Ausgangspunkt trennt, ganz im Sinne dieser im kapitalistischen Geschäftsverkehr praktizierten Verselbständigung mit der „Eigenschaft“ unbedingt – im Juristenjargon: Er reiht den Handelswechsel ein unter die bedingungsfeindlichen Rechtsgeschäfte
, deren Eigenart die Experten ohne falsche Scheu vor Tautologien so definieren: Bedingungsfeindliches Rechtsgeschäft: Rechtsgeschäft, das – zur Vermeidung einer Unsicherheit über die künftige Rechtslage im Interesse der Allgemeinheit oder des Geschäftsgegners – nicht wirksam mit einer Bedingung verbunden werden kann
[7] und streng funktionalistisch mit einer Negation begründen: Die Wechselausstellung ist ... bedingungsfeindlich, weil bedingte Wechsel für den Umlauf nicht geeignet sind.
[8] Die Leistung des Gesetzes, auf die mit dem Argument der andernfalls fehlenden Zirkulationsfähigkeit des Wechsels verwiesen wird, besteht in der gewaltmonopolistisch dekretierten Verabsolutierung des Zahlungsanspruchs, den die Teilnehmer am Wechselgeschäft schon gegen seinen Entstehungsakt verselbständigen. In diesem Sinn wird der Bestand der Wechselschuld den privaten Willen, die sie in die Welt gesetzt haben, entzogen; sie wird explizit gegen den Verlauf des Ursprungsgeschäfts wie aller weiteren Geschäfte, die der Wechsel vermittelt hat und aus denen heraus seine Haltbarkeit verbürgt worden ist, geltend gemacht, und zwar je nachdem gegen den Wechselschuldner, den Wechselaussteller und alle Indossanten gleichermaßen.[9] Jeder Wechselverpflichtete muss als Gesamtschuldner unwidersprechbar Eigentum in Geldform hingeben, wenn es vom Wechselinhaber verlangt werden kann;[10] und das mit letzter Konsequenz – die Bestimmungen des allgemeinen Schuldrechts, nach denen ein Zahlungspflichtiger grundsätzlich mit seinem gesamten Vermögen für seine Zahlungsversprechen haftet, gelten in verschärfter Weise auch für eine Wechselschuld [11] – und alternativlos. Wenn der Gesetzgeber die Vortäuschung eines Handelsgeschäfts beim Begründen eines Wechsels als Betrug unter Strafe stellt und zugleich die Ablösung von Handelswechseln durch ihre bloß finanztechnische Erneuerung als „Wechselreiterei“ verbietet, dann reagiert er damit auf allerlei „Wildwuchs“, der frei-vertraglichen Wechseln eigen war, die dem Staat dann im Streitfall auf den Tisch seiner Gerichte gelegt worden sind; generell dienen solche Paragraphen, ebenso wie allerlei penible Form- und Fristvorschriften,[12] allesamt der eindeutigen rechtlichen Fixierung des Umstands, dass hier ein schriftliches Zahlungsversprechen als solches, ein bloßer Kontrakt, zwar nur befristet, auf Zeit aber tatsächlich Geldqualität besitzt.
Auf die Art billigt die bürgerliche Staatsmacht die „Ableitung“ des „Handelsgeldes“ aus seiner Funktion fürs kapitalistische Geschäftsleben, macht sie gesellschaftlich gültig und verbindet ihr Plazet zugleich mit der rechtlichen Sicherstellung des qualitativen Unterschieds zwischen Schuld und Zahlung, den die Kaufleute selbst auch nie vergessen. Sie erkennt an, dass die Vermehrung des Geldes an der Menge des jeweils schon verdienten Geldes keine Schranke haben darf und soll; sie dekretiert, dass die kommerzielle Emanzipation vom verdienten Geld nur auf ein Warengeschäft begründet sein darf, also grundsätzlich der produktiven Geldvermehrung untergeordnet sein muss; und sie macht den Inhalt des Geldversprechens zum unbedingten, vom Erfolg des Basisgeschäfts getrennten Gebot. In der Kombination macht der Staat den Geschäftserfolg praktisch zur Pflicht und legt fest, dass eine mit Schulden finanzierte Produktion dafür da sein muss, die Geldqualität des Wechsels zu beglaubigen und den Vorgriff auf kontinuierlichen Geschäftserfolg zu rechtfertigen. Diese von ihm beglaubigte Unterordnung des Geldes – der Sache, um deren Vermehrung es geht – unter seine Funktion für die kontinuierliche Geldvermehrung erhebt er damit zur neuen Geschäftsgrundlage.
Den Widerspruch, den die Geschäftswelt sich damit leistet, schafft der Staat so natürlich gar nicht aus der Welt; er mindert noch nicht einmal substanziell das Risiko, das die kapitalistischen Konkurrenten mit ihrem vertrauensvollen Wechselobligo eingehen, geschweige denn dass er es ihnen abnimmt. Was er mit seinem Recht beisteuert, ist zum Vertrauen die Gewalt, zur berechnenden privaten Verpflichtung der hoheitlich gewährleistete Vollstreckungstitel. So macht er, nach dem Antagonismus der Konkurrenz, den Widerspruch eines positiven geschäftlichen Zusammenhangs der Konkurrenten, einer freiwillig eingegangenen, am Ende jedoch irreversiblen Abhängigkeit des je eigenen von fremdem Geschäftserfolg, überhaupt haltbar. Mit diesem doppelten Dienst der bürgerlichen Staatsgewalt steht – im Prinzip – das System aus Konkurrenz und Kredit.
§ 6 Notwendig falsches Bewusstsein über Geld, Gewinn, Eigentum, Markt und Staat; gewöhnlich sowie wissenschaftlich
1. Grundmuster der Würdigung, die die Einkommensquelle Kapital erfährt: Die Beschwörung von Leistungen, die mit dem Zweck nichts zu tun haben, ihn aber gutheißen
Ob explizit als Kompliment, ob mit einem eher verhaltenen „immerhin“: der kapitalistischen Produktionsweise werden als ihre wesentliche Errungenschaft allerhand positive Leistungen zugutegehalten. Die effiziente Güterversorgung vor allem: Es gibt nichts, was es nicht zu kaufen gibt; Bedürfnisse werden nicht bloß befriedigt, sondern mit Überangeboten bedient, oft genug durchs Angebot überhaupt erst geschaffen. Dass Geld verdient werden muss, um am hergestellten Überfluss teilzuhaben, ist klar; aber auch das schafft die Marktwirtschaft, und das ist ihre nächste gute Tat: Sie bietet Arbeitsplätze, deren entscheidende Qualität nicht in der dort verrichteten Arbeit, sondern im dort verdienten Geld besteht. Und, dritte Wohltat des Systems: Für das Geld, das die Mitglieder der Stiftung Marktwirtschaft an ihren Arbeitsplätzen – in Fabriken und Betrieben, im Staatsdienst oder wo auch immer – verdienen, sorgen die Unternehmer auch: Sie verdienen es „am Markt“, und aus ihren Einnahmen zahlen sie Löhne, alimentieren sie direkt oder indirekt den Staat, namentlich dessen Sozialleistungen, spendieren sie der Volksgemeinschaft Fußballstadien und Museen, die gerechterweise den Namen ihrer Mäzene tragen, usw. Das Lob der Produktionsweise und ihrer maßgeblichen Akteure beschränkt sich auch gar nicht aufs Materielle. Vielleicht nicht jedes einzelne Geschäft, aber die ganze Art des auf Gewinn gerichteten Wirtschaftens sorgt grundsätzlich für Effizienz. Leistung wird gefordert, aber auch gefördert und mit dem Anreiz belohnt, der im Geld, dem ständig neu zu verdienenden, liegt. Das Ergebnis mag in zahllosen Einzelfällen dem Ideal der Leistungsgerechtigkeit, der glücklichen Entsprechung von Anstrengung und Ertrag, von Verdienst im moralischen und Verdienst im materiellen Sinn des Wortes, nicht genügen; das ändert aber nichts daran, dass das System des Wettbewerbs eben diesem Ideal verpflichtet ist; und aufs große Ganze gesehen gleicht sich auch wirklich in letzter Instanz – fast – alles irgendwie aus. Dass es Anstrengung kostet, sich marktwirtschaftsgemäß als Wettbewerber zu behaupten, ist kein Übel, sondern eine ganz entscheidende erzieherische Gratisgabe des Kapitalismus an die menschliche Natur, die ohne Anstachelung durch Verlustängste und Gewinnaussichten unter ihren Möglichkeiten bleibt, ja zur Verwahrlosung neigt.
Was mal mehr der Wirtschaftsweise, mal explizit deren kapitalistischen Machern zugutegehalten wird, in aller Öffentlichkeit und im Bedarfsfall von den sprachmächtigen Vertretern des Unternehmerstandes selbst, hat mit dem banalen Zweck, den Unternehmer in der Marktwirtschaft verfolgen, ersichtlich nichts zu tun, und auch nichts mit dem Inhalt der Sachzwänge, die aus deren Aktivitäten folgen und vom Staat mit der flächendeckenden Gewalt seines Rechts in Kraft gesetzt werden. Fast peinlich, daran zu erinnern: Kapitalistischen Unternehmern geht es, was auch immer sie sich für ihr Privatleben davon versprechen und sonst noch vornehmen, von Berufs wegen um Geld, nämlich um das, welches aus dem Einsatz ihres Vermögens als produktive Geldquelle zu machen ist. Ihr gesellschaftlicher Daseinszweck ist schlicht und ergreifend ihre private Bereicherung. Die Versorgung der Gesellschaft, die sie zustande bringen, ist Mittel für diesen Zweck; sie unterbleibt, wenn der Produzent damit keinen Überschuss an Geld verdient. Der Lohn, den die Unternehmer zahlen, mag den bezahlten Angestellten für alles Mögliche dienen; seine Bezahlung bezweckt nichts weiter als das wirksame Kommando über freie Leute, die für ihren Lebensunterhalt auf ein Arbeitsentgelt angewiesen sind. Der Arbeitsplatz, für den Lohn gezahlt wird, ist mit all seinen technischen Merkmalen nichts als Mittel für den Einsatz bezahlter Kräfte für die Bereicherung ihrer Chefs. Entgelt und Arbeitsplatz verhalten sich deswegen so zueinander, dass die Masse der entlohnten Arbeitskräfte mit ihrer Kaufkraft von dem Reichtum, der an ihren Arbeitsplätzen produziert wird, ausgeschlossen ist und bleibt. Die Effizienz, zu der die Kapitalisten einander durch ihre Konkurrenz „am Markt“ und im Hinblick darauf ihre Belegschaft nötigen, ist keine allgemeine Tugend, sondern der beschönigende Name für gesellschaftliche Gewaltverhältnisse mit einem eindeutigen ökonomischen Inhalt: Kapitalisten verdienen ihr Geld im Konkurrenzkampf mit ihresgleichen und auf Kosten der Leute, die sie wohlwollend „ihre Mitarbeiter“ nennen. Wenn Geschäftsleute einander ihr Vertrauen schenken und Kredit geben, dann nur unter der wirklich nicht menschennatürlichen Bedingung, dass die Partner dafür ihre geschäftliche Existenz verpfänden. Und wenn sie aus ihren Überschüssen die öffentliche Gewalt alimentieren, dann machen sie erstens bei jeder Gelegenheit deutlich, dass sie jeden eigenen Beitrag zum Gemeinwohl als kontraproduktive Zweckentfremdung ihrer Einnahmen bedauern, obwohl zweitens gerade sie überhaupt nichts in der Hand hätten, geschweige denn als Mittel für ihren Gelderwerb einsetzen könnten ohne eine Staatsgewalt, die die Gesellschaft flächendeckend ihrem Regime unterwirft, das auf Schutz des Eigentums und der Personifizierung des Eigentums, der freien Rechtsperson, zielt. Womit auch klar ist, dass das, was man gerne „Menschennatur“ nennt, nicht durch die Gnade der freien Konkurrenz zur Blüte gebracht, sondern durch hoheitliche Gewalt hergestellt wird.
Von dem letzten Punkt vielleicht abgesehen, ist das alles wohlbekannt. Es hilft aber nichts: Die wirklichen Zwecke kapitalistischen Produzierens und ihre sachwidrige Rechtfertigung gehen im Selbstbewusstsein der Unternehmer wie in der Vorstellungswelt der auf Gelderwerb festgelegten Gesellschaft prächtig zusammen. Und zwar aus einem einzigen denkbar schlechten Grund: Die Gleichsetzung des banalen Zwecks, den kapitalistische Unternehmer professionell verfolgen, mit lauter nützlichen Leistungen für den Rest der Gesellschaft und fürs große Ganze überhaupt, so als wären die die eigentliche Wahrheit des Gelderwerbs mit Kapital, begründet sich aus und mit der tatsächlichen Abhängigkeit des gesellschaftlichen Lebens und Überlebens vom kapitalistischen Geschäft, der tatsächlichen Herrschaft der Privateigentümer über den gesellschaftlichen Produktionsprozess und das dafür in Dienst genommene Potential an Arbeits- und Produktivkräften. Es ist die mit viel hoheitlicher Gewalt tatsächlich hergestellte Subsumtion alles dessen, womit die Menschheit sich materiell reproduziert, unter die Erfordernisse privater kapitalistischer Bereicherung, die in der Aufzählung unentbehrlicher Leistungen der Kapitalisten für die Allgemeinheit ihre idealisierende Fassung und hohe moralische Würdigung erfährt; umgekehrt bezeugt dieser Idealismus nichts weiter als die Totalität des ökonomischen Regimes der Geschäftemacherei über das Gemeinwesen.
Vom Standpunkt der kapitalistischen Produzenten versteht sich die Gleichung, die ihrer Geschäftstätigkeit allerhöchsten Rang beimisst, ohnehin von selbst. Ohne ihr unermüdliches Bemühen um maximalen Gelderwerb würde in einem Land, in dem alles Produzieren in ihrer Hand liegt, gar nichts vorangehen; ohne ihren Konkurrenzkampf um die Zahlungsfähigkeit des Publikums käme in einer funktionierenden Marktwirtschaft niemand an irgendeinen Gebrauchsartikel; ohne ihre Produktionsmittel und ihre Lohnzahlungen wären die eigentumslosen Massen ohne jede Chance, sich einen Lebensunterhalt zu verdienen. Dass diese Logik des „Ohne uns läuft gar nichts!“ lauter Zwangsverhältnisse unterstellt, die Privatmacht des Geldes und die Ohnmacht der Eigentumslosigkeit, spielt keine Rolle in einem Denken, das alle Geldinteressen und deren Gegensätze für die Realität nimmt, die nicht befragt, sondern mit den gegebenen Mitteln bewältigt gehört.[13] Das Interesse, von der eigenen Firma zu leben, langt dafür schon: Es macht aus den Verhältnissen, in denen und mit deren Ausnutzung Kapitalisten ihr Geld verdienen, den Standpunkt, der dazu schon allein deswegen auch theoretisch einzunehmen ist, weil er für sie praktisch der allein sinnvolle ist. Völlig gleichgültig, was Geld seiner ökonomischen Natur nach ist: Für den engagierten Unternehmer ist es sein Eigentum in flüssiger, überall und jederzeit einsetzbarer Gestalt, Liquidität. Der Gewinn, den er mit seinem Betrieb erwirtschaftet, ist der Aufschlag auf seine Betriebskosten, den er sich am Markt erkämpft, und in dem Maß, wie er sich einstellt, die Erfolgsprämie für sein Geschick, den Betrieb effizient gemacht und den verlangten Profit richtig bemessen zu haben; wodurch die Differenz zwischen den Ausgaben für seinen Produktionsprozess und dem Gelderlös für seine Produkte überhaupt zustande kommt, muss er wirklich nicht wissen. Die Lohnarbeit, die diese Differenz schafft, interessiert den Unternehmer als Beitrag zum und Abzug vom Betriebsergebnis, als ein leibhaftiger Widerspruch also, den er aber ganz pragmatisch handhabt: Er muss ganz einfach auf zwei Dinge aufpassen, nämlich auf einen effizienten Arbeitseinsatz und auf möglichst geringe Lohnkosten. Zu den Arbeitskräften, die die nötige Arbeit wegschaffen, stellt er sich als freien, gleichen, selbstverantwortlichen Bewerbern, wenn es um ihre Einstellung geht; er schätzt sie als Mitarbeiter, mit denen er sich das Betriebsergebnis teilt, solange der Betrieb gut läuft; wenn nicht, dann bedauert er die sachlich gebotene Trennung und verlangt dafür ein gewisses Verständnis der Betroffenen, dass es wohl so sein muss, weil die Konkurrenz nun einmal ihre Härten hat. Der Markt ist für Kapitalisten die wichtigste Phase im produktiven Einsatz ihres Vermögens, in der sich nämlich entscheidet, ob ihr Produkt zu Geld und der beanspruchte Gewinn realisiert wird, also die permanente Bewährungsprobe für ihre Fähigkeit, sich gegen ihresgleichen durchzusetzen; deswegen besteht ihr Verständnis der Sache in dem leicht widersprüchlichen Anspruch, dass dort nach ganz objektiven Kriterien ein gerechter Wettbewerb um Effizienz abläuft, der wie von selbst immerzu ihnen Recht gibt, weil andernfalls viel dafür spricht, dass wettbewerbswidrig manipuliert worden ist. Und dass die Staatsgewalt mit ihrer Rechtsordnung die Welt so eingerichtet hat, dass sie mit der Privatmacht ihres Geldes über eine Arbeitermannschaft disponieren können und ihr Betrieb für sie zur Geldquelle wird, begreifen die Unternehmer gleich als das verpflichtende Versprechen der Politik, nicht mehr und nicht weniger als das Nötige dafür zu tun, dass die Welt dann auch so funktioniert. Im Lichte dieser Logik, die zwischen der Realität, ihrer interessierten Inanspruchnahme und einer fordernd-affirmativen Einstellung zu ihr keinen Unterschied macht, verstehen Kapitalisten sich als Sachwalter der Wirtschaft oder überhaupt gleich als die Wirtschaft, setzen ihren Nutzen mit dem der Allgemeinheit gleich und schreiben die maßgebliche Rolle, die sie spielen, nicht dem im Geld vergegenständlichten gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnis zu, sondern mit größter Selbstverständlichkeit sich, nämlich ihrer praktisch so entscheidenden Handhabung ihres Geldvermögens und ihres Betriebs. Ihr Anrecht darauf, dass die Welt es ihnen bei der Ausübung ihres Jobs nicht schwer macht, sondern zuarbeitet, folgt daraus ganz von selbst; für Unternehmer gehört es schlicht zur Normalität – die freilich oft genug, zum Schaden der Allgemeinheit, missachtet wird –, dass Arbeiter für bescheidenen Lohn anforderungsgemäß arbeiten, der Markt ihnen Geld einspielt, überhaupt immer genug Geld für ihre Belange verfügbar ist und der Staat Hindernisse aller Art fürs Geschäft im Allgemeinen, für das ihre im Besonderen aus dem Weg räumt.
Darin kann ihnen „die Allgemeinheit“ – in Gestalt der politisch Verantwortlichen wie einer realitätstüchtig ums Gemeinwohl besorgten öffentlichen Meinung –, zumindest im Prinzip, nur zustimmen. Die staatlichen Machthaber bestehen keineswegs darauf, dass es doch die von ihnen gehandhabte politisch monopolisierte Gewalt ist, die die Gesellschaft aufs Geldverdienen als Lebensmittel festlegt und die Verhältnisse schafft, die die industriell aktiven Geldbesitzer als Instrumentarium ihrer Bereicherung benutzen: Von den hergestellten Zuständen ausgehend, verstehen und betätigen sie sich vielmehr als die zuständigen Sachwalter der Realität, erkennen die Interessen, die sich im Sinne eines redlichen Gelderwerbs daran zu schaffen machen, als das natürliche Recht ihrer Bürger an, stellen sich ganz grundsätzlich affirmativ zu den Abhängigkeiten, die daraus folgen, und machen deren Erfordernisse und Konsequenzen zu ihrer Gestaltungsaufgabe. Ein verantwortungsbewusster Mitbürger, der an die herrschenden Verhältnisse die zwei kritischen Fragen zu stellen hat, wie er damit zurechtkommt und wie sie allenfalls in dem Sinne zu verbessern wären, dass er besser damit zurechtkommt, kann seinen Politikern in ihrer Sorge um den Erfolg des ganzen Ladens im Prinzip nur Recht geben. Die herrschende öffentliche Meinung geht über solche Gesichtspunkte gerne hinaus. Sie belässt es nicht dabei, den Unternehmern im Namen dessen, dass sie „die Wirtschaft“ sind, bei ihrem Bemühen um Bereicherung gutes Gelingen zu wünschen. Aus der Art und Weise, wie die als alternativlose Realität anerkannte Marktwirtschaft funktioniert, nämlich ausgerechnet aus dem Umstand, dass im Geschäftsleben die Durchsetzung von Interessen allemal auf Kosten von Kontrahenten gelingt, leiten Fachleute der Menschennatur eine tiefe Einsicht ab: Wenn die Konkurrenz mit ihren harten Anforderungen so flächendeckend den gesellschaftlichen Lebensprozess beherrscht, dann muss das erstens etwas Gutes sein, nämlich eine Herausforderung an Leistungsvermögen und Leistungsbereitschaft der Menschen durch edlen Wettstreit; jeden störenden Inhalt beiseite gelassen, stellt der Kapitalismus sich dar als Wettbewerbsgesellschaft, die Leistung belohnt, also gerecht und effizient zugleich ist. Und das muss zweitens daran liegen, dass Konkurrenz „ganz allgemein“ in der Natur derer liegt, die in der schnöden Wirklichkeit gar keine andere Chance haben, als im bürgerlichen Lebenskampf mitzumachen. Was man sich dann auch sehr schön an der Evolution als allgemeinem Lebensgesetz der Natur überhaupt klarmachen kann, das bekanntlich schon die Dinosaurier wegen mangelnder Fähigkeit zur Anpassung an den bürgerlichen Lebenskampf zum Aussterben verurteilt hat.
2. Die ‚Schattenseiten‘ als Problem: arm/reich, Verteilung, Knappheit/Maßlosigkeit
Dass die große Mehrheit in der Marktwirtschaft, die Masse derer, die gegen Lohn die anfallenden Arbeiten erledigen, in einem auffälligen Kontrast zur Menge des geschaffenen Reichtums herzlich wenig verdient, zählt im Lichte des affirmativen Realismus, der „die Dinge“ so nimmt, wie sie „nun einmal“ sind, zu den Schattenseiten, mit denen bei derart lichtvollen Verhältnissen allemal zu rechnen ist. Zu diesem heiklen Thema hat der marktwirtschaftliche Sachverstand ein kleines Arsenal von Ideologien entwickelt, die die Konsequenzen des herrschenden Produktionsverhältnisses so deuten, dass Lohnarbeit und Kapital darin gar nicht vorkommen.
Tatsächlich lässt der nicht zu übergehende Maßstab des Einkommens manchen nicht bloß über den Überfluss auf der einen Seite ehrfürchtig staunen, sondern über den Mangel auf der anderen Seite und die sich immer weiter öffnende „Schere“ zwischen arm und reich kritisch werden – der Unterschied gilt als ziemlich beklagenswert, in vielen Fällen als zu groß und seine Vergrößerung als ungerecht. Wenn man großzügig den Gegensatz außer Acht lässt, durch den die Leistung der vielen ziemlich armen Leute dauernd den Reichtum hervorbringt, der zu seiner Mehrung den kostensparenden Einsatz von Lohnarbeit gebietet, dann sind die folgenlosen Beschwerden über eine ungerechte Verteilung der passende Ersatz für Kritik. Zumal man mit solchen Klagen seine Zustimmung zum Recht und seine Vorliebe dafür nachdrücklich unterstreicht: Das „System“ geht schon in Ordnung, Gleichheit & Freiheit sind eine Freude, zu der die lästigen Erfahrungen mit eigener und fremder Armut eigentlich nicht passen. Umgekehrt melden sich aber auch Liebhaber von „Unterschieden“ zu Wort und beteuern, dass Gleichmacherei doch nicht der Sinn von Gleichheit sein könne; für sie bezeugen die diversen Grade des Erfolgs nicht nur, dass man es zu etwas bringen kann – auch der Weisheit, dass eine gerechte Ordnung die Verschiedenheit der Menschen zu würdigen habe, sind sie mächtig. Dass es Arme und Reiche gibt, ist für sie überhaupt kein Grund, den besagten und beklagten Unterschied abzulehnen. Zur Bekräftigung ihres Gerechtigkeitsempfindens bemühen sie die alberne Feststellung, dass es schon früher, nämlich immer Reiche und Arme gegeben hat. Ihnen stehen Denker zur Seite, die sich aufs Rechnen verstehen und demonstrieren, dass eine andere „Verteilung“ mit der Benutzung von Lohnarbeit durch kapitalistische Firmen gar nicht vereinbar ist. Ihre intellektuelle Blüte kündet davon, dass es keinem der vielen Schlechterverdienenden viel nützen würde, wenn die wenigen Reichen ihre Habe unter sie verteilen würden: Der einzelne bekäme kaum etwas und hätte mangels finanzkräftiger Arbeitgeber keine Gelegenheit mehr zu nichts. So einfach geht die Anerkennung einer Produktionsweise als „naturnotwendig“, in der mit der „Arbeitsteilung“ zwischen den Klassen auch schon alles Übrige verteilt ist.
Die Zweifel, die angesichts solch kluger Deutungen noch übrig bleiben, erledigt die ideologische Nachhut aus dem demokratisch, sozial, geschichtlich und menschlich denkenden Lager, das auch mit jedem Tag Kapitalismus wächst. Bei demokratischem Licht besehen genießen Lohnarbeiter weder die Arbeit noch den Lohn, sondern das Recht. Ihre Menschenwürde ist verbrieft, willkürlicher Gebrauch ihrer Arbeitskraft ist nicht zugelassen. Sooft der gesetzlich geregelte Gebrauch sich nachteilig bemerkbar macht, stellt sich daher die heiße Frage, ob nicht doch eine Rechtsverletzung stattgefunden hat oder ob gar statt des Gesetzes Privilegien zur Anwendung gekommen sind. Die „sozial Schwachen“ nämlich, das weiß der aufgeklärte Demokrat, sind insgesamt – „tendenziell“, „immer noch“... – benachteiligt. Das soziale Denken gibt dazu zu bedenken, dass den ökonomischen Beschränkungen der Lohnarbeiter in allen ihren Verlaufsformen – „immerhin!“ – die staatliche Betreuung auf dem Fuße folgt. Das ist eine Errungenschaft, weil so etwas natürlich von der Güte der politischen Herrschaft zeugt, die bei allen – „alternativlosen“ – „sozialen Härten“ das Schlimmste zu vermeiden trachtet. Darunter stellen sich auch die geschichtlich bewanderten Gemüter allerlei nicht-, vor- oder frühkapitalistische Formen des Elends vor – und wenn Ähnliches dann doch auch heute wieder und noch vorkommt, so bildet es die Ausnahme und gehört unter die offizielle Definition der „Sozialfälle“, die es aus Gründen selbst- oder unverschuldeter Lebensuntüchtigkeit immer wieder gibt. Weil offiziell als solche anerkannt, haben diese Fälle nichts mit dem an Menschlichkeit orientierten „System“ zu tun, sondern sind ein Problem für humanitäre Bemühungen, die der Staat höchstselbst anleitet. Dass es ein solches „soziales Engagement“ immer braucht und nicht einmal der Kapitalismus da endgültig Abhilfe zu schaffen vermag, hat die Volkswirtschaftslehre in ihr Dogma von Mensch und Natur übersetzt: auf der einen Seite die Menschennatur mit ihren maßlosen Bedürfnissen, auf der anderen Seite dasselbe, nämlich die naturgegebene Knappheit. Daher kommt es, dass sich alle, die sich alles kaufen können, trotz allem nicht alles kaufen können! Der Kapitalismus – eine notgedrungene Erfindung zur Verteilung knapper Güter: eine schönere Notwendigkeit geht kaum.
3. Die BWL: Marktwirtschaft als Inventar von Faktoren, mit denen resp. über die ein Unternehmen disponiert, also im Sinne seines „ökonomischen Prinzips“ Entscheidungen zu treffen hat
Die Fiktion einer naturgegebenen Notwendigkeit, die dem kapitalistischen Unternehmen seinen wahren Produktionsauftrag erteilt und zu der das kapitalistische Wirtschaften so gut passt, als wären Ressourcen und Bedürfnis von einer unsichtbaren Hand eigens dafür eingerichtet worden, dient einer Wissenschaft als ideologischer Auftakt, die sich ganz speziell und im Detail ums Metier des unternehmerischen Geldverdienens kümmert und sich um dessen allseitigen Erfolg verdient machen will. Die BWL eröffnet die entsprechend zielgerichtete Analyse ihres Gegenstandes ausgerechnet mit der Beschwörung einer Auftragslage – nämlich: mit prinzipiell unzureichenden Ressourcen einen prinzipiell nicht zu sättigenden Bedarf zu befriedigen –, die vom Geld als Mittel und Gewinn als Ziel, überhaupt vom allgemein bekannten Inhalt unternehmerischer Tätigkeit vollständig abstrahiert, ja erklärtermaßen fürs Erste gar nichts wissen will. Die Erfindung einer solchen naturgegebenen Problemlage dient ihr zur Ableitung einer Lösung, die sie „ökonomisches Prinzip“ nennt und die in der Sache nichts als das erfundene Problem selbst als das Gesetz seiner Lösung formuliert: Betriebliches Wirtschaften, wann, wo und unter welchen Bedingungen auch immer, bestünde seinem wahren, wissenschaftlich ermittelten Zweck nach eben darin, aus knappen Ressourcen ein Maximum an Bedürfnisbefriedigung herauszuholen. Zu diesem fiktiven Optimierungsauftrag setzt die BWL die allseits und natürlich auch von ihr gewussten wirklichen Ziele und Erfordernisse unternehmerischen Handelns – Geldvermögen in der Produktion gewinnbringend einzusetzen – ins Verhältnis als probates Mittel: als eine unter verschiedenen denkbaren Alternativen; Planung zum Beispiel lässt sie durchaus als mögliche Methode zur Versorgung der Menschen mit ihrer metaphysiologischen Bedürfnisnatur gelten, freilich als schlechte. Denn so will diese Wissenschaft das kapitalistische Gewinnstreben von vornherein verstanden haben, noch bevor man mehr davon weiß als eben die Trivialität, dass sich da der Egoismus eines vermögenden Betriebseigentümers betätigt: Genau das wäre die optimale Art und Weise, Ansporn und Methode zugleich, das „ökonomische Prinzip“ in die Tat umzusetzen – jenes Prinzip, das ja erstaunlicherweise nichts anderes gebietet als in absurd abstrakter Form eben das, was Unternehmer auf ihre Art machen, wenn sie aus dem Einsatz ihrer notorisch „knappen Ressource“ Geld ein Maximum an Befriedigung ihres durch kein Maß begrenzten Strebens nach Gewinn herauszuholen versuchen.
Als Erklärung des Prinzips kapitalistischen Unternehmertums ist der dort angeblich realisierte Triumph des Grundsatzes Mach viel aus wenig!
albern. Als ideologische Vorgabe taugt der Gedanke prima. Er rechtfertigt nämlich ohne alle Abstriche und Relativierungen den Standpunkt, mit dem Unternehmer tatsächlich auf die Welt losgehen. Dass Natur und Arbeit, Produkte und Bedürfnisse, Geld und Menschen dem Gewinnmaximierungsbestreben der Unternehmer zu Gebote stehen, stellt sich in diesem Sinne als ökonomischer Glücksfall dar: Da gehen eine optimale Güterversorgung der Menschheit und eine optimale Profiterwirtschaftung marktwirtschaftlicher Betriebe glatt Hand in Hand.
Im Lichte des guten Zwecks, den das praktische Interesse von Unternehmern an der Maximierung ihres Gewinns erfüllt, macht die BWL dieses Interesse zum theoretischen Standpunkt ihrer Disziplin: Wissenschaftlich fundierte Anleitungen zum Betriebserfolg sind der spezielle Dienst, den sie – die sich selbst als „Hilfswissenschaft für die unternehmerische Praxis“ versteht – zum wirtschaftlichen Geschehen und dessen Funktionieren beizutragen hat. Dafür fasst sie die Maximierung des Gewinns als eine Frage des richtigen Disponierens mit – das ist für die praxisorientierte BWL keine offene Frage – all den menschlichen wie sachlichen ‚Instrumenten‘, mit denen Unternehmer um des Betriebserfolges willen hantieren. Die freie Verfügung über alle Dinge und Interessen, mit denen ihr Sorgeobjekt es zu tun bekommt, hält die wissenschaftliche Lehre vom Betrieb offensichtlich für dessen entscheidenden ökonomischen Inhalt. Dass sie sich mit der Umdeutung der praktischen Notwendigkeiten, die Unternehmer exekutieren, in Techniken des Umgangs mit Produktionsfaktoren nicht blamiert, da kann sich die Wissenschaft – wie die Praktiker in den Führungsetagen – ganz auf die wirkliche Macht des Eigentums verlassen: Die Produktionsfaktoren sind in einem kapitalistischen Betrieb Variablen der Disposition über sie. Auf dieser Basis mustert die BWL die Geschäftspraxis der kapitalistischen Unternehmenswelt und verknüpft dabei systematisiertes Erfahrungswissen aus der betrieblichen Praxis mit deren bemühter Deutung und Präsentation im Sinne eines Rezeptbuchs für sicheren Erfolg beim Gewinnemachen – ganz so, als wäre die Durchsetzung in der kapitalistischen Konkurrenz eine Frage spezieller Regeln und Methoden der Unternehmensführung.
Für den Einkauf der Produktionsfaktoren über die „Leistungserstellung“ bis zur „Vermarktung“ der Produkte entwickelt die Wissenschaft daher Gesetzmäßigkeiten, Modelle und daraus resultierende „betriebliche Handlungsalternativen“. Neben einem Repetitorium der Grundrechenarten des Geschäfts, mit dem die Frage nach dem Gewinn schnell erledigt ist – Erlös minus Kosten –, bietet die BWL mehr oder weniger komplizierte Berechnungsverfahren an, damit die Entscheidungen des Managements im Betriebsalltag zu optimalen Bestellmengen, Losgrößen und Produktionslosen führen. Worauf jeder Unternehmer baut, wenn er einkauft, Lagerbestände plant oder Produktionslose nach wechselnden Auftragslagen kalkuliert, dass er mit seiner Kalkulation von Kosten, Auftragsmengen und Zeitperioden nicht daneben liegt, diesem praktischen Ideal will die BWL mit ihren Methoden Verlässlichkeit verleihen. Dazu verwandelt sie die betrieblichen Kalkulationen in Kalküle nach dem Muster ihres „ökonomischen Prinzips“ – sofern und unter der Bedingung, dass die richtigen Annahmen getroffen werden, die dann als Variablen in den Formeln ihre Wirkung entfalten, sind für jede Geschäftssituation optimale Entscheidungen möglich. Die Fiktion einer Verfahrenstechnik für den Betriebserfolg bringt die BWL selbstverständlich auch auf den Absatzmärkten zur Anwendung. Gerade dort, wo sich Kapitalisten im „Wettbewerb“ gegen ihresgleichen durchsetzen müssen und mit nicht verwunderlicher Regelmäßigkeit Absicht und Resultat nicht unbedingt zusammenfallen, sind im Sinne der Planbarkeit des betrieblichen Erfolges berechenbare Grundlagen gefordert, auf die sich die Formulierung und Umsetzung der „strategischen Ziele“ stützen lassen. Dafür hat die BWL „Entscheidungsmodelle bei Unsicherheit“ in petto, mit denen sie die praktische Spekulation auf den Betriebserfolg um einen Methodenapparat bereichert, der auch noch für die Risiken dieses Treibens einen Grad an Sicherheit stiften soll. Usw.
So ist der Impetus, den maßgeblichen Organisatoren der Produktion im Kapitalismus „Planungs- und Entscheidungshilfen“ für den betrieblichen Erfolg, i.e. zum Profitemachen zu offerieren, für eine ganze Wissenschaft gut, die gänzlich ohne eine Erklärung des kapitalistischen Gewinnprinzips auskommt. Die BWL beglaubigt das kapitalistische Geschäft nicht nur als optimale Verfahrensweise zur Versorgung der Menschheit. Sie stellt mit ihren wissenschaftlich fundierten Einsichten, Ratschlägen und praktischen Handlungsanweisungen auch dem Selbstbewusstsein der Kapitalisten ein gutes Zeugnis aus – ihr Methodenapparat des Betriebserfolgs ist ein Spiegelbild der Einbildungen, die sich die kapitalistischen Eigentümer bzw. ihre bezahlten Manager notwendigerweise über ihr Tun und über das Geheimnis des von ihnen gemanagten Geschäftserfolgs machen: Von ihrem Können und Wissen hinge es ab, ob die Firma in der Konkurrenz reüssiert oder nicht. Ideologien und Technologien der Ausbeutung und Konkurrenz – das ist die akademische Dienstleistung der BWL [14] für das kapitalistische System.
[1] Dass die Staatsgewalt ihrem Volk so respektvoll begegnet, rechnet sie sich hoch an; immerhin kann sie auch ganz anders, tut das auch bei Bedarf, hat Freiheitsberaubung und diskriminierende Behandlung aber nicht im Programm und macht überhaupt nichts ohne Rechtsgrundlage, die „ohne Ansehen der Person“ für alle Bürger gleichermaßen gilt. Eine ehrwürdige Tradition hat die Selbstverpflichtung der öffentlichen Gewalt auf gleichen Respekt vor der Entscheidungs- und Handlungsfreiheit ihrer Bürger auch; für den epochalen Kampf gegen eine Staatsgewalt, die ihr Volk in unterschiedlich dienstbare Stände einteilt und zwischen denen allerlei persönliche Herrschafts- und Unterwerfungsverhältnisse verfügt, hat die aufstrebende bürgerliche Klasse manche Opfer gebracht, vor allem das niedere Volk bluten lassen; am Ende wurde in glorreichen Revolutionen der Grundsatz durchgesetzt, dass vor dem Staat und seinen Gesetzen alle Bürger gleich viel gelten und niemand programmatisch gegen seinen wohlverstandenen freien Willen zu besonderen Diensten und persönlichen Verzichtleistungen gezwungen werden darf. Staatliche Gewalt beschränkt sich seither auf den Erlass und die Durchsetzung eines allgemeinen Regelwerks, das unterschiedslos für alle gilt und einem jeden den Willen konzediert, nach seiner Façon sein Glück zu machen.
[2] Die Diagnose demokratie- und menschenrechtsidealistischer Linker, überall da, wo Elend herrscht und Klasseninteressen kollidieren, wären Freiheit, Gleichheit und die darauf beruhende „wahre Demokratie“ noch nicht verwirklicht, ist daher ebenso verkehrt wie die Vorstellung verfassungstreuer Sozialisten, ein so hochanständiges Grundgesetz wie das deutsche enthielte eine Lizenz für die friedliche Überwindung des Kapitalismus. Die Idee, mit dem Gleichheitsgrundsatz des bürgerlichen Staates und der von ihm garantierten Handlungsfreiheit wären relevante soziale Unterschiede und ökonomische Interessengegensätze im Prinzip unvereinbar, ist zwar gut gemeint, aber nicht wirklich rechtsstaatskonform.
[3] Dass grundsätzlich Bedarf nach ihren Gebrauchsartikeln besteht, davon gehen Kapitalisten mit derselben Selbstverständlichkeit aus, wie sie umgekehrt unterstellen, dass die Gebrauchsgegenstände, die sie für die kontinuierliche Aufrechterhaltung ihrer Produktion benötigen, am Markt verfügbar sind, alles Kaufen und Verkaufen letztlich also nur eine Frage der Verfügung über hinreichend viel Geld ist.
[4] In die Welt kommt ein solcher Wechsel – wie schon erwähnt – von vornherein nur um seiner Funktion als Zirkulationsmittel willen, als zirkulationsfähiger Schuldtitel. Der Gläubiger einer aus einem Handelsgeschäft herrührenden Geldforderung – ein Verkäufer hat seinem Kunden Waren und/oder Dienste geliefert, aber deren Bezahlung dem Käufer gestundet – „zieht“ auf seinen Schuldner (den „Bezogenen“) einen Wechsel („Tratte“): Er erzeugt eine schriftliche Zahlungsanweisung an seinen Schuldner in der Form eines Dokuments, das außer den Angaben zum Bezogenen und zum Wechselaussteller den geschuldeten Betrag, den Erfüllungsort und Erfüllungstermin der Zahlungsanweisung sowie die Unterschrift des Ausstellers enthält, mit der dieser sich für die Bestandskraft seiner Forderung verbürgt. Die Unterschrift des Bezogenen auf dem Wechsel ist zwar nicht obligatorisch, wird aber in der geschäftlichen Praxis vom Wechselaussteller häufig eingefordert, weil der Bezogene mit dieser Unterschrift seine Schuld förmlich akzeptiert, die „Tratte“ wird dadurch zum „Akzept“. Mit diesem Dokument eines zukünftigen Geldeingangs als Geldersatz kauft der Wechselaussteller dann ein. Vom Standpunkt des Verkäufers wie des Bezogenen wechselt dadurch die Person des jeweiligen Kontrahenten – des (primär) Zahlungspflichtigen im einen, des Begünstigten im anderen Fall. Dabei ist diese Geld(ersatz)qualität des Wechsels allein verkörpert in dem Originaldokument selbst; wer es hat, ist Inhaber der Forderung, wer es verliert, hat auch den Anspruch verloren – wie beim richtigen Geld.
Unterstützt wird die Akzeptanz eines Wechsels als Kaufmittel im Übrigen dadurch, dass die Geldsumme, die der Wechsel verspricht, üblicherweise über dem Barverkaufspreis der Waren liegt, wobei die Höhe des Zuschlags abhängig ist von der Restlaufzeit des Wechsels.
[5] Durch einen Weitergabevermerk auf der Rückseite des Wechsels (das Indossament) überträgt der Begünstigte die Begünstigung auf einen Dritten und garantiert zugleich für die Erfüllung der kontrahierten Schuld. Der neue Begünstigte nutzt das empfangene Zahlungsversprechen dann in gleicher Weise seinerseits als „Handelsgeld“ und so weiter, bis der Wechsel bei Fälligkeit aus der Zirkulation fällt und eingelöst sein will.
[6] In diesen Zahlungsverkehr sind die Banken eingestiegen – zunächst in ihrer Eigenschaft als Liquiditätsverwahrer und Zahlstelle kapitalistischer Unternehmer – mit dem Angebot, dem Wechselbegünstigten gegen ein gewisses Entgelt – den ‚Diskont‘ – unmittelbar universell verwendbares Geld auszuzahlen und dafür die Bewirtschaftung des Zahlungsversprechens bis hin zum Eintreiben der Forderung am Fälligkeitsdatum zu übernehmen. Umgelaufen sind die übernommenen Wechsel dann nicht zuletzt zwischen den Banken, die so ihre wechselseitigen Ansprüche aus dem Geschäftsverkehr ihrer Kunden zum Ausgleich brachten, mit dem Effekt, dass für solche von einer oder mehreren Banken indossierte Wechsel der Widerspruch zwischen seiner Allgemeinheit als Zahlungsmittel und der Begrenztheit der Zahl der Garanten relativiert ist, insofern eine Bank sich mit ihrer Unterschrift gleich mit der Gesamtheit ihrer Geschäftsbeziehungen für den Wechsel verbürgt.
Erst über diese Einmischung der Banken in die Wechselzirkulation hat das Zahlen mit Wechseln allgemeine Verbreitung, in der Folge dann aber auch sein Ende gefunden: Der kommerzielle Kredit zwischen Kaufleuten ist überführt worden in ein Kreditverhältnis zwischen der Bank und ihren Kunden, die über das bei der Bank geführte Kontokorrentkonto ihren Zahlungsverkehr mit Kunden und Lieferanten abwickeln. Denen räumt die Bank eine Kontokorrentlinie ein: einen Überziehungskredit, den die Unternehmen bedarfsgerecht in Anspruch nehmen, um das zeitliche und wertmäßige Auseinanderfallen von Zahlungseingängen und Zahlungspflichten zu überbrücken, also die Kontinuität ihres Umschlags sicherzustellen getrennt von der Zirkulationszeit und den Fährnissen der Zirkulation ihrer Waren. Zugleich versetzt die Kontokorrentlinie sie in die Lage, ihren Kunden Zahlungsziele einzuräumen, die sie ihrerseits bei ihren Lieferanten in Anspruch nehmen. Als Sicherheit verlangen die Banken für den Kontokorrentkredit häufig die Abtretung von Kundenforderungen. Bei dieser Form des kommerziellen Kredits liegt schon die Stiftung der Schulden und damit aller segensreichen Wirkungen auf den Umschlag des Kapitals ganz auf Seiten der Bank; es ist ihre Entscheidung, in welcher Höhe sie ihren Kunden einen solchen Kredit einräumt. Die Zirkulation der kommerziellen Schulden der Unternehmen ist komplett eingeordnet in die Kontoführung innerhalb und zwischen den Banken, also die Verrechnung bzw. Saldierung des über die Banken abgewickelten Zahlungsverkehrs ihrer Geschäftskunden.
[7] www.rechtslexikon.net 2014
[8] Derleder, Knops, Bamberger (Hrsg.), Handbuch zum deutschen und europäischen Bankrecht, Springer 2009, S. 1337
[9] Die Fachwelt bezeichnet das als Materielle Wechselstrenge: Beim Wechsel handelt es sich um ein abstraktes Wertpapier, das losgelöst von dem zugrunde liegenden Rechtsgeschäft Ansprüche verbrieft. Einwände aus dem Grundgeschäft (z.B. mangelhafte oder unvollständige Ware, Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche) können nach Ausstellung des Wechsels die Haftung der Wechselverpflichteten nicht mehr einschränken.
(Gabler, Wirtschaftslexikon)
[10] Der Inhaber kann gegen die Indossanten, den Aussteller und die anderen Wechselverpflichteten bei Verfall des Wechsels Rückgriff nehmen, wenn der Wechsel nicht bezahlt worden ist.
(WG Art. 43 Abs. 1) (1) Alle, die einen Wechsel ausgestellt, angenommen, indossiert oder mit einer Bürgschaftserklärung versehen haben, haften dem Inhaber als Gesamtschuldner. (2) Der Inhaber kann jeden einzeln oder mehrere oder alle zusammen in Anspruch nehmen, ohne an die Reihenfolge gebunden zu sein, in der sie sich verpflichtet haben.
(WG Art. 47)
[11] Insofern verschärft, als ein Wechsel schon fast so gut wie ein Vollstreckungstitel ist. In den Worten von Wikipedia: Der Wechselprozess ist eine besondere Verfahrensart im deutschen Zivilprozessrecht. ... Unterform des Urkundenprozesses. Der Zweck des Wechselprozesses besteht darin, dem Begünstigten eines Wechsels die schnelle Erlangung eines Vollstreckungstitels zu ermöglichen, ohne auf das häufig überlastete und daher relativ langsame reguläre Zivilprozessverfahren angewiesen zu sein.
[12] So verfügt der Gesetzgeber z.B., dass ein Wechsel Schriftform haben und welche Bestandteile eine Wechselurkunde enthalten muss – neben der Bezeichnung des Dokuments als Wechsel
und dem Betrag ist z.B. anzugeben, wann, an wen und wo gezahlt werden muss (Art. 1 bzw. 75 WG) –; festgelegt sind Vorlegungsfristen usw. Diese Bestimmungen werden zusammengefasst unter dem Titel der formellen Wechselstrenge
.
[13] In Zeiten der Durchsetzung der kapitalistischen Produktionsweise, des politischen Kampfes der geldbesitzenden Bourgeoisie um ihr freies flächendeckendes Kommando über die gesellschaftliche Arbeit, war der fortschrittliche Zeitgeist noch um eine explizite moralische Rechtfertigung des eigennützigen Gewinnstrebens reicher Unternehmer bemüht: Es galt, deren ersichtlich partikulare, den gewohnten Lebensbedingungen der Masse der Landeskinder feindliche Interessenlage ideell ins Recht zu setzen. In Verkehr gebracht wurde die Vorstellung eines Verzichts, den große Eigentümer üben, wenn sie ihr Vermögen nicht – wie der bis dato herrschende Adelsstand – verjuxen, sondern produktiver Verwendung zuführen: Enthaltsamkeit als sittliche Rechtfertigung der Macht des Reichtums, arme Leute für dessen Vermehrung arbeiten zu lassen und entsprechend zu entlohnen. Den Theoretikern des Kapitals hat dieser Moralismus so gut gefallen, dass sie daraus ein wissenschaftliches Argument gemacht haben: Gemäß der Logik, dass die entscheidende Ursache für eine Wirkung im Fehlen des Gegenteils der behaupteten Ursache liegt, haben sie zur Erklärung des Gewinnemachens die Abstinenztheorie des Kapitals erdacht. Die lebt in einem der zentralen Dogmen der Volkswirtschaftslehre, der Gleichsetzung der Produktivkraft des kapitalistisch angewandten Eigentums – der ‚Investition‘ – mit gesamtgesellschaftlicher Zurückhaltung beim Konsumieren – dem ‚Sparen‘ –, der Formel ‚I=S‘, noch munter fort, ohne dass nach einer moralischen Rechtfertigung der Verfügungsmacht der kapitalistischen Elite über Arbeit und Reichtum der Gesellschaft noch eine nennenswerte Nachfrage bestände. Der moderne Unternehmer verrichtet einen anerkannten Job; sein Gewinn ist das Produkt, das die Welt von ihm erwartet; sein Einkommen vergütet ihm seinen Erfolg. Die Kritik, die es an diesem Berufsstand noch gibt, richtet sich nicht gegen das kapitalistische Geschäftsleben als Beruf, sondern gegen Pflichtversäumnisse bei seiner Ausübung.
[14] Dass die Konkurrenz der Kapitalisten eine eigene Wissenschaft hervorgebracht hat, verdankt sich dem Staat. Wegen der Abhängigkeit des nationalen Lebens vom Erfolg der Unternehmen legt dieser großen Wert auf eine höhere Ausbildung in Sachen Betriebsführung und Management. Deswegen avancierten die Erfahrungen und Instrumente der kaufmännischen Praxis irgendwann zum Stoff einer akademischen Vorbereitung auf Berufe im Management. Mittlerweile machen die Fehler der BWL den gesellschaftlichen Sachverstand über die Bedeutung von Unternehmen und Unternehmern für ‚die Wirtschaft‘ aus. Diese Wissenschaft zählt heute zu den Massenfächern an Hochschulen; auch so demonstriert die Gesellschaft, dass der Standpunkt der Kapitalisten eine zweifellos gute Referenz für das Nachdenken über die Realität des Wirtschaftens ist.
Ein Grund, das Programm und die Fehler dieser Wissenschaft näher unter die Lupe zu nehmen. Das geschieht im Rahmen der Broschüre Kritik der Betriebswirtschaftslehre, die demnächst im Gegenstandpunkt Verlag erscheint. Kapitel I und II sind in GegenStandpunkt 2-17 erschienen.