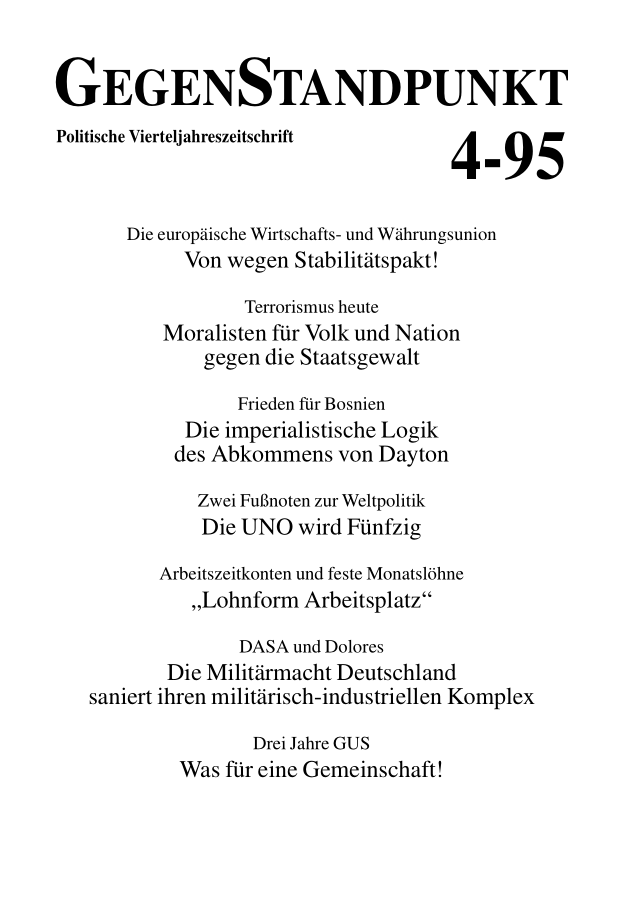Drei Jahre GUS
Was für eine Gemeinschaft!
Die durch die Auflösung der Sowjetunion unabhängig gewordenen Staaten schließen ein Bündnis, in dem sie friedlich um die Aneignung der geerbten Gewaltmittel konkurrieren. Für sie und insbesondere auch für die verbliebene Hauptmacht Russland stellt sich die Frage nach einem funktionierenden Gewaltapparat ganz neu. Bei all diesen Staatsgründungen sind vor allem neue, zur ehemaligen Volksdefinition der SU sehr konträre Scheidungen von Inländern und Ausländern durchzuführen und darüber werden etliche neue ethnische Machtkämpfe gestiftet. Der Westen entdeckt dabei lauter Einspruchstitel und beharrt auf weiterer freiwilliger Selbstentwaffnung.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Drei Jahre GUS
Was für eine Gemeinschaft!
Unter dem gleichmacherischen Titel eines Staates bevölkern bekanntlich recht unterschiedliche Subjekte den Erdball. Da gibt es die Handvoll von Staaten, die dank ihrer erfolgreichen imperialistischen Benutzung aller anderen zu Recht als die tätigen Subjekte dessen gelten, was Stoff und Inhalt von Weltpolitik ist. Deren Objekte – auch Staaten – sind alle, die es außerhalb ihres Kreises sonst noch gibt, und da weiß man im Grunde, womit man es zu tun hat: Vom herrschaftlich mehr oder weniger konsolidierten, daher im selben Maße zuverlässigen Rohstofflieferanten, über den tendenziellen „Ordnungsfall“, der bei „Instabilität“ oder unpassenden politischen Ambitionen wirklich einer wird, bis hinunter zum Herrschaftsgebilde, das es einfach nur gibt, weil von maßgeblicher Stelle die Lizenz zum Aufziehen eines Staatswesens erteilt wurde, reicht die Spanne dieser Geschöpfe, die die Macher der „Weltordnung“ in ihrem Wirken hinterlassen. Der Anerkennung dieser Staaten als Staaten tut dies keinen Abbruch. Ihre formelle Behandlung von gleich zu gleich ist und bleibt die Methode, mit der die wirklichen Mächte der Welt über sie Herrschaft ausüben, und stellt sicher, daß sie, solange es sie gibt, für diese brauchbar bleiben.
Nun bevölkert seit drei Jahren eine Generation von Staaten die Welt, die weder die Karriere ihrer imperialistischen Benutzung hinter sich noch so recht vor sich haben; die sich mit allen Ressourcen einer intakten Weltmacht gegründet, von denen gleich nach ihrer Gründung aber so gut wie nichts mehr übriggelassen haben; und von denen seit ihrer Gründung Eigentümlichkeiten zu Protokoll gegeben werden, die die Staatenwelt bislang nicht gesehen hat und die absehbar auch nicht in sie hineinpassen werden. Aber auch ihnen wird seitens aller maßgeblich Beteiligten unverdrossen die Anerkennung zuteil, die ihnen als Staaten gebührt, und darauf nicht zuletzt kommt es diesen Neugründungen auch schwer an. Der Erfolg, den die staatlichen Subjekte, die sich als GUS gegründet haben, mit ihrer Aufnahme in den Club der Souveräne ohne Zweifel für sich verbuchen können, täuscht allerdings darüber hinweg, daß sie in den nicht hineingehören.
*
Es war schon eine merkwürdige Entscheidung, die ein Dutzend aus der Taufe gehobener Nationen getroffen hat. Zur Unabhängigkeit entschlossene Führungen sind zu der Überzeugung gelangt, daß sie in vielen Belangen voneinander abhängig sind – also haben sie ihre Zusammenarbeit beschlossen. Die ist für die Herstellung ihrer Unabhängigkeit nämlich nötig. Denn das Teilen der politischen Macht ist erstens wie alles Teilen im Leben eine Angelegenheit, in der die Rücksicht auf den anderen gefragt ist. Zweitens aber geht es in der ehemaligen Sowjetunion nicht um einen Kuchen, dessen einvernehmlich rationierte Stücke durchaus den Appetit mehrerer Interessenten zu befriedigen vermögen, zumal sich bei Bedarf auch eine neue Lieferung herstellen läßt. Die politische Macht, um die es den neuen Souveränen geht, erweist sich beim Teilen als ein ziemlich schwieriges Objekt, weil sie einen in jeder Hinsicht ausschließenden Charakter besitzt. Das ist nicht nur den Parteien vor und hinter dem Ural geläufig, sondern auch den demokratischen Weltordnern, die – so sehr sie auch von der Zerlegung der SU begeistert sind – schon wissen, warum sie vor einem „Jugoslawien“ gigantischen Ausmaßes warnen.
Zunächst einmal ist es das Territorium, an dem sich die monopolistische Natur der politischen Herrschaft bemerkbar macht. Immerhin geht es auch den neuen Staaten um die Verfügung über ihr elementares Lebensmittel, wenn sie die Gebiete abstecken, in denen sie das Sagen haben und bestimmen, was mit den Wäldern und Wiesen, den Bodenschätzen und den aus dem Nachlaß der SU versammelten Reichtümern passiert. Die Quellen ihres Reichtums, aus denen die neuen Staatenlenker ihre künftige Macht hochrechnen, stehen mit den Quadratkilometern und Grenzen auf dem Spiel. Und selbst dann, wenn – wie zunächst in der GUS – die Grenzfragen friedlich-schiedlich über die Anerkennung der alten Republikabmessungen geklärt sind, stellt sich bei der Nutzung des staatlichen Anwesens des öfteren heraus, daß die Trennung in „unser“ und „euer“ Hoheitsgebiet einiges verhindert. Schon die Nutzung eines Flusses, die ab sofort nationalen Rechnungen unterworfen ist, bringt die neuen Souveräne in die ernstesten ökonomischen und ökologischen Gegensätze…
Auch die zur Ausübung des Gewaltmonopols nötigen Mittel übernehmen die neuen Gemeinwesen aus der Erbmasse der aufgelassenen SU. Gerät und Mannschaften des alten Militärs werden der politischen Führung der neuen Staaten unterstellt, so daß das Gelingen der Staatsgründung – wg. innerer und äußerer Sicherheit – damit steht und fällt, was eine Nation der anderen an diesen staatlichen Lebensmitteln entzieht. Dabei ist mit der Bedienung der neuen Herrschaften an dem gerade auf ihrem Gebiet stationierten Gewaltapparat noch gar nichts geregelt, auch wenn alle erst einmal so tun, als ob dies selbstverständlich wäre. Zumindest die Kommandeure der Truppen haben im militärischen Dienst ihren Willen nicht aufgegeben, sind also auch in der Lage zu prüfen, welchen Herren sie inskünftig dienen möchten. So fällt manchem – wegen der angesagten Umwidmung ihrer bisherigen Dienste auf lauter alternative neue Herren – eine gewisse Zugehörigkeit zur russischen Tradition ein; wobei sie das Bedürfnis nach Klärung ihrer Loyalitätsfrage mit dem gemeinen Volk teilen…
Die dritte elementare Auseinandersetzung zwischen den GUS-Staaten und in ihnen dreht sich um die Verfügung über ein Volk. Und zwar über eines, das sich fügt, als brauchbar angesehen wird und die neue Obrigkeit als brauchbaren Architekten seiner zukünftigen Heimat würdigt. So werden Millionen von Ex-Sowjetbürgern zum Objekt eines Kampfes darum, wer sie sich mit Recht als seine Untertanen zurechnet, und machen sich auch ihrerseits an der allemal ein bißchen rassistisch anmutenden Entscheidung zu schaffen, als welchen Gewaltmonopols legitimes und angestammtes Derivat sie sich betrachten wollen. Sie stellen vor lauter patriotischer Gesinnung die neuen Nationen in Frage, bringen sich „in die Politik ein“, statt zu gehorchen, tragen die neue Grundsatzfrage in den Militärstand, wo sie schon gewälzt wird, und kommen immer häufiger zu dem Befund, daß sie oder andere auf dem falschen Staatsgebiet wohnen…
Dies alles führt dazu, daß es in der Ex-Sowjetunion nicht gerade idyllisch zugeht – und der Westen einen ziemlich unhandlichen, großen Fall von Weltordnung auf sich zukommen sieht. Den einheimischen Vorkämpfern des neuen Nationalismus wie seinen auswärtigen Liebhabern steht wohl der eine oder andere „Friedensprozeß“ ins Haus.
Überblickend ist 1995 folgender Stand zu vermelden[1]:
Das Territorium
Daß staatliche Souveräne die schiere Ausdehnung des Gebietes, über das sich ihre Hoheit erstreckt, so furchtbar wichtig nehmen, ist wahrlich keine Besonderheit der Gründungsaktivisten, die sich am Gelände der ehemaligen UdSSR zu schaffen machen. Noch dem zivilisiertesten Exemplar der bürgerlichen Vorbilder, denen sie dabei nacheifern, ist die Umrechnung von Macht in die Dimensionen des Raumes, der einem exklusiv gehört, vorwärts wie rückwärts geläufig, weil eben das, was einem da gehört, die Materiatur der ganzen Souveränität ausmacht: Der Boden mit allem, was auf ihm ist und in ihm steckt, ist das allererste Objekt, auf das sich die Kontrolle der Staatsmacht erstreckt und an dem sie alle Mittel vorfindet, aus sich etwas zu machen. Und noch bevor sich ein Staat anschickt, seine Hoheitsbefugnis auszuüben und zur praktischen Nutzung der Mittel zu schreiten, über die er gebietet, weiß er zumindest eines: Mit und in den Grenzen seines Gebietes ist nicht nur der Raum, sondern eben auch die Potenz seiner Macht beschränkt, und das ist der entscheidende Grund, weshalb alle Staatswesen sich durch die Grenzen, in die sie eingebunden sind, im Prinzip immer beengt wissen. Die blutige Tradition der bürgerlichen Staatswerdung gibt darüber Auskunft, in welchen Fällen sich die eine oder andere Nation für definitiv zu eingeengt befunden und den konsequenten Schritt zur Ausdehnung der eigenen Machtgrundlagen für angezeigt gehalten hat.
Im Vergleich zu dieser Tradition sind die neuen staatlichen Gründungen des GUS-Vereins verhältnismäßig zurückhaltend vonstatten gegangen – die Republiken, die sich auf ihren Weg in ihre Unabhängigkeit machten, gab es in den alten Grenzen ja schon, und ihren nationalen Werdegang beschlossen sie im wesentlichen nicht in deren Verschiebung nach außen, sondern sie wollten mit dem viel hermachen, was nunmehr ihr exklusiver Besitz war. Allerdings wird aus diesen überkommenen Gebietsmarkierungen etwas ganz anderes, wenn ein frisch gekürter Staatswille sich auf das bezieht, was ihm aus der Liquidation und Nationalisierung der Potenzen einer Sowjetunion so alles an Grundlagen seines Vermögens beschert worden ist, und sie als Basis seiner Macht in Beschlag nimmt: Dann werden die Abmessungen der alten Sowjetrepubliken zu richtigen Grenzen, die die Reichweite des ausschließlichen, andere Souveräne ausschließenden Verfügungsrechts der Staatsgewalt angeben, die sich in ihnen etabliert hat, und die dazu da sind, dieses staatliche Monopol auf Land und dessen lebendes wie totes Inventar zu sichern. Wenn dann der prüfende Blick darüber Einzug hält, was das alles ist und wofür es alles taugt, worüber man nunmehr hoheitlich verfügt, stößt er allerdings im selben Moment auch darauf, was einem nunmehr, wo man eigene Grenzen hat, so alles fehlt – weil es blöderweise außerhalb derselben und daher in einem anderen Staat liegt, von dessen Hoheit man seinerseits ausgeschlossen wird. Und da zeigt sich bei den Staatsgründungen auf altem sowjetischen Boden, daß sich zwar schon das Territorium im Großen und Ganzen einvernehmlich aufteilen läßt, das Einvernehmen aber wegen dem, was mit dem Territorium auch gleich mit geteilt wird, aufhört: Die negative Gemeinsamkeit im Entschluß, die Ländereien der SU als Material für die Niederlassung neuer Staatswesen auszuschlachten, wird zum Gegeneinander der Subjekte, die sich da als Staaten aufbauen wollen.
Da gibt es dann etliche Bemühungen einer stolzen Behauptung staatlicher Eigenständigkeit, aus denen einfach deswegen nichts wird, weil sich mit den Nachbarn schon allein darüber nicht Einvernehmen erzielen läßt, worauf sich die beanspruchte Souveränität überhaupt erstreckt. Einerlei, ob die Staatsmacht dabei ein Gebiet für sich reklamiert, weil sie dessen völkische Insassen ideell schon unter sich einbezogen hat; oder ob ein ausgeprägtes völkisches Selbstbewußtsein seine Identität partout nicht in der neuen Hoheit wiederfinden mag, die über sie kommandieren will: An Zweifelsfällen dieser und ähnlicher Art wird augenblicklich die Gewalt bemerklich, aus der Staatsgrenzen gefertigt sind, und die Definition des Territoriums wird zur Frage der gewaltsamen Durchsetzung der Macht, die es ihr eigen nennt.
Das unabhängige
Armenien
zum Beispiel ist auch noch 1995 von seinem Nachbarstaat
Aserbaidschan einfach nicht wegzudenken. Das
hehre Prinzip des Selbstbestimmungsrechts der
Völker
, das es wie jeder Staat für sich in Anspruch
nimmt, erstreckt sich nämlich auch auf einen von eigenem
Volk besiedelten Berg auf dem Gelände, das dem
Nachbarstaat gehört, und der verweigert mit seinem
mindestens gleich guten Recht der territorialen
Unverletzlichkeit
die verlangte Herausgabe. Zur
entscheidenden Lösung der offenen Kriegsfrage verfügt
nach den gescheiterten anfänglichen Bemühungen keine der
beiden Seiten über die erforderlichen Mittel, der
„Konflikt“ bleibt daher „ungelöst“ und die
außenpolitischen Beziehungen, die sich vor Ort abspielen,
sind entsprechend am Vorkriegszustand orientiert: Eine
umfassende Wirtschaftsblockade und regelmäßige Attentate
auf im näheren Ausland gelegene Pipelines, die die
gesamte Energieversorgung lahmlegen, erinnern schmerzlich
daran, was einem Staat manchmal so an Grundlagen zur
Durchsetzung seiner Rechte fehlen kann. Dem armenischen
Kampf um Unabhängigkeit tut dies jedoch keinen Abbruch,
sondern verleiht ihm seine Besonderheiten. Vertraglich
gesicherte russische Militärbasen im Land,
russische Techniker, die das etwas wacklige AKW
– den Hauptstromlieferanten – zusammenschrauben und Gas-
bzw. Stromlieferungen aus dem Iran sollen die
nächsten 25 Jahre Armenien unabhängig machen –
von Rußland und allen seinen Nachbarn. Das ist
dann auch das einzige nationale Vorhaben, das
sich von diesem Staat überhaupt benennen läßt. Sonst gibt
es noch einen amtierenden Präsidenten, der sich seiner
Machtkonkurrenten mit Terror einstweilen erfolgreich
entledigt hat und ein Volk regiert, das mit dem
physischen Überleben in einem Ausmaß befaßt ist, daß es
sogar droht, in seinem patriotischen Haß auf die Aseris
in der Nachbarschaft nachzulassen.[2]
In Georgien
ist nach der Sezession Abchasiens und Süd-Ossetiens
gleichfalls der Umfang des Staatsgebiets das Kernproblem
der jungen Nation geblieben. Die neuen Grenzen erinnern
bleibend an einen dringlich verspürten Handlungsbedarf zu
ihrer praktischen Korrektur, und zu der sehen sich nicht
wenige aufgerufen. Da machen sich dann schon des öfteren
organisierte Kämpfer für die georgische Sache privat zur
Kritik diesbezüglicher staatlicher Versäumnisse auf,
versuchen, verlorene Gebiete auf eigene Faust
zurückzuerobern, und verlangen dem amtierenden Machthaber
ein ums andere Mal den praktischen Nachweis ab, daß er
doch über so etwas verfügt wie das Monopol auf Gewalt.
Die bisherigen Proben aufs Exempel hat Schewardnadse
überstanden, für die Zukunft setzt er dabei auf die
Hilfe russischer Truppen im Land. Die
übrigen Georgier leben mit Löhnen von etwa drei Dollar
im Monat
so dahin und hassen die Abchasen, die
ihrerseits ihre völkische Zukunft durch einen
Zusammenschluß mit Rußland sichern wollen. In
Moldawien
hält noch immer die 14. russische Armee die Region links des Dnjestrs besetzt und wahrt in Form eines autonomen Transnistriens das vorläufige Ergebnis einer ethnischen Säuberung zwischen Moldovern auf der einen und Russen und Ukrainern auf der anderen Seite. Vorläufig ist dieses Ergebnis, da die Gagausen im Süden des Landes gleichfalls autonom werden wollen, und weil der Zusammenschluß zu einem Großrumänien eine politische Position ist, die es im Rahmen der offiziellen Staatspolitik immerhin auch noch gibt.[3] In
Tadschikistan
– immerhin auch eine Republik – kämpfen
hauptsächlich russische, in kleinem Umfang auch
kirgisische, kasachische etc. Truppen
gegen muslimische Kämpfer aus Afghanistan, um
einen Präsidenten an der Macht zu halten, den
marodierende Banden, die die „Opposition“ sind, umgekehrt
wegen seiner Moskau-Treue
stürzen wollen. Es gibt
auch einige einheimische Banden, die zu ihm halten; ein
Staatsleben sonst findet nicht statt.
Wo es vergleichsweise noch gesitteter zugeht und es wenigstens Grenzen gibt, die nicht nur bestritten sind, finden die Souveräne, die sie um sich gezogen haben, sehr schnell andere Gegenstände zur Betätigung ihres Gegensatzes: alles das, was vom Rohstoff bis zum Geld nunmehr eben einer national exklusiven Verfügung unterliegt. Angetreten sind alle Republiken mit dem festen Willen, aus dem, was ihnen nunmehr exklusiv gehört, viel zu machen, reich zu werden und Geld zu verdienen, daß es nur so kracht. Aber in allen Republiken zerschlägt die wechselseitige territoriale Ausgrenzung augenblicklich den ganzen Bestand einer regional organisierten produktiven Arbeitsteilung, die einst immerhin eine Großmacht zu unterhalten vermochte. Derselbe Schritt, mit dem sie jeweils für sich ihr abstraktes Monopol auf ausschließliche Verfügung über ihr Gelände aufpflanzen und anderen damit dessen Nutzung verwehren, nimmt nicht nur denen einiges an produktiven Lebensgrundlagen, sondern zerlegt auch die eigenen, weil auch die für das großartige Projekt einer staatlichen „Unabhängigkeit“ nie vorgesehen waren und dementsprechend nur bedingt bis gar nicht zu gebrauchen sind. So entziehen sich die 12 neuen Monopolisten im selben Zug, in dem sie sich die territorialen Grundlagen ihrer Macht wirksam aneignen, wechselseitig auch umfassend die Möglichkeiten, diese Grundlagen für das, wofür sie nunmehr vorgesehen sind, praktisch zu nutzen. Ihr Besitz taugt gar nicht für ihre großartige Ambition, ein unbedingt eigenständiges Gemeinwesen in Gang zu bringen und zu unterhalten – und das bemerken sie auf ihre Weise und reagieren entsprechend darauf: Sie legen sich die Lage, in der sie sich mit ihrer frisch gekürten Souveränität befinden, als deren Behinderung zurecht, und bei der Suche nach deren Grund stoßen sie zielstrebig auf die Existenz ihrer Nachbarn. So fällt der Wille, die beanspruchte staatliche Unabhängigkeit durch den Gebrauch dessen praktisch zu nutzen, worüber man gebietet, einerseits schon ziemlich schnell auf die Einsicht zurück, daß er für seine Vorhaben recht wenig vermag und die junge Nation da eigentlich überall von anderen sehr abhängig ist. Andererseits ist dies natürlich keine Einsicht in dem Sinn, sondern ein einziger Auftrag dazu, sich auf das naturgemäß polemische Verhältnis zu besinnen, in dem die eigene, exklusive staatliche Rechtsposition zu allen anderen steht: Es gilt, sich das Recht auf eigene Grenzen und Staatlichkeit gegen die zu verschaffen, von denen man sich abhängig weiß, so daß recht viele der noch laufenden zwischenstaatlichen Beziehungen durch den Versuch geprägt sind, den eigenen Nutzen über die Schädigung des Nachbarn sichern zu wollen. Nicht zufällig kreisen dabei die emanzipatorischen Bemühungen immer um die Republik, die den Großteil der ex-sowjetischen Bestände an sich genommen hat – von der gehen ja auch aus demselben Grund die meisten „Abhängigkeiten“ aus, die es loszuwerden gilt.[4]
Die junge Republik Aserbaidschan
vertraut da ganz auf die Zukunft des Öls
, das
nunmehr vor ihrem Küstenstreifen liegt. Da sie
über die Mittel nicht verfügt, es aus dem Sand zu holen,
soll es demnächst von westlichen
Erdölgesellschaften gefördert, transportiert und
exportiert werden – wenn erstens die kleineren und
größeren Kriegshandlungen in der Region dies erlauben.
Und wenn es zweitens vor allem gelingt, den Antrag
Rußlands auf eine gemeinsame Nutzung der Vorräte
im Kaspischen Meer durch alle Anrainer
zurückzuweisen und den großen Bruder von der Mitverfügung
über das Öl wirksam auszuschließen. Diese
anti-russische Perspektive, zu der auch die
außer Landes geschickten russischen Truppen gehören,
ist es im wesentlichen, was – neben der
aserischen Unbeugsamkeit in Sachen „Berg Karabach“ –
dieses Aserbaidschan im Aufbruch
ausmacht.
Inzwischen sind ansehnliche Teile des Staatsgebietes
ausländischen Ölgesellschaften pachtweise zur
Exploitation überlassen worden, und im Streit mit
Rußland, wem das Öl gehört, hat sich der Akzent
ein wenig verlagert: Zusammen mit Aserbaidschan
verhandeln die Türkei, die USA und ein Konsortium
westlicher Öl-Multis mit Moskau, wieviel Öl
demnächst noch durch russische Pipelines fließen wird;
der Rest soll durch neue Leitungen über georgisches
Territorium und anschließend an türkische Häfen gehen.
Turkmenistan
das in seinem Boden die drittgrößten Erdgasvorkommen der
Welt beherbergt, ist gleich mit der Idee in die
Unabhängigkeit aufgebrochen, demnächst das Kuwait
Zentralasiens
zu werden. Das ist eine Idee geblieben,
weil auch diesem Anrainer des Kaspischen Meeres wie
seinen souveränen Kollegen die Mittel fehlen,
den Rohstoff zu Geld zu machen. Die Exportwege sind auf
die vorhandenen Pipelines auf russischem
Territorium beschränkt, und was durch die geschickt wird,
erfreut sich reger Anteilnahme durch den dort ansässigen
Geschäftsgeist. Manche Lieferung unterbleibt daher wegen
des Streits um die zu entrichtenden Transitgebühren,
viele gelangen auf direktem Wege zu den garantiert
zahlungsunfähigen Abnehmern in der näheren Umgebung, so
daß Turkmenistan – nicht ganz freiwillig – nach
Rußland der zweitgrößte Kreditgeber der Ukraine
ist.
Das läßt natürlich die entsprechenden Projekte
einer nationalen Emanzipation heranreifen, nämlich in
Form von Pipelines unter garantiert
nicht-russischer Kontrolle. Aus denen
wird dann nichts, weil schon wieder das Geld fehlt, weil
die politische Lage der gesamten Nachbarregion nirgendwo
für eine alternative Routenwahl spricht, welche die
angepeilte „Unabhängigkeit“ garantieren könnte, und weil
Projekte, mit dem Iran ins Geschäft zu kommen, den
Risiken durch die ordnungspolitischen Interessen der USA
unterliegen.
Dieser ausgiebige Gebrauch der hoheitlichen Macht über eigenes Territorium, der ganz dem Prinzip gehorcht, von den Nachbarn und gegen sie möglichst viel der Mittel an sich zu ziehen, die wenigstens die Weiterexistenz des autonomen Gemeinwesens sichern sollen, sorgt an nicht wenigen Stellen dafür, daß der grenzüberschreitende Verkehr nicht mehr stattfinden will, über den die Zufuhr des Benötigten läuft – sei es, weil mangels Zahlungswille oder -fähigkeit des Nachbarn Verdienste ausbleiben, sei es, weil es die Abhängigkeit zur Erpressung nützlicher politischer oder anderer Dienste zu nutzen gilt. Da verliert dann eben eine Republik, die ihren Lebensunterhalt ohnehin nur über Zuwendungen ihres Hauptsponsors zu bestreiten vermag, schon auch mal den Glauben an ihre eigene nationale Zukunft – und es kommt ein Staat heraus, der mangels Hoffnung sein Territorium wegschmeißt: In
Weißrußland
beispielsweise hat sich in den letzten drei Jahren der
Reiz, in einen unabhängigen Staat hineinzugehören oder
ihm gar vorzustehen, ziemlich verflüchtigt. Eine
ansehnliche Mehrheit des Volkes ist sich mit
seinem Präsidenten grundsätzlich darin einig,
daß der Reformkurs für Marktwirtschaft und
Demokratie
das Land einfach nur ruiniert
hat: In der Armut, die sie auszuhalten haben, sehen die
einen, in der unabweisbaren Perspektivlosigkeit einer
„Nation Weißrußland“ sieht der andere die wenig
ansprechenden Folgen des staatlichen Weges in die
Unabhängigkeit. Einen Begriff von der
Notwendigkeit dieser Folgen macht sich
allerdings dort auch niemand, so daß trotz der rührigen
alten KP schon wieder nicht Kommunismus, sondern eben nur
die Rückgängigmachung der Unabhängigkeit und der
Anschluß an Rußland
die Option ist, von der sich
Weißrussen für ihre Zukunft etwas mehr versprechen lassen
und wollen.
Eine andere Republik, in der gleichfalls nichts mehr läuft, setzt dafür umso unverdrossener auf die Zukunft – und es kommt ein Staat heraus, der aus Territorium, einer absurden Hoffnung sowie aus Leuten besteht, die an sie glauben. In
Kirgistan
ist 1995 der erste unabhängige Aktienmarkt
gegründet worden. Wie man von der zuständigen staatlichen
Stelle erfährt, hat die Spekulation vor Ort allerdings
ein recht ungewöhnliches Objekt. Der Möglichkeit, mittels
An- und Verkauf von Papieren reich zu werden, steht
nämlich der Umstand schon ein wenig entgegen, daß es
weder das Kapital noch den Kredit gibt, an deren
produktiver Kombination Aktionäre ansonsten zu verdienen
pflegen. In Kirgistan ist das aber nicht so wichtig:
Wir haben keine spezielle wirtschaftliche Basis für
die Eröffnung der Börse. Aber um einen Durchbruch zu
schaffen, um Kirgistans Wirtschaft
– das ist die
nicht vorhandene „Basis“ dieser „Börse“! – „zu
stärken, sollten wir so schnell wie möglich in den Markt
einsteigen. Kirgistan muß Kapital anziehen, um zu
überleben.“
Das Gewaltmonopol
Auch wenn dort anders, sozialistisch, Staat gemacht wurde – die Mittel zur Wahrung staatlicher Souveränität waren auch in der großen Volksdemokratie die hierzulande bekannten, und einiges hat die Sowjetunion da schon zuwegegebracht, um ihre anti-imperialistische Staatsalternative auch militärisch mit Substanz zu untermauern. Dabei waren die Streitkräfte ganz auf den Dienst hin organisiert, die Sowjetunion in ihrer damaligen strategischen Dimension zu verteidigen: Es waren Unionsstreitkräfte, in Aufbau und Zusammensetzung an den Mitteln der feindlichen Gegenseite orientiert; auf das Einhalten der allgemeinen Wehrpflicht wurde Wert gelegt, auf die Durchmischung der verschiedenen Landsmannschaften des Personals gleichfalls, weil es ungeachtet aller vorhandenen und gepflegten völkischen Besonderheiten eben auf den vaterländischen Dienst und sonst nichts ankam. Dem politischen Selbstverständnis gemäß trug der sozialistische Staat dafür Sorge, daß seine Armee sich nicht als bloßes Vollzugsorgan militärischer Befehle verstand, sondern die verlangten Dienste auch im Wissen um einen guten politischen Grund versehen wurden. Wie im Westen immer für die Freiheit zu kämpfen war, so wurde auch im Osten für die politische Fundierung der Kampfmoral der Truppe gesorgt, und die Politoffiziere der Roten Armee agitierten für die Einsicht in die notwendige Verteidigung der „Errungenschaften des Sozialismus“ und anderer Schönheiten mehr. Offenbar war der Einschwörung auf die sozialistische Moral kein großer Erfolg beschieden, denn der kalten Erledigung der ruhmreichen UdSSR stand die Rote Armee – wie die sowjetischen Volksmassen insgesamt ja auch – ziemlich teilnahmslos gegenüber. Auch als der Ruin des Vaterlandes binnen kurzem nach dem erfolgreichen Greifen des ökonomischen „Reformwerks“ und der Zerlegung der SU unübersehbar war, mochte aus den Reihen dieser Armee niemand zu dessen Rettung initiativ werden. Insofern stand sie – zu Beginn jedenfalls – bei ihrer Entlassung aus ihrem alten politischen Auftrag einer anschließenden Verpflichtung auf den neuen Dienst, als Gewaltmateriatur eines bürgerlichen Staatswesens zu fungieren, im Prinzip aufgeschlossen gegenüber.
Daß diese Verpflichtung nicht reibungslos vonstatten ging und geht, liegt wiederum daran, daß die Monopolisierung staatlicher Machtmittel im Wege des einvernehmlichen Teilens einer ererbten Masse wegen der Natur der zu teilenden Sache nicht so leicht ins Werk zu setzen ist. Die neuen politischen Herren der Region wußten nämlich schon von Anbeginn, daß die reklamierte „Unabhängigkeit“ ihres Staatswesens ganz davon abhing, wieviel des vorhandenen Inventars staatlicher Gewaltmittel sie für sich in Beschlag nehmen konnten: Das und nichts anderes sichert ihr Territorium, verschafft ihrem frisch gegründeten nationalen Recht im Zweifelsfall Respekt und garantiert die Verläßlichkeit einer politischen Ordnung im Inneren des Landes. Ihnen war auch das Verhältnis von Anfang an bekannt, in das sie sich in dem Moment zueinander begeben, in dem sie ihre hoheitlichen Verfügungsrechte über Bestände der alten sowjetischen Militärmacht beanspruchen. Da will sich eben schon jeweils eine Macht aufbauen, um sich nötigenfalls gegen die anderen behaupten zu können. Aber auch das haben die Potentaten der GUS zu Beginn noch einvernehmlich hingekriegt, und sich darauf geeinigt, daß ein jeder das auf seinem Territorium lokalisierte Militär gewissermaßen als herrenloses Gut betrachten und sich die Teile von ihm aneignen dürfe, auf die er wegen seiner vaterländischen Rechtstitel Anspruch habe.
Daß sie damit allerdings nur die
Eröffnung des Kampfes ums Gewaltmonopol
und damit um den Bestand ihres Staatswesens überhaupt eingeleitet haben, merken sie seit ihren ersten Bemühungen, aus der ererbten Masse der Roten Armee eine eigene nationale Streitmacht zu verfertigen. Noch am ehesten zu verschmerzen für sie ist da vermutlich die gewisse Zerstörung des Gebrauchswerts der feinen militärischen Ware, die augenblicklich einsetzt, wenn deren 12 Erben sich zum Zweck ihrer Nationalisierung ans Aufteilen machen. Eine Armee, die nicht nach rassisch-völkischen Gesichtspunkten aufgebaut ist, läßt sich nach diesem Gesichtspunkt auch nicht sauber und unter Wahrung ihrer Funktionstüchtigkeit zerlegen. Durchsortieren läßt sich das Personal nach dem Kriterium seiner Volkszugehörigkeit zwar schon, und damit im Prinzip auch festlegen, welchem Staat es fortan zu dienen habe. Sobald dann aber die Ausgliederung der Landsmannschaften praktisch erfolgt, sinkt auch die Mannschaftsstärke unter ihr Soll und die Kampffähigkeit der Truppe ist dahin – inzwischen in einem Maße, daß verschiedentlich die vollständige Auflösung von Truppenteilen droht. Sicher läßt sich auch eine ganze Flotte rechnerisch durch zwei teilen, und die Teile lassen sich schon auch den zwei politischen Herren unterstellen, die an sie Besitzansprüche erheben. Ihre praktische Halbierung löst jedoch auch das ganze, sehr zweckmäßig ausgetüftelte Verhältnis auf, in dem die diversen Kampf-, Versorgungsschiffe und andere Schwimmgeräte zueinander stehen, so daß keine der beiden Hälften mehr über die entsprechende Kampffähigkeit verfügt. Verluste von militärischem Gebrauchswert dieser oder anderer Art mögen angesichts der Masse, die zur Verteilung anstand oder noch ansteht, vielleicht nicht ins Gewicht fallen, und die frisch gebackenen Machthaber mögen sich angesichts dessen, was sie sich erfolgreich krallen, im Großen und Ganzen zufrieden geben. Grund dazu haben sie allerdings deswegen nicht, weil mit der Abwicklung der diversen Teilungsprojekte der politische Gegensatz zwischen ihnen erst so richtig offenliegt: Eine zwischenstaatliche Konkurrenz um Machtmittel hört ja nicht deshalb auf, eine zu sein, weil sie einmal nicht nach dem klassischen Verfahren des gewaltsamen Wegnehmens verläuft, sondern nach dem Willen der Beteiligten als welthistorisches Novum eines friedlich-schiedlichen Aufteilens vonstatten gehen soll.
Diese Konkurrenzlage zwischen den diversen Aspiranten auf ein exklusives Gewaltmonopol wird von ihnen augenblicklich daran bemerkt, daß nach vollzogener Teilung von Mannschaften und Geräten nach dem Kriterium der Volkszugehörigkeit in fast jedem Fall die Frage überhaupt erst zur Entscheidung ansteht, wessen Gewaltmonopol die Militärmacht auf den jeweiligen Territorien Boden eigentlich ist. Vor allem die Russifizierung der ehemaligen Roten Armee hat da zu dem Ergebnis geführt, daß ansehnliche Teile der russischen Truppe nunmehr in das „nahe Ausland“ verlagert sind, das aus ihren aus Sowjetzeiten überkommenen Stationierungsorten geworden ist. Ob sie dort überhaupt erwünscht oder grundsätzlich unerwünscht sind – weil ihre bloße Präsenz eben schon die faktische Außerkraftsetzung des von der dortigen Souveränität beanspruchten Gewaltmonopols ist –, hängt ganz davon ab. Entweder davon, ob der politische Gastgeber in ihnen eine unerträgliche Knechtung seiner Souveränität oder gleich die vollzogene Usurpation seines Landes sehen will – dann sind sie draußen. Oder ob er sich mangels ausreichend vorhandener eigener Mittel dazu veranlaßt sieht, zur Wahrung der Ordnung im Land oder gleich des Staates insgesamt auf sie als Mittel seiner Souveränität zurückzugreifen – dann dürfen sie ihm dienen. Wo letzteres der Fall ist, kann sich dies manchmal sogar mit den russischen sicherheitspolitischen Interessen decken. Dann zum Beispiel, wenn zusammen mit den Grenzen irgendeiner Republik auch die äußeren Grenzen des GUS-Raumes insgesamt zu verteidigen sind, und die russische Macht Gefahr läuft, Teile ihres Einflußbereiches an ganz andere Hoheiten zu verlieren, die dann auch gleich noch ihre neuen Nachbarn wären. Doch selbst zwischen den vier Partnern, die in Kenntnis dieser Sachlage und in nüchterner Einschätzung des im Wege des Aufteilens ererbten realen Kräfteverhältnisses eigens dafür die entsprechenden Verträge geschlossen haben, gibt es im Prinzip denselben Streit um den Status der russischen Truppen wie mit allen anderen, die ihre Sicherheitsinteressen lieber selbst in die Hand nehmen oder sie westlichen Freunden überantworten: Überall, wo russische Truppen im Land stehen, werfen sie Streitfragen auf, die dann als Dauerthema den zwischenstaatlichen Diskurs bestimmen und die sich um die Definition ihrer Befugnisse, um den Träger ihrer Kosten, kurz: um ihre Zuordnung zur politischen Herrschaft überhaupt drehen.
Wegen dieses Gegensatzes, der in ihnen abgewickelt werden soll, finden manche Teilungsvorhaben aber auch gar nicht erst statt. In ihrem
Streit um die Schwarzmeerflotte
haben Rußland und die Ukraine, die beiden nennenswerten Mächte, die sich aus der SU herausgebrochen haben, bemerkt, daß sie sich mit einer eventuell zu vereinbarenden Teilungsquote auf den Verzicht von Mitteln ihrer Macht zugunsten eines Konkurrenten festlegen, und diese an sich richtige Einschätzung der Sachlage bestimmt dann lustigerweise Verhandlungen, die ums Teilen gehen. Das führt dazu, daß unter dem Vorwand, sich weiterhin einigen zu wollen, die Quote der Aufteilung selbst Streitgegenstand wird und bleibt. Sofern man sich zwischenzeitlich auf diese einigen kann – fifty-fifty im gegenwärtigen Stand der Verhandlungen –, dokumentiert dies freilich keine Einigung zwischen den Parteien in der Sache, weil die Verhandlungspartner zum selben Thema längst andere strittige Fragen aufgeworfen, sich in sie verbissen haben und im Fortgang an denen ihren Willen zur Einigung auf die Probe stellen. Gegenwärtig wird den Russen der hoheitliche Gebrauch irgendeines Anteils der Flotte mit dem Argument verwehrt, die dazu erforderliche Konzession von Stützpunkten an der ukrainischen Küste käme einer Schändung des ukrainisch-vaterländischen Bodens gleich und könne daher nicht gewährt werden. Stattdessen wäre zu erwägen, ob Rußland nicht die gesamte Flotte von der Ukraine – die sie also behalten will – einfach pachtet – und als Pachtgebühren die aufgelaufenen und zukünftigen Schulden für den Import des für die Ukraine Lebensnotwendigen verrechnet, die diese ohnehin weder zahlen kann noch will. Die auch nicht gut zu verhandelnde Gegenposition formuliert dann ein russischer General mit der Kundgabe des Standpunkts, daß die Flotte von Natur aus russisch und daher unteilbar sei. Eine Übereinkunft auf zwischenstaatlicher Verhandlungsebene findet daher nicht statt, was allerdings insofern auch nicht von allzugroßer praktischer Bedeutung ist, als ja überhaupt noch sehr die Frage wäre, ob irgendeine erzielte Einigung überhaupt das Papier wert wäre, auf dem sie steht. Das Personal der Flotte betreffend finden sich nämlich quer durch alle Dienstgrade etliche, die deren Weggabe als Verrat an der Fahne ansehen, auf die sie vereidigt wurden; die sich deshalb entweder weigern, ihren Arbeitsplatz einfach so aufgeben zu sollen; oder die von einem Kommandanten Befehle in ukrainischer Sprache auf keinen Fall entgegennehmen wollen und ihre russisch-patriotisch begründete Befehlsverweigerung gegenüber einer eventuell aus Moskau doch irgendwann ergehenden politischen Direktive schon einmal vorsorglich bekanntgeben.
Was
die Lage des Gewaltmonopols in Rußland
selbst betrifft, so steht der Umstand, daß dieses Land ohne Zweifel der Haupterbe des sowjetischen militärischen Materials ist, keineswegs dafür, daß deswegen auch die Übernahme und der Erhalt eines funktionsfähigen Gewaltmonopols dort geglückt wäre. Erstens ist die militärische Logistik aus Sowjetzeiten aus den genannten politischen Gründen im Zusammenhang mit der Aufteilung der Ware zu ansehnlichen Teilen entweder ganz verloren oder nur bedingt nutzbar, da 35 russische Militärbasen im GUS-Raum in Verhandlungen mit den neuen Souveränen gesichert werden müssen, die langen Nachschubwege über fremdes Territorium also nicht in eigener Regie plan- und verfügbar sind. Zweitens machen sich auch an der gebrauchswertmäßigen Substanz der staatlichen Machtmittel inzwischen die Folgen recht einschneidend geltend, die der allgemeine ökonomische und herrschaftsmäßige Verfall des Landes nach sich zieht. Nicht nur, daß der moralische Verschleiß, dem auch Waffen unterliegen, längst nicht mehr aufzufangen geht, neues Gerät kaum entwickelt und herangeschafft wird; sogar der Erhalt des alten schafft etliche Probleme, die allesamt bezeugen, wie wenig der russische Staat sich zusammen mit den Machtmitteln auch deren Funktion, sich sein Monopol auf Gewalt zu sichern, wirklich anzueignen vermochte: Zum Teil wird Militärgerät von Soldaten einfach an interessierte Abnehmer irgendwohin im Land oder außerhalb desselben verkauft, weil monatelang Soldzahlungen ausbleiben. Zum Teil fehlt es aber auch wegen Desertionen und massenhafter Nichtbefolgung der Wehrpflicht einfach am nötigen Personal für die Wartung des Kriegsgeräts: Das Dienen in der russischen Armee ist nichts, wofür sich inzwischen manche nationalbewußte Untervölker Rußlands hergeben wollen, und selbst für junge Russen, die ohnehin keine Perspektive haben, ist der Militärdienst so ziemlich das Letzte, was sie sich als ihre Perspektive vorstellen können. Und an denen, die der Staat zu fassen kriegt, schlagen sich zum Leidwesen der Militärs die Folgen von 10 Jahren Perestrojka sichtbar nieder – geklagt wird über den rapiden Anstieg an unterernährten und wehruntauglichen Rekruten, einen deutlichen Abfall des Bildungsniveaus und die allgemeine Verrohung der Sitten, die in zur Tagesordnung gehörenden Gewaltexzessen zum Ausdruck kommt.
Offenbar weil aus den alten Zeiten schon noch genügend Zeug herumsteht, gehen die für Politik in Rußland Zuständigen einfach davon aus, daß es um die die Verfassung ihres Gewaltmonopols nicht weiter schlimm bestellt ist, und ignorieren die Besorgnisse weitgehend, mit denen sie von ihren Militärs angegangen werden. Und das paßt sehr gut zu der Einschätzung, die sie über die Funktionalität ihrer Machtmittel überhaupt pflegen, wenn sie sich aus politischen Gründen zu ihrem Gebrauch veranlaßt sehen: Auch diesbezüglich ist ihr Urteil sehr sachfremd und nimmt nicht zur Kenntnis, daß in Rußland die politische Staatsführung über die Macht als Mittel zu ihrer Durchsetzung gar nicht verfügt. Daß es gar nicht die Exekution eines fest definierten Staatswillens ist, wenn in Rußland das Militär seinen allerersten Dienst nicht verrichtet, rührt daher, daß dieser Staatswille und damit die nationale Sache selbst, in deren Namen die politische Instrumentalisierung der Machtmittel ja stattfindet, dort sehr in Frage steht. So zeugen zuallererst die auswärtigen Kriegsschauplätze, auf denen nach der Territorialisierung der Roten Armee
das russische Militär in der GUS
verwickelt ist, keineswegs von einem irgendwie positiv bestimmten politischen Interesse der Führung in Moskau, einem russischen Zugriffswillen auf fremde Gebiete womöglich oder ähnlich gelagerten imperialistischen Drangsalen: Sie sind erstmal nur die Reaktion des russischen Staates darauf, daß die Abwesenheit eines Gewaltmonopols innerhalb eines GUS-Nachbarn auch unmittelbar seine sicherheitspolitischen Belange tangiert. Als diese Reaktion kämpfen russische Truppen in Tadschikistan, Georgien und anderswo – und ersetzen solange, wie sie dort sind und kämpfen, faktisch die Staatsmacht vor Ort. Sie sind in alle dort sich abspielenden Machtkämpfe praktisch involviert – aber den politischen Auftrag, sie auch tatsächlich zur Entscheidung zu bringen, die fehlende staatliche Souveränität wirklich zu ersetzen und so das russische Sicherheitsinteresse zu wahren, haben sie eben nicht. Vielmehr existieren umgekehrt bei der auftraggebenden politischen Instanz in Moskau erhebliche Zweifel über den Sinn und Nutzen des Engagements in den umliegenden Ausländern: Weil in der politischen Führung des Landes niemandem so recht ein nationaler Grund für die Opfer an russischem Geld und Leben einfallen will, wenn anderswo der Schein von staatlicher Souveränität gewahrt wird, verweigert man beispielsweise die von Militärs in Tadschikistan zusätzlich verlangte Unterstützung – und ersetzt, wenn sie wegen der Lage an der Front weiterhin angefordert wird, den verantwortlichen General durch einen anderen, der aus der Lage, wie sie ist, schon irgendwie das Beste zu machen verspricht. Die dort und anderswo in die diversen Händel verstrickten Truppen werden auf diese Weise damit vertraut gemacht, daß das Vaterland, dem sie dienen, auf ihre Dienste gar keinen Wert legt, und ein Militär, das einerseits kämpfen soll, dem andererseits zugleich seine politische Rechtfertigung entzogen wird, verliert auch seinerseits allen Grund zu politischer Loyalität und legt sich eigene Daseinsgründe zurecht: Es war schon seine Interpretation des notwendigen Dienstes an der russischen Sache, die er in Moskau einfach von niemandem so recht vertreten sah und sieht, die einen General Lebed dazu beflügelt hat, eine Militäraktion in der Republik Moldawien gleich in den Gründungsakt einer „autonomen Region“ zu überführen. Und daß er aus seinem Erfolg dabei – seine Armee ist dort die Instanz, die politische „Unabhängigkeit“ garantiert – die Berufung für höhere nationale Aufgaben ableitet, ist erstens sehr konsequent, und wirft zweitens ein bezeichnendes Licht auf die Verfassung des Landes: Über das zukünftige Schicksal der 14. Armee am Dnjestr haben deren oberster Befehlsstab und die Regierung im Moskau durchaus nicht nur verschiedene Auffassungen, sondern sie stehen in ihrer Kontroverse in offener Konkurrenz um die Definition des politischen Auftrags, den die russische Armee hat, und zwar nicht nur im Kaukasus und Mittelasien. Denn daß dieser Gegensatz zwischen Militär und politischer Führung nicht ein auf den General Lebed beschränkter Einzelfall ist, sondern das Gewaltmonopol auch in Rußland grundsätzlich in Frage stellt, hat ausgerechnet die
militärische Durchsetzung Rußlands im eigenen Land
gezeigt. Alles Nötige zum Krieg in Tschetschenien steht
in GegenStandpunkt 1-95, S.151,
„Marktwirtschaft und Demokratie“ in Rußland. Zum dort
Erläuterten hinzugekommen sind inzwischen einige
Fortschritte, die die Vergeblichkeit des
Versuchs betreffen, so etwas hinzubekommen wie die
allererste Grundlage und Voraussetzung einer hoheitlichen
Kontrolle, die ein Staat für gewöhnlich über sein
Territorium ausübt. So gibt es in Tschetschenien
Verhandlungen zwischen den Kriegsparteien, die allein
schon wegen ihres Stattfindens die Ohnmacht der
russischen Staatsmacht offenlegen. Die mag letztendlich –
immerhin sind im Zusammenhang mit dem Krieg in
Tschetschenien mehrere Hundert Offiziere wegen
Befehlsverweigerung entlassen worden – dazu gereicht
haben, mit einer Strategie der verbrannten Erde die
militanten Separatisten vor Ort mehrheitlich
niederzuwerfen oder aus dem Land zu jagen; die
vorübergehende Besetzung einer russischen Kleinstadt
durch sie vermochte sie weder zu verhindern noch
gewaltsam aufzuheben. Vielmehr willigte sie in die
Erpressung ein, ganz offiziell den praktischen Erfolg und
damit auch den politischen Sinn und Zweck ihres
militärischen Einsatzes in diesem Staatsgründungskrieg
von der in ihm unterlegenen Partei nachträglich in Frage
stellen zu lassen: In der erzwungenen Anerkennung eines
überhaupt verhandelbaren Gegenstandes in Gestalt eines
zukünftigen Status von Tschetschenien
wurde ihr
das Eingeständnis in die Vergeblichkeit ihrer
Bemühung abverlangt, mit Militärgewalt die Unterwerfung
und den Respekt von entschlossenen Sezessionisten
erzwingen zu können. Inzwischen hat sich die
Lage in der Weise stabilisiert, daß beide Seiten der
politischen Nicht-Lösbarkeit der
Tschetschenien-Frage
Rechnung tragen. Das
russische Militär bleibt im Land und führt Krieg gegen
die tschetschenischen Partisanen, daneben wird
auf dem Verhandlungsweg an einer politischen
Lösung
gearbeitet, die nicht zustandekommt, weil der
Preis, den die Tschetschenen für ihre freiwillige
Selbstentwaffnung verlangen, in etwa das beinhaltet, was
die Russen mit ihrem Feldzug verhindern wollten.
Einem Staat, der nach einem erfolgreichen Feldzug
derartige Eingeständnisse seiner Ohnmacht abgibt, ist
offenbar der politische Wille, den verlangten
Respekt vor seiner Souveränität im Bedarfsfall auch zu
erzwingen, gleich bei der ersten Gelegenheit abhanden
gekommen, bei der er ihn praktisch exekutieren
wollte. Es ist in Moskau nämlich erstens eine sehr
umstrittene Frage, ob die
unbedingte russische Autorität bis in den Kaukasus
reichen und nötigenfalls auch gewaltsam gesichert werden
soll. An diesem Streit, der nichts weniger zur
Disposition stellt als den politischen Sinn und Zweck der
ausgeübten Staatsgewalt insgesamt, machen sich zweitens
alle Fraktionen zu schaffen, die schon längst und auf
allen Ebenen im Machtkampf gegen den Präsidenten
verstrickt sind, der an den Tschetschenen wenigstens ein
Exempel für die Existenz seines Gewaltmonopols
statuieren wollte – und so wird aus dessen Versuch, sich
mit Gewalt als Vorsteher einer funktionstüchtigen
staatlichen Macht zu behaupten, die wahrgenommene
Gelegenheit seiner Konkurrenz, ihn weiter zu
entmachten und darüber auch den politischen Willen
zu einem russischen Gewaltmonopol überhaupt außer Kurs zu
setzen: Inzwischen ist laut Parlamentsbeschluß die
Einmischung
der russischen Streitkräfte zur
Lösung politischer Konflikte innerhalb des Landes
verboten – so daß der nächste Fall, in dem sie vom
Präsidenten irgendwo in seinen 89 autonomen Reichsteilen
gleichwohl für nötig befunden wird, unmittelbar die Frage
aufwirft, ob seine Macht in Moskau zur
Durchsetzung reicht. Und selbst wenn dies noch der Fall
sein sollte, ist es überhaupt nicht sicher, daß an
entscheidender Stelle auf sein Kommando gehört und
marschiert wird, wie und wohin er will.
Das Volk
Die Gründer der Sowjetunion und ihre Nachfahren hatten
sich dem Dienst an allen guten Rechten der
Massen verschrieben, die im bürgerlichen
Herrschaftsbetrieb nach ihrer Auffassung zu kurz
kommen. Sie wollten sich als Staatsmacht aufbauen, damit
endlich einmal verwirklicht werde, was bürgerliche
Staaten nur immer prätendieren, wenn sie in ihrer
abstrakten Manier die grundsätzliche Einheit des Staates
mit seinem Volk beschwören, in Wahrheit aber doch nur den
Interessen der herrschenden Klasse
dienen.
Entsprechend haben sie sich das Projekt eines
sozialistischen Vaterlandes aller Werktätigen
vorgenommen und einen Staat eingerichtet, der den
gerechtfertigten Anliegen des Volkes
praktisch zum Durchbruch verhelfen zu verhelfen
hatte – das war für Sozialisten der gute Grund
für Herrschaft. Allerdings schon auch der gute Grund für
die Herrschaft eines Staates, und
insofern alles andere als die Aussicht auf eine
praktische Erledigung des Gegensatzes, den ein
Staatswesen zu den so geschätzten Interessen der
Werktätigen und Bauern nun einmal begründet. Nur sollte
der eben praktisch keine Rolle spielen, da eine
kommunistische Partei an der Macht die
dauerhafte Gewähr bot, daß alle staatlichen Anliegen –
anders als im bürgerlichen Klassenstaat – ganz dem
Interesse aller Mitglieder des sozialistischen
Gemeinwesens verpflichtet waren. Daher fanden die
Bolschewisten überhaupt nichts an den gewaltsamen
Abstraktionen auszusetzen, die einen sozialen Verein zu
einem Volk machen und ihn in die höhere
Identität einer Nation überführen. Sie bezogen
sich umgekehrt sehr affirmativ auf die
Elementarkategorien der bürgerlichen Herrschaft und sahen
in deren wirklichem Dasein, in den Herrschafts- und
Knechtschaftsverhältnissen des Zarenreiches, einen
einzigen Verstoß gegen die Gerechtigkeit, die
ihnen über alles ging. Daher sahen sie in den russischen
Zuständen für sich den Auftrag vorliegen, nicht nur das
russische Proletariat, sondern auch den Rest Rußlands als
dieses Sammelsurium der Völkerschaften und Nationalitäten
vom Joch der Zarenherrschaft zu befreien und
allen zusammen mit der gerechten Herrschaft ihres
Sozialismus zu dienen. So kam im Wege dieser Befreiung
und anschließenden Eingemeindung von vielen Völkern eine
Union von sozialistischen Republiken zustande,
die nicht nur als solche, sondern auch in ihren einzelnen
Bestandteilen selbst ein einziges Zeugnis davon abgab,
wie sehr sich auch Sozialisten auf die herrschaftliche
Moral verstanden, Staaten als Heimat von Völkern und
Nation als guten Grund für Herrschaft zu denken. Auf der
anderen Seite war es freilich überhaupt nicht die
Hauptsache ihres Sozialismus, so gut wie jede übernommene
Völkerschaft mit dem Status einer nationalen
Identität
und entsprechender Autonomie
zu
bedenken, den Aufbau und die Verwaltung der Union
manchmal bis hinunter zum Landkreis an der ethnischen
Zusammensetzung ihrer Mitglieder zu orientieren und diese
ansonsten sich selbst zu überlassen. Die KPdSU hat schon
praktisch dafür gesorgt, daß sich für ihre
Vorhaben mit diesen vielen Völkerschaften
ein Staatswesen organisieren läßt: Nicht das
leere Prinzip Autonomie
, sondern der auf ihren
planerischen Vorhaben beruhende funktionelle Zusammenhang
des Gesamtladens Sowjetunion und damit die materielle
Lebensgrundlage aller in ihr hausenden autonomen Gebilde
war ihre Hauptsache, und wegen der fanden sich die
ansonsten so geschätzten Nationalitäten der
Sowjetbürger auch wieder zur praktischen
Bedeutungslosigkeit herabgesetzt. Da aus dem gleichen
Grund der Respekt, den die KPdSU den Besonderheiten der
vielen Völkerschaften ansonsten zollte, nie so weit ging,
diese von der Teilnahme an allen Errungenschaften des
Sozialismus auszuschließen, kamen auch noch die
hinterletzten Autochthonen des sozialistischen Reiches in
den Genuß gewisser zivilisatorischer Fortschritte und
fanden in Elektrizität und anderen Kulturbestandteilen
den Grund, ihrem sozialistischen Vaterland
und
überhaupt nicht ihren jeweiligen völkischen
Besonderheiten dankbar zu sein.
Mit der Auflösung der UdSSR ist auch die Kommunistische Partei als das Subjekt aus dem Verkehr gezogen worden, das zusammen mit der Organisation des Gesamtverbundes der Nationalitäten auch für die praktische Bedeutungslosigkeit des Nationalismus der vielen Völker gesorgt hatte. An dessen Stelle getreten sind dafür mehrere Subjekte, die diesen Nationalismus nunmehr allerdings sehr wichtig nehmen, denn sie sehen in ihm das gute Recht ihres Willens zur Staatengründung verankert: Auch bei dem menschlichen Material ihres Herrschaftswillens, das sie in Form von Völkern mit eigenen Nationalitäten vorliegen haben, gehen sie davon aus, im Zuge der einvernehmlichen Zerlegung der Sowjetunion im wesentlichen schon mit allem ausgestattet worden zu sein, womit sich Staat machen läßt – und auch da belegen ihre Schwierigkeiten beim Antreten der Erbschaft die große Täuschung, in der sie befangen sind.
Mit ihrem Willen, aus dem Material der sozialistischen Republiken und Nationalitäten Staaten zu gründen und sich dafür überhaupt erst die Völker anzueignen, machen sich die GUS-Souveräne wechselseitig mit ihrem Recht bekannt, fortan exklusiv über ein paar Millionen Sowjetbürger zu regieren, andere also von der hoheitlichen Verfügung über Menschen auszuschließen. Im Visier haben die jeweiligen Machthaber dabei alle, die ihr staatliches Territorium bevölkern, auf die sie also Zugriff nehmen und sie zu ihrem Volk vereinen können. Diese formelle Kür zu staatlichen Volkskörpern macht aus den ehemaligen Sowjetbürgern zunächst einmal viele
neue Inländer und Ausländer
Bei ihrem Bemühen, sich den Menschenhaufen auf ihrem
Territorium exklusiv anzueignen und zu einem
Volk zu vereinen, das ihren Anspruch auf eigene
Staatlichkeit begründet, besichtigen sie ihr menschliches
Material unter Zuhilfenahme aller Indizien, die von der
Blutsbande der Abstammung bis zur sprachlichen Eigenheit
schon im kulturellen Überbau der alten Sowjetunion zur
Stiftung von Völkerschaften und Nationalität in Funktion
waren – und bemerken im nächsten Moment, daß ihre
Instrumentalisierung dieses völkerstiftenden Unsinns
nicht so recht auf das Material paßt, auf das sie
losgehen. Denn wirklich völkisch und so voneinander
abgegrenzt, daß sie als fertige Staatsvölker nur zu
übernehmen wären, waren die auf dem Boden der ehemaligen
Sowjetrepubliken Ansässigen eben doch nie, so daß der
neue herrschaftliche Wille, über sie als
Volk zu verfügen, das einen Staat
hergibt, am vorhandenen menschlichen Material die
Abgrenzung überhaupt erst vorzunehmen hat, die
sein exklusiver Verfügungsanspruch verlangt. Das dafür
bei den Insassen in Anschlag gebrachte Sichtungskriterium
der durch Blut und Rasse, Sprache oder Kultur begründeten
Volkszugehörigkeit führt dann sehr schnell zu
dem Befund, daß sich innerhalb eines Staatsgebiets zwar
viele finden, die sich völkisch aggregieren lassen – aber
immer auch etliche andere, die nach Maßgabe desselben
Kriteriums nicht dazugehören und daher
Ausländer sind. Sie mögen sich zwar bisher durch
nichts von allen anderen Einheimischen unterschieden
haben; aber nun, wo es um die Konstituierung eines
Staatsvolks geht, ist genau der Unterschied elementar,
der Inländer von Ausländern abgrenzt, weil mit ihm die
von Staats wegen reklamierte Verfügung über eigenes Volk
in Gestalten einer anderen völkischen Herkunft an ihre
Schranke stößt: Die sind einem anderen
Verfügungsanspruch zuzurechnen und daher
Repräsentanten einer fremden Macht. Und da will
es die Zusammensetzung des vorliegenden
Menschenmaterials, aus dem die GUS-Staaten ihre Völker
verfertigen wollen, daß vor allem eine – und
dazu noch die größte – Macht ihr Volk auf alle
anderen Staaten verteilt hat. 25 Millionen
Auslandsrussen
bezeugen überall dort, wo sie sich
aufhalten und „Minderheiten“ beträchtlichen Umfangs
bilden, daß die staatliche Souveränität, unter der sie
zufällig leben, die Verfügung über ein eigenes,
ausschließlich ihr zurechenbares Volk nur
beansprucht, aber nicht wirklich in Händen hat. Der
Anspruch selbst wird darüber freilich nicht unwirklich,
und das bekommen die auswärtigen russischen
Völkerschaften praktisch zu spüren. Ohne daß sie selber
sich als Fremde, als Staatsbürger einer anderen Macht
betragen würden, erfahren sie praktisch, daß sie
die Manövriermasse einer zwischenstaatlichen Konkurrenz
um das exklusive Verfügungsrecht über sie sind: In den
baltischen Staaten werden sie ausgesondert und einer
staatlichen Sonderbehandlung unterworfen, die von der
Nichtgewährung der „normalen“ Staatsbürgerrechte bis zur
Zuweisung eines Sonderstatus reicht, an den sich
besondere Pflichten knüpfen, und in dieser
negativen Form existiert dann das Recht der
baltischen Staatsgründer, sich das Menschenmaterial auf
ihrem Gelände als ihr Volk zurechtzudefinieren.
Die Macht, gegen die sich dies richtet und die sich
ihrerseits ihre Bürger nicht von anderen
schikanieren lassen will, sieht sich entsprechend
herausgefordert und droht Gewaltmaßnahmen als Konsequenz
an.
Aber auch dort, wo die Zweifel an einer durch Blut und
völkisches Herkommen verbürgten Loyalität zum Staat
weniger rabiat exekutiert werden, geht die Definition der
Staatsvölker nahtlos in den Gegensatz zwischen den
staatlichen Subjekten selbst über, die da ihre exklusiven
Rechte geltend machen: Die 11 Millionen russischen
Staatsbürger, die in der Ukraine beherbergt
sind, begründen ungefähr genausoviele Rechte einer
russischen Einmischung, die längst zum Aufwerfen
zwischenstaatlicher Machtfragen der höheren Art gediehen
ist. Sie sind der bleibende Berufungstitel, mit dem der
große Nachbar im Osten von der ukrainischen Obrigkeit
nicht nur pfleglichen Umgang mit seinen Staatsbürgern
verlangt. Er möchte das Recht, das er in Anschlag bringt,
auch gleich noch als ukrainische Selbstverpflichtung in
der Verfassung verankert sehen, mahnt freundlich die
Einführung einer doppelten Staatsbürgerschaft
für
die Russen des Landes an und bringt dem slawischen
Brudervolk den Respekt vor dieser Rechtsposition immer
wieder einmal eindringlich nahe – mit der Sistierung
benötigter Rohstofflieferungen, dem Präsentieren offener
Rechnungen oder dem Verweis auf demnächst wohl
ausbleibende Kreditierung. Für die ukrainische Seite sind
umgekehrt russisch-stämmige Landsleute Fälle, an denen es
ihre wesentlich anti-russische Souveränität zu behaupten
gilt. Sie möchte die Russen einerseits unbedingt als
ihre Staatsbürger behalten, sieht sich
andererseits aber mit russischen Forderungen
konfrontiert, die ihr dies bestreiten, so daß an den
Russen der Streit um Minderheitenrechte
unversöhnlich vor sich hingeht und so manches zur
Disposition stellt, was an „Freundschafts-“ und anderen
Verträgen zwischen den Staaten ausgehandelt wurde, die
sich streiten.[5]
Die Logik dieser Staatsgründung, vom Standpunkt des abstrakten Willens zur eigenen Staatlichkeit sich das zum Staat dazugehörende Volk zuzuordnen, wirft nicht nur an Russen und auf zwischenstaatlicher Ebene unmittelbar Fragen auf, die die Gründungsstaaten an den elementaren Gegensatz erinnern, in dem sie zueinander stehen. Sie sorgt auch dafür, daß auf dem Gelände der ehemaligen Sowjetunion nicht nur Staaten nach ihren Völkern suchen; sondern daß auch umgekehrt noch weit mehr
Nationalitäten, ethnische und andere Subjekte
auf der Suche nach ihrer herrschaftlichen oder staatlichen Identität unterwegs sind, als es im GUS-Raum überhaupt Staaten gibt, die sich zusammen mit ihren Völkern als Nationen konsolidieren wollen. Denn wenn Staaten außer ihrem Willen zu viel Eigenständigkeit und Souveränität nichts aufbieten und das Volk, das sie für sich reklamieren, nicht tatsächlich auf sich verpflichten, scheitern erst einmal sie selbst mit ihrem Gründungsprojekt. Und das Scheitern ihrer Staatsgründung fällt zusammen mit einigen alternativen Bemühungen, unter Bezugnahme auf gutes völkisches und anderes Recht Herrschaft zu begründen.
Durchwegs lassen die politischen Vorsteher der neuen Gründungsstaaten die entscheidende Dienstleistung für ihre Völker vermissen, ohne die ein erfolgversprechendes Aufziehen eines Staatswesens nicht zu denken ist. Sei es dort, wo sie die Macht selbst schon gar nicht haben, mit der sie ihr reklamiertes Aufsichts- und Verfügungsrecht über ein Volk auszuüben gedenken, weil sie noch in den entsprechenden Kämpfen um sie verwickelt sind; sei es dort, wo sie den Machtkampf für sich entschieden, die politische Opposition im Land erledigt haben, und das Volk ihnen die unumstrittene Machtbefugnis auch noch für die nächsten 10 Jahre bestätigt hat: Weder hier noch dort bringt der Gebrauch der öffentlichen Gewalt ein geregeltes Staats- und Gesellschaftsleben zustande. Er unterbleibt entweder gleich ganz, weil dort, wo um die Macht noch so richtig gekämpft wird, an die Verrichtung notwendiger Staatsfunktionen gar nicht zu denken ist. Oder diese Verrichtung unterbleibt deswegen, weil die für den Aufbruch der jeweiligen Nation politisch Zuständigen darin ihre allererste Aufgabe gar nicht sehen. Sie legen sich statt dessen den fortschreitenden Ruin ihres Landes, den sie mit ihrer Gründung eines eigenen Staatswesens auf den Weg gebracht haben, als Folge davon zurecht, daß es dem noch zu sehr an „Unabhängigkeit“ fehle; daß die „Reformen“, mit denen sie das Zerstörungswerk der sozialistischen Ökonomie einleiteten, noch nicht „greifen“ würden; und daß vor allem sie selbst bei der der von ihnen – wie auch immer – ausgeübten politischen Kontrolle über das Land noch viel zu sehr behindert würden – und bieten das ihrem Volk als Ersatz für ihr Versäumnis, für eine halbwegs funktionelle Organisation aller für ein Staatsleben unabdingbaren arbeitsamen und sonstigen Dienste zu sorgen.
Untertanen, die auf der einen Seite aus allen intakten Lebens- und Reproduktionszusammenhängen herausgerissen und von ihrem neu aufgemachten Staat – mit Verweis auf ihre völkische Eigenheit, die sie dazu bestimmte – zu einem Staatsvolk gekürt werden, die auf der anderen Seite als dieses aber gar nicht funktionieren, lassen sich damit über kurz oder lang nicht beeindrucken. Wenn sie unter Berufung auf ihre höchstspezielle Besonderheit zum loyalen Dienst an einer nationalen Sache antreten sollen, für den Dienst an dieser aber gar nicht brauchbar gemacht und in Gebrauch genommen werden, bemerken sie schon, daß die groß angekündigte Angelegenheit, für die sie zum Staatsvolk vereint wurden, gar nicht stattfindet. Dann können und wollen sie in den Herren, die in ihrem Namen über sie regieren, auch nicht ihre Herren wiederfinden, und das mindeste, worauf sie verfallen, ist die Verweigerung der abverlangten staatsbürgerlichen Loyalität.
Dies läßt in nicht wenigen der neuen GUS-Staaten manche
althergebrachten Loyalitätsbindungen wiederaufleben und
führt zu einem Rückfall auf vor- und
außerstaatliche Formen von Vergesellschaftung,
in die sich das nur formell zum Staatsbürgertum gekürte
Volk einsortiert. In diesen mögen die Autochthonen zwar
schon zu Zeiten der Sowjetunion vor sich hingelebt haben.
Aber jetzt treten die ganzen Clan-, Sippschafts- und
Stammesbeziehungen aus dem unbedeutenden
Schattendasein, das sie im Sozialismus und unter der
Herrschaft der KPdSU führten, heraus und bestimmen
anstatt der öffentlichen Gewalt das soziale
Leben: Die sind nunmehr die außerhalb aller
Staatlichkeit existierende soziale Organisation eines –
und nicht selten des einzigen – Beschaffungswesens, das
die Versorgung mit dem Nötigsten sicherstellt, das zum
Überleben gebraucht wird. Die an Alter, familiärer
Abstammung, Tradition und sonstigen überkommenen
ethnischen Gebräuchen orientierten
Gefolgschaftsverhältnisse füllen mit Erfolg das
herrschaftliche Vakuum auf, das die politische
Mannschaft, die in der Hauptstadt regiert, im Rest des
Landes erzeugt. Der Übergang zum rein kriminellen
Bandenwesen
, mit dem eine Sippschaft unter
Anleitung ihres Chefs das Beschaffungswesen auszudehnen
oder zu verfeinern oder auch nur gegen andere zu
verteidigen sucht, die dasselbe auf ihre Kosten
probieren, ist fließend – genauso aber auch der zur
Politisierung des Haufens oder mehrerer von
ihnen, die den Staat dann in einen Zustand des
dauerhaften Bürgerkriegs zu überführen hilft. Die
organisierte Privatgewalt imitiert dann im Kleinen das
Prinzip, bei dessen Vollzug im Großen der Staat
gescheitert ist: In Händen eines Anführers, der seine
Sache zu der Aller macht, fungiert sie als Instrument der
Herrschaftsgründung, wird Partei in einem entweder schon
laufenden oder mit ihr eröffneten Kampf um die
Macht im Gemeinwesen, in dem sich dann alles darum
dreht, unter Berufung auf eine stammesmäßig,
religiös[6]
oder sonstwie hergeleitete Besonderheit ein
eigenes Herrschaftswesen aufzuziehen – gegen
andere Vereine, die dasselbe wollen, und gegen das, was
es an Resten einer Staatsmacht noch gibt. Das erzeugt
dann die bekannten Unruhegebiete
im GUS-Raum, die
entweder – wie in Tadschikistan – ganze Republiken
umfassen oder – wie in den Republiken im Kaukasus –
ansehnliche Teilbereiche von ihnen, und bei denen es
vorkommt, daß selbst ein Staatspräsident die aktuell
kämpfende Partei nicht zu nennen weiß, deren
Attentatsversuch er gerade davongekommen ist.
Ein wenig übersichtlicher ist die Sache dort, wo sich ein
größerer ethnischer Haufen mit Erfolg dazu hat
mobilisieren lassen, gegen den Staat, der ihn zu
seinem Volk rechnet, die eigene völkische Besonderheit
selbst zum Argument einer eigenen Staatlichkeit
zu machen. In diesen Fällen haben sich Führer
darauf verstanden, ein verbrieftes, schon zu Sowjetzeiten
gewährtes
„Recht auf Selbständigkeit“
einer Volksmannschaft innerhalb des GUS-Raums zu ihrem
Charisma zu machen und ausreichend Leute hinter sich zu
bringen, die sich in diesem Recht durch den Staat, in dem
sie sitzen, nicht bedient sehen. So werden Forderungen
laut, die die Identität des nationalistischen Kollektivs,
das sich da zu Wort meldet, im Austritt aus dem
Staatswesen und der Neugründung eines eigenen,
im Beitritt zu bereits bestehenden Staaten oder
autonomen
Gebieten oder im grenzübergreifenden
Zusammenschluß mit Völkerschaften gleichen
Herkommens nebst anschließender Staatengründung gewahrt
wissen wollen. Nicht immer wird aus diesen Forderungen
dann wirklich eine Volksbewegung, der die nationale Sache
wichtig genug ist, sich gegen den Staat aufzubauen, der
sie auch schon vertritt; manchmal aber eben schon, und
die heiß begehrte Autonomie
kommt zustande: Der
Erklärung der eigenen Selbständigkeit
und dem
Auszug aus dem Staatsverband folgt früher oder später die
kriegerische Behauptung gegen die Staatsmacht nach, die
zusammen mit vielen Bürgern auch die letzten Reste der
noch funktionierenden Lebensgrundlagen im Land erledigt.
Sie wird – wenn sie gegen den Staat einigermaßen
erfolgreich war – im nunmehr eigenen Territorium in Form
von ethnischen Säuberungen fortgesetzt, denn in etwas
anderem als im nationalistischen Wahn einer dem Volk
gebührenden eigenen Staatlichkeit existiert die
Staatsraison nicht, so daß sie in allen, die sie als
Exemplare von fremder völkischer Herkunft ausmacht, ihre
Gegner sieht und sie entsprechend behandelt. Daher sind
in den GUS-Staaten jede Menge völkischer Minderheiten als
Flüchtlinge unterwegs, vagabundieren zwischen
den Republiken umher und erfreuen sich überall dort, wo
sie sich aufhalten, derselben Wertschätzung, der sie ihre
trostlose Lage zu verdanken haben: Dort, wo sie gerade
sind, gehören sie einfach nicht hin…
Auch wenn es unblutig verläuft, trägt das vielfache
Geltendmachen des Rechts auf eigene Staatlichkeit nicht
gerade positiv zur Konsolidierung der bestehenden bei.
Wenn Kommunen oder Landkreise in Rußland aus den vielen
wirtschaftlichen Schwierigkeiten
bei der
Verwaltung ihres Gebiets den Schluß ziehen, daß fortan in
der Unabhängigkeit
von Moskau ihre Perspektive
liegt; wenn Kenner der russischen Szene ungefähr 60 (!)
Völker- oder Gebietskörperschaften anzugeben wissen, die
sich unter Berufung auf einen – mal völkisch, mal
„historisch“, mal religiös begründeten – Rechtstitel
darin vereint sehen, sich anders, nämlich
autonom
und als neu- bzw. umzugründendes
quasi-staatliches Subjekt in die Russische Föderation
hinein- oder gleich ganz aus ihr hinausdefinieren zu
wollen, so kündigt sich zwar nicht in jedem dieser Fälle
der Übergang an, den die Tschetschenen vormachen. Eine
Absage an die Macht in Moskau und die virtuelle
Kündigung der von ihr beanspruchten
Aufsichtsbefugnis stellen diese konkurrierenden Angebote
zur Stiftung von Formen politischer Zusammengehörigkeit
aber in jedem Fall dar. Das gilt auch dort, wo überhaupt
nicht anti-russisches Ressentiment, sondern
ausgerechnet pro-russischer Nationalismus in
Reinkultur auf seine staatliche Eigenständigkeit pocht,
und Kosaken dieser in Gestalt einer eigenen
Miliz und Gerichtsbarkeit Ausdruck verleihen: Immerhin
ist ihnen vom russischen Präsidenten die
Anerkennung zuteil geworden, mitten in Rußland
eine besonders russische und daher auch besondere Macht
zu sein.
Als solche betätigen sich auf ihre Weise auch die Russen, die auf der Krim ansässig sind, ihre ukrainische Heimat aber gleichfalls nicht als Erfüllung ihrer patriotischen Drangsale sehen wollen. Wenn sie mit der Wahl eines eigenen Präsidenten ihren Auszugswillen aus dem Gastland dokumentieren und den Anschluß an ihr Vaterland betreiben, so konfrontieren sie dieses mit dem Antrag, es möge seine Macht für die Rechte verwenden, die sie als Russen in der Diaspora geltend machen – und entsprechend die Staatsgrenzen dorthin verschieben. Je weniger dieser Antrag in Moskau Gehör findet – die Rechtsposition als solche wird politisch gewahrt, für den Übergang zum Feldzug sieht niemand Bedarf –, desto mehr sehen sich die Russen im Ausland zu Zweifeln darüber veranlaßt, ob denn in Rußland eigentlich die Richtigen im Amt sind, die für russisches Recht sorgen. Mit diesem Zweifel sind sie dort keineswegs allein und treffen auf die offenen Ohren aller ohnehin schon im Machtkampf verstrickten Parteien, so daß ausgerechnet ihr russischer Nationalismus von unten denselben Dienst tut wie der anti-russische Behauptungswahn von Tschetschenen und die anderen, vorerst bloß im Ideellen verbleibenden „Autonomie-“ Gründungen: Er legt offen, was bei den Erben der SU hinsichtlich der elementaren Fragen der Staatsgründung alles nicht stattgefunden hat.
Als Staaten Anerkennung finden diese 12 Subjekte gleichwohl noch, die sich gemeinschaftlich aus dem Bestand der Sowjetunion ausgegründet haben. Das liegt daran, daß von den Staaten im Westen, die für ihre Anerkennung zuständig sind, mit dieser vor allem die negative Seite honoriert wird, die mit ihrem Gründungsakt einherging: Mit dem Entstehen der GUS als dem krönenden Abschluß der Perestrojka des sowjetischen Reformkünstlers war das Ende der Macht besiegelt, die sich mit Erfolg dem westlichen Diktat der Weltherrschaft von Freiheit & Demokratie widersetzte und mit ihrem sozialistischen Alternativmodell dagegenhielt.
Die außenpolitischen Beziehungen der GUS-Staaten zum Westen
die es als Konsequenz ihrer Anerkennung auch schon seit
drei Jahren gibt, machen auf ihre Weise deutlich, daß der
Westen außer dieser Funktion, die die
Gründungsstaaten für ihn verrichteten, an ihnen einfach
nichts findet, was ihm ihre staatliche Weiterexistenz
lohnend erscheinen läßt. Nichts von dem, was sich im
Rahmen des diplomatischen Verkehrs zwischen den
GUS-Souveränen und den maßgeblichen Staaten des Westens
abspielt, verrät bei letzteren eine gewisse Sorge, ihre
neuen Partner
könnten den offenkundigen
Schwierigkeiten, die ihrem Weiterbestand entgegenstehen,
vielleicht nicht ganz gewachsen sein, weswegen ihnen –
soll es sie weiter geben – auch Hilfe
zu gewähren
sei: Sämtliche Gesuche, die seit den letzten drei Jahren
diesbezüglich an die gutbestückten Adressen im Westen
ergehen, stoßen dort auf ziemlich taube Ohren. Und
wenn man dort positiv wird, und die GUS-Staaten
tatsächlich ins Visier der außenpolitischen Interessen
geraten, die der Westen an ihnen verfolgt, dann zeigt
sich umgekehrt, daß dieser alles andere im Sinn hat, als
dafür zu sorgen, daß aus den anerkannten staatlichen
Gründungsakten auch Staaten mit Rechten werden, die sie
sich selbst zurechtlegen.
Alle in den Herrschaftsgebilden der GUS noch offenen Fragen, von der Absteckung der staatlichen Territorien und der Zuordnung der jeweiligen Volksmannschaften bis zur politischen Aufsicht über die vorhandenen militärischen Machtmittel, werden von den Mächten des Westens sehr sachgerecht und ganz als das genommen, was sie sind: Sie dokumentieren, was den Gründungsstaaten alles an Mitteln ihrer Souveränität fehlt – also umgekehrt auch, welche Mittel der gestalterischen Einflußnahme man deswegen selbst umso mehr in Besitz hat, mit denen sich bestimmen läßt, was aus diesen unfertigen staatlichen Gebilden wird.
Zur Frage des Gewaltmonopols in den GUS-Staaten
steht diesbezüglich fest, daß nach Möglichkeit kein
weltpolitischer Faktor aus ihnen wird, den es zu
berücksichtigen gilt. Ihre diplomatischen Verhandlungen,
die sie hierzu mit den Führungsmächten des Westens
bestreiten, laufen auf die mit Nachdruck vermittelte
Einsicht in die Notwendigkeiten hinaus, die ein
imperialistisches Aufsichtsmonopol über eine neue
Weltordnung
, der sie sich ja nun zurechnen dürfen, so
mit sich führt. Und immer enden sie mit dem Antrag, sie
möchten mit ihrer freiwilligen Selbstentwaffnung
zügig voranschreiten: Im Fall der Ukraine,
Kaschstans und Weißrußlands wird das
vom Westen sanktionierte Verfahren bei der Gründung des
ganzen Vereins, sich die sowjetische Erbmasse als Mittel
einer neuen souveränen Staatlichkeit anzueignen, ganz
grundsätzlich außer Kraft gesetzt. Diesen drei Staaten
wird zu verstehen gegeben, daß sie als das, was sie
nunmehr sind, kleinere Atommächte
nämlich, auf
keinen Fall anerkannt werden, sie für eine wohlwollende
Behandlung von gleich zu gleich vielmehr erst gewisse
Vorleistungen zu erbringen hätten. Diese bestehen darin,
sich von der absoluten Untauglichkeit und Überflüssigkeit
ihrer schweren Waffen für all das überzeugen zu lassen,
was ihnen an staatlichen Ambitionen allenfalls zu
konzedieren ist – und auch konzediert wird, wenn
sie sich abrüsten lassen. Zur Verschrottung
ihrer Waffen gewährt man ihnen dann
Hilfe
, bezahlt technisches Gerät und die
Spezialisten, die es vor Ort bedienen, damit schon mal in
diesen drei Staaten in Zukunft nichts mehr da ist, woran
ein imperialistisches Kontrollbedürfnis eine ernsthaft zu
berücksichtigende Schranke vorfindet.
Daß im selben Zug, in dem die atomare Entwaffnung in
diesen drei Staaten der GUS vorankommt, ein vierter,
Rußland, zum Gesamtverwalter des ehemaligen
sowjetischen Arsenals avanciert, begründet die Sorte
Diplomatie, die es zwischen diesem Staat und dem Westen
gibt, und auch bei der zeichnet sich der Westen durch
absichtsvolle Ignoranz gegenüber dem aus, was er an neuer
Staatlichkeit im Prinzip anerkannt hat. Da wird
entschieden darauf gedrängt, daß alle alten Verträge, in
denen zwischen den USA und der Sowjetunion bzw.
den Partnerstaaten ihres Paktes Abrüstung vereinbart
worden war, auch von Rußland als verbindlich
angesehen und erfüllt werden. Im Prinzip jedenfalls, denn
unmittelbar untersagen kann und will man es dieser Macht
nun doch nicht, wenn sie ihre aktuellen
Sicherheitsinteressen z.B. im Kaukasus wichtig nimmt und
sich über das hinwegsetzt, was der Sowjetunion im Rahmen
des KSE-Vertrags dort an Truppen und Panzern genehmigt
wurde. Aber aus seiner relativen Ohnmacht, auch die
Entwaffnung dieser Macht voranzutreiben, folgt für den
Westen noch lange nicht die Anerkennung einer
souveränen russischen Verfügung über das
militärische Potential, das dieser Staat besitzt. Unter
Hinweis auf die nach wie vor bestehenden vertraglichen
Verpflichtungen wird den Russen gewährt, zur
Wahrung der Stabilität
in der Region ihre
Erfüllung vorübergehend auszusetzen, so daß auch da das
prinzipielle westliche Aufsichtsrecht über den
Raum, den die GUS ausfüllt, gewahrt und es einer
westlichen Konzession überantwortet bleibt, wer
in ihm welche sicherheitspolitischen Interessen in
welcher Weise verfolgen darf. So kommt es einerseits
nicht in Frage und wird als Verletzung des
heiligen Prinzips der staatlichen Souveränität
gewertet, wenn vom Standpunkt russischer
Sicherheitsinteressen aus von Moskau das Recht reklamiert
wird, im GUS-Raum alleinzuständige
Aufsichtsmacht zu sein. Andererseits wird den Russen –
stillschweigend – die Wahrnehmung dieses
Rechtsstandpunkts doch auch konzediert – dort nämlich, wo
er für die letzten Reste einer Kontrolle des
GUS-Zusammenhalts überhaupt sorgt, und damit auch dafür,
daß sich Teile der GUS nicht schlagartig jeder
Kontrollierbarkeit entziehen. Nur deswegen, weil so
Stabilität
geschaffen und mit dieser die Bedingung
einer imperialistischen Aufsichtnahme aufrechterhalten
wird, darf Moskau in seinem „nahen Ausland“ mit
Waffengewalt präsent sein, bislang jedenfalls noch, und
auch nur in den drei bis fünf Fällen, die sich gleich
nach der Zerschlagung der SU als „Krisenherde“
herausgebildet haben.
Bei ihren diversen Konflikten, die aus ihren Bemühungen
resultieren, ihr staatliches Territorium zu
arrondieren und sich ihre Völker anzueignen,
werden die GUS-Staaten vom Westen gleichfalls nicht
allein gelassen. Was zunächst das Territorium
betrifft, so sammeln die Gründungsstaaten, die um es
streiten, ja noch immer ihre Erfahrungen damit, was es
mit dessen Unverletzlichkeit
auf sich hat. Mitten
hinein in den Streit, den sie bei ihren einschlägigen
Definitionsversuchen ausfechten, platzen aber schon auch
noch Anträge von der Seite, die ansonsten dafür bekannt
ist, daß sie über das Prinzip der Unverletzlichkeit
aller bestehenden Grenzen
nichts kommen läßt, die
sich hier aber diplomatisch mit ganz eigenen
Vorstellungen darüber einführt, wie diese
unverletzlichen Grenzen zu verlaufen haben: Ganz weit
hinten im fernen Osten ist es Japan, das
nachhaltig den Klärungsbedarf vorbringt, wem ein paar der
zu Rußland gehörenden Kurilen zu gehören haben. Und außer
Rußland selbst findet sich im Westen einfach keiner, der
diesen Expansionsdrang mit Verweis auf eherne Prinzipien,
die zwischen Staaten gelten, zumindest etwas bedenklich
finden würde. Gleiches trifft auf die Machenschaften ganz
vorne im Westen der GUS zu, wo von Deutschland
aus – natürlich immer unter Berufung auf eine vor Ort
ansässige Landsmannschaft – an gute Traditionen
angeknüpft und über bestehende Grenzen hinweg an die
politische Neugeburt Ostpreußens gedacht wird. Auch da
hat an der Unfertigkeit der GUS-Staaten ein
praktisches Interesse von westlicher Seite seine
positive Bedingung entdeckt, und es wird vom
nationalen Standpunkt aus definiert, was man
eigentlich nicht als Hoheitsgebiet des
anerkannten Souveräns anzuerkennen bereit ist. Umgekehrt
schrecken dieselben Politiker, die in fremden Staaten
verlorengegangene deutsche Ostgebiete
wiedererkennen, überhaupt nicht davor zurück, sich unter
Berufung auf sakrosankte Grenzverläufe in Angelegenheiten
einzumischen, die erstens die eines fremden Staates sind
und sich zweitens zwischen zwei fremden Staaten
abspielen: Dem Wunsch Weißrußlands, sich wieder
dem russischen Kernland anzuschließen, tritt das deutsche
Außenministerium zwar nur deshalb entgegen, weil es die
Vergrößerung der russischen Macht nicht will, die es
darin sieht. Begründet wird dieses Votum aber mit dem –
in diesem Fall gegebenen – Verbot, einmal anerkannte
Grenzen revidieren zu wollen, und die weißrussische
Führung wird diplomatisch damit vertraut gemacht, daß in
ihrem Fall ihre Anerkennung ernst gemeint ist. Auch so
kann man zu verstehen geben, wofür man einen
Staat anerkannt hat. Dieselbe Botschaft mit anderem
Inhalt wird der Ukraine in Form des Antrags
mitgeteilt, sie möchte ihr Kernkraftwerk in
Tschernobyl ganz vom Standpunkt derer aus behandeln, die
es für sich als „Sicherheitsrisiko“
definiert haben und es für untragbar halten, daß
ihr Standpunkt sich an dem einer ukrainischen
Energieversorgung zu relativieren hat.
Auch bei den Problemen, die die GUS-Staaten mit der
Aneignung ihrer Völkerschaften haben, erfreuen
sie sich einer westlichen Anteilnahme, die sehr wenig
Respekt vor dem ansonsten geltenden Grundsatz bezeugt,
daß da einfach zusammenwachsen muß, was gemäß staatlicher
Definition zusammengehört. Das Recht, sich unter Berufung
auf Völkisches in die inneren Angelegenheiten der
GUS-Staaten einzumischen, bedarf hierzu gar nicht einmal
solcher Blut-und-Boden-Kreaturen wie der
Deutschstämmigen
, deren Erscheinungsbild jedem
zusammengehörigkeitsbewußten Deutschen Bedenken einflößt,
denen es aber – lt. Regierungsbeschluß – zwecks
Vermeidung von Zuzug an der Wolga, in Sibirien oder in
Nordkasachstan unbedingt zu einer
deutsch-republikanischen Eigenständigkeit zu verhelfen
gilt. Daß sie in den westlichen Staaten die berufenen
Experten für alle Fragen haben, die das
Selbstbestimmungsrecht der Völker
betreffen,
erfahren die GUS-Staaten beinahe in allen Fällen, in
denen sie in die einschlägigen Probleme verwickelt sind,
sich ihren Völkern als die Verwirklichung dieses
Rechts zu präsentieren, und auch da ist die Zielrichtung
nicht zu verkennen, der die westlichen Expertisen folgen:
Ganz hoch im Kurs des Ansehens in den maßgeblichen
westlichen Kreisen steht im Prinzip jede
Landsmannschaft, deren autonome Drangsale sich gegen
Rußland wenden, deren Unterstützung also darauf
hinausläuft, die Macht Rußland zu schwächen. Das
können ganze – sogar islamische und ein bißchen
fundamentalistische – Republiken sein, denen der
vorgetragene Emanzipationswille aus russischer
Abhängigkeit
dann mit ein bißchen
Entwicklungshilfe honoriert wird; es kann ein Staat wie
die Ukraine sein, dem man bei seinen
Streitfragen mit Rußland – die Flotte im Schwarzen Meer,
die Russen auf der Krim – diplomatisch und auch mit ein
wenig Kredit zur Seite steht; es kann aber auch nur eine
Minderheit
sein, die sich ihre Republik erst noch
sucht, und für die es unbedingt Partei zu
ergreifen gilt, weil ihr Auszugswille aus der russischen
Föderation ganz zweifelsfrei belegt, daß sie in der nur
unterdrückt
worden ist. Im Fall
Tschetschenien, wo Rußland um die Wahrung seines
staatlichen Bestandes kämpft, taktiert der Westen. Unter
Berufung auf die edlen Titel des Völkerrechts erklärt er
einerseits seine Parteinahme für die geknechteten
Sezessionisten; andererseits versagt er den russischen
Bemühungen, für den Zusammenhalt der Föderation zu
sorgen, ein gewisses Verständnis nicht; beides
miteinander kombiniert ergibt einen entschiedenen
Vorbehalt gegen eine souveräne Handhabung der
russischen Machtmittel, der dann je nach der Entwicklung
vor Ort und je nach Bedarf in allen gewünschten
Richtungen hin ausbaufähig ist. Von selbst versteht es
sich, daß umgekehrt die russischen Minderheiten im
Baltikum nach westlicher Auffassung
keine nennenswerten Rechte besitzen, schon
gleich nicht solche, die Rußland irgendwie zum
Einschreiten gegen deren offizielle Schikanierung
berechtigen könnten.
*
So richtig bedingungslos als Staaten anerkannt und als Souveräne von gleich zu gleich behandelt werden die Subjekte der GUS aber schon auch. Das ist immer dort der Fall, wo sie dem einzigen positiven Interesse dienstbar sind, das der Westen an ihnen hat. Das wiederum betrifft gar nicht sie selbst, sondern sie als formelle Eigentümer der stofflichen Reichtümer, die in ihren Territorien lagern. Für den Abtransport aller Rohstoffe dorthin, wo nach ihnen Bedarf herrscht, dürfen sie dann sorgen. Entweder selbst – was selten vorkommt, weil sie dazu kaum noch imstande sind –, und dann verdienen sie an Exporterlösen so gut wie alle anderen Länder, die sich für diese Dienstleistung hergerichtet haben. Oder – was öfter der Fall ist – sie verpachten ihr Land gleich an die, die sich für dessen Reichtümer interessieren, und dann leben sie von der Gebühr, mit der ihnen die Überlassung des Bodens großzügig entgolten wird.
[1] Die Karriere der GUS ist in der Bibliothek des GegenStandpunkts ausführlich dokumentiert, und zwar in GegenStandpunkt 1-92, S.61, in GegenStandpunkt 3-92, S.45, in GegenStandpunkt 2-93, S.141, und zuletzt in GegenStandpunkt 1-95, S.151.
[2] Die EU nutzt übrigens die Gelegenheit, sich als Adresse der „politischen Orientierung“ des Landes in Erinnerung zu halten, und spendiert zur Abwendung drohender Hungerkatastrophen aus ihren überflüssigen Beständen Nahrungsmittel.
[3] Im Unterschied zu
den kaukasischen Nachbarn gedeihen im eigentlichen
Staatsgebiet immer noch viele Früchte und andere
Agrarprodukte, mittlerweile aber eben viel
zuviel – für „Märkte“ nämlich, die im Westen,
in der EU, nicht betreten werden dürfen und im Osten
gar nicht erst vorhanden sind. Die harte
Währung
, die für nötige Importe – v.a. Erdöl und
-gas aus Rußland und Transnistrien – hinzulegen ist,
entstammt westlicher Kreditierung, der entschiedene
Kampf gegen Inflation und Haushaltsdefizit
, der
dem Land die IWF-Kreditwürdigkeit sichern soll, zeitigt
nur den üblichen Erfolg einer umfassenden Verarmung des
Volkes. Nationale Erfolgsmeldungen gibt es gleichwohl,
die stehen sogar kommentarlos in ernsthaften
Wirtschaftsblättern und lesen sich dann so: Die
Währung der Moldau, der Leu, ist in Zukunft frei
konvertierbar. Wie der Chef der Nationalbank der Moldau
(…) weiter mitteilte, sei es durch strikte Geldpolitik
gelungen, die Inflation 1994 auf 110% zu senken. 1995
soll die Geldentwertung nur 10% betragen.
[4] Rußland verfügt zwar über das größte ökonomische Potential in der GUS. Aber daß dort nicht gleich das gesamte ökonomische Leben zum Erliegen kommt, wenn die Gosplan-Zuweisungen ausbleiben, wie in zehn der zwölf benachbarten Republiken, heißt für sich noch nicht viel. Eine funktionelle Erpressung, eine nützliche und ausnutzbare „Abhängigkeit“, auf deren Herstellung und Pflege sich imperialistische Nationen wie nichts verstehen, ist es jedenfalls nicht, was Moskau mit seinen Energielieferungen bzw. mit deren – angedrohter oder kurzfristig wirklich stattfindender – Unterbindung zuwege bringt: Damit wenigstens noch die letzten, auch für Rußland unverzichtbaren Reste eines grenzüberschreitenden Verkehrs stattfinden können, ist die Ablieferung von Energie an die Nachbarn unbedingt nötig – auch wenn auf unabsehbare Zeit hin feststeht, daß die Bezahlung nur im Anwachsen des schon laufenden Schuldenkontos des Empfängers besteht. Der selbst wiederum sieht darin für sich eine einzige Veranlassung, auf Abhilfe zu sinnen und möglichst auch noch diese, jeder imperialistischen Berechnung spottenden „wirtschaftlichen Beziehungen“ zu kappen, weil sie ihm wie eine unerträgliche Einschnürung seiner „Selbständigkeit“ vorkommen.
[5] In Kasachstan wirft die Zusammensetzung der Mannschaft, die der Staat zu seinem Volk zu definieren sucht, gleichfalls die Frage auf, welche auswärtigen Rechte dadurch tangiert werden und entsprechende Berücksichtigung verlangen. Da dort mehr als ein Drittel Russen sind, steht die Anmeldung russischer Rechte naturgemäß an erster Stelle und findet auch regelmäßig statt, aber auch die – vergleichsweise kleine – deutschstämmige Minderheit ist eine beständige Einmischung Deutschlands in die innerkasachischen Angelegenheiten wert. Die will der regierende Autokrat sich nicht bieten lassen, weil die Zurückweisung dieser Eingriffe in sein Definitionsrecht des Staatsvolk so ziemlich das einzige ist, das die beanspruchte staatliche Souveränität bezeugt: Die Hilfe, die von den USA zur Entwicklung des Landes gewährt wird, ist für die Verschrottung der noch vorhandenen Atomwaffen sowie die Verrentung von Rüstungsspezialisten zweckgebunden, weiterer Transfer von wirklichem Geld findet nicht statt, so daß die Nutzung vorhandener natürlicher Ressourcen nur in engen Schranken stattfindet; die Vermietung des Weltraumbahnhofs bringt Rubel, sonst nichts; unumgängliche Importe werden zu Weltmarktpreisen fakturiert und als Schulden verbucht, und ein Könner vom IWF hat eine „Inflation“ der Landeswährung so um 2000% jährlich errechnet. Da bleibt außer dem Rechtstitel auf einen Rohstoff Volk nicht viel, womit sich Staat machen läßt.
[6] Zumeist fungiert hierbei der Islam als der Titel, der das unabdingbare Recht auf herrschaftliche Eigenheit einer diesmal im Glauben vereinten Gemeinschaft ausweist – und als der ziemlich verläßliche Hebel, mit dem gebietsansässige Scheichs und Mullahs ihre Gefolgschaft finden und an sich und ihre herrschaftlichen Ambitionen zu binden verstehen. Die Berufung auf den Glauben macht die betreffende Gemeinschaft aber zugleich wieder ziemlich ununterscheidbar von allen anderen, die dasselbe tun, so daß die Religion als Indiz der Unverwechselbarkeit des Vereins so weit auch wieder nicht trägt. Daher kämpfen im Zeichen desselben Allahs die Scheichs wegen ihrer weltlichen Konkurrenzfragen auch wieder gegeneinander; und Söldner ziehen durchs Land, die ganz anderen Rechten als denen ihres eigenen Stamms zur Seite stehen wollen. Wo sich ganze Republiken zur Demonstration ihres anti-russischen Emanzipationswillens und zur Wahrung von „Eigenständigkeit“ islamisch umtauften, nehmen die entsprechenden Schriftgelehrten, die das Volk unterrichten, die hauptsächliche Staatsfunktion wahr. Unterstützt werden sie von einem Kulturprogramm, das von türkischem Boden ausgeht, weil diese Macht so ihren regionalen Imperialismus befördern möchtet.