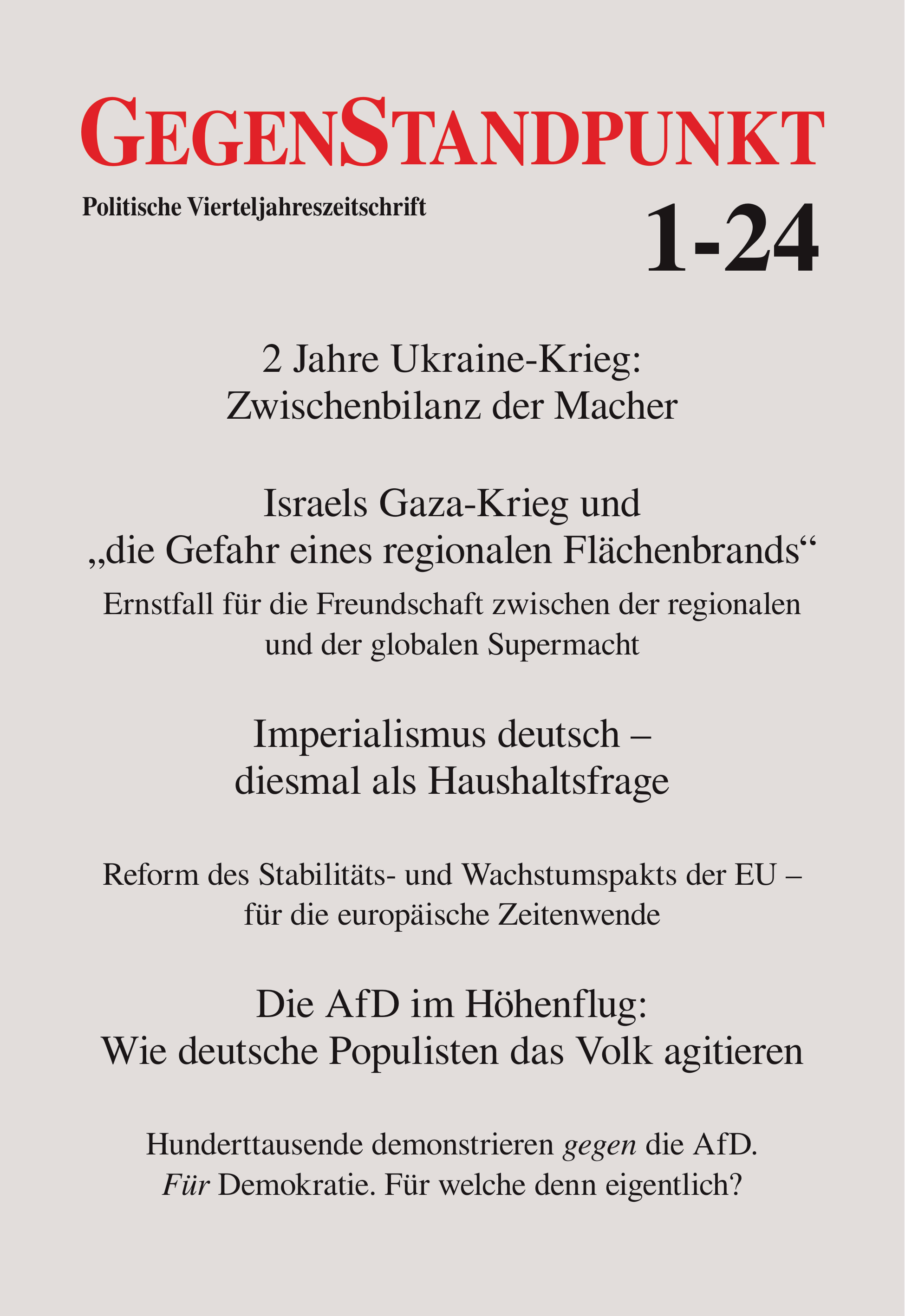Zur Reform des europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakts
Die EU justiert ihr Kreditregime über die Haushaltspolitik der Mitgliedstaaten neu – für die europäische Zeitenwende
Ende des letzten Jahres einigte sich der EU-Ministerrat auf eine Reform des „Stabilitäts- und Wachstumspakts“, dem seit Jahrzehnten geltenden supranationalen Kreditregime über die Haushaltspolitik der Mitgliedstaaten. Spätestens mit dem Ukraine-Krieg steht fest, dass die EU auf die bisher gültigen, für Europa günstigen und geklärten Gewalt- und Geschäftsbedingungen nicht mehr bauen kann. Daraus folgt das positive Programm für das vereinte Europa: Die Union muss sich in der ökonomisch-zivilen wie militärischen Staatenkonkurrenz gegen Weltmächte wie Russland, China und die USA behaupten und durchsetzen.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
- 1. Zeitenwende à la Europäische Union
- a) Imperialismus zivil: ein „Green Deal“ zur Besetzung des Weltmarktes
- b) Imperialismus militärisch: Aufwuchs zu autonomer Kriegsfähigkeit
- 2. Ein rundum erneuerter Pakt für Wachstum, kombiniert mit Stabilität
- 3. Kreative Regeln für die Freisetzung des Schuldenmachens durch kontrollierte Stabilität
Zur Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts
Die EU justiert ihr Kreditregime über die Haushaltspolitik der Mitgliedstaaten neu – für die europäische Zeitenwende
Ende des letzten Jahres einigte sich der EU-Ministerrat – nach monatelangem Streit zwischen der Kommission, Italien, Frankreich, dem deutschen Wirtschaftsminister auf der einen Seite und dem deutschen Finanzminister, den Niederlanden etc. auf der anderen Seite – auf eine Reform des „Stabilitäts- und Wachstumspakts“, dem seit Jahrzehnten geltenden supranationalen Kreditregime über die Haushaltspolitik der Mitgliedstaaten. [1] Dieser Pakt
„... beruht auf dem Ziel solider und tragfähiger öffentlicher Finanzen als Mittel zur Verbesserung der Voraussetzungen für Preisstabilität und für ein starkes, nachhaltiges, durch finanzielle Stabilität untermauertes Wachstum, wodurch die Verwirklichung der Ziele der Union für nachhaltiges und integratives Wachstum und Beschäftigung unterstützt wird.“ (Vorschlag für eine Verordnung über die wirksame Koordinierung der Wirtschaftspolitik und die multilaterale haushaltspolitische Überwachung, Kompromisstext vom 22.2.24, Erwägungsgrund 2)
Diese Zwecksetzung erfüllt nach einhelliger Meinung aller Mitgliedstaaten der Pakt in seiner bisherigen Fassung samt seinen Kennziffern für das gültige Maßverhältnis zwischen Verschuldung und erbrachtem Stand des Wirtschaftswachstums heutzutage nicht mehr. Zu „unwirksam“, nicht mehr „realitätsgerecht“, zu „ineffektiv“, lautet ihr abschließendes Urteil über den bisherigen Pakt – womit die ursprünglich vereinbarte Wiederinkraftsetzung seiner Regelungen vom Tisch ist. [2]
1. Zeitenwende à la Europäische Union
Für welche Zielsetzungen die dringend erforderliche Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts ihre Wirkung entfalten soll, bestimmt der Europäische Rat so:
„Dazu gehören das Erreichen eines fairen digitalen und grünen Übergangs, einschließlich des Klimagesetzes, die Gewährleistung der Energiesicherheit, die Unterstützung einer offenen strategischen Autonomie, die Bewältigung des demografischen Wandels, die Stärkung der sozialen und wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit und der nachhaltigen Konvergenz sowie die Umsetzung des strategischen Kompasses für Sicherheit und Verteidigung, was alles in den kommenden Jahren Reformen und anhaltend hohe Investitionen erfordert.“ (aus: Kompromisstext, Erwägungsgrund 5)
Es ist ein anspruchsvolles, nämlich die entscheidenden Bereiche ihrer Machtentfaltung umfassendes Programm, das sich die EU da unter der Überschrift „Widerstandsfähigkeit“ und „Sicherheit“, also im Gestus einer unbedingten Existenznotwendigkeit zum Ziel gesetzt hat. Für ihre Macher steht damit zugleich unwidersprechlich fest, dass dafür eine enorme und dauerhafte Kreditausweitung seitens der EU sein muss. Woran diese Kreditschöpfung quantitativ wie qualitativ Maß nimmt, drückt der amtierende Wirtschaftskommissar der EU ganz unverblümt so aus:
„Der Krieg in der Ukraine war in vielerlei Hinsicht ein Weckruf für Deutschland und für Europa. Wir können unseren Energiebedarf nicht nach Russland outsourcen. Wir können unsere Sicherheit nicht an die USA outsourcen. Und wir können unsere Industrie nicht nach China outsourcen. Und das ist ein neues, großes Bewusstsein in der Europäischen Union. In weniger als einem Jahr haben wir weitreichende Veränderungen auf den Weg gebracht, von denen es kein Zurück mehr geben wird: die Abkehr von russischen fossilen Brennstoffen, die Forcierung stärkerer Verteidigungskapazitäten, die Hinwendung zu einer neuen Industriepolitik. Der Weg, der vor uns liegt, ist mit Unsicherheiten gepflastert. Aber wenn wir geeint und ehrgeizig bleiben, bin ich zuversichtlich, dass aus dieser Krise ein neues Europa geboren werden kann. Ein gerechteres, grüneres und wettbewerbsfähigeres Europa.“ (Rede von EU-Kommissar für Wirtschaft und Währung Paolo Gentiloni an der Hertie-School: A Union of Security and Solidarity: Building a fairer, greener and competitive European economy, 30.1.23)
Spätestens mit dem Ukraine-Krieg steht für Gentiloni endgültig fest, dass die EU auf die bisher gültigen, für Europa günstigen und geklärten Gewalt- und Geschäftsbedingungen nicht mehr bauen kann. Daraus folgert er das positive Programm für das vereinte Europa: Die Union muss sich in der ökonomisch-zivilen wie militärischen Staatenkonkurrenz gegen Weltmächte wie Russland, China und die USA behaupten und durchsetzen. Sie muss sich – das ist Gentilonis Ansage – bei Strafe ihres Untergangs endlich aus eingegangenen Abhängigkeiten von diesen Mächten befreien und ihrerseits zu einer Macht werden, die autonom über die Deckung ihres Energiebedarfs, ihre ökonomischen Reichtumsquellen und die militärische Durchsetzung ihrer Macht bestimmt. Sonst nämlich degradieren diese „Raubtiere“, die unter Einsatz ihrer jeweiligen Potenzen die Durchsetzung ihres Weltmachtanspruchs verfolgen, [3] die EU zu einem „Pflanzenfresser“ (Gentiloni), sprich einer hoffnungslos unterlegenen, harmlosen Macht, die sich keinen Respekt bei ihren mächtigen Rivalen verschaffen kann. Dieses Programm muss die EU unter Einsatz ihrer Kreditmacht forciert vorantreiben. Es besteht aus zwei Hauptbestandteilen:
a) Imperialismus zivil: ein „Green Deal“ zur Besetzung des Weltmarktes
Die Macher Europas befinden einen kompletten Umbau der Energiepolitik für nötig. Die EU will sich zu einem führenden Subjekt auf dem Weltenergiemarkt machen, indem sie schwerpunktmäßig auf die industrielle Erzeugung von Energie durch heimische Energiekapitale in und für Europa setzt. Dafür wird die Entwicklung der entsprechenden Technologie subventioniert und die europäische Energiewirtschaft teils radikal erneuert, teils komplett in Richtung grüne Wasserstofferzeugung umgestaltet, also eine ganz neue Geschäftssphäre gestiftet samt umfangreichen Investitionen in die Schaffung der dafür nötigen Hafenanlagen, Pipelines, Netze, Speicherkapazitäten usw. Des Weiteren will die EU sich mit der Förderung entsprechender Infrastruktur die nähere und weitere Staatenwelt in Afrika und Asien als Zuliefer- und Transitländer ökonomisch wie politisch zuordnen, um diese für das kapitalistische Wachstum auf ihrem Binnenmarkt so entscheidenden Lieferketten unter ihrer Kontrolle zu haben.
Diese Transformation betreibt die EU zugleich als Voraussetzung für eine „grüne“ Umrüstung der energetischen wie technologischen Grundlagen der industriellen Produktion in der EU,[4] mit der sie den europäischen Standort hin zur Erzeugung von grünem Stahl, Aluminium, E-Autos etc. umwälzt und ihn mit den entsprechenden rechtlichen Regelungen und Subventionen gleichzeitig zu dem dazu passenden gewinnträchtigen Zuliefer- und Absatzmarkt herrichtet. Dabei verfolgt sie ein Ziel, nämlich als „Global Player“ in Sachen „Green Deal“ gegen China und gegen die USA die Maßstäbe für kapitalistische Produktivität in diesen Geschäftssphären zu setzen und das Weltmarktgeschäft maßgeblich zu dominieren:
„Mit der Offshore-Windkraft haben wir gezeigt, dass wir bei sauberen Technologien weltweit führend sein können. Das müssen wir nun auch in anderen strategischen Sektoren wie Solar, Wasserstoff, Batterien und Halbleiter tun. Die EU muss bei diesen Innovationen an vorderster Front bleiben, wenn sie ein globaler industrieller Akteur bleiben will.“ (Rede von P. Gentiloni, a.a.O)
Allein für den „grünen Wandel“ will die Kommission jährlich zusätzliche Investitionen von über 700 Mrd. Euro mobilisieren.
Komplementär dazu treibt die EU unter dem Stichwort „Digitalisierung“ die Entwicklung der KI-Sparte voran, die sie – über die Bereitstellung ihres Rohstoffs in Form von riesigen Datenmengen und ihrer Speicherung – von der Rationalisierung der industriellen Produktion über die Automatisierung von Funktionen der politischen Herrschaft bis hin zur Perfektionierung der Kriegführung zu ihrer neuen, global wirksamen profitträchtigen Waffe machen will. Ziel der europäischen KI-Strategie ist es,
„die EU zu einem Drehkreuz von Weltrang für KI zu machen... Im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität stehen 134 Mrd. EUR für digitale Geräte zur Verfügung. Dies wird ein Wendepunkt sein, der es Europa ermöglicht, seine Ambitionen zu verstärken und weltweit führend bei der Entwicklung modernster, vertrauenswürdiger KI zu werden.“ (Europäische Kommission, Gestaltung der digitalen Zukunft Europas) [5]
Dies also ist die Ambition, die Europas ziviler Imperialismus verfolgt: Am Vorhaben einer Umwälzung der energetischen Grundlagen des Weltkapitalismus und der darauf gegründeten Industrien will die EU nicht nur teilhaben, sondern sie will die Konkurrenz bestimmen, in die sie mit Weltwirtschaftsmächten vom Schlage der USA und Chinas eintritt.
b) Imperialismus militärisch: Aufwuchs zu autonomer Kriegsfähigkeit
„Angesichts der weltweiten Instabilität, des strategischen Wettbewerbs und der Sicherheitsbedrohungen betont der Europäische Rat, wie wichtig es ist, die europäische Sicherheit und Verteidigung im Hinblick auf eine ehrgeizige geopolitische Union zu stärken. Die Union muss mehr Verantwortung für ihre eigene Sicherheit und Verteidigung übernehmen, eine strategische Vorgehensweise verfolgen und ihre Fähigkeit zum autonomen Handeln verbessern.“ („Schlussfolgerungen der Tagung des Europäischen Rates vom 14. und 15. Dezember 2023“)
Der Ukraine-Krieg hat den europäischen Staatenlenkern deutlich vor Augen geführt, wie sehr die Verteidigung der „europäischen Friedensordnung“ per Stellvertreterkrieg in der Ukraine, also die durchzusetzende Unterordnung der strategischen Macht Russlands, auf die militärischen Fähigkeiten und den Willen der amerikanischen Weltmacht angewiesen ist. Gerade darum konkurrieren sie nicht nur im NATO-Bündnis um Sonderbeziehungen zu den USA, sondern betreiben zugleich das Ziel, als „ehrgeizige geopolitische Union“ ihre Abhängigkeit von den Gewaltpotenzen der USA zu vermindern. Ihre Union – das Kollektiv imperialistischer Nationen, die sich, jede für sich, zu klein wissen, um den globalen „strategischen Wettbewerb“ aufnehmen zu können – müssen und wollen sie entsprechend aufrüsten, um auf militärischem Gebiet eigene imperialistische Zurechnungsfähigkeit zu erwerben. Zwar bleiben ihre Errungenschaften in Sachen gemeinschaftliche kriegerische Gewalt regelmäßig hinter ihrer Anspruchshaltung zurück – schließlich berührt die Vergemeinschaftung des Militärs den Kern der nationalen Souveränität der Mitgliedstaaten. Aber spätestens seit in den USA eine zweite Präsidentschaft von Donald Trump droht, macht sich für die EU-Instanzen und vor allem ihre beiden Führungsmächte das Desiderat dringlich bemerkbar, als Union „mehr Verantwortung für ihre eigene Sicherheit und Verteidigung“ übernehmen zu können und „ihre Fähigkeit zum autonomen Handeln“ durchgreifend zu optimieren. Dies betrifft die ganze Bandbreite moderner Gewaltmittel, die Sicherstellung ihrer „Interoperabilität“ im Rahmen des Bündnisses, die Ertüchtigung der kontinentalen Rüstungsindustrie – und die Finanzierung der entsprechenden Unternehmungen über den Rahmen der einzelstaatlichen Verteidigungshaushalte hinaus. In allen Bereichen hat es die EU zu einer ansehnlichen Liste von praktisch verfolgten Projekten gebracht. [6] Diese Anstrengungen kulminieren derzeit in dem Vorhaben,
„rasch eine Strategie für die europäische Verteidigungsindustrie (EDIS), einschließlich eines Programms für Europäische Verteidigungsinvestitionen (EDIP), vorzulegen, da es notwendig ist, die technologische und industrielle Basis der europäischen Verteidigung zu stärken und sie innovativer, wettbewerbsfähiger und widerstandsfähiger zu gestalten.“ („Schlussfolgerungen der Tagung des Europäischen Rates vom 14. und 15. Dezember 2023“)
Daran arbeitet energisch der zuständige EU-Binnenmarkt-Kommissar Breton. „Langfristig, so Breton, sollte die EU 100 Milliarden Euro investieren, um die Industrie der Union auf ‚Kriegskurs‘ zu bringen.“ (euractiv.de, 11.1.24) Zur Finanzierung kursiert „eine Idee, dafür gemeinsame Schulden, sogenannte Verteidigungs-Bonds, aufzunehmen“ (NZZ Global Pro, 11.1.24). Und als prominenter Unterstützer dieser „Idee“ hat sich der französische Präsident exponiert, der am 17. Januar beim Weltwirtschaftsforum in Davos erklärte, „auch erneute gemeinsame Verschuldung zur Stärkung der Verteidigung sei eine Option“ (euractiv.de, 17.1.24). Dazu sei Europa sehr wohl in der Lage, wenn es „selbst auferlegte Blockaden“ überwinde. Der notorische Vordenker eines wirksamen Europa-eigenen Imperialismus lässt wissen: Wenn Europa aus eigener Kraft nicht imstande ist, amerikanische Kriegsleistungen zu ersetzen – dann heißt das alles andere, als seinen imperialistischen Ehrgeiz zurückzufahren; dann ist das vielmehr ein nicht zu ignorierender Weckruf für viel mehr ganz Europa-eigene Militanz. Und die darf an der Frage der Finanzierung nicht scheitern – wofür hat Europa schließlich seine ökonomische Macht?
***
Diese „neuen Investitions- und Reformziele“ der EU will der Rat mit seiner Neufassung des Stabilitäts- und Wachstumspakts „unterstützen“: ein qualitativ wie quantitativ neues Investitionsprogramm in die imperialistische Zukunft der EU, das sich die EU als Weltmacht schuldig ist. Dafür setzt die EU ihre Kreditmacht ein und nimmt dabei Maß an dem, was sich die mächtigen Rivalen ihrerseits für ihre energie- und industriepolitische Weltmarktoffensive und die ständige Perfektionierung ihrer militärischen Abschreckungsmacht an Kredit leisten. Dabei – zumindest auf dem Feld der zivil-ökonomischen Konkurrenz traut sich die EU das schon zu – muss sie ihnen immer den entscheidenden Schritt voraus sein, den es braucht, um eine autonom agierende Macht zu werden. Die Umsetzung ihres Programms muss also ihre Kreditmacht so stärken, dass sie als Quelle ihrer Machtentfaltung erhalten bleibt und das vereinte Europa zu „anhaltend hohen Investitionen“, also einer permanenten Kreditausweitung in der Lage ist.
2. Ein rundum erneuerter Pakt für Wachstum, kombiniert mit Stabilität
Dashochgesteckte imperialistische Programm der europäischen Staaten will finanziert sein. Also brauchen sie jede Menge Kredit. In erster Instanz gehen sie davon aus, dass sie, gestützt auf den Weltgeldrang ihrer gemeinsamen Währung, die Potenz zum Schuldenmachen haben. Sie sind sich aber auch bewusst, dass ihr Block mit kapitalistischen Weltmächten Marke Amerika und China und deren Kreditmacht konkurrieren muss; dass also ihre Inanspruchnahme der Finanzmärkte – der Instanz der vergleichenden Bewertung der global gehandelten Währungen – jedenfalls nicht zu dem Resultat führen darf, dass der Euro, der Geldausdruck ihrer Wachstumserfolge oder -misserfolge, in seiner Werthaltigkeit Schaden nimmt, an „Stabilität“ einbüßt.
Die EU-Länder haben sich deshalb bei ihrer schließlich erfolgten Einigung auf eine Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts darauf verständigt, diesen Pakt so auszugestalten, dass er „Wachstum“ und „Stabilität“ in einer Weise neu kombiniert, die ihn für die Herausforderungen, die der europäische Block zu bewältigen hat, zum Hebel machen soll:
„Der Rat einigte sich auf das übergeordnete Ziel dieses Rahmens, nämlich Schuldenstände und Defizite schrittweise, auf realistische, nachhaltige und wachstumsfreundliche Weise zu senkenund gleichzeitig Reformen und Investitionen in strategischen Bereichen wie Digitales, Umwelt, Soziales oder Verteidigung zu schützen... Die überarbeiteten Haushaltsregeln werden auch dazu beitragen, gemeinsame mittel- und langfristige politische Ziele zu erreichen, wie etwa den digitalen und den grünen Wandel gerecht zu gestalten, die Energieversorgungssicherheit zu gewährleisten, eine offene strategische Autonomie zu fördern, den demografischen Wandel zu bewältigen, die soziale und wirtschaftliche Resilienz sowie eine dauerhafte Konvergenz zu stärken und den Strategischen Kompass für Sicherheit und Verteidigung umzusetzen.“ (Pressemitteilung des Rats der EU vom 21.12.23)
Erkennbar grenzt sich die Neufassung des Pakts ab von dessen Handhabung während der Finanzkrise des vergangenen Jahrzehnts, als zwecks Rettung der europäischen Gemeinschaftswährung solchen Staaten wie Griechenland die Schrumpfung ihres nationalen Kapitalismus auf das Level aufgezwungen wurde, das die Finanzmärkte für die betroffenen Standorte bloß noch für angemessen hielten. Schon der Satz der Pressemitteilung, der von einem fälligen Abbau von „Schuldenständen und Defiziten“ handelt, legt den Akzent darauf („schrittweise, realistisch, nachhaltig“), die betreffenden Standorte mit der Reduzierung ihrer Schuldenstände in ihrer kapitalistischen Leistungsfähigkeit nicht zu überfordern. Und mit einem „und gleichzeitig“ leitet der Rat der EU dazu über, dass die Bearbeitung der nationalen Defizite auf keinen Fall die Zielsetzung konterkarieren soll, dass alle EU-Mitglieder als Beiträger zu den großen imperialistischen Vorhaben der EU vorgesehen sind und in dieser Eigenschaft nicht durch übertrieben restriktive Pakt-Regeln behindert werden sollen. Im Gegenteil: „Die überarbeiteten Haushaltsregeln werden auch dazu beitragen, gemeinsame mittel- und langfristige politische Ziele zu erreichen“ – sind also nunmehr explizit dafür gedacht, als Mittel und nicht als Hemmnis für „das übergeordnete Ziel“ zu wirken, Europa zu einem nicht zu übergehenden Mit-Subjekt des Imperialismus in seinem gegenwärtigen Stadium zu entwickeln.
Dafür will der Rat die Kontroll- und Einwirkungsrechte auf das Finanzgebaren der autonom agierenden nationalen Haushälter produktiv machen, über die die EU (genauer: die Kommission als supranationale Behörde) mit dem Stabilitäts- und Wachstumspakt verfügt. Diese Aufsichtsbefugnisse sollen zum Einsatz kommen – aber eben nicht wie seinerzeit als Diktat zum Standort-Offenbarungseid von Staaten, die in der Konkurrenz auf dem europäischen Binnenmarkt gescheitert sind, sondern unter gegenteiligem Vorzeichen: Im Lichte
„neuer gemeinsamer Investitions- und Reformziele reformiert die EU derzeit den Stabilitäts- und Wachstumspakt und prüft, wie die Wirksamkeit des Pakts weiter verbessert werden könnte.“ (Pressemitteilung des Rats der EU vom 21.12.23)
Insgesamt also eine Verbesserung der „Wirksamkeit des Pakts“ ganz im Geiste dessen, dass die EU sich als Erfolgsbedingung im Ringen mit ihren weltmächtigen Kontrahenten den Gesamterfolg des europäischen Blocks auf die Fahnen geschrieben hat, um eine rundum imperialistisch zurechnungsfähige Macht zu werden, kurz: „geeint und ehrgeizig“ (Gentiloni) agieren zu können.
Entsprechend kreativ sehen die neuen Regeln des Stabilitäts- und Wachstumspakts aus.
3. Kreative Regeln für die Freisetzung des Schuldenmachens durch kontrollierte Stabilität
Für die Durchführung des Imperativs, dass die Schuldenregeln für die einzelnen Mitgliedsländer realisierbar sein müssen, als Bedingung dafür, dass das Kreditgeld solide bleibt für die Umsetzung der imperialistischen Ambitionen der EU, handelt die Kommission auf Basis von Kennziffern mit den einzelnen Ländern einen individuellen „Schuldenabbaupfad“ aus, den sie ganz an die jeweilige Lage [7] der verschuldeten Mitgliedsländer anpasst:
„Die EU-Kommission handelt diesen Pfad [=Schuldenabbaupfad] mit den hoch verschuldeten Ländern jeweils individuell aus. Außerdem wird der Pfad längerfristig – auf vier bis sieben Jahre – angelegt. In die nationalen Pläne sollen Haushalts-, Reform- und Investitionsziele zusammen eingehen. Wenn die Länder Reformen – nicht zuletzt Investitionen in die grüne und digitale Transformation – nachweisen, werden ihnen diese angerechnet. Zudem orientiert sich die Analyse der Haushaltspolitik am Kriterium der Schuldentragfähigkeit. Das erlaubt flexible, von der Konjunktur-, Zins- und Inflationsentwicklung abhängige Vorgaben.“ (faz.net, 22.12.23)
Das bisherige Aufsichtsinstrument über die Verschuldung der nationalen Haushalte, die Vorschrift eines gemäß den Stabilitätskriterien verbindlich festgeschriebenen Defizitabbaus, überführt der Rat in einen Weg hin zum Schuldenabbau. Dieser „Schuldenabbaupfad“ legt als gemeinsames Ergebnis von Kommission und betroffenen Ländern die Modalitäten und die Verwendung der nationalen Staatsverschuldung fest und berücksichtigt dabei auch einen ihrer jeweiligen „Schuldentragfähigkeit“ angemessenen und daher sehr begrenzten Schuldenabbau. Er ist also eine Öffnungsklausel für die in den nächsten Jahren dringend erforderliche Kreditausweitung für die „Reform- und Investitionsziele“, die deshalb konsequenterweise flankiert wird durch die „längerfristige Anlage“ des Pfads, sprich zeitliche Streckung des Schuldenabbaus.
Oberste Prämisse für die Haushaltspolitik hoch verschuldeter Staaten ist damit der Sache nach die ihnen durch das Herausrechnen von bestimmten Schulden aus der Schuldenbilanz erteilte Lizenz zum Schuldenmachen. An diese Lizenz knüpft der Rat Bedingungen, die auf die Produktivität dieser Schulden im Sinne der hochgesteckten „Reform- und Investitionsziele“ des europäischen Blocks hinwirken.
Erstens zählen Schulden für die „Reformen“, die die Union sich verordnet hat,nicht zu den anzurechnenden Schulden, weil der Zweck in diesem Fall unbedingt das Mittel heiligt: Schulden mit diesem Bestimmungszweck dürfen nicht nur, sondern sollen und müssen auch unbedingt für die imperialistischen Ambitionen der EU sein, sind nämlich notwendige Investitionen in das anspruchsvolle Projekt der Realisierung der europäischen Zeitenwende und dienen so per definitionem des renovierten Pakts der Solidität des europäischen Schuldenmachens. [8] De facto zieht der Rat damit den Kern des bisher gültigen Stabilitäts- und Wachstumspakts, die Bindung der nationalen Kreditschöpfung an das bisher erbrachte Wirtschaftswachstum in Gestalt des BIP, aus dem Verkehr als unproduktive Fessel für das Wofür ihrer Freisetzung: die zwei großen imperialistischen Vorhaben der EU.
Zweitens zählt deshalb zu den „gemeinsamen Prioritäten der Union“, deren Umsetzung in den nationalen mittelfristigen Strukturplänen darzulegen ist, ab sofort auch der erforderliche Aufbau von Verteidigungskapazitäten. [9] Die Staatsverschuldung für den Rüstungsetat ist dementsprechend bei der Beurteilung des Defizits als unabdingbare Investition in die militärische Stärkung der Union zu berücksichtigen und konsequenterweise aus der Berechnung der Schuldenquote herauszunehmen. [10]
Drittens geht es der EU um „flexible, von der Konjunktur-, Zins- und Inflationsentwicklung abhängige Vorgaben“ beim Schuldenabbau, mit denen die EU der „Heterogenität“ ihrer Mitgliedstaaten Rechnung trägt und deren jeweilige Haushaltslage resp. die spezifischen Haushaltsnöte der Mitgliedstaaten als mildernde Umstände beim Defizitabbau berücksichtigt. Eine Ausweitung der nationalen Verschuldung für die Bewältigung eines wirtschaftlichen Rückgangs, einer steigenden Inflation sowie für den wachsenden Schuldendienst wg. höherer Zinsen stuft der Rat – im Kontrast zu früher üblichen Auslegungen des Pakts – nicht mehr als selbst verschuldete Krise, sondern als Reaktion auf eine objektive Notlage ein, mit der die Partner fertigwerden müssen und sollen – um ihre „Schuldentragfähigkeit“ zu sichern für die Kreditausweitung, auf die es dem Rat im Sinne seiner neuen Kombination von Wachstum und Stabilität ankommt.
Für den Fall, dass ein Staat am Ende doch die Defizitgrenze reißt – ein Fall, mit dem der Rat sicher rechnet – folgen auch die dafür vorgesehenen Verfahren zur Durchsetzung dieser Grenzen bis hin zu dem Beschluss möglicher Sanktionen ganz der Logik der Reform:
„Der Rat hat die Regeln für das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit insofern beibehalten, als bei der Einleitung des Defizitverfahrens auf der Grundlage des Defizitkriteriums der Nettoausgaben-Korrekturpfad mit einer jährlichen strukturellen Mindestanpassung von mindestens 0,5 % des BIP vereinbar sein sollte. Allerdings hat der Rat auch beschlossen, dass die Kommission während eines Übergangszeitraums in den Jahren 2025, 2026 und 2027 bei der Berechnung der Anpassungsanstrengungen im Rahmen des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit den Anstieg der Zinszahlungen berücksichtigen kann.“ (Pressemitteilung des Rats der EU vom 21.12.23)
Die dann avisierte „Mindestanpassung“ zum Schuldenabbau muss so gering wie möglich sein, wobei „bei der Berechnung der Anpassungsanstrengungen“ vor allem der Haupttreiber für übermäßige Defizite, die steigenden Zinskosten, herausgerechnet gehört: ein gemeinschaftliches Bekenntnis dazu – und darin ein deutliches Signal an die Finanzmärkte –, dass die Bedienung wachsender Zinszahlungen seitens des Rats und der Kommission nicht als Ausweis eines unsoliden Finanzgebarens gewertet wird. Dies gilt insbesondere für die am höchsten verschuldeten Staaten wie Italien und Frankreich:
„Für Länder, die derzeit hohe Defizite aufweisen, gilt jedoch eine vorübergehende Bestimmung, nach der die jüngsten Erhöhungen der Kreditkosten nicht auf das strukturelle Defizit angerechnet werden. Dies verschafft Ländern wie Frankreich und Italien, die in diesem Jahr vermutlich ein Defizitverfahren durchlaufen müssen, kurzfristig etwas mehr finanziellen Spielraum.“ (euractiv.de, 21.12.23)
Zu wichtig ist die Bedeutung dieser beiden ökonomischen und militärischen Schwergewichte für die Durchsetzung des imperialistischen Programms der EU sowie die Werthaltigkeit des Geldes, die sich aus dieser projektierten Machtentfaltung speist, als dass deren finanzielle Handlungsfreiheit beschränkt werden dürfte.
Seiner Logik bleibt der Rat auch für den unwahrscheinlichen Extremfall, die Verhängung von Sanktionen bei Nichteinhaltung der Regeln, treu:
„Der Rat kam überein,dass sich die Geldbuße im Falle der Nichteinhaltung auf bis zu 0,05 % des BIP belaufen soll und alle sechs Monate bis zur Ergreifung wirksamer Maßnahmen akkumuliert wird.“ (Pressemitteilung des Rats der EU vom 21.12.23)
Auch hier gilt: Mit Sanktionen belegte Staaten müssen sich an die Sanktionen auch halten können, mögliche Strafzahlungen tendieren daher sachgerecht gegen Null. So wird dem Paradox des bisherigen Pakts Rechnung getragen, dass Staaten mit Zahlungsschwierigkeiten auch noch mit finanziellen Strafen belegt werden.
Die europäische Zeitenwende verzichtet also nicht auf das Aufsichts- und Kontrollregime über die nationale Haushaltsgestaltung. Ihre Macher polen dieses Regime jedoch konsequent um: Beaufsichtigt, kontrolliert und mit Unterstützung versehen wird die Rolle, die für die Mitgliedstaaten heute vorgesehen ist – als Beiträger zum imperialistischen Aufbruch, den der europäische Block unternimmt.
***
Die Macher des europäischen Blocks gratulieren sich selber: Sie haben einen rundum „guten Kompromiss“ zwischen Wachstum und Stabilität, ein Regelwerk, das „realistischer und wirksamer zugleich“ (Christian Lindner) ist als sein Vorläufer, zustande gebracht – und damit zur Linie des vereinten Europa gemacht: Die nationalen Haushalte sollen sich langfristig als strategisches Instrument des imperialistischen Erfolgs Europas bewähren. Europas Wirtschafts- und Finanzpolitiker setzen auf den Hebel staatlicher Verschuldung für die Herbeiführung eines Wachstums, das die Schulden als kapitalistisch gültigen Reichtum bestätigt. Für diesen politökonomischen Zirkel setzen sie auf die Kreditmacht, die die EU ausweislich der Qualität ihrer Welt- und Reservewährung Euro schon besitzt. Und diesen Besitzstand, den sie sich zurechnen, rechnen sie hoch: Sie halten ihr Vorhaben für erfolgsträchtig, so dass die Umsetzung ihres per Staatskredit angestoßenen Programms für die Durchsetzung in der globalen Konkurrenz erfolgreich genug ist, um den projektierten geschäftlichen wie militärischen Machtzuwachs zu erbringen. Sie rechnen damit, dass dieses Programm auf diese Weise das positive Interesse der global engagierten Finanzmärkte auf sich zieht und so die europäische Kreditmacht stärkt, damit diese als Quelle europäischer Machtentfaltung weiterhin und noch besser fungiert. Dass der europäische Kredit als diese Quelle strapaziert wird, soll sein kapitalistisches Gütesiegel sein und nicht seine Gefährdung. Dies die aktuelle Fassung des Verhältnisses von Wachstum und Stabilität, mit dem Europas Standorthüter auf die Welt losgehen: Sie spekulieren darauf, dass die weltweiten Finanzspekulanten Europas anspruchsvoller Perspektive recht geben, in Sachen Geschäft und Gewalt zu deren heutigen Vormächten aufzuschließen.
[1] Die sogenannte präventive Komponente des dreiteiligen Gesetzgebungspakets zum Stabilitäts- und Wachstumspakt bedarf der Zustimmung des Europäischen Parlaments. Vertreter von Rat, Europaparlament und Kommission haben sich inzwischen auf einen leicht ergänzten Kompromisstext geeinigt. (FAZ, 12.2.24) Mit der endgültigen Zustimmung von Rat und Europaparlament wird allgemein gerechnet.
[2] Diese Regelungen hatte die EU zwecks der wirtschaftspolitischen Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise im Mai 2020 de facto ausgesetzt und ihren Mitgliedstaaten erlaubt, sich über das bisher gültige Maß zu verschulden.
[3] „Das Risiko der Standortverlagerung wird durch die Bemühungen anderer Länder verstärkt, unsere Unternehmen nicht nur mit niedrigeren Energiepreisen, sondern auch mit einer Vielzahl anderer Anreize anzuziehen. Und das erleben wir jetzt vor allem im Bereich der sauberen Technologien mit dem Inflation Reduction Act der USA. Der grüne und der digitale Wandel machen auch deutlich, wie abhängig wir von importierten Rohstoffen und Schlüsseltechnologien sind, wobei die Lieferketten überwiegend von China dominiert werden. Wir stehen also vor einer dreifachen Herausforderung für unsere Wettbewerbsfähigkeit: hohe Energiepreise, die Industriepolitik anderer Länder und der Zugang zu wichtigen Rohstoffen und Technologien.“ (Rede von P. Gentiloni, a.a.O.)
[4] Die bekannten Förderprogramme des „Green Deal“ sind NextGenerationEU, Horizon Europe, der EU-Innovationsfonds für Unternehmen, die auf die Nutzung erneuerbarer Energiequellen umstellen – um nur die wichtigsten zu nennen.
[5] Daneben existieren weitere Finanzierungsprogramme wie das „KI-Innovationspaket zur Unterstützung von Startups und KMU im Bereich künstliche Intelligenz“ (Januar 2024), spezielle Förderprogramme für die Halbleiterforschung und -innovation usw.
[6] Dafür hat die EU 2017 die „Europäische Ständige Strukturierte Zusammenarbeit“ (PESCO) gegründet. Darüber hinaus gibt es inzwischen: den „Europäischen Verteidigungsfonds“ (EVF), der für 2021 bis 2027 mit 8 Mrd. € bestückt ist; die „Europäische Friedensfazilität“ (EFF), ursprünglich für denselben Zeitraum mit 5,7 Mrd. € ausgestattet, dann für die Ukraine aufgestockt; die „Verordnung des Europäischen Parlamentes und des Rates zur Förderung der Munitionsproduktion“ (ASAP); das „Instrument zur Stärkung der Europäischen Verteidigungsindustrie durch Gemeinsame Beschaffung“ (EDIRPA); die „Plattform für strategische Technologien für Europa“ (STEP). (Auszugsweise aus Telepolis, 14.1.24)
[7] „Eine wesentliche Neuerung im Rahmen der Reform ist der vorgesehene differenzierte Ansatz gegenüber den einzelnen Mitgliedstaaten, um der Heterogenität innerhalb der EU bezüglich der Haushaltslagen, Schuldenstände und wirtschaftlichen Herausforderungen Rechnung zu tragen. So wird der neue Rahmen mehrjährige länderspezifische haushaltspolitische Zielpfade für jeden Mitgliedstaat ermöglichen und dabei zugleich eine wirksame multilaterale Überwachung gewährleisten und den Grundsatz der Gleichbehandlung wahren. Jeder Mitgliedstaat wird einen mittelfristigen strukturellen finanzpolitischen Plan für einen Zeitraum von vier oder fünf Jahren erstellen, mit dem er sich zu einem haushaltspolitischen Zielpfad sowie zu öffentlichen Investitionen und Reformen verpflichtet, die zusammen einen anhaltenden schrittweisen Schuldenabbau und ein nachhaltiges und inklusives Wachstum gewährleisten.“ (Pressemitteilung des Rats der EU vom 21.12.23)
[8] Das europäische Parlament ist hier noch einen Schritt weitergegangen: „Die Parlamentsvertreter setzten aber eine Ausweitung jener Bestimmungen durch, die mehr öffentliche Investitionen in die grüne und digitale Transformation, die Energiesicherheit und in die Rüstung erlauben. Ausnahmen soll es für nationale Ausgaben geben, mit denen EU-Förderprogramme kofinanziert werden.“ (FAZ, 12.2.24)
[9] „In dem nationalen mittelfristigen Finanz- und Strukturplan ist darzulegen, ... wie die folgenden gemeinsamen Prioritäten der Union angegangen werden sollen: (i) ein fairer grüner und digitaler Übergang, einschließlich der Übereinstimmung mit dem europäischen Klimagesetz; (ii) soziale und wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit, einschließlich der europäischen Säule sozialer Rechte; (iii) Energiesicherheit; und (iv) erforderlichenfalls der Aufbau von Verteidigungskapazitäten.“ (Art. 11 Abs. c der Verordnung über die wirksame Koordinierung der Wirtschaftspolitik (Kompromisstext))
[10] „In Anbetracht der zunehmenden geopolitischen Spannungen und sicherheitspolitischen Herausforderungen und der entsprechenden Notwendigkeit für die Mitgliedstaaten, ihre Fähigkeiten auszubauen, sollte der Anstieg der staatlichen Investitionen in die Verteidigung gegebenenfalls als relevanter Faktor bei der Beurteilung des Bestehens eines übermäßigen Defizits gemäß Artikel 126 Absatz 3 AEUV berücksichtigt werden.“ (Änderungsverordnung des Rates über die Beschleunigung und Klärung des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit (korrektiver Teil des SWP-Pakets), Erwägungsgrund 14a)