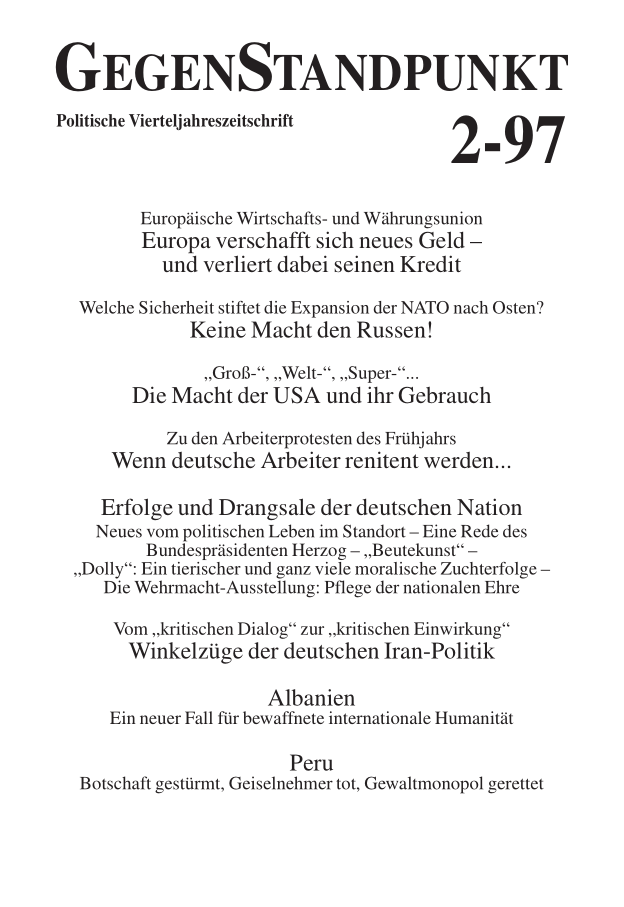„Groß-“, „Welt-“, „Super-“ …
Die Macht der USA und ihr Gebrauch (Teil 1)
Die USA kontrollieren die Ausstattung mit und den Gebrauch von Gewalt aller anderen Souveräne. Mit ihren überlegenen Gewaltmitteln verleihen sie ihrem Anspruch auf amerikafreundlichen und –dienlichen Gewaltgebrauch weltweit Nachdruck. Für ihre Gewaltherrschaft reklamieren sie die Anerkennung als von allen Staaten akzeptiertes oberstes Recht. Dieser Anspruch hat in der UNO die passende diplomatische Form und im Völkerrecht den passenden ideologischen Ausdruck gefunden.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Siehe auch
Systematischer Katalog
Gliederung
- 1. Die Sonderstellung der USA in Sachen Gewalt: In allen Machtfragen engagiert, um sie zu entscheiden
- 2. Der zum Standpunkt verfestigte Anspruch der USA: Weltweites Kontrollregime über den Gebrauch politischer Gewalt
- 3. Mittel und Methoden der USA zur Durchsetzung und Sicherung ihrer globalen Überlegenheit
- 4. Der diplomatische Überbau: Die UNO
- 5. Der ideologische Überbau: Weltpolitik als Rechtspflege und als moralische Veranstaltung
- Ein Zwischenergebnis: Die Macht der USA und ihre materiellen Voraussetzungen
„Groß-“, „Welt-“, „Super-“…
Die Macht der USA und ihr Gebrauch
Teil A. Der globale Gewalthaushalt
In der Staatenwelt der neunziger Jahre kracht es ununterbrochen. Mit der Befreiung der Menschheit von der Geißel des Realen Sozialismus ist trotz aller Verheißungen freiheitlich denkender Kalter Krieger nicht der ewige Friede ausgebrochen. Stattdessen sind jede Menge Friedensprozesse in Gang gekommen. Einerseits deswegen, weil ganz ohne Zutun irgendeiner Sorte Kommunisten so manche bislang respektable Staatsgewalt ihr Haltbarkeitsdatum überschritten hat. In einigen großen und kleinen Nationen sind Abteilungen des Volkes dazu übergegangen, den amtierenden Regierungen die Gefolgschaft zu kündigen. Sie bescheiden sich nicht mit Wahlkampf, sondern stellen das Gewaltmonopol ihres Staates in Frage. Die nationalen Nachlaßverwalter des „Ostblocks“, mehrere afrikanische und lateinamerikanische Staaten beliefern die neue Ära mit Bürgerkriegsszenarien, die nicht nur menschlichen Schrott hervorbringen, mit dem die intakten kapitalistischen Staaten nichts Rechtes anzustellen wissen. Die mehr oder minder blutigen Auseinandersetzungen werfen auch die Frage auf, was für Staaten aus ihnen hervorgehen – mit welchen Interessen die zivilisierten Staaten sich da künftig herumschlagen müssen. Andererseits sind auch die berühmten „offenen Fragen“ zwischen den Nationen nicht verschwunden, so daß an etlichen Stellen Kriege stattfinden bzw. ins Haus stehen. Auch das läßt die Nationen, die über eine funktionierende Hausordnung verfügen und reich sind, nicht kalt – Gewalt zwischen verfeindeten Staaten gilt ihnen, ebenso wie die innere Zerrüttung gewisser Nationen, als Herausforderung erster Klasse, die diplomatische Tugend der „Nicht-Einmischung“ als Laster; und ihre Verantwortung ist groß.
1. Die Sonderstellung der USA in Sachen Gewalt: In allen Machtfragen engagiert, um sie zu entscheiden
Unter den Staaten, die von jeder Veränderung im Gewalthaushalt der Staatenwelt betroffen sind und sich zur Einmischung befugt sehen, gibt es einen Konsens, der in jüngster Zeit häufig ausgesprochen wird. Politiker, namentlich, aber keineswegs nur aus europäischen Hauptstädten, stellen fest, daß „ohne die USA nichts geht“, und betonen, daß sie „in Übereinstimmung“ und „in Absprache mit Washington“ handeln oder zu handeln gedenken. Der Ton, der auch da die Musik macht, liegt manchmal mehr auf dem Bedarf, auf dem Wunsch nach amerikanischer Unterstützung der eigenen Vorhaben; manchmal ist auch das „leider“ nicht zu überhören, das Leiden daran, daß man auf die Billigung der USA angewiesen ist. In jedem Fall bringt das diplomatische Protokoll zum Ausdruck, daß die Weltmacht Amerika nicht zu übergehen ist und allemal ein Interesse an der Sache hat, die man selbst als Nation gerade in Angriff nimmt.
So haben sich die demokratischen Führer der wichtigsten EU-Mächte in der „Jugoslawienfrage“ ausdrücklich von ihrem anfänglich erklärten Standpunkt verabschiedet, die Neuordnung der Staatenwelt auf dem Balkan müsse als innereuropäische Affäre von ihnen allein geregelt werden; als unentbehrliche und am Ende entscheidende Ordnungs- und Garantiemacht waren die USA mit ihren Diplomaten und Soldaten gefragt. Gar nicht erst zuständig gemacht haben sich dieselben führenden Euro-Nationen für die Unterdrückung des immerwährenden Grenzstreits zwischen ihren nächsten Partnern Griechenland und Türkei; diese haben ihren Konflikt mit Blick auf Washington bei Gelegenheit eskaliert und auf amerikanische Machtworte auch wieder gehört. Israel und die Palästinenser setzen für ihre jeweiligen unvereinbaren Sicherheitsinteressen gleich auf Unterstützung und Maßregelung ihres Gegners durch den US-Präsidenten. Und so geht es weiter; rund um den Globus. Mit den vielfältigen „inneren Konflikten“ verhält es sich ebenso: Wenn der algerische Staat eine Machtergreifung seiner islamischen Opposition gewaltsam verhindert, tut er das nicht ohne Rücksprache mit Paris … und, schon wieder, Washington. Und wenn der französische Präsident meint, mit eigenen Truppen in eine an Stammesgrenzen orientierte blutige Fehde in Zentralafrika eingreifen zu müssen, dann bezieht er sich auch mit dieser Entscheidung auf die transatlantische Großmacht – in der Gewißheit, daß die USA vielleicht nicht durch eine weltpolitisch so nebensächliche Schlächterei, durch ein französisches Eingreifen aber auf alle Fälle alarmiert sind und ein Konsens mit ihnen nicht zu vermeiden, also ratsam ist. Und so weiter…[1]
Daß alle Staaten bei allen gewichtigeren Gewaltaktionen ihre Aufmerksamkeit auf Washington richten, hat seinen guten Grund. Die Mitwirkung Amerikas ist sicher, wo immer gewaltträchtige politische Streitfragen eröffnet, fortgewälzt, eskaliert oder beigelegt werden. Eine Einladung, einen Hilferuf oder ähnliches braucht es dafür nicht: Die USA sind grundsätzlich dabei und so engagiert, wie sie es für angezeigt halten. Wenn sie sich in einer Gewaltfrage einmal zurückhalten, die Parteien streiten und sogar andere Mächte eingreifen lassen, so tun sie das aus eigenem, jederzeit widerrufbarem Entschluß – und nicht, weil die Sache sie schlicht nichts anginge. Und wenn sie sich einmischen, dann nie, um sich eine Zurückweisung einzuhandeln: Dann wollen sie die strittige Angelegenheit in dem von ihnen festgelegten Sinn auch entscheiden.
Die Aufzählung einschlägiger Fälle käme einer Chronik der laufenden Ereignisse gleich – vom Golfkrieg bis zum Friedensprozeß in Nordirland; von demjenigen in und um Israel bis zur Befriedung Bosniens; vom Kampf afghanischer Glaubenskrieger bis zu Chinas Gewaltandrohungen gegen Taiwan; von einer Geiselnahme in Peru, die ausnahmsweise nicht einmal US-Bürger betrifft, bis zum Krieg um die Herrschaft über Zaire. Besondere Erwähnung mag Albanien verdienen, weil die USA hier auf den Oberbefehl über eine jener bewaffneten Eingreiftruppen zur Spendenverteilung und Schußwaffenkontrolle, wie sie in der geeinten Welt des grenzenlos siegreichen Kapitalismus offenbar immer häufiger für nötig erachtet werden, verzichten – ohne daß der tatsächlich abwegige Verdacht aufkäme, sie wären durch das italienische Kommando politisch irgendwie ausgeschaltet. Erwähnenswert auch zwei der Fälle, in denen die US-Regierung sich in letzter Zeit für die interne Gewaltanwendung fremder Souveräne zuständig gemacht hat:[2] In Serbien hat sie die unermüdlich und bemerkenswert ungestört demonstrierende Opposition mit nachdrücklichen Warnungen und Embargo-Drohungen gegen die Regierung unter ihren ganz speziellen Schutz gestellt; in China betreut sie Dissidenten – fast wie in alten kommunistischen Zeiten – und macht damit deutlich, daß für das große Land die gewünschte „normale“ Behandlung noch immer eine Konzession ist, die es sich zu verdienen hat. In der eigenen Hemisphäre Amerikas schließlich gibt es Länder, deren innere Konflikte zwischen illegaler und Regierungsmafia sich überhaupt nur dem ordnenden Eingreifen der US-Drogenpolizei verdanken… Worum Amerika sich kümmert, das ist eben damit keine „innere Angelegenheit“ eines fremden Souveräns mehr, der sich „Einmischung“ verbitten könnte.
2. Der zum Standpunkt verfestigte Anspruch der USA: Weltweites Kontrollregime über den Gebrauch politischer Gewalt
Wo immer die USA sich in Gewaltaktionen außerhalb ihrer Staatsgrenzen einmischen, handeln sie nach dem Grundsatz, daß „vor Ort“ eine souveräne Herrschaft ihre Pflicht tun soll. Sie sind nicht als Eroberer unterwegs; auch wo sie gelegentlich fremde Landstriche okkupieren, geht es ihnen nicht darum, dort selbst zu regieren; den Kolonialismus, den sie einst selber praktiziert haben wie die anderen Großmächte, haben sie für sich und alle anderen abgeschafft. Überall sollen nationale Souveräne die Regierungsgeschäfte erledigen; nötigenfalls verschaffen die USA einer von ihnen protegierten Partei ein flächendeckendes Gewaltmonopol oder jedenfalls soviel davon, daß sie zum geschäftsfähigen politischen Gegenüber wird. Ihre Einmischung bezieht sich, das allerdings sehr grundsätzlich, auf den Gebrauch, den staatliche Machthaber – bzw. im Falle eines inneren Konflikts deren aufstrebende Konkurrenten – von der ihnen verfügbaren Gewalt machen: Der muß amerikanischen Vorstellungen entsprechen. Die USA wollen souveräne Gewaltmonopolisten in aller Welt: als handlungs-, nämlich herrschaftsfähige Adressaten eines Anspruchs auf Funktionalität, unter den sie jeden autonomen Machtgebrauch stellen. Sie wollen politische Gewalthaber, die Amerika als übergeordnete „Instanz“ respektieren – gewissermaßen als obersten Lizenzgeber für reguläre Gewaltanwendung.[3]
Den gesamten Rest der Staatenwelt konfrontieren die USA also mit ihrem Standpunkt, als weltweit überlegene politische Gewalt von jeder zwischen- und mancher innerstaatlichen Gewaltanwendung betroffen zu sein. Als Macht mit globalem Kontroll- und Lenkungsanspruch mischen sie sich in alles ein, weil jeder Gewaltgebrauch durch und gegen irgendwelche politischen Hoheitsträger irgendwo die Kräfteverhältnisse verschiebt und schon damit das Kräfteverhältnis tangiert, in dem Amerika zum Rest der Welt steht. Das darf erstens überhaupt nicht verändert werden und zweitens wenn, dann nur zugunsten der USA: Das ist der oberste und letzte Imperativ, den die Weltmacht in ihrem universellen Kontrollbedürfnis geltend macht. Es geht ihr um die Wahrung der Überlegenheit, die es ihr überhaupt gestattet, so anspruchsvoll gegen den Rest der Welt aufzutreten, daß noch die entferntesten Gewaltaktionen in den Umkreis ihres Selbsterhaltungsinteresses fallen.
Wenn sie sich dann zu praktischer Einmischung in auswärtige Angelegenheiten entschließen, dann nehmen die USA natürlich allemal in irgendeiner besonderen Auseinandersetzung für die eine und gegen die andere Seite Partei, sind also insoweit auch selber eine besondere Partei; und außerdem haben ihre Weltpolitiker stets auch selber einen Haufen besonderer und begrenzter nationaler Interessen im Auge, die sie mit ihrer Einmischung fördern. Das eine wie das andere macht aber nicht den Standpunkt ihrer Einmischung aus. Die USA brauchen weder parteiische Gesichtspunkte noch den Reiz eines speziellen materiellen Gewinns, um politische Gewaltanwendung, wo immer sie geschieht, auf sich zu beziehen und sich als mitwirkende, Entscheidungen herbeiführende Partei ins Spiel zu bringen; und sie machen sich auch nicht zum Parteigänger der politischen Absichten, deren Vertreter sie unterstützen. Es ist umgekehrt: Wo Gewalt geübt wird, sehen sie sich zur Mitwirkung herausgefordert. Die politischen Absichten, die sie vorfinden, messen sie an ihrem Kontrollbedürfnis. In dem Sinn, nämlich nach Maßgabe dessen, was ihnen für die Wahrung oder den Ausbau ihrer Überlegenheit im internationalen Kräfteverhältnis erforderlich und zweckmäßig erscheint, nehmen sie Partei und stellen sich die Aufgabe, eine „Lösung“ durchzusetzen, die ihrer Kontrollmacht nützt. Das ist grundsätzlich dann der Fall, wenn sich alle Beteiligten zur Respektierung der amerikanischen Entscheidung gezwungen sehen; sei es aus Berechnung, sei es aus Ohnmacht. Denn sie sollen ja wieder funktionieren: als souveräne Machthaber, die im eigenen Land für eine zuverlässige Herrschaftsordnung sorgen und um sich herum die zwischenstaatliche Ordnung und ihren Platz in der Hierarchie der Mächte einhalten.
Ob dieser Effekt eintritt oder nicht, ist eine andere Frage. Keineswegs gelingt der Weltmacht alles, was sie sich vornimmt; nach eigener Einschätzung und auch nach dem Urteil einer eher mißgünstig gestimmten auswärtigen Weltöffentlichkeit mißlingt ihr sogar enorm viel, jedenfalls mehr als allen anderen Nationen. Diese Bilanz bezeugt aber vor allem anderen erst einmal das enorme Anspruchsniveau, mit dem die USA auf den Rest der Staatenwelt losgehen.
So hat der Vietnamkrieg ein angeblich noch immer nachwirkendes „nationales Trauma“ hinterlassen, weil die vielen Opfer auf amerikanischer Seite nicht durch die bedingungslose Kapitulation des eigentlich gar nicht gleichwertigen Gegners belohnt worden sind. Der Krieg gegen den Irak hat zwar so gut wie keine eigenen Opfer gekostet; dafür amtiert der zum neuen Hitler hochstilisierte irakische Diktator noch und gebietet sogar über einen Rest militärischer Macht, den die siegreiche Allianz ihm abzunehmen versäumt hat. Im Chaos Somalias haben die US-Streitkräfte mit all ihrer Waffenpracht überhaupt keine staatliche Ordnung hingekriegt und nicht einmal ersatzweise den zum Hauptfeind erwählten Clan-Chef verhaftet; so war schon ein toter Soldat zuviel und ein Abzug fällig, der den Fehlschlag eingestanden, aber wenigstens in Grenzen gehalten hat. Wo die USA nicht militärisch interveniert haben, steht es erst recht nicht besser: Auf Kuba hält sich gegen ihren erklärten Willen der letzte Drittwelt-Kommunist an der Macht. Indien tritt trotz amerikanischem Druck dem Atomwaffensperrvertrag nicht bei. Die chinesische Regierung behandelt ihre demokratischen Dissidenten schlechter, als Kongreß und Präsident in Washington es ihnen erlauben möchten. Und so weiter…
So gesehen scheitern die USA fortwährend. Aber womit?
- In ihre Beziehungen zur mächtigsten Nation Asiens bauen sie einen Vorbehalt ein, der – ganz gleich, was er sonst noch praktisch bewirken mag – Amerikas Anspruch klarstellt, Zulassungsbedingungen für die Teilnahme von Staaten am weltpolitischen Geschäftsverkehr aufzustellen; Bedingungen, die, indem sie den internen Machtgebrauch der Staatsmacht betreffen, deren Legitimation prinzipiell in Frage stellen und amerikanischem Urteil unterwerfen. Es geht also überhaupt nicht um eine regelbare „Sachfrage“ des politischen Umgangs miteinander – geschweige denn mit ein paar Oppositionellen –, sondern um die Grundsatzfrage, ob die chinesische Regierung sich einer amerikanischen Entscheidung über ihren souveränen Gewaltgebrauch beugt. In dieser Frage sind die USA gescheitert – mit dem Ideal, ein ernster Wink aus Washington würde genügen.
- Der anderen asiatischen Großmacht, die nie auf der falschen Seite im 40-jährigen Kalten Weltkrieg gestanden, eine gewisse amerikanische Oberaufsicht vielmehr immer respektiert hat und deswegen auch nicht mit Vorbehalten gegen die Legitimität ihrer Herrschaft konfrontiert wird, enthalten die USA den Status der anerkannten Atomwaffenmacht vor – den China sich immerhin errungen hat! – und machen damit zwar kein wirkliches Atomwaffenmonopol mehr geltend, immerhin aber ihre Kompetenz, maßgeblich über das Waffenarsenal zu befinden, mit dem ein so großer Staat wie Indien drohen und sich in seiner Umgebung Respekt verschaffen kann.
- Mit Fidel Castro werden die USA deswegen nicht fertig, weil sie ihn einerseits bedingungslos los werden wollen, seine Beseitigung ihnen andererseits keinen Krieg – mehr – wert ist. Denn erobern wollen sie seine Insel ja gar nicht; irgendein Arrangement mit dem alten Feind wollen sie aber genausowenig. Es geht ihnen gar nicht darum, Kuba zu einer entgegenkommenderen Politik zu bewegen, sondern um das Prinzip, gegen das dieser Staat verstoßen hat: Amerikas alleinige strikte Kontrolle über die politischen Verhältnisse in seiner Umgebung. Sie behandeln diesen Kontrollanspruch wie ein höchstes Recht, dessen Verletzung Unversöhnlichkeit begründet und allenfalls durch die in aller Form abgelieferte Kapitulation des Gegners wiedergutzumachen wäre.
- Die Unzufriedenheit der USA mit dem Ergebnis, das sie im Irak zustandegebracht haben, ist von gleicher Art. Ihre nachträgliche Selbstkritik, Saddam Hussein nicht vollends entmachtet und ersetzt zu haben, mißt die tatsächliche Zerstörung und Fesselung der irakischen Macht an dem tatsächlich nicht verwirklichten Wunsch, die dortige Staatsgewalt mitsamt ihrem souveränen Repräsentanten komplett auf die Anerkennung amerikanischer Oberhoheit als neue Staatsräson festzulegen: Die Machthaber, die das Land wirksam im Griff haben, verweigern eine für Amerika befriedigende Unterwerfung – wie immer die aussehen könnte; politische Kräfte, die sich dafür hergeben würden, sind schwer zu finden und kaum von der Art, daß die USA ihnen die effektive Beherrschung des Landes zutrauen und anvertrauen könnten; und das irakische Elend selber zu regieren, ist definitiv nicht amerikanisches Programm.
- Ebensowenig wie eine Kolonisierung Somalias: Die US-Intervention dort ist daran gescheitert, daß ein nationaler Souverän, der seine politische Macht in Respekt vor amerikanischen Direktiven hätte ausüben können, nicht existierte und durch Schutztruppen für eine nicht existierende Ordnung auch nicht herzukriegen war.
- Was schließlich den Vietnamkrieg betrifft,[4] der noch in ein anderes Zeitalter, nämlich das der durch die Sowjetmacht gebrochenen amerikanischen Weltmacht gehört, so haben die USA am Ende zweifellos eine militärische Niederlage hingenommen. Wenn es für die politische Würdigung ihres Abzugs im Rückblick aber gar keine Rolle spielt, daß die USA immerhin ihr Ziel erreicht haben, „den Kommunismus“ in seinem befürchteten Vormarsch zu stoppen, so daß das zerbombte Vietnam selbst ihnen am Ende keinen Krieg mehr wert war, und daß sie aus dieser Kalkulation heraus ihren zur Selbstbehauptung unfähigen südvietnamesischen Verbündeten preisgegeben und den „Siegern“ nichts als ein gründlich verwüstetes Schlachtfeld hinterlassen haben: wenn das alles nichts weiter zählt, dann liegt die Meßlatte recht hoch. Dann bemißt sich die amerikanische Unzufriedenheit nämlich an dem auch damals schon gültigen Ideal, mit einem überschaubaren und begrenzten Militäreinsatz müßte sich auch in diesem Land eine Herrschaft etablieren lassen, die Amerika den doppelten Dienst erbringt: bedingungslos ergeben und dabei aus eigener Kraft souverän zu sein.
Die Bilanz der Niederlagen und gescheiterten Projekte, die amerikanische Weltpolitiker aufstellen und die für US-Patrioten immer wieder die Frage aufwirft, ob die Staatenwelt soviel amerikanisches Engagement überhaupt verdient,[5] belehrt also erst einmal nur darüber, was die USA vom Rest der Staatenwelt verlangen – nicht anders als die Liste der Erfolge, die ja durchaus auch verbucht werden, bei der Verwandlung von „Ostblock“-Staaten in anschlußwillige Hinterhöfe der schon seit längerem Freien Welt zum Beispiel: Auch sie verdeutlicht, wie die USA die Welt haben wollen. Nämlich flächendeckend aufgeteilt unter souverän herrschenden nationalen Staatsgewalten, die sich ihren Gewaltgebrauch im Innern und nach außen grundsätzlich durch Amerika genehmigen lassen.
3. Mittel und Methoden der USA zur Durchsetzung und Sicherung ihrer globalen Überlegenheit
Die USA mischen sich mit dem Anspruch auf Kontrolle, genehmigend und verbietend, in den Gewaltgebrauch zwischen den Staaten und nach Bedarf auch in ihnen ein. Gegenüber allen souveränen Gewaltmonopolisten führen sie sich als Führungsmacht auf. Sie machen ihre überlegene Gewalt geltend mit dem einen klaren Ziel, eben diese Überlegenheit zu wahren. Die Mittel, die sie sich für diesen Zweck geschaffen haben und unterhalten, ebenso wie die Methoden ihres Einsatzes bemessen sich an dem damit in die Welt gesetzten Abstandsgebot. Also nicht an den Anstrengungen, die andere Nationen wirklich unternehmen, um ihren Abstand zum weltweit führenden Gewaltmonopolisten zu verringern. Amerikas Überlegenheit verlangt vielmehr, eine wirkliche Herausforderung und praktische Infragestellung seiner Spitzen- und Führungsposition erst gar nicht zuzulassen.
a) Krieg mit überlegenen Mitteln
Die USA rechnen mit der Notwendigkeit, ihre Kontrolle über die staatliche Gewalt in den Händen fremder Souveräne, ihren Generalvorbehalt gegen deren Anwendung gewaltsam durchzusetzen. Sie unterhalten daher eine Militärmacht, die ihr Maß in dem Auftrag hat, Staaten, die ihre bewaffnete Macht mißbrauchen, „zur Räson bringen“ zu können. Und zwar erstens jeden; zweitens überall auf dem Globus; drittens zu gleicher Zeit an mehr als einem Schauplatz. Demgemäß folgt ihre enorme Rüstung dem Ziel, die Ebene des militärischen Kräftemessens mit einem potentiell gleichwertigen Gegner hinter sich zu lassen und sichere technische Garantien für einen überall und jederzeit herstellbaren Sieg zu schaffen.
Mit der Atomwaffe hat Amerika sich einstmals diesen Traum erfüllt. Allerdings nur in einem negativen Sinn: Sie garantiert die undifferenzierte Vernichtung des Feindes – also nicht die Unterwerfung einer funktionierenden Herrschaft unter US-Kontrolle; ihr Einsatz läßt von dem politischen Subjekt, das auf die richtige Linie gebracht werden soll, zuwenig übrig. Und nicht einmal die Vernichtungsgarantie hat je richtig funktioniert und das gewollte Monopol auf den freien Gebrauch des Mittels Krieg beschafft, weil der große Gegenspieler allzu rasch seinerseits über die Fähigkeit verfügte, die USA mit Atomwaffen zu zerstören. So lastete vier Jahrzehnte lang auf der amerikanischen Kriegsmacht das „atomare Patt“. Immerhin hatte dieser unerträgliche Zustand den wohltuenden Effekt, den militärischen Erfindungsgeist der USA zu den wahnwitzigsten Bemühungen anzustacheln; sowohl bei der Entwicklung immer neuen Geräts, das auf jeder „Ebene“ unterhalb des totalen Atomkriegs jeden gewünschten Kriegserfolg sicherstellen sollte, als auch bei dem Versuch, auf dem schwierigen Feld des atomaren „Schlagabtauschs“ die Kontrolle über das Geschehen und die Freiheit zu seiner einseitigen Eskalation zu erlangen. Für den letztgenannten Zweck haben die USA bekanntlich am Ende das nicht ganz einfache Projekt eines hinreichenden Arsenals weltraumgestützter Abwehrwaffen gegen feindliche Atomraketen in Angriff genommen. Dank der Kapitulation des sowjetischen Gegners hat diese „Verteidigungs-Initiative“ dann an Dringlichkeit verloren. Aufgegeben worden ist das Projekt deswegen keineswegs: Im Hinblick auf die in Rußland übriggebliebenen sowie auf für die Zukunft durchaus denkbare sonstige feindliche Nuklearwaffen wird es fortgeführt.
Die andere Anstrengung, die „Lücke“ zwischen „konventionellen“ Kriegsmitteln und atomarer Vernichtungskapazität zu schließen, hat für den „Normalfall“ eines Konflikts mit nicht gleichrangig gerüsteten Staaten zu offenbar recht brauchbaren Ergebnissen geführt. Dem leitenden Ideal eines technisch nach Maß herstellbaren, sicheren und dabei dosierten Sieges über eine „konventionelle“ Militärmacht mittlerer Größe sind die USA in ihrem Feldzug gegen den auf Machtgewinn durch Eroberung setzenden Irak schon sehr nahe gekommen.
Ihre eigenen umfassenden Rüstungsanstrengungen ergänzt die große Militärmacht seit jeher um die fortwährende Überprüfung der Arsenale, die die restlichen Nationen auf dem Globus sich beschaffen. Sie tut das weniger in der tatsächlich unbegründeten Befürchtung, irgendeinen waffentechnischen Fortschritt zu verpassen – obwohl auch unter diesem Gesichtspunkt Freunde wie ehemalige Feinde ausspioniert werden; im allgemeinen sind jedoch US-Experten überall hilfreich mit dabei, wo an der Fortentwicklung des Krieges und seiner Geräte geforscht und gearbeitet wird. Die USA brauchen genaue Kenntnisse über den Rüstungsstand aller Nationen für ihr kompetentes Urteil darüber, ob die verschiedenen Mächte das, was sie sich anschaffen, überhaupt brauchen. Das Kriterium dafür liegt nämlich nicht in deren souveräner Einschätzung der eigenen Bedarfslage, sondern in den Vorstellungen amerikanischer Weltpolitiker von einer passenden Hierarchie der Militärmächte und von angemessenen Kräfteverhältnissen. Stört die Rüstung eines Landes diese Maßverhältnisse, dann ist das für die USA gleichbedeutend mit einem Angriff auf die bestehende Machtverteilung und damit auf ihre gesicherte Überlegenheit. Die ungenehmigt erworbene Fähigkeit gilt ihnen als feindlicher Wille; der wird mit einem Bewaffnungsverbot belegt; und wenn dem nicht Folge geleistet wird, liegt ein hinreichender Grund für einen vorsorglichen Entwaffnungsschlag vor – für Navy und Air Force bei Bedarf eine schöne Gelegenheit zur praktischen Erprobung ihrer neuesten Fähigkeiten.
b) Abschreckung
Die Kriegseinsätze des amerikanischen Militärs richten sich nie bloß gegen den bekämpften Feind. Sie sind, ebenso wie der gar nicht verheimlichte, im Gegenteil von Fall zu Fall spektakulär ins Licht gerückte Rüstungsfortschritt der USA, an die gesamte Staatenwelt gerichtet: Sie dienen der Abschreckung von eigenmächtiger Gewaltanwendung, indem sie den verantwortlichen Souveränen die Kompromißlosigkeit des amerikanischen Eingriffswillens und die Unwiderstehlichkeit seiner nach Bedarf verfügbaren Gewaltmittel vor Augen führen. Die USA haben damit zwar keinen allgemeinen Verzicht auf Eigenmächtigkeit erzwungen, wohl aber durchgesetzt, daß jeder bewaffnete Konflikt grundsätzlich als Fall für eine Intervention von außen gilt und der US-Regierung ein Monopol auf freies Intervenieren sowie auf die Erteilung von Lizenzen zu gewaltsamem Eingreifen zukommt. Ihre universelle Eingriffsdrohung ist eine Konstante, mit der alle Gewalthaber rechnen müssen.
Die Aufgabe der – „bloßen“ – Abschreckung haben die westlichen Strategen der amerikanischen Militärmacht ausgerechnet in den Jahrzehnten als ihre wichtigste Funktion zugeschrieben, in denen sie eben diesen Dienst gar nicht richtig zu leisten vermochte: Gegen die mit eigenen atomaren Vernichtungsmitteln ausgestattete Sowjetunion war die Drohung, ungenehmigten Gewaltgebrauch mit letzter Konsequenz zu unterbinden, zwar keineswegs wirkungslos, aber auch nicht bedingungslos glaubwürdig; ein Mangel, den US-Militärpolitiker in eigentümlicher Nicht-Achtung ihres Feindes als den Widerspruch atomarer „Selbstabschreckung“ gekennzeichnet und wahrscheinlich sogar empfunden haben. Das demokratische Publikum wurde in dieser Zeit an den verharmlosenden Denkfehler gewöhnt, zwischen der Abschreckungsfunktion und dem Einsatz von Streitkräften so strikt zu scheiden, als wäre eine Abschreckungswirkung auch ohne den ernsten Kriegswillen zu haben, von dem sie doch bloß ausgehen kann. Mittlerweile dürften die Kriegseinsätze der USA am Golf und, in kleinerem Maßstab, auf dem Balkan zumindest die Klarheit gestiftet haben, daß eine solche Trennung nicht existiert – und daß amerikanische Interventionsdrohungen, wenn sie denn schon offiziell kundgetan werden, durchaus wörtlich zu nehmen sind.
In welchen Fällen diese Drohungen verfangen haben, ist schwer zu sagen, weil auffällige kriegerische Verwicklungen dann ja unterblieben sind. Immerhin war wohl im Manöverkampf der chinesischen Armee gegen taiwanesische Autonomiebestrebungen die Mobilisierung amerikanischer Flugzeugträger ein gewichtiger Beitrag zum Geschehensablauf. Nicht so eng zu bestimmen ist der Erfolg, den Amerikas immer wieder erneuerte Kriegsdrohungen gegen den Iran bezwecken: Sie sollen das „Mullah-Regime“ generell abschrecken, nämlich vom Aufbau ihres Staates zur dominierenden Regionalmacht; einem nationalen Projekt, das immerhin naheliegt, nachdem die USA selbst das entsprechende Unternehmen des feindlichen Nachbarn Irak zunichtegemacht und dessen Macht dezimiert haben – wohlweislich ohne sie völlig zu zerstören. Deswegen ist sich Amerika freilich auch an dieser Front immer wieder einiges schuldig: Ein effektives Kontrollregime über Saddam Husseins Macht und Machenschaften bedarf der gelegentlichen Auffrischung durch demonstrative Raketenschläge.
c) Zivile Erpressung
Unter ihrem allgemeinen, durch militärische Abschreckung wirksam gemachten Gewaltvorbehalt erkennen die USA die Souveräne in aller Welt als zuständige Herrschaft über Land und Leute an und pflegen mit ihnen viel zivilen Verkehr. Dessen ökonomischer Inhalt ist Thema des zweiten Teils (Teil B.). Für das hier behandelte Abschreckungsregime sind diese Beziehungen aber auch schon von Belang, weil die USA sie dafür instrumentalisieren. Im diplomatischen Alltag dienen sie nämlich – mit den Gelegenheiten, die sie einer Staatsmacht bieten, und den Nachteilen, die ihre Umgestaltung oder Blockierung mit sich bringt – als ‚Argumente‘, mit denen sich auf die Kalkulationen auswärtiger Machthaber erpresserisch einwirken läßt. Dabei stellt sich – aus den später darzulegenden politökonomischen Gründen – regelmäßig heraus, daß Amerika auch in zivilen Belangen aus einer Position der Stärke heraus zu operieren vermag und darüber den größten Einfluß auf die politische Willensbildung in anderen Staaten ausübt.
Dieses Kräfteverhältnis tritt drastisch zutage, wenn die Erpressungen den Rahmen des diplomatischen Einvernehmens verlassen: Daß über sie ein Embargo verhängt wird, womöglich eines, das sie zu Wohlverhalten gegenüber dem anderen Staat nötigt, brauchen die USA nicht zu fürchten; umgekehrt ist kein Kontrahent der Amerikaner vor Boykottmaßnahmen sicher, die ihn schädigen. Gelegentlich gehen die USA dabei so weit, nicht nur ihre eigenen, sondern überhaupt alle zivilen Beziehungen zu einer Nation zu unterbinden, ein ganzes Land gewissermaßen unter politische Quarantäne zu stellen. Es handelt sich hierbei um die zivile Variante einer Kriegserklärung; durch sie werden, ähnlich wie im Fall eines wirklichen Krieges, alle übrigen Staaten genötigt, mitzumachen – oder sich als Gegner des amerikanischen Vorgehens zu bekennen, mit den für den jeweiligen Fall festgelegten Folgen. Das humanitäre Bedenken, derartige Boykottmaßnahmen würden den Tatbestand der grenzüberschreitenden Geiselnahme erfüllen, weil sie die Zivilbevölkerung pauschal für die falsche Politik ihrer Machthaber haftbar machten, ebenso wie den genauso heuchlerischen Einwand, sie bewirkten nichts – die gewaltsame Entmachtung des so unter Druck gesetzten Souveräns bewirken sie in der Tat nicht –, behalten sich die USA für Fälle vor, in denen sie die Anträge anderer Staaten auf die Anwendung dieses Erpressungsmittels gegen ein „Gewaltregime“ abschlägig bescheiden. Das Monopol auf die abschreckende Ächtung von Staaten, die damit als Feinde identifiziert sind, lassen sie sich nicht nehmen.
Jahrzehntelang haben die USA über ihren einstigen Kriegsverbündeten, in dem sie gleich anschließend den neuen Hauptfeind erkennen mußten, eine weitgehende politische Quarantäne verhängt, die der mitsamt seinen Verbündeten freilich gut ausgehalten hat; kaputtgegangen ist der Sowjet-„Block“ jedenfalls mehr an dem dann doch genehmigten Osthandel des Westens als an dessen Embargolisten. Seither gibt es neue Anwendungsfälle für dieses stärkste zivile Kampfmittel, über das die USA verfügen:
- Im Fall des Irak setzen sie mit einem totalen Embargo ihr gegen das Machtpotential der Nation gerichtetes Zerstörungswerk fort, praktizieren also mit zivilen Mitteln ihre Unversöhnlichkeit gegen die Macht, die es gewagt hat, ihnen einen zwar aus hoffnungslos unterlegener Position geführten, aber immerhin einen wirklichen Krieg zu liefern.
- Gegen den Iran dienen die amerikanischen Boykottmaßnahmen und -forderungen der Eskalation der schlechten Beziehungen in Richtung auf ein militärisches Vorgehen, das sie keineswegs ersetzen. Die USA ächten damit einen Staat als Feind, der nach ihrer Einschätzung dabei ist, aus der Zerstörung des Irak denselben verkehrten Schluß zu ziehen wie vormals Iraks Saddam Hussein aus den Freiheiten, die ihm in seinem Krieg gegen den iranischen „Gottesstaat“ gestattet waren.
- Im libyschen und kubanischen Fall stellt die verhängte bzw. verlangte Quarantäne eine eindeutige Zwischenlage zwischen Krieg und Frieden her. Sie dient auch hier dazu, Amerikas Unversöhnlichkeit wirksam werden zu lassen, ohne dafür gleich Krieg zu führen.
- Mehr auf einen begrenzten praktischen Effekt berechnet war die internationale Boykottaktion gegen Serbien. Sie war der vorläufige Ersatz für militärische Schläge gegen den Staat, dem zwar keine direkte Kriegsteilnahme, dafür aber um so mehr sein Widerstand gegen den euro-amerikanischen Regelungsanspruch in den laufenden Sezessionskriegen auf ehemals jugoslawischem Territorium vorzuwerfen war. Und sie hat, bei dem nachgiebigen Gegner, die gewünschte Wirkung gezeitigt, so daß es beim zivilen Kriegsersatz bleiben konnte.
d) Das Bündnis: Abschreckungsgemeinschaft mit den Konkurrenten
Mit ihren Bemühungen, den Gewaltgebrauch der souveränen Staaten unter wirksame Aufsicht zu stellen, stoßen die USA nicht bloß allenthalben auf größere oder kleinere Widerstände von Machthabern, die ihre eigenen Berechnungen anstellen und ihre ‚höchste Gewalt‘ im Innern und nach außen gerne autonom handhaben würden. Sie sind vor allem mit Konkurrenten konfrontiert: Genauso wie sie selber sehen sich auch noch ein paar andere Mächte auf der Welt durch die Verwendung, die auswärts von politischer Gewalt gemacht wird, zu Einmischung und entscheidender Mitsprache herausgefordert; die Mittel, mit denen sie diesem Anspruch Geltung verschaffen, sind im Prinzip dieselben – zwar geringer dimensioniert, aber auch durchaus wirksam – wie diejenigen des globalen amerikanischen Gewaltvorbehalts; insbesondere bemühen sie sich wie die USA auf eben die Art und Weise, von der im nächsten Abschnitt die Rede sein wird, im großen Kreis der souveränen oder zur Herrschaft strebenden Gewalthaber um interessierte Unterstützer ihrer Entscheidungsmacht.
Diese Konkurrenz können die USA nicht unterbinden; sie dulden sie aber auch nicht. Und sie haben – zuerst in der Auseinandersetzung mit dem großen weltpolitischen Gegenspieler, der sowjetischen Macht – eine Methode entwickelt, dagegen vorzugehen. Sie treten diesen ihnen selbst so ähnlichen – „westlichen“ – Nationen mit der verbindlichen Einladung entgegen, ihren konkurrierenden Zuständigkeitsanspruch und ihre Interventionsmacht nicht ohne sie, vielmehr an ihrer Seite zu betätigen: als Bündnispartner. Für den Verzicht auf konkurrierendes Vorgehen, auf Eigenmächtigkeiten und Alleingänge im internationalen Erpressungsgeschäft, versprechen die USA eine Erfolgsgarantie für gemeinsame Unternehmungen und halten das für ein unschlagbares Angebot.
Tatsächlich können sie auf den Opportunismus ihrer Konkurrenten rechnen, und auch darauf, daß mit jedem gewonnenen Partner ihr Angebot attraktiver wird, weil die Erfolgsaussichten konkurrierender Unternehmungen bzw. Vorhaben damit schwinden. Umgekehrt müssen sie dauernd damit rechnen, daß gewonnene Partner sich nur zu ihren eigenen Bedingungen unterordnen – was zwar ein Widerspruch, aber ein in der Staatenwelt sehr alltäglicher ist – und unter ihresgleichen ebenfalls Verbündete suchen; und da kann derselbe Opportunismus, der die Partnerschaft stabilisiert, sie geradesogut zersetzen, nämlich mangelnde Linientreue eines Partners Anlaß für andere werden, den Ertrag ihrer Linientreue kritisch zu überprüfen. Jedenfalls ist das Bündnis, das die USA mit ihren wichtigsten Konkurrenten immerhin zustandegebracht haben, keine feste Einrichtung, sondern von der „Führungsmacht“ her die fortwährende Anstrengung, die unwiderstehliche Attraktivität der amerikanischen Abschreckungsmacht für alle gleichgearteten und -gesinnten Nationen zu beweisen – und über die Aussichtslosigkeit konkurrierender Veranstaltungen keine Zweifel aufkommen zu lassen.
Den Aufstieg zur globalen Macht haben die USA nicht zufällig als Führungsmacht einer siegreichen Weltkriegsallianz geschafft: eben nicht allein gegen den Rest der Welt, sondern unter Mithilfe der meisten anderen Staaten der damaligen Welt, die zum Teil gar keine andere Wahl hatten, als gegen die faschistische Kriegsmaschinerie der Deutschen und der Japaner auf Amerika zu setzen, und denen ansonsten die Erkenntnis nicht schwerfiel, im Bündnis mit den USA auf der Seite des Erfolgs zu stehen. Lauter abhängige Alliierte sowie besiegte und mit eigenen Truppen besetzte, gleichfalls zu untergeordneter Mithilfe vorgesehene und bereite ehemalige Feindesländer: das hätte wunderbar für eine weltweite pax americana getaugt; die UNO wäre das passende diplomatische Instrument dafür gewesen. Doch hat sich dann bekanntlich der mächtigste Verbündete zu autonom gebärdet und sein eigenes, auf Sozialismus und Unabhängigkeit von Amerika eingeschworenes „Lager“ gegründet. Amerikas Allianzen bekamen damit einen neuen Zuschnitt und eine neue Zweckbestimmung: die „Eindämmung“ des neuen sowjetischen Hauptfeindes sowie dessen „Abschreckung“ durch immer gewaltigere Kriegsdrohungen. Unter dieser Zielsetzung wurden alte Partner und neue Satelliten der amerikanischen Macht zu Figuren einer globalen Strategie zurechtdefiniert und zurechtgemacht, die den Globus unter so eigene Gesichtspunkte, nämlich Konfrontationskategorien subsumierte wie „Inselmacht“ und „Gegenküsten“ versus „Kontinentalmacht“. Die BRD erfreute sich eines (Wieder-)Aufbaus als antisowjetischer „Frontstaat“; fürs ebenso christdemokratisch unter Kontrolle gehaltene Italien ergab sich die ehrenvolle Funktion eines „unsinkbaren Flugzeugträgers“ der USA und Heimathafens ihrer Flotten im Mittelmeer; und so weiter. Die politische Geschäftsgrundlage dieser Allianz bestand in der „Lage“, die die USA mit der Konzentration aller Kräfte auf das Ringen mit der sowjetischen Gegenmacht herzustellen verstanden: Unter der Wucht ihrer Drohung mit einem 3., atomaren Weltkrieg gegen alle weltumstürzlerischen Umtriebe Moskaus ordnete sich die Staatenwelt der Kalten-Kriegs-Front zu. Allen voran diejenigen kapitalistischen Mächte, die in dieser Welt wieder eine (mit)entscheidende Rolle zu spielen gedachten; für deren Ambitionen wären Vorbehalte gegen Amerikas Konfrontationspolitik schädlich, ein Entzug aus der angebotenen strategischen Partnerschaft die sichere Niederlage gewesen. Und das immer eindeutiger mit jedem Nachbarn, der sich den USA anschloß. Die freie und souveräne opportunistische Berechnung der Mitgliedsstaaten, lieber auf der stärkeren Seite der Front beheimatet zu sein als auf der falschen oder am Ende zwischen den Fronten, sicherte den USA ihre Gefolgschaft, stabilisierte den Freien Westen und machte die NATO definitiv zur stärkeren Seite im globalen Ringen. Die darauf aufgebaute Weltkriegsdrohung, einschließlich ihrer immer gigantischeren nuklearen Optionen, wirkte umgekehrt als materialisierter Bündniszwang, dem sich selbst Frankreich mit seiner dauerhaften politischen Opposition gegen die amerikanische Dominanz nicht entzog: Seine eigene nukleare Option durchbrach nie wirklich die strategische (Un-)Logik der von der NATO erarbeiteten Atomkriegsszenarios, war vielmehr nur auf Grundlage und innerhalb dieses Konzepts militärisch halbwegs sinnvoll und durchführbar. Auf mehr als einen größeren Einfluß auf das Bündnis – darauf nämlich, den Übergang zum Nuklearkrieg notfalls aus eigener nationaler Entscheidung erzwingen zu können – war Frankreichs Emanzipation vom Bündnis tatsächlich auch gar nicht berechnet – und hat nicht einmal dazu getaugt.
Mit dem Wegfall der antisowjetischen Prämissen der Weltpolitik geriet dann logischerweise das Bündnis in die Krise, nicht bloß seine Defensiv-Ideologie. Allerdings wurden damit weder die institutionell verfestigten und verdinglichten Kooperationsverhältnisse in der NATO hinfällig noch die Kalkulationen der Verbündeten mit den Vorteilen einer Anbindung an die weltweit erfolgreichste und stärkste Macht. Und es ließen die Fälle nicht lange auf sich warten, die die USA zum Anlaß genommen haben, die Notwendigkeit einer Erneuerung der gemeinschaftlichen Abschreckungspolitik zu exemplifizieren und ihre alternativlose Einladung an die alten Verbündeten zum Mitmachen in der „neuen Weltordnung“ gewaltsam zu aktualisieren:
- Im Krieg gegen Saddam Hussein ging es nicht bloß um einen gloriosen Sieg von weitreichender Abschreckungswirkung, sondern um die Herstellung einer schlagkräftigen Allianz unter US-Führung und unter Einschluß wichtigster europäischer Partner, also um das auf amerikanische Initiative und zu amerikanischen Bedingungen konstruierte kollektive weltpolitische Subjekt der im Sieg bewiesenen totalen militärischen Übermacht. Dem An-Gebot, dabei aktiv mitzumachen, mochten sich die beiden westeuropäischen Militärmächte, auf die es vor allem ankam, nicht entziehen; die anderen haben ihre fügsame Zustimmung auf ihre Weise: mit einer namhaften Spende für die Kriegskasse abgeliefert.
- Die Staatsgründungskriege, die das alte vielvölkergemischte Jugoslawien zerstört haben, haben sich – nicht ohne amerikanische Nachhilfe – zur nächsten Gelegenheit entwickelt, von Washington aus die NATO als entscheidendes bündnispolitisches Instrument zu erneuern. Zunehmend entschieden und im Endeffekt erfolgreich haben die USA da den Versuch der Europäer gekontert, untereinander, ohne den „großen Bruder“, eine aktionsfähige europäische Interventionsmacht auf die Beine zu stellen und mit der eigenen, internen Konkurrenz um die Richtlinienkompetenz in der Euro-Gemeinschaft fertig zu werden: Die innereuropäische Konkurrenz wurde ermuntert; das Scheitern der eigentümlich gebremsten Eingriffsversuche, auf die die EU-Mächte sich einigen konnten, wurde wohlwollend gefördert; womöglich erfolgversprechende Initiativen der EU- und UNO-Vermittler, also ohne die USA als federführendes Subjekt, wurden hintertrieben, manchmal sogar erst in letzter Minute durch einen sachdienlichen Wink an die insgeheim sowieso unterstützte Bürgerkriegspartei. So konnte es nicht ausbleiben, daß mit dem Bedürfnis nach einer wirklich entscheidenden, also bewaffneten Intervention die Einsicht wuchs, ein im nötigen Maße respektgebietender Erfolg sei wohl doch nicht ohne die USA und am sichersten unter deren Führung im Rahmen der alten transatlantischen Allianz zu haben. Bei der Durchführung des fälligen gewaltsamen Eingriffs haben sich dann die vierzig Jahre lang gepflegten NATO-Strukturen, etwa Italiens Flugzeugträger-Funktion, – erstmals! – ganz materiell bewährt. Die weltpolitische Bedeutung des Friedensabkommens von Dayton liegt dementsprechend eindeutig nicht in seinen praktischen Konsequenzen für den zum Staat erhobenen bosnischen Kriegsschauplatz, vielmehr in dem darin kodifizierten Erfolg der neuen NATO-Abschreckungspolitik – genauer: darin, daß dieser Erfolg durch die Neubelebung der Allianz zustandegekommen ist.
Natürlich wissen die USA und rechnen damit, daß auch solche bedeutenden Erfolge ihrer Bündnispolitik die Konkurrenz in der Allianz, die sich fortwährend gegen ihre dominierende Stellung richtet, und das zersetzende Bestreben, die Kompetenzen zwischen Amerika und den Europäern neu zu verteilen, keineswegs beenden. Der Streit um den Oberbefehl im Mittelmeer, den Frankreich für einen europäischen General reklamiert, ist nicht mehr und nicht weniger als ein mit viel Bedeutung befrachteter Brennpunkt dieses Konflikts. Er zeigt umgekehrt auch, daß die Führungsmacht hier nichts außer Acht läßt und, je mehr die eingerichtete Kompetenzverteilung im Bündnis und damit die Hierarchie der Mitgliedsstaaten angefochten ist, um so entschiedener Führung praktiziert.
Derzeit investiert sie viel Führungsstärke – und das recht wirkungsvoll, was die Beziehungen zu den wichtigsten Partnern betrifft – in das strategische Großunternehmen der NATO-Osterweiterung.[6] Die USA vereinigen da die strategischen Interessen und die militärische Macht ihrer potentiellen Gegenspieler in Europa in dem für alle vorteilhaften Projekt, die westlichen Kernländer des ehemaligen Warschauer Pakts strategisch zu okkupieren, militärisch zu integrieren, dadurch die Allianz zur alleinigen Ordnungsmacht auf dem und für den alten Kontinent, also zur exklusiv bestimmenden europäischen Kontinentalmacht zu machen und dem neuen, demokratisch befreiten Rußland seinen Platz als neutralisierter, zu grenzüberschreitender Einflußnahme nicht mehr fähiger Außenseiter NATO-Europas zuzuweisen.
e) Rekrutierung souveräner Helfershelfer
Die Aufforderung, der amerikanischen Abschreckungsmacht ihre positive Seite abzugewinnen und sich mit ihr in Übereinstimmung zu bringen, richten die USA an die gesamte Staatenwelt. Ohne Ansehen der Größenordnung bieten sie jedem nationalen Souverän die Ermächtigung zum Helfershelfer ihrer Weltmacht an – nämlich: Waffen sowie die Freiheit, diese auch anzuwenden und sich nach innen bedingungslosen Respekt, nach außen Einfluß zu verschaffen, und zwar nach eigenem Ermessen; vorausgesetzt, versteht sich, Ermessensfreiheit und Waffen werden nicht mißbraucht, vielmehr im Sinne amerikanischer Einmischungs- und Abschreckungsbedürfnisse genutzt. Auf diese Weise sorgen die USA in den verschiedenen Regionen der Staatenwelt, auch dort – und das ist selten genug der Fall –, wo sie nicht selbst mit eigenen Streitkräften präsent sind, für einen Gewalt-Haushalt, der sich ihrer Einmischung verdankt, ihre Überlegenheit stabilisiert und ihren generellen Kontrollwillen wirksam macht.
Freilich funktioniert dieses System keineswegs von selbst. Das liegt schon daran, daß sich die nationalen Interessen und Berechnungen kooperationswilliger Partner mit dem Standpunkt der USA zwar decken mögen, aber nie identisch werden – schon bei der Bewaffnung eines Verbündeten pflegen sich tiefe Meinungsverschiedenheiten zwischen dem angemeldeten Bedarf und der Bedarfsschätzung der Weltmacht zu ergeben –, so daß dauernd die eine Seite sich von der anderen verraten und die andere von der einen im Stich gelassen sieht. Solche unvermeidlichen Friktionen sind außerdem ebensoviele Ansatzpunkte für den fortwährenden Versuch der anderen weltweit interessierten und engagierten Mächte, sich durch eigene, bessere und entgegenkommendere Ermächtigungsangebote Einfluß, womöglich sogar ganze Einfluß-Sphären zu schaffen; die konstruktive Einbindung dieser Mächte ins große Bündnis macht deren konkurrierendem Anspruch auf weltweite Mitbestimmung über den politischen Gewaltgebrauch auf dem Globus ja keineswegs ein Ende. Es kommt für die USA also viel darauf an, weltweit die Überzeugung zu verankern und wachzuhalten, daß es sich allemal mehr lohnt, mit Amerika gegen andere gemeinsame Sache zu machen – auch wenn in dieser gemeinsamen Sache von der eigenen nationalen nicht mehr so gar viel enthalten ist – als mit anderen ohne und insofern gegen Amerika. Komplementär zu ihrem Abschreckungsregime, und damit es lückenlos seine Wirkung entfaltet, müssen die USA auf den Opportunismus nationaler Machthaber setzen und sie mit der Gewißheit bedienen, als Partner Amerikas noch am ehesten auf der Gewinnerseite zu stehen. Umgekehrt zieht nämlich jede Machtverschiebung irgendwo, jeder Rückschlag für einen ausgewiesenen Freund Amerikas und jeder gegen die hergestellten Verhältnisse errungene und festgehaltene nationale Erfolg die amerikanische Dominanz über die politischen Gewaltverhältnisse in Mitleidenschaft – vor Ort, in der Region und am Ende überhaupt…
Zusätzlich zur Ausstattung kooperativer Regime mit Machtmitteln bedarf es also kontinuierlicher Anstrengungen, deren politischen Willen sachgerecht zu bilden. Es versteht sich angesichts der Größe der Aufgabe, daß es hierfür kein Mittel gibt, auf das die USA verzichten könnten. Nicht zuletzt kann und darf der Geheimdienst einer Weltmacht sich unmöglich auf rein informative Tätigkeiten beschränken.
Auch die hier einschlägigen – diplomatischen und sonstigen – Techniken haben die USA im Zuge ihres globalen Kalten Krieges gegen die Sowjetunion perfektioniert und mit nachhaltigem Erfolg angewendet: Gegen die grundsätzlich überall zu unterstellende „kommunistische Gefahr“ wurden Hilfskräfte gesucht und gefunden oder geschaffen, innerstaatliche Machtkämpfe blutig beendet oder angezettelt, auch zwischenstaatliche Stellvertreterkriege geführt, wo das antisowjetische Abschreckungsinteresse der USA und nationale Machtbedürfnisse in der Definition eines gemeinsamen regionalen Feindes übereinkamen. Defensiv im Sinne einer Notwehrmaßnahme gegen „die Weltrevolution“ war das schon damals nicht; gegen drohende Gefahren verteidigt wurde vielmehr das amerikanische Abstandsgebot gegenüber der großen rivalisierenden Weltmacht – hier im Kampf um die Funktionalisierung unterklassiger Mächte für die eigene Seite. Die als „Dominotheorie“ bekanntgemachte amerikanische Befürchtung, der „Abfall“ eines Landes von der richtigen Seite müßte den weiterer Kandidaten nach sich ziehen und zum Verlust der Kontrolle über die außersowjetische Staatenwelt führen, letztlich also zum Untergang der freiheitlichen Weltmacht, begründete die universelle Reichweite und den Totalitarismus des Abwehrkampfes der USA gegen jede Gefahr einer „Erosion“ der von ihnen hergestellten und betreuten Kräfteverhältnisse.
Diese Verhältnisse überläßt Amerika selbstverständlich keineswegs sich selbst, nachdem das Ringen mit dem großen Rivalen gewonnen ist und die Pflege der Weltordnung ihre antisowjetische Eindeutigkeit verloren hat. Dadurch ergeben sich vielmehr neue Aufgaben und auch neue Bündnisse und Komplotte für Amerikas Weltordnungspolitik. Wenn sich zum Beispiel im jahrzehntealten sudanesischen „Bürger“-Krieg kurz vor der Jahrtausendwende das Kriegsglück den christlichen Rebellen im Süden zuwendet, dann lassen sich die Ursachen leicht bis zu der amerikanischen Entscheidung zurückverfolgen, dem in Khartoum regierenden islamischen Fundamentalismus endlich eine für Schwarzafrika exemplarische Niederlage zu bereiten. Und das ist nur ein kleines Beispiel für die allgemeinere Notwendigkeit, die Grenzlinien der Verteidigung der amerikanischen Überlegenheit der neuen Erfolgslage anzupassen. Vor allem im bislang vorenthaltenen Teil der Staatenwelt gilt es noch Problemfälle zu identifizieren und Helfer fürs amerikanische Aufsichtsregime zu gewinnen bzw. herzustellen – vom Baltikum bis nach Mittelasien.
Andere Aufgaben bleiben der amerikanischen Bündnispolitik auch in der neuen Weltlage erhalten. So insbesondere ihr klassischer und exemplarischer Fall und nach wie vor einer der wichtigsten: die Betreuung Israels. Nicht gleich zu Beginn, aber schon bald nach dem gewonnenen Staatsgründungskrieg des jüdischen Gemeinwesens haben die USA Israels Not, sich in einer feindlichen Umwelt gewaltsam behaupten zu müssen und Respekt verschaffen zu wollen, für deckungsgleich mit ihrem Bedürfnis erkannt, die arabischen Staaten von dem Projekt einer gemeinsamen Großmacht außerhalb amerikanischer Kontrolle – und sogar nach Lage der Dinge mit prosowjetischer Orientierung – abzubringen und mit militärischen Niederlagen für ihre antiamerikanische Eigenmächtigkeit büßen zu lassen. Die in mehreren anschließenden Kriegen bewährte Übereinstimmung des recht ausgreifend definierten israelischen Sicherheitsbedarfs mit dem amerikanischen Willen zur Bremsung, Beschränkung und teilweisen Zerstörung arabischer Macht bedeutet freilich auch in diesem Fall keine Identität der jeweiligen Interessen. Die Unterschiedlichkeit der Standpunkte, die da so lange und so bemerkenswert genau zusammengefallen sind, macht sich logischerweise immer stärker praktisch geltend, seit Israels arabische Nachbarn einschließlich der Palästinenser zunehmend die von den USA gewünschte Wirkung zeigen und ihrerseits Amerika als Schutzmacht gegen Israel angehen. Diese hoffnungsvolle Entwicklung ist schon vor dem Ende der Sowjetunion aus Unzufriedenheit mit deren allzu begrenzter und bremsender, weil mehr auf ein Arrangement mit dem Westen als auf einen Umsturz der Machtverhältnisse angelegter Unterstützung in Gang gekommen; danach haben die USA mit ihrer Golfkriegs-Allianz wichtigen, bis dahin sogar eher als gegnerisch eingestuften arabischen Staaten das deutliche und kaum auszuschlagende Angebot gemacht, sich grundsätzlich auf die Seite der Sieger umzuorientieren. Seither macht sich Israel Sorgen um die bedingungslose Rückendeckung Amerikas für seine nach wie vor eher intransigente Politik; die USA ihrerseits haben zu tun, um die noch keineswegs entbehrliche Instrumentalisierung ihres jüdischen Partners gegen nahöstliche Eigenmächtigkeiten mit ihrer Einladungspolitik an die arabischen Nationen zur Deckung zu bringen.[7]
Schon vor dem letzten Golfkrieg, den die USA selbst in die Hand genommen – und von dem sie ausgerechnet Israel ausgeschlossen – haben, hat übrigens in derselben Region ein „Stellvertreterkrieg“ der eigentümlichsten Art stattgefunden: ein Krieg ganz ohne antisowjetische Zielsetzung, obwohl es die Sowjetunion als Feind noch gab; stattdessen mit der Merkwürdigkeit, daß beide Parteien in der Verfolgung ihres Eigeninteresses quasi stellvertretend ein und dasselbe US-Interesse bedient und dafür sogar eine gewisse militärische Unterstützung bekommen haben. Aufeinander losgegangen sind Irak und Iran mit der ganz eigennützigen Berechnung, durch einen Sieg über den Gegner zur bestimmenden Regionalmacht aufzusteigen; unterstützt wurden sie dabei von den USA, noch etwas berechnender, je nach Kriegsglück so, daß der Krieg sich in die Länge gezogen hat und statt des Sieges einer Seite nichts als wechselseitige Zerstörung und die relative Machtlosigkeit beider Seiten herausgekommen ist. Daß wenig später ein direktes Vorgehen gegen den Irak dann doch nötig wurde, um die Gefahr einer von Amerika nicht gewünschten regionalen Übermacht zu bannen, hat den USA, wie schon erwähnt, den Anlaß geboten, die Welt demonstrativ mit ihrer neuen Abschreckungsdoktrin unter dem Titel „Neue Weltordnung“ bekanntzumachen.
4. Der diplomatische Überbau: Die UNO
Die USA kümmern sich um jede politische Gewalt, die sich auf dem Globus bemerkbar macht; sie teilen Macht zu und ermuntern Gewaltanwendung, wenn sie der universellen Hierarchie mit Amerika an der Spitze dienlich ist; sie führen Kriege, wo sie die Entmachtung eines Machthabers nötig finden, und laden andere Nationen zum Mitmachen ein; sie hungern mit zivilen Mitteln ganze Staaten aus, um Verstöße gegen ihr Kontrollregime über die globalen Kräfteverhältnisse zu ahnden; doch dabei belassen sie es nicht. Sie stehen zusätzlich für eine alle Staaten umfassende Institution gerade, die alle Souveräne – auch sie selbst – in aller Form auf die Respektierung eines ganz prinzipiellen, quasi suprastaatlichen Gewaltvorbehalts verpflichtet und zugleich zu den mitbestimmenden Teilhabern dieses Scheins einer übergeordneten Welt-Souveränität erhebt. Allen gewaltträchtigen Affären zwischen den Machthabern dieser Welt, allen Einmischungsinteressen ihrer Konkurrenten und selbstverständlich auch ihren eigenen Kontroll- und Interventionsbedürfnissen verschaffen die USA so, in der UNO nämlich, eine zweite Gestalt: als organisierte Befassung aller Staatsgewalten mit jedem politischen Stoff mit dem Ziel einer kollektiven, unanfechtbar allerhöchsten Beschlußfassung. Das Bemühen der USA um allseitige Hinnahme und Unterstützung ihrer Entscheidungen und Interventionen, die konkurrierenden Bemühungen gleichgearteter Mächte um eigene Machtpositionen, das Ringen der übrigen Staatswesen um Eigenständigkeit oder auch nur um Berücksichtigung, das Aufbegehren der einen und dessen Zurückweisung durch andere – das alles verdoppelt sich hier in einer diplomatischen Dauerveranstaltung mit ganz eigenen Regeln. In der UNO wird darum gerungen, erstens welche Affäre überhaupt zum Gegenstand kollektiver Befassung wird; zweitens in welcher Angelegenheit es a) überhaupt zu einer Beschlußfassung kommt, b) zu welcher, und c) welcher Grad der Verbindlichkeit einem etwa gefaßten Beschluß zukommt; drittens geht es um die praktischen Konsequenzen daraus, darunter zuerst und vor allem um die Federführung bei der Durchsetzung etwaiger Entscheidungen; viertens um eine verbindliche Ein-, also Unterordnung der Staaten, die sich im Zuge der diplomatischen Auseinandersetzung als Konkurrenten, Abweichler oder Gegner hervorgetan haben.
Selbstverständlich geht in diesem Streit um die Etablierung eines allseits anerkannten globalen Aufsichtswesens das wirkliche Kräfteverhältnis zwischen den USA und den vielen anderen Mächten keineswegs verloren. In dem – durch exklusive Veto-Rechte entscheidend zurechtgerückten – Formalismus der gleichberechtigten Teilnahme aller, der größten wie der kleinsten Souveräne kommt es vielmehr voll zum Tragen. Nicht eine Fiktion von Suprastaatlichkeit, sondern die wirkliche Macht der USA erfährt vermittels der UNO und unter dem Schein einer supranationalen Weltordnung ihre ausdrückliche Anerkennung als von allen höchsten Gewalten gebilligtes Rechtsverhältnis. Ihr Bemühen um ein globales Netz von Helfershelfern ihrer Gewalt und um die berechnende Fügsamkeit aller politischen Gewalten werten die USA damit diplomatisch um und auf zum Ringen um eine Selbstverpflichtung der Nationen auf kollektiv gefaßte Beschlüsse.
Jedenfalls im Prinzip. Denn in der Praxis genügt die „Völkergemeinschaft“ ihrem amerikanischen Auftrag selten genug. Der Vorteil, den Willen der Weltmacht in ein einigungsfähiges Gemeinschaftsprojekt mit allen Konkurrenten und Betroffenen umzudeklarieren, ist nicht ohne den Nachteil zu haben, daß auf dieser abgehobenen Ebene die Stimmabgabe frei ist und nur allzu willkürlich erfolgt. Ganz oft muß daher die Befassung der UNO mit internationalen Streitfragen, auch solchen, die die USA als Ordnungsanliegen vorbringen, mangels wunschgemäßer Ergebnisse oder Erfolgsaussichten im Sande verlaufen. Und wo die verlangte allgemeine Zustimmung zustandekommt, da steht dem diplomatischen Gewinn immer noch der Mangel gegenüber, daß der Konsens einem Projekt gilt, als dessen Urheber sich auch andere Mächte ins Spiel gebracht haben, so daß die USA den Zuspruch der Staatenfamilie doch nicht direkt und ausdrücklich auf sich beziehen können. Sogar die Rolle des Generalbevollmächtigten einer von der UNO antizipierten Weltregierung ist nicht frei von dem Makel der Beauftragung durch andere, auch wenn sie in der Realität mit der Funktion eines bloßen Auftragnehmers nicht zu verwechseln ist.
Es wundert daher nicht, daß die USA als Erfinder und Garant der UNO auch ihr größter Kritiker sind. Vielleicht sind sich manche Politiker in Amerika ja wirklich nicht so ganz über den Nutzen im Klaren, den sie auf alle Fälle davon haben, daß in der UNO die weltweiten Gewaltverhältnisse, so wie sie durch die Macht der USA zugerichtet sind, sich so darstellen und betätigen, als wären sie ein von allen Betroffenen mitgetragenes Ordnungsprogramm.
Zu Zeiten des Kalten Krieges hat die UNO diesen Standpunkt einer gemeinschaftlich zu bewirkenden Weltordnung auch realisiert; allerdings nur als Konflikt um die Ordnungsprinzipien – wie auch sonst, solange Amerikas freiheitliche Kontrollgewalt über die Welt eine halbe Sache war. Der diplomatische Geschäftsalltag der Organisation hat daher auch bloß die gegensätzliche Zuordnung der Staatenwelt nach „Ost“ und „West“, mit dadurch definierten „Blockfreien“ dazwischen, zur Anschauung gebracht und das dazugehörige Gezerre auf höherer Ebene reproduziert.
Diese Ära der – im Rückblick bezeichnenderweise so genannten – „Selbstblockade“ der Weltorganisation ist überwunden. Im Rahmen der ausgiebigen diplomatischen Vorbereitung ihres Golfkriegs haben die USA die UNO in ihrem Sinn in Stellung gebracht, über sie ihre Intervention zum erklärten Willen der „Völkergemeinschaft“ gemacht; entsprechend hoher Wertschätzung hat der Verein sich eine Zeitlang erfreut. Zwischenzeitlich haben die USA allerdings wieder viel zu kritisieren gefunden an ihrem Geschöpf: Lauter Tendenzen haben sich breitgemacht, das amerikanische Vorgehen im Falle Saddam Hussein unbefugt zu kopieren; der Generalsekretär selbst hat die Emanzipation der UNO von ihrem eigentlichen weltpolitischen Subjekt regelrecht betrieben, hat von sich aus Interventionsbedarf angemeldet, im Falle Somalias sogar – jedenfalls aus amerikanischer Sicht – auf Kosten der USA durchgesetzt; am Ende hat er allen Ernstes eine interventionsfähige bewaffnete Eingreiftruppe unter seinem Oberbefehl beantragt und sich damit endgültig als „Reformgegner“ disqualifiziert.
Es gab also einiges zurechtzurücken; und das ist im Zuge der diplomatischen Begleitung des bosnischen Staatsgründungskriegs auch geschehen: Über den UNO-Freibrief für die NATO, alles Nötige gewaltsam zu regeln, bis hin zum Dayton-Abkommen, das der UNO-Generalsekretär noch nicht einmal als Notar der Weltgemeinschaft beglaubigen durfte, ist die Organisation demonstrativ und durchaus beispielgebend aus der Regelung dieser Affäre verabschiedet worden. Ebenso liegt es freilich im Ermessen der USA, aus gegebenem Anlaß und in einem geeigneten Fall die „Völkerfamilie“ – mittlerweile unter einem neuen, anerkannt „reformfreudigen“, nämlich von ihnen durchgedrückten Generalsekretär – wieder mehr zu aktivieren. Klar ist auf alle Fälle, daß die USA sich auf ihr diplomatisches Geschöpf nicht einfach verlassen können, sondern Grund und genügend Anlässe haben, die eigens institutionalisierte Illusion völkergemeinschaftlichen Beschließens auch immer wieder einmal rückgängig zu machen.[8] Klargestellt ist allerdings auch, daß dieser Schein mitsamt seinem diplomatischen Gewicht anderen Mächten für die Förderung ihrer gewalttätigen Anliegen noch viel weniger zu Gebote steht: Ohne die Macht der USA ist das ganze Beschlußwesen der UNO überhaupt nichts wert.
5. Der ideologische Überbau: Weltpolitik als Rechtspflege und als moralische Veranstaltung
a) Das Völkerrecht
Indem die USA alle Gewaltaffären der Staatenwelt auf sich als letzte Entscheidungs- und Interventionsinstanz beziehen, auswärtigen Herrschaften Vorschriften machen und Respekt erpressen, unter dieser Bedingung die Souveränität nationaler Machthaber anerkennen, auch für Anerkennung durch alle anderen höchsten Gewalten sorgen und überdies die grundsätzliche Zustimmung aller Nationen zu dieser „Sachlage“ als dauerhafte Weltversammlung fest organisieren, verleihen sie diesen Werken ihrer Macht den Charakter einer internationalen Rechtsordnung. Denn Recht und Ordnung sind ohnehin nichts anderes als eben dies: die Verhaltensregeln, die eine überlegene und anerkannte Gewalt durchzusetzen vermag. Gewaltanwendung in Widerspruch zu amerikanischen Auflagen erfüllt damit prinzipiell den Tatbestand eines Verstoßes gegen internationales Recht; Nationen, die so etwas dauerhaft tun, verdienen eine Einstufung als Unrechtsregime. Das erleichtert vieles, in der Diplomatie wie für die Pflege der weltöffentlichen Meinung.
Wenn die USA ihr Vorgehen gegen Staaten, die sie als Störenfriede in der von ihnen gewollten Hierarchie und Ökonomie der politischen Gewalten ausgemacht haben, – wie etwa gegen Libyen und Iran – unter den Titel „Terrorismusbekämpfung“ stellen; wenn sie die Auslieferung von Agenten solcher „Terrorstaaten“ an amerikanische Gerichte fordern und die Verweigerung mit einer Quarantäne und dem einen oder anderen, militärisch überhaupt nicht weiter zweckmäßigen Bombenangriff „bestrafen“; dann wenden sie das innerstaatliche Gewaltverhältnis des Anklagens, Urteilens und Richtens, das Verfahren der Rechtspflege also, auf ihre außenpolitischen Beziehungen an. Sie treiben Weltpolitik nach dem Muster des Strafrechts und machen auf diese Weise doch einmal ernst mit dem politologisch-weltbürgerlichen Ideal eines wirksamen internationalen Gewaltmonopols. Damit nehmen sie einerseits bloß eine pure Rechtfertigungsideologie für ihre praktizierte Gewalttätigkeit in Anspruch. Diese Ideologie hat andererseits doch auch eine eigene praktische Bedeutung: Sie verdeutlicht unmißverständlich den totalitären Geltungsanspruch verletzter amerikanischer Ordnungsinteressen; und sie entspricht auch der Sachlage in der Machtfrage so vollkommen, daß sie von den Exekutoren amerikanischer Gewalt wie eine Verfahrensvorschrift beherzigt wird – die USA müssen sich in der Tat nicht an ihren Feinden und als bloße Kriegspartei mit deren Militär messen, sondern gehen von vornherein als überlegene Macht ans Werk, eben so wie im staatlichen Innenleben die Polizeigewalt gegen Verbrecher, und setzen die Gegenwehr des Betroffenen ganz praktisch, nämlich indem sie sie zunichte machen, ins Unrecht. Weil sie so überlegen sind, gelingt es ihnen auch regelmäßig, andere Souveräne zum Mitmachen zu gewinnen – was ihre Überlegenheit noch größer macht – und einen internationalen Konsens herzustellen, der den Schein eines wirklichen Rechtsverhältnisses zwischen dem von den USA verteidigten Weltzustand und dessen Störfällen als gültig beglaubigt.[9]
b) Die Menschenrechte
Wenn die USA ihr Kontrollregime über die Staatenwelt wie ein universelles Richteramt exekutieren, dann berufen sie sich für die moralische Unanfechtbarkeit ihrer Urteile und Interventionen gerne auf einen allerhöchsten, selbst die höchsten Gewalten sittlich verpflichtenden Wert: die Menschenrechte. Die offizielle Liste dieser Rechte, die kein geringerer als „die Natur“ oder auch „der Schöpfer“ den Menschen mitgegeben hat, braucht niemand parat zu haben, geschweige denn eine ihrer offiziellen philosophischen Herleitungen,[10] um die entscheidende Botschaft mitzukriegen: Kein Mensch soll und darf seiner staatlichen Obrigkeit einfach ausgeliefert und exklusiv verfügbar sein; darauf paßt die staatliche Obrigkeit aus Amerika auf. Der Respekt vor der weltbürgerlichen Natur ihrer Untertanen verpflichtet jede Staatsmacht zu respektvoller Selbstbeschränkung; und diese allgemeingültige Pflicht entbindet die amerikanische Staatsmacht von jeder Beschränkung auf ihren nationalen Zuständigkeitsbereich. Als geborene Schutzmacht aller Regierten und ihrer „angeborenen“ Rechte finden die USA sich ermächtigt und dank ihrer Übermacht auch glücklich in der Lage, sämtlichen übrigen Mächten – auch wenn diese noch so sehr in ihren Verfassungen selber schon die Respektierung aller humanen Rechte geloben – bei deren Regierungsgeschäften auf die Finger zu schauen und zu hauen, wenn nötig.
Die Maximen, die die USA da geltend machen, haben – unter anderem – durchaus gewisse zivile Umgangsformen zwischen Staatsmacht und Regierten zum Inhalt; und diese Gepflogenheiten haben ihrerseits einen handfesten, nämlich politökonomischen Inhalt; von dem wird noch die Rede sein. Kein Menschenrechtskatalog verkündet jedoch – und erst recht erläutert kein einschlägiger Kommentar – die darin unterstellten Zwänge des bürgerlichen Gelderwerbs, geschweige denn das Interesse Amerikas daran, daß auswärtige Völkerschaften von ihrer nationalen Obrigkeit eben diesem Sachzwang dienstbar gemacht werden, nämlich sich weltwirtschaftlich nützlich zu machen, und nicht irgendwelchen sonstigen, damit womöglich unvereinbaren eigennützigen Zwecken. Das alles geht vollständig auf in der Phrase vom unveräußerlichen Recht des Menschen, seines Glückes Schmied zu sein; wo es in der Sache darum geht, Konkurrenz zu dekretieren, wird nichts als Freiheit gefordert; und überhaupt ist jedermann eingeladen, nicht den Spuren des bürgerlichen Elends im Grundrechtskatalog zu folgen, sondern dem offiziellen Fingerzeig auf eine ganze Latte offenbar sehr verbreiteter staatlicher Grausamkeiten bis hin zu Folter und Mord im Regierungsauftrag und die Menschenrechtspolitik der USA für die beste Versicherung gegen solche „Übergriffe“ zu halten, die überhaupt zu haben ist. Daß es um eine solche allgemeine Lebensversicherung für drangsalierte Untertanen so richtig dann doch nicht geht, wird freilich schon daran ersichtlich, daß Amerikas Obhut die Kompetenz einschließt, allein und nach eigenem Ermessen zwischen verbotenen Übergriffen, menschenrechtlich irrelevanten politischen Aktivitäten und staatlicher Pflichterfüllung, etwa bei der Bekämpfung „terroristischer Umtriebe“, verbindlich zu unterscheiden. Und dieses Ermessen folgt Gesichtspunkten, die in ihrer Eindeutigkeit gar nicht so leicht mit dem Ideal eines anständigen Umgangs der Obrigkeit mit ihren Untertanen zur Deckung zu bringen sind. Es handelt sich dabei eben um Menschenrechtspolitik: um ein Stück Weltpolitik mit dem Menschenrechtskatalog. Die schmarotzt am menschlichen Mitleid mit Opfern staatlicher Gewalt und an der Empörung über die Gewalttätigkeit höchster Gewalten; sie wird nicht veranstaltet, um die Schreckensbilanz staatlicher Herrschaft auf dem Globus zu korrigieren.
Für Idealisten einer überstaatlichen menschenrechtlichen Norm gibt es daher immer genügend Anlaß zu bedauern – und die aus den Hauptstädten der Menschenrechts-Internationale mit Anklagen überzogenen „Gewaltherrscher“ tun sich leicht zu „entlarven“ –, wie „inkonsequent“ die internationale Rechtspflege ausfällt, bei der die USA sich die Federführung nicht nehmen lassen, und wie da „mit zweierlei Maß gemessen“ wird. Leider blamiert dieser Befund nicht die Fiktion einer Rechtslage, der die Weltmacht zu Diensten sein müßte, sondern bloß die Menschenrechtspolitik der USA und auch die nur ein bißchen, weil alle Empörung in die Aufforderung an die Weltmacht und ihre Gehilfen mündet, ihre Aufsichtspflicht über den Rest der Welt ernst zu nehmen. Genau das tut die aber immer schon zur Genüge und läßt sich dabei auch keine Inkonsequenz zuschulden kommen und kein doppeltes Maß. Sie mißt nämlich jeden auswärtigen Gewaltgebrauch konsequent an dem einen Kriterium des Respekts, der ihr als der maßgeblichen Schutzmacht der Menschenrechte entgegengebracht wird – schließlich verfügen die USA exklusiv über das nötige Unterscheidungsvermögen, um herauszufinden, ob das Abhacken diebischer Hände zur Folklore eines hochanständigen Scheichtums gehört oder ein Indiz für strafwürdigen Fundamentalismus ist; wo Leichen für Staatsterrorismus und wo für Terrorismusbekämpfung stehen; daß in einem Land, das US-Konzerne enteignet, Kunst und Meinungsfreiheit unerträglich unterdrückt werden… So schwierige Urteile können unmöglich anderen Staaten überlassen werden, auf deren menschenwürdige Selbstbeschränkung ja umgekehrt Amerika aufpassen muß. Und freischaffende Idealisten der ‚human rights‘ wie die von ‚amnesty international‘ finden mit ihren Anklagen ungeahndeter Menschenrechtsverletzungen genau soviel Gehör, wie daraus der Schrei der gequälten Kreatur nach mehr amerikanischer Gewalt und sonst gar nichts hörbar wird.[11]
Was an der Beschwörung von Freiheit und Menschenrechten als den maßgeblichen Leitsternen amerikanischer – oder gleich allgemeiner: westlich-demokratischer – Weltpolitik immer wieder beeindruckt, ist nicht bloß die Selbstsicherheit, mit der die Häupter der Freien Welt anderen Staaten Gewalt gegen Oppositionelle als Verbrechen anlasten, die sie in vergleichbaren Fällen für sich als höchstes, weltweit zu unterstützendes Recht in Anspruch nehmen. Mindestens ebenso eindrucksvoll ist der Zynismus in allen Fragen des materiellen Elends, der mit der Berufung auf die wahren höheren Werte einhergeht. Die kapitalistisch erzeugte Armut wird als Anklagepunkt gegen die politisch Verantwortlichen einfach nicht zugelassen – es sei denn vermittels ihrer Umdeutung in eine Konsequenz „undemokratischer“ Politik. Demokratische Politiker und Sachverständige, nicht bloß in den USA, scheuen nicht einmal das offene Bekenntnis dazu, daß eine Wirtschaftspolitik in ihrem Sinn – der zweite Teil dieses Aufsatzes wird dazu noch einiges erläutern –, die sie aus Gründen der ökonomischen Vernunft und der Menschenwürde kompromißlos fordern, die hoffnungslose Verarmung der arbeitenden resp. arbeitslosen Massen ganzer Nationen, und zwar weit unter die schon einmal erreichte Stufe der Selbsterhaltung, zum sachlich zwingenden Erfordernis macht.
Inkonsequent ist dieser Zynismus freilich nicht, vielmehr höchst folgerichtig. Er verrät die Abstammung der höchsten und letzten Rechtfertigungsgründe globaler Einmischungspolitik aus der bürgerlichen Ideologie, die in getreuer Affirmation des kapitalistischen Systems der Erwerbstätigkeit den materiellen Lebensunterhalt in dieser Gesellschaft zur Privatsache jedes einzelnen erklärt: zur Sphäre seiner ganz „menschennatürlichen“ Freiheit, in die die öffentliche Gewalt grundsätzlich nicht hineinregieren darf, die sie andererseits freilich auf ihre Begrenzung an den ebenso privaten materiellen Mitteln anderer festnageln muß. Das muß sie in der Tat – wovon die Menschenrechtsidee allerdings nichts wissen will –, eben weil die Privatheit der materiellen Mittel, das Eigentum daran, das gesellschaftlich herrschende Prinzip ist, nach dem Armut, Reichtum und deren glückliche Verknüpfung in der Lohnarbeit fürs Kapital zustandekommen. Dieser Einsatz der Staatsgewalt fürs Eigentum und sein Monopol auf den gesellschaftlichen Reichtum und dessen Produktion stellt sich in der dazugehörigen Ideologie als Dienst am Privatleben und vornehme Zurückhaltung der Staatsmacht dar, umgekehrt die Unterwerfung unter die „Sachzwänge“, die das Privatleben, seinem materiellen Inhalt nach, wirklich bestimmen, als Freiheit – der Betroffenen nämlich, mit sich und der Welt ins Reine zu kommen.
Diese Ideologie verwenden die USA offensiv als höhere Weihe für ihre Weltpolitik des Vorschriftenmachens, Kontrollierens und Bestrafens. Als Anwalt der Untertanen fremder Staaten, im Namen eines denen zugesprochenen Rechts, richtig beherrscht zu werden, konfrontieren sie den Rest der Welt mit ihrem Anspruch auf richtiges, nämlich vollinhaltlich und formvollendet funktionales Herrschen. Ihre Parteinahme für den freien Weltbürger richtet sich nicht gegen die Herrschaft nationaler Instanzen und die von ihr ausgehenden Zwänge, denen die Gesellschaft gehorchen muß. Sie richtet sich an die politischen Machthaber mit der Forderung, gewisse supranationale Regeln speziell bei der demokratischen Legitimation ihrer Herrschaft einzuhalten und bei der Herstellung von ‚Law and Order‘ das Privatsubjekt im Untertanen zu achten; und dabei kommt es noch nicht einmal auf die Zugeständnisse selbst an, die die politischen Gewalten ihren Bürgern machen sollen, sondern auf die ideologische Handhabe, Amerikas Unzufriedenheit mit der Politik anderer Staaten als moralische Kritik an deren unnötiger Gewalttätigkeit geltend zu machen. In allen drei Punkten ist die freiheitlich-demokratische Beschwörung der Menschenrechte die radikale Antithese zu der kommunistischen Parole, die ‚Proletarier aller Länder‘ sollten ‚sich vereinigen‘: Dieser Appell richtet sich – ohne Berufung auf irgendeinen höheren Wert an das Fußvolk nationalstaatlicher Herrschaft; er ruft dazu auf, die von der politischen Gewalt in Kraft gesetzten gesellschaftlichen Zwänge – und die Brutalitäten politischer Ordnungsstiftung sowieso – abzuschaffen; zur moralischen Waffe eignet er sich überhaupt nicht, weil er es eben nur darauf anlegt, daß die angesprochenen Lohnarbeiter aus ihrer Klassenlage eine richtige Konsequenz ziehen; die Fiktion den „Menschen“, dem die Weltmacht ein nicht veräußerliches Recht auf gute Herrschaft zuspricht, ist damit auch schon kritisiert. Ausgerechnet die Schutzmacht der „Weltrevolution“ hat hier freilich von einem Gegensatz nichts wissen wollen; den Machthabern der Welt hat sie ihren Realen Sozialismus als zusätzliches „soziales Menschenrecht“ nahegebracht, dessen Beachtung ihnen nur nützen könnte – und das war noch nicht einmal die Andeutung einer weltpolitischen Erpressung zu prosowjetischem Wohlverhalten. Umgekehrt haben sich die Chefs und Ideologen der Freien Welt mit Begeisterung auf den Systemgegensatz zwischen „Menschenrechten“ und „Weltrevolution“ gestürzt; im Kampf und für ihren Kampf mit der Sowjetunion um die Vorherrschaft auf dem Globus[12] haben sie die feindliche Macht als prinzipiellen, systematischen Verstoß gegen die Natur geächtet und ihr Sendungsbewußtseins zur explizit so genannten und auch benutzten „Menschenrechtswaffe“ perfektioniert. Am Ende haben die regierenden Sowjet-Nationalisten den Vorwurf der immerwährenden, systemimmanenten Menschenrechtsverletzung bekanntlich dadurch widerlegt, daß sie ihn eingesehen und auch für ihre Manövriermasse das einzig menschengemäße System übernommen haben. Ihre nationalrussischen Nachfolger verstoßen seither mit ihren Barbareien grundsätzlich gar nicht mehr und im übrigen wie jeder unsichere Partner nur noch fallweise und je nach amerikanisch-russischer Verhandlungslage gegen die Menschennatur.
Deren Imperative haben dadurch freilich nichts an Beliebtheit eingebüßt, und das aus gutem Grund. Diplomatisch ist und bleibt die Menschenrechtsidee in ihrem Universalismus das optimale Mittel der amerikanischen Politik, um mit moralischen Unwerturteilen ihre Ansprüche, Vorbehalte, Drohungen und Feindschaftserklärungen gegen andere Staaten und deren Nationalismus zu verdeutlichen – eben als Sorge um die geschädigten Untertanen der inkriminierten Gewalt. Und für die einheimische staatsbürgerliche Gesinnungspflege ist sie erst recht unschlagbar: Sie schließt den Bürger der bürgerlichen Weltmacht – und der ihrer Verbündeten darf an diesem Stolz teilhaben – ideell mit deren Hoheitsanspruch gegen alle Gewaltmonopolisten minderen Grades zusammen; so als ginge es ausgerechnet in den härtesten Angelegenheiten nationaler und internationaler Gewalt um sein und überhaupt das wahre Menschentum, und als wäre der Imperialismus seiner Nation der schlagende Beweis, daß er sich schmeicheln darf, im gesicherten Vollbesitz aller menschennatürlichen Rechte und insofern der weltweit verbindliche Mustermensch schlechthin zu sein. Bei soviel Identität des Untertanen mit dem Universalismus der über ihn herrschenden politischen Gewalt braucht es gar keine ausdrückliche Rassenlehre, um die selbstbewußten Inhaber einer Green Card an sich als gültige Verwirklichung jener Menschen-Natur
glauben zu lassen, deren Recht weltweit durchgesetzt gehört. Der amerikanische Patriot „begreift“ sich selbst als den leibhaftigen Gewaltvorbehalt gegen die gesamte Staatenwelt und in diesem Sinne als Auftraggeber seiner Weltmacht.[13] Durch die, menschlich gesehen, auch für Amerikaner gar nicht bekömmliche Indienstnahme seiner Leiblichkeit für den real existierenden Gewaltbedarf seiner staatlichen Befehlshaber ist dieser ideologische Überbau am allerwenigsten zu erschüttern: Per definitionem kämpft im US-Soldaten der wahre Mensch gegen die minderwertige Rasse derer, die sich unterdrücken lassen…
Ein Zwischenergebnis: Die Macht der USA und ihre materiellen Voraussetzungen
Die Weltmacht USA hat „vitale Interessen“ in aller Welt. Das ist kein Wunder. Denn sie hat ein ganz grundsätzliches, für ihren Bestand als Weltmacht lebenswichtiges Interesse: an politischer Gewalt, wo immer, von wem auch immer, und unabhängig von dem bestimmten Anliegen, für das sie gebraucht wird. Dieses Interesse geht keineswegs dahin, Gewaltanwendung in der Staatenwelt zu be-, geschweige denn zu verhindern – dann wäre es mit einer regulären Staatenwelt gleich vorbei… –; die Förderung oder sogar Schaffung von Machthabern und Eröffnung von Kriegen gehört genauso zum Programm wie die Unterbindung von Gewaltaktionen und die Entmachtung von Souveränen. Worum es den USA in allen Fällen geht, ist ein Kontrollregime über den weltweiten Gewaltgebrauch, die Herstellung und Aufrechterhaltung eines von ihnen gelenkten globalen Gewalthaushalts, als Mittel ihrer überlegenen Macht. Die Staatenwelt teilt sich danach auf in Feinde, Problemfälle, Konkurrenten, Verbündete, eigene und gegnerische Unterstützer, Einflußsphären. Sie sortiert sich hierarchisch gemäß der jeweiligen militärischen Potenz und der Zahl und Macht und Linientreue der jeweiligen Verbündeten. Die Geographie der Staatsgrenzen, mitsamt der Verteilung von Meeren und Landmassen auf dem Globus, wird zum Material für strategische Landkarten, die mit den Fortschritten der Waffentechnik ebenso wie mit jeder Verschiebung in einem regionalen oder lokalen Kräfteverhältnis ihr Gesicht wandeln. Die Abstraktion ‚Macht‘ hat darin ihre praktische Realität. Große Abteilungen der engagierten Regierungsapparate, des amerikanischen wie in den anderen Nationen, brauchen deshalb gar keine anderen Parameter im Kopf zu haben und keine anderen Maximen zu befolgen als die seltsam primitiven, die die Experten des Faches Politologie in der höchst komplexen Rubrik „Machtpolitik“ aufzählen und bei deren Anwendung sie die wirklichen Machthaber so furchtbar gern beraten – würden: wer mit wem gegen wen; wieviel militärische Abschreckungs- und sonstige Macht kann und will jede Seite aufbieten…
Die amerikanische Weltmacht lebt natürlich nicht von den Einsätzen ihres Gewaltapparats.[14] Der setzt vielmehr die Mittel voraus, die er verschlingt. Und die sind beträchtlich. Sie müssen nämlich eine Militärmacht hergeben, die den zu gesicherter Überlegenheit nötigen Abstand zwischen Amerika und dem Rest der Welt herstellt und für ein permanentes Abschreckungsregime über die gesamte Staatenwelt taugt. Dazu gehört erstens eine Rüstung, deren permanenten qualitativen Fortschritten keine andere Nation etwas Ebenbürtiges entgegenzusetzen vermag, zweitens der Unterhalt mehrerer aus dem Stand kriegsbereiter und garantiert siegfähiger Armeen. Schon deswegen überschreitet der Reichtum, den die USA für ihre weltweite Macht aufwenden, gleichfalls alles, was andere Nationen sich ökonomisch leisten können. Und dies nicht bloß in einem einmaligen Kraftakt, mit dem der Vorsprung der US-Macht wenigstens für eine Zeitlang gesichert wäre. Überlegenheit garantierende Mittel müssen kontinuierlich anfallen, als laufend verfügbarer Überschuß aus der Friedenswirtschaft der Nation – denn um Frieden, den Weltfrieden handelt es sich bei dem Zustand, auf dessen Erhaltung die amerikanische Abschreckungspolitik gerichtet ist. Um des lieben Friedens willen also verlangt die Weltmacht ihrer Nationalökonomie nicht bloß staatlich verwendbare Überschüsse ab, die alle vergleichbaren Erträge anderer Nationen in den Schatten stellen, sondern Akkumulationsleistungen, deren Erträge den nie definitiv befriedigten Bedarf der politischen Instanzen decken und ihr eigenes kontinuierliches Wachstum sicherstellen.
Was die Weltpolitik der USA verschlingt, das muß die Ökonomie hergeben: Das ist die Existenzbedingung amerikanischer Macht und zugleich deren Auftrag. Denn was sie fordert, das fördert sie auch. Wenn sie sich die nötigen Mittel nimmt, um der Staatenwelt eine Ordnung zu verpassen, dann setzt sie voraus, daß ihr die ökonomischen Mittel der friedlich geordneten Welt zur Verfügung stehen, und macht diese Voraussetzung als Anspruch geltend: Sie führt einen permanenten Konkurrenzkampf um den ökonomischen Nutzen aus dem „friedlichen Zusammenleben der Völker“. Das Mindeste, was die amerikanische Friedensordnung hierbei zu leisten hat, ist die Gewähr, daß kein ordentlicher Souverän mit seinen Staatsgrenzen und seiner inneren Ordnung zur Schranke für die Akkumulation amerikanischen Reichtums wird. Wenn es für die Weltmacht darauf ankommt, daß keine andere Nationalökonomie mit der Größenordnung und den Wachstumserfolgen der amerikanischen mithalten kann, dann wird mit den Mitteln globaler Überlegenheit auch dafür gesorgt, daß kein Staat seine Ökonomie dem praktischen Leistungsvergleich mit dem wachstumsschaffenden Reichtum Amerikas, dem Weltmarkt also entzieht oder gar dessen Ergebnisse zu Ungunsten Amerikas verfälscht – was aus amerikanischer Sicht allemal der Fall ist, wenn die USA verlieren. Denn das widerspricht eindeutig den Spielregeln der Veranstaltung namens Weltwirtschaft, an der alle Nationen als schwächere Konkurrenten und zusätzliche Quellen amerikanischen Reichtums teilzunehmen haben.
Die Macht, um die es den USA geht, hat also nicht bloß ihre eigene abstrakte, nämlich strategische Logik. Sie hat auch einen materiellen Inhalt und Zweck, nämlich die Pflege ihrer eigenen Voraussetzung: der Ökonomie, der sie ihre Mittel entnimmt. Die Weltmacht Amerikas kann nur funktionieren, weil und soweit sie in ihrem einheimischen Kapitalismus über eine Geldmaschine von überlegener Effizienz verfügt. Deswegen verlangt sie von der ganzen Welt einen funktionierenden Kapitalismus, der sich funktionell in diese Maschinerie einfügt. Sich selbst fordert sie die Leistung ab, für einen sachgerecht funktionierenden Welt-Kapitalismus zu sorgen.
So sieht der ökonomische Alltag des Weltfriedens dann auch aus.
B. Der globale Kapitalismus
(Teil 2 folgt in der nächsten Nummer.)
[1] Die hier angeführten und noch etliche andere „Fälle“ werden in den folgenden Überlegungen immer wieder als Beispiele vorkommen; es wird gebeten, darauf zu achten, wofür sie jeweils als Beispiel stehen. Ein auch nur annähernd vollständiger Überblick über Amerikas weltpolitische Aktivitäten ist nicht beabsichtigt.
[2] Mehr als ein Scherz am Rande: Nicht einmal die BRD, die sich sonst von niemandem etwas vorschreiben läßt, was den Umgang der Behörden mit den diversen Abteilungen der eigenen Bevölkerung betrifft, ist davor sicher, in ihrem inneren politmoralischen Feldzug gegen eine Gruppe bekennender Idioten des bürgerlichen Konkurrenzerfolgs, die „Scientology“-Kirche, durch die US-Außenministerin persönlich, und zwar gleich bei deren Antrittsbesuch in Bonn, zurechtgewiesen zu werden.
[3] Die USA führen sich beinahe wie der internationale Gewaltmonopolist auf; doch – um erst gar keine Mißverständnisse aufkommen zu lassen – von einem wirklichen Gewaltmonopol nach Art der flächendeckend präsenten Ordnungsmacht, der souveräne Staatsgewalten ihre Gesellschaft unterwerfen, kann beim Verhältnis der USA zu den übrigen Gewaltmonopolisten auf der Welt nicht die Rede sein. Nicht weil ihre Macht dazu zu klein wäre; das weltbürgerliche Ideal einer globalen Regierung, zu der die einzelnen Souveräne sich quasi wie Bürger oder als bloße nachgeordnete Instanzen verhielten, ist gar nicht der Inhalt des Anspruchs, den die USA an die Gewaltmonopolisten dieser Welt stellen. Das ist schon daran ersichtlich, daß kein US-Politiker je auf die Idee käme, seine eigene Nation könnte jemals in einem globalen Gesamtstaat aufgehen. Aber auch die anderen Staatsgewalten sieht und behandelt die amerikanische Weltpolitik durchaus nicht als von Washington regierte Bundesstaaten zweiter Ordnung, sondern als ihr gegenüberstehende Mächte mit völlig eigener, ungeteilter Verantwortung für das, was in ihrem anerkannten Zuständigkeitsbereich geschieht und was sie von dem aus unternehmen. Die Verantwortung will Amerika ihnen nicht abnehmen; im Gegenteil: Es kennt ein paar klare Richtlinien, nach denen die auswärtigen Souveräne ihre ungetrübte Souveränität selber wahrzunehmen haben – nämlich mit dauerndem Blick nach Washington und in selbstverständlichem Respekt vor dessen Willen; jederzeit bereit, die eigenen Entscheidungen amerikanischer Beurteilung zu unterwerfen und gegebenenfalls zu korrigieren. Seine eigene weltpolitische Verantwortung definiert der amerikanische Souverän komplementär so, daß er den anderen Staaten nicht etwa ihre Gewalt abnehmen, sondern deren souveränen Gewaltgebrauch unter Kontrolle halten muß; schon deswegen, weil ihm sonst die Kontrolle über die Bedingungen, unter denen er selbst agiert und von denen seine eigene Machtposition abhängt, entgleiten würde. Was Amerikas Weltmacht verlangt, ist folglich gerade nicht die Abschaffung fremder Souveränität, sondern ein gebührender Abstand der eigenen zu deren Macht: eine Überlegenheit, die ausreicht, um die freien und souveränen Gewaltmonopolisten einem amerikanischem Generalvorbehalt und einer durch Amerika definierten Auftragslage zu unterwerfen. Wenn die anderen Machthaber keine andere Chance haben, als sich an Amerikas Vorgaben, die globale Hierarchie der Staaten und ihr Kräfteverhältnis betreffend, abzuarbeiten – dann ist für die USA die Welt in Ordnung.
[4] Ausführlichere „Klarstellungen zum Vietnamkrieg“ stehen in dem Heft „Imperialismus 2: Die USA – Weltmacht Nr. 1“ aus dem ehemaligen Resultate-Verlag, München 1979.
[5] Ausschließlich in diesem Zweifel besteht übrigens das, was man in den USA „Isolationismus“ nennt. Es handelt sich bei diesem (anti)weltpolitischen Standpunkt bloß um einen etwas übersteigerten Anspruch auf Botmäßigkeit der restlichen Welt; darauf, in allem, was Amerika von der Welt will und braucht, prompt bedient und mit Widerspenstigkeiten aller Art, Geldwünschen vor allem, verschont zu werden. Um einen Vorschlag der Art, selber den Rest der Menschheit in Ruhe zu lassen, handelt es sich nicht.
[6] Diesem Thema widmet sich ein eigener Beitrag im vorliegenden Heft.
[7] Ausführlicheres zu diesem Thema bietet der GegenStandpunkt 2-94, S.137 – „Massaker und Autonomie. Neueste Entwicklungen im nahöstlichen Friedensprozeß“ – und GegenStandpunkt 4-96, S.47 – „Die Politik der Regierung Netanjahu: Weder Land noch Frieden. Israel bleibt das Projekt ‚Judenstaat‘“.
[8] Es ist nun mal ein wesentliches Merkmal der Institution, nämlich die Kehrseite des diplomatischen Vorteils der ganzen Konstruktion für ihren Konstrukteur, daß die UNO ihren eigenen Standpunkt und ein – wie sehr auch immer von den wirklichen Mächten bloß geliehenes – Eigenleben entfaltet, das Geschöpf sich mit seinem Schöpfer entzweit. Von diesem Eigenleben handelt der UNO-Artikel in GegenStandpunkt 1-93, S.15.
[9] Das war zu Zeiten des sowjetischen „Njet“ in der UNO wirklich noch anders: Da war die Behauptung eines vom Westen exklusiv gehüteten und zu vollstreckenden Völkerrechts schon deswegen als bloßes parteiisches Ideal kenntlich, weil der Gegner für seine Belange genauso „argumentierte“ und nicht von vornherein im Unrecht war, weil er nicht wirksam ins Unrecht gesetzt werden konnte.
[10] Allzu gründlich darf man ohnehin nicht nachdenken über diese „Idee“, die die Kategorie des Rechts, also eines positiven Bezugs zwischen dem menschlichen und einem „höheren“, als verpflichtend anerkannten, verbietenden und erlaubenden Willen, mit einer vorgestellten waldursprünglichen Menschennatur verknüpft. Die nie widerlegte, dafür um so gründlicher vergessene Kritik an dieser ideologischen Konstruktion hat bereits K. Marx in seinem Beitrag „Zur Judenfrage“ für die Deutsch-Französischen Jahrbücher geliefert.
[11] Das haben die meisten einschlägig engagierten Vereine auch längst gemerkt; und soweit sie nicht ohnehin gar nichts anderes meinen, halten sie es für eine geschickte Taktik, ihre Moral – im Interesse der Entrechteten, versteht sich – nach dem herrschenden Kräfteverhältnis einzurichten.
[12] Wie wenig dieser Kampf durch den Gegensatz der politischen oder ökonomischen, geschweige denn weltanschaulichen Systeme begründet war, zeigt sich im Nachhinein am Umgang des Westens mit dem russischen Rechtsnachfolger deutlich genug.
[13] Von einer extremistischen Sumpfblüte eben dieses Selbst- und Menschenbildes handelt der Aufsatz „Oklahoma: Eine Bombe für die Nation“ in GegenStandpunkt 2-95, S.117.
[14] Eine politische Ökonomie des Ausplünderns in dem Sinn, daß die überlegene Macht mit Besatzungstruppen hingeht und sich mit Gewalt aneignet, was sie im eigenen Land nicht hat: Das ist Amerikas Sache nicht; damit wäre seine Übermacht auch schnell am Ende. Die universelle Abschreckung, auf der die Weltmacht der USA beruht, funktioniert nur, weil diese Nation Unternehmungen von der Art faschistischer Eroberungskriege nicht nötig hat. Was sie braucht und sich leisten muß, ist der Dauereinsatz einer Militärmacht, die Überlegenheit über jeden Staat garantiert, der sich einen konkurrierenden „Griff nach der Weltmacht“ zutraut.