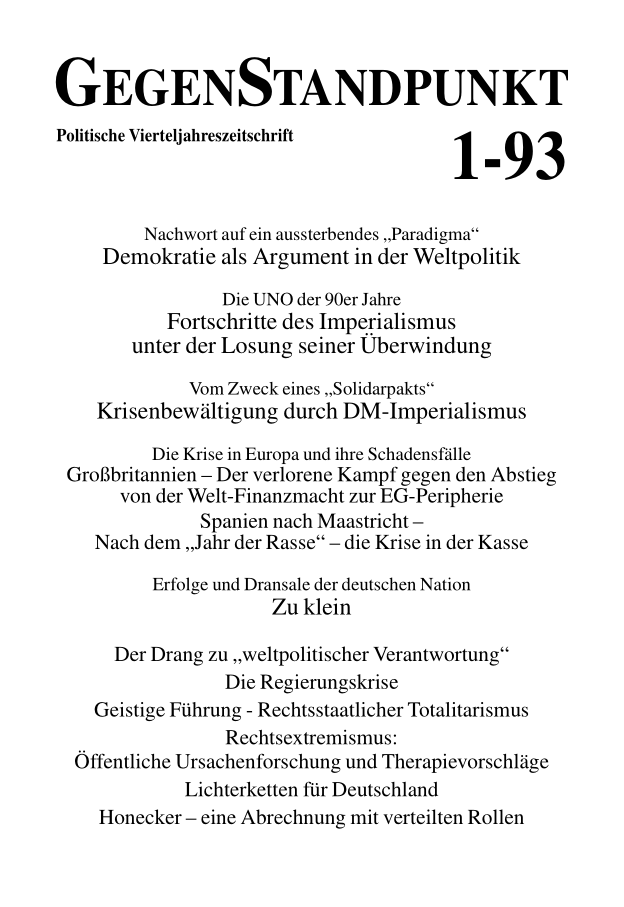Die UNO der 90er Jahre
Fortschritte des Imperialismus unter der Losung seiner Überwindung
Mit dem Ende der Ost-Westkonfrontation entstehen neue Aufsichts- und Kontrollbedürfnisse, die von den interessierten Staaten zur kollektiven Betreuung in die UNO getragen werden. Diese scheint damit – die „Blockade durch die SU“ ist vorbei – dem Ideal einer „oligopolistischen Weltpolizei“ nahe zu kommen. An den national unterschiedlich interessierten Definitionen der Ordnungsfälle Irak, Jugoslawien, Kambodscha, Somalia, zeigt sich jedoch, dass eine gemeinsame Ordnung nur als Bedingung des je nationalen Fortkommens interessiert, der jeweilige „Fall“ zum Material der Konkurrenz der imperialistischen Nationen um die Vorherrschaft auf der Welt wird. Außerdem: Kleiner Exkurs zum außenpolitischen Stil Deutschlands.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
- Die neue UNO: Ein Traum wird wahr
- Das Programm: Der verlogene Schein einer friedlichen Rechtsgemeinschaft der Staaten
- Wem und wozu die UNO taugt, oder: Vom Bedürfnis nach einem pluralistischen Gewaltmonopol und den Tücken einer Gemeinsamkeit, die sich imperialistischer Konkurrenz verdankt
- Clearingstelle für weltpolitischen Ordnungsbedarf
- Lizenzen für internationale Einmischung
- Die Konkurrenz um die Definition gemeinsamer Ordnungsstiftung
- Die Fiktion einer oligopolistischen Weltpolizei
- Kleiner Exkurs zu Deutschland, imperialistische Stilfragen betreffend
- PS zum Haltbarkeitsdatum
Die UNO der 90er Jahre
Fortschritte des Imperialismus unter der Losung seiner Überwindung
Die neue UNO: Ein Traum wird wahr
Die UNO und ihre Charta genießen seit neuestem einen hemmungslos guten Ruf. Die Charta – die dafür niemand zu kennen braucht – gilt als eine Art Weltgrundgesetz, das entscheidet, was den Staaten zusteht und wie ihnen Recht geschieht, und als Handlungsanweisung für die Herstellung ordentlicher Verhältnisse auf dem Planeten. Was in ihrem Namen und UNO-Auftrag geschieht, kann weder falsch noch unrecht sein; und daß in jüngster Zeit unter UNO-Flagge allerhand Gewaltsames geschieht, regulärer Krieg und viele Aktionen dicht darunter, das berechtigt zu den schönsten Hoffnungen. Denn Kriege, zu denen die UNO ermächtigt, gehen dermaßen in Ordnung, daß an ihnen nichts geringeres abzulesen ist als der allmähliche Fortschritt der Weltordnung überhaupt.
Freilich auch gewisse Stockungen; denn noch längst löst die UNO nicht alles gewaltsam ein, was ihre Charta verspricht. Die „Weltorganisation“ versagt noch zu oft bei der gleichmäßigen, flächendeckenden Durchsetzung ihrer Resolutionen, die im Großen und Ganzen den vernünftigen Konsens der Völkergemeinschaft widerspiegeln; wohl deswegen, weil sie sich noch nicht genügend von den nationalegoistischen Berechnungen ihrer Mitglieder emanzipiert hat, noch viel zu sehr auf deren Mittel und guten Willen angewiesen ist und noch viel zu wenig ein eigenständiges Macht-Subjekt. Aber es wird daran gearbeitet; und vorangekommen ist die UNO doch auch, das gestehen selbst Skeptiker zu. Die schöne Aufgabe gewaltsamer Friedenstiftung packt sie schon an, ebenso manche der modernen Weltprobleme, die sich bekanntlich nicht nach nationalen Grenzen richten. Und eins steht auf alle Fälle fest: Überhaupt keine Rede kann im Zeitalter der neuen UNO mehr sein von jener alten Unart großer Nationen, die man Imperialismus nennt.
Dieser glückliche Weltzustand ist eingetreten, seit die Staatenwelt ihren großen Störenfried, die Sowjetunion, losgeworden ist. Bislang hat nämlich die oberste Entscheidungsinstanz der Welt, der UNO-Sicherheitsrat, an dem Konstruktionsfehler gelitten, daß das Vetorecht des einen großen Gründungsmitglieds seine schönsten Initiativen abgeblockt hat. Mit dieser „Selbstblockade“ ist es jetzt vorbei; die Weltorganisation kann ihrem eigentlichen Beruf nachkommen und die Staatenwelt in Ordnung bringen. Zwar fehlt noch einiges an Kants regulativer Idee vom ewigen Frieden und am politikwissenschaftlichen Traum von einem handlungsfähigen Weltgewaltmonopol, das die „höchsten Gewalten“ über sich einrichten, um einander freiwillig nach Recht und fester Verfahrensordnung zur Vernunft zu zwingen. Aber die ersten Schritte sind getan, um so etwas wahr werden zu lassen.
Oder etwa doch nicht? Geht es womöglich um etwas ganz Anderes?
Das Programm: Der verlogene Schein einer friedlichen Rechtsgemeinschaft der Staaten
Eins steht jedenfalls fest: Keine Schießerei größerer Ordnung läuft mehr ab ohne UNO-Beobachtung und -Intervention. Keine Hungerkatastrophe greift um sich, kein Flüchtlingstreck setzt sich in Marsch, ohne daß die UNO es registriert. Keine globale Naturzerstörung nimmt ihren Lauf, ohne daß die UNO sich darum sorgt. Je wüster es zugeht, um so wichtiger nimmt sich die Gemeinschaft der Veranstalter des betreuten Elends. Sie begreift sich als weltpolitisches Subjekt und tritt auch wie ein solches auf: mit dem Standpunkt des Auftraggebers im Krieg der USA gegen Saddam Husseins Irak; mit dem Standpunkt der Überwachungsbehörde und des Schlichters in blutigen Konflikten aller Art; mit dem Standpunkt der Mandatsmacht in heruntergekommenen Staatsgebilden, in denen keine souveräne Gewalt mehr anzutreffen ist; mit dem Standpunkt der tonangebenden Weltzentrale bei der Befassung mit globalen Folgeerscheinungen der modernen Weltordnung, die allgemein als Weltprobleme anerkannt sind. Und so beziehen sich die souveränen Staaten auch – neben allem, was sie sonst tun – auf ihren gemeinsamen Club: Zur Gewaltanwendung lassen sie sich beauftragen; sie intervenieren im Namen der UNO; Vorbeugung gegen und Umgang mit Hunger- und anderen Katastrophen überlassen sie gern den „hohen Kommissaren“ der Weltorganisation; usw.
*
Entsprechend selbstbewußt gibt der Chef des Unternehmens Auskunft.
Frage des demokratischen, also in Kategorien des Personenkults denkenden Korrespondenten der „Frankfurter Rundschau“: „Wenn Sie nach Ihrem ersten Amtsjahr Bilanz ziehen, haben Sie dann den Eindruck, neue Akzente gesetzt zu haben?“
Butros-Ghali in aller Bescheidenheit: „Meine Arbeit unterscheidet sich nicht von jener meines Vorgängers, aber die Situation hat sich verändert. Es gibt viel mehr Konflikte, die Vereinten Nationen genießen mehr Glaubwürdigkeit, und wir haben mehr Probleme zu lösen. Ich erinnere Sie an ein Ereignis von kapitaler Bedeutung, das die öffentliche Meinung in Bann gezogen hat, nämlich den Umweltgipfel von Rio. 1992 haben sich wichtige Dinge ereignet, bei denen die UN als Motor, als Führungskraft auftraten.“
Die Völkergemeinschaft streitet sich mehr; das spricht für den Verein, den die feindlichen Brüder bilden. Der kann außerdem Probleme auf die Tagesordnung von Veranstaltungen setzen, die, wenn schon sonst nichts, so doch viele Journalisten in Bewegung setzen. Das ist Richtlinienkompetenz.
„Ein weiteres Beispiel für die veränderte Situation ist, daß im vergangenen Jahr zwei Dutzend neue Staaten Mitglieder der UN wurden, darunter alle Republiken der früheren Sowjetunion. Wir haben in den neuen Hauptstädten Büros eröffnet und helfen diesen Ländern, am internationalen Leben teilzunehmen. Die Verantwortung der UN ist vielfältiger geworden. Wir beschäftigen uns jetzt mit Problemen der Demokratisierung, der Menschenrechte, mit wirtschaftlichen, sozialen und strukturellen Reformen. Die Vereinten Nationen spielen eine wachsende Rolle in planetarem Maßstab.“
So läßt es sich auch sehen, das Ausscheiden eines Gründungsmitglieds, das sich immerzu mit seinen abweichenden „wirtschaftlichen, sozialen und strukturellen Reform“-Vorstellungen ins Management des Weltfriedens einmischen wollte und nie eine „Rolle in planetarem Maßstab“ spielen durfte: Statt seiner hat die UNO viele neue Mitglieder, denen sie bei der Umstellung aufs neuerdings alleingültige System zur Seite steht. Denn endlich braucht sie nicht mehr so zu tun, als wäre sie systemneutral.
„Die Tatsache, daß alle Staaten die UN zum Handeln auffordern, daß die UN an allen Ecken der Welt präsent sind, ja sogar die Tatsache, daß gewisse Entscheidungen der UN so umstritten sind, erbringt den Beweis, daß die Vereinten Nationen neue Aufgaben haben.“
Kein Volk sträubt sich: Alle wollen eine UNO, die ihnen Vorschriften macht, auch wenn die ihnen dann gar nicht passen. Deswegen sehen sie wohl auch ein, daß ihr gemeinsamer Club ein eigenes Militär braucht:
Der Korrespondent fragt nach dem Schicksal des Vorschlags, eine multinationale „Schnelleingreiftruppe“ im Dienst der UNO und einen 1-Mrd-Dollar-Fonds für „Friedensmissionen“ zu schaffen.
Der Generalsekretär:„Sowohl im Sicherheitsrat wie in der Generalversammlung waren die Reaktionen äußerst positiv. Ich habe auch von zahlreichen Staaten zustimmende Antworten erhalten. Sie sind bereit, dem Sicherheitsrat auf Verlangen binnen 24 Stunden Schnelleingreiftruppen zur Verfügung zu stellen. Es würde sich um nationale Einheiten handeln, die speziell ausgebildet wären und auf Abruf bereitstünden. Mit anderen Staaten würden wir Abkommen über die Bereitstellung von Transportmitteln für die Truppen treffen. Schließlich stünden dem Sicherheitsrat in verschiedenen Weltgegenden Waffenlager zur Verfügung. … Ein Ausschuß hoher Militärs arbeitet an einem Plan. … Meine Idee wäre eine Größenordnung von 50.000 oder 100.000 Mann, bereitgestellt von 30 bis 40 Ländern.“ Und so weiter.
*
Die Mitglieder spendieren ihrer gemeinsamen Organisation ein Programm. Das sieht im Wesentlichen folgendes vor: Statt daß die einzelnen Staaten ihre Konkurrenz austragen und um ihre nationalen Interessen und Rechte Krieg führen, wenn sie keinen anderen Weg sehen, soll die UNO überall nach dem Rechten schauen, Probleme lösen und für Ordnung sorgen. Befriedungsaktionen, mit deren Fälligkeit jeder rechnet, werden als gemeinsame Sache aller Nationen durchgeführt, als kollektive Polizeiaktion.
Das kann nicht die Wahrheit sein.
Immerhin sind es bewaffnete Konflikte, in die die UNO eingreifen soll; Staaten, die für ihren Rechtsstandpunkt Gewalt einsetzen, also keine Rücksichten mehr kennen, sollen eben daran gehindert werden. Es geht um die gewaltsame Korrektur von real existierenden Staatswillen, also schlicht um Krieg zur Entscheidung von Kriegen – und nicht um eine Alternative dazu. Es ändert nichts an der Sache, wenn Konflikte von vornherein wie Rechtsstreitigkeiten betrachtet werden sollen, in denen Schuldige ermittelt und ihrer gerechten Strafe zugeführt werden: Tatsächlich steht Recht gegen Recht, und die Entscheidung fällt allemal per Gewalt.
Deswegen scheiden sich auch zum einen die Geister an der Frage, für wen wie sehr Partei ergriffen werden soll. Zugleich tritt aber noch eine viel prinzipiellere Differenz hervor: Es unterscheiden sich die Staaten, die überhaupt an auswärtigen Konflikten Anteil nehmen, weil sie gewichtige nationale Interessen in jeder Region auf dem Globus haben und auch von sich aus über die Macht zum Eingreifen verfügen, von den andern, deren Interessen und Mittel gerade dazu ausreichen, Konflikte heraufzubeschwören, um die andere sich kümmern, die also Objekte fremder Regelungsinteressen sind. Diese Unterscheidung ist nicht umkehrbar, etwa so, daß die vielen Statisten und die Objekte tatkräftiger Eingriffsbedürfnisse beschließen könnten, die weltpolitisch tätigen Subjekte und die von denen verantworteten Streitigkeiten wären der lösungsbedürftige Ordnungsfall. Grund genug gäbe es dazu; denn diese Nationen treten ja wirklich nicht als interesselose Schiedsrichter ins Weltgeschehen ein. Kaum einer der regelungsbedürftigen Konflikte, die der UNO-Generalsekretär lösen können möchte, ist ohne sie entstanden, keiner wird ohne ihre Waffen ausgetragen. Tatsächlich sind das aber nur um so mehr Gründe für das Recht der maßgeblichen Nationen, als verantwortliche Subjekte der Weltordnung aufzutreten.
Indem sie das tun, stellt sich noch eine weitere Differenz heraus: Die befugten Macher der Weltordnung bilden keineswegs ein Kollektiv; sie sind untereinander überhaupt nicht auf eine gemeinsame Sache festgelegt, sondern selber weltpolitische Parteien mit Konflikten untereinander und vielfältigen Mitteln, berechnend gegeneinander vorzugehen. Wenn eine von ihnen sich durchsetzt und ihr Anliegen zum gemeinsamen und zur UNO-Sache macht, dann ist eben das passiert und nicht ein gemeinschaftlicher Beschluß im Sinne eines von allen geteilten überparteilichen Ordnungsanliegens ergangen.
Die Fiktion einer Staatengemeinschaft, die sich in der UNO zu vernünftigem Rat und kollektiver Tat versammelt, ist also genauso verlogen wie das Ideal, hier würde die gewaltsame Konkurrenz der Staaten – der großen wie der kleinen – überflüssig gemacht. Sache der UNO ist es, den Kräfteverhältnissen und Konkurrenzkämpfen zwischen den Nationen den Schein einer immerwährenden Beratschlagung und gemeinsamen Beschlußfassung zu verleihen. Wer diesen Schein wofür braucht, d.h. nützlich zu machen versteht: Das ist das Neue an der neuen UNO der 90er Jahre.
Wem und wozu die UNO taugt, oder:
Vom Bedürfnis nach einem pluralistischen Gewaltmonopol und den Tücken einer Gemeinsamkeit, die sich imperialistischer Konkurrenz verdankt
1.
Die UNO der 90er Jahre fungiert als Stelle, bei der weltpolitischer Ordnungsbedarf angemeldet wird – von den Subjekten dieses Bedürfnisses, aber auch von seinen Objekten und von der Weltorganisation selbst, zu der beide Seiten gehören. Diese Funktion der UNO ist ebenso neu wie die Vielzahl und Eigenart der Problemfälle, die ihr zur Behandlung vorgelegt werden: Beides ist mit dem Ende der Konfrontation zwischen Ost und West eingerissen.
Der in der UNO versammelten Staatengemeinschaft werden Notfälle präsentiert, in die sie regulierend eingreifen soll. Staaten, die durch äußere oder innere Feinde – in der Regel beides – in Bedrängnis geraten, verlangen Schutz und Hilfe bei der (Wieder-)Herstellung ihres Gewaltmonopols im eigenen Land; so z.B. die „vom Bürgerkrieg zerrissenen“ südafrikanischen Staaten Angola und Mosambik oder auch die um eine international anerkannte Rechtsposition kämpfenden Neu-Staaten Bosnien und Kroatien; mit den Palästinensern wird ausnahmsweise seit längerem ein noch gar nicht zum Zug gekommener organisierter Staatswille bei der UNO vorstellig. In diesen und in weiteren Fällen werden außerdem Nationen mit weitreichenden Interessen und Machtmitteln aktiv und befassen die UNO mit regelungsbedürftigen Staatskrisen und Konflikten außerhalb ihrer Grenzen, von denen sie schon allein deswegen sehr betroffen sind, weil sie mehr oder weniger ursächlich dahinterstecken: Die Westeuropäer bringen die blutige Auflösung des alten Jugoslawien in neue Kleinstaaten vor die UNO, die USA die Versuche der irakischen Regierung, Souveränität über ihr Land zurückzugewinnen, usw. Auch die UNO-Leitung selbst ergreift Initiativen und setzt Problemfälle wie die innere Befriedung Kambodschas oder die hoffnungslose Lage Somalias auf die Tagesordnung ihres Vereins.
Was da als „Fall“ vor die UNO gebracht wird, ist vorab durch den Gesichtspunkt entschieden, unter dem die internationale Staatengemeinschaft überhaupt einen Handlungsbedarf entwickelt. Nicht – oder jedenfalls längst nicht mehr – dazu gehören etwa Anträge auf eine „neue Weltwirtschaftsordnung“, die den „unterentwickelten Ländern“ ihren „gerechten Anteil“ am weltweiten Reichtum verschafft; und wenn irgendwo massenhaft Menschen umkommen, so ist das für sich genommen auch noch lange keine Herausforderung, der die souveränen Instanzen dieser Welt sich zu stellen hätten – erst wenn deswegen die staatliche Autorität zusammenbricht, ganze Landstriche quasi herrenlos zu werden drohen, wird die Sache relevant. Dann ist nämlich die Ordnung in der Staatenwelt tangiert: Ordnung im Sinn der Sicherheit, daß in der ganzen Welt Staatsgewalten anzutreffen sind, die alle nach ungefähr dem gleichen Muster Land und Leute souverän unter Kontrolle haben. Zur Ordnung, um die die UNO sich kümmert, gehört außerdem, daß diese souveränen Gewalten sich an ihre Grenzen halten und kooperatives Entgegenkommen zeigen, wenn eine andere Macht von ihnen etwas will; deswegen geht prinzipiell jeder Streit zwischen Staaten die UNO etwas an. Gleichgültig ist hingegen der materielle Inhalt des zwischenstaatlichen Verkehrs, auch wenn da die Gründe liegen, aus denen Streit, Krieg und andere Unschönheiten entstehen. Welcher Art die Interessen sind, die in der Welt im Schwange sind – von einigen großen Nationen ausgehend, den großen Rest der Staatenwelt betreffend –, das ist kein Stoff, über den die Staatengemeinschaft mit sich zu Rate geht. Ihr Stichwort heißt „Ordnung“; ihr Thema und Gesichtspunkt sind also die Gewaltverhältnisse, zwischen und nötigenfalls auch in den Ländern dieser Erde, die nötig sind, damit überhaupt ein Staat seine Interessen anderswo geltend machen kann und ein gesicherter Geschäftsverkehr über alle Grenzen hinweg in Gang kommt und bleibt.
Diese Materie ist überaus abstrakt; und darin gerade liegt ihr Sinn und Zweck. Der Gesichtspunkt der geordneten Gewaltausübung heiligt nämlich alles, wovon er abstrahiert: Alle wirklich eingerichteten Macht- und Geschäftsverhältnisse sind als selbstverständliche „Gegebenheiten“ vorausgesetzt und stillschweigend gebilligt, wenn alle Sorge sich darauf richtet, daß auch ja überall auf dem Globus Souveräne bereitstehen, die mit ihrer Staatsgewalt die elementaren Bedingungen dafür gewährleisten. Daß gar nicht zur Debatte steht, wofür sie die Bedingungen setzen, macht die Sache gerade so scharf. Denn gerade so ist die Kategorie der internationalen Ordnung der denkbar brutalste Interessenstandpunkt: Alle tatsächlich herrschenden Interessen und Gewaltverhältnisse sind damit ins Recht gesetzt. Gleichzeitig ist dieser anerkannte Standpunkt der Grund für den bemerkenswerten Zynismus, mit dem die UNO allen Ernstes, also jenseits aller schönfärberischen Ideologien über „Weltpolizeiaktionen“ u.dergl., den Krieg als einzig und überall brauchbares Heilmittel für die Übel dieser Welt betrachtet und gebraucht: Er ist ja wirklich das „Mittel der Wahl“, um Gewaltverhältnisse im Sinne der machtvollsten Interessen einzurichten bzw. zu korrigieren; und um nichts anderes geht es eben, wenn Ordnung angesagt ist.
Um Ordnungsprobleme, d.h. um die Grundsatzfrage der Existenz und der Funktionalität von Staatsgewalten überall auf dem Planeten geht es also, wenn die UNO sich mit Streit- und Notfällen befaßt; wobei logischerweise die einen Staaten mehr ihre Überlebensprobleme vortragen, die andern mehr ihre Probleme mit der Tauglichkeit und Kooperationswilligkeit anderer. Kennzeichnend für die UNO der 90er Jahre sind Art und Vielzahl derartiger Problemfälle wie auch vor allem die Tatsache, daß sie tatsächlich durchwegs der UNO zur Stellungnahme und gefälligen Lösung unterbreitet werden. Beides ist neu, und beides hat ein und denselben Grund: Es gibt die Sowjetunion nicht mehr. Die Feindschaft des vereinigten Westens, Urheber und Garant der vorherrschenden Verhältnisse, gegen das sozialistische Lager, die große Ausnahme von der Regel kooperationswilliger Staatsgewalten, hat bis vor kurzem noch eine etwas andere Definition der Weltordnung und ihrer Problemfälle vorgegeben: Die zwischenstaatliche Ordnung in dem heute wieder aktuellen Sinn funktionaler Gewaltverhältnisse auf dem ganzen Planeten war durch die nicht zu beseitigende Gegenmacht des sowjetischen „Blocks“ zerstört; die eine ordentliche Welt war „geteilt“. Ordnungsprinzip war daher für die westliche Welt, quasi ersatzweise, die Herstellung von Bündnissystemen zur Bekämpfung des sowjetischen Einflusses; leitender Gesichtspunkt war das Ringen um strategische Positionen unter dem Aspekt eines alles entscheidenden Dritten Weltkriegs. Die zwischenstaatliche Ordnung im Sinne nützlicher Herrschaft in aller Welt war unter diese Perspektive subsumiert. Dementsprechend waren auswärtige Staatskrisen und zwischenstaatliche Konflikte nicht einfach Störungen, sondern einerseits Risiken, andererseits Handhaben im und für den Kampf um Positionsgewinne an der allgegenwärtigen „Front“. Sie gingen in Ordnung, wenn damit dem Gegner eine Schwächung zuzufügen war, wurden dafür auch angeheizt oder überhaupt angezettelt; wenn umgekehrt eine eigene Niederlage drohte, dann war diese das Problem und nicht ein abstrakter Ordnungsverstoß. Logischerweise gehörten die anfallenden Konfliktfälle nicht vor die UNO, die ihrerseits ja bloß ein Abbild der „geteilten“ Welt und ihrer fundamental gestörten Ordnung war. Als Ordnungs-„Instanz“, mit Resolutionen und auch gewissen Interventionen, wurde die Weltorganisation nur dort tätig, wo Ost und West sich zuvor darauf geeinigt hatten, einen Streitfall nicht in ihr Ringen um Einfluß und Verbündete einzubeziehen; sei es aufgrund des Beschlusses einer Seite, sich aus einer Affäre herauszuhalten – wie etwa die Sowjetunion im Fall Cyperns –, sei es – wie im Nahen Osten – infolge der Übereinkunft, den beiderseits betreuten Konflikt nicht zur Gefahr für die momentan erreichte „Stabilität“ ausarten zu lassen. Daneben blieb der UNO die Rolle eines Forums, auf dem die feindlichen Weltmächte ihre weltpolitischen Ansprüche demonstrativ gegeneinanderstellten; sie war diplomatisches Testgelände für die Orientierung und eventuelle Umorientierung dritter Staaten innerhalb des feststehenden Weltgegensatzes und auch eine diplomatische Börse, an der umgekehrt dritte Staaten ihren Kurswert als leistungsfähige Verbündete für den einen oder den anderen „Block“ ermitteln konnten. In dieser „geteilten“, insoweit aber zuverlässig geordneten Welt war für die Befassung der UNO mit einem ungedeckten weltpolitischen Regelungsbedarf kein Raum; und es gab auch die eigentümlichen Ordnungsfälle nicht, die seit Beginn der 90er Jahre vor die Versammlung der Nationen gebracht werden. Die sind nämlich erst aus der Kapitulation der sowjetischen Weltmacht und der Auflösung der alten „Schlachtordnung“ entstanden:
- Seither verfallen ganze Länder, die zwischen Ost und West umstritten waren, also von der einen Seite mit einer brauchbaren Herrschaft und den nötigen Mitteln für eine souveräne Staatlichkeit ausgestattet wurden und von der anderen mit bewaffneten Oppositionsgruppen. Die daraus resultierenden „Bürgerkriege“ haben diese Länder verwüstet und die Voraussetzungen für eine funktionierende einheimische Regierungsmacht gründlich zerstört. Nun haben die Kriege ihren Sinn verloren, an den Parteien besteht kein Interesse mehr, die bisher engagierten auswärtigen Mächte befinden die Unkosten für das bislang subventionierte Maß an staatsähnlichen Verhältnissen für zu hoch. Damit reißen Verhältnisse ein, deren vorläufiges Endstadium in Somalia oder Afghanistan zu besichtigen ist: Bewaffnete Terrorgruppen kämpfen für ihren jeweiligen Stammesverband gegeneinander um die Reste von Macht und Reichtum, die vom früheren Staatswesen noch übrig sind.
- Aber nicht nur solche Restposten der ehemaligen Block-Konfrontation, auch Staaten ganz anderen Kalibers, bis hinauf zur Dritt-Welt-„Supermacht“ Indien, sind betroffen, wenn zu ihrer fortschreitenden und zunehmend ruinösen „Integration in den Weltmarkt“ ein bedeutend verringerter strategischer Gebrauchswert ihrer nationalen Macht hinzukommt. Es kann passieren, daß der politischen Gewalt in solchen Ländern zugleich mit ihrer ökonomischen Basis auch ihre bisherige – sei es antikommunistische, sei es prosowjetische – Staatsräson abhanden kommt und daß dann ihre Souveränität nach innen durch „neue Kräfte“, die womöglich unter dem Titel „Demokratisierung“ von außen gefördert werden, gar nicht übernommen, sondern regelrecht zerstört wird.[1]
- Andere Länder zerfallen, seit sie sich ihrer realsozialistischen Staatsräson entledigt haben; die Sowjetunion selbst[2] sowie das von Tito auf seinen eigenen „dritten Weg“ gebrachte Jugoslawien[3] an der Spitze. Genauer gesagt: sie werden von den nach Souveränität strebenden Machthabern völkisch definierter Teilstaaten zerstört, die ihrerseits gegeneinander um die passenden Abgrenzungen von Land und Leuten streiten.
- Auch der Fall des Irak[4] gehört der nach-sowjetischen Weltordnung an, auch wenn es die Sowjetunion seinerzeit noch gab: Unter den Bedingungen des „Ost-West-Konflikts“ hätte die Annexion eines Scheichtums unter amerikanischer Protektion durch einen „Klienten“ der Sowjetunion eine eklatante Verschiebung der Kräfteverhältnisse zum Nachteil des Westens bedeutet; und deswegen hätte es – bei funktionierender Abschreckung zwischen Ost und West – die Freiheit für soviel nationalen Ehrgeiz gar nicht gegeben. Die Räumung strategischer Positionen außerhalb der eigenen Grenzen durch die Sowjetunion war also – zwar nicht der Grund, der lag eher in Saddam Husseins Erfahrungen mit dem lebhaften Interesse wichtiger Mächte an seinem Krieg gegen Iran, wohl aber – die unerläßliche Voraussetzung für den irakischen Versuch, ohne Rücksicht auf die Ost-West-Abschreckung etwas zu betreiben, was ja sogar in Europa dadurch möglich geworden war, nämlich ein Stück nationale Wiedervereinigung. Die USA haben Saddam Husseins Übergriff denn auch gleich so gesehen und bekämpft: als Beispiel für die neue Unsicherheit, mit der nach der Auflösung der alle anderen Konflikte unter sich subsumierenden Weltkriegsfront allgemein zu rechnen sei.
Die Welt ist also voller Problemfälle, seit – und weil es die weltkriegsträchtige Konfrontation nicht mehr gibt, durch die und in die alle Staaten mit ihren äußeren und inneren Konflikten einsortiert waren. Diese Problemfälle stören zwar kaum den erfolgreichen Gang des weltumspannenden Geschäftslebens, wohl aber die Ordnung, unter der dieser Erfolg seinen Gang geht und auf die alle souveränen Mächte verpflichtet sind. Also werden sie vor die UNO gebracht: Die ganze Staatengemeinschaft soll sich im Interesse ordentlicher Verhältnisse dazu stellen.
2.
Die neue UNO repräsentiert den Konsens aller Staaten, die es angeht, daß in Fragen der internationalen Ordnung, also der militärischen Gewaltanwendung nationale Alleingänge zu unterbleiben haben. Über die Weltorganisation nimmt jede Nation ihr Recht auf allgemeine Einmischung wahr – jede, so gut sie es vermag. Was eine Nation in und mit der UNO vermag, ist also auch ihr gutes Recht.
Kein Mitgliedsstaat der UNO nimmt sich derzeit das Recht heraus, in eigener Regie und auf eigene Rechnung Problemfälle der internationalen Ordnung auszurufen und in seinem Sinne zu regeln. Die Staaten, die dazu sowieso kaum in der Lage sind, werden bloß selber zum Problemfall, wenn sie auf eigene Faust in ihrer Umgebung eine ihres Erachtens untragbare Lage ausmachen und bereinigen wollen. Diejenigen Nationen, die sich mehr leisten könnten, weil sie über globale Interessen und eine nennenswerte Weltordnungsmacht verfügen, leisten einhellig „Verzicht auf Alleingänge“ – und praktizieren damit eine eigentümliche Unterscheidung. Sie trennen zwischen ihren materiellen Interessen im Ausland, die sie so vorteilhaft wie möglich zu gestalten suchen, also so, daß andere Interessenten weniger oder gar nicht zum Zuge kommen, und den nicht-exklusiven Bedingungen, unter denen sie ihre materiellen Interessen betätigen. Die Abstraktion der Ordnung setzen sie in dem Sinn in die Tat um, daß sie sich jenseits ihres Bemühens um möglichst exklusiven nationalen Nutzen um dessen sichere Grundlage kümmern; und die soll so aussehen, daß überall nationale Souveräne herrschen, die für alle auswärtigen Interessenten im Prinzip gleichermaßen zugänglich und brauchbar sind. Die um Ordnung bemühten Mächte leisten sich damit einen Widerspruch. Denn mit ihrem Kampf um möglichst einseitige Ausnutzung der Staatenwelt machen sie einander ja doch dauernd den Zugang zu auswärtigen Staaten und deren Ausnutzung streitig; sie sorgen selbst dafür, daß in ihrer schönen offenen Weltordnung die Konkurrenten immer weniger zum Zuge kommen; so untergraben sie, ein jeder beim andern, die prinzipielle Übereinstimmung von nationalem Interesse und allgemeiner Ordnung, von der sie in der Art ihrer Außenpolitik ausgehen; und deshalb ist die Unterscheidung zwischen dem nationalen Erfolg und dessen allgemeinen Bedingungen auch keineswegs das letzte Wort. Indem sie aber die UNO zum Forum für die Regelung von Problemfällen machen, erkennen die Großmächte zunächst einmal eine allgemeine Ordnung als ihren gemeinsamen Interessenstandpunkt an und verlangen vom Rest der Welt und vor allem voneinander, daß das allseits respektiert wird. Die Kehrseite dieses „Verzichts auf Alleingänge“ ist logischerweise – und damit zeigt sich schon ein erstes Stück der Berechnung, die die mächtigen Nationen mit ihrer „Zurückhaltung“ verbinden –, daß kein UNO-Mitglied von der Beratung und Beschlußfassung über die Pflege der Weltordnung und die Behandlung ihrer Störfälle ausgeschlossen ist. Ausgeschlossen ist im Gegenteil die Nicht-Befassung einer interessierten Nation mit Affären weltpolitischer Art. Alle Staaten sind überall dabei, wo es etwas zu regeln gibt; universelle Einmischung ist ihr gutes Recht; die Beschlußlage der UNO definiert ihre Eingriffsrechte.
Auf dieser Grundlage wird die UNO tätig. Ihr Repertoire an Reaktionen reicht von der bloßen Kenntnisnahme von einem Problemfall oder Konflikt, der Aufforderung zu anständigem Benehmen und bloßer Aufsicht, wahrgenommen durch unbewaffnete „Beobachter“, über der Form nach verbindliche Resolutionen des Weltsicherheitsrats und die Entsendung von „Blauhelmen“, die die getroffene Entscheidung freilich bloß repräsentieren, nicht gewaltsam durchzusetzen haben, bis hin zur formellen Ermächtigung eines Staates oder einer Staatenkoalition zu militärischem Durchgreifen. Die Weltorganisation betätigt das allgemeine Einmischungsrecht der Nationen, als wäre sie schon so etwas wie eine überparteiliche Regelungsbehörde. Allerdings: Wann und wo immer sie ihr Instrumentarium für ordnende Eingriffe zum Einsatz bringt, blamiert sie zugleich den Standpunkt der unparteiisch auf Ordnung bedachten Aufsicht. Mit Recht kann immer eine betroffene Seite über „Ungleichbehandlung“ klagen: Gleichartige Fälle werden ungleich gewichtet, manche gar nicht weiter beachtet, andere hochgespielt; die Entscheidungsfindung folgt keiner allgemeingültigen „Rechtslage“, sondern dem Kräfteverhältnis der im Sicherheitsrat vertretenen Interessen; die gefaßten Beschlüsse sind von ungleicher Verbindlichkeit; durchgesetzt werden sie mit ungleichen Mitteln oder auch gar nicht. Resolutionen gegen den Irak werden bis zum letzten Komma und darüber hinaus durchgekämpft, wohingegen Israel ungestraft Anweisungen der UNO mißachten oder die serbische Luftwaffe über Bosnien UNO-Ultimaten ignorieren „darf“… Keine Frage, die praktizierte Weltordnungspolitik der UNO ist ein Hohn auf den Schein, die Weltordnung wäre so etwas wie allgemeine Gerechtigkeit und die UNO deren selbstloser Anwalt – freilich auch bloß auf diesen Schein. Tatsächlich kommt in den „ungleichen“ Beschlüssen und Eingriffen der UNO nichts anderes zum Zuge als das Recht, das der UNO-Konsens allen Mitgliedern erteilt: das Recht, mitzuberaten und mitzumachen – ein jeder, so gut er kann. Daß jeder gleich viel vermag, das allgemeine Recht auf Befassung gleichen Einfluß garantiert, ist nicht versprochen. Daß jeder das Seine beitragen kann, keiner ausgeschlossen ist, wo es um die Ordnung zwischen den Staaten geht: Das ist im Gegenteil die Grundlage dafür, daß jedes Mitglied zusehen muß, wieviel Gewicht es seinem Standpunkt zu verschaffen vermag, und am Ende die Machtverhältnisse darüber entscheiden, wie einem Staat Recht geschieht.
Am überparteilichen Standpunkt der UNO stellt sich also erstens heraus, daß jede Macht, die überhaupt etwas zu melden hat, an jedem Fall auch ihre eigenen Vorstellungen über dessen passende Behandlung anzumelden hat. So abstrakt sie alle dem Gesichtspunkt der Ordnung verpflichtet sind: So abstrakt kalkuliert kein Staat, daß er über den allgemeinen Bedingungen seines Erfolgs den nationalen Erfolg aus dem Blick verlieren würde, für dessen Voraussetzungen er sich gemeinsam mit anderen stark macht. Nicht einmal die USA sehen einen Sinn darin, beispielsweise das eherne Prinzip der Folgsamkeit eines jeden Souveräns gegenüber den Entscheidungen des Sicherheitsrats ausgerechnet an ihrem Verbündeten Israel durchzukämpfen, wo sie dem doch in ihrem Konzept einer gut aufgeräumten nahöstlichen Staatenwelt eine ganz spezielle Aufgabe zugedacht haben. In jedem Anwendungsfall übersetzt sich der Wille zu einer allgemeinen, verbindlichen Ordnung der Dinge für jede engagierte Macht „zurück“ in die Absicht, mit den allgemeinen Bedingungen eines ordentlichen Weltgeschehens den eigenen nationalen Kalkulationen zum Erfolg zu verhelfen und konkurrierende Gesichtspunkte auszuschalten. Weil es aber gleichzeitig bei der Entscheidung bleibt, nichts „im Alleingang“ zu unternehmen, übersetzt sich diese Absicht in einen entsprechend berechnenden Antrag in der UNO auf gemeinsame ordnende Eingriffe.
Für dessen Erfolg kommt dann alles darauf an, wessen Berechnung wieviel zählt, wenn es in der UNO ans Entscheiden geht; das ist also das Zweite, was im unparteiischen Vorgehen der UNO deutlich wird. Hier scheiden sich die wenigen kompetenten Beiträge von den vielen inkompetenten – und das ist keine Verletzung von UNO-Prinzipien. Im Gegenteil: Gerade weil die Weltordnung kein exklusives Recht einer Nation gegen andere, sondern als allgemeines Anliegen definiert ist, unterscheiden sich bei dessen Wahrnehmung die weltordnungspolitisch maßgeblichen Nationen von den unmaßgeblichen und unter den ersteren die Macher von den Mitmachern. Im Entscheidungsprozeß der UNO, bei der Durchsetzung einer allgemeinen, für alle Mitglieder der Weltorganisation verbindlichen und von ihnen ins Recht gesetzten Linie, kommen die Unterschiede zwischen den Nationen zum Tragen, die sich sonst im direkten Kampf um exklusiven Einfluß und Ordnungsmacht herausstellen müßten: ihre unterschiedlichen national berechnenden Anforderungen an ein geordnetes Weltgeschehen und ihre unterschiedlichen Fähigkeiten, die entsprechende Ordnung zu schaffen.
Dieses Kräftemessen ist der eigentliche weltpolitische Inhalt der UNO. Den behandelten „Fällen“ kommt die Ehre zu, dafür Anlaß und Material zu liefern.
3.
Jeder Problemfall, der in der UNO zur Verhandlung und Entscheidung kommt, fordert die imperialistische Kompetenz der führenden Mitglieder heraus. Diese Mächte konkurrieren um die Definition gemeinsamer Ordnungsangelegenheiten und bei deren Durchführung um die Verteilung von Lasten und Nutzen. Auf diese Weise streiten sie um ihre Position in der imperialistischen Hierarchie.
Für sich genommen sind die Problemfälle, mit denen die UNO sich befaßt, weltpolitisch eher unbedeutend, auch wenn immer viel von ihnen hergemacht wird, sobald die UNO sich einmal mit ihnen befaßt; von sich aus hätte keines der ordnungspolitisch betreuten Länder die Macht, eine wirksame Befassung mit seinen politischen Existenzsorgen zu erreichen; es handelt sich eben um die Objekte des Weltordnungsgeschäfts. Es kommt schon darauf an, daß ein Subjekt dieses Unternehmens sich der Sache annimmt: eine Macht, die auf der Welt viel bewegt und deswegen auch in der UNO einiges in Bewegung setzen kann. Nämlich zunächst einmal einen Prozeß des Verhandelns um Ob und Wie eines ordnenden Eingreifens, um verlangte und versprochene Beiträge zu einer Lösung, sobald diese beschlossen ist, usw. In diesem Prozeß tritt die Position der führenden Nationen hervor: ihre Freiheit, das Geschehen zu lenken, wie ihre Einbindung in einen Konsens, den sie gar nicht allein bestimmen. Und um diese Position geht es den Aktivisten der Weltordnung dann auch: Um sie wird gestritten, wenn „Fälle“ ver- und behandelt werden.
Der erste Kampf wird um die Definition des Problems geführt: um seine Wichtigkeit und die richtige Problemstellung. Gehört es vor den Sicherheitsrat, oder handelt es sich um einen Alltagsfall z.B. der Weltflüchtlingshilfe? Wer der UNO einen „Fall“ präsentiert, hat hier seinen ersten Leistungsbeweis anzutreten; und schon trennt sich vom verhandelten Fall ein eigener weltpolitischer Gehalt ab, nämlich die Durchsetzungsfähigkeit der Nation, die ihm Bedeutung beimessen will. Wer ist als Störer der Ordnung dingfest zu machen? An der Fähigkeit, die eigene Sicht der Schuldfrage durchzusetzen, entscheidet sich zum zweiten Mal die Sache, um die es geht, nämlich das weltpolitische Gewicht des Staates, der einen Störfall ausgerufen hat. Gerechterweise kommt die Frage auf, was der Staat, der seine Problemsicht zur Grundlage der Verhandlungen machen will, eigentlich bezweckt, für sich; zu entscheiden ist die Meta-Frage, ob dieser Staat für seine wahren Absichten Zustimmung verdient – der „Fall“ gerät allmählich zum bloßen Ausgangspunkt für die eigentlich relevanten Überlegungen. Wie soll eine Lösung aussehen? Schon wieder stellt sich das zweifache Problem, auf welchem Niveau und gegen wen die UNO eingreifen soll; schon wieder richten sich die Antworten nach dem Gehör, das dem Staat gebührt, der für die eine oder andere Behandlungsart plädiert. Die Probe auf dessen Durchsetzungsfähigkeit ist jetzt allerdings schon härter; denn nach beschlossener Lösung wird Unterstützung eingefordert. Eine UNO-Aktion durchsetzen heißt also, andern Staaten die Kalkulation zumuten, ob sie mit einem praktischen Lösungsbeitrag besser fahren oder sich lieber entziehen sollten. Diese Kalkulation führt erst recht wieder auf die Frage, ob der Staat, der eine Resolution erwirkt, einer ist, mit dem die andern nolens volens gemeinsame Sache machen, oder nicht. Letzter Streitpunkt ist die Frage der Federführung bei der Exekution gefaßter Beschlüsse: Was wird der Verantwortung der UNO-Zentrale überlassen, für welchen Erfolg setzt welche Nation ihren politischen Kredit aufs Spiel? So gerät die ganze Angelegenheit endgültig in ihr Gleis: Die Eigenarten des „Falls“, seine Bedeutung für bestimmte materielle Staatsinteressen, die Schwierigkeiten seiner Lösung, das alles wird zum Hilfsmittel für die engagierte Ordnungsmacht, nach ihrem Konzept andere Staaten in Aktionen hineinzuziehen und auf Koalitionen festzulegen. Diese andern kalkulieren Nutzen und Last eines Beitrags und legen rückwirkend von da aus fest, wie sie sich in den früheren Stadien der Beschlußfassung entscheiden.
Und ganz am Ende bleibt die Frage, was mit der Bewältigung eines Falles für die Sache: die Machtposition der engagierten Weltordnungsnation, eigentlich entschieden ist…
In allen diesen Fragen haben die Amerikaner mit ihrem Engagement gegen Saddam Hussein Maßstäbe gesetzt – und Schule gemacht.
Der „Fall Irak“: Krieg für eine neue Weltordnung und kein Ende
Die USA haben nicht einfach dem Scheich von Kuwait gegen den Irak geholfen. Sie haben die Notwendigkeit eines Sieges über Saddam Hussein zum UNO-Konsens gemacht.
Als erstes hat die amerikanische Seite also eine Prinzipienfrage aufgeworfen. Sie hat sich nicht damit begnügt, ein materielles Interesse zu bekennen, das durch den irakischen Überfall auf Kuwait verletzt oder gefährdet worden, dessen Sicherung ihr notfalls einen Krieg, vielleicht aber auch einen brauchbaren Kompromiß wert gewesen wäre. Möglich, daß die Kriegsgründe Saddam Husseins ursprünglich von solcher Art waren; die der USA waren es jedenfalls nicht. Die US-Regierung hat den Weg zum Krieg mit der Entscheidung eingeschlagen, den Standpunkt des bloßen Interesses zu verlassen und mit aller Konsequenz den der zu schützenden Ordnung einzunehmen. Den irakischen Einmarsch in Kuwait hat sie als Verletzung des Kräfteverhältnisses in einer wichtigen Weltregion bewertet und unter das sittlich wertvolle Gesetz subsumiert, Grenzen dürften auf dieser Welt nicht mit Gewalt verändert werden. Da wurde nicht der Machterwerb eines Staates pragmatisch beurteilt, sondern ein Verstoß registriert; gegen ein Gesetz, dessen Eigentümlichkeit darin liegt, daß es überhaupt nicht gilt: Es gibt die über allen Staaten stehende wirksame Instanz nicht, die ihm Verbindlichkeit verleihen könnte; auch am Ende des 20. Jahrhunderts sind Staaten noch allemal selber ihre höchste Rechtsinstanz. Genau das hat den amerikanischen Staat aber nur dazu beflügelt, sich für die Gültigkeit des genannten Grundsatzes stark zu machen; nicht weil die Sache mit den „unveränderlichen“ Grenzen ihm so sympathisch wäre – wie klein wären dann die USA! –, sondern eben weil er damit aus dem Status eines Staates unter anderen heraustritt und den Standpunkt einer supranationalen Rechtsinstanz einnimmt, und zwar keineswegs bloß in einem akademischen Sinn. Die USA haben mit ihrer Sicht der Lage die Stellung einer Gewalt oberhalb aller „höchsten Gewalten“ beansprucht: das Gewaltmonopol über die Souveräne dieser Welt.
Um diesen Standpunkt wirksam werden zu lassen, haben die Amerikaner nicht bloß eine Koalition geschmiedet, mit deren Hilfe sie Saddam Husseins Armee problemlos besiegen konnten – das haben sie natürlich auch gemacht, aber was da gelaufen ist, das wäre für sich genommen von einem ordinären Krieg zwischen ungleich starken Gegnern gar nicht zu unterscheiden gewesen. Daß es um etwas Höheres ging, um die Etablierung eines Welt-Gewaltmonopols, und zwar nicht bloß in der amerikanischen Kriegsideologie, sondern in der real existierenden Staatenwelt: Das war nur durch den UNO-Konsens zu erreichen. Alle Staaten sollten die amerikanische Lagebeurteilung billigen, also die Fiktion eines Gewaltmonopols, das weltweit verbindlich Gesetze erläßt, in aller Form anerkennen – und damit wahr machen. Dieser Anspruch erging in Form der Einladung an alle – die Mitgliedsstaaten im allgemeinen, die im Sicherheitsrat vertretenen Mächte im besonderen –, sich gewissermaßen als Mit-Urheber und Teilhaber dieser oberhoheitlichen Instanz zu begreifen und zu betätigen – durch Beistimmung zum amerikanischen Standpunkt und praktische Beihilfe. Die Weltmacht USA trat dafür hinter die UNO zurück; sie verlangte die Anerkennung des Weltmachthabers und -gesetzgebers nicht direkt für sich, sondern für die Versammlung aller Staatsgewalten; für sich selbst „bloß“ die Generalvollmacht zur Ausgestaltung und Vollstreckung der fiktiven UNO-Hoheit über alle ihre Mitglieder. Über das Scheinhafte dieses „Umwegs“ über die UNO war einerseits kein Irrtum möglich; andererseits war die Entscheidungshoheit der anderen Mächte damit eben doch formell anerkannt und die theoretisch gar nicht zu entscheidende, praktisch seither heftig umstrittene Frage aufgeworfen, ob das nun eine bloße Formalität ist oder nicht doch eine Formsache mit weitergehender Bedeutung.
Der Anspruch auf allgemeinen Konsens wurde durch die Tat eingelöst. Die US-Regierung hat sich gar nicht erst darauf verlegt, bei den UNO-Mitgliedern herumzufragen, ob ihnen ein UNO-Gewaltmonopol mit Amerika als Treuhänder recht wäre. Eine Resolution nach der andern hat sie im Weltsicherheitsrat durchgedrückt, gleichzeitig ihren ordinären Krieg gegen den Irak vorbereitet und mit dieser Doppelstrategie alle anderen Staaten unausweichlich vor die Alternative gestellt, mitzumachen – oder sich gegen den aufgemachten Hoheitsanspruch zu stellen und sich damit nicht ein fiktives Weltsubjekt, sondern die kriegsentschlossene Weltmacht zum Feind zu machen. Das härteste Argument für die zur Mithilfe aufgerufenen Mächte, sich einzuordnen, war der unmißverständliche Wille des US-Präsidenten, sich davon nicht abhängig zu machen, sondern auf alle Fälle zuzuschlagen und so durch die Tat Freunde der „neuen Weltordnung“ von den Feinden des internationalen Rechts zu scheiden.
Auf diese Weise angegangen wurden vor allem zwei „Partner“. Zum einen die Sowjetunion, die seinerzeit ja noch existierte, allerdings schon nicht mehr so wie in den vier Jahrzehnten zuvor, nämlich als gegnerische Macht, die den Anspruch der USA auf ein Weltgewaltmonopol, in wessen Namen auch immer, hätte scheitern lassen. Gorbatschow war bereits Amerikas verläßliche Stütze; und soweit der Vorstoß der USA in dieser Hinsicht ein Test war, wieviel von der „Spaltung“ der einen Welt durch die sowjetische Gegenmacht noch übrig war, so ist er eindeutig und uneingeschränkt günstig ausgegangen. Durch das Verschwinden der Sowjetmacht hat das ganze Problem sich mittlerweile vollends erledigt – bis sich womöglich das neue Rußland auf seinen nationalen Drang nach weltpolitischer Eigenständigkeit besinnt.
Etwas komplexer gestaltete sich die Auseinandersetzung und Einigung mit den jahrzehntelang Verbündeten. Bei denen war, außer auf die traditionsreiche Verbundenheit, auf ein gewisses grundsätzliches Interesse am Konstrukt einer quasi-gesetzlichen Weltordnung zu setzen, für die Amerika sich stark machte; schließlich hatten sie bisher schon von Gewaltverhältnissen profitiert, die die USA garantiert hatten. Das war aber bloß der allerallgemeinste Aspekt der Angelegenheit, und gar nicht einmal der von vornherein entscheidende. Gerade die altgedienten Partner Amerikas haben sofort den neuartigen Hoheitsanspruch der USA als Urheber, Anwalt und Vollstrecker einer unbeschränkt weltweiten UNO-Hoheit gespürt und sich der Frage stellen müssen, wie sie – in einer Welt ohne „sowjetische Gefahr“ – mit dem Anspruch umgehen sollten. Keine ganz einfache Frage; denn tatsächlich wurde da durch die „Führungsmacht“ ihre ganze bisherige Art, ihre grenzüberschreitenden Interessen zu verfolgen, keineswegs bestätigt, sondern schwer zurechtgewiesen. Am Skandal des Waffenhandels mit Saddam Hussein wurde der Vorwurf durchgenommen, vor allem die Europäer hätten ihre bornierten nationalen Interessen über ihre Verantwortung für die Sicherheit der Staatenwelt, den Gewinn über die Ordnung gestellt, die ihn doch überhaupt erst ermöglicht. Deutlich genug wurde die amerikanische Beschwerde, die USA hätten gerade umgekehrt die Lasten der Weltordnung auf sich genommen, ohne entsprechenden Gewinn zu verbuchen; den hätten sich vielmehr die verantwortungslosen Partner geteilt. Hier war Änderung verlangt – und als erstes die Einordnung in das amerikanische Programm, Mitwirkung an einem Weltgewaltmonopol nach amerikanischer Definition und unter amerikanischem Oberbefehl, exemplarisch durchexerziert an dem „Verbrecher“ Saddam Hussein. Die Verbündeten sind gefolgt; weil sie den Durchmarsch ihres transatlantischen Partners ohnehin nicht hätten verhindern können – gefragt in dem Sinn wurden auch sie nicht! –, haben sie lieber mitgemacht, einfach um dabei und nicht ausgeschlossen zu sein, wo sich in Sachen Weltordnung etwas Neues und Entscheidendes tat. Dabei waren sie freilich alle mit ihren Vorbehalten, mit ihren eigenen Lagebeurteilungen und vor allem: im Irak, nicht mehr und nicht weniger.
Zwei Jahre später legen die Amerikaner den „Fall Irak“ neu auf. Gestützt auf die alten UNO-Resolutionen und die seinerzeit diktierten Waffenstillstandsbedingungen schlagen sie wieder zu; und die Vorwände sind verlogen wie nie: Alle Welt fragt sich, warum die amerikanische Weltmacht plötzlich irakisches Radar als Aggression definiert und die von der UNO ultimativ verlangte Räumung irakischer Posten in einem dem Scheichtum Kuwait zugeschlagenen Grenzstreifen als nicht hinnehmbare Provokation einstuft und eine von UNO-Kommandos für harmlos erklärte Fabrik als Produktionsstätte für irakische Atomwaffen deklariert. Um verständnisinnige Antworten ist die demokratische Öffentlichkeit übrigens gar nicht verlegen; sie findet es ganz normal, persönliche Beweggründe des nicht wiedergewählten US-Präsidenten anzunehmen: Bush hätte seinem bestgehaßten Erzfeind noch kurz vor seinem Abschied aus dem Amt den Triumph versalzen wollen, länger als er Präsident geblieben zu sein. Wenn so etwas als durchaus verständlicher, ja passabler Kriegsgrund für die großartigste Demokratie auf Erden gilt, dann weiß man ja Bescheid, wie es unter dieser besten aller Staatsformen zugeht – offenbar auch nicht viel anders als in jener zutiefst unmenschlichen Diktatur, wo die Launen des obersten Chefs immer gleich für ein paar Tote gut sind. Die persönliche Gereiztheit eines Präsidenten, egal wie er an sein Amt gekommen ist, ist eben immer eine gefährliche Sache; wenn gar der US-Präsident sich austobt, dann setzt es gleich einen Angriffsbefehl für etliche Bomberstaffeln und 40 Cruise Missiles; denn der Grund seiner persönlichen Verärgerung ist allemal politischer Natur und das dadurch bestimmte Handeln eine Staatsaffäre. Die ganze amerikanische Nation zeigt sich in ihren neuesten Heldentaten am Golf zutiefst unzufrieden – und gibt so zu verstehen, daß die Rechnung, die die USA mit ihrer Intervention gegen den Irak aufgemacht haben, doch nicht ganz aufgegangen ist.
Dabei will wirklich niemand behaupten, Saddam Hussein und die Reste seiner Militärmacht wären noch eine ernsthafte Gefahr für die „Stabilität in der Region“ und Amerikas Zugriffsmöglichkeiten. Nur daß der Iraker sich überhaupt noch rührt – mit „Nadelstichen“, wie es passenderweise heißt, nämlich ohnmächtigen Demonstrationen eines praktisch uneinlösbaren Anspruchs auf mehr Souveränität über das eigene Land, das ihm ja gelassen worden ist –: Allein das geht schon zu weit, verhöhnt die Ordnung, die die USA am Golf verhängt haben. Ihr Maßstab ist anspruchsvoll: Es geht um eine Kontrolle, der sich nichts und niemand entzieht, gegen die niemand aufbegehrt. Am Recht – der UNO, also ihres „Beauftragten“ Amerika – auf totalen Gehorsam ganzer Staaten wird die Lage gemessen; und die US-Regierung kommt nicht umhin, einen Fehlschlag zu registrieren: Sogar da, wo sie sich exemplarisch brutal, demonstrativ abschreckend betätigt, der Welt ihren Willen diktiert und gewaltsam aufgezwungen hat, hören die Widerspenstigkeiten nicht auf.
Also wird zugeschlagen. Und keine Frage: Das wird sich schon noch machen lassen, einen besiegten Feldherrn zum Stillhalten zu zwingen; schlimmstenfalls dadurch, daß der Irak für einige Zeit wieder zum Übungsplatz amerikanischer Militärs wird. Aber was ist sonst noch damit gewonnen? Der Grund dafür, wieder so demonstrativ weltöffentlich zuzuschlagen und dabei jede „Verhältnismäßigkeit der Mittel“ vermissen zu lassen, ist ja gerade, daß es um mehr geht als bloß um Saddam Hussein; nämlich schon wieder ums alte Prinzip: ein fraglos wirksames Weltgewaltmonopol. Die Bombardierung irakischer Ziele ist die gewaltsame Reaktion darauf, enthält also auch das Eingeständnis, daß der alliierte Sieg am Golf dieses Ziel gar nicht in der gemeinten anspruchsvollen Weise bestätigt hat. Auch nach diesem Triumph ist es nicht so, daß die ganze Welt bloß auf Kommandos auf Washington wartet; schon gar nicht die Verbündeten, die zwar mitfliegen, wenn der amerikanische Oberbefehlshaber es nicht mehr aushält, aber auch gewisse Einsätze ablehnen und darüber unmißverständlich einen Dissens anmelden. Wenn aber noch nicht einmal beim grandios geschlagenen Feind die „Lektion“ verfängt und die Abschreckung total wirkt, dann ist die gesamte tiefere Bedeutung des Einsatzes fraglich; am Ende reduziert sich der Sieg auf einen ganz ordinären gewonnen Feldzug. Hätte man nicht wenigstens Saddam Hussein aus dem Amt jagen müssen? Diese Frage selbst verrät den Zweifel am errungenen Erfolg und zugleich die Ratlosigkeit des Anspruchs auf eine unzweifelhafte Erfolgsgarantie.
Noch weniger, auch das verrät die Gereiztheit der Weltmacht, ist die nationale Rechnung der USA mit der – zu großen – Last und dem – zu geringen – Ertrag ihrer ordnungsstiftenden Übermacht wunschgemäß ins Lot gekommen. Statt vom demonstrativ klargestellten Kräfteverhältnis zu profitieren, fällt die Weltmacht in der Konkurrenz mit ihren Verbündeten weiter zurück; den Nutzen aus der mit Mühe erkämpften Weltordnung haben aus amerikanischer Sicht nach wie vor die andern. Die bleiben andererseits unhandlich oder sogar widerwillig, was eine vom US-Standpunkt aus gerechte Verteilung der Lasten der Weltherrschaft – der Abschreckung von Abweichlern, der Terrorisierung von „Verbrechern“ gegen die internationale Ordnung, des gewaltsamen Aufräumens – betrifft. Mit lauter Vorbehalten stehlen sie sich aus der Verantwortung, die Amerika mit ihnen teilen will, warten andererseits mit eigenen Friedensplänen für neue Konflikte auf: Sie wollen sich nicht einfach in die Pflicht nehmen lassen. Dieses Mißverhältnis ist der Grund dafür, daß der geschlagene Iraker sich mit ein paar Demonstrationen ohnmächtiger Unbotmäßigkeit die ganz unverhältnismäßige Wut der USA zugezogen hat: An seinem Fall, zwei Jahre nach dem Sieg, werfen die Amerikaner die Frage auf, was ihr Triumph ihnen überhaupt gebracht hat – nachdem er die beabsichtigte Korrektur des Weltgeschehens nicht geleistet hat.
Den eingeschlagenen Weg, das ist die letzte Klarstellung der Schläge gegen den Irak, verlassen die USA dennoch nicht. Das Mißverhältnis zwischen dem Aufwand für die Etablierung ihres als UNO firmierenden Weltgewaltmonopols und den zu Hause vermißten, anderswo entdeckten oder vermuteten Erträgen mag ihnen noch so groß vorkommen: Ein Verzicht auf die Oberhoheit, so als wären sie tatsächlich bloß „Partner“ und ein Staat unter anderen, kommt am allerwenigsten in Frage; die Alternative steht, daß sie entweder konkurrenzlose Weltmacht – oder gar keine Macht mehr sind. Und nach wie vor kennen sie zur Sicherung ihres Status keinen besseren Weg als denjenigen, für den die UNO steht: die freiwillige Unterordnung aller Nationen unter eine kollektive Machtzentrale, die deswegen eine ist, weil Amerika die Generalprokura hat. Wenn die so etablierte Weltordnung weiterhin Verhältnisse sichert, die andere Nationen mehr als die USA begünstigen, wenn sie also dem Ideal der nützlichen Kontrolle nicht genügt – dann kommt es um so mehr darauf an, darauf zu bestehen. Deswegen die Unduldsamkeit, mit der Präsident Bush noch bis zu seinem Abgang auf dem Irak herumgehackt und von der UNO verlangt hat, daß sie sich hinter die Ehre Amerikas stellt und nicht umgekehrt. Die Gleichung, wonach die Herrschaftsinteressen der USA sich im Ordnungsstandpunkt der UNO auflösen, wurde da einmal nachdrücklich umgekehrt betont: Was die UNO will, das hat seine ganze Bedeutung darin, die USA mit ihrer weltherrschaftlichen Unzufriedenheit ins Recht zu setzen.
Getäuscht hat sich da sowieso keiner; am wenigsten die Verbündeten. Bei denen hat das amerikanische Vorgehen nämlich Schule gemacht.
Der „Fall Jugoslawien“: Der Kampf der Europa-Macher um eigenständige imperialistische Kompetenz. Mit einer Randbemerkung zur KSZE
Die Idee, nach dem Ende der Sowjetunion eine allgemeinverbindliche internationale Ordnung zu proklamieren, die ein überstaatliches Gewaltmonopol voraussetzt, das es zwar nicht wirklich gibt, zu dessen Anwalt und Exekutor man sich aber erklärt, um unter allgemeiner Zustimmung Weltmacht auszuüben: diese Grundidee des modernen Imperialismus hat niemandem so gut gefallen wie Amerikas europäischen Verbündeten. Sie haben dafür gleich die beste Verwendung gehabt. Mit der Selbstauflösung des sozialistischen Lagers steht schließlich „vor ihrer Haustür“ ein halber Kontinent – und noch dazu halb Asien – zur umfassenden Neuordnung an: zur Integration in den kapitalistischen Weltmarkt und zur Neukonstitution politischer Gewalten mit der passenden Staatsräson. Vom ersten Moment an haben die Westeuropäer dafür ihre ungeteilte Zuständigkeit erklärt. Für den unumkehrbaren „Übergang in die Marktwirtschaft“ sowieso; für die politische Neuformierung der realsozialistischen Hinterlassenschaft erst recht und um so mehr, als es da mit dem Export westlicher Parteidoktrinen und Gesetzbücher keineswegs getan ist. Denn mit der Erneuerung der östlichen Nationalstaaten werden zwischen ihnen lauter neue Abrechnungen eröffnet: über eigene völkische Minderheiten unter falscher Herrschaft, über volksfremde Minderheiten im eigenen Land, über die jeweils dazugehörigen Grenzen usw. Auf sowjetischem und jugoslawischem Boden werden ganz neue Nationen aufgemacht, die einander teils ihren Bestand überhaupt, teils ihre aus dem alten Staatswesen überkommenen Grenzlinien bestreiten; so geht es an etlichen Stellen ans Kriegführen. Diese „Lage“ haben die Verantwortungsträger aus dem Westen Europas als Appell begriffen, sich nicht bloß mit den herkömmlichen Mitteln der Diplomatie, des Außenhandels, der Parteistiftungen usw. einzumischen, sondern außerdem in so ähnlicher Weise, wie es die USA im Golfkrieg vorgemacht haben: mit der Institutionalisierung einer Oberaufsicht, die von allen zu betreuenden Staaten anerkannt wird, weil sie dabei sind, und die tatsächlich durch die EG-Mächte ausgeübt wird.
Für diesen neuen Zweck wurde eine Zeitlang eine altbewährte Institution der freiheitlichen Ostpolitik neu belebt: die „Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa“. Das war nicht ohne Logik; schließlich hatte sich die KSZE zu den Zeiten, als sie von antikommunistischen Ostpolitikern aktiv in die Hand genommen wurde, als Mittel bewährt, um mit Zustimmung des sowjetischen Gegners in dessen Herrschaftsbereich hineinzuregieren. Anknüpfend an diese Tradition, wollten nun vor allem die deutschen Gesamteuropa-Politiker die KSZE zur „Regionalorganisation der UNO“ aufwerten – eine Einrichtung, die tatsächlich in einem längst vergessenen Punkt der UNO-Charta zugelassen ist. Von der in der UNO organisierten allgemeinen Zuständigkeit aller souveränen Staaten für alles sollte so ein Sonderrecht für Europa einschließlich der asiatischen Ex-Sowjetrepubliken abgetrennt werden: ein eineinhalb Kontinente umfassendes supranationales Gewaltmonopol, legitimiert durch die Mitgliedschaft aller KSZE-Nationen samt Nachfolgestaaten, zum Eingreifen im Interesse der demokratisch-marktwirtschaftlichen Ordnung ermächtigt, wahrgenommen durch die führenden EG-Staaten, abgesegnet durch den großen Partner USA. Das wäre nebenbei, aus Sicht der Westeuropäer, die von der US-Regierung angemahnte „Lastenteilung“ in Sachen Weltordnung gewesen: Sie hätten sich, mit Billigung der Amerikaner, als anerkannte Führungsmacht auf dem Kontinent etabliert; die KSZE hätte sie mit jedem gewünschten Mandat bis hin zur Neugründung ganzer Staaten ausgestattet; die Herrichtung des ehemaligen Ostblocks zum Tummelplatz westeuropäischer Interessen hätte ihre feste Ordnung gehabt. Um die Verteilung des Nutzens aus diesem Projekt hätten sich die Prokuristen der neuen europäischen Ordnung keine Sorgen zu machen brauchen.
An dem „Fall“, um dieses europäische Modell nach dem Vorbild der amerikanischen Lektion im Irak durchzukämpfen, also durch exemplarischen praktischen Einsatz die beanspruchten Ordnungsbefugnisse über Europa durchzusetzen, hat es auch nicht gefehlt. Die Sezessionskriege im ehemaligen Jugoslawien wurden in den EG-Hauptstädten als passende Gelegenheit hierfür wahrgenommen. Aus der KSZE-Konstruktion ist freilich noch gar keine entscheidungsmächtige Regional-UNO geworden; nach einigen ermahnenden Beschlüssen und, als äußerster Sanktion, dem Ausschluß Serbiens, des erklärten Bösewichts im Balkankrieg, von der weiteren Mitarbeit hat sich dieses Instrument als gar nicht ohne weiteres handhabbar herausgestellt. Stattdessen haben die EG-Mächte im eigenen Namen, ohne weitere Verkleidung als führender Teil eines gesamteuropäischen Gremiums, die Aufsicht über das Geschehen in Jugoslawien an sich gezogen und werden mit dem „Angebot“, als anerkannte Ordnungsmacht tätig zu werden, gleich bei der UNO selbst vorstellig, deren Sicherheitsrat ja nach wie vor das Monopol auf Lizenzen zum Kriegführen besitzt.
Eben diese Lizenz haben sich die EG-Staaten bislang allerdings gar nicht ausstellen lassen; und so sind sie von ihrem Ziel, es den USA gleichzutun und sich mit einer siegreichen Intervention „vor der eigenen Haustür“ als Mandatsträger des UNO-Gewaltmonopols Respekt zu verschaffen, weit entfernt. Nach amerikanischem Vorbild hätten sie, unbekümmert um die Einwände anderer, eine überlegene Gewaltapparatur auffahren und sich gleichzeitig formell zu dem ermächtigen lassen müssen, was sie bereits in Gang gesetzt hätten. Stattdessen betreut die EG gemeinsam mit der UNO ein immer wieder fruchtloses Konferenzwesen; und die „Friedenstruppen“ vor Ort machen den Anspruch auf Fügsamkeit der ex-jugoslawischen Kriegsparteien zwar deutlich und erhalten ihn unverdrossen aufrecht, setzen aber nichts durch.
Diese „Zurückhaltung“, das Haltmachen unterhalb der militärischen Intervention, wird den EG-Regierungen von der moralisch aufgebrachten Öffentlichkeit ihrer Länder schwer verübelt. Die hat sich voll auf den Schwindel von den „humanitären Gründen“ geworfen, die es unabweisbar gebieten, machtvoll dazwischenzufahren und das innerjugoslawische Gemetzel um einen Krieg von außen zu ergänzen, der selbstredend kein Krieg in dem Sinn, sondern eben eine zutiefst menschenfreundliche, selbstlose Weltpolizeiaktion wäre. Daß da nach allgemeinem Konsens die pure Menschlichkeit endlich einmal nicht Stillhalten, sondern pures Dreinschlagen gebiete, begeistert zivilisierte Demokraten dermaßen, daß sie das „Zögern“ ihrer Regierungen überhaupt nicht verstehen können. Dabei ist der Grund sehr schlicht: Die Kriegspropaganda, mit der Völker in Stimmung gebracht werden, ist nun einmal nicht der Kriegsgrund, nach dem Staaten sich richten. Den EG-Mächten geht es nicht um vergewaltigte Witwen – ganz davon abgesehen, was die von europäischen UNO-Legionären hätten – oder um die Erhaltung ethnisch „durchmischter und durchraßter“ Bevölkerungsstrukturen, oder wie die Berufungstitel für erzgerechte Bombardierungen und militärische „Säuberungen“ sonst lauten mögen, sondern – wenn man schon von dieser moralischen Fiktion ausgehen will – um das politische Subjekt, das sich für seinen Kriegswillen darauf beruft: um sich als Aufsichts- und Ordnungsgewalt. Und da liegt der Haken, das Hemmnis für die hemmungslos propagierte Kriegsbereitschaft: Es hapert an der Identität des politischen Subjekts, das da zur Ordnungsmacht aufwachsen will – die EG-Mächte sind sich schlicht nicht einig. Jede Regierung hat ihre eigenen Vorstellungen von einem gemeinsamen Eingreifen und ihre eigenen Vorbedingungen dafür.
- Deutschland auf der einen Seite wird vor allen anderen staatengründend tätig; es ermuntert die slowenische und kroatische Sezession, erwirbt seinen Schützlingen internationale Anerkennung und setzt damit Fakten. Gleichzeitig beschränkt sich das deutsche Engagement ganz bescheiden selber, indem es das gewaltsame Durchkämpfen der neuen Souveränitäten, den Krieg zur Beseitigung der alten jugoslawischen Zentralmacht und um volksstaatliche Besitzstände, seinen Kreaturen vor Ort überläßt. Deutschland handelt, als hätte es bereits das Gewaltmonopol auf dem Balkan – und handelt gleichzeitig so, als wäre ein solches Monopol ohne eigene Gewalt zu haben. Und das nicht, weil die kriegsunerfahrenen Machthaber in Bonn sich täuschen würden, sondern weil es ihnen um etwas reichlich Kompliziertes geht. Ein Krieg auf eigene Faust oder auch nur ein Vorgehen mit dem klaren und ehrlichen Inhalt: Deutschland hilft den Machthabern Kroatiens und Bosniens beim Landerwerb – das wäre das Letzte, was diese Nation will. Deutschland will auf die tiefere weltpolitische Bedeutung einer europäischen Balkan-Intervention hinaus: auf die Etablierung der Europäischen Union, auch wenn es die noch gar nicht gibt, als anerkannter kontinentaler Ordnungsmacht – darüber entsteht sie dann schon oder kommt zumindest entscheidend voran und nimmt gleich von vornherein den Platz ein, den Deutschland ihr zugedacht hat.
- Eine solche gemeinsame Großmacht wollen Deutschlands Partner auch. Eben deswegen kämpfen sie aber nicht für eine Ordnung, die Deutschland ohne jeden Kampfeinsatz diktieren möchte. Gleichzeitig geht es auch ihnen nicht um eine eigene Zuständigkeit ohne – was automatisch heißen würde: gegen – ihren stärksten Partner BRD.
- Vor allem aber geht es allen EG-Partnern um eine Einbindung ihres allerstärksten Verbündeten, der USA; und zwar gerade weil es ihnen um ihre kollektive Zuständigkeit als generalbevollmächtigter UNO-Mandatar für den Balkan und Europa überhaupt zu tun ist. Das ist nämlich nicht durch machtvolle Alleingänge zu erreichen, sondern nur durch allgemeine Anerkennung als legitime Führungsmcht. Und dafür kommt es vor allem andern auf die Bereitschaft des stärksten Partners an, die Rolle des Mitmachers zu spielen – Amerika hat es vorgemacht, mit seinem Bemühen um den Konsens seiner Verbündeten in der Irak-Affäre.
- Die USA ihrerseits sind einer Einmischung nicht prinzipiell abgeneigt. Ihnen geht es allerdings, wenn sie sich engagieren, darum, die „Lektion“ vom Golf, sachgerecht auf osteuropäische Verhältnisse zugeschnitten, zu erneuern. Und dazu gehört die Klarstellung, daß sie auch in Europas Hinterhof die Führungsmacht sind, ohne die nichts geht und die die EG-Mächte als Erfüllungsgehilfen an den Ort des Geschehens bestellt; auf gar keinen Fall spielen sie selbst die Rolle des bloßen Weltpolizisten, der von den Europäern bestellt wird, um deren Krieg zu führen. Das wiederum ist das genaue Gegenteil dessen, was die EG-Staaten von den USA wollen.
Das alles zusammen ergibt ein bißchen zuviel Uneinigkeit über Rechte und Pflichten, Lasten und Nutzen der Beteiligten, als daß ein zielstrebiger Aufmarsch in der Adria und eine Politik der Konfrontation des UNO-Sicherheitsrats mit dem Anspruch auf immer weitergehende Ermächtigungen zum Kriegführen herauskommen könnte. Stattdessen kommt einerseits die Nato ins Spiel, weil sie doch die jahrzehntelang bewährte Einheit der Westeuropäer mit ihrer amerikanischen Schutzmacht ist; sie übernimmt die Ausarbeitung von Interventionsplänen und bietet sich der UNO als Vollstreckungsorgan von Sicherheitsratsbeschlüssen an, die freilich über bloßes Beobachten und Kontrollieren gar nicht hinausgehen, weil unter den gegebenen Bedingungen keines der Sicherheitsratsmitglieder weitergehende Aufträge einfordert. So bleibt die Rolle der Nato andererseits auch wieder sehr beschränkt – schließlich steht sie, aus europäischer Sicht, doch für ein reichlich unausgewogenes Verhältnis zwischen der atomaren Supermacht und ihrem „europäischen Pfeiler“. Außerdem ist Frankreich als wichtigste Militärmacht im EG-Verbund mit seiner Streitmacht dort gar nicht vertreten. Wohl aber ist es Mitglied der WEU, die den Vorzug, aber auch den Nachteil hat, bloß europäisch zu sein; außerdem gebietet sie einstweilen über keine eigenen Truppen…
Aus dieser komplexen Problemlage hat sich mittlerweile – Stand Anfang Februar; für die Haltbarkeit von Zwischenlösungen in diesem durch und durch unehrlichen Konkurrenzstreit kann keinerlei theoretische Garantie übernommen werden! – immerhin ein EG-Konsens herausgebildet. Deutschland, das ja ohnehin nicht kämpfen will, und die Partner, die ohne Deutschland nicht kämpfen wollen, – wobei für alle gilt: es sei denn, daß es sein muß! –, haben sich auf die vielgeschmähte Doppelstrategie des unermüdlichen Verhandelns und der militärischen Drohungen geeinigt.
- Verhandelt wird unter doppelter – EG- und UNO- – Leitung über einen Friedensplan, mit dessen Durchsetzung die Westeuropäer ihren Durchbruch als Ordnungsmacht in und für Europa schaffen wollen. Damit das gelingt, soll sich der Weltsicherheitsrat ausdrücklich dahinterstellen und den Kriegsparteien vor Ort jede Aussicht auf andere Lösungen verbauen. Über den Sicherheitsrat sollen vor allem die USA sich den Euro-Plan zueigen machen; mit einem noch so kleinen Interventionstrüppchen der Amerikaner auf Grundlage der europäischen Initiative wäre die Sache in ihrem wesentlichen Punkt geschafft. Eben deswegen stößt der „Vance-Owen-Plan“ bei den Amerikanern jedoch auf wenig Gegenliebe. Ihre Ablehnung kleiden sie in das hochmoralische Argument, das zeitweise die Deutschen gepachtet hatten: Man dürfe keine serbischen Kriegsgewinne honorieren. So kommt es zu einer netten kleinen Ironie der Geschichte: Der deutsche Außenminister, der immer als größter antiserbischer Scharfmacher aufgetreten ist, muß im Interesse der vereinbarten europäischen Linie versuchen, die neue Regierung Amerikas, das von der deutschen Öffentlichkeit gerne ungerechtfertigter, aus Weltkrieg-I-Tagen stammender Sympathien für die serbisch-jugoslawische Sache verdächtigt wurde, von ihrem Einwand abzubringen, der EG-UNO-Plan würde serbische Siege legitimieren. So kann es gehen, wenn die beiden großen Weltordnungs-„Partner“ Weltpolitik vom methodischen Standpunkt der Durchsetzung eigener Kompetenz gegen die des jeweils andern betreiben und dafür einen immerhin real existierenden Krieg als Material benutzen; da muß manche Parteinahme schon mal widerrufen werden, eben weil es um eine Parteilichkeit der höheren Ordnung geht. Die Kriegsparteien vor Ort sind natürlich die ersten, die die neueste Konstellation im europäisch-amerikanischen Kräftemessen für sich ausnutzen: Sofort begreift der Präsident Bosniens den amerikanischen Widerstand gegen eine EG-UNO-Lösung – genauso wie zuvor die deutschen Einwände gegen die EG-Mehrheitslinie – als Versprechen, daß er durch pures Durchhalten und bedingungslose Verlängerung der Schlächterei nur gewinnen kann. Also lehnt er den Friedensplan ab und unterläuft ihn vor Ort in der Berechnung, daß die US-Regierung ihn scheitern läßt; die beruft sich ihrerseits für ihre Zurechtweisung des europäischen Versuchs, „eigenmächtig“ über die UNO auf dem Balkan Ordnung zu stiften, darauf, daß nicht alle kriegführenden Parteien ihn akzeptieren.
- Daneben eskalieren die militärischen Eingriffsdrohungen, ohne übermäßig an Zielrichtung und Bestimmtheit zu gewinnen; selten dürfte am Aufbau einer militärischen „Drohkulisse“ so deutlich abzulesen gewesen sein, daß es dabei zwar auch um die Einschüchterung der bedrohten Kriegsparteien geht, vor allem aber – schon wieder – um die übergeordnete methodische Frage, in wessen Kompetenz das Drohen fällt und auch das gewaltsame Eingreifen, vorausgesetzt es kommt, so oder so, über die UNO zu einer Gleichschaltung des europäischen und amerikanischen Eingriffswillens. Frankreich entsendet einen Flugzeugträgerverband, nach dessen militärischem Auftrag eine skeptische Öffentlichkeit vergeblich fragt, weil die Regierung dabei sowieso weniger den durchschlagenden Effekt auf das Kriegsgeschehen im Auge hat als ihre Gleichrangigkeit mit oder besser noch Vorrangigkeit vor den USA, die ihrerseits aus ganz den gleichen, nur umgedreht gelesenen Gründen mit viel Marine in der Adria aufgefahren sind. Frankreich vertritt eben am entschiedensten die Seite des EG-Standpunkts, daß Europa die USA zwar braucht, ihnen aber auf keinen Fall die Federführung bei der Beilegung eines Konflikts auf europäischem Boden überlassen darf; wohingegen andere die Kooperation mehr betonen und deswegen auf die Nato-AWACS-Flugzeuge zur Überwachung eines eventuell verschärften Flugverbots über Bosnien setzen. Und die deutsche Öffentlichkeit kann sich schon wieder über einen scheinbaren Widerspruch wundern: Ausgerechnet Frankreich, dem sie immer am heftigsten eine unsittliche Serbien-Freundschaft nachgesagt hat, droht am massivsten, wohingegen Deutschland, das die Heuchelei vom sittlich gebotenen Krieg am weitesten treibt, jeden Soldaten schuldig bleibt.
So ringen die EG-Staaten, einigermaßen gemeinsam, mit den USA um ein UNO-Mandat für ihren „Vance-Owen-“ gegen einen eventuellen amerikanischen Friedensplan sowie um ein Vorrecht auf Erpressung der Kriegsparteien bis hin zur Drohung mit einem Interventionskrieg, über den sonst noch gar nichts, aber soviel auf alle Fälle feststeht: Weder die Europäer – am wenigsten die Deutschen – noch die Amerikaner wollen ihn allein führen; daß die US-Streitkräfte sich so unter EG-Befehl stellen könnten, wie die europäischen Verbündeten sich am Golf amerikanischem Kommando unterstellt haben, ist ausgeschlossen; daß diese Konstellation wiederkehrt und in der Adria schon wieder auf US-Befehle gehört wird, wollen die Europäer unbedingt ausschließen. Wieviel Krieg am Ende herauskommt, ist offen. Die UNO-Leitung fürchtet offenbar, daß ihre Blauhelme zwischen die Fronten geraten, wenn einer der beiden großen Friedensstifter, EG oder USA, schließlich doch zu dem Schluß kommt, er sei sich – natürlich im Interesse der Weltordnung – ein paar eindrucksvolle Schläge einfach schuldig. Umgekehrt fürchten die Friedensstifter in der demokratischen Öffentlichkeit der engagierten Nationen, das ordnungsschaffende Gemetzel im UNO-Auftrag könnte aus Uneinigkeit am Ende unterbleiben; dann hätte, scheußliche Vorstellung für demokratische Weltordner, erstmals wieder seit den Tagen des sowjetischen „Njet“ im Weltsicherheitsrat „die UNO sich selbst blockiert“ – also im Klartext: Imperialistische Rivalität hätte einen Krieg ausnahmsweise mal verhindert. Am meisten fürchten allerdings die Europäer, für sie könnte am Ende doch wieder nichts anderes übrigbleiben als die Rolle des amerikanischen Hilfs-Sheriffs – eine schwerwiegende Niederlage der höheren Art, wo sie doch gerade begonnen haben, am „Fall Jugoslawien“ ihren Anspruch auf Gleichrangigkeit mit der etablierten Weltordnungsmacht, zumindest in und für Europa, in die Tat umzusetzen. Da könnte dann doch ein „gezielter“ und „dosierter Militärschlag“ die bessere Lösung sein – allerdings nicht ohne UNO-Lizenz, für die man wiederum die Amerikaner braucht…
UNO-Missionen weltweit: Widersprüche einer kollektiven „Kanonenbootpolitik“
In Dutzenden von „Fällen“, rund um den Globus, ist die UNO mit Beobachtern und „Blauhelmen“ in unterschiedlicher Massierung unterwegs, um zweifelhafte Kandidaten in der Staatenwelt dazu zu bringen, daß sie nach innen eine ordentliche Herrschaft durchsetzen – „Demokratie“ ist der allgemein anerkannte Titel und zugleich so etwas wie eine Verfahrensvorschrift dafür – und nach außen Wohlverhalten an den Tag legen. Die Weltorganisation betätigt sich hier wie das Subjekt einer Aufsicht, für die ansonsten Großmächte auf eigene Faust Kanonenboote und Kolonialarmeen bzw. Flugzeugträger, Marinesoldaten und Fallschirmjäger entsandt haben – und auch heute noch losschicken, wenn ihnen das Treiben in fremden Ländern endgültig nicht mehr hinnehmbar erscheint. Denn solche Mittel stehen der UNO als solcher nicht zu Gebote, so sehr ihr Chef es sich auch wünscht und sich schon als Befehlshaber einer militärisch schlagkräftigen Weltpolizei sieht. Wo sie hingeht, ist sie keine weltordnende Gewalt, sondern deren Schein. Der bewirkt soviel, wie die wirklichen Großmächte an Nachdruck dahintersetzen. Das wiederum hängt nicht vom Ehrgeiz der UNO-Zentrale ab und auch nicht in erster Linie von dem Konflikt, in den diese eingreifen darf, sondern davon, was die wirklichen Mächte der Position, die sie in der Konkurrenz gleichgesinnter Weltmächte einnehmen wollen, im gegebenen Fall schuldig sind.
Danach sieht das Ergebnis der UNO-Intervention vor Ort dann auch aus.
Der „Fall Kambodscha“: Frieden, Demokratie und ein Kräfteverhältnis in Fernost
In Kambodscha hat die UNO sich friedenstiftend in einen inneren Krieg eingemischt, den die frühere Regierungspartei der Roten Khmer und zwei weitere Guerilla-Gruppen seit anderthalb Jahrzehnten gegen die amtierende Regierung führen. Bei den Roten Khmer handelt es sich um ein Produkt des Vietnamkriegs; nach ihrem Sieg haben sie denkbar brutal im eigenen Volk – nicht zuletzt mit „volksfremden“ Vietnamesen – aufgeräumt und sind als Bande „ultramaoistischer Massenmörder“ in Verruf geraten. Hinter ihnen steht China, außerdem das alte Votum der UNO, sie nach wie vor als einzig legitime Vertretung des Landes anzuerkennen. Die zwei anderen Oppositionsgruppen, davon eine unter dem Kommando des Uralt-Prinzen Sihanouk, sind Geschöpfe westlicher Einmischung. Die amtierende Regierung ist von Vietnam nach der siegreichen Intervention gegen die Herrschaft des Rote-Khmer-Chefs Pol Pot eingesetzt worden. Zwischen diesen Parteien hat die UNO ein Waffenstillstandsabkommen herbeigeführt, an das sich keine Seite hält. Sie hat alle Kriegsparteien zu gleichberechtigten politischen Konkurrenten erklärt und damit vor allem in Kambodscha die Roten Khmer in aller Form rehabilitiert. Die Souveränität der amtierenden Regierung hat sie suspendiert und damit den Guerillatruppen Entlastung verschafft; außerdem wurde dadurch eine Sorte Überlebenskunst gefördert, die in andern Staaten unter „organisierte Kriminalität“ fällt. 20.000 „Blauhelme“ und eine große Masse Verwaltungspersonal hat die UNO ins Land gebracht, deren wesentliche Leistung darin besteht, Dollarquelle für Geschäftemacher zu sein. Und sie bereitet für Mitte des Jahres 93 freie Wahlen vor, mit denen die Kriegsparteien auf eine gedeihliche parlamentarische Zusammenarbeit festgelegt werden sollen; die Parteien führen ihren Wahlkampf mit terroristischen Überzeugungsmethoden. Von Anfang bis Ende ist das Ganze ein Hohn auf das allgemein beliebte Bild von der UNO als Bastion des Guten und der Menschlichkeit in der Staatenwelt.
Nun hat sich die UNO keineswegs deswegen in Kambodscha eingemischt, weil sie ausgerechnet für als „ultralinks“ verschriene politische Massenmörder Sympathien hätte. Mit ihrer seinerzeitigen Parteinahme für die von der vietnamesischen Armee verjagten Roten Khmer, gegen die Vietnam-freundliche neue Regierung, die den internationalen Mindestanforderungen an einen brauchbaren Souverän im Grunde viel besser entsprach als das vorherige Schreckensregime, war sie ausschließlich den außenpolitischen Interessen der Mächte gefolgt, die sich damals im Sicherheitsrat hatten durchsetzen können, übrigens ohne damit viel zu bewirken: Der Westen war sich mit China dahingehend einig geworden, der vietnamesischen Intervention jede Anerkennung zu versagen. Der Antikommunismus der Freien Welt hatte sich konstruktiv zusammengetan mit der chinesischen Feindschaft gegen Vietnam als „Vorposten der Sowjetunion“ in Indochina. Aus Gründen der gleichen Art hat die UNO sich zu einer Großaktion für Frieden und Demokratie in Kambodscha entschlossen, als zu Zeiten des späten Gorbatschow die sowjetische Regierung den Vietnamesen ihre Unterstützung, auch für ihre Ordnungspolitik im Nachbarland, entzog: Kambodscha soll mit aller Macht von Vietnam emanzipiert, der vietnamesische Einfluß überhaupt in die Schranken gewiesen, den auswärtigen Interessenten zu ihrem Recht auf Einfluß verholfen werden, das sie die ganze Zeit über mit dem Unterhalt eigener Guerillatruppen aufrechterhalten hatten. Solche Kalkulationen werden an Kambodscha exekutiert, wenn die Bevölkerung des Landes jetzt der absurden Veranstaltung unterworfen wird, mit dem Wahlzettel die Aussöhnung unversöhnter und erklärtermaßen unversöhnlicher Kriegsgegner zu bewirken. Deswegen sind die verheerenden Wirkungen der großmächtigen Befriedungsaktion der UNO im Innern des Landes auch überhaupt nicht dazu angetan, die Veranstalter in ihrem Projekt irre zu machen. Die Rechnung mit der Neuzuteilung von Einfluß und Zuständigkeiten ist zum guten Teil ja schon aufgegangen.
Dies übrigens nicht bloß für die unmittelbaren Konkurrenten und Gegner Vietnams, sondern auch und speziell für diejenige kapitalistische Großmacht, die sich im „Fall Kambodscha“ erstmals wieder seit ihrem verlorenen Weltkrieg mit Truppen – wenn auch unterm blauen Helm – engagieren darf und die es sich nicht hat nehmen lassen, den Chef der UNO-Übergangsverwaltung zu stellen. Nein, diesmal nicht Deutschland, obwohl man auch in Bonn schon wieder eine Gelegenheit gesehen und ergriffen hat, ein bißchen Bundeswehr am andern Ende der Welt eingreifen zu lassen, wenn auch bloß heilend und helfend: Irgendwo müssen die ersten Schritte hin zur weltweit präsenten Militärmacht schließlich getan werden. Der andere große Verlierer, das längst wieder groß gewordene Japan betreibt dort sein Come-back als geläuterte Ordnungsmacht, die gar nicht in der früheren Weise gewalttätig imperialistisch auftritt, sondern bescheiden im UNO-Auftrag; zudem in viel engerem Rahmen als dem, den es sich als Wirtschaftsmacht auf dem pazifischen Markt längst geschaffen hat; aber eben als neuer „Ordnungsfaktor“, der für seinen Einsatz im Dienst einer allgemein abgesegneten Ordnungsaufgabe unbedingt Anerkennung verdient.
So weltpolitisch nützlich die Aktion insoweit also ist: Das Ziel, allgemein brauchbare politische Verhältnisse in Kambodscha herzustellen, erreicht die UNO mit Sicherheit nicht. Sie untergräbt ja mit ihrem Eingriff die elementare Voraussetzung internationaler Geschäftsfähigkeit, nämlich die Regierungsautorität; sie schafft gute Voraussetzungen dafür, daß die geplanten Wahlen auch nicht viel davon wiederherstellen; nebenher ruiniert sie alle Ansätze zur Wiedergewinnung materieller Brauchbarkeit des Landes. Wenn sie abzieht, hinterläßt sie Kambodscha absehbarerweise noch etwas tiefer in einem Zustand, den es sonst bloß in den Law-and-Order-Ideologien wehrhafter Demokraten als Schreckbild gibt, nämlich unregierbar.
Für die Regisseure des UNO-Einsatzes stellt sich die Lage verständlicherweise etwas anders dar. Sie haben ihre offizielle Zielsetzung längst so zurechtdefiniert, daß ein Erfolg unvermeidlich ist: Zielpunkt sind die freien Wahlen; und die werden sich schon irgendwie durchziehen lassen, notfalls ohne die Roten Khmer, die sich mittlerweile diesem absurden Versöhnungsversuch widersetzen, und unter Aussparung der von ihnen besetzten Gebiete. Um mehr zustandezubringen, um zumindest das ruinierte Gewaltmonopol über das Land wirksam wiederherzustellen, fehlt es ganz erheblich an Gewalt. An größeren und weitergehenden Gewalteinsätzen aber besteht bei den Urhebern und Sachwaltern des UNO-Mandats über Kambodscha vorerst gar kein Interesse. Ihre Konkurrenzbedürfnisse sind bedient; für mehr „Frieden und Demokratie“ mag – einstweilen – niemand kämpfen.
Es wäre, nebenbei, auch schwer zu sagen, wie mit mehr Gewalt von außen eine brauchbare Ordnung in diesem Land zu stiften wäre – unter den mittlerweile von außen hergestellten Verhältnissen. Um verläßlich zu sichern, was für die maßgeblichen Mächte den Tatbestand einer nützlichen Ordnung erfüllen würde, wäre die gewaltsame Verwaltung des Landes selbst nötig; gewissermaßen eine neue Sorte Kolonialherrschaft – das Ideal davon geistert ja bereits durch die politologischen Diskussionen über die Dritte Welt und ihre zunehmende Unbrauchbarkeit. Die UNO ist aber gar nicht das Subjekt, um ruinierte Staaten auf diese Weise politisch in Besitz zu nehmen. Im Gegenteil: Sie beruht auf dem Beschluß, daß überall eigenständige souveräne Herrschaften funktionieren sollen: nationale Regierungen, die im Fall eines – von den Ordnungsmächten so eingestuften – Mißbrauchs ihrer Souveränität „zur Räson gebracht“ werden müssen, die aber auch „zur Räson gebracht“ werden können und dann wieder als brave UNO-Mitglieder funktionieren. Genau das, was die UNO da voraussetzt, wird nun allerdings durch die Ordnung selbst zugrundegerichtet, die die UNO stiftet.
Dieses grundsätzlichere Dilemma ist es aber gar nicht, was die Nationen mit Aufsichtsrecht über den Globus davon abhält, eine sachgerecht ausgestattete Besatzungsarmee nach Kambodscha zu schicken. Diese Nationen sehen da sowieso kein Dilemma, sondern schlimmstenfalls enorm zunehmende Anforderungen an ihre Gewaltapparate; ob und wie sie denen entsprechen, das teilen sie sich ein. Wo sie meinen, daß sie es sich schuldig sind, geizen sie nicht mit eigenem Militär und halten das auch unbefangen für das goldrichtige Rezept – ohne den Übergang zur Neo-Kolonialmacht zu machen, die als neues „Mutterland“ ernsthaft die Verantwortung für intakte Gewaltverhältnisse vor Ort übernähme. Sie folgen schlicht ihrem brutalen Idealismus, mit demonstrativem Zuschlagen an frei ausgewählten Orten müßte sich letztlich doch alles regeln lassen.
Der „Fall Somalia“: Abschreckungspolitik am untauglichen Objekt für eine ordentliche Staatlichkeit – und für die Klärung von Kompetenzfragen
Am „Horn von Afrika“ gehen die USA als Schutzmacht der UNO und ihrer gerechten Belange, wie man hört, ganz ungemein selbstlos ans Werk. Der Irak-Krieg des Präsidenten Bush konnte nie ganz von dem Verdacht freigesprochen werden – der umgekehrt in der amerikanischen Öffentlichkeit durchaus auch als Werbeargument für diesen Krieg Verwendung fand –, es ginge letztlich doch „bloß“ um billiges Öl. Ähnliche Unterstellungen finden im Fall Somalias keinen Anhaltspunkt – was innerhalb der USA nicht nur Beifall findet, sondern auch die Frage aufrührt, ob die Regierung sich nicht besser um das Elend im eigenen Land kümmern sollte –: Ohne Eigeninteresse bekämpft Amerika dort den Hunger.
Mit Waffen.
Der Hunger als solcher kann es demnach freilich doch nicht sein, dem es da an den Kragen geht. Mit ihrem Truppenaufmarsch jedenfalls haben die USA „bewaffnete Banden“ im Visier, Überreste der in jahrelangen, von außen – auch aus Amerika – ermunterten und unterhaltenen Kriegen kaputtgegangenen Staatsgewalt und aufgebauten Oppositionsgruppen. Die sind an der Hungerkatastrophe insofern schuld, als sie „verhindern, daß die Hilfe ankommt“. So recht den Grund des Massensterbens in Somalia hat man damit zwar nicht diagnostiziert – manche Experten haben sogar Gründe für die Meinung, die gelaufene Betreuung des Landes durch die UNO-Welthungerhilfe hätte zur Katastrophe und zum Bandenwesen einiges beigetragen -. Dafür ist aber ein bißchen klarer, was diesem Land vor allem fehlt: die Elementarform politischer Ordnung – eine Gewalt, die allgemein respektiert wird.
In der öffentlichen Meinung der großen Demokratien steht dieses Bedürfnis nach durchsetzungsfähiger, konkurrenzloser Gewalt – das hauptsächlich die betreuenden Staaten empfinden – umstandslos für die damit verbundene humanitäre Absicht, nämlich daß die Hungerhilfe ordentlich ausgeteilt wird. Einen anderen Zweck können sich dieselben Meinungsbildner und guten Menschen nicht vorstellen, die andererseits durchaus überzeugt sind, daß „wir“ unmöglich „alles Elend dieser Welt schultern“ können; die also auch schon mal zu einem gewissen Zynismus neigen und sich sogar die absurde Rechnung einleuchten lassen: besser ein paar tausend Soldaten hin als -zigtausend Hungerleider her, die dann bloß „unser Asylrecht mißbrauchen“. Mehr an egoistischer Berechnung, an handfestem materiellem Interesse ist im Somalia-Einsatz der Amerikaner aber nicht zu erkennen – jedenfalls nicht vom Standpunkt der moralischen Überprüfung, den eine liberale Öffentlichkeit in Kriegsfragen so gerne einnimmt. Da bleibt nämlich bloß die Alternative: Öl oder Ideale. Der abgebrühte Skeptiker sucht nach dem materiellen Vorteil, der ihm als Kriegsgrund einleuchten würde; und entweder läßt sich etwas in der Art finden, dann ist „die Politik“ mal wieder sehr „Real-“, oder es gibt moralische Pluspunkte, weil der Verdacht auf Selbstlosigkeit einfach nicht zu widerlegen ist.
Dabei verlieren materielle Berechnungen allemal ihr Recht, wenn Nationen in Ordnungsfragen grundsätzlich werden und ohne Rücksicht auf Kosten, nur nach militärischen Erfolgsgesichtspunkten zu Werk gehen. Ob Öl oder Hunger, oder genauer: ob die Annexion einer Ölquelle durch die benachbarte Staatsfirma oder der Zerfall einer eigenstaatlichen Hungerverwaltung den Ausgangspunkt bilden: Eine Staatsmacht, die sich dadurch zu gewaltsamem Eingreifen herausgefordert sieht, subsumiert die „Lage“ unter den sehr speziellen Gesichtspunkt, dort würde ein Recht verletzt, für das sie einzustehen hat. Um diesen ihren Rechtsstandpunkt geht es ihr dann auch, wenn sie eigene Bürger als Soldaten losschickt – in Somalia gar nicht anders als in Kuwait. Übrigens faßt die öffentliche Meinung in den engagierten Demokratien die Sache im Grunde ganz genauso auf: Auch sie kommt ohne die Deutung eines Stücks Weltgeschehen als Unrecht gegen Prinzipien, für die die eigene Nation angeblich einsteht, gar nicht aus, wenn sie einen unabweisbar guten Kriegsgrund ausmachen will. Deswegen sind ihr dann auch die Wirkungen des Gewalteinsatzes, sei es aufs Ölgeschäft, sei es aufs Verhungern, nicht mehr gar so wichtig, wenn moralisch klar ist, daß „dazwischengefahren“ werden muß – da geht es der öffentlichen Meinung nicht viel anders als den zuständigen nationalen Befehlshabern, die zwar nicht auf ihre eigene Kriegspropaganda hereinfallen, aber jedenfalls auch beim Siegen nicht noch auf Leidtragende achten können.
Die USA besetzen also Somalia militärisch, weil sie es als ihr Recht begreifen, daß auch dort eine politische Gewalt die Lage unter Kontrolle hat. Herrenloses Land ist in der modernen Welt ein Unding; es wäre eine Verletzung der Weltordnung, für die die USA einstehen, weil sie sie, nicht ohne Grund, als die Ihre betrachten.
Nun gibt es solche Ausfallerscheinungen wie in Ostafrika häufiger in der Staatenwelt von heute, von Afghanistan bis Liberia, und in Zukunft absehbarerweise immer öfter, wo immer UNO-Interventionen unregierbares Land hinterlassen, von Kambodscha bis Angola. Das ist niemandem klarer als dem großen Ordnungshüter selbst. Zu tun gäbe es also viel. Warum die USA sich ausgerechnet Somalia zum Eingreifen ausgesucht haben, dafür mögen vielerlei Gesichtspunkte eine Rolle gespielt haben: der strategische Wert gewisser Häfen, die die Seemacht Amerika dem gefährdeten Bereich des „mittleren Ostens“ zurechnet; vielleicht auch die militärisch einstweilen nicht allzu komplizierte Lage. Entscheidend ist aber die Bedeutung, die die USA durch ihr Eingreifen dem „Fall Somalia“ verleihen. Sie definieren den Staatszerfall dort als Angelegenheit, die im Grunde ganz in die Zuständigkeit der UNO als relativ selbständig agierender allgegenwärtiger Aufsichts-„Behörde“ fällt und deswegen an sie auch wieder übergeben werden soll, zu deren Bewältigung der UNO allerdings die zeitweilig nötigen Gewaltmittel fehlen. Daß deren Besitz ein amerikanisches Monopol bleibt und die Entscheidung über ihren Einsatz ein exklusives Recht der US-Regierung, ist damit ebenso klargestellt wie die Entschlossenheit der USA, die UNO mit ihren Weltordnungseinsätzen nicht zum allgemeinen Gespött werden zu lassen. Wenn tatsächlich sogar somalische Räuberbanden Sicherheitsratsbeschlüsse mißachten und die Blauhelme als Papiertiger vorführen könnten, dann wäre die von den USA gewählte Methode, der Welt bindende Richtlinien zu verpassen, überhaupt hinfällig. In diesem Sinne ist es für die Eingriffsentscheidung der US-Regierung womöglich entscheidend gewesen, daß der UNO-Generalsekretär durch den Raub von offizieller Hungerhilfe und die Hilflosigkeit der als Schutztruppe entsandten Blauhelme die Ehre seines Weltvereins angegriffen gesehen und für diese Sichtweise nachdrücklich geworben hat. Jedenfalls haben die USA durch den UNO-Mißerfolg sich herausgefordert gesehen und dementsprechend zugeschlagen: demonstrativ, um die Allzuständigkeit der USA als Schirmherr aller UNO-Missionen zu unterstreichen; exemplarisch, um ihre Freiheit zu verdeutlichen, nach eigenem Ermessen einzugreifen; und so gründlich, daß die „Lektion“ „sitzt“.
Die Frage ist freilich, wer diese „Lektion“ lernen und beherzigen soll. Im „Fall Somalia“ geht es ja nicht, wie gegenüber am Golf, um die Abschreckung einer souveränen Staatsgewalt von außenpolitischen „Abenteuern“, d.h. unerlaubten Versuchen einer Kräfteverschiebung, sondern um die Restauration einer UNO-tauglichen und UNO-treuen Souveränität überhaupt; und das ist gar nicht „exemplarisch“ und „ein für allemal“ zu erledigen, wie das demonstrative Einmarschieren insinuiert. Womöglich gelingt es ja nicht einmal in Somalia, eine Staatsgewalt zu installieren, die den ihr zugedachten Dienst eines funktionalen Gewaltmonopols dauerhaft zu versehen vermag, nachdem alle Voraussetzungen dafür unter tatkräftiger Mithilfe des jetzt so hilfswilligen Auslands zugrundegerichtet worden sind – der Einfall, von den somalischen „Banden“ schlicht eine demokratische Wahlkonkurrenz in nationalem Konsens zu verlangen, gerade so, als wäre denen dieses wunderbare Verfahren bislang bloß nicht eingefallen, ist jedenfalls ein bodenloser Witz. Mit einer Mischung aus Besorgnis und Häme wird den USA bereits das Dilemma prognostiziert, sie müßten sich entweder auf Dauer in Somalia einrichten oder würden bei ihrem Abzug ein größeres Chaos hinterlassen, als sie vorgefunden haben. Der Streit mit der UNO darüber, ob eine flächendeckende Entwaffnung der somalischen Kampfgrüppchen zum US-Kampfauftrag dazugehört oder nicht, zeigt allerdings, daß die USA sich vor so einem Dilemma gar nicht sehen. Sie teilen sich ihren Einsatz nach ihren eigenen Gesichtspunkten ein und ziehen ihn nach einer anderen Logik durch als unter der Maßgabe, die die UNO gern durchgesetzt hätte: das Gewaltmonopol über einen verwüsteten Landstrich in die eigene Verantwortung zu übernehmen, womöglich mitsamt Verwaltungs- und Versorgungsleistungen. Für die USA ist auch Somalia ein „Fall“ eines Prinzips, das sie durch demonstrativen Einsatz ihrer Gewalt weltweit gültig machen und respektiert sehen wollen.
Und ein paar Adressaten hat diese „Lektion“ auf alle Fälle. Immerhin müssen sich die Verbündeten Amerikas schon wieder auf ihren Beitrag und ihre Bereitschaft befragen lassen, Gewalteinsätze mitzutragen, wann und wo immer die US-Regierung beschließt, daß sie für den Erfolg von UNO-Missionen nötig und nützlich sind und gemacht gehören. Sie werden in die Pflicht genommen; zwar wieder nur an einem einzelnen Fall, der Absicht nach aber grundsätzlich und überhaupt. Zugleich werden sie einmal mehr auf das „Modell“ zur Sicherstellung einer geordneten Welt eingeschworen, auf das die USA nach wie vor setzen: Selbst in Fällen, denen eine moderne Großmacht den Appell entnehmen möchte, ein ganzes Land der eigenen Gewalt zu unterstellen, bleibt es dabei, daß ordnungsstiftende Eingriffe den Weg über einen UNO-Beschluß zu nehmen – und dort die amerikanische Kontrolle zu passieren haben. Denn daß die UNO als verlängerter Arm der USA fungiert und nicht die USA als Büttel der UNO, das lehrt die Abwicklung des Somalia-Einsatzes auch wieder einmal.
Die Verbündeten machen mit; doppeldeutig wie immer. Die Alternative, sich ganz zu entziehen, haben sie nicht, trauen sie sich nicht zu und wollen sie auch nicht. Im Mitmachen melden sie aber schon wieder ihren Dissens an: Sie sehen das Entwaffnungsproblem vor Ort anders, mehr wie die UNO – nicht, weil sie es in der Sache anders bewerten würden; ein neokolonialer Ehrgeiz treibt auch sie nicht. Jede Meinungsverschiedenheit zwischen UNO und USA ist aber per se eine Gelegenheit, die unmöglich ausgelassen werden darf, das Auftragsverhältnis zwischen der Weltmacht und ihrer Weltorganisation umgekehrt zu betonen und darauf zu bestehen, daß amerikanische Maßnahmen genauso den Konsens der Sicherheitsratsmächte zu passieren haben wie die Vorhaben aller anderen zur Weltordnung berufenen Nationen. So ringen sie, nach den von den USA vorgegebenen Regeln, um ihren Status als Kontrollmächte, ohne deren Zustimmung nicht einmal die amerikanische Weltmacht erfolgreich Gewalt anwenden kann.
So kriegt über die UNO selbst das Verhungern in Somalia seine weltpolitische Bedeutung: Es ist schon wieder ein Anlaß für die Konkurrenz der Imperialisten ums Führen und Mitmachen.
4.
Die UNO der 90er Jahre ist ein Organ der Weltherrschaft, die die imperialistischen Nationen kollektiv ausüben: die Fiktion eines pluralistischen Gewaltmonopols, scheinbarer Auftraggeber einer oligopolistischen Weltpolizei. Was die wirklichen Subjekte weltweiter Gewalt mit diesem Organ und im Namen dieser Fiktion anstellen, bezeugt zugleich, daß zwischen ihnen der Kampf ums wirkliche Monopol auf Gewalt über die Welt und um einseitigen nationalen Nutzen daraus in Gang gekommen ist. Bis zur Kündigung des Standpunkts der Gemeinsamkeit ist dieser Kampf um die Neuverteilung der Weltherrschaft noch nicht vorangekommen. Deswegen – und solange – gibt es die neue UNO mitsamt ihrem Schein, sie wäre, mindestens fast, eine Macht.
Gleichberechtigt sind alle Staaten dieser Welt in der UNO vertreten. Um so eindeutiger ist der Unterschied und die Scheidung zwischen den paar Mächten, nämlich den USA und ihren demokratisch-kapitalistischen Verbündeten und Konkurrenten, von denen alle weltpolitischen Ordnungsansprüche ausgehen, und dem großen Rest der Welt, auf den sie sich beziehen. Umgekehrte Ansprüche auf eine Revision dieser Verhältnisse, Wünsche nach einer neuen Weltordnung, von minder bemittelten Mitgliedern der Völkerfamilie gegen die maßgeblichen Nationen vorgebracht, fristen kaum noch ein Schattendasein als weltfremdes Ideal, seit es mit der Sowjetunion vorbei ist und die Großmächte des Westens die UNO ernsthafter in Gebrauch nehmen. Weltordnung heißt Kontrolle über die Staatenwelt, Aufsicht über die Herren anderer Länder, gewaltsame Zurechtweisung, wenn nötig; und das ist Sache der Nationen, die daran ein elementares Interesse haben, die dazu nötigen Mittel besitzen und ihr daraus entspringendes Recht von der UNO anerkannt bekommen. Die andern liefern über die UNO ihre prinzipielle Zustimmung dazu ab; ansonsten sind sie diejenigen, die kontrolliert, bisweilen unter Aufsicht gestellt, manchmal auch überhaupt wieder auf die Beine gestellt werden müssen; der Grad ihrer aktiven Beteiligung am internationalen Aufsichtswesen ergibt sich aus dem Interesse der maßgeblichen Mitglieder an ihnen. Das Ganze kommt dem Ideal einer ordentlichen Weltherrschaft verdächtig nahe, in der jede souveräne Staatsgewalt nicht mehr und nicht weniger als eine Zweigniederlassung der einen weltumspannenden Ordnungsgewalt darstellt – mit der entscheidenden Ausnahme, daß gewisse Souveräne den gesamten Laden leiten, von seinem Funktionieren profitieren, also Subjekte, nicht funktionelle Unterabteilungen der globalen Herrschaftsordnung sind. Was sich in der UNO abspielt, ist, mit einem Wort: Imperialismus.
Daß mehrere Nationen – die USA, die EG-Mächte, Japan – diese Weltordnung als ihre Sache betrachten und sich als ihr Subjekt, dem der Nutzen aus geregelten Verhältnissen gebührt und ihr Schutz obliegt, entlarvt die Einheit der Weltordnung freilich als Schein. „Der“ Imperialismus, der sich in der UNO so kooperativ gibt, ist ein Plural: Soviele verantwortliche Subjekte, soviele Imperialismen gibt es auch – sonst wären die verschiedenen Großmächte gar nicht wirklich souverän, sondern die einen Handlanger eines anderen; und den Status läßt sich keine der betreffenden Nationen gefallen. Bei allem Gerede über die „beschränkte Bedeutung nationaler Souveränität“ heutzutage und das „Ende des Nationalstaatsprinzips“: Wirklich angebracht ist die Aufhebung nationaler Autonomie ausschließlich bei den andern; Sache der wirklich Großen ist es, die Souveränität aller andern wirksam zu beschränken – durch ihre eigene. Zwischen den paar Staaten, für die die Souveränität noch ihre volle Bedeutung behalten hat, wirft das natürlich Streitfragen auf; vor allem, wie sie es untereinander mit Souveränität und Unterordnung halten; außerdem kann auch der Rest der Welt schlecht das Material unterschiedlicher Benutzungs- und Kontrollansprüche sein, ohne daß die Urheber dieser Ansprüche einander ins Gehege kommen. Die Führungsmächte der UNO sind also notwendigerweise imperialistische Konkurrenten.
Deren Kampf um die Weltherrschaft – Imperialismus in der Einzahl – findet auf hohem Niveau statt. Mit der Ausgrenzung eines Stücks der Welt unter eigener nationaler Hoheit, eines Kolonialreichs zu exklusiv eigener Verfügung, ist keine der imperialistisch interessierten Nationen zufrieden; deswegen läßt auch keine so etwas bei den andern zu. Die ganze Welt soll es schon sein, die den nationalen Interessen zu Diensten ist; gerade auch das Stück, das die Konkurrenten regieren. Der Maßstab der dazugehörigen Sicherheitspolitik ist dementsprechend kein geringerer als ein weltweites Gewaltmonopol.
Ihrem Kampf um einen Imperialismus, der diesen Ansprüchen genügt, haben die engagierten Staaten in der Vergangenheit eine eigentümliche Verlaufsform gegeben: Sie haben ihn funktional aufgeteilt in die gemeinschaftlich unter amerikanischer Führung wahrgenommene Beherrschung der Welt durch Krieg, Abschreckung und Diplomatie und auf der anderen Seite einen Freiraum der Konkurrenz um die Ausnutzung, die von den einzelnen Nationen zu verbuchenden Erträge des in gemeinsamer Anstrengung gesicherten Weltzustands. In ihrer ganzen Widersprüchlichkeit ist diese Konstruktion aufgebaut worden und haltbar geblieben unter dem Druck der „sowjetischen Gefahr“: Gegen die im sowjetischen Ostblock ausgemachte Bedrohung jedes kapitalistischen Weltsystems haben sich die westlichen Weltkriegsalliierten mit den Verlierern zu einem Weltkriegsbündnis nach amerikanischen Maßgaben zusammengetan, das die „Politik der Abschreckung“ als gemeinsame Sache organisiert und zugleich jeder beteiligten Nation ein eigenes Recht auf den Kampf um ökonomischen Erfolg gegeben hat.
Diese Aufteilung des Imperialismus nach „Sachbereichen“ versuchen die Verbündeten des freien Westens auch ohne „Osten“ weiterzuführen; gerade so, als ginge es um nichts Komplizierteres als eine vernünftige Arbeitsteilung zwischen Militärs und Bankiers. Die Nato wird nicht aufgelöst, obwohl ihr alter Bündniszweck sich erledigt hat, sondern im Hinblick auf „weiterbestehende Bedrohungslagen“ sowie – sogar „zunehmende“! – „weltweite Unsicherheiten“ in einer Weise „reformiert“, die den Verlust der alten Verbindlichkeit ebenso deutlich macht wie den Willen zu weiterer Kooperation; aber das ist ein anderes Kapitel. Zu ganz neuer Bedeutung gelangt ist die UNO: Sie soll das Unmögliche wirklich machen und eine supranationale „Sicherheitszusammenarbeit“ garantieren: anders als die Nato weltweit, freilich auch anders als die Nato ohne die bisherige militärische Integration; aber jedenfalls so, daß die Kontrolle der politischen Gewalten auf der Welt als gemeinsame Leistung der westlichen Nationen Bestand hat, neben und über ihrem freien Konkurrenzkampf um die dadurch gesicherten Quellen nationaler Macht. Alles, was im Namen und Rahmen der UNO unternommen wird, widerlegt zugleich das Konstrukt einer Teilung imperialistischer „Sachbereiche“: Dieselben Staaten, die Kooperation und Konkurrenz nebeneinander zu organisieren versuchen, setzen laufend und auch mit jeder kollektiven UNO-Aktion dieses Nebeneinander außer Kraft – ohne bislang die Sache bis zur letzten Konsequenz zu führen. Ein Konkurrenzkampf findet statt, vor allem zwischen der etablierten Weltmacht Amerika und der noch unfertigen, gleichwohl heftig aufstrebenden Europäischen Union, der allseits von Verlogenheit, halb zurückgenommenen Schädigungsabsichten, berechnend-feindseligem Mitmachen und Sich-Entziehen, Mitwirkung in Sabotage-Absicht und anderen Nettigkeiten geprägt ist und in dem nichts als das gilt, was es ist – dies das eindeutige Ergebnis der vieldeutigen „Lektionen“, die die Großen dieser Welt einander und dem Rest über die UNO erteilen:
– Die USA führen UNO-Aktionen herbei und durch; zugleich führen sie Klage über ungleich verteilte Lasten. Diese Beschwerde hat Tradition; seit jeher behauptet die Führungsmacht, bei der „Verteidigung des Westens“ am schwersten belastet zu sein; zur inneren Ökonomie der Nato hat das immer dazugehört. Jetzt, an dem von niemand anderem als den USA selbst inszenierten Interventionen mit UNO-Gütesiegel festgemacht, ist die These von der Last des Ordnung-Stiftens, die ganz unverhältnismäßig auf Amerika fiele, unredlicher denn je. Die USA wollen ja auf nichts verzichten, was sie als ihre Last deklarieren, geschweige denn auf das Ziel, für das sie alles mögliche auf sich nehmen: Von der „Last“ des konkurrenzlosen atomaren Arsenals, der konkurrenzlosen Fähigkeit zu weltweitem militärischem Eingreifen, der Federführung bei Aktionen, der maßgeblichen Rolle in der UNO usw. wollen sie überhaupt nichts abgeben, relativieren lassen oder aufteilen – „Last“ steht eben in Wahrheit für Herrschaft. Worum es ihnen geht, wenn sie ihre Belastung als Argument geltend machen, ist nichts, was irgendwie auf eigenes Zurückstecken hinausliefe, sondern gerade umgekehrt: ihre Verbündeten in die Pflicht zu nehmen. Der Anspruch, Lasten – und sonst nichts! – an sie loszuwerden, drückt – fast schon wieder ehrlich – die Absicht aus, sie am Geschäft der Weltkontrolle zu beteiligen, ohne auch nur im geringsten Kompetenzen an sie abzutreten. Auf diese Weise beantwortet Amerika den Willen seiner Alliierten, in Gewaltfragen mehr mitzureden – mit der Gegenforderung, stattdessen Dienste zu erbringen. Im Golfkrieg hat dieser Anspruch unter anderm die Form der schnöden direkten Geldforderung angenommen; aber in solch einer umgekehrten „Scheckbuch-Diplomatie“ geht er bei weitem nicht auf. Mit der Kategorie der gerecht zu teilenden Lasten wird nämlich gar nicht bloß auf einen Budgetposten verwiesen, den der amerikanische Steuerzahler finanzieren müßte und die andern nicht, sondern es wird ein grundsätzliches Verhältnis des militärischen Engagements der US-Macht zu den eigenen nationalen Bilanzen und zu denen der Verbündeten überhaupt hergestellt. Prinzipielle Unzufriedenheit wird angemeldet mit den relativen Erträgen der Weltherrschaft, von der die Verbündeten ihre – ungerechtfertigten – Vorteil haben. Mitten in die Auseinandersetzung um die gemeinsame Sicherstellung der amerikanischen Weltherrschaft kommt so die andere Seite der imperialistischen Konkurrenz herein, die doch eigentlich davon getrennt, nach ihren eigenen „marktwirtschaftlichen Gesetzen“, ablaufen sollte; nämlich der ökonomisch substanzielle nationale Nutzen, der sich aus amerikanischer Sicht so, wie die gemeinsame Kontrolle über die Welt geregelt ist, grundverkehrt verteilt. Mehr nützliche Unterordnung wird verlangt und der Wille angesagt, die hauptseitig durch amerikanische Gewalt gesicherten Geschäftsbedingungen der Weltpolitik zu ändern, so daß die Rechnung wieder stimmt, also zum Schaden der Verbündeten; allerdings – bislang – kein Weg angekündigt, wie das durchzusetzen wäre. Die eingeforderten und kassierten deutschen und japanischen Milliardenbeiträge zum Golfkrieg bringen die Korrektur nämlich auf alle Fälle nicht. Jede gründlichere Korrektur würde aber die Scheidung zwischen der militärischen und der kommerziellen „Seite“ des Imperialismus definitiv als haltlose Fiktion widerrufen – und eine ganz andere Verlaufsform imperialistischer Konkurrenz auf die Tagesordnung setzen.
– Für Amerikas Verbündete ist die Interpretation der nach amerikanischen Vorgaben gemeinschaftlich organisierten Weltsicherheitspolitik als Last genau umgekehrt der geeignete Gesichtspunkt, um mehr Beteiligung an deren Konzeption und Durchführung einzufordern, also das Übergewicht der USA in Kontroll- und Machtfragen anzugreifen. Und das nicht nur ideologisch, mit lauter berechnend angebrachten Sprachregelungen, sondern auch praktisch: Das Bemühen der Europäer um mehr Gleichrangigkeit mit dem übermächtigen Verbündeten, was ordnendes Eingreifen und die Gewaltmittel dazu betrifft, ist zwar ein Angriff auf dessen Status, vollzieht sich aber als Beitrag zu einer gemeinsamen Sache, die freilich immer ein wenig abweichend gesehen wird – also als Gerangel um die Definition der Gemeinsamkeit. Mit ihrer praktisch bewiesenen Bereitschaft, den USA die Last der Verteidigung zu erleichtern, „Verantwortung zu übernehmen“ usw., bauen sich Amerikas Partner zu Militärmächten auf, die beim Mitmachen darauf achten, daß sie sich nicht bevormunden lassen, sondern emanzipieren. Dabei spielen auch hier die nationalen Bilanzen, auf die mit dem Konzept der zu übernehmenden Last angespielt ist, ihre Rolle: In genauer Umkehrung der amerikanischen Beschwerde über zu schlechte Erträge ihrer doch eigentlich konkurrenzlosen Macht melden gewisse Partner mit dem impliziten Verweis auf ihre gute nationale Geschäftslage, ihre dementsprechende „Verantwortung“ und ihre Bereitschaft, „mehr Lasten zu tragen“, den Anspruch an, das militärische Kräfteverhältnis mit dem weltwirtschaftlichen zur Deckung zu bringen – zu Lasten der USA. So stellen auch sie, umgekehrt wie die ökonomisch unzufriedene „Supermacht“, die Trennung zwischen zivilem Welterfolg und militärisch fundierter Kontrollmacht in Frage, also das gesamte absurde Arrangement von Unterordnung und Recht auf Interesse, auf dem die Konstruktion eines kollektiv ausgeübten Imperialismus doch beruht.
Es geht bei diesem Konstrukt in Wahrheit eben gar nicht um die Scheidung zwischen zwei Sphären, funktionellen Abteilungen oder Gesichtspunkten imperialistischer Politik – sosehr die Kooperation der maßgeblichen Nationen auch nach diesem Muster organisiert ist. Tatsächlich wird damit der Staats-„Egoismus“, das imperialistische Interesse der Nationen überhaupt unter die unhaltbare Maßregel gesetzt, sich freiwillig zu bescheiden – die USA bei der Ummünzung militärischer Konkurrenzlosigkeit in ökonomische Konkurrenzvorteile, die anderen bei dem Bemühen, aus ökonomischer Stärke weltordnerische Kompetenz abzuleiten. Für beide Parteien ist das ein Widerspruch, den sie nicht aushalten: Amerika sucht nach Methoden, Kontrollgewalt zum schlagenden Argument in der weltwirtschaftlichen Konkurrenz zu machen, konfrontiert in dieser Absicht den Rest der Welt mit Beweisen militärischer Selbstherrlichkeit und verpflichtet die Partner, nicht zuletzt über die UNO, auf Zustimmung und Einordnung – freilich nur bei der jeweiligen Aktion. Die Europäer ringen mit ihren unterschiedlichen nationalen Mitteln und mit deren Kombination um den Aufstieg zum Status einer Weltmacht, die nach eigenem Ermessen Weltordnungsfragen aufmacht und über ihre Lösung entscheidet.
Der Kampf um eine neue Aufteilung der Welt – um mehr Macht da, um bessere Erträge dort, also von beiden Seiten her um den Erfolg ihres letztlich unteilbaren Imperialismus – ist längst losgegangen. Stück um Stück, Aktion um Aktion widerlegen die Weltmacht wie ihre Konkurrenten den praktizierten Schein, mehrere nationale Ambitionen auf Weltherrschaft wären durch sinnreiche Selbstbeschränkung kompatibel zu machen. Und dabei halten sie unverdrossen an Konditionen fest – die UNO gehört dazu –, die den offenen Machtkampf vertagen und immer wieder das Konstrukt der beschränkten Konkurrenz und die Lüge von der Lastenteilung aufrechterhalten. Sie werden schon wissen, warum sie das tun.
Kleiner Exkurs zu Deutschland, imperialistische Stilfragen betreffend
Zur Rolle des neuen Deutschland im frisch eröffneten Kampf um die nicht mehr geteilte und doch wieder gestückelte Weltherrschaft ist das Meiste schon gesagt: Zusammen mit dem europäischen Weltkriegsgewinner Frankreich und mit der gemeinsamen Europa-Perspektive ist der europäische Weltkriegsverlierer Anführer der Partei, die mit dem Anspruch auf militär-, sicherheits- und überhaupt weltordnungspolitische Emanzipation von Amerika gegen die alte imperialistische „Arbeitsteilung“ ankämpft, ohne sie direkt aufzukündigen. Wie diese aufstrebende Nation dabei zu Werke geht und insbesondere die Weltorganisation für sich zu funktionalisieren sucht – in der alten UNO erst gar nicht, dann doppelt und damit einmal zuviel, jetzt einfach und damit entschieden zu gering vertreten; beim Kriegführen als UNO-Mandatar noch immer nicht richtig dabei, hingegen auf Grund seiner dicken Beiträge zum UNO-Haushalt zutiefst berechtigt, im Sicherheitsrat dauerhaft Platz zu nehmen und an der Lizenz für Feldzüge mitzuwirken, die man dann auch großherzig zu führen bereit ist … –: Das fällt selbst im Club der größten und erfolgreichsten Heuchler der Weltgeschichte aus dem Rahmen des Üblichen.
- Wenn eine Nation das verlogene US-Argument von der Weltherrschaft als einziger Last für sich umzudrehen versteht, dann das Heimatland des Genscherismus: Zum Einsatz ihres Gewaltapparats für die jetzt erforderliche weltweite Abschreckungspolitik läßt sie sich hinkomplimentieren.
- Wenn eine Nation den Schein vom gewaltfreien Gewaltmonopol der UNO bis zum Letzten auszureizen versteht, dann das Vaterland der Sozialdemokratie: Jeden Blauhelm läßt es sich mühsam abhandeln.
- Dabei ist es in Wahrheit mittlerweile längst so:
- Wenn eine Nation auf der Identität von Geld und Gewalt besteht, dann das Deutschland Helmut Kohls: Der Kanzler leitet ohne jedes umständliche Zwischenargument aus ökonomischen Erfolgen, einem vergrößerten Staatsgebiet und 350 Millionen „Verbrauchern“ die moralische Unmöglichkeit militärischer Zurückhaltung ab.
- Wenn eine Nation geil ist auf weltweites Herumkommandieren, dann das Deutschland Klaus Kinkels: Der Außenminister hält den Zwiespalt zwischen seinem weltpolitischen Auftrumpfen, auf dem Balkan und anderswo, und der Abwesenheit deutscher Flugzeugträger und Fallschirmjäger an den Krisenherden der Welt nicht mehr aus.
- Wenn eine Nation mit der UNO als Mittel ihrer nationalen Macht und ihres Aufstiegs zum „Weltpolizisten“ kalkuliert, dann das Deutschland Björn Engholms: Gemeinsam mit dem UNO-Generalsekretär, der eine wehrhafte Weltorganisation ohne dauernde amerikanische Vormundschaft will und dafür seinerseits auf Deutschlands Ehrgeiz setzt, ist die SPD zu jedem Krieg bereit, wenn nur Deutschland ihn mit auf die Tagesordnung gesetzt hat.
Jede imperialistische Nation versteht sich heute darauf, ihre einseitigen Interessen berechnend als die allergemeinsamste Sache der Welt auszugeben: Die USA, wenn sie den Irak bombardieren; Frankreich, wenn es Flugzeugträger in die Adria schickt; Japan, wenn es für hinterindische Kräfteverschiebungen den Schiedsrichter spielt. So auch Deutschland, wenn es sich auf dem Balkan als Ordnungsmacht betätigt, dann allen anderen den Vortritt beim Kämpfen läßt und das als Zugzwang für mehr Militarismus auffaßt.
PS zum Haltbarkeitsdatum
Dieselben Nationen, die sich zu den Konsequenzen ihrer Konkurrenz als Imperialisten hinarbeiten, sorgen sich um ihre weltpolitische Verbundenheit. Sie pflegen die UNO und werten sie auf, gerade so, als sollten die Festigkeit dieser Organisation, ihre formalisierten Entscheidungsabläufe, ihr weltweites Eingreifen, ihr scheinbares Gewaltmonopol – und ihr Generalsekretär, der als Idealist dieses Scheins seinen Verein aus dem Status des Papiertigers herausführen möchte – das Unmögliche schaffen und eine Weltherrschaft mit verschiedenen Subjekten etablieren. Gleichzeitig unterlaufen sie gemeinsame Beschlüsse, drehen sie in ihrem Sinne und gegeneinander hin, arbeiten überall dort, wo sie gemeinsame Sache machen, auch zum Nachteil ihrer Alliierten.
Dieser Widerspruch funktioniert insofern, als keiner eine bessere Alternative hat. Er funktioniert genau so lange, bis beide Seiten ihn in irgendeinem Fall nicht mehr aushalten und alles für besser halten als die Zumutung, auf einen Partner Rücksicht zu nehmen.
[1] Vgl. hierzu den Artikel: Eine Hinterlassenschaft von 40 Jahren Entwicklung und ihre imperialistische Betreuung: Der Verfall der Dritten Welt; in GegenStandpunkt 4-92, S.175.
[2] Vgl. hierzu aus dem GegenStandpunkt-Verlag: Karl Held (Hg.), Das Lebenswerk des Michail Gorbatschow. Von der Reform des ‚realen Sozialismus‘ zur Zerstörung der Sowjetunion, München 1992.
[3] Vgl. hierzu die Artikel: Bürgerkrieg in Jugoslawien. Ein Fall für europäische Weltordner; in GegenStandpunkt 1-92, S.139, sowie: Der Krieg auf dem Balkan. Zweifelhafte Fortschritte auf dem Exerzierfeld des deutsch-europäischen Imperialismus; in GegenStandpunkt 3-92, S.83.
[4] Vgl. hierzu den Artikel: Krieg Am Golf: Imperialismus heute; in MSZ 1/91.