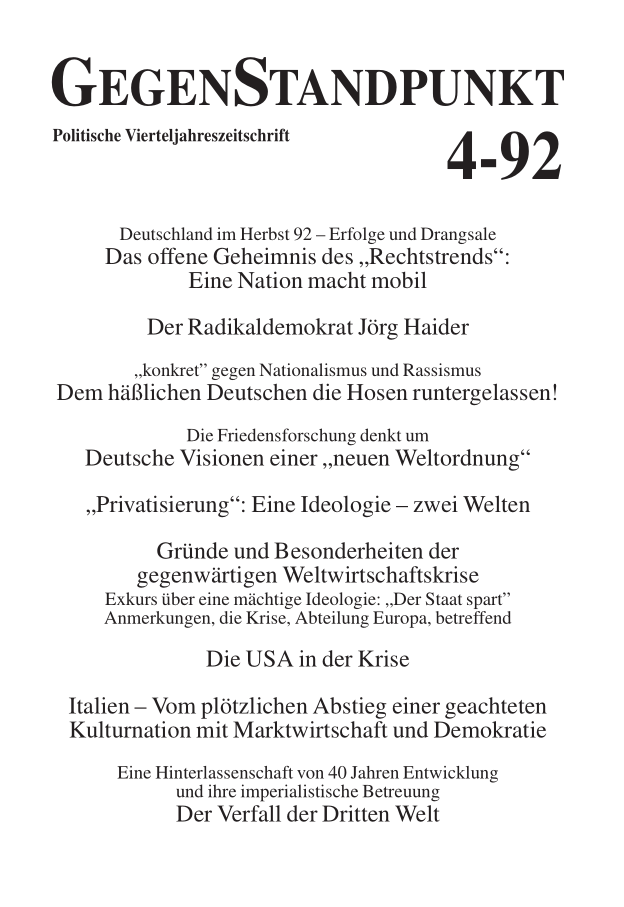Die USA in der Krise
Die spezielle Form der Wahrnehmung der Krise und ihrer Bewältigung in den USA: Der nationalen Selbstkritik an der verkehrten Organisation des Kapitalismus („Jobpolitik“, „Zusammenbruch des Gesundheits- und Bildungssystems“, „Rüstungslasten“, „Trickle-down-economy“, „Defizitpolitik“) liegt die Wirtschaftskrise und die Krise des Dollar zugrunde, so dass der Kredit der Nation entwertet ist. Die Krisenbewältigung des „american renewal“ setzt auf mehr Gewalt für´s Geschäft (Kampf dem „Protektionismus“, „Sicherung von Märkten“, innenpolitische Aufrüstung).
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Die USA in der Krise
I. „Wende“ auf amerikanisch
1. Stimmung für Stimmen
Die erste Präsidentschaftswahl in den USA nach dem Ende des „Kalten Krieges“ verlief anders als erwartet. Statt der geplanten Feier des Endsiegs über den Hauptfeind und des Beginns eines neuen „amerikanischen Zeitalters“ fand eine Inszenierung nationaler Unzufriedenheit statt, wie sie die USA schon lange nicht mehr erlebt haben. Die traf den amtierenden Präsidenten: Nationwide versagte das Wahlvolk dem Schirmherrn über die Abdankung des Ostens die gebührenden Danksagungen und Wählerstimmen und hob stattdessen einen bislang in der nationalen Politik völlig unbekannten Südstaaten-Gouverneur als neuen Hoffnungsträger auf den Schild. Der machte Stimmung und Stimmen damit, daß er unter Bruch aller nationalen Traditionen das Volk nicht mit seiner Entschlossenheit zu Wahrung und Ausbau der amerikanischen Weltordnung köderte, sondern den Blick auf die inneren Zustände im Lande richtete und die Lage der nationalen Wirtschaft zum alles überragenden Wahlkampfthema ernannte.
Damit traf er die Stimmungslage der Nation. Politexperten und Medien wurden seitdem nicht müde, mit tausend schlechten „Indizes“, von Arbeitsplätzen über Exportziffern bis Staatsschulden, dem Wähler in aller Breite auszumalen, wie hoffnungslos das nationale Wirtschaften in Unordnung gekommen ist. Das Volk durfte sich mit der Sichtweise der Dinge anfreunden, wonach die US-amerikanischen Probleme und Herausfordungen seit Neuestem nicht „außen“, sondern „zuhause“ angesiedelt seien; es lernte die Kandidaten danach zu unterscheiden, daß Clinton sich der „häuslichen Sorgen“ annehme, während Bush sich ohne Gefühl für die wirklichen Nöte der Nation im Nahen Osten und in Japan herumtreibe und die Lage „daheim“ vernachlässige. Mit solchen platten bis kindischen Wahlkampfsprüchen wurde dem neuen nationalen Problembewußtsein der Charakter eines unumstößlichen Gemeinplatzes verliehen, hinter den kein national verantwortlich denkender Mensch mehr zurückkann. An der amerikanischen Wirtschaft ist ganz grundsätzliches faul und muß eben so grundsätzlich verändert werden.
Was den Charakter und die Qualität der Malaise und den Inhalt der beschworenen fundamentalen Änderungen betrifft, blieb die gleiche Expertenriege zwar ziemlich vage. Das machte aber weiter nichts. Sie war sich nämlich gleichzeitig gewiß, wie „es“ dazu kommen konnte: Die Nation hat zuviel ausgegeben und sich zuwenig um ihre Einnahmen gekümmert, und daran ist der amtierende Präsident schuld, weil er sich für den ökonomischen Erfolg der Nation nicht interessiert. Deshalb ist die Lage inzwischen so mies, daß es ganz schwierig wird, sie zu verbessern; klassisch zusammengefaßt in dem Spiegel-Titel: „Hypothek für die Wende: Eine marode Wirtschaft verhindert rasche Genesung“. Na klar: Je krank, desto schwieriger gesund! So daß der Schluß nicht ausbleiben konnte: Zur Bekämpfung dieser schwierigen Lage braucht die Nation eine neue, entschlossene Führung.
Damit stand fest: Clinton macht das Rennen. Als Repräsentant des Willens zum „change“ ist er nach der Logik demokratischen Denkens schon deshalb glaubwürdiger als ein Bush, weil er der newcomer ist. Der Amtsinhaber hingegen sieht sich des „alten Denkens“ überführt; egal, wie sehr er sich müht, seinen wirtschaftsfördernden Tatendrang nach „innen“ wie „außen“ ins rechte Licht zu rücken.
So hatte der Wahlkampf seinen guten Sinn. Erstens wurde das amerikanische Volk geistig-moralisch in die neue nationale Problemlage eingestimmt. Die Erörterung von „Entschlossenheit“, „vision“ und „caring“ der Kandidaten sorgte dafür, daß die Sorgen jedes arbeitslosen und zwangsgeräumten amerikanischen Bürgers richtig eingeordnet wurden, nämlich als Ausdruck der Sorgen der Nation, die gelöst werden müssen. Und zweitens war wieder einmal klargestellt, wo das Heil für jede Not zu suchen ist: Bei einem Präsidenten, der sich dieser Sorgen energisch annimmt. Der verdient das Vertrauen und die „Mitarbeit“ der Bürger, gerade wenn und weil er nichts versprechen will und kann als „hard times“. Das macht ihn als Retter der Nation ja gerade so glaubwürdig.
2. „Neue Entschlossenheit“
Die wahlkampfgerechte Sortierung der nationalen Sorgen und Kandidaten nach „außen“ und „innen“ ist ziemlich erfunden. Weder hat Clinton vor, die Allzuständigkeit der USA für die Geschicke der Welt aufzugeben und sich statt aufs Beaufsichtigen und Kriegführen zukünftig auf die Betreuung der amerikanischen Wirtschaft, gar des Lebensstandards der Massen, zu verlegen; noch sprechen Bushs Demarchen in Sachen japanischer Marktöffnung und europäischer Agrarsubventionen gerade für wirtschaftspolitische Tatenlosigkeit. Aber nicht nur das: Die Sortierung amerikanischer Problemlagen nach „zuhause“ und „auswärts“ geht auch ziemlich daran vorbei, wo und wie die amerikanische Nation sich die Quellen ihres Reichtums sichert und weiterhin sichern will. Schließlich verdankt sich der kritische nationale Blick nach „innen“, auf die mangelnde Leistungsfähigkeit der Wirtschaft daheim, keinem anderen Maßstab und Interesse als der Zurückeroberung der amerikanischen Führungsrolle auf dem Weltmarkt; also dem Anspruch, wieder frei nach „außen“ auf den Reichtum anderer Nationen zugreifen zu können. Das brauchten die Kandidaten schon deswegen nicht zu betonen, weil es ohnehin ohne weitere Begründung feststeht:
„Wir können nur dann eine Supermacht sein, wenn wir eine wirtschaftliche Supermacht sind. Wir können nur dann eine wirtschaftliche Supermacht sein, wenn wir eine wachsende Arbeitsplatzbasis haben.“ (Ross Perot in der 1. Fernsehdebatte der Kandidaten)
Die maßgeblichen Führer der Nation haben bemerkt, daß die Rolle, die die USA als Weltführungsmacht spielen und weiterspielen wollen, und ihre ökonomischen Potenzen zur Erledigung dieser Aufgabe nicht mehr so ganz zusammenpassen. Das konstatieren sie als unerträglichen Zustand, dem eine neue Konzentration der Politik auf „die Wirtschaft“ abhelfen soll. Die imperialistische Allzuständigkeit der amerikanischen Politik bedarf eines neuen, schlagkräftigen ökonomischen Unterbaus, um entsprechend frei auf die Mittel für diese Politik zugreifen zu können. Eine schöne Klarstellung: Die Wirtschaft, ihre Potenzen sind für die Freiheit der Politik da; wenn die sich in ihren Projekten behindert sieht, ruft sie in Sachen Wirtschaft den nationalen Notstand aus.
Daß es in der Macht der USA liegt, ihre Stellung als ökonomische Supermacht wiederzugewinnen, steht dabei außer Frage:
„Wir können für die Wirtschaft ebensoviel Mut und Zielstrebigkeit aufbringen wie für Wüstensturm…Wir müssen zu Investitionen ermutigen…es einfacher machen, zu investieren und neue Produkte, neue Industrien und Arbeitsplätze zu schaffen. Wir müssen Wachstumshindernisse aus dem Weg räumen – hohe Steuern, zuviele Vorschriften, Bürokratie, verschwenderische Staatsausgaben; und wachstumsfördernde Ausgaben beschleunigen.“ (Bush in seiner Rede zur Lage der Nation. Januar 1992)
Wenn ein amerikanischer Präsident seinem Volk verspricht, mit Mut und Zielstrebigkeit Wachstums„hindernisse“ weg- und Wachstums„förderung“ herzuschaffen, täuscht er sich selbst mindestens ebenso wie seine Wähler. Diese Täuschung ist überhaupt der nationale Konsens, aus dem der Wahlkampf in den USA seine matte Spannung bezog. Der Streit um „visions“ und „Konzepte“ lebt von der Überzeugung, daß die Nation in ihrer Wirtschaftskraft im Prinzip über die Potenz verfügt, um erneut auch in dieser Sphäre zur Supermacht aufzusteigen. Sie lebt von der fixen Idee, daß die Politik diese Potenz nur ordentlich herrichten und in Anschlag bringen muß, damit alles wieder so klappt, wie es doch schon einmal geklappt hat. Als Fans einer erfolgsgewohnten Staatsgewalt kennen Politiker wie Wähler gemeinsam nur Fehler und Versäumnisse, denen die jeweilige Lage geschuldet ist, und Rezepte, wie sie zu überwinden sei. Daß es für den Erfolg der Nation in Geldfragen andere Schranken geben könnte als mangelnde Entschlossenheit der zuständigen Macher, kann sich ein Ami ebensowenig vorstellen, wie ein Deutscher sich vorstellen kann, daß die Stärke der DM sich nicht dem energischen Auftreten der Bundesbank verdankt. Daß es sich im Verhältnis von ökonomischer Macht und „Entschlossenheit“ vielleicht umgekehrt verhält; daß die ökonomischen Leiden der Nation gar etwas zu tun haben könnten mit einer objektiven ökonomischen Lage, in der die Nation sich befindet, käme ihnen glatt wie Defätismus vor.
An dieser Überzeugung hat sich mit der Wende in den USA nichts geändert. Neu ist die Diagnose, die die Nation über ihre eigene Lage zu bieten hat; und einigermaßen neu – jedenfalls für amerikanische Verhältnisse – sind deshalb auch die Antworten, die der Politik zur Rettung Amerikas einfallen.
II. Nationale Selbstkritik: Kapitalismus, verkehrt organisiert
1. „jobs“
Die Lage auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt ist seit einiger Zeit Gegenstand erschreckender Bilanzen. Das „Time magazine“ konstatiert:
„Entlassungen nehmen mit schonungsloser Geschwindigkeit zu… Die harte Wirklichkeit ist, daß die USA im Sumpf einer längeren Stagnationsperiode steckenbleiben, die sich noch jahrelang fortzuschleppen droht… Firmen haben sich neu organisiert, ganze Industriezweige haben ihre Belegschaften abgebaut, und „Schlank bleiben“ hat sich als fester Bestandteil ins Firmenbewußtsein eingegraben… Zwar werden in der Gesundheitsindustrie sowie bei bundesstaatlichen und lokalen Behörden noch Leute eingestellt, aber die meisten amerikanischen Firmen machen Personalkürzungen zu ihrem Lebensstil…In diesem Jahr haben die großen amerikanischen Firmen täglich ca. 1500 Stellen abgebaut… Ganze Abteilungen des mittleren Management werden gestrichen… 36% der Entlassenen sind ‚white collar workers‘.“ Wo eingestellt wird, gibt das auch keinen Grund zur Hoffnung: „Chrysler investiert 225 Mill. für den neuen Dodge Pickup und schafft damit 70 Arbeitsplätze… Firmensprecher allerorten vermelden: Auch wenn es wieder aufwärts geht, stellen wir nicht wieder ein.“ (Time, 20.7.92)
Das Ganze gibt’s nochmal auf rührend: Reporterteams überfallen ganz normale families, die in die Kamera jammern dürfen, daß der Mann arbeitslos ist, die Frau zuwenig verdient, die nächste Rate fürs Häuschen nicht mehr gezahlt werden kann. Entlassene oder vor der Entlassung stehende Arbeiter berichten von der Schließung oder Abwanderung „ihrer“ Fabrik, und der Reporter setzt noch eins drauf mit der Auskunft, daß Trostgründe dahingehend, irgendwann oder -wo würden diese Leute doch wieder Arbeit finden, völlig daneben liegen.
Das ist nun alles so ungewöhnlich auch wieder nicht. Erstens ist es überall in der kapitalistischen Welt der Auftrag verantwortlich denkender Manager, im Interesse wachsender Gewinne Belegschaften neu durchzusortieren. Und zweitens sind Leute, die ohne „job“, also ohne Geld, im Elend leben, ja nun wirklich kein neues Phänomen in den USA, wo immer schon ganze Abteilungen der Bevölkerung aus der vom Kapital lohnend beschäftigten work force herausfallen.
Jetzt soll man an Arbeitslosigkeit und Armut etwas Neues entdecken: Das Elend des „kleinen Mannes“ steht seit kurzem für einen nationalen Notstand. Das untermauert die Politik in Worten und Taten: Die Wahlkampfkontrahenten wetteifern darin, ihr jeweiliges Wirtschaftsprogramm als Mittel zur Versorgung des amerikanischen Volkes mit „jobs“ anzupreisen bzw. dem des Gegners diese Leistung abzusprechen. Der Präsident gibt Haushaltsmittel für Infrastrukturmaßnahmen vorzeitig frei, verschiebt den Termin für Steuerzahlungen, um einen „Konsumstoß“ zu provozieren, verlängert die Bezugszeiten für Arbeitslosenunterstützung und gestaltet seine Wahlkampfreisen als trips zu amerikanischen Rüstungsunternehmen, denen er die Aufrechterhaltung von zum Streichen vorgesehenen Projekten oder das Auflegen neuer zusagt. Der demokratische Präsidentschaftskandidat setzt noch eins drauf und verspricht, seine erste Tat als Präsident werde sein, ein „Arbeitsbeschaffungsprogramm“ zu initiieren.
Die Sorge der Nation um die schlechte Geschäftslage ihres Kapitals als Sorge um die Opfer von deren Geschäftspolitik darzustellen, ist natürlich Heuchelei. Was nicht geheuchelt ist: Die amerikanische Politik erklärt sich hier tatsächlich neu zuständig für eine Wirkung des kapitalistischen Geschäfts, die sie bislang mit Überzeugung den Fährnissen der Konkurrenz, also der individuellen Lebensbewältigung überlassen hat. In den USA ist es staatlicher Usus, dem Kapital bei der Sortierung des Proletariats in die verschiedenen Abteilungen der industriellen Reservearmee freie Hand zu lassen; staatliche Maßnahmen zur Milderung der Not der Betroffenen oder gar zur „Arbeitsplatzbeschaffung“, so vorhanden, gelten als unzulässige, deshalb höchstens vorübergehend zu ergreifende „Einmischung“ in die nützlichen Wirkungen der freien Konkurrenz. Das nationale Credo heißt: „Jobs“ gibt es als Abfallprodukt einer rundum erfolgreichen Industrie. Überhaupt einen „job“ zu haben, ist deshalb auch schon der erste Lohnbestandteil des „hardworking american“. Der genießt damit nicht nur das zweifelhafte Glück, sich durch Arbeit in fremden Diensten über Wasser halten zu können: Mit diesem seinem höchstpersönlichen „pursuit of happiness“ erwächst ihm zugleich der moralische Bonus, anständig, ein braver Bürger, ein Patriot zu sein. Wer keinen „job“ hat, hat dagegen nicht nur wenig bis nichts zum Leben. Der ist damit auch gleich „on the wrong side of the tracks“, ein dropout, als solcher bestenfalls Opfer unglücklicher persönlicher Umstände, im Prinzip aber kriminell. Der beste Beweis für diese Theorie sind selbstverständlich die, die es „trotz einfacher Verhältnisse“ dennoch schaffen, gute Amerikaner, also reich und erfolgreich zu werden: siehe Bill Clinton. Dieser rassistischen Theorie der kapitalistischen Konkurrenz gilt jede staatliche Betreuung der Armut als Störung der heilsamen Wirkungen, die Geldnot auf die „Leistungsbereitschaft“ der unteren Klassen ausübt; auch und gerade da, wo sich zum Leisten gar nichts findet. Wo die Abfallprodukte des kapitalistischen Geschäftslebens zu sehr stören, ist die Staatsgewalt mit Suppenküchen und Polizei zur Hand; wobei gar kein Hehl daraus gemacht wird, daß ein bißchen Essen nur als höchst unzulängliche Ergänzung, keinesfalls aber als Ersatz für die Gewalt taugt.
Kein Zweifel: Dieses System hat lange Jahre wunderbar geklappt, die USA sind damit reich und mächtig geworden. Insofern es darauf ankommt, waren Armut und Elend kein Thema, schon gar nicht Grund, an der prinzipiellen Güte des amerikanischen Kapitalismus zu zweifeln. Es gab sie eben, basta. Jetzt erklärt die gesamte amerikanische Politmafia samt Öffentlichkeit „jobs“, bzw. ihr Fehlen, zu einem nationalen Problem, dessen sich die Politik anzunehmen habe. Eine gewisse Ironie der Geschichte liegt schon darin: Sollte man sich nicht vor kurzem dieses feine System als Modell für den maroden Osten denken? An dem Standpunkt hat sich natürlich gar nichts geändert. An den jetzigen Entlassungswellen ist der Politik vielmehr aufgefallen, daß die zunehmende Arbeitslosenzahl gar nicht Ausdruck einer erfolgreichen Kalkulation des Geschäfts mit dem Verhältnis von Lohn und Leistung ist. Die ständig steigenden Entlassungen indizieren keine Gesundung einer Wirtschaft, die mit gestraffter, verbilligter Mannschaft neue Produktions- und Gewinnchancen auftut, sondern „stagnation“, bestenfalls gleichbleibendes, in aller Regel aber schrumpfendes Geschäft. Auch wenn die Freisetzung von Leuten, die bislang nützliche Dienste am Reichtum amerikanischer Unternehmen geleistet haben, die Gewinne des einen oder anderen Kapitals befördert, stellt sich darüber kein nationales Wachstum ein:
Durch Streichen von Kosten „werden zahlreiche Konzerne in diesem Jahr Geld verdienen, ganz gleich, wie sich die Konjunktur weiterentwickelt… hohe Gewinne 1992 werden ebensowenig Auskunft über die Verfassung der US-Wirtschaft insgesamt geben wie die schlechten Zahlen des letzten Jahres.“ (Handelsblatt, 26.2.92)
Folglich kann die Nation auch keinen Nutzen erkennen, den die immer weiter steigende Arbeitslosigkeit ihr bringt. Sie stellt im Gegenteil fest, daß sie Schäden verursacht: Der Konsum der Massen, als fester Bestandteil der Wachstumsraten von Auto-, Bau- und Textilindustrie eingeplant, versagt seinen Dienst am Gewinn dieser Branchen. Die Steuereinnahmen sinken; und beim Staat, der die Armut eigentlich nie betreuen wollte, fallen jetzt steigende Ausgaben dafür an. Die Nation bilanziert seit langer Zeit – genauer gesagt, seit 60 Jahren wieder zum ersten Mal –, die Armut des Volkes nur noch als Kost, die die nationale Reichtumsvermehrung behindert, statt ihr als lohnende Kost zu dienen. Darüber wird der US-Staat zum Kritiker am nationalen Umgang mit der Armut: Er bezichtigt sich selbst, sich zu wenig um die Dienste gekümmert zu haben, die sie der Nation erbringen soll. Das soll in Zukunft anders werden. Der neue „Bund mit dem amerikanischen Volk“ verspricht den „hardworking americans“ „opportunities“, also neue „Gelegenheiten“ zum Dienst am Kapitalwachstum, und dem unbrauchbaren Rest des Volkes, daß der Staat es ihnen nicht mehr erlauben werde, sich im Elend einzurichten, sondern für jede noch so kleine Leistung einen (Arbeits-)Dienst verlangen werde: Nach den Worten des neuen Präsidenten soll „welfare“ zukünftig „Hilfe zur Selbsthilfe“ sein und nicht mehr ein „way of life“.
2. „Zusammenbruch des Gesundheits- und Bildungssystems“
2.1. Wer kümmert sich um die Volksgesundheit?
Aus Volksarmut, aus der sich zuwenig nationaler Reichtum schlagen läßt, wird Kost für die Nation. Das bemerkt die US-Politik derzeit vor allem an ihrem Gesundheitswesen:
„Es gibt zwei verschiedene Probleme des Gesundheitssystems, die miteinander im Widerstreit liegen. Die Kosten explodieren, während gleichzeitig 36 Mill. Amerikaner keine Krankenversicherung haben. Die Ausgaben der USA für Gesundheitsvorsorge machen inzwischen 820 Mrd. $ pro Jahr aus – fast 14% des Bruttosozialprodukts… Das ist nicht bloß Monopoly-Geld. Alle Dollars für Gesundheit kommen aus den Einkommen der Haushalte, entweder direkt oder über Steuern, Versicherungsbeiträge, über höhere Preise für Produkte oder niedrigere Löhne für Arbeiter. Trotz dieser ganzen Ausgaben müssen US-Bürger ohne Versicherung oft auf Behandlung verzichten oder sich in Notambulanzen drängeln, wo ihre Versorgung höhere Kosten für alle Beteiligten zur Folge hat. Für Möchtegern-Reformer ist der Trick, die Kosten unter Kontrolle zu bringen und die Versicherungsdeckung zu erhöhen, bei Beibehaltung qualifizierter Behandlung.“ (Newsweek, 19.10.92)
Eine interessante Beschwerde in einem Land, das sich bislang immer soviel auf sein Prinzip der „privaten Verantwortlichkeit“, der „Freiheit“ in Sachen Sozialversicherung zugutegehalten hat! Schließlich hat die US-Sozialpolitik ihre Leistungen bislang mit Absicht immer als „last resort“ einer Gesellschaft definiert, die im Prinzip selbst dafür zuständig ist, sich um die Kosten kapitalistischen Benutztwerdens zu kümmern. Entweder man hat Glück, d.h. einen Arbeitsplatz in einem Betrieb mit einer Belegschaftsversicherung oder genug Geld übrig, um sich selbst zu versichern; oder man fällt aus dem nicht vorhandenen sozialen Netz heraus und Programmen wie „Medicare“ und „Medicaid“ zum Opfer. Dazu muß man allerdings krank genug sein, um als Notfall einer Krankenhausbehandlung für würdig erachtet zu werden. Alles darunter her geht die staatlich organisierte Medizin nichts an, und auch in dem Fall kann es passieren, daß man sich für den Rest seines Lebens verschulden muß, um versorgt zu werden.
Jetzt entdeckt die Politik, daß immer weniger ganz normale Leute überhaupt in der Lage sind, sich „verantwortlich“ um ihre weitere Brauchbarkeit zu kümmern. Mehr als die Hälfte aller Streitigkeiten zwischen Gewerkschaften und Unternehmen entzünden sich inzwischen daran, daß die Betriebe Sozialleistungen streichen; wer entlassen wird, verliert seinen Versicherungsschutz sowieso. Für ein vernichtendes Urteil über eine Produktionsweise, die sich soviel auf ihren „medizinischen Fortschritt“ zugutehält, hält das niemand; daß „explodierende Gesundheitskosten“ etwas damit zu tun haben könnten, daß auch robuste Ami-Naturen 100 Jahre Kapitalismus nicht ganz unbeschadet überstehen, ist in den USA ebensowenig Thema wie hierzulande. Was stört, ist die Schranke, die die kapitalistische Armut in den USA derzeit den Staatsfinanzen aufmacht. Programme, die als letzter Notnagel fürs Elend organisiert waren, müssen jetzt für Leistungen herhalten, für die sie nie gedacht waren: zur Versorgung von normalen Bürgern.
Darüber ist im politischen establishment der USA der Verdacht aufgekommen, hier würde nicht nur zuviel, sondern unzweckmäßig Geld ausgegeben. Plötzlich fällt auf, daß diese Kosten „explodieren“, ohne einen Beitrag zum Erhalt der Volksgesundheit zu leisten. Das sollten sie bislang auch nie; also ist es ziemlich sachfremd, sie an diesem Maßstab zu messen. Jetzt wird dieser Maßstab offiziell eingeführt; und US-Politiker denken darüber nach, ob es den Staat, wenn er schon Geld für „Gesundheit“ ausgibt, nicht sogar letztlich billiger komme, wenn er diesen bislang verpönten Gesichtspunkt zur Anwendung bringt:
„Firmen streichen Gesundheitsausgaben… Und was passiert mit all diesen Leuten? Sie bekommen trotzdem medizinische Versorgung, aber erst, wenn sie richtig krank sind. Das kostet ein Vermögen, und diese Kosten tragen alle anderen… Zur Zeit geben wir 13,3% unseres Einkommens für Gesundheitsvorsorge aus. Kanada liegt bei 9,1%, Deutschland bei 8,7%.“ (Clinton in USA Today, 14.8.92)
Das Urteil: „Gesundheitssystem funktioniert nicht richtig!“ kritisiert die bisher geltende, strenge Trennung zwischen denen, die am Gesundheitssystem teilhatten, und denen, die „draußen“ waren, als dysfunktional für das nationale Interesse an Volksgesundheit. Das ganze Volk soll zukünftig als „Solidargemeinschaft“ mit den Kosten der Gesundheitsvorsorge belastet werden und nach Maßgabe der Belastbarkeit dieser Solidargemeinschaft von ihr profitieren. Das, so heißt die neue Linie, kommt die Nation insgesamt billiger, als wenn die Erledigung dieser Frage den Sonderkalkulationen von Betrieben und Privaten überlassen bleibe.
2.2. Bildungsmisere gefährdet Konkurrenzfähigkeit
Auch das amerikanische Bildungssystem ist ins Gerede gekommen. Klagepunkte gibt es viele: zuviele Analphabeten; schlechte Leistungsstandards amerikanischer Schüler im internationalen Vergleich; auch hier steigende private wie staatliche Kosten ohne den versprochenen Ertrag:
„Ein Regierungsbericht vom letzten Herbst … stellte fest, daß heutige Studenten das Leistungsniveau, das vor 20 Jahren als normal galt, kaum erreichen… Trotz Bushs Versprechen des Jahres 1988, der „Ausbildungspräsident“ werden zu wollen, und trotz des von ihm 1989 einberufenen „Ausbildungsgipfels“ aller Gouverneure (der Einzelstaaten) erbringt der Ausbildungssektor weiterhin mangelhafte Ergebnisse. In den 6 nationalen Erziehungszielen (unter anderem: ‚Sicherzustellen, daß alle Erwachsenen lesen und schreiben können und in der Lage sind, ihren Pflichten als Bürger und Arbeiter nachzukommen‘), die dieser Gipfel setzte, ist zwei Jahre später wenig Fortschritt festzustellen… Obwohl die Bundesausgaben für Ausbildung unter Bush um 22% zugenommen haben, wird behauptet, daß sein Ansatz im wesentlichen nur weißen Mittelklassekindern etwas gebracht habe.“ (Guardian Weekly, 30.8.92)
Und warum ist das jetzt plötzlich schlimm? Schließlich galt ja auch in dieser Abteilung der US-Politik bislang, daß Erfolg recht gibt. Also gibt es halbwegs brauchbare Schulen in den Gemeinden, wo Eltern dafür zu blechen bereit und in der Lage sind; vom Geldbeutel der Eltern, eigenem Dazuverdienen und seltenen Stipendien hängt ab, ob man es sich leisten kann, die „high school“ bis zum Ende zu durchlaufen, und auf welches „gute“ oder weniger gute college man danach gehen kann, usf. Jetzt finden Kritiker des US-Schul- und Universitätssystems Gehör, die bereits vor 25 Jahren zu den gleichen Befunden kamen wie heute: Bei den Schwarzen und Minderheiten in den Ghettos findet schulische Ausbildung praktisch nicht statt, das schulische Niveau sinkt ständig, die Universitätsausbildung kommt die Eltern immer teurer… Inzwischen hat die Nation nämlich den Zustand ihres Ausbildungssystems als Misere entdeckt, die nicht bloß den Geldbeutel und die Lebenschancen ihrer Bürger trifft:
„Kurz, der Bericht kam zu dem Ergebnis, daß die USA ein zunehmend unqualifiziertes Arbeitskräftepotential produzieren, das unweigerlich die ökonomische Konkurrenzfähigkeit unterminieren müsse.“ (ebd.)
Solange US-Unternehmen gute Gewinne machten, hat sich außer ein paar Bildungsidealisten niemand über miserable Mathematikkenntnisse US-amerikanischer Schüler aufgeregt; also werden deren Kenntnisse für die Ertragslage des Kapitals wohl auch keine entscheidende Rolle gespielt haben. Wenn Firmen entscheiden, daß ihrer Belegschaft wegen neuer Maschinerie, Datenverarbeitung etc. pp. ein paar neue „Bildungselemente“ beizubiegen sind, dann erledigen sie das auch in den USA noch allemal selbst und verlassen sich nicht auf die Ergebnisse des Schulwesens; und die „Qualifikation“ von Leuten, die ohnehin nie für „Beschäftigung“ vorgesehen waren, brauchte ja auch wirklich niemanden zu interessieren. Jetzt, wo den USA auf dem Weltmarkt Konkurrenten erwachsen sind, soll man die Sache umgekehrt sehen: Koreanische Kinder können besser rechnen, kein Wunder, daß sie „uns“ die Märkte abnehmen! Die US-Politik wirft sich vor, den Gesichtspunkt der Sicherstellung nationaler Konkurrenzfähigkeit vernachlässigt zu haben, und wird prompt fündig: In Umkehrung von Ursache und Wirkung soll jetzt der Umstand, daß das Kapital jede Menge Arbeiter für lohnendes Geschäft nicht (mehr) brauchen kann, seinen Grund in deren mangelnder Qualifikation haben. Deshalb gerät jetzt ein Ausbildungswesen, daß lange Jahre als Gipfel von individueller Freiheit, Selbstbestimmung und Menschenwürde galt, in den Verdacht, zuwenig für die Nation zu leisten. Wo früher gerade die Konkurrenz der Ausbildungsstätten um Finanzen und die Konkurrenz von Schülern um Zugang zu ihnen – von hiesigen Bildungspolitikern als „Marktmodell“ gefeiert – die besondere Qualität der Ergebnisse garantieren sollte, stellt die US-Politik jetzt fest, daß das Jungvolk, das die nationalen Erziehungsanstalten ausspucken, in jeder Hinsicht zu wünschen übrig läßt. Sie können nichts, wollen nicht lernen, sind unmotiviert, nehmen Drogen und schießen bei jeder Gelegenheit um sich…
Im Unterschied zu früheren Kampagnen dieser Art dienen solche Schreckensgemälde nicht nur der moralischen Aufrüstung des nationalen Nachwuchses. Die Politik bezichtigt sich eines Versäumnisses, wenn sie auf die Jugend zeigt und deren geistige Verfassung beklagt: Sie hat nicht ausreichend dafür Sorge getragen, daß die „Leistungsreserven“ der amerikanischen Jugend in optimaler Weise für Staat und Kapital erschlossen werden. Mit Schlagworten wie „life long learning“, der Ankündigung eines „nationalen Berufsbildungsprogramms“ und eines „Ausbildungsförderungsgesetzes“ macht sich die Demokratische Partei zum Fürsprecher einer Korrektur der nationalen Sichtweise, daß die Konkurrenz der Privatinteressen immer noch am sichersten dafür sorge, daß die Nation die Staats- und Arbeitsbürger bekommt, die sie braucht.
3. „Rüstungslasten“
Die Kosten, die die Zunahme dysfunktionaler Armut der Nation bereiten, machen die eine Hälfte der Beschwerde der Nation über ihre Lage aus. Die andere Hälfte verdankt sich der Unzufriedenheit mit Kosten, die die Nation ganz freiwillig und absichtsvoll auf sich genommen, die sie deshalb bislang auch nie als solche bilanziert hat: die Rüstungsausgaben. Die waren bis zum Abdanken der Russen nicht nur selbstverständlich nötig; sie dienten stets auch dem Beweis amerikanischer Überlegenheit und Größe. Mit „star wars“ hat Reagan noch den Wahlkampf gewonnen, und die Frage nach den Kosten wurde offensiv zurückgewiesen. Es lag in der Macht und Freiheit der Nation, einen gewaltigen Teil ihres nationalen Reichtums in ein Projekt zu stecken, das sie für immer unbesiegbar machen sollte.
Auch in dieser Hinsicht hat sich seit dem Abdanken der Russen einiges geändert. Die Demokraten haben die Forderung nach massiven Kürzungen des Rüstungsetats aufgebracht und mußten sich von Bush den Vorwurf anhören, die „nationale Verteidigungsfähigkeit“ zu unterminieren:
„Die Demokraten wollen mit einem Abbau der Verteidigungsausgaben beginnen, der fast 60 Mrd.$ über die vom Präsidenten vorgeschlagenen Kürzungen hinausgeht… Sie benutzen den Verteidigungshaushalt als bodenloses Sparschwein, um Schwerter in politische Geschenke umzufunktionieren. Das ist eine Dummheit.“ (Bush vor der convention der Republikaner, Amerika-Dienst (AD) 26.8. 92)
Seitdem ist der Streit auf der nationalen Tagesordnung, wieviel die Nation an Rüstung braucht; der Gesichtspunkt ist in die nationale Debatte eingeführt, daß auch Rüstungsausgaben Kosten sind, die die Nation sich leisten können muß. Fest steht, daß alles Notwendige, also auch viel Neues, getan werden muß, um den USA ihre militärische Unanfechtbarkeit zu sichern. Zugleich wird die Frage der „Finanzierbarkeit“ aufgeworfen und Vorschläge zur „Umschichtung“ von Mitteln von alten Programmen auf neue Projekte gemacht. Diese Debatte hat in dem Umstand, daß der Hauptfeind entfallen ist und speziell zu seiner Vernichtung eingerichtete Teile des Militärs überflüssig geworden sind, ihren Ausgangspunkt, aber nicht ihren Grund. Der liegt darin, daß den USA die bislang so selbstverständliche Freiheit, über neue rüstungspolitische Notwendigkeiten zu beschließen, ein wenig abhanden gekommen ist.
Es zeigt sich nämlich – das ist der wahre Hintergrund von Bush’s Wahlkampfreisen zu Rüstungsfirmen –, daß das Streichen von Rüstungsprogrammen zwar Haushaltslasten erspart, aber gerade deswegen nicht unbedingt im ökonomischen Interesse der Nation ist. Das bemerkt die Politik derzeit vor allem daran, daß ein nicht geringer Teil der Entlassungen, die derzeit in den USA stattfinden, sich unmittelbar oder mittelbar der Kürzung von Rüstungsprojekten verdanken. Nachträglich erweist sich der militärisch-industrielle Komplex der USA als das staatliche Konjunkturförderungsprogramm, das diese Nation als solches nie getätigt haben wollte – von wegen „Einmischung des Staates in die Wirtschaft“. Die amerikanische Nation hat über Jahrzehnte einen Großteil ihres Reichtums für Panzer, Flugzeuge, Soldatengehälter, kleinere und größere Kriege verpulvert; also bestritten ganze Abteilungen der nationalen Wirtschaft ihre Gewinne und ihr Kapitalwachstum aus nichts anderem als dem ständigen Anwachsen des Rüstungsetats.
Daß die USA weder eine sozialstaatliche Betreuung des Volkes noch eine kalkulierte Förderung „allgemeiner Produktionsbedingungen“ wie Infrastruktur, Energiepolitik etc. meinten nötig zu haben, heißt eben nicht, daß sie für das Wachstum ihrer Wirtschaft nichts getan hätten. Im Gegenteil: Der größte Staatshaushalt der Welt diente umstandslos dem Ausbau und der Sicherung der überlegenen militärischen Gewalt – auch da, wo der Haushaltstitel „Entwicklungshilfe“ hieß – und war damit automatisch ein riesiges „Konjunkturprogramm“. Um die Wirkungen, die diese staatlichen Aufgaben auf das Geschäft des Kapitals, auf Arbeitsplätze etc. hatten, kümmerte sich die US-Politik nicht weiter. Das nationale Geschäftsleben wurde rein nach den staatlichen Erfordernissen mit einem schier endlosen Zustrom von Geld versorgt. So förderte der US-Staat die „technologische Entwicklung“ bei den Konzernen, die seine modernen Waffen schmieden durften; so sorgte er für einen beträchtlichen Teil dessen, was es in den USA an „Infrastruktur“, „Arbeitsplätzen“, „Sozialausgaben“ gibt. Je nachdem, wie Firmen und Regionen vom Rüstungsgeschäft oder von der durch sie produzierten Kaufkraft profitierten, wie Bundes- und oder lokale Behörden die Erträge des Rüstungsgeschäfts als Steuereinnahmen bilanzieren durften, kamen solche Leistungen zustande oder auch nicht – siehe „Silicon Valley“.
Rein der Masse nach stellten die USA mit diesem Wirtschaftsförderungsprogramm, das keines sein sollte, noch jede Konjunktur- und Wirtschaftsförderungspolitik anderer imperialistischer Staaten in den Schatten. Daß sie es nötig haben könnten, dabei auf die Kosten zu achten, die die ständig ausgeweiteten Militärausgaben ihrem Haushalt aufbürdeten, kam den USA lange Zeit gar nicht in den Sinn. Wo europäische Staaten den Rüstungsexport als Mittel zur Kostensenkung ihrer Militäretats einplanten und bei ihrem Ausbau zur Atommacht zugleich auf die internationale Vermarktung von Atomtechnologie sannen; wo sie „Technologieförderung“ ausdrücklich zum staatlichen Betreuungsgegenstand erklärten, verschwendeten die USA keinen Gedanken auf solche „Nebeneffekte“, weil und sofern sie automatisch abfielen. Gelungener Rüstungsexport machte es überflüssig, Rüstungsexport zum nationalen Programmpunkt zu erheben: Er fand statt in der Übernahme von „Rüstungslasten“ durch die Nato-Verbündeten sowie im Import „nationaler Sicherheit“ durch die vielen zweitrangigen Verbündeten, die sich die USA rundum auf der Welt schufen. Die High-Tech, die für modernste Raketen nötig war, trug Früchte in den Geschäftskalkulationen amerikanischer Multis, die aus jeder neuen Technologie neue Dollars machten, weil sie ohnehin die einzigen waren, die über beides verfügten. Und wer irgendwo auf der Welt High-Tech, Flugzeuge etc. kaufen wollte, wußte, wohin er sich zu wenden hatte.
Dieses goldene Zeitalter amerikanischer Konkurrenzlosigkeit im Geschäft mit technischen Mitteln zur Kostensenkung und Produktivitätssteigerung ist schon seit längerer Zeit vorbei. Jetzt, wo Kürzungen und Umstrukturierungen im Militärhaushalt anstehen, entdecken die USA an ihrer Rüstungsindustrie Qualitäten, die sie gar nicht so einfach für die Nation verzichtbar macht:
„Jahrzehntelang präsentierten sich die USA als Arsenal der Demokratie. Ihr gewaltiges Netzwerk privater militärischer Zulieferer erschien für die nationale Sicherheit nicht weniger wichtig als das Pentagon. Aber mit dem Ende des Kalten Krieges und dem Rückgang der Militärausgaben nimmt das Waffenarsenal ab, und viele seiner Lieferanten sind unsicher ob ihrer Zukunft. Jetzt will Thomson-SF aus Frankreich, eine der führenden europäischen Elektronik- und Rüstungsfirmen, eine der führenden US-Luftfahrt- und Rüstungsfirmen kaufen. Das Angebot hat eine heftige Debatte in den USA ausgelöst – nicht nur über die Nationale Sicherheit, sondern auch über ökonomische Prioritäten.“ (Newsweek 1.6.92)
Die Rüstungsindustrie bemerkt, daß sie ihr Heil, d.h. das Kapital für neue Investitionen und neues Geschäft, woanders suchen muß als im Militäretat – und der Politik fällt auf, daß das private Geschäftemachen doch im nationalen Auftrag erfolgte. Also geht eine Debatte los um die Frage, inwieweit dieser Auftrag noch gilt, wie er neu zu definieren wäre, ob solche Rüstungsunternehmen sich einfach so aufführen dürfen, als seien sie ein ganz normaler Geschäftszweig, der sich seine Märkte und Kapitalgeber da sucht, wo es ihm paßt. Der Politik fällt ein, daß solche Unternehmen nicht bloß Waffen produziert haben, sondern darüber zur „technological base“ der Nation geworden seien; daß sie über „High-Tech“, Patente, „Know-How“ verfügen, die die Nation nicht in die Hände der imperialistischen Konkurrenz geraten lassen sollte. Diesem Gesichtspunkt steht allerdings der andere ebenso gewichtig entgegen, daß hier einer fast bankrotten Firma dringend benötigtes Kapital zugeführt wird, das aus ihr überhaupt erst wieder ein Stück amerikanischen Wachstums werden läßt.
Welchen Gesichtspunkt die Politik in diesem Falle auch immer gelten läßt, eines ist damit klar: Die lange selbstverständlich geltende Interessenidentität von Staat und Kapital ist dahin. Es ist eben nicht mehr so, daß die Politik ihre Projekte erledigt, das Kapital automatisch daran verdient, und beide Seiten mit dem Erfolg zufrieden sind. Deshalb kommen grundsätzliche Zweifel an den Methoden staatlicher Wirtschaftspolitik auf den Tisch, und der Politjargon sieht sich um neue Beschwerdetitel bereichert:
4. „Special interests“ und „trickle-down-economy“
Die Geschäftswelt, die bislang herrlich vom Rüstungsgeschäft gelebt hat, beklagt sich darüber, daß es in den USA keine „Technologieförderung“, keine „Industriepolitik“ gebe. Die Managerriege von „Silicon Valley“, bislang überzeugte Reaganfans, gibt zu Protokoll, daß sie dieses Mal Clinton zu wählen gedenke, weil der wenigstens „Konzepte“ in dieser Richtung anzubieten habe. Die klingen so:
„Den Kräften der Habgier und den Verteidigern des status quo habe ich eine Nachricht zu überbringen – ihre Zeit ist gekommen und zuendegegangen… Unsere Regierung wurde das Opfer privilegierter Einzelinteressen. Sie hat vergessen, wer hier wirklich die Rechnungen bezahlt… Unser Präsident ist in einer überkommenen Wirtschaftstheorie gefangen… Unter Präsident Bush hat Amerika eine unerfreuliche Wirtschaft irgendwo zwischen Deutschland und Sri Lanka… Ich weiß, daß die alten Methoden nicht mehr funktionieren. Eine Wirtschaft, in der alles versickert, hat ganz sicherlich versagt.“ (Clinton auf der convention der Demokraten, AD 22.7.92)
Dem „Mann des Volkes“ blieb es vorbehalten, diese Klage auf ihren prinzipiellen Kern zusammenschnurren zu lassen:
„Wir müssen vom Kapitalismus des 19. zum Kapitalismus des 21. Jahrhunderts übergehen. In den Vereinigten Staaten besteht ein Gegensatz zwischen Staat und Wirtschaft, während es bei den internationalen Konkurrenten ein intelligentes Verhältnis, ein unterstützendes Verhältnis gibt.“ (Ross Perot in der 1. Kandidatendebatte, AD 14.10.92)
Das gibt zusammengenommen den widersprüchlichen Befund, daß der Staat sich dadurch in Gegensatz zur Wirtschaft gebracht haben soll, daß er ihren Agenten erlaubt hat, seine Mittel für private Sondervorteile in Beschlag zu nehmen. So habe sich eine „trickle down economy“ breitgemacht, wo staatliche Mittel eher zufällig in die Ökonomie „herunterrinnen“ und dort irgendwo „versickern“, statt koordiniert und systematisch unter dem Gesichtspunkt der Wachstumförderung verausgabt zu werden.
Eine besonders treffende Beschreibung der koordinierten und systematischen Zusammenarbeit, die Staat und Kapital in den USA 40 Jahre lang zwecks Aufrüstung und auch sonst gepflegt haben, ist das zwar nicht gerade. Aber für einen Fan erfolgreicher Wirtschaftspolitik macht die Rede von dem feindseligen Verhältnis, das der Staat zur Wirtschaft einnehme, indem er ihren „lobbies“ alles hinten reinschiebt, dann Sinn, wenn das Resultat nicht mehr gefällt, das diese Form der Zusammenarbeit zeitigt. Dann denkt er sich die schlechte Lage, in der sich die nationale Wirtschaft befindet, so zurecht, daß sich zwar allerlei private Interessen an ihr bereichern, sie aber dadurch nicht reicher wird. Also nützt der Staat der Wirtschaft mit seinen Zuwendungen an ihre Agenten nicht, sondern schadet ihr: nämlich in dem übergeordneten Sinn, daß er seine Pflicht versäumt, die Sonderinteressen nach Maßgabe ihres Beitrages zum nationalen Ganzen zu beurteilen und auch nur so zu befördern.
Auch das ist in den USA eine höchst bemerkenswerte Klage. Schließlich haben in den USA bislang die Mehrung privaten Reichtums und die ökonomische Potenz der Nation immer für ein und dasselbe gegolten, eine Unterscheidung zwischen beiden wurde nie für nötig befunden; gerade so haben es die USA zur weltweiten Sonderstellung ihres Reichtums und ihrer Macht gebracht. Die Regelung des Zugangs zu staatlichen Mitteln über die Konkurrenz der lobbies und „special interests“ war kein Versäumnis der amerikanischen Methode, Politik zu machen; dem lag vielmehr das Urteil zugrunde, daß diejenigen, die reich und mächtig, also in Gelddingen erfolgreich sind, auch am besten wissen, wie mithilfe staatlicher Mittel mehr Geld zu machen sei. Das galt als automatische Garantie dafür, daß sich dann auch mehr Staatsreichtum einstellt: mehr Wachstum, mehr Steuereinnahmen, eine erweiterte Grundlage für den Zugriff des Staates auf die ökonomischen Mittel, die er haben will. Jetzt kommt diese sonst immer als Gütesiegel und besondere Qualität des „american way of life“ gefeierte Methode, die Konkurrenz der privaten Interessen über Nutzen und Notwendigkeit staatlicher Zuwendungen entscheiden zu lassen, ins Gerede. Weil der Erfolg ausbleibt, gilt die alte Erfolgsmethode jetzt als schlechtes Verfahren, die Sonderinteressen zu nationaler Schlagkraft zu bündeln.
Das Selbstbild der amerikanischen Misere ist damit fertig. Zusammengefaßt lautet die Diagnose: Der amerikanische Staat ist für den Auftrag, die USA wieder zur ökonomischen Weltführungsmacht zu machen, schlecht gerüstet und falsch organisiert. Statt daß er mit dem, was er an Mitteln der Wirtschaft entzieht und wieder in sie hineinfließen läßt, die Potenzen der nationalen Ökonomie befördert, schadet er ihnen. Der ganze Staatsapparat, seine Einnahmen und Ausgaben, deren Verwendungsweisen und Verwaltungsmethoden sind zu einer einzigen Last für die Nation geworden. Der Titel, der diese grundsätzliche Selbstkritik zusammenfaßt, heißt:
5. „Defizit“
Man kann die amerikanische Staatsschuld nach Milliarden oder Billionen zusammenrechnen; man kann ihre Zunahmeraten für die Zukunft prognostizieren, man kann sie auf den Kopf der amerikanischen Bürger umrechnen: Ein Argument wird aus der bloßen Quantität der Staatsschuld immer noch nicht. Jahrelang leisteten die USA sich eine Staatsverschuldung, die das Bruttosozialprodukt manch anderen Staates leicht in den Schatten stellt, ohne daß dies zu grundsätzlichen Bedenken hinsichtlich der Funktionsfähigkeit von Staat und Wirtschaft Anlaß gab. Zwar wird das „deficit“ schon seit geraumer Zeit immer mal wieder als Problem besprochen; praktisch kümmerte das die Politik wenig.
Die inzwischen aufgelaufenen Summen gelten jetzt als Beleg dafür, daß es so einfach nicht weitergehen kann:
„Langfristig gesehen dominiert ein einziges Problem die ökonomische Landschaft der Nation: Die Staatsschuld des Bundes… Sie saugt Investitionskapital auf und fügt Milliarden von Dollar an Zinszahlungen zur jährlichen Last des Steuerzahlers.“ (Newsweek, 21.9.92)
Rückblickend bekrittelt die Nation den Boom der Reagan-Ära als „national spending spree“, wo alle über ihre Verhältnisse gelebt hätten. Als ob das „alle“ so einfach könnten – der Staat war es, der seinen Kredit frei nach Bedarf ausgeweitet hat, um die UdSSR totzurüsten und nebenbei noch ein paar mittlere Kriege zu finanzieren. Das hat dem Finanzkapital zu Zinserträgen und Spekulationsmaterial, den Konzernen zu Gewinnen und Kapitalwachstum verholfen; solange das gutging, war der Staatskredit allen recht, um daran zu verdienen. Jetzt wird rückwirkend konstatiert: Der ganze „Reagan-Boom“ war gar kein „echter“ Boom, sondern ein einziges Zuschußwesen des Staates an seine Wirtschaft. Die hat auf Staatskosten produziert, wo es doch umgekehrt gedacht war: daß der Staat seine Ausgaben aus einem wachsenden Geldreichtum finanziert, den seine Wirtschaft hervorbringt. Und schon heißt der gleiche Kredit, das Mehr an Zahlungsfähigkeit, das alles boomen ließ, Schulden und wird als „Erblast“ verhandelt, die der „Kalte Krieg“ der Nation hinterlassen habe.
Weil die nationale Wirtschaft ihren Dienst an der Staatsschuld versagt, kommt sie als die „Verhältnisse“ ins Blickfeld, über die der Staat „gelebt“ haben soll. Der ganze Staatsapparat kommt die nationale Wirtschaft schlicht und einfach zu teuer; für sie, im Verhältnis zu ihrer Leistungsfähigkeit sind die Schulden des Staates „zuviel“. Zwar wüßte keiner von denen, die diesen Befund tagtäglich mit neuen Milliarden bebildern, das Maß dieses Zuviel in Dollar und Cent anzugeben. Aber daß es ein Maß gibt, wird in der Klage darüber, daß der Staat es überschritten haben soll, durchaus bemerkt. So schlägt den bürgerlichen Verstand, der ansonsten „Wert“ als metaphysische Kategorie abtut und das Geld als substanzlose Recheneinheit und bloß technisches Geschäftsabwicklungsmittel bespricht, der Unterschied zwischen wirklicher und fiktiver Wertvermehrung: Plötzlich fällt ihm auf, daß die Vermehrung staatlicher Kreditzettel, die jahrelang als zusätzliche Kaufkraft in die Gesellschaft flossen und allerlei Bilanzen verbesserten, doch nicht ganz dasselbe ist wie eine wirkliche Vermehrung des Reichtums in Geldform, auf den es im Kapitalismus ankommt.
Den schlichten Befund, daß der US-amerikanische Geldreichtum das eben nicht mehr hergibt, was die Staatsschuld ihm abverlangt, will die nationale Debatte über das „deficit“ allerdings nicht zu Protokoll geben. Wer die Schulden als Zuviel für die Wirtschaft bilanziert, legt ja Wert darauf, daß es sich bei der aktuellen Lage von Schulden und Wachstum um ein Mißverhältnis handelt, für das die Politik verantwortlich zeichnet. Der hält also an dem Ideal fest, daß es doch ein „richtiges“, gelingendes Verhältnis von Staatshaushalt und Wirtschaftswachstum gibt, und daß es in der Macht der Politik liegt, dies auch wieder herzustellen. Beweis: Früher hat es doch geklappt! Der politische Sachverstand bemerkt die Ohnmacht der politischen Gewalt gegenüber den Gesetzen der Wertvermehrung, die noch jeden Boom in „Wachstumsschwäche“, „Rezession“ oder gar „Depression“ abstürzen lassen – und läßt diesen Befund nicht gelten. Das würde den Inhabern der Staatsmacht glatt als Defätismus und Verrat an ihrem Auftrag vorkommen, zuzugeben, daß ihre Macht die Wirkungen dieser Gesetze nicht in den Dienst des nationalen Erfolgs zwingen könnte – bei all den machtvollen Worten, die die Politik bei noch jeder ökonomischen Transaktion mitzureden hat! Die Selbstbezichtigung der Politik, sie habe es durch Versäumnisse in allen Abteilungen zum „deficit“ kommen lassen, bekräftigt gerade ihre Hoheit über das Wirken und die Erträge des Geschäfts: So kündigt die Politik an, daß sie sich nun umso macht- und verantwortungsvoller dem Ziel widmen werde, Wirtschaftsleistung und Staatskredit wieder zum Zusammenpassen zu bringen.
Daß es über die richtigen Methoden, dies zu bewerkstelligen, in der Politikergarde zum Streit kommt, ist nicht verwunderlich. Alle „Konzepte“ kommen eben nicht darum herum, daß Haushalt und Wachstum eben derzeit nicht zusammenpassen und durch noch soviele geschickte Haushaltsschachzüge auch nicht zum Passen zu bringen sind. Einerseits heißt die Devise „Sparen“; andererseits kennt jeder nützliche Dienste des Haushalts, auf die gerade wegen der „Bekämpfung der Staatsverschuldung“ nicht verzichtet werden kann bzw. die neu eingeführt werden müssen. Einerseits sollen Haushaltskürzungen die Staatsschuld senken, andererseits sollen sie nicht das Geschäft im Lande schädigen und die Staatseinnahmen dadurch wieder beeinträchtigen. In komplizierten Rechnungen wird vorgeführt, wie sich das Defizit dadurch vermindern läßt, daß der Staat weniger einnimmt oder mehr ausgibt: Bush will Steuern senken für „mehr Investitionen“; Clinton verspricht ein „anspruchsvolles Programm gezielter Fördermaßnahmen“, die das gleiche Ergebnis besser bewirken sollen. Experten ersinnen Kombinationen von Ausgabenerweiterung und/oder -kürzung, Steuererhöhungen und/oder -senkungen und sagen gleich dazu, daß man natürlich nicht wissen könne, ob die gewünschte Wirkung auf das „deficit“ sich einstellen wird. Und dem nun endgültig verwirrten Zeitungsleser wird empfohlen, sich darauf einzustellen, daß die Sache mit dem Defizit sich wohl noch eine Weile hinschleppen wird.
So arbeiten sich die Kontrahenten in dem Bedingungszirkel von zu hohen Staatsausgaben und zu niedrigen Wirtschaftserträgen herum und zu dem Befund vor, daß hier nicht die eine oder andere Reparaturmaßnahme, sondern mindestens ein „American Renewal“ (Bush) oder ein neuer „Bund mit dem amerikanischen Volk“ (Clinton) vonnöten ist, also unter einer Anspannung aller nationalen Kräfte der Endsieg an der ökonomischen Front nicht zu erlangen ist. So zeigt sich, daß die Quellen des amerikanischen Geldes angeschlagen sind; was die neue Regierung nicht daran hindert, weiterhin so zu tun, als habe sie es bloß mit den Folgen schlechter Wirtschaftspolitik zu tun.
III. Staatskredit und Wirtschaftskrise
Die offizielle Diagnose über die Lage der US-Ökonomie will festhalten: Weil der Staat zuviel ausgegeben hat, hat er den „Wachstumskräften“ der Wirtschaft geschadet. Die Wahrheit ist umgekehrt: Weil die US-Wirtschaft in einer Krise ist, entwertet sich der Staatskredit.
1. „Stagnation“ = Zuviel Kapital für lohnende Verwertung
Seit ein paar Jahren verzeichnen die USA eine Bankenkrise. Die Banken haben ihren Kredit ausgeweitet, Unternehmen, Händlern, Grundeigentümern Zahlungsfähigkeit zur Verfügung gestellt. Die haben diesen Kredit in Kapital verwandelt: Ihn in Fabriken, in Büro- und Warenhäusern, im Kauf von und in der Spekulation mit Eigentumstiteln auf Erträge aus der Geschäftstätigkeit anderer, in Staatsschuldtiteln angelegt. So haben die Banken ihr Kapital vermehrt: Als Rechtstitel auf Teilhabe an den Erträgen, die ihre Schuldner so erwirtschaften, stellen sie die „Sicherheiten“ dar, aufgrund derer die Banken selbst Kredit ziehen. Schon seit längerem zeigt sich bei amerikanischen Banken und Sparkassen, daß diese Rechtstitel bloß fiktiv sind. Weil ihre Schuldner mit dem Kredit, den sie für allerlei Geschäfte eingeräumt bekommen haben, keine Erträge mehr erwirtschaften, kommen auch die Kreditgeber in Schwierigkeiten. Statt eines Plus an Zinsen, das den vergebenen Kredit als Kapital auswies, verzeichneten Banken und Sparkassen in ihren Bilanzen lauter Minus; ihr Kredit, also ihr Kapital, wurde entwertet. Darüber wurden viele Banken selbst gegenüber ihren Gläubigern zahlungsunfähig; die anderen achteten vermehrt darauf, noch eingehende Erträge für die Sanierung möglicherweise faul werdender Kredite einzuplanen; sie kündigten Kredite vorzeitig, verteuerten ihren Kredit und sahen genauer auf die Bonität ihrer Kunden. Der Kredit schrumpfte; weitere Kreditnehmer kamen in Zahlungsschwierigkeiten; schließlich sah sich der Staat genötigt, mit seinem Kredit für die Zahlungsverpflichtungen bankrotter Sparkassen einzustehen, um zu verhindern, daß platzender Kredit bei einigen Banken die Funktionsfähigkeit des Kreditsystems insgesamt in Mitleidenschaft ziehe.
Das geht nun schon seit einiger Zeit so zu. Trotz einer Entwertung von Kredit in großem Umfang will eine neuerliche Ausweitung des Bankkredits nicht in die Gänge kommen. Die schleppende Kreditnachfrage aus den Sphären von Produktion und Handel, aber auch die zögerliche Haltung der Banken gegenüber weiterer Kreditvergabe machen deutlich, daß dem Bankgeschäft seine handfeste Grundlage in der wirklichen Vermehrung von Kapitalreichtum entzogen ist. Das zeigt sich in voller Härte auch und gerade auf dem Markt, der ansonsten im kapitalistischen Geschäftswesen als der allersolideste gilt:
„Als die Preise (für Häuser, Büros etc.) zu bröckeln begannen, fielen auch die Mieten… Wer kapitalmäßig auf schwachen Beinen stand, mußte Objekte verkaufen oder Konkurs anmelden… Viele Investoren konnten ihre Verpflichtungen gegenüber den Banken nicht mehr erfüllen.“ (Handelsblatt 28.8.92) Die Konsequenz heißt: „Weil über der Bauszene Pleitegeier kreisen, weigern sich die US-Banken immer noch, in größerem Umfang neue gewerbliche Immobilienkredite herauszulegen.“ (21.8.)
Weil die zahlungsfähige Nachfrage nach Wohn- oder Büroraum dem Immobilien- und Baugeschäft seine Gewinne nicht mehr sichert, sind die gerade noch so ertragreichen Häuser, Büros etc. plötzlich als Kapitaleigentum zuviel. Nicht nur lohnt es nicht mehr, neue Häuser als Mittel des Verdienens hinzustellen. Auch die alten taugen als Kapital nicht mehr; sie stehen leer, verfallen. Ihre Eigentümer erklären sich für zahlungsunfähig; mit den ausbleibenden Erträgen ist auch das Kapital weg, das sie besaßen. Aus ausbleibender Kreditbedienung zieht das Bankkapital seine Schlüsse: Baugeschäfte gelten ihm ab sofort als heikel; Baufirmen bekommen keinen neuen Kredit, haben keine Aufträge, gehen pleite; Leute werden entlassen… Plötzlich erweist sich als ein einziger Schwindel, daß zu Zeiten des Booms mit dem Eigentum an Grund und Boden als besonders sicherer, „wertbeständiger“ Kapitalanlage kalkuliert wurde; daß darauf Gewinne berechnet und kassiert, daß es zu immer höheren Preisen ge- und verkauft wurde, daß darauf immer neuer Kredit gezogen wurde. Solange die Gewinne in Produktion und Handel wachsen, erlaubt eben die bloße Verfügungsgewalt über Bodenfläche deren Eigentümern, mit dessen Vermietung, Verkauf und Verpachtung als schierer Voraussetzung für jede Geschäftstätigkeit ein immer besseres Geschäft zu machen. Wenn die Gewinne ausbleiben, zeigt sich der ganze „Bodenwert“ samt dessen Steigerungen als pur fiktive Rechnung, die auf nichts anderem beruht als der spekulativen Ausbeutung anderweitig verdienter Überschüsse. In der Krise wird abgerechnet: Und im Zusammenbruch des Überbaus an Spekulation zeigt sich, daß das Kapital mit seinem Wachstum lauter Ansprüche auf zukünftigen Gewinn in die Welt gesetzt hat, die sich aus den produzierten Gewinnen nicht mehr bedienen lassen. Also wird es entwertet.
2. Die Krise des Dollar
Die besondere Form, in der die USA an der gegenwärtigen Krise teilhaben, erklärt sich aus der besonderen Art und Weise, in der diese Nation die kapitalistische Reichtumsproduktion für ihre nationalen Zwecke mit Beschlag belegt. Die USA haben sich stets in besonderer Weise befähigt und berechtigt gesehen, sich mit ihrem Staatskonsum an den Erträgen zu bedienen, die das US-Kapital daheim und auswärts so einspielte. Die Fähigkeit entnahmen sie dem Umstand, daß sie die größte Weltwirtschaftsmacht waren: Ihr Markt brachte die größte Masse nationalen Kapitalreichtums hervor, und ihr Geld, der Dollar war entsprechend unanfechtbar, universell gültiges Weltgeld. Die Berechtigung ergab sich aus ihrem Auftrag, als Aufsichtsmacht für die weltweite Durchsetzung der Produktionsweise zu sorgen, der sie eben diesen Reichtum verdanken. Die USA sehen in ihrer Militärmacht zu Recht die absolute Existenzbedingung für die Freiheit ihrer Geschäftswelt, jeden Winkel der Erde für Kapitalvermehrung zu nutzen; deshalb wäre ihnen die Frage, ob die Nation sich diesen Militäraufbau leisten könne, als nationale Selbstaufgabe erschienen. Die Freiheit, die der Reichtum der Nation dem US-Staat eröffnete, begründete zugleich die Rücksichtslosigkeit, mit der er für seine Zwecke auf diesen Reichtum zugriff.
Lange Jahre leisteten es sich die USA, diese Rücksichtslosigkeit als ihr genaues Gegenteil abzuwickeln: Nämlich als lauter zusätzliche Gelegenheiten für kapitalistisches Geschäft. Indem die USA ihren Militärapparat mit Kredit finanzierten, vollbrachten sie das kleine Wunder, ihren Staatskonsum, d.h. den Abzug von produktiver Verwendung, in ein zusätzliches Mittel der Kapitalakkumulation zu verwandeln. Ihrem Bedarf an Gebrauchsgütern für staatliche Zwecke gaben sie die Form der „Versorgung“ der Wirtschaft mit zusätzlichem Kredit; die staatlich geschaffene zahlungsfähige Nachfrage finanzierte und realisierte zusätzliche Produktionskapazitäten und Gewinnansprüche. Mit seinem gewaltigen Rüstungsetat verschaffte der US-Staat so lange Jahre dem US-amerikanischen Kapital zusätzliche Quellen der Bereicherung und Vermehrung.
Das „Wunder“, das der US-Staat vollbracht hat, war eine Formverwandlung der Kosten, die der Militärapparat dem kapitalistischen Geschäft auferlegt, hat sie aber nicht zum Verschwinden gebracht. Im „Reagan-Boom“ bürdeten die USA dem Kapital immer mehr Abzug von der produktiven Verwendung des Reichtums auf, ohne Rücksicht darauf, daß der Nachschub dessen Produktion immer neu herschaffen muß. Damit haben die USA die Vermehrungspotenzen der weltweiten Kapitalakkumulation überfordert. Daß das so ist, zeigt sich am Geld der USA, dem Dollar. In dessen Entwertung präsentiert die Konkurrenz der Kapitalisten und der Nationen den USA die Rechnung für das Wunder.
Die Konkurrenz der Kapitalisten hat in den letzten Jahren dafür gesorgt, daß die ehemals herausragende Stellung der USA auf dem Weltmarkt verschwunden ist. Die US-Wirtschaft bestimmt nicht mehr das Weltmarktgeschäft, sondern ist zu einem Standort in ihr herabgesetzt, der neben und im Vergleich zu anderen als Mittel für Im- und Export von Waren und Kapital taugt. Damit hat das weltweit akkumulierende Kapital aber auch die Sonderstellung des amerikanischen Geldes schrittweise beseitigt. Neben und zusätzlich zum Dollar benutzte es die Währungen anderer Nationen, vorzugsweise DM und Yen, zunehmend als Mittel seines weltweiten Geschäfts und setzte sie damit konkurrierend zum Dollar in Wert. Damit wurden den Nationen als den Hütern dieser Währungen neue Freiheiten in die Hand gespielt, in Konkurrenz zu den USA den weltweiten Zugriff auf Reichtumsquellen zu organisieren und andere Nationen für sich einzuspannen. Der relative Umfang, in dem das Kreditgeld der USA, der Dollar, am Weltmarktgeschäft verdient, nimmt ständig ab; die Nachfrage nach dem Dollar hält schon seit längerer Zeit nicht Schritt mit der Nachfrage nach DM und Yen. Das Resultat heißt: Mit ihrem nationalen Geld kommandieren die USA immer weniger Reichtum im Weltmaßstab. Oder was dasselbe ist: Der Kredit der Nation ist immer weniger wert. So bekommen die USA vorgeführt, daß die Ansprüche, die sie mit ihrer ständigen Vermehrung von Dollarkredit an die Erträge der Geschäfte in Dollar aufmachen, von diesen nicht mehr bedient werden können.
Damit wird auch offenbar, daß das US-Kapital im Verlauf seiner Akkumulation den US-Kredit faktisch immer mehr als Ersatz dafür benutzt hat, sich nach neuen, zusätzlichen Quellen des Geldverdienens umzutun. Das US-Kapital hatte einerseits einen riesigen inneren Markt als Geschäftssphäre zur Verfügung; es hat sich am Export solange bereichert, wie die US-Waren für den Rest der Welt ohnehin die einzigen tauglichen Geschäftsmittel waren; ansonsten war es als Multi bei jedem Geschäft immer schon dabei. Deshalb hat es lange Zeit keine Notwendigkeit gesehen, sich ausdrücklich gegen die Konkurrenz um auswärtige Märkte zu kümmern; ganzen neu entstehenden Abteilungen des Weltmarktgeschäfts, wie etwa die Belieferung des weltweiten Auslands mit Unterhaltungselektronik und Autos, hat es ziemlich interesselos gegenübergestanden. Wo es als Kapital emigrierte und zum Multi wurde, kamen seine Geschäftserfolge schließlich den Bilanzen anderer Nationen zugute. Weil es sich mit Dollars an jedem Geschäft in der Welt beteiligen konnte, war es ihm egal, inwieweit seine Geschäfte den Dollar stärkten. Und solange das Weltmarktgeschäft Geschäft mit dem Dollar war, brauchten auch die USA sich nicht um die Gleichung zwischen geschäftlicher Verwendung von und dem nationalen Interesse am Dollar zu kümmern.
Vom Standpunkt der Nation aus betrachtet soll das Geschäft des Kapitals dafür sorgen, daß das nationale Kreditgeld, der Dollar, sich im Vergleich mit anderen nationalen Geldern als vermehrungsfähiges Geld, also als Kapital bewährt; auf diese Weise soll sichergestellt sein, daß auch die vom Staat in Umlauf gesetzten Dollar ihm ein Mehr an Zahlungsfähigkeit sichern. Diese nationale Rechnung geht für die USA schon seit längerem nicht mehr auf. Seitdem gibt es die Beschwerde über das Außenhandelsdefizit. Mit dieser Beschwerde nehmen die USA einen neuen Standpunkt zum Weltmarkt ein. Sie bilanzieren den Verlust an Weltmarktgeschäft in Dollar so, daß die Weltmarktkonkurrenten von den USA Reichtum abziehen, statt dem Reichtum in Dollarform Überschüsse hinzuzufügen. Die USA wären die letzten, die zugeben würden, daß es ihr militärisches Anspruchswesen war, mit dem sie die Reichtumsproduktion der Welt überfordert und ihren Kredit verspielt haben. Die Außenhandelsbilanz taugt ihnen als Beleg für die Sichtweise, daß andere ihnen Weltmarktanteile weggenommen haben und sich zusätzlich noch ungerechtfertigt an ihrem inneren Markt bereichern. Deshalb sortiert die Nation die Vermehrungsquellen des Dollar neu auseinander in den lokalen Standort USA, der zu sichern ist, und in Märkte und Gewinne auswärts, die verstärkt zu erobern sind. In der Sorge um die Brauchbarkeit des äußeren Handels für die Währung zeigt sich so einerseits das Eingeständnis der US-Politik, daß die Nation sich den Reichtum erst noch verdienen muß, auf den sie in ihrer Kreditausweitung schon längst zugegriffen hat; andererseits der feste Wille, im Kampf um Marktanteile und Handelsüberschüsse den Verlust an Kreditwürdigkeit rückgängig zu machen, den die Nation erleidet.
Mit ihren ganzen „Exportoffensiven“ und „Marktöffungsinitiativen“ der letzten Jahre haben die USA die Entwertung ihres Kredits nicht verhindern können. Jetzt kommt das US-Kapital in die Krise; und damit macht sich die Entwertung des Dollar für die USA als Verlust der Fähigkeit geltend, sich durch die Vermehrung von Dollarkredit noch vermehrten Zugriff auf gesellschaftlichen Reichtum zu sichern. Weil das Kapital keine vom Staatskredit unabhängige Vermehrung des Geldreichtums der Gesellschaft zustandebringt, erweisen sich die Geldzeichen, die Anweisungen auf produzierten Wert, die der Staat in Umlauf bringt, als immer weniger taugliche Zugriffsmittel: Die Vermehrung dieser Kreditzettel bewirkt nur noch ihre Entwertung.
3. Der Kredit der Nation ist entwertet – Schulden bezahlen Schulden
Das bringt die Nation überhaupt nicht davon ab, immer weiteren Kredit in die Welt zu setzen. Gerade weil er sich entwertet, schlägt nämlich die Freiheit der Nation, sich mittels Kredit am Reichtum der Gesellschaft zu bedienen, um in die Notwendigkeit, ihn fortzusetzen und aufrechtzuerhalten. Weil soviel an Geschäft und Zahlungsfähigkeit im Land nur noch am Staatskredit hängt, bringt jede Kürzung dieser Ausgaben die Krise bei Banken und Unternehmen erst recht zum Ausbruch; deren Aufrechterhaltung führt umgekehrt bloß dazu, daß sich die Staatsschuld noch mehr aufbläht und der Kredit sich weiter entwertet. Dem Staat gerät seine Verschuldung außer Kontrolle: Er setzt Kredit nicht mehr wegen und für Projekte in die Welt, die er beschlossen hat, sondern reagiert mit weiterer Verschuldung nur noch auf die Lage seiner Wirtschaft und sieht sich folglich mit immer neuen „Löchern“ konfrontiert, die es so oder so zu „stopfen“ gilt. Die Politik stellt fest, daß ihr die souveräne Verfügung über ihr Geld abhandengekommen ist.
Diesen Notstand der Staatsfinanzen bemerkt die Politik daran, daß die Verschuldung den Staat immer mehr kostet:
„Zum ersten Mal in der amerikanischen Geschichte hat der Fiskus im abgelaufenen Haushaltsjahr für den Schuldendienst mehr ausgegeben als für das Pentagon“ (SZ 31.10.91),
d.h. inzwischen ca. 20% des amerikanischen Budgets. Der Staat zahlt einen wachsenden Teil seines Haushalts weg ans Finanzkapital. Dieser Teil seiner Geschäftswelt verdient am Staat, aber das Geschäft bleibt einseitig: Er bedient sich immer weniger an den Erträgen seiner Geschäftswelt, weil diese schrumpfen. Diese Lage läßt die US-Politik nicht auf sich beruhen: Sie besinnt sich auf kreditpolitische „Instrumente“, mit denen sie für bessere Geschäftsbedingungen sorgen will. In diesem Sinne hat die US-Notenbank den Refinanzierungszins für die Banken seit 1989 24mal gesenkt. Als „Signal“ an die Bankenwelt sollten diese Zinssenkungen für eine allgemeine Rückführung des Zinsniveaus sorgen, was der geldpolitischen Bilderwelt zufolge als „günstige Geschäftsbedingung“ gilt. Als zweiten Effekt einer solchen allgemeinen Zinssenkung erhofften sich die Staatsbanker, der Finanzwelt die neuen Staatsschuldtitel auch mit niedrigerem Zins als lohnende Geldanlage offerieren zu können und damit die zukünftige Zinsbelastung des Haushalts zu senken. „Hochzinspolitik“ wie noch zu Reagans Zeiten sollte nicht gemacht werden; auf eine Attraktion des Geldkapitals durch Zinsen hat die US-Politik nicht gesetzt, sondern genau umgekehrt die Zinsen als Kost für den Staat beurteilt, die möglichst zu senken sei.
Das mit dem Geschäftsaufschwung durch billigen Kredit hat bislang nicht geklappt. Stattdessen darf man in US-Gazetten von einer wundersamen Sanierung von Bankbilanzen lesen –
„Das Bankgewerbe hat in der ersten Hälfte 1992 15,5 Mrd. $ verdient, der höchste Reingewinn, den es je erzielt hat“ (Newsweek 19.10.92) –,
neben Berichten von neuen „gefährdeten Instituten“ und Mutmaßungen, daß eine neue „Bankenkrise“ bloß aus Wahlkampfzwecken „verschleiert“ worden sei. So recht mag offenbar niemand behaupten, die Bankgewinne stünden tatsächlich für eine gute Geschäftslage im Kreditüberbau. Das ist kein Wunder. Denn diese Sanierung ist offenbar bloß darüber zustandegekommen, daß die Finanzwelt mangels anderer lohnender Anlage mit der Spekulation, dem Kaufen und Verkaufen von Kreditpapieren und Staatsschuldtiteln gute Geschäfte gemacht hat. Da fällt noch jedem Konjunkturbeobachter, dem ansonsten jeder fiktive Kreditzettel als „Kapitalanlage“ gleich lieb ist, der Unterschied zwischen solidem und unsolidem Geschäft auf. Der Staat hat seine Schulden vermehrt, die Finanzwelt verdient daran, aber außer diesem Hin- und Herschieben von fiktiven Titeln tut sich im Kreditgewerbe nichts. Die Gewinne der Banken indizieren gar keinen Aufschwung der Geschäfte, der dem Staatskredit eine neue Grundlage verschaffen würde; vielmehr wird mit dem immer neuen Staatskredit die Solidität des Finanzgeschäfts weiter geschädigt und untergraben, so daß jeder dessen Erträge gleich als Schwindel durchschaut. Mit seiner ganzen Verschuldung ist der US-Staat nicht in der Lage zu bewirken, daß sein Kredit als Mittel der Kapitalvermehrung fungiert. Er sorgt mit seinem Kredit nur noch dafür, daß die Kreditbasis, das Kreditieren und Zahlen selbst, weiter klappt, und er damit weiter Zugriff auf Geld hat. Das ist aber auch alles, was die Staatsgewalt garantieren kann. Diese Garantie kostet sie zugleich immer mehr; und alle Welt kommt um die Frage nicht mehr herum, was ein solcher Kredit eigentlich noch wert ist.
4. Staatsbankrott – oder was?
Die Frage, was der Kredit der USA noch wert ist, stellt die Geschäftswelt schon des längeren. Sie vergleicht tagtäglich die relative Tauglichkeit des US-Kredits für Weltmarkt-, Kredit- und Spekulationsgeschäfte aller Art mit der Tauglichkeit konkurrierender Kreditgelder, vor allem DM und Yen. Schon seit einigen Jahren ist das Ergebnis dieses Vergleichs unterm Strich betrachtet ein stetig sinkender Dollarkurs. Für die USA bedeutet das einen ständigen Verlust an nationaler Zahlungsfähigkeit. Allerdings nicht so, daß die Nation, daß deren Geschäftswelt irgendwann einmal wirklich nicht mehr hätte zahlen können. Sie zahlen ja, eben in Dollar; die USA und ihre Geschäftswelt genießen weiterhin den Vorzug, über ein Geld zu verfügen, das unmittelbar als internationaler Kredit fungiert, mit dem man überall kreditwürdig ist. Nur bekommen sie ständig weniger für ihre Dollar; und diejenigen, die sich in Dollar zahlen lassen, bekommen ein ständig sich entwertendes Geld. Für die läge die Frage nahe, warum man den Dollar überhaupt noch als Anweisung auf Wert akzeptieren solle. Im Kursverfall praktiziert alle Welt längst den Standpunkt, daß mit dem Dollar immer weniger anzufangen ist; dennoch kommt die Forderung gegenüber dem US-Staat nicht auf, daß er für seinen immer schlechter werdenden Kredit mit anderem, besseren Geld einzustehen habe.
In anderen, ähnlich gelagerten Fällen arbeitet sich der ökonomische Sachverstand trotz aller Schönrednerei, wonach „so etwas“ heute eigentlich gar nicht mehr passieren kann, schon eher zu dem Verdacht vor, die „Finanzreserven“ eines Staates seien „erschöpft“ und er selbst quasi „bankrott“. Als Finanzspekulation und Politik vor kurzem Italien und England zwangen, ihre Währung massiv abzuwerten, ihre Devisenreserven abzuliefern und sich für beschränkt zahlungsfähig zu erklären, wußte jeder gleich: Das mußte ja so kommen! Bei den Staatsschulden, den fehlenden Wachstumsraten, den Pleiten bei Banken und Unternehmen, den negativen Handelsbilanzen, der Inflationsrate… Daraus konnte nach allgemeiner Auffassung gar nichts anderes folgen als die Flucht der Finanzwelt aus dem maroden Kredit dieser Nationen und deren Verpflichtung darauf, sich neuen Kredit nicht mehr durch Vermehrung ihres eigenen Kreditgeldes, sondern auswärts, bei der überlegenen Konkurrenz zu besorgen.
Auf die Idee kommt bei den USA niemand. „Alarmierende Zahlen“ über Arbeitslose und Handelsbilanzen sind Anlaß für weiteren Kursverfall, aber nicht dafür, daß die Finanzwelt am Dollar wie an Lira und Pfund grundsätzliche Zweifel anmelden, was er überhaupt noch als Geschäftsmittel taugt. Zwischendurch geht der Dollarkurs auch immer einmal wieder ein wenig nach oben, wenn irgendwelche „Daten“ oder Ereignisse in Europa oder Übersee eher eine Spekulation gegen DM oder Yen geraten sein lassen. Aus den Führungsetagen Europas oder Japans wird nicht die Aufforderung an die USA vernommen, zuzugeben, daß ihr nationaler Kredit verbraucht sei und sie sich zukünftig zwecks Verfügung über Zahlungsfähigkeit an die Notenbanken in Bonn und Tokio zu wenden hätten. Man hört, daß die USA sich in den letzten Jahren aus dem größten internationalen Gläubigerland in die größte Schuldnernation verwandelt haben. Aber weder werden die USA wie England und Italien genötigt, ihre Schulden in „gutem Geld“ zurückzuzahlen; noch werden sie wie weiland Mexiko dazu verdonnert, zwecks Schuldenbedienung ihre Rohstoffvorräte an ihre Gläubiger in den „reichen Staaten“ zu verpfänden. Die USA zählen vielmehr weiterhin selbst zu diesen Reichen, deren Kreditgeld den „Armen“ als „harte Währung“ nach den Konditionen der „Geberländer“ zugeteilt wird.
Offenbar entscheiden die Bilanzen in Sachen Schulden, Wachstum und Währung für sich gar nicht darüber, welche Freiheiten sich eine Nation mit ihrem Kredit erlauben kann. Es kommt schon sehr darauf an, wessen Kredit in Nöte kommt; welche Nation hinter dem Geld steht, in dem die Schulden sich vermehren. Und da liegt der Fall USA eben doch sehr anders als die Fälle Italien und England:
Erstens schon aufgrund ihrer Macht. Zwar zeigt der ständige Kursverfall des Dollar, der sich auch durch einen mittleren Krieg nur kurzzeitig unterbrechen ließ, daß die Zeiten passè sind, als die Währung der unbezweifelten Führungsmacht USA ebenso unbezweifelt Wert war. Aber immer noch haben die USA es als Führungsmacht der Freien Welt nicht nötig, sich in Kredit- und Währungsfragen von irgendeiner anderen Macht etwas sagen zu lassen, und die aufstrebenden Konkurrenz-Imperialisten werden sich hüten, einen solchen Anspruch aufzumachen. Die Hüter von DM und Yen wissen sich zugleich abhängig von der Weltaufsicht des Oberimperialisten; sie möchten sie benutzen, von ihr profitieren. Schon deswegen käme keiner von ihnen auf die Idee, dem Geld dieser Macht seine Qualität als Kredit absprechen zu wollen oder sich gar anzumaßen, sie könnten den USA in die Verwendungsweise ihres Geldes hineinreden, wie dies Deutschland gegenüber Italien und England ganz selbstverständlich zu tun beansprucht.
Zweitens aufgrund der Funktion, die der Dollar als Kredit der Weltmarkt-Nation USA für ihre Konkurrenten weiterhin erfüllt – entwertet oder nicht. Dollar zu haben mag ja vergleichsweise blöd sein – im Verhältnis zu DM oder Yen. Aber im Verhältnis zu ’zig anderen nationalen Geldern ist er eben immer noch vergleichsweise nützlich. Schließlich bleibt der US-Markt einer der größten der Welt, den noch jeder benutzen will; niemand kann einen Vorteil darin entdecken, diesem riesigen Teil des Weltmarkts in toto Unwirtschaftlichkeit, „Überschuldung“ vorzuwerfen und ihn abzuschreiben. Also muß man wohl oder übel auch mit dem Geld leben, das diesen Markt in Schwung hält: Zuviel eigenes Geschäft, zuviel eigener Kredit hängt mit davon ab, daß die Geschäfte in den USA, mit dem Dollar klappen. Solange sich immer noch mit dem Dollar jede Menge Geschäfte machen, an ihm verdienen läßt, nimmt die Geschäftswelt seine „schleichende“ Entwertung in Kauf und geht mit ihr um.
Drittens ist die Sachlage inzwischen die, daß nicht nur den Dollar das Verdikt „Schulden zuviel!“ trifft. Die Weltwirtschaftskrise schlägt auch in Japan und Europa zu; den einen oder anderen Bank- und Immobilienkrach haben diese Weltgegenden auch zu verzeichnen, und Europa plagt sich mit den „Kosten der Einheit“. Insofern mag der Dollar ja schlechtes Geld sein; inwieweit die anderen eigentlich soviel besser sind, steht dahin. Deswegen kommen die konkurrierenden Weltwirtschaftsmächte nicht nur nicht auf die Idee, den USA ihre Schulden zu präsentieren und auf Saldierung zu drängen: Die Weltwirtschaftsmächte können sich gar nichts Schrecklicheres vorstellen als eine Dollarkrise. Schon am Beispiel Pfund und Lira hat sich ja gezeigt, daß es eine Sache ist, den Kredit von Staaten zur „Schwachwährung“ zu erklären und damit der Finanzwelt nahezulegen, sich dieses schlechten Geldes möglichst umgehend zu entledigen; und eine andere, einen solchen Kreditkrach so abzuwickeln, daß daraus nicht eine allgemeine Krise aller Kredite wird, die mit Lira und Pfund tausendfach verschränkt und verflochten sind. Wer die Lira „schlechtredet“, muß im Zweifelsfall auch in der Lage sein, mit dem eigenen Kredit für die Zahlungsfähigkeit Italiens geradezustehen, wenn nicht alle Geschäfte platzen sollen, die mit dieser Nation laufen. Daß eine schlagartige Entwertung des amerikanischen Kredits dasselbe wäre wie ein weltweiter Kreditkrach, der der Konkurrenz mindestens ebenso schaden würde wie den USA, ist sicher. Daß weder der europäische noch der japanische Kredit in der Lage wären, sich den Dollar unterzuordnen, für die Zahlungsfähigkeit der USA an deren Stelle zu garantieren, ist jedem irgendwie klar, der über die in der „Dollar-Schwäche“ liegenden Gefahren für „die Weltwirtschaft“ herumräsonniert. Den Dollarkredit will nicht nur niemand infragestellen: Er darf nach dem Willen der Weltmarkt-Beaufsichtiger gar nicht infragegestellt werden, wenn sich nicht die Weltwirtschaftskrise, die schon da ist, in einem allgemeinen Kreditkrach entladen soll, der das Geschäftsleben weltweit zum Erliegen bringt.
Allen Beteiligten ist bewußt, daß es insgesamt auf der Welt, und nicht bloß bei den USA, zuviel Kredit gibt. Das macht alle Aktionen, mit denen die Weltwirtschaftsmächte gegeneinander um die Sicherung ihres Kredits kämpfen, immer prekärer; sie selbst stellen wechselseitig ihre Bereitschaft und Fähigkeit zu gemeinsamer Kontrolle und Beaufsichtigung auf eine immer schwerere Probe. Deshalb schafft der Umstand, daß kein Weltwährungshüter wegen der Rückwirkungen auf den eigenen Kredit den Dollar angezweifelt sehen will, die Befürchtung nicht aus der Welt, daß „es“ – durch irgendeine unbedachte Äußerung oder Tat der Politik – doch dazu kommen könnte. Inzwischen schlägt es das blödeste Auge, daß die ständigen Mahnungen zu „gemeinsamer Verantwortung“ bloß die Kehrseite einer Konkurrenz um die Vermeidung von Schäden sind, die die Krise des Kapitals in allen nationalen Bilanzen anrichtet; und das Finanzkapital aller Länder ist dauernd auf dem Sprung, um bei dieser Schadensverteilung zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein.
Diese Lage befinden die USA jetzt in besonderer Weise als unerträglich. Sie stellen nämlich fest, daß sie es sind, die immer schlechter fahren, je länger sie sich hinzieht. Daß keine andere Nation den Dollar in Zweifel zieht, macht ihn nicht zum tauglichen Mittel für die USA, sondern heißt nur, daß die Konkurrenz ihn weiterhin nach Kräften für die eigenen Bilanzen ausnützt. Daß das internationale Finanzkapital keine Flucht aus dem Dollar inszeniert, heißt nicht, daß er auf ewig davor gefeit wäre; was die USA daran bemerken, daß sie den Wert des Dollar weder sichern noch garantieren können. Die USA bemerken die Weltwirtschaftskrise als Abhängigkeit der Nation von den Kalkulationen der konkurrierenden Staaten und des internationalen Geldgeschäfts und damit als Schranke der nationalen Handlungsfähigkeit in Geldfragen. Die wollen sie nicht weiter dulden; also leiten sie selbst die Reorganisation ein, die sie aus dieser Abhängigkeit befreien soll.
Das ist sie, die „Wende“. Die USA definieren die Gefährdung ihres Kredits als Herausforderung der Nation und tun so in guter imperialistischer Manier kund, daß sie ebensowenig wie irgendeine andere kapitalistische Nation ihre Ansprüche dem anzupassen bereit sind, was die Weltmarktkonkurrenz ihnen ökonomisch erlaubt. Die USA sehen die Sache umgekehrt: Sie sind schließlich Welt-Wirtschafts-Macht, deshalb kämpfen sie mit dieser Macht auch darum, daß ihr Geld wieder den Gang der Weltmarktgeschäfte bestimmt.
IV. „American Renewal“ – aber wie?
Was sich in der Krise der USA zeigt, ist: Auch für diese Nation gelten die Gesetze kapitalistischer Reichtumsvermehrung. Die besagen: Wenn der Staat mit seinem Kredit Gewinne befördert und Wirtschaftswachstum ermöglicht, dann tut er eben auch nur das. Die Kalkulationen des privaten Geschäfts entscheiden darüber, was und wie aus diesen Möglichkeiten Wirklichkeit wird; nach dem Willen der Staatsgewalten, die diese Produktionsweise betreuen, sollen sie das ja auch. Sie entscheiden darüber auf einem Markt, der längst – nicht zuletzt auf Betreiben der USA selbst – Weltmarkt ist: Wo die Angebote und Geschäftsgelegenheiten, die die Staatsgewalt der USA unter ihrer Kontrolle hat, sich vergleichen lassen müssen mit denen anderer Nationen und Regionen.
Was die USA aus dieser Lage schließen, ist etwas ganz anderes: Auch die USA brauchen eine nationale Wirtschaftspolitik, die diese Angebote und Geschäftsgelegenheiten zu Konkurrenzmitteln der Nation herrichtet und sich nicht einfach darauf verläßt, daß die USA als Standort automatisch ein Angebot sind. Die Nation nimmt Abschied von der Vorstellung eines schier unerschöpflichen amerikanischen Reichtums, auf den sie quasi automatisch und nach Belieben zugreifen kann; sie beschließt, wie jede andere kapitalistische Nation mit der Gestaltung ihrer Ausgaben darum zu kämpfen, daß der Reichtum etwas taugt, der bei ihr produziert und verdient wird. Die USA erkennen damit an, daß sie in die kapitalistische Konkurrenz um die nationalen Quellen der Reichtumsvermehrung eingereiht sind; nicht mehr „Super-“, nur noch – jedenfalls vom US-nationalen Standpunkt aus betrachtet – „Macht“.
Das Eingeständnis, konkurrieren zu müssen, also auch zu wollen, ist alles andere als defensiv. Zugleich geben die USA damit zu Protokoll, daß an bedingungsloses Durchsetzen US-amerikanischer Interessen gegen den Rest der Welt derzeit nicht gedacht ist. Die USA wollen mehr vom Weltmarkt profitieren, weil ihr eigener, innerer Markt, die „daheim“ produzierenden Kapitale längst in ihn eingemischt und eingebunden sind; die hergestellten Geschäftsbeziehungen und Abhängigkeiten sollen als Hebel dienen, damit die US-Nation sich mit ihrer Macht und ihrem Geld entschiedener gegen die Konkurrenz durchsetzt. So ein Programm setzt einerseits darauf, daß die Konkurrenz sich von Geschäften mit den USA weiterhin Vorteile ausrechnet bzw., was nicht ganz desselbe ist, auf die Gültigkeit amerikanischer Macht und die Zahlungsfähigkeit des amerikanischen Marktes angewiesen ist. Und es will zugleich diese Abhängigkeit ausnutzen, um die Richtung umzukehren, die die Verteilung von Nutzen und Schaden auf diesem Markt die letzten Jahre genommen hat:
„Wir sind in eine Weltwirtschaft eingetreten. Heute haben wir die Möglichkeit, ihre auf Wettbewerb beruhenden Herausforderungen zu bewältigen anstatt zu gestatten, daß diese Veränderungen unsere Stärke untergraben.“ (Clinton, Erklärung in Little Rock nach seiner Wahl. AD 4.11. 92).
Das ist ein widersprüchliches Unterfangen.
1. Gewalt für Export und Erträge
Daß Clinton „Kontinuität in der Außenpolitik“ verspricht, hat schon seine Richtigkeit. Sein Projekt, die USA zur „stärksten Handelsmacht der Welt“ zu machen, ist ja überhaupt nicht neu; das gleiche Ziel verfolgen US-Präsidenten, seit vor 10 Jahren die Schäden offenbar wurden, die die aufstrebende Konkurrenz dem Dollar zufügt. Neu ist die Lage, in der der neue Präsident das Versprechen der USA erneuert, sich von der Konkurrenz keine Beeinträchtigungen US-amerikanischer Wirtschaftsmacht mehr gefallen zu lassen.
1.1. Waffen
Der erste Blick der Politik fällt auf die „Märkte“, die die USA haben, und die politischen Abhängigkeiten, die eingerichtet sind. Die Belieferung auswärtiger Herrscher mit US-Kriegsgerät vereint beide Gesichtspunkte aufs Vortrefflichste. Die „Nachfrage“ ist durch den Wegfall der UdSSR nicht geringer geworden; die Notwendigkeit, neu mit eigenen Waffenlieferungen politische Abhängigkeiten zu stiften, ebensowenig, schon wegen entsprechender Aktivitäten der imperialistischen Konkurrenz. Also besichtigen die USA ihre Waffenindustrie neu als Mittel von Geschäft und Gewalt:
„Die USA haben ihre Waffenverkäufe an Staaten der 3. Welt im vergangenen Jahr (1990) mehr als verdoppelt… Der seit 2 Jahren rückläufige amerikanische Militäretat stellt die Waffenhersteller vor die Alternative, unterzugehen oder neue Märkte im Ausland zu erschließen, heißt es in dem Jahresbericht des Kongresses. Die USA kommandieren inzwischen 45% des Marktes in der 3. Welt, dagegen Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien noch zusammen 10% gegenüber 22,4% im Jahr davor.“ (SZ 13.8.91)
Daß diese Ausweitung des Waffenexports so ganz auf die Privatinitiative der jeweiligen Firmen zurückzuführen ist, ist ausgerechnet bei einer Nation, die Cocom-Listen erfindet und bei anderen auf „nonproliferation“ drängt, wenig glaubhaft. Ausdrücklich haben die USA den Standpunktwechsel, nach dem der Staatshaushalt fremder Souveräne neuerdings ein „Markt“ ist, an dem sich US-Firmen konkurrierend bedienen sollen, mit ihren Verkäufen von 150 Jagdflugzeugen an Taiwan vollzogen:
„Die F-16 wird von General Dynamics in Bush’s Wahlheimat Texas gebaut. 3000 Texaner, die von dem Unternehmen bis 1995 entlassen werden sollten, können jetzt mit Weiterbeschäftigung rechnen.“ (Handelsblatt 4.9.92)
Dieser Aktion das Etikett „bloß Wahlkampf“ anzuhängen, ist nicht einmal die halbe Wahrheit: Schließlich kann man ja auch mit „Friedensdividende“, „Teilen“ und „Solidarität“ Wahlkampf machen. Die alte US-Regierung hat sich eben auf den Standpunkt gestellt, daß im Zuge der „neuen Weltordnung“ die amerikanische Waffenindustrie der Nation auch neue, gute Dienste leisten kann. Da darf man sich auf „Kontinuität“ verlassen: Die USA bleiben nicht nur die Waffenschmiede der Welt – sie wollen in Zukunft auch mehr daran verdienen.
1.2. Kredit
als politische Waffe war in der Zeit des Ost-West-Gegensatzes eher das Metier der europäischen Möchtegern-Großmacht. Unter dem Schirm der amerikanischen Weltordnung sicherte sie sich mit ihrem guten Geld die besondere Geneigtheit und das Geschäft mit weniger bemittelten Souveränen; auch und gerade im vormaligen „Osten“. Die USA, die vordem solchen Machenschaften eher kritisch gegenüberstanden, haben jetzt auch den Kredit als Waffe entdeckt. Auf den internationalen Finanzmärkten mag ja die Macht des Dollar nur noch relativ zählen: Für Staaten, die überhaupt keinen Kredit, also kein Geld haben, ist der Zugang zu einem solchen Weltgeld immer noch die absolute Bedingung, um überhaupt an Weltmarktprodukte heranzukommen. Diese Macht des Dollar haben die USA vor kurzem gegenüber der GUS in Anschlag gebracht: Sie haben sich freundlicherweise bereit erklärt, einen Teil ihrer sonst unverkäuflichen Argrarüberschüsse an Rußland zu verkaufen, und haben es im Gegenzug darauf verpflichtet, den dafür gleichzeitig eingeräumten Dollarkredit vorrangig vor allen anderen Schulden zu bedienen. Daß diese „anderen Schulden“, die Erblast der untergegangenen UdSSR, sich wesentlich in den Büchern deutscher Banken finden, vereinfacht die Sache vom Standpunkt der USA aus gesehen natürlich.
Die USA haben damit nicht nur den Russen erfolgreich demonstriert, mit welcher Macht sie sich vor allem gut stellen müssen, wenn sie sich Chancen auf „Hilfe“ für das Überleben ihres marktwirtschaftlichen Projekts ausrechnen. Sie haben vor allem der imperialistischen Konkurrenz gezeigt, wie die USA in Zukunft ihre Macht für den Zugriff auf Geldquellen einzusetzen gedenken; daß sie bereit und in der Lage sind, sich dabei auch über bislang eingerichtete Absprachemethoden und Konkurrenztechniken – in diesem Fall: der imperialistischen Dauerveranstaltung „Umschuldung der GUS-Schulden“ – hinwegzusetzen. Diese „Umschuldungsverhandlungen“ gehen anerkanntermaßen nur noch darum, den Schaden zu verteilen, den die faktische Zahlungsunfähigkeit der GUS in den Bilanzen westlicher Banken anrichtet; entsprechend giftig ist inzwischen der Ton zwischen Bonn, Paris und Washington. Das gibt dem Vorgehen der USA, neuen Dollarkredit als vorrangigen Anspruchstitel auf von Rußland verdiente Devisen anzumelden, seine besondere Brisanz. Immerhin nimmt die Weltmacht damit Abstand von einer Geschäftsgepflogenheit, mit der die konkurrierenden imperialistischen Nationen bislang ihre Konkurrenz einvernehmlich abgesichert haben. Die Rücksicht auf den weltweit zirkulierenden Kredit, seine Behandlung als gemeinschaftliches Sorgeobjekt, wird gekündigt. Stattdessen meldet eine Gläubigernation den gar nicht bescheidenen Anspruch an, daß ihr Kredit ein exklusives Zugriffsrecht auf die Bilanzen und Wirtschaftspolitik des Schuldners beinhaltet.
Wenn zwei Atommächte aus der Abwicklung des Weizenexports heraus kurzerhand beschließen, ein Funktionsprinzip des IWF außer Kraft zu setzen, dann ist es auch von dieser Affäre her nicht mehr weit zu den aufgeregten Diskussionen um die Zukunft des Welthandels.
2. Kampf dem „Protektionismus“
Wenn die USA die Abhängigkeit dritter Staaten für ihre Bilanzen einspannen, sehen sich die anderen Weltwirtschaftsmächte gerade jetzt besonders betroffen. Schließlich haben ja alle die Handelsbilanz als ihr Kampfmittel entdeckt und wollen gegeneinander die Welt als vorrangige Domäne ihres „guten“ Geldes sichern. Deswegen sehen sie jedes Geschäft, das die USA mit Dritten tätigen, als eines an, das gegen sie gerichtet ist, ihnen Macht- und Geldquellen bestreitet bzw. vorenthält. Verhindern können sie Sonderverträge der USA mit Rußland, Saudi Arabien usf. nicht; also zetern sie und halten auf anderen Feldern dagegen. So werden die USA andauernd aufs Neue darauf gestoßen, daß ihr Standpunkt, sich ihren „rechtmäßigen Anteil“ am Weltmarkt sichern zu wollen, nicht nur nicht anerkannt ist, sondern daß die Konkurrenz die Sache genau umgekehrt sieht: Wenn die USA ihre besondere Machtstellung ins Spiel bringen, um Konkurrenzergebnisse umzukehren, dann sind sie es, die gegen den „freien Welthandel“ verstoßen, dessen offensiver Propagandist sie einst waren.
Ganz in dieser Logik hat sich Clinton mit seiner Ankündigung, er werde „im Bereich der Außenpolitik mehr Gewicht auf wirtschaftliche Aspekte legen“, in den europäischen Chefetagen den Ruf eingehandelt, einen „Rückfall in den Protektionismus“ einleiten zu wollen. Dabei hat Clinton bloß versprochen, diesen Vorwurf verschärft zurückzugeben. Er kämpft nämlich gegen den Protektionismus, natürlich den in Europa und Japan.
Seit die Monopolstellung amerikanischer Multis und amerikanischen Geldes ins Wanken kam, beschweren sich die USA über Verstöße der Konkurrenz gegen die Regeln des „fair play“ in Handelsfragen. Ihre Frage: „Wie konnte es dazu kommen?“ beantworteten sie zielsicher so, daß Europa und Japan unerlaubterweise ihren Staatshaushalt für gegen die USA gerichtete Konkurrenzprojekte instrumentalisiert hätten, statt „dem Weltmarkt“ freien Lauf zu lassen. Im Streit über die Airbus-Subventionen etwa beschwerten sich die USA darüber, daß Europa das US-Monopol im zivilen Flugzeugbau mit Staatsgeldern brechen will, und verlangten nach „fairer Konkurrenz“. Die europäischen Regierungen konterten, daß Boeing über finanzielle und technologische Potenzen für den Bau ziviler Flugzeuge ja auch nur aufgrund seiner Funktion als quasi Staats-, nämlich Rüstungsbetrieb verfüge. Dieser Anwurf erschien den USA ganz abwegig. Sie sahen die Sache so, daß es ganz der privaten Leistungsfähigkeit von Boeing geschuldet ist, wenn die Firma es schafft, aus Rüstung zivile Erträge herauszuholen. Das hielten sie für absolut unvergleichbar mit der ausdrücklichen Absicht der Konkurrenz, Industrien auf Staatskosten zum Kampf gegen die US-Vormachtstellung auszurüsten; letzteres galt ihnen als Verfälschung der „wirklichen“, „echten“ Konkurrenzlage zwischen den Nationen.
Der Airbus-Streit und der dazugehörige Kampf um die Marktanteile am Luftverkehr hat seine Konjunkturen; ebenso die Klärung anderer Rechtsfragen der Konkurrenz, zu denen immer wieder die Landwirtschaft in ihrer Eigenschaft als nationaler Bilanzposten gehört. Darüber hat sich der Tonfall der US-Politik in letzter Zeit verschärft:
„Wir wissen aus unserer Erfahrung mit militärischer Sicherheit, daß der Schlüssel zu wirtschaftlicher Sicherheit auf ‚Frieden durch Stärke‘ basieren muß, nicht auf einseitiger Abrüstung. Aus diesem Grund habe ich unlängst die größte jemals durch das Exportförderungsprogramm vergebene Menge Weizen bekanntgegeben – nahezu 30 Mill. Tonnen an 28 Käufer.“ (Bush, Programm für die Erneuerung Amerikas, AD 16.9.92)
Diese Maßnahme der US-Regierung verstand sich als Reaktion auf die Weigerung Europas, im Streit um Marktöffnung und Subventionskürzungen bei Agrarexporten im GATT dem US-amerikanischen Standpunkt weiter entgegenzukommen. Indem die USA ihren Bauern Kampfpreise für lohnenden Export finanzieren, bestreiten sie der EG Exporterträge; darüber hinaus stellen sie klar, daß sie es nicht kampflos hinnehmen, daß die EG sich nicht auf ihre Forderungen in Welthandelsfragen einlassen will. Die Subventionierung amerikanischer Exporterträge soll die EG zu der Einsicht erpressen, daß sie es sich nicht leisten kann, sich den US-Forderungen zu widersetzen, weil diese es in der Hand haben, sie empfindlich zu schädigen. Diese Botschaft ist bei der EG angekommen und wurde entsprechend kommentiert. Europa hat nämlich auf diesem Markt einiges zu verlieren und sieht deshalb keinen Grund, sich dem US-Ansinnen einfach zu beugen. Im Gegenteil:
„Die EG-Kommission sprach in einer Stellungnahme von ‚einem kriegerischen Zustand, der fruchtbaren Beziehungen zwischen der EG und den USA nicht gerade zuträglich ist.‘“ (SZ 4.9.92)
Inzwischen ist der „Handelskrieg“ in die nächste Runde gegangen. Die Europäer verweigern – trotz anderslautender Entscheidung des GATT – weitere Zugeständnisse bei der Kürzung von Subventionen bei Ölsaaten. Die USA sehen darin eine Verletzung der „Regeln des freien Welthandels durch die EG“ und sehen sich deshalb berechtigt, ihrer ersten Erpressung eine zweite hinterherzuschicken: Sie beschließen vorsorglich Strafzölle auf europäische Agrarimporte.
Diese Offensive der USA ist der Test darauf, wie einig, wie geschlossen Europa als Weltmarktblock schon ist; wie sehr die verschiedenen europäischen Nationen noch ihr besonderes Geschäftsinteresse, wie sehr sie schon das Gemeinsame der neuen, aber eben noch nicht existenten Großmacht im Auge haben. Die USA machen sich zunutze, daß Europa die politische Wucht noch nicht ist und hat, die es mit der Fertigstellung seiner Union anstrebt; sie probieren aus, ob sich dieser Umstand nicht in der gegenwärtigen Lage, wo alle auf ihre Bilanzen schauen müssen, für die alte Großmacht ausnutzen läßt. Ein Stück weit geht diese Rechnung ja auch auf. Es kommt zu „Krisensitzungen“, die „in letzter Minute“ das neue GATT-Abkommen noch retten sollen. Europäische Politiker beschimpfen sich wechselseitig, das Ergebnis „torpediert“ zu haben. Und die Presse wundert sich, wie „man“ denn so unvernünftig sein könne, wegen ein paar Millionen Exporterträgen den ganzen „freien Welthandel“ zu gefährden, und bezichtigt die deutsche Politik der Unterwürfigkeit gegenüber französischer Intransigenz. Dabei sind schon die aufgeworfenen Streitfälle nicht mit dem Argument zu erledigen, es ginge bloß um „Minisummen“; am Agrarexport der Franzosen entscheidet sich die Funktionsfähigkeit ganzer Regionen in dieser Nation, weswegen sie gar nicht umhin kann, die prinzipielle Bedeutung der so bescheiden aussehenden Prozente in ihrem Außenhandel herauszustreichen. Nun könnten natürlich trotzdem die Unterhändler aller Seiten ihre angeblich längst vollzogene Einigung in 999 anderen Handelsfragen absegnen und die Frage der Ölsaatensubvention dann eben offen lassen. Alle Beteiligten reden am Fall der „Ölsaaten“ aber gar nicht mehr bloß darüber, welche neuen Geschäftsmöglichkeiten sich die Nationen wechselseitig im Austausch für Zugeständnisse auf anderen Feldern abhandeln lassen. Thema der Verhandlungen ist schon längst, welchen Nutzen die Weltwirtschaftsmächte überhaupt noch darin erkennen können, sich gemeinsam auf Regelungen ihrer Konkurrenz zu einigen; Zugeständnisse und „Hart-Bleiben“ stehen für den Grad an prinzipieller Kompromißbereitschaft, den sie in der gegenwärtigen Lage der Weltwirtschaft noch geboten sehen. Insofern trifft die Rede von der „Gefährdung des Welthandels“ die Lage durchaus. „Den Welthandel“ gibt es eben nicht anders denn als Konkurrenz seiner politischen Aufsichtsmächte um ihn, also um den Ertrag, den sich die Nationen aus dem grenzübergreifenden Geschäftsleben sichern wollen. Der Antrag wohlmeinender Beobachter, gerade jetzt, wo „die Weltkonjunktur“ so flau wird, müßten die Mächtigen doch erst recht gemeinsam für „freien Handel“ sorgen wollen, geht deshalb ziemlich an der Sache vorbei: Die Nationen geraten ja gerade deshalb aneinander, weil die Erträge fraglich werden.
Die USA stellen mit ihrer Offensive klar, wie ihr Interesse an Einrichtungen wie dem GATT beschaffen ist. Deren Regelungen gehen in Ordnung, wenn sie das amerikanische Interesse zufriedenstellen; wenn nicht, behalten die USA es sich vor, sich ihren Zugriff auf den Weltmarkt mit eigenen Mitteln zu sichern. Die USA haben das GATT überhaupt bloß zur Durchsetzung der Freiheit des US-Kapitals erfunden; inzwischen allerdings zeigt es sich als getreues Abbild der konkurrierenden Interessen, die in ihm das Sagen haben. Das wollen die USA nicht dulden. Also geben sie bekannt, daß sie sich neue Hebel suchen werden, um ihr Interesse durchzusetzen, wenn und sofern die alten nicht mehr taugen: Sie können keinen Sinn in einer weltwirtschaftlichen Regelungsinstanz entdecken, die in den Worten von Clinton „unsere Interessen untergräbt, statt sie zu stärken“. Das ist die Drohung damit, die USA könnten in Zukunft darauf verzichten, sich überhaupt noch mit der Konkurrenz ins Benehmen zu setzen, wenn diese sich weiter intransigent zeigt.
Wie solche Affären auch immer ausgehen mögen: Für die Umkehrung der Verteilung von Nutzen und Schaden, die die USA bezwecken, richten sie immer nur bedingt etwas aus. Die USA verfügen über kein Mittel, die Weltmarktkonkurrenz für sich zu entscheiden: Sie können nicht mehr auf Abhängigkeiten pochen, ohne ihre eigene vorgeführt zu bekommen. Was immer an neuen Absprachen zwischen den Konkurrenten in den letzten Jahren zustandegekommen ist: Immer durften die USA unterm Strich bilanzieren, daß sie, daß ihre Bilanzen den Kürzeren gezogen haben. Keine von den USA durchgesetzte „Marktöffnung“ anderswo hat garantieren können, daß auf diese Weise beförderte Geschäfte vorwiegend den US-Bilanzen nützen. Das beste Beispiel dafür ist der US-Handel mit Japan: Die USA verpflichten Japan auf immer neue Zugeständnisse in Im- und Exportfragen, und der Bilanz-Überschuß Japans gegenüber den USA nimmt ständig zu.
Jetzt zieht die US-Politik aus 10 Jahren „Kampf gegen den Protektionismus“ ihre Konsequenzen. Die heißen: Die USA müssen zu Maßnahmen greifen, mit denen sich der Nutzen der Nation aus dem Weltmarkt dauerhaft gegen die Konkurrenz sichern läßt. Das Ideal kommt auf, daß die Politik für ein Monopol auf Geschäftsgelegenheiten sorgen müsse, das gewährleisten kann, daß in den USA produzierendes Kapital neu auf den gesamten Weltmarkt zugreifen kann.
3. Die neue Offensive: „Sicherung von Märkten“
Dazu ist den USA ein
3.1. „System bilateraler Handelsverträge“
eingefallen. Mit dem sollen dem US-amerikanischen Export von Waren und Kapital lauter Exklusivrechte bei anderen Staaten gesichert werden. Die US-Politik nimmt sich vor, ein
„…strategisches Netz von Freihandelsabkommen über den Pazifik und Atlantik hinweg sowie in unserer Hemisphäre in die Wege (zu) leiten. Dieses Netz wird in krassem Gegensatz zu den rückständigen Blöcken der wirtschaftlichen Isolierung stehen. Wenn wir wirklich eine Exportsupermacht sein wollen, können wir uns nicht nur auf eine Region beschränken… (wir wollen) unseren attraktiven Binnenmarkt (i.e.: NAFTA; vgl. Punkt 3.2.) als Grundlage einer kraftvollen Freihandelspolitik einsetzen, die den wirtschaftlichen Aktionsradius Amerikas weltweit stärken und unsere weltweite militärische Präsenz ergänzen wird. Indem wir uns auf die Öffnung von Märkten konzentrieren, können wir die strukturellen Hindernisse für den Wettbewerb in Nordamerika, Westeuropa, Japan und andernorts abbauen… Neue Handels- und Wirtschaftschancen in Lateinamerika … Freihandelsabkommen mit Polen, Ungarn, Tschechei … Verbindung NAFTA – Asean…“ (AD 16.9.)
Diese „Freihandelspolitik“ unterscheidet sich ziemlich grundlegend von dem, was bislang darunter verstanden wurde: Die USA propagieren hier nicht mehr allgemeine, für alle Staaten gültige Regeln des Welthandels, unter deren Herrschaft das US-Kapital freien Zugriff auf alle Märkte der Welt haben soll, sondern melden gerade umgekehrt ihr Recht auf lauter Sonderkonditionen an. Die „rückständigen Blöcke“ haben sich offenbar weniger „wirtschaftlich isoliert“ als sich überall auf der Welt so eingemischt, daß daraus lauter Vorteile für deren Bilanzen herauskommen. Dagegen wollen die USA so vorgehen, daß sie mit politischen Sonderregelungen die Nationalisierung von Weltmarkterträgen erzwingen. So geben sie offiziell zu Protokoll, was sie in den GATT-Verhandlungen praktizieren: Ein „freier Welthandel“, der keine US-Überschüsse abwirft, ist keiner. Also führen die USA neue Regeln dafür ein, was ab sofort für sie als solcher zählt:
„Auf internationaler Ebene werden wir freien Handel und offene Märkte an allen Fronten fördern – global, regional, und bilateral. Wenn einige Nein sagen, werden wir uns diejenigen aussuchen, die sich unsere Vision stärkeren Handels und besseren Wachstums zueigen machen.“ (US-Staatssekretär Zoellick vor der ASEAN in Manila 24.7.92, nach AD 29.7.)
Dieses Programm ist der Widerspruch, mehr vom Weltmarkt, vom internationalen Hin und Her von Waren und Kapital haben zu wollen, indem man ihn aufkündigt. Die US-amerikanische Liste von Nationen und Gegenden, die für „bilaterale Verträge“ ausersehen sind, kommt einerseits wieder ganz global daher: So bescheiden sind die USA nicht, daß sie sich irgendwelche Eckchen aus dem Weltmarkt herausschneiden und dort ihre exklusiven Geschäfte abwickeln wollten. Andererseits soll die Frage, welche Nation vom allseitigen Geschäft am Ende profitiert, möglichst schon vorweg entschieden sein; Kriterium des Kaufens, Verkaufens, sich Anlegens soll das Sonderinteresse der USA sein. Die USA wollen weder sich noch ihren neuen Exklusivpartnern irgendein Geschäft mit den anderen Weltwirtschaftsmächten von vornherein verbieten; zugleich wollen sie mittels ausgehandelter Exklusivrechte die Erträge des Geschäfts auf die US-amerikanischen Bilanzen „lenken“. So drückt sich das nationale Bedürfnis aus, quasi vorweg auseinanderzusortieren, welcher Import und Export von Waren oder Kapital mehr den USA und ihrem Geld, welcher mehr dem ihrer Partner und/oder Konkurrenten nützt. Dieser Standpunkt, einmal aufgemacht, bringt einiges im internationalen Geschäftsleben durcheinander.
Wie die USA sich die Verwirklichung dieses Ideals monopolisierter US-amerikanischer Zugriffsrechte vorstellen, zeigt die Freihandelszone, die kürzlich in Nordamerika gegründet wurde. Das „North American Free Trade Agreement“
3.2. NAFTA
wurde vom letzten Präsidenten als das Projekt zur Wiedergewinnung amerikanischer Stärke propagiert:
„Mein Gegner behauptet, Amerika sei eine Nation im Niedergang. Von unserer Wirtschaft sagt er, wir seien irgendwo auf der Liste zwischen Deutschland und Sri Lanka. Lassen Sie sich von niemandem erzählen, Amerika sei zweitklassig…Vielleicht hat er nicht gehört, daß wir immer noch die größte Volkswirtschaft der Welt sind… Erst vor zwei Wochen haben sich die drei Nationen Nordamerikas auf den freien Handel von Manitoba bis Mexiko verständigt.“ (Bush, Rede vor der convention)
Dieses Lob auf die Leistungsfähigkeit der USA ist einigermaßen verräterisch. Diese „größte Volkswirtschaft der Welt“ kann sich nämlich auf die schiere Masse ihres Reichtums als sicheres Konkurrenzmittel offenbar gar nicht mehr verlassen; sonst wäre den USA ein Konstrukt wie NAFTA nämlich nie eingefallen. Und daß sich von Manitoba bis Mexiko jetzt der „größte Markt der Welt“ zusammenaddiert, kann auch nicht so ganz darüber hinwegtäuschen, daß sich hier Nationen zusammenfinden, deren ökonomische Potenzen ein wenig unvergleichlich sind.
Die NAFTA verstehen die USA durchaus als „Antwort“ auf die EG; mit der hat sie allerdings nicht viel gemein. Erstens schafft die NAFTA weder eine „Zollunion“ noch einen „Binnenmarkt“, sondern ist ein Freihandelsvertrag, in dem die schon bestehende Freihandelszone zwischen den USA und Kanada um Mexiko erweitert wird. Zweitens tun sich hier nicht vergleichbare kapitalistische Nationen zusammen, um durch Bündelung ihrer Potenzen gemeinsam auf dem Weltmarkt mehr zu putzen; sondern eine dominierende kapitalistische Macht subsumiert sich die Ökonomien ihrer Anrainerstaaten, um damit ihre ökonomische Wucht zu vergrößern. Die USA halten es offenbar für notwendig, die ökonomische Anbindung von Kanada und Mexiko an das Geschäft des US-Kapitals, die längst besteht, in den neuerdings gerechtfertigten Protektionismus der USA fest einzubinden und politisch abzusichern. Von vornherein steht fest, wem durch diesen Vertrag neue Erträge zufließen sollen, und von „wechselseitigem Nutzen“ kann keine Rede sein. Das macht die Eigentümlichkeit dieses Projektes aus.
Der Hauptinhalt von NAFTA besteht in umfassenden Zollsenkungen. Allerdings nicht so, daß alle Beteiligten im Gleichschritt und Gleichmaß ihre Zölle gegeneinander abbauen; vielmehr ist minutiös und für jeden einzelnen nationalen Zoll verschieden geregelt, wann er in welchem Umfang zu fallen hat. Die ersten, umfassenden Zollsenkungen betreffen hauptsächlich mexikanische Zölle auf US-amerikanische Fertig- und high-tech-Waren bzw. auf Autos; dagegen bleiben weite Teile der US-Agrarwirtschaft bis zum Abschluß der Zollsenkungen in 15 Jahren vor mexikanischen Importen geschützt. Die gleiche „Einseitigkeit“ betrifft die Regelungen zur Liberalisierung des Kapitalverkehrs: Die betreffen de facto nur die mexikanische Industrie.
Für Mexiko vollendet NAFTA das nationale Projekt, das dort ohnehin im Gange ist. Mexiko hat in den letzten Jahren in einer gigantischen „Privatisierungswelle“ die nationale Kontrolle über die heimische Industrie aufgegeben und sich darein gefunden, sein Heil in der Unterwerfung unter die Kalkulationen des international agierenden Kapitals zu suchen. Die „Liberalisierung von Investitionen“ durch NAFTA kündigt endgültig den Standpunkt, Firmenübernahmen durch ausländisches Kapital beschränken zu wollen, um den „Ausverkauf“ nationaler Geldquellen zu verhindern. Und die Zollsenkungen beseitigen den vorher gültigen Gesichtspunkt Mexikos, Zölle als Mittel zum Schutz einheimischen Produzierens wirken zu lassen.
Das „Wie“ dieser „Marktöffnung“ ist allerdings schon der Witz. Schließlich beseitigt Mexiko ja Zölle exklusiv für US-Waren und schafft exklusiv für US-Kapital besondere Zugriffsrechte auf sein nationales Kapital, vor allem im Erdöl-Bereich. Die „Liberalisierung“ ist also eine, die zugleich dem US-Kapital ein Vorkaufsrecht in allen Abteilungen des neuen, „privaten“ mexikanischen Geschäftslebens sichert. Schon jetzt bezieht Mexiko einen wesentlichen Teil seiner Importe aus den USA; US-amerikanisches Kapital hat sich in privatisierte Betriebe eingekauft; und in den „Maquiladoras“ entlang der mexikanischen Grenze nutzen US-amerikanische Firmen schon das Billigangebot mexikanischer Löhne und nicht vorhandener Umweltauflagen zur Auslagerung von Teilfertigungen, deren Produkte zollfrei in die USA reimportiert werden dürfen. Die NAFTA vollendet die Subsumtion der mexikanischen Ökonomie unter das Interesse der USA; und Mexiko setzt darauf, daß darüber auch ein besonderes Interesse US-amerikanischen Kapitals in die Wege geleitet wird, sich am Geschäft in Mexiko zu beteiligen.
Die USA wollen mit der NAFTA jedes nur denkbare Geschäft, das in und mit diesem Territorium läuft, zum Mittel der US-Bilanz machen. Nach den Worten seines Haupt-Protagonisten soll die NAFTA sowohl den USA „einen wichtigen Markt öffnen, eine mexikanische Volkswirtschaft, deren Wachstumsaussichten, seine expandierenden Industrien und seine Verbraucher rasch zu hervorragenden amerikanischen Kunden machen wird…“, als auch „durch Integration der amerikanischen, mexikanischen und kanadischen Fähigkeiten unsere globale Wettbewerbsfähigkeit stärken, indem sie es amerikanischen Firmen erlaubt, Zulieferleistungen zu geringeren Kosten zu erwerben.“ (Bush, Programm f.d. Erneuerung…)
Sicher nimmt das US-Kapital die Gelegenheiten gerne mit, die ihm die Politik mit einer exklusiven Realisierungssphäre bereitstellt. Wesentlicher wird aber für US-amerikanische Firmen wohl die Perspektive zu Buche schlagen, daß sie künftig das Territorium Mexikos als Mittel der Billigproduktion und als Bezugsquelle von Billiglieferungen noch extensiver nutzen können sollen. Das werden dann wohl auch die „Wachstumsaussichten“ sein, die sich diesem „hervorragenden Kunden“ bieten. An eine Aufpäppelung Mexikos aus dem Status eines Drittweltstaates heraus ist ja nicht gedacht, und Fragen der nationalen Abrechnung des „Freihandels“ fallen von vornherein aus der Zuständigkeit von NAFTA heraus.
Mit der NAFTA stellt sich die US-Politik auf den Standpunkt, daß ein „größerer Markt“ auf jeden Fall die Verbesserung der Konkurrenzfähigkeit des US-Kapitals leisten soll. Zugleich legt die US-Politik Wert auf den Standpunkt, daß darüber bestehendes US-Kapital nicht geschädigt werden soll. Letzteres wird besonders deutlich in den Vorschriften für „local content“, die sich im NAFTA-Vertrag finden. Diese Vorschriften betreffen die Bedingungen der Produktion und des Imports von Autos fremder (japanischer) Firmen: Diese müssen sich, wenn sie Produktionsstätten in den USA (ab 1994: Im NAFTA-Gebiet) errichten wollen, verpflichten, bis zu 65% des Autowerts von US-amerikanischen Zulieferern zu beziehen; und nur Autos mit einem entsprechenden US-amerikanischen Anteil dürfen zollfrei aus Kanada bzw. Mexiko in die USA importiert werden. Die US-Politik sieht die Sache mit der Internationalisierung des Kapitals offenbar so: Kapitalanlage von auswärts ist recht, sofern sie die nationalen Wachstumspotenzen stärkt; aber schlecht, sofern sie Importe aus dem Herkunftsland der jeweiligen Firma nach sich zieht. Das verschlechtert die nationale Bilanz bzw. schädigt US-amerikanischen Zulieferern das Geschäft; diesen soll sich vielmehr mit der neuen Kapitalanlage eine neue Geschäftssphäre eröffnen, mit der sie ihrerseits zum nationalen Wachstum beitragen können.
Das ist weder freihändlerisch noch exportfördernd gedacht. Die Politik sichert in USA produzierendem Kapital den heimischen Markt, indem sie den Kostenvergleich verbietet und die Käufer auf den Ort der Produktion gegen die Kalkulation mit Qualität und Preis verpflichtet. Die USA setzen auf das Interesse fremden Kapitals, sich am US-Markt zu bereichern, und zwingen es zugleich zu einer Kostenkalkulation im US-nationalen Interesse. Damit mag die Politik zusätzliche Importe verhindern; zusätzlichen Export fördert sie dadurch nicht gerade. Die Sicherstellung von viel Geschäft unter US-amerikanischer Fuchtel ist nun einmal nicht dasselbe wie die Beförderung eines Kapitalwachstums, das im Weltmaßstab konkurrenzfähig ist.
In der Frage, ob Importe eher unter dem Gesichtspunkt zu betrachten sind, daß sie dem Kapital Kosten senken, oder unter dem, daß sie heimischem Geschäft den Markt kaputtmachen, schlagen sich die USA auf die zweite Seite. Mit dem modernen Autarkiegedanken des „local content“ bestehen sie darauf, ihren inneren Markt auf jeden Fall als nationales Konkurrenzmittel zu sichern. Den „globalen Wettbewerb“ nehmen die USA nicht so auf, daß sie das daheim produzierende Kapital zwingen, sich im Interesse der Verbesserung nationaler Konkurrenzfähigkeit dem Kostenvergleich im Weltmaßstab zu stellen. Die US-Politik setzt vielmehr weiterhin darauf, daß die schiere Größe des US-Marktes ein Konkurrenzmittel ist, und die Erhaltung vorhandener Produktion gegen die Konkurrenz von außen erscheint ihr ebenso als Mittel, neue Märkte zu gewinnen, wie die Beförderung neuen Kapitalwachstums.
Mit der NAFTA nehmen die USA einen Teil des Weltmarkts unter die eigene, exklusive Fuchtel, um dort die „globale Wettbewerbsfähigkeit“ herzustellen, die ihnen das freie Hin und Her von Waren und Kapital immerzu bestreitet. Gegen den Weltmarkt soll die Verfügung aller Momente lohnenden Geschäfts auf ihm herbeigezwungen werden; gegen die Konkurrenz sollen den USA besondere Konkurrenzbedingungen gesichert sein. Die Doktrin des „offenen Welthandels“ ist damit beendet, so sehr die USA ihre neuen Projekte auch noch in den Kategorien des „alten“ verkaufen mögen.
4. Innenpolitische Aufrüstung
Von diesem Standpunkt aus richtet die US-Politik den Blick neu auf das Treiben des Kapitals, das sich unter ihrer Hoheit abspielt. Mit dem ist die Politik in hohem Grade unzufrieden: Für das nationale Ziel, Exporte zu steigern und den Dollar zu stärken, leistet es einfach zu wenig. Für diesen Umstand hat die US-Politik eine doppelte Begründung: Erstens hat die Politik das Kapital nicht genügend darin unterstützt, diesen nationalen Auftrag zu erfüllen. Und zweitens ist das Kapital selbst zu wenig national, fühlt sich diesem Auftrag nicht genügend verpflichtet oder arbeitet ihm sogar entgegen.
4.1. „Investitionsförderung“
soll die neue, erste Priorität der US-Politik werden. Die neue Regierung verkündet, ab sofort nicht mehr aufs Defizit starren zu wollen wie das Kaninchen auf die Schlange, sondern den Staatskredit als Hebel für „jobs“, „Märkte“ und „Konkurrenzfähigkeit“ zum Einsatz zu bringen:
„Wir haben in der Vergangenheit die Einsparungen im Verteidigungshaushalt verwendet, um sie für die steigenden Kosten im Gesundheitswesen und die Sanierung von Sparbanken auszugeben. Wir schlagen vor, diese Einsparungen einzusetzen, um in amerikanische Arbeitsplätze, in das Verkehrswesen, den Kommunikationsbereich sowie die neuen Technologien des 21. Jahrhunderts zu investieren.“ (Clinton)
Der neue Präsident hat sich viel vorgenommen. Die alten Aufgaben sind ja nicht einfach hinfällig, wenn er antritt und beschließt, das Geld für neue Staatsprojekte zu verwenden. Dafür will er einen extra „Investitionsfonds“ einrichten, in den alle Einsparungen aus dem Militär eingewiesen und als quasi Separathaushalt nur für „Investitionsförderung“ verausgabt werden sollen. Schon geht die nationale Debatte um die Kriterien los, unter denen dieses neue amerikanische „Staatsziel“ in Angriff genommen werden soll:
„Einige Berater Clintons bevorzugen eine ‚strategische‘ Handelspolitik, wo Washington die Japaner imitiert, indem es Schlüsselindustrien daheim aufbaut und schützt. Andere wollen bloß eine kooperativere, zivile Beziehung zwischen der Regierung und der Wirtschaft.“ (Newsweek 16.11.92)
Der neuen Regierung fällt auf, daß ihr Instrumente und Einrichtungen fehlen, um ihr Projekt „Aufmöbelung der US-Wirtschaft“ in die Tat umzusetzen. In diesem Sinne hat der neue Präsident angekündigt, er werde gleich zu Beginn seiner Amtszeit einen „Wirtschaftlichen Sicherheitsrat, ähnlich dem Nationalen Sicherheitsrat“ einberufen, der die neue politische Linie in ökonomischen Fragen erarbeiten soll.
Das Projekt ist bitter ernst gemeint. Ideell jedenfalls schreiben Clinton und Co. den Staatskredit für Rüstung, mit dem die US-Regierung jahrelang Investitionsförderung, „Hochtechnologie-“, Infrastruktur- und Energiepolitik betrieben, „jobs“ geschaffen haben, schon einmal als gigantische nationale Fehlinvestition ab. Jetzt soll das Investieren auf Staatskredit neu losgehen: Mit Projekten, die offensiv darauf zielen, dem US-Kapital neue Weltmarktanteile zu erobern. Mitten in der Krise stellen sich die USA auf den Standpunkt, daß sie es sich leisten können und wollen, dem heimischen Kapital bessere Geschäftsbedingungen zu verschaffen, mit denen es dem Geschäft der Konkurrenz auf „deren“ Märkten Paroli bieten soll. Sie beschließen, offensiv auszutesten, was sich mit US-Kredit nicht noch alles auf die Beine stellen läßt – und das in einer Lage, in der auch der Kredit der anderen in Schwierigkeiten kommt.
Die Kriterien, nach denen die private Geschäftstätigkeit für das nationale Ziel „Konkurrenzfähigkeit“ befördert werden soll, werden sich dann finden. Klargestellt ist aber schon, daß die Politik es dem privaten Geschäftskalkül nicht mehr einfach überlassen will, wie es sich für die Nation nützlich macht. Die Politik sinnt auf Methoden, den nationalen Gesichtspunkt im Geschäftskalkül der Privaten zu verankern: Die Begünstigungen, auf die das Kapital seitens des Staates hoffen darf, sollen ihm zugleich die Verpflichtung aufmachen, das staatliche Interesse am Ertrag des Geschäfts zu bedienen. So sollen Unternehmen in Zukunft „tax credits“ eingeräumt bekommen, wenn sie investieren; gleichzeitig sollen die Steuern für „höchste Einkommen“ erhöht werden. Die von Reagan eingeführte Linie, die Wirtschaft dadurch zum Wachstum zu „ermuntern“, daß kapitalkräftigen Bürgern einfach weniger Steuern abgeknöpft, mehr Erträge zur freien Verfügung gelassen wurden, ist damit passè. Der US-Staat will nicht mehr einfach darauf setzen, daß das private Kalkül mit Gelegenheiten zum Geldverdienen ganz automatisch der Nation dient; es sollen schon Investitionen, Geldanlage zwecks produktiver Verwendung sein, die das Recht auf staatliche Vorzugsbehandlung begründen.
Über solche „incentives“ hinaus besteht die neue amerikanische Wirtschaftspolitik bislang noch im wesentlichen im Wälzen der Frage: Wie machen es denn die anderen? Getreu der Logik, nach der die miese Lage der US-Wirtschaft sich Versäumnissen amerikanischer Wirtschaftspolitik verdanke, sieht sich die neue US-Regierung ganz undogmatisch bei der Konkurrenz nach „Konzepten“ für die geplante Aufmöbelung der USA um. Ein europäischer Kommentator bemerkt spöttisch:
„Clinton nimmt seine Gesundheitspolitik aus Deutschland, seine Ausbildungsförderungsprogramme aus Schweden, seine Berufsbildungskonzepte abermals aus Deutschland, und sein Konzept einer strategischen Rolle der Regierung für die Wirtschaft teilweise von der französischen Planification und eher mehr von Japans MITI. Aber seine Welfare-Politik, seine Verpflichtung auf law ’n order und der ökonomische Nationalismus, der er im Wahlkampf propagierte, hätten fast genauso vom rechten Ideologen Pat Buchanan kommen können.“ (Guardian Weekly 15.11.92)
Das ist eben überhaupt kein Gegensatz, weil alle Abteilungen der Wirtschafts- und Sozialpolitik dem selben Zweck dienen. America soll wieder groß und mächtig werden; und „Arbeitsbeschaffungsprogramme“, neue Methoden der „Bekämpfung der Kosten im Gesundheitswesen“ und „Schutzmaßnahmen gegen die japanischen Konkurrenz“ sind mit Projekten zur Durchfütterung armer Leute nicht zu verwechseln. Der Erfolg, so er sich einstellt, wird sich wieder an Unternehmensgewinnen, Bilanzüberschüssen und Dollarkursen messen und nicht an der Verbesserung von Armutsstatistiken.
4.2. „Economic nationalism“
Der Standpunkt der „Investitionsförderung“ will nicht einfach dem Wachstum von Unternehmensgewinnen auf die Beine helfen, sondern will die Erträge dieses Wachstums auf die US-Bilanzen „lenken“. Also erntet das gleiche kapitalistische Geschäft, das unter dem Gesichtspunkt mangelnder Fähigkeit zum Dienst an der nationalen Bilanz gefördert werden soll, unter dem Gesichtspunkt mangelnden Willens zu diesem Dienst herbe Kritik. Z.B. hat der neue Präsident angekündigt, den NAFTA-Vertrag noch einmal unter dem Gesichtspunkt prüfen zu wollen, ob er nicht zuviele „jobs“ in den USA gefährde. Dabei fielen auch kritische Töne gegenüber den Agenten des Geschäfts, weil sie solche Gelegenheiten nutzen: „Amerikanische Firmen sollen sich wie Amerikaner aufführen und Produkte, nicht jobs exportieren.“ (Clinton)
Was in der Lobrede Bushs auf NAFTA gerade als Beitrag zur Förderung der US-Bilanzen daherkam: US-Kapital soll mexikanische Billiglohnangebote zur Kostensenkung nutzen, kommt hier als deren Beeinträchtigung unter Beschuß. Die Frage steht, ob US-Investitionen in Mexiko als Kapitalexport unterm Strich den US-Reichtum vermehren oder ihm als Kapitalflucht schaden. Diese Frage ist natürlich unbeantwortbar: Weil das Kapital sich freigemacht hat von nationalen Bindungen, als Multi die Nationen samt ihren Völkern, Ressourcen, Märkten, Steuersystemen als „Standorte“ fürs Gewinnemachen benutzt und sowohl Kapital („jobs“ in der Redeweise von Clinton) als auch Waren ständig über alle Grenzen im- und exportiert, ist es dem einzelnen Waren- oder Kapitalexport nie mehr anzusehen, welcher nationalen Bilanz es unterm Strich am meisten dient. Daß diese Frage in den USA aufkommt, zeigt, daß den USA die Internationalisierung des Kapitals inzwischen im wesentlichen als Schädigung der Nation und nicht mehr wie vordem als Mittel zu ihrer Bereicherung unterkommt. Jetzt zieht die Politik aus dieser Lage den ihr gemäßen Schluß. Der heißt: Wenn die heimische Wirtschaft nicht ihr, der dazugehörigen Staatsgewalt, Reichtum einspielt, dann liegt das daran, daß der Staat es versäumt hat, diesen nationalen Gesichtspunkt gegenüber dem Treiben des Kapitals auf seinem Territorium zur Geltung zu bringen. Nicht nur wurde das „eigene“, „heimische“ Kapital – „Schlüsselindustrien“ nennen das die Industriestrategen – nicht genug gefördert; dem Kapital wurde auch zuviel „Antinationales“ erlaubt, und „fremdes“, ausländisches Kapital konnte sich zuviel Freiheiten herausnehmen. Also stellt sich die US-Politik jetzt auf den Standpunkt, daß sie für die Beförderung der nationalen Erträge wieder schärfer zwischen nationalem und fremdem Geschäft sortieren muß. Getreu dieser Logik kündigt Clinton an, Kapital neu als „amerikanisches“ definieren und es darauf festlegen zu wollen, redlich „im Lande“ für Wachstum zu sorgen und den Weltmarkt mehr für Warenexport zu nutzen. Bei „fremdem“ Kapital dagegen steht weniger „Industrieförderung“ an als die Überprüfung, inwieweit sein Treiben auf US-amerikanischem Boden sich nicht unamerikanischen Motiven verdankt.
Schon unter Bush wurde beschlossen, das Geschäft internationaler Konzerne in den USA stärker zur Finanzierung des Staatshaushalts heranzuziehen. Bei denen wollen US-Politiker nämlich festgestellt haben, daß sie sich antiamerikanischer Steuerhinterziehung schuldig gemacht haben:
„Nach Erklärungen aus dem Clinton-Lager ergibt sich für amerikanische Unternehmen eine Ertragsquote von durchschnittlich 9% gegenüber lediglich 1% bei den in den USA tätigen ausländischen Unternehmen. Dies führt zu der Annahme, daß in erheblichem Umfang über Transferpreise zur Reduzierung der Steuerschuld Gewinne ins Ausland verschoben werden… Offizielles Ziel ist, durch eine Verschärfung der Steuererhebung Mehreinnahmen von 5 Mrd. $ zu erzielen.“ (HB 13.11.92)
Nach einem neuen Steuergesetz soll nach einer „Comparable Profit Interval“-Methode festgelegt werden, was diese Firmen eigentlich als Gewinn hätten ausweisen müssen, um sie auf der Grundlage zu besteuern. Führende japanische Unternehmen haben daraufhin bereits mit der US-Steuerbehörde ein „Advanced Pricing Agreement“ getroffen, mit dem vorweg „Transferpreise“ festgelegt werden, um sich diesem Verdacht und der angedrohten Steuernachzahlung zu entziehen.
Daß man das Ganze auch genau umgekehrt sehen könnte – vielleicht weisen „amerikanische“ Multis ja daheim lieber mehr Gewinne aus als auswärts? – ist den USA bei ihrem Vorgehen natürlich völlig schnuppe. Das Verfahren nimmt seinen Ausgangspunkt an dem prinzipiellen Mißtrauen gegenüber „ausländischer“ Kapitalanlage, diese würde keinen Beitrag zum US-Wirtschaftswachstum leisten, sondern sich nur ungerechtfertigterweise am US-Standort bereichern wollen. Daß auch die USA vom internationalen Kapital unter dem Gesichtspunkt begutachtet werden, welche Standortvorteile, welche Nachteile sie so zu bieten haben, erklären die USA jetzt für einen Standpunkt, den sie nur bedingt dulden wollen.
Grund für ihr Mißtrauen hat die US-Politik schon deshalb, weil sie selbst vom Standpunkt der Standortförderung aus dem internationalisierten Kapital lauter Sonderangebote zur Bereicherung macht. Ein klassisches Beispiel dafür ist die BMW-Ansiedlung in Spartanburg, South Carolina:
„South Carolina erhielt den Zuschlag, weil Bund, Land und Gemeinden alle Register zogen. Sie lasen BMW jeden Wunsch von den Augen ab und mobilisierten Vorleistungen von etwa 200 Mill. $.“ (HB 22.10.92)
Unter anderem für den Ausbau eines Flughafens für Jumbofrachter, für Infrastruktur, für den Aufkauf des geforderten Geländes „aus 140 Einzelgrundstücken mit etwa 100 Eigentümern, deren Häuser abgerissen oder auf Tieflader versetzt werden mußten“, für die Senkung der Grundsteuer auf 20 Jahre, für die Finanzierung der Ausbildung von Facharbeitern in München, usw. usf. Auch die USA haben es eben inzwischen nötig, dem Kapital in Sachen lohnende Anlage Angebote zu machen. Insofern ist es wenig verwunderlich, wenn US-Parlamentarier behaupten, daß 70% der ausländischen Unternehmen in den USA überhaupt keine Steuern bezahlen. So feiert die Politik einerseits die Attraktion fremder Anlage als Mittel, aus Armutsgegenden, wo sonst nichts läuft, wieder nationale Ertragsquellen zu machen; und macht angesichts der Kosten, die die Politik sich dafür aufbürdet, den Verdacht auf, diese Angebote würden in Wirklichkeit gar nicht der Nation, sondern bloß der Profitsucht des Kapitals zugutekommen.
Mit ihrer neuen Steuergesetzgebung, die Clinton sogar noch verschärfen will, haben die USA aus diesem Widerspruch eine Konsequenz gezogen. Sie stellen klar, daß sie in Zukunft vermehrten nationalen Nutzen aus ihrem Standortangebot ziehen wollen. Sie machen den entsprechenden Firmen die Alternative auf, entweder zu zahlen oder dann eben ihre Benutzung des US-amerikanischen Marktes einzustellen; lassen es also darauf ankommen, wie sehr deren Interesse, am US-Markt mitzuverdienen, sie zu entsprechendem „Entgegenkommen“ veranlaßt. Das Vorgehen der japanischen Firmen bestätigt den US-Behörden, daß sie auf der richtigen Linie liegen.
Das Interesse der USA an der Nationalisierung von Weltmarkterträgen macht also auch im Innern neue Gegensätze zum Weltmarkt und damit zu den konkurrierenden Mächten auf:
„Seitens der japanischen Behörden wurde Kritik an dem amerikanischen Vorgehen geäußert und erklärt, man wolle im Verbund mit den Europäern zu einer bedachtsamen Vorgehensweise auffordern… Die Regelung der steuerlichen Behandlung von Transferpreisen könne nicht Sache eines einzelnen Staates sein.“ (HB 13.11.92)
Das mit dem „Können“ stimmt nicht so ganz, weil die USA die Regelung treffen und die Konkurrenz sie nicht verhindern kann, deshalb auch betroffenen Firmen empfiehlt, sich mit den US-Steuerbehörden gütlich zu einigen. Immerhin wird so klar, daß die Botschaft der neuen US-Regierung in den Chefetagen Europas und Japans angekommen ist. Das „American Renewal“ richtet sich gegen sie, auch und gerade dort, wo die US-Politik „daheim“ zur ökonomischen Aufrüstung bläst.
V. Der Ertrag
des US-Projekts ist ungewiß. Erstens, weil Weltwirtschaftskrise ist, und zweitens, weil das Anheizen der Konkurrenz zwischen den Weltwirtschaftsmächten die Frage immer dringlicher auf den Tisch bringt, wer sich von wem noch was gefallen lassen soll. Für die einvernehmliche Regelung der Konkurrenz ist die Grundlage entfallen: Erstens gibt es nur noch Schäden zu verteilen, und zweitens ist der unabweisbare Grund dafür im Hauptfeind entfallen. Damit stehen die Verfahren selbst, also die ganze schöne „Weltwirtschaftsordnung“ zur Disposition, mit der die Weltwirtschaftsnationen bislang ihre konkurrierenden Interessen immer wieder neu vereinbar gemacht und sie dem Rest der Staatenwelt als gemeinsames Interesse aufgezwungen haben:
„Der Sojabohnen-Streit verwandelt sich in einen Test, der die neue Ordnung – oder Unordnung – der nachsowjetischen Welt definieren wird. Es würde ein trauriges Licht auf den Westen werfen, wenn er in eine Spirale zerstörerischen Streitens verfiele, sobald die äußere Bedrohung des Kalten Krieges verschwunden ist.“ (Washington Post)
So kann man es auch sagen, daß es sich bei der Freien Welt weniger um eine „Wertegemeinschaft“ als um imperialistische Staaten handelt, von denen keiner freiwillig auf das Recht der Nation verzichtet, sich seinen nationalen Ertrag aus dem Geschäft des Kapitals zu sichern. Vielleicht war es ja doch die UdSSR, die 45 Jahre lang den Weltfrieden gesichert hat.