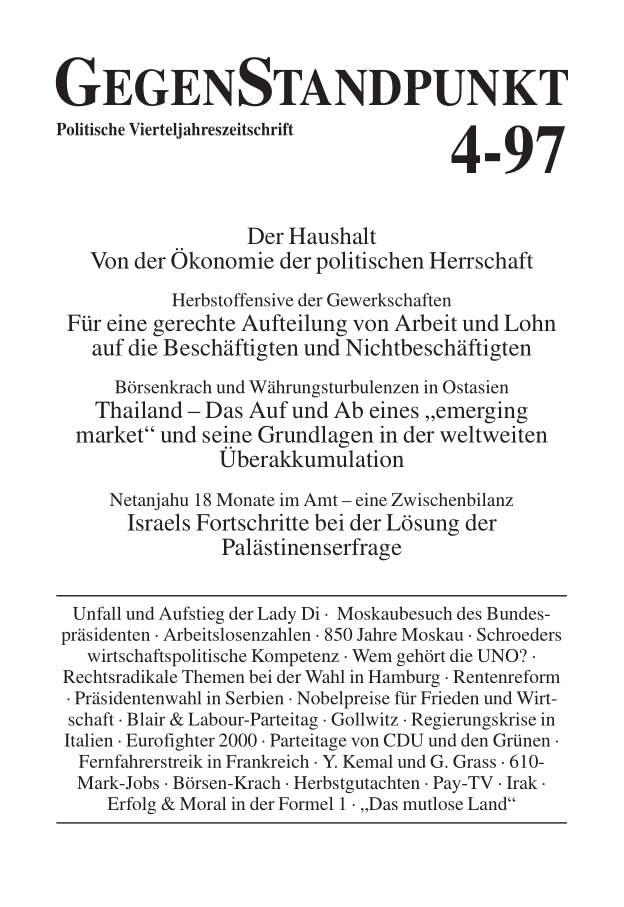Der Staatshaushalt
Von der Ökonomie der politischen Herrschaft
Kein Haushalt wie jeder andere: Von der Steuer und dem politisch garantierten Kreditgeld als Grundlage des Staatshaushalts. Über den Gebrauch von Geld und Kredit durch den „ideellen Gesamtkapitalisten“ zur Beförderung eines kontinuierlichen kapitalistischen Wachstums. Von der Pflege nationalen Wachstums zur Herstellung und Wahrung internationaler Geldmacht.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Siehe auch
Systematischer Katalog
Gliederung
- Kein Haushalt wie jeder andere
- I. Die Grundlage des Staatshaushalts: Das „gesetzliche Zahlungsmittel“ – ein politisch garantiertes Kreditgeld
- II. Zweck und Mittel des Staatshaushalts – oder: Der Gebrauch von Geld und Kredit durch den „ideellen Gesamtkapitalisten“
- III. Der Haushalt: Die staatliche Planung in Nationen, in welchen „Marktwirtschaft“ herrscht
- IV. Das letzte Erfolgskriterium des Haushalts: Stabilität des Geldes
Konkordanz
Teile dieses Artikels sind neu gefasst in:
- Von den vielgepriesenen Leistungen des schnöden Mammons
- Einige Wahrheiten, Ware und Geld betreffend
- Geld – das ‚reale Gemeinwesen‘
- Geld im Systemvergleich
- Das Geld des Staates
Der Staatshaushalt
Von der Ökonomie der politischen Herrschaft
Kein Haushalt wie jeder andere
Wenn im Herbst die Volksvertreter kapitalistischer Nationen den Haushalt diskutieren, geht es zunächst in aller Form um das Verhältnis von Einnahmen und Ausgaben. Der Finanzminister, zuständig für die Verwaltung der Staatskasse, rechtfertigt seine Abrechnung für das abgelaufene Geschäftsjahr und legt dem Parlament die Planung für das nächste zur Billigung vor. Dabei steht eine Prüfung der verfügbaren Geldmittel ebenso an wie der Streit darüber, wofür sie ausgegeben werden sollen. Daß es sich um keinen gewöhnlichen Haushalt dreht, wie er in der Welt des Privateigentums einerseits als Kalkulation von Unternehmen, andererseits als Bewirtschaftung von Einkommen aus „unselbständiger Arbeit“ vorkommt, wird auf beiden Seiten des staatlichen Rechnungswesens deutlich. Der hoheitliche Umgang mit Geld ist zwar auch darauf gerichtet, über möglichst viel von diesem Stoff zu verfügen; aber sowohl die Art der Beschaffung wie die der Verwendung der staatlichen Finanzen weicht erheblich von den Berechnungen und Techniken ab, die den privaten Umgang mit Einnahmen und Ausgaben kennzeichnen.
Die Einnahmen des Staates stammen nicht aus irgendeiner Sorte Tausch. Der Staat verdient sich das Geld nicht, sondern eignet es sich durch das höhere Recht seiner legitimen Gewalt an. Die Steuern sind nach Art und Höhe Resultat von Beschlüssen, mit denen der Staat über Teile des in der Gesellschaft zustande gekommenen und umlaufenden Privateigentums verfügt. Das Entrichten der Steuer ist entsprechend auch kein Kauf und berechtigt die Zahlenden nicht zu Ansprüchen auf staatliche Gegenleistung; aus der Perspektive der Bürger erscheint die Steuer allemal als Abzug und Beschränkung ihres Eigentums. Sie zeugt freilich ebenso von der Abhängigkeit, in die der Staat sich stellt: Seine Ressourcen fallen danach aus, was das Funktionieren des Privateigentums unter seiner Hoheit hergibt. Den Respekt vor seiner Geldquelle demonstriert der Souverän erst recht, wenn er sich verschuldet. Seine Gläubiger haben – dem Marktrecht entsprechend – Anspruch auf Zinsen, also Kapital.
Die Ausgaben des Staates sind, wie der Name schon sagt, eine ziemlich marktwirtschaftliche Art, Hoheit auszuüben. Die Sachen und Dienste, die der Staat für sein Werk braucht und seiner Gesellschaft abverlangt, requiriert er nicht bzw. nur im Fall einer äußersten nationalen Notlage. Er kauft und bezahlt sie und ordnet dadurch sich selbst dem Regime des Geldes unter, das er installiert. Der politische Souverän beugt sich dessen Gesetzen, weil Geld und seine Mehrung sein eigener erster Zweck ist. Davon zeugt nicht nur die geschäftliche Form, in der er die erforderlichen Dienste der Gesellschaft „kommandiert“, sondern ebenso der Inhalt des Regierens, für das die staatliche Revenue ausgegeben wird. Was immer der Staat sich vornimmt, dient diesem Zweck: Die marktwirtschaftliche Ordnung braucht sehr viel Staat – nicht zu ihrer Korrektur, sondern für ihr Gelingen.
Mit seinem Haushalten, dem Einziehen wie dem Ausgeben von Geld, definiert das politische Gemeinwesen sich und seine Gesellschaft: es verordnet ihr die Herrschaft des Geldes. Kein Plan und kein Kommando stiftet in der Marktwirtschaft den materiellen Zusammenhang zwischen den Bürgern, sondern das von der Politik ebenso getrennte, wie von ihr ermächtigte reale Gemeinwesen
Geld.[1] Die Verfügung darüber ist absolute Bedingung der Teilhabe am materiellen Reichtum; Gelderwerb daher der allgemeine Zweck aller wirtschaftlichen Betätigung. Über das Geld, nur darüber, hängen die Privatsubjekte voneinander ab – und zwar in einer antagonistischen Weise: Jeder ist bestrebt, sich des Geldes zu bemächtigen, das der andere hat; das Angebot, das einer dem anderen zu diesem Zweck machen muß, benutzt dessen Bedürfnis als die Schwäche, die es auszunutzen gilt. Am Preis, den einer dabei erzielt, entscheidet sich, ob und in welchem Maß seine Arbeit sich für ihn als Mittel des Erwerbs bewährt, für den sie da ist. Der Staat benutzt seine politische Macht, um die Bürger auf das Geld als die reale Macht festzulegen, die sie übereinander ausüben und der sie sachlich unterworfen sind. Ihre gegeneinander gerichteten Anstrengungen, sich Geld anzueignen, verbucht er als Beiträge zu dem nationalen Gesamtertrag, den er von ihnen will. Die Privatsubjekte, die sich um nichts als ihre kapitalistischen Geldinteressen kümmern, sind immer zugleich im politischen Auftrag unterwegs: Was die Bürger gegeneinander an Geld erwirtschaften, ist der Inbegriff der ökonomischen Macht des Staates.[2]
I. Die Grundlage des Staatshaushalts: Das „gesetzliche Zahlungsmittel“ – ein politisch garantiertes Kreditgeld
1. Staatliche Geldschöpfung: Das Banknotenmonopol und seine Leistung
Das Wirtschaften sowohl der Bürger wie des Staates beruht auf einem Geld, das im modernen Kapitalismus der Staat selbst „schöpft“. Wenn Zeitungen und Ökonomen darum rechten, ob die Bundesbank die angemessene Geldmenge zur Verfügung stellt, dann wissen sie darum. Sie interessieren sich zwar nur für die quantitative Seite, setzen stillschweigend aber die qualitative voraus: Eine Bundesbehörde[3] macht das Geld. Und zwar in einem umfassenderen Sinn als in früheren Jahrhunderten, in denen der Souverän Legierung und Gewicht der Geldware Gold oder Silber durch seine den Münzen aufgeprägten Insignien garantierte. Diese Metalle haben als Arbeitsprodukte selbst Wert und vermögen deshalb unabhängig vom Staat und jenseits seiner Landesgrenzen den Wert der Waren gültig auszudrücken. „Geldschöpfung“ heißt zweitens mehr, als daß der Staat Papierzettel nur als Stellvertreter des andernfalls erforderlichen Goldes zirkulieren und den Warentausch vermitteln ließe. Die sogenannte „Golddeckung“ der staatlichen Banknoten ist aufgehoben.[4] Eine Bindung der Notenausgabe an eine gewisse Quantität des im Besitz der Nationalbank befindlichen Goldschatzes, auf das ihre Noten dann Anweisungen wären, gibt es nicht mehr; ebensowenig die Pflicht der Notenbank, das von ihr ausgegebene Papiergeld zu einem feststehenden Kurs gegen Gold zurückzunehmen. Dadurch ist das metallische Geld, das selbst Wert hat, aus dem inneren, seit dem Zweiten Weltkrieg auch weitgehend aus dem zwischenstaatlichen Geschäftsverkehr verbannt und durch ein papierenes „gesetzliches Zahlungsmittel“ ersetzt worden.
Die staatliche Zentralbank knüpft damit an Leistungen des privaten Kreditgewerbes an, die zum Zwecke der Verdeutlichung in Erinnerung gerufen werden sollen.
Schon im kommerziellen Zahlungsverkehr dienen Zahlungsversprechen als Zahlungsmittel, wenn ein Schuldner, statt seine Rechnung zu begleichen, einen Schuldschein ausstellt, sein Gläubiger dafür – gegen ein gewisses Entgelt, versteht sich: den Zins – Zahlungsaufschub gewährt und mit dem Zahlungsversprechen seines Schuldners einstweilen seinerseits Zahlungspflichten erfüllt, indem er es an seinen eigenen Gläubiger weiterreicht – der dann selbstverständlich am zu erwartenden Zinsgewinn teilhat. Freilich unterliegt dieses Wechselgeschäft dem Risiko und daher dem Vorbehalt, daß der erste Schuldner am Ende auch wirklich zahlt; der Ersatz der Zahlung durch den Wechsel ist nur vorläufig und der Schuldschein als Zahlungsmittel nur soviel wert, wie der Schuldner am Fälligkeitstermin liquide ist. Solider und verläßlicher wird die Sache, wenn die Banken sich einmischen, die als technische Agenten des gesellschaftlichen Zahlungsverkehrs ohnehin den Geldschatz der kapitalistischen Welt verwalten, nämlich deren Vorrat an verdientem, aktuell nicht weiterverwendetem Bargeld. Gestützt auf diesen Vorrat, macht die Bank bei ihr eingereichte Wechsel zu Bargeld, stattet ihre Kundschaft außerdem auch unabhängig von einem zugrundeliegenden Wechselgeschäft mit Geldmitteln für die Fortführung alter und die Eröffnung neuer Unternehmungen aus – auch das, versteht sich, gegen Zinsen. Dafür braucht sie nicht einmal gleich und direkt ihre Bargeldbestände anzugreifen: Sie räumt ihren Schuldnern ein Konto ein, gestattet ihnen auf diese Weise, Zahlungsverpflichtungen zur Begleichung an sie weiterzureichen, verrechnet dann ihrerseits eingehende mit auszuzahlenden Beträgen und muß nur für den angemeldeten Bargeldbedarf sowie gegebenenfalls für den Saldo auf ihre Einlagen oder ihr Bargeldvermögen zurückgreifen. Auch das kann sie sich aber noch sparen, wenn sie statt Geld eigene Banknoten herausgibt: die in bestimmte Geldbeträge gestückelte Garantie, dieselbe jederzeit bar einzulösen.
Ein solcher Ersatz von Bargeld durch Banknoten hat nicht bloß den technischen Vorteil, den Zahlungsverkehr buchstäblich zu erleichtern. Der Bank eröffnet er die Möglichkeit, sich in ihrer Kreditvergabe von dem Bargeldbestand, über den sie verfügt – und für den sie ihren Einlegern selber Zinsen zahlen muß –, weitgehend zu emanzipieren. Selbst für die Zahlungsverpflichtungen, die sie bar zu begleichen hat, braucht sie den gehorteten Geldschatz nicht anzugreifen, muß sich also auch nicht mehr an dessen beschränkten Umfang halten, wenn sie ihr Bargeld nur noch ideell, in Form von Noten auszahlt. Solche nicht mehr befristeten – und auch nicht mehr mit Zins ausgestatteten – Zahlungsversprechen zirkulieren glatt anstelle echten Geldes, wie Bargeld – freilich nur, solange das Vertrauen des Publikums in die Zahlungsfähigkeit der Bank nicht erschüttert ist, der Emittent seine Noten nicht zurücknehmen und wirklich auszahlen muß bzw. seine Bargeldbestände für die paar Auszahlungen ausreichen, die er trotzdem zu leisten hat. Denn davon hängt nunmehr alles ab: Sobald die Banknoten nicht mehr bloß den wirklichen Schatz der Bank im Verhältnis 1:1 repräsentieren, sondern ihren eigentlichen Dienst als Kreditmittel tun und das Geld als existent und verfügbar vorstellig machen, das die damit kreditierte Geschäftswelt erst verdienen muß und zur Schuldenbedienung abzuliefern hat, muß der Gang der Bankgeschäfte dann auch dafür sorgen, daß an der Geldqualität ihres Kreditmittels keine Zweifel aufkommen. Willige und gutgläubige Einleger sind vonnöten, die mit der Hinterlegung ihres Verdienten den Banknoten-Überbau unterfüttern; vor allem aber erfolgreiche Schuldner, die aus den Zahlungsverpflichtungen, für deren Begleichung ihre Hausbank mit ihren Banknoten einsteht, kapitalistischen Reichtum machen und so die Werthaltigkeit der emittierten Banknoten bestätigen. Nicht bloß für den Bankgewinn kommt es darauf an, sondern für die Stichhaltigkeit des abstrakten Reichtums, der in der Papiergestalt der Noten der jeweiligen Bank existiert. Der Ersatz von Bargeld durch private Banknoten bleibt somit immer noch vorläufig. Der Geldwert, den die Noten repräsentieren, ist relativ, nämlich kritischen Vergleichen zwischen den Emittenten unterworfen, was, als es das alles noch gab, dazu geführt hat, daß sie einen regelrechten Kurs bekamen und mit Auf- oder Abschlägen – einem Agio oder Disagio – weitergegeben wurden. Und insgesamt bleibt dieses Bankgeld prekär: Im Fall einer Kreditkrise, wie sie zum Kapitalismus nun einmal gehört – als „Rezession“ verbucht sie der verständige Konjunkturbeobachter und rechnet alle paar Jahre damit –, annulliert jeder Bankrott die auf die zerrüttete Bank bezogenen Banknoten, und die Entwertung umlaufenden Bankgeldes verallgemeinert den Zusammenbruch des Geschäftsverkehrs schlagartig. Am Ende ist die Zahlungsfähigkeit der gesamten Geschäftswelt wieder auf die paar mobilisierbaren Bargeldbestände zurückgeworfen, von deren Schranken das Kreditgewerbe die Geschäftswelt doch so gründlich befreit hat.
Hier setzt die Leistung der staatlichen Zentralbank ein. Mit ihrer Einrichtung wird den Geschäftsbanken die Emission eigener zirkulationsfähiger Zahlungsmittel – von Banknoten eben – verboten, insofern also eine Einschränkung ihrer Fähigkeit verfügt, unter Berufung auf ihr Passivgeschäft jede Menge Kredit zu gewähren und Zahlungsfähigkeit zu stiften, für die sie gar nicht zuverlässig einstehen können. Dafür werden sie auf der anderen Seite um so gründlicher von den Schranken des gesellschaftlichen Bargeldschatzes freigesetzt, den sie bei sich zentralisieren und als Grundlage ihrer Kreditschöpfung benutzen. Denn zur Refinanzierung ihrer Ausleihungen, als Bargeldfundus für die Auszahlung der Forderungen gegen sich, die sie mit der Aufnahme von Geldern wie mit der Vergabe von Krediten in die Welt setzen, verfügen die Kreditinstitute nunmehr über ein Konto bei der staatlichen Zentralbank, das ihnen nach bestimmten Regeln Zugriff auf deren Banknoten eröffnet. In diesem Zugriffsrecht auf Zentralbankgeld besteht – letztlich – der gesellschaftliche Geldvorrat, den sie mit ihrer Kreditvergabe in Vorschüsse für kapitalistische Geschäfte und eine potenzierte gesellschaftliche Zahlungsfähigkeit verwandeln. Ihr Bargeld-Fundus und folglich ihre Macht zur Kreditschöpfung ist damit entscheidend ent-schränkt.
Denn die staatliche Zentralbank ihrerseits ist bei der Notenemission überhaupt nicht auf einen angesammelten und bei ihr hinterlegten gesellschaftlichen Schatz, auf verdientes, beiseite gelegtes und bankmäßig verwahrtes Geld angewiesen; ebensowenig auf Rückflüsse aus den Geschäften, die sie mit ihren Banknoten refinanziert. Zwar hat etwa die Bundesbank ihren Verkehr mit den Geschäftsbanken so geregelt, daß diese für das Zentralbankgeld, das sie für Refinanzierungszwecke abrufen können, kommerzielle Wertpapiere bestimmter Güte übereignen oder hinterlegen und Zinsforderungen abtreten oder selber Zinsen zahlen müssen. Auf diese Weise verdient sie ganz regulär mit am allgemeinen Kreditgeschäft.[5] Und ganz nach den Regeln des Bankgeschäfts notiert sie auch ihre Notenausgabe als „Passivgeschäft“, soweit dann jemand ihre Banknoten hat, als hätte der Betreffende damit eine offene Forderung gegen sie in der Hand,[6] und als „Aktivgeschäft“, insofern sie Forderungen gegen Kreditinstitute erwirbt, und führt darüber eine Bilanz.[7] Die Banknoten jedoch, mit denen sie Wertpapiere kauft, diskontiert, beleiht oder die sie sonst wie auch der Geschäftswelt zugänglich macht, beziehen sich nicht auf ein Geld, das jemand verdient und bei ihr angelegt hätte oder das erst noch bei ihr einlaufen müßte, wie das beim privaten Banknotengeschäft der Fall ist – bzw. wäre, wenn es noch zugelassen wäre. Der „gesellschaftliche Schatz“, den die Noten der staatlichen Zentralbank „repräsentieren“, besteht in gar nichts anderem als ihrem öffentlichen Auftrag: in ihrer Autorisierung durch die Staatsgewalt, Banknoten auszugeben. Daß die dann alle Geldfunktionen versehen, ist daher auch keine bedingte und erfolgsabhängige Leistung – bedingt durch den verdienten Geldreichtum, den die Bank verwaltet, und abhängig vom durch gute Aktivgeschäfte begründeten Vertrauen in die Solvenz des Instituts –; vielmehr ist die Differenz zwischen Banknote und Geld per Gesetz überhaupt getilgt. Die Einheiten, die der Banknote aufgedruckt sind, sind das gültige Maß des gesellschaftlichen Reichtums, Maßstab aller Einkommen und Preise, so wie früher die Gewichtseinheiten des Edelmetalls. Und die Banknoten bezeichnen nicht – sie sind selber das Bargeld der Gesellschaft, mit dem Zahlungspflichten abschließend zu erfüllen sind.[8] Indem sie es „nachahmt“ und monopolisiert, vollendet die staatliche Notenbank den Kunstgriff des Kreditgewerbes, statt Geld Schuldpapiere als Zahlungsmittel zirkulieren zu lassen, und stellt es zugleich auf den Kopf: Sie stiftet selber das Geld, das es in der Gesellschaft überhaupt bloß zu verdienen gibt.
Um das zu leisten, bloßen Zetteln definitive Bargeld-Qualität beizulegen, ist eine für die gesamte Gesellschaft unbedingt verbindliche Gewalt vonnöten. Immerhin ersetzen die Druckmaschinen der Zentralbank nicht bloß ganze Edelmetallbergwerke, sondern auch die Mühseligkeit, deren Produkte zu erwerben, anzusammeln und zur Grundlage eines flüssigen Geschäftsverkehrs zu machen. Sie schaffen den Stoff
, aus dem der Reichtum der Gesellschaft besteht, sobald er seine wahre und angemessene, nämlich abstrakte Gestalt angenommen hat. Der Wert, der da ausgedruckt vorliegt, hat seine Substanz
in dem Gesetz, welches die Anerkennung und den Gebrauch der Zentralbanknoten als Bargeld anordnet; in einem Gewaltverhältnis also, dem die Geschäftswelt samt ihrem Anhängsel, der restlichen geldverdienenden und -ausgebenden Gesellschaft, ausnahmslos und ohne konkurrierende Autorität subsumiert ist. Umgekehrt macht der Staat sein Gewaltmonopol zur ökonomischen Sache, indem er per Gesetz das Objekt des allgemeinen Geldverdienens in die Welt setzt.
2. Staatliche Geld-„Versorgung“: Die Bedienung des freigesetzten Bedürfnisses nach Kredit und der Erfolgsanspruch des Staates
In der Welt, nämlich der Geschäftswelt ist das staatliche Notenbankgeld freilich nicht schon dadurch, daß die Zentralbank es druckt. Es wird zum Bargeld der Gesellschaft, indem es den Kreditinstituten als Refinanzierungsmittel dient, also von denen auf dem Wege eines regelgerechten Passivgeschäfts gegen Zinszahlungen an die Zentralbank beschafft und im Zuge ihres Aktivgeschäfts in Umlauf gebracht wird. Schon damit ist klar, daß die „Geldversorgung“, die der Staat bei seiner Notenbank zentralisiert und monopolisiert hat, dem „bereitgestellten“ Geld einen geschäftlichen Auftrag mit auf den Weg gibt: Seine Verwendung muß sich lohnen; bei den Banken, die es sich beschaffen und dafür zu zahlen haben, und folglich auch bei deren Geschäftskunden, von denen sie sich ihrerseits Zinsen holen. Alles Bargeld verdankt seine Existenz einem Kreditgeschäft, das von der staatlichen „Bank der Banken“ seinen Ausgang nimmt, und fordert eine Weiterverwendung, die diesem Geschäft Genüge tut.
Indem die Zentralbank die Ersetzung des Geldes durch Banknoten perfekt macht, vollendet sie somit zugleich das kapitalistische Kreditgeschäft in so idealer Weise, daß sie auch dessen „Logik“ gewissermaßen auf den Kopf stellt. Für sich genommen kommt die geschäftsbankmäßige Kreditschöpfung nämlich nicht davon los, daß sie auf verdientem, von der Kundschaft angelegtem Geld beruht: Auch wenn die Banken alles tun, um sich von dieser Grundlage freizumachen und das Geld, das sie sich aus ihren Krediten erwarten, also noch nicht haben, in Zahlungsmittel zu verwandeln, mit denen sie ihre Kredite finanzieren, also ihre Vorschüsse auf künftigen Gelderwerb leisten – sobald Bargeld verlangt ist, müssen sie aus gelaufenen Geschäften welches besitzen, auf das sie zurückgreifen können, und zwar immer mehr als genug. Mit der staatlichen Zentralbank und deren Banknotenmonopol im Rücken, haben sie aber im Prinzip – die einschränkenden Konditionen der Geldbeschaffung modifizieren dieses Prinzip, unterstellen also dessen Gültigkeit – immer genügend Bargeld, und zwar ohne zuvor gelaufene Geschäfte, also über die Schranken der bei ihnen eingelaufenen und festgehaltenen Bargeldsummen hinaus. Insofern wird das private Kreditgeschäft dank staatlicher Geldversorgung von seiner Basis – dem Handelsgeschäft, dem Wechsel, dessen Diskontierung usw., wie im ersten Teil dieses Kapitels in Erinnerung gerufen – frei und gründet sich stattdessen auf das Bargeld, das der Staat den Kreditinstituten auf dem Kreditweg als ihr Kreditmittel „zuteilt“. Der Staat selbst wird so zur „Basis“ – wie des Bargelds, so auch – des gesellschaftlichen Kredits: Er „wartet nicht ab“ – um das logische Verhältnis ins sprachliche Bild einer zeitlichen Reihenfolge zu fassen –, bis sich „über“ dem Kommerz ein dafür funktionales Leih- und Kreditschöpfungsgeschäft aufgetan hat und den kapitalistischen Laden in Schwung bringt. Er „eröffnet“ vielmehr selber den ganzen kapitalistischen Zirkus von „oben“ her: Mit der Bereitstellung eines Kreditmittels, das den Besitz von Bargeld nicht bloß vorspiegelt, sondern selbst das definitive Bargeld ist, kurbelt er das Kreditgeschäft an; mit der Maßgabe, daß daraus dann das gesamte übrige marktwirtschaftliche Geschäftsleben erwächst. Daß die Zentralbank für die Zuteilung dieses idealen Kreditmittels an die Geschäftsbanken strenge Maßregeln anwendet, ist da nur folgerichtig: Diese Konditionen sind der notwendige Reflex darauf, daß sie mit ihrem Bargeld das Kreditgeschäft von der funktionalen Schranke, die sonst durch den Umfang des von den Banken thesaurierten Bargelds der Gesellschaft läge, emanzipiert.
Die Kontrolle, die der Staat mit den Vorschriften für den Verkehr zwischen Zentralbank und Geschäftsbanken über deren Tätigkeit ausübt, macht den Anspruch praktisch geltend, den er mit jedem herausgegebenen Geldschein in die Welt setzt. Es ist kein anderer Anspruch als der, der jedem Kreditgeld eigen ist: daß das damit finanzierte Geschäft sich lohnt, so daß der behauptete Geldwert des Kreditmittels durch den Ertrag seiner Verwendung tatsächlich bestätigt wird. Diese Forderung erhebt nun aber der Staat gegenüber seiner Geschäftswelt insgesamt. Dabei ist der Geldwert des Kreditmittels – im Unterschied zum privat geschöpften Zahlungsmittel – nicht mehr in der Weise von der Erfüllung dieses Anspruchs abhängig, daß er durch Bargeld eingelöst werden müßte; es ist selbst Bargeld, sein Wert gesetzlich garantiert. Das mindert den Anspruch aber nicht; auch der Wert, der im gesetzlichen Zahlungsmittel bereits existiert, will durch gelingende Geschäfte geschaffen, die staatliche Vorgabe durch wirkliche Geldvermehrung eingelöst sein. Denn in einer Weise, zu der ein privates Kreditgeld es nie bringen kann, ist auch das staatliche von seiner Bestätigung durch erfolgreichen Gebrauch abhängig: Der gesetzlich fixierte Wert des Zahlungsmittels selbst wird relativ; das Bargeld unterscheidet sich selbst von seinem Geldwert; der Gebrauch, den die konkurrierenden Kapitalisten der Nation davon machen, entscheidet darüber, wie sehr.
Dieses Paradox ist der unvermeidliche „Preis“ dafür, daß der Staat sein nationales Kreditgewerbe mit einem idealen Kreditmittel ausstattet. Damit macht er eben umgekehrt sein gesetzliches Geld zum Maß der vergebenen Kredite; und dann steht und fällt es auch mit dem Geschäft, das insgesamt aus diesen Krediten entsteht. Mit der kühnen Gleichung von Vorschuß und Bargeld, die der Staat dekretiert, setzt er sein Bargeld der Bewährungsprobe aus, die der Kreditvorschuß zu bestehen hat. Sein Dekret hebt die kapitalistische Grundgleichung nicht auf, nach der nur produzierter und mit Gewinn in Geld verwandelter Tauschwert wirklich gesellschaftlichen Reichtum darstellt – und es soll sich dagegen auch gar nicht versündigen: Der Staat besteht seiner Gesellschaft gegenüber darauf, daß sie ihm und seiner Vorleistung durch kapitalistische Verwertungsleistungen Recht gibt. Mit dem Wert des Bargelds selbst, das es in der Nation zu verdienen gibt, macht er seine Geschäftswelt samt arbeitendem Anhängsel dafür haftbar, daß sie den abstrakten Reichtum produziert, den seine Zentralbanknoten im Akt ihrer Emission bereits realisiert haben wollen und beziffern. Die Maßeinheit dieser Ziffern ist „weich“, weil darin Kredit und Geld als identisch behauptet sind; die gesamte Ökonomie der Nation steht unter der Maßgabe, sie als „hart“ zu erweisen und die behauptete Identität herzustellen, indem sie den „Unterbau“ an Geschäftserfolgen zustandebringt, den der „Überbau“ der staatlichen Kreditgeldversorgung postuliert.
Die paradoxe Identität und Nicht-Identität von Bargeld und Kredit, die den staatlichen Banknoten eigen ist, wird sofort kenntlich, wo die gesetzlichen Zahlungsmittel es mit einer gleichartigen Alternative zu tun bekommen, sobald sie nämlich mit den Produkten des Banknotenmonopols anderer Nationen gleichgesetzt, also verglichen werden: Sie bekommen einen Kurswert, der das Maß, in dem die nationale Ökonomie den gesetzlich garantierten Wert des Staatsgeldes ökonomisch beglaubigt, relativ zum entsprechenden Verhältnis zwischen Vorleistung und Leistung der Geldversorgung in anderen Nationen mißt. Was der Staat innerhalb seiner Gesellschaft mit der Monopolisierung der Banknotenemission unterbindet, das macht sich auf höherer Stufenleiter zwischen den Staaten geltend: Kreditmittel, die alle gleichermaßen sämtliche Geldfunktionen erfüllen und das dann doch nicht in gleichem Maße tun, konkurrieren um das Maß, in dem sie das tun, nämlich soviel wert zu sein, wie sie zu sein behaupten. Das Kreditmittel, das der Staat aller internen Konkurrenz enthebt, um damit seine nationale Ökonomie zur gelingenden Bewährungsprobe des vorgegebenen Werts heranzuzüchten, erweist sich als Objekt und Inbegriff einer offenen Erfolgsfrage, die das Konkurrenzverhältnis zu den anderen Nationen bestimmt; und das dauerhaft, weil sie prinzipiell nie definitiv zu beantworten ist. Statt die offenen Geschäftsbedürfnisse seiner Kapitalisten abschließend zu befriedigen, wirft die Geldversorgung durch den Staat das politökonomische Problem einer gesamtnationalen Bewährungsprobe in der internationalen Konkurrenz um die relativ gelungenste Identität von Kredit und Geld auf.
Da trifft es sich gut, daß die bürgerliche Staatsgewalt auf gar nichts anderes aus ist, als eben dieses Problem fortwährend zu bewältigen. Was sie dafür unternimmt: davon handeln die folgenden drei Kapitel.
II. Zweck und Mittel des Staatshaushalts – oder: Der Gebrauch von Geld und Kredit durch den „ideellen Gesamtkapitalisten“
Die Tätigkeit der Zentralbank wird – was die Versorgung des Wirtschaftskreislaufs mit einem funktionierenden Umlaufsmittel angeht – als unerläßliche Dienstleistung einer staatlichen Behörde angesehen. Ihr Wirken bietet erst einmal wenig Stoff für öffentliche Anteilnahme, fällt schon gar nicht unter die umstrittenen Affären. Daß sie den Geldumlauf und die Kreditversorgung der Wirtschaft regelt, gilt eher als die Bewältigung eines technischen Erfordernisses, als sachgemäßer Beitrag zum Funktionieren des marktwirtschaftlichen Verkehrs denn als Politikum. Zu einem solchen wird das Handeln der Nationalbank erst durch zusätzliche Gesichtspunkte; etwa durch den Einfluß, den es – wirklich oder angeblich – auf den Verlauf der Konjunktur oder auf den Haushalt der Regierung nimmt.
Die Vorstellung, daß da einer Gesellschaft zur Abwicklung von Produktion, Verteilung und Konsum das technische Hilfsmittel abgeht, der Staat diesen Mangel aber behebt, das freie marktwirtschaftliche Treiben ermöglicht und seine Bürger mit dem gesetzlich geschützten Geld rechnen und tauschen läßt – ein wenig merkwürdig ist diese Vorstellung allerdings schon. Sie geht nämlich locker über den nicht ganz unwesentlichen Umstand hinweg, daß es offenkundig hoheitlicher Gewalt bedarf, um „dem Markt“ zum Funktionieren zu verhelfen. Das ist immerhin ein Anzeichen dafür, daß es mit der „Eigengesetzlichkeit“ des Marktes nicht so weit her ist. Seine vielberufenen „Sachzwänge“ treten offenbar gar nicht in Kraft ohne den segensreichen Zwang, den ein politischer Souverän mit seinem Gewaltmonopol ausübt.
Angesichts der immer wieder aufgewärmten Mär von „der Wirtschaft“, die der Staat bloß freisetzt und sich selbst überläßt, auf daß sie unbehelligt von obrigkeitlicher Einmischung ihren Gang geht, ist dem bürgerlichen Staat für eine praktische Klarstellung zu danken. Daß seine Zentralbank mit ihren fälschungssicheren Noten nur einem Imperativ zum Durchbruch verhilft, der ein ganzes Produktionsverhältnis etabliert – das bekannte nämlich, in dem alles Arbeiten und Leben dem Geld, das immer wem gehört, untergeordnet ist –, scheint wenigstens den Profis von der „politischen Klasse“ geläufig zu sein. Die halten sich mit ihrer Regierungsgewalt jedenfalls nicht zurück. Daß in der Konkurrenz ums Geld nichts funktioniert ohne flächendeckende Betreuung durch die Staatsgewalt; daß das florierende Geschäft, zu dem das Geld ermächtigt ist und seine Eigentümer befähigt, dauerhafte Unterstützung benötigt; daß die Wirkungen dieses Geschäfts für zahlreiche Bürger gar nicht durchzustehen sind ohne institutionalisierte „Eingriffe“ der Obrigkeit u.a.m. – das alles demonstrieren sie mit ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit ziemlich ausführlich. Eben weil es dem Staat um nichts anderes zu tun ist als um die Durchsetzung des erwähnten politökonomischen Imperativs namens Kapitalismus, fällt der Katalog der Staatstätigkeiten
, die im Haushaltsbuch der Nation aufgeführt und mit Mitteln bedacht zu werden pflegen, recht umfangreich aus und die Beschaffung der Mittel, mit denen die Staatsmacht ihre Herrschaft exekutiert, einigermaßen komplex:
- Was in der politischen Öffentlichkeit mal als „öffentlicher Dienst“ – an wem auch immer – gewürdigt, mal als „Staatseingriff“ ins Leben der Gesellschaft,
ins ökonomische zumal, von den einen gefordert, von anderen beargwöhnt wird, was jedenfalls in der standardisierten Ressortaufteilung der staatlichen Exekutive als feststehender
Aufgabenbereich jeder Regierung anerkannt und festgeschrieben ist, dreht sich ausnahmslos um
- das Funktionieren der Konkurrenz (A.),
- die Kontinuität des kapitalistischen Wachstums (B.) sowie
- die internationale Geschäftsfähigkeit und den weltweiten Erfolg der nationalen Ökonomie (C.).
- Das materielle Mittel, mit dem der bürgerliche Staat seinen herrschaftlichen Zweck durchsetzt, dessen er sich in allen seinen hoheitlichen Maßnahmen bedient,
von dem seine Gewaltausübung also auch abhängt, ist das Geld, das in seiner Gesellschaft verdient wird und auf dessen Vermehrung er seine Bürger systematisch festnagelt.
In diese Ökonomie des Geldverdienens fügt er sich bei seiner Mittelbeschaffung sachgerecht ein (D.):
- Er partizipiert mit Steuern am Gelderwerb wie an den Geldausgaben seiner Landesbewohner; und
- er nutzt den Kredit, dessen Funktionstüchtigkeit er seiner Geschäftswelt garantiert.
A. Herstellung und Sicherung einer nationalen Konkurrenzgesellschaft
1. Recht & Ordnung
Um ein allgemeines Geldverdienen und -vermehren in Gang zu setzen und zu halten, schafft die bürgerliche Staatsgewalt zuerst und vor allem Rechtssicherheit. Die Geschäfte, in denen die Menschheit sich engagieren soll, brauchen Regeln: Massen von Gesetzen für den Abschluß und die Erfüllung von Verträgen aller Art, in denen Eigentum und Dienste wechselseitig übereignet werden. Um deren korrekte Anwendung auf sämtliche geschäftlichen Affären kümmert sich ein umfangreicher Justizapparat. Der muß sich mit seinen Entscheidungen auf eine durchgreifend wirksame Polizeigewalt verlassen können. Und weil dort, wo auf solche Weise Recht und Gesetz zur Anwendung gebracht werden, auch der Gesetzesbruch und Rechtsverstoß zu Hause ist, gehört eine Strafjustiz dazu, die mit der Bestrafung von Verbrechern die Autorität des Rechts gegen seine Mißachtung verteidigt.
Ein beträchtlicher Aufwand also ist nötig, und zwar auf Dauer, um die Einwohner einer modernen Nation in eine rechtliche Ordnung zu bringen. Entgegen anderslautenden Vermutungen liegt das aber nicht an den Leuten, denen aus unvordenklichen Ursachen eine rechtmäßige Lebensführung prinzipiell schwerfiele. In den eigentümlichen Grundsätzen, die die öffentliche Gewalt dem gesellschaftlichen Zusammenleben vorgibt, liegt der Grund für die umfangreichen Vorkehrungen, die sie zur Sicherung rechtlicher Verhältnisse treffen muß, offen zutage.
Der entscheidende Grund liegt im Eigentum, dessen geschäftlicher Gebrauch so komplexer Vorschriften und eines so elaborierten Überwachungsregimes bedarf. Menschen, die keinen Schritt und keinen Handschlag tun, weder etwas Nützliches zustandebringen noch überhaupt subsistieren könnten ohne die Arbeit anderer, tun das alles unter der – im Wortsinn: eigentümlichen – gesellschaftlichen Bedingung des wechselseitigen Ausschlusses von den Mitteln wie Ergebnissen ihrer – dementsprechend uneigentlichen – „Kooperation“. Alle Gegenstände, über die sie voneinander abhängen und gesellschaftlich zusammenwirken, stehen grundsätzlich nicht dafür zur Verfügung, sondern unter dem staatlich verfügten Vorbehalt, exklusiv einer Privatperson zu gehören. Und dieser Vorbehalt wird nie mehr, schon gar nicht im Zuge des notwendigen „arbeitsteiligen“ Zusammenwirkens der einzelnen, aufgehoben: Über ihn, durch die Scheidung zwischen ausschließend verfügungsberechtigten Eigentümern und deren dementsprechend negative Abhängigkeit voneinander, stellt sich der produktive Zusammenhang zwischen den einzelnen und der gesellschaftliche Lebensprozeß her.
Bei dieser ersten Prämisse gesellschaftlicher Existenz im bürgerlichen Gemeinwesen handelt es sich um ein Willensverhältnis: Die Menschen werden dazu genötigt, das Eigentum als Bedingung und Mittel jeden Nutzens, als Elementarform jeglichen „Reichtums“ anzuerkennen. Und zwar einerseits durch die Drohung einer überlegenen herrschenden Gewalt, jeden abweichenden Willen zu brechen; andererseits durch das Angebot, auf dieser festen und verläßlichen Grundlage eigene Nutzenabwägungen vornehmen und in aller Freiheit danach handeln zu dürfen. Jeder „normale“ Materialismus, der auf materielle Güter um ihres Gebrauchswerts willen gerichtet und für deren möglichst unaufwendige, planmäßige Beschaffung zu haben wäre, ist damit ausgeschlossen, autorisiert hingegen jeder „Materialismus“, der das exklusive ‚Haben‘ als quasi naturwüchsige Voraussetzung jedes zweckmäßig-gemeinsamen Gütergebrauchs respektiert und sich dementsprechend auf Eigentum schlechthin richtet.
Die freien „materialistischen“ Berechnungen, die damit gefordert sind, haben folgerichtig den Haken, daß sie allemal gegen die gleichartigen, eben auch auf ein ausschließendes Verfügungsrecht über möglichst viele Dinge ausgehenden Kalkulationen und Anstrengungen all der andern stehen, auf deren Leistungen ein jeder gleichzeitig doch angewiesen bleibt. Jeder Schritt und jeder Handschlag, den die Leute tun, tangiert fremdes Eigentum und provoziert entsprechende Interessenkonflikte. Die Absurdität ist damit fertig: Der Konkurrenzkampf um Geld, um immer mehr Eigentum, was mit wechselseitigem Ausschluß von der Verfügung über Gebrauchsgüter zusammenfällt, ist die gültige Verlaufsform und der eigentliche Inhalt und Zweck des gesellschaftlichen Produzierens und Konsumierens.
Die Staatsgewalt inszeniert diesen „Kampf ums Überleben“, indem sie ihn in alle seine absehbaren Ausformungen hinein mit ihren gesetzlichen Regeln und ihrer Rechtspflege begleitet. Sie monopolisiert die Gewalt, die dem Konkurrenzverhältnis zwischen lauter Eigentümern immanent ist, und etabliert sie damit: Sie verbietet private Gewaltanwendung und ersetzt
sie, indem sie ihre hoheitliche Gewalt hinter die nach ihren Regeln ins Recht gesetzten Interessen stellt und gegen die unberechtigten geltend macht. Dabei ergänzt sie ganz folgerichtig die Ermächtigung der Eigentümer – sie sind zu mancher Schädigung der Interessen und Lebensbedürfnisse anderer Leute in der Lage und berechtigt – um den schäbigen Schutz der Person, jenes armseligen Rests, der von den Lebensäußerungen eines Menschen auch dann noch übrigbleibt, wenn er seiner Lebensmittel verlustig geht. So rechnet dann alle Welt, notgedrungen und auf den eigenen Vorteil bedacht, mit Gewalt, nämlich der öffentlichen, sucht sie sich im gesellschaftlichen Verkehr zunutze zu machen und ihren Verdikten zu entgehen. Daß auf einen so berechnenden Gehorsam kein Verlaß ist, versteht sich von selbst; zuallererst für die bürgerliche Staatsmacht selber, die wechselseitige Übergriffe zwischen ihren Rechtssubjekten und eigensüchtige Regelverstöße in ihr Gesetzeswerk von vornherein mit aufnimmt und gleich einer weiteren allgemeinen Regel unterwirft, nach der auf verbotenes Tun Strafe folgt.[9]
Das alles ist, wie gesagt, nicht billig. Es hat eben seinen Preis, das Geld zum „realen Gemeinwesen“ zu machen. Dafür dreht sich dann aber auch alles ums Geld; der gesamte gesellschaftliche Lebensprozeß dient dem Erwerb von Eigentum und seiner Mehrung. Insofern ist der staatliche Aufwand dann doch lohnend, marktwirtschaftlich gesehen: Er produziert zwar sonst nichts – aber immerhin das marktwirtschaftliche Produktionsverhältnis selbst.
2. Das politische Gemeinwesen
Indem der bürgerliche Staat seine Landesbewohner zu Eigentümern und Erwerbspersonen macht, nimmt er an ihnen eine ideelle, nichtsdestotrotz praktisch folgenreiche Unterscheidung vor. Alles Materielle an ihrer natürlichen und gesellschaftlichen Existenz ist unter die Kategorie des privat Eigenen, des exklusiven Verfügungsrechts subsumiert, bleibt innerhalb der Grenzen dieses Rechts ihnen selbst überlassen und geht ihn grundsätzlich nichts weiter an. Worum er sich kümmert, das ist eben dieses Recht und dessen Grenze: die gerechte, regelgemäße Abgrenzung der Privatsphären gegeneinander. In dieser Hinsicht gelten ihm alle seine Untertanen gleich, unterliegen nämlich „ohne Ansehen der Person“, was hier gleich ihre gesamte materielle Existenz einschließt, unterschiedslos seinem gesetzlichen Reglement. Dieses Regelwerk zugrundegelegt und von allen Lebensbedürfnissen und -mitteln abstrahiert, sind sie frei und haben uneingeschränkt Anteil am öffentlichen Leben.
Diese Gunst gewährt der Staat allerdings nicht einfach jedem, der bei ihm vorbeikommt. Sie kommt nur Leuten zu, die er, auch dies nach Recht und Gesetz, als die Seinen anerkennt. Die erfaßt die öffentliche Verwaltung genau, von der Geburt bis zum Tod, damit stets klar ist, wer sich für seine Freiheit auf ihre Gewalt berufen kann. Umgekehrt haben freie Bürger ihrem Staat gegenüber auch Pflichten; vor allem und alles andere einbegreifend die, ihn als den Ihren anzuerkennen, also auch das Nötige für seinen Bestand und Erfolg beizutragen. Das Rechtsverhältnis zwischen dem Gewaltmonopolisten und seinen privaten Erwerbspersonen schließt somit ein ideelles Verhältnis der Zu- und Zusammengehörigkeit ein: ein wechselseitiges Anerkennungsverhältnis zwischen dem Citoyen und seinem politischen Gemeinwesen. Neben die auf Gelderwerb festgelegte und über ihre systemgemäß antagonistischen Interessen vergesellschaftete Bourgeois-Mannschaft tritt gewissermaßen sie selber in Gestalt einer souverän selbstbestimmten Gemeinschaft freier und gleicher Staatsbürger.
Diese Verdoppelung des bürgerlichen Zusammenlebens ist ein teurer Spaß. Es braucht dafür ein öffentliches Leben, eine Beteiligung der Bürger an der Politik, womöglich über demokratische Wahlen, Parlamente, Parteien usw., eine staatsbürgerliche Erziehung und Meinungsbildung, eine nationale Kultur und Repräsentation der ideellen Zusammengehörigkeit von Staat und Bürgern, die sich darüber den Ehrennamen eines Volkes verdienen… Dieser Aufwand ist aber erstens unentbehrlich, weil der kapitalistische Gelderwerb als gesellschaftliches Lebensgesetz nur funktioniert, wenn freie Bürger ihn als die angestammte Sphäre ihres öffentlich berechtigten Nutzenstrebens wahrnehmen und die Gewalt, die sie dabei in die Schranken weist, als notwendiges, sinnvolles und von ihnen selbst gewolltes Mittel, und sei es bloß als „Korrektiv“, begreifen und anerkennen. Wenn sie das tun und sich die Belange der Herrschaft, die sie zu Knechten des Eigentums macht, wichtiger nehmen als ihre materielle Einzelexistenz, dann steht es gut um die Mobilisierung der Gesellschaft für die politische Ökonomie der Nation. Insofern ist das Geld für die Inszenierung eines politischen Volksgemeinschaftswesens zweitens im Prinzip auch gut angelegt.
3. Innen & Außen
Das politische Verhältnis zwischen der Staatsmacht und ihren Bürgern bzw. den freien Staatsbürgern und ihrem Gemeinwesen hat eine Außenseite. Es richtet sich ausschließend und abgrenzend gegen andere höchste Gewalten und deren Untertanen.
Der Ausschluß fremder Staatsangehöriger aus dem eigenen Staatsvolk versteht sich von selbst: Es geht da um ein Rechtsverhältnis, das von der rechtsetzenden Gewalt ausgeht und vom einzelnen Subjekt nicht einfach gekündigt und schon gar nicht einseitig eröffnet werden kann. Der Ausschluß fremder Zuständigkeit für die eigenen Bürger ist erst recht unerläßlich für ein wirksames Gewaltmonopol; die Staatsmacht gäbe sich selber auf, ließe sie konkurrierende Rechtsansprüche auf die Leute zu, denen sie die gültigen gesellschaftlichen Existenzbedingungen diktiert und den Rang von Trägern des allgemeinen freien Staatswillens zuerkennt.[10] Zur Sicherstellung ihrer Souveränität benötigt sie freilich mehr und andere Gewaltmittel als eine Polizei, die dem Recht im Innern den nötigen Respekt verschafft: Sie muß ihre Grenzen gegen jede Möglichkeit fremder Übergriffe schützen, also einen militärischen Gewaltapparat in Rufbereitschaft halten. Da bekommt mancher Bürger Gelegenheit, seine Privatexistenz eine Zeitlang ganz hinter sich zu lassen und im Wehrdienst praktisch zu beweisen, wie vollständig der Citoyen seinem Staat an-gehört. Und alle anderen zahlen zumindest mit.
Der Aufwand lohnt sich dafür noch in einer anderen Hinsicht sehr. Die Grenze, die der Staat zwischen seinem Zuständigkeitsbereich und dem Rest der Welt zieht, verschafft der Gemeinde der Staatsangehörigen eine ganz eigene Exklusivität. Im Namen eines unterscheidenden Eigennamens machen Staat und Volk gemeinsam die Weltgeschichte unsicher, und die zustande gebrachten Taten und Leiden füllen die Abstraktion des Citoyen mit jeder Menge ideellen Inhalts: einer „nationalen Identität“. Das Nützliche an diesem Ding ist der Umstand, daß der Kapitalismus, diese materielle Lebensbedingung, um die sich alles Staatshandeln dreht, darin definitiv nicht vorkommt: Darin unterscheiden sich die modernen Nationen ja wirklich nicht. Das heißt zwar umgekehrt nur, daß das, worin all die unvergleichlichen nationalen Kollektivsubjekte dasselbe, nämlich Nationen sind, eben auch keinen anderen Inhalt hat als marktwirtschaftliche Produktionsverhältnisse und deren politische Betreuung. Staatenlenker wie Staatsbürger verstehen die Sache aber unerbittlich andersherum. Sie bestehen darauf – die Staatsmacht gegenüber ihrem Volk und dieses gegenüber seiner politischen Führung, die immer auch eine „geistig-moralische“ sein soll –, daß die eigene Nation in ihrer unterscheidenden Besonderheit ihr Wesen hat und die Zugehörigkeit dazu keineswegs ein Unterwerfungsverhältnis, sondern eine Auszeichnung ist. So wird dann sogar der banale kapitalistische Alltag zur Teilnahme des mündigen Bürgers am Bemühen der Nation, ihre ganz eigene unverwechselbare Zukunft zu gewinnen. Und sollten die Leute dann einmal ihre Unzufriedenheit mit ihren materiellen Lebensverhältnissen nicht mehr aushalten, dann richten sie sich in ihrem nationalen Idealismus ganz bestimmt nicht mehr einfach gegen diese Verhältnisse. Auch insofern kann der Aufwand für die nationale Grenzsicherung, einschließlich der ideologischen, auch rein marktwirtschaftlich gesehen kaum zu hoch ausfallen.
B. Einsatz für ein kontinuierliches kapitalistisches Wachstum
Der bürgerliche Staat macht den gesellschaftlichen Lebensprozeß insgesamt zur Domäne des Privateigentums, verschafft dem Kapital die im Geld vergegenständlichte Kommandogewalt über Arbeit und Konsum. Eben deswegen jedoch kommt das kapitalistische Wachstum von allein nicht vom Fleck, wirtschaftet sich überdies in Widersprüche hinein, mit denen seine Urheber nicht selbst fertig werden. Denn das Regime über die ökonomischen Aktivitäten der Gesellschaft ist kapitalistischen Eigentümern überantwortet, die damit gegeneinander um die Ausnutzung der gesellschaftlichen Kaufkraft für möglichst große eigene Anteile am Profit konkurrieren und nur in dem negativen Interesse übereinkommen, die systemgemäß auf Geld gerichteten Ansprüche der übrigen Klassen zu beschränken, womit sie notwendige Voraussetzungen ihres eigenen Erfolgs ruinieren.
Der bürgerliche Staat übernimmt daher die Rolle des ideellen Gesamtkapitalisten. Er nimmt den real existierenden Einzelkapitalisten weder die Macht über die gesellschaftliche Produktion noch die Freiheit zum Konkurrieren, sondern ergänzt ihre verheerenden Leistungen durch den Einsatz seiner Macht für einen kontinuierlichen und dauerhaften Fortgang des kapitalistischen Geschäfts insgesamt. Mit seinem politischen Standpunkt der Verantwortung fürs allgemeine Wohl mischt er sich in die von ihm selbst so definierte und konstituierte ökonomische Privatsphäre seiner Bürger ein und zwingt ihnen per Gesetz zusätzliche Rechte und Pflichten, Rücksichten und Mittel auf, so daß das System der privaten Bereicherung seinen gewünschten Gang gehen kann.
1. Die Herstellung der allgemeinen Produktions- und Zirkulationsbedingungen
Der Staat kümmert sich um die Bedingungen des kapitalistischen Geschäfts, um die sich die Geschäftemacher aus lauter Konkurrenz um Profit nicht auch noch selber kümmern können, und hier auf der einen Seite um das alles entscheidende Geschäftsmittel: das Geld seiner Gesellschaft. Die Geschäftswelt entwickelt nämlich einigen Erfindungsreichtum, um den Einsatz des abstrakten Reichtums für seine Verwertung zu effektivieren und die Schranken gründlich zu erweitern, die seine begrenzte Größe seinem Konkurrenzerfolg setzt. So sehr kommt es den Geldbesitzern auf immer mehr Geld an, daß sie es einander stunden, Zahlungsversprechen akzeptieren und als Zahlungsmittel weiterverwenden, überhaupt zukünftige Geschäfte wie bereits vorhandene Geschäftserfolge behandeln, also allenthalben den Gebrauch wirklichen Geldes vermeiden, um ohne Stockung mehr davon zu verdienen, als ihre Eigenmittel es ihnen eigentlich erlauben. Geldkapitalisten treiben die funktionelle Ersetzung von Geld durch Kredit so voran, daß am Ende jedermann die von ihnen beglaubigten Schulden als Geschäftsmittel verwendet, also auch mit seinem Vermögen von der Gültigkeit ihrer Zahlungsversprechen abhängt. Wenn sich dann wieder einmal herausstellt, daß insgesamt dauernd weit mehr Geschäftsmittel vorgeschossen und eingesetzt als wirklich lohnend verwertet werden, dann verliert die Geschäftswelt nicht bloß einiges von dem, was sie sich als fertiges Geldvermögen in ihre Bücher geschrieben hat. Sie hätte die Ruinierung ihres Geschäftsmittels selbst zu verkraften, wäre auf primitive Barzahlung zurückgeworfen und müßte ihr ganzes mit Kreditgeld finanziertes Wachstum abschreiben, wenn sich nicht die Staatsmacht geldschöpferisch eingemischt und ein Kreditgeld herausgegeben und garantiert hätte, das unabhängig von Kreditkrisen und Bankrotten seine Gültigkeit behält – so wie in Kapitel I. dargestellt. Ein krisenfreies Wachstum garantiert der Staat seinen kapitalistischen Unternehmern damit zwar nicht – wie auch! –; er bewahrt aber das Universalmittel des kapitalistischen Unternehmertums vor seiner Ruinierung durch seinen wachstumsfördernden Gebrauch. Dieser Dienst kostet ihn ausnahmsweise nicht einmal was, sondern läßt ihn als letzten Kreditgeber an den Zinserträgen des Kreditgewerbes teilhaben.
Die stofflichen Voraussetzungen eines flotten und dauerhaften allgemeinen Kapitalwachstums kann der Staat gleichfalls nicht einfach „der Wirtschaft“ überlassen. Ihre Schaffung und Beschaffung ist zwar, wie alles im Kapitalismus, bloß eine Geldfrage; und an Geld mangelt es unter der Ägide eines staatlich abgesicherten Kreditgewerbes nicht. Nur muß sich der Einsatz privater Zahlungskraft auch lohnen, und zwar für den Konkurrenzkampf des Unternehmens, das ihn leistet. Das ist aber nur dann der Fall, wenn sich der gekaufte Nutzen monopolisieren läßt. Und damit hapert es an entscheidenden Stellen.
So ist zum einen naturwissenschaftliche Erkenntnis samt ihrer technologischen Anwendung eine Produktivkraft, die das Kapital für seinen Konkurrenzkampf unbedingt braucht, die sich aber wegen ihrer Allgemeinheit im Grunde gar nicht zum Konkurrenzmittel eignet. Mit der Erfindung der Kategorie des „geistigen Eigentums“ und ihrer praktischen Durchsetzung mithilfe des Patentrechts ist da zwar schon viel geholfen: Wissen wird mit Staatsgewalt unter einen privatrechtlichen Anwendungsvorbehalt gestellt und kann so doch für Konkurrenzzwecke seinen Dienst tun. Dieser bemerkenswerte Eigentumsschutz greift allerdings nur in Bereichen, die nach der auch marktwirtschaftlich nicht außer Kraft zu setzenden immanenten Logik der Forschung bereits eine Menge Wissen voraussetzen – Erkenntnisse, die erstens jemand parat haben muß und deren Erweiterung zweitens immer größere Aufwendungen erfordert, die aber entweder zu allgemeiner Natur sind, um sich überhaupt patentieren zu lassen, oder von geschäftlichen Anwendungen zu weit entfernt, um lohnende Erträge aus einer Patentierung zu versprechen. Den nötigen Aufwand leistet der Staat: Er sorgt für die Ausbildung von Wissenschaftlern, auf die, und für Grundlagenforschung, auf deren Ergebnisse das freie Unternehmertum für seinen wissenschaftlich-technischen Fortschritt zurückgreifen kann, ohne sich in geschäftlich nicht zu verantwortende Unkosten zu stürzen. Wo dieser Bereich der wissenschaftlichen Grundausbildung und der „Grundlagen“-Forschung anfängt, ist denn auch keine wissenschaftliche, sondern eine Finanzierungsfrage. Die Abgrenzung zur „anwendungsorientierten“ Wissenschaft ergibt sich aus dem praktischen Verhältnis und Zusammenspiel zwischen kapitalistischer Praxis und kulturstaatlicher Verantwortung, verschiebt sich auch mit jeder Verallgemeinerung naturwissenschaftlicher und technischer Errungenschaften – und hat immer besonders viel mit dem speziellen Erkenntnisdrang des Staates selbst in seiner Eigenschaft als fortschrittliche Militärmacht zu tun.
Dem marktwirtschaftlichen Dilemma, daß gewisse Einrichtungen für erfolgreiches Konkurrieren unabdingbar, für konkurrierende Geschäftsleute aber nicht lohnend und insofern zu kostspielig sind, begegnet der bürgerliche Staat außerdem und vor allem in dem Bereich der nationalen Infrastruktur. Eindeutig abzugrenzen ist dieser „Sektor“ nicht – bzw. nur in eben dem funktionellen Sinn, daß es sich dabei um Gebrauchswerte handelt, für die gesorgt werden muß, obwohl ihre Beschaffung in der gegebenen Konkurrenzlage keinen Gewinn abwirft, damit weiterhin wachsende Gewinne zustandekommen. Ob der Staat sich hier vorauseilend um die jeweils benötigten Wachstumsbedingungen kümmert oder erst auf „Notlagen“ reagiert und wo er sich überhaupt gefordert sieht, das ist nach Nationen verschieden; auch politische Parteien unterscheiden sich mit Vorliebe darin, wie sie hier den staatlichen Handlungsbedarf ansetzen. Auf jeden Fall gehören Verkehrswege, die, einmal angelegt, allgemeiner Benutzung offenstehen, immer wieder zum staatlichen Aufgabenbereich und fallen auch immer wieder heraus, wenn sie sich in lohnende Erwerbsquellen verwandeln lassen – sobald nämlich die teuren Investitionen getätigt sind; die Geschichte der kapitalistischen Weltwirtschaft kennt manche gescheiterte Privatunternehmung im Bereich des Kanal- und Eisenbahnbaus und gerade in letzter Zeit viele erfolgreich privatisierte Staatsunternehmen in der Transportbranche. Ebenso kommt es bei der Beschaffung von Natur- und Rohstoffen, auch von industriell gefertigten Grundstoffen wie Eisen, sowie beim Energiebedarf der Industrie immer wieder dahin, daß die kapitalistischen Unternehmen für ihr Wachstum Vorleistungen brauchen, mit deren ehrlicher Bezahlung sie ihre Konkurrenzfähigkeit ruinieren würden – oder umgekehrt: mit deren Herstellung kein hinreichender Profit zu erwirtschaften ist. Da sind dann vom politischen Gemeinwesen spendierte Hüttenwerke nötig, oder es braucht eine staatliche Atomenergiepolitik, damit die kapitalistischen Konkurrenten über eine selbstproduzierte Wachstumsschranke hinwegkommen.[11]
Gewiß ist das alles kostspielig. Es handelt sich aber um notwendige Unkosten einer Produktionsweise, in der sich alles fürs Privateigentum lohnen muß, weil es sonst unterbleibt. Außerdem trifft sich auch beim staatlichen Aufwand für „Infrastruktur“ die Sorge ums nationale Wirtschaftswachstum oft genug – nicht bloß bei den Faschisten – glücklich mit den Versorgungs- und Mobilitätsbedürfnissen und gewissen Autarkiebestrebungen der staatlichen Militärmacht: zweifacher Ertrag für ein und dieselbe Ausgabe…
2. Die Bildung einer brauchbaren Arbeiterklasse
Im bürgerlichen Staat ist der Lebensprozeß der Gesellschaft im Ganzen wie die Erhaltung der einzelnen als deren Privatsache organisiert. Gearbeitet wird für Geld, nach Maßgabe des Vertragsrechts, das die Freiheit des einen am gesetzeskonformen Eigennutz des andern enden läßt. Daß sich dabei allerhand Unterschiede ergeben, rechnet das bürgerliche Gemeinwesen zu den naturwüchsigen Eigentümlichkeiten, die es an seinen Mitgliedern vorfindet und als deren jeweilige Freiheitssphäre respektiert. So geht es den Staat grundsätzlich auch nichts an, daß die ganz normale Erwerbsarbeit – das Arbeiten für ein Entgelt, das durch das Konkurrenzkalkül des „Arbeitgebers“ begrenzt ist, und nach Leistungsvorgaben, die nach derselben Rechnung eingerichtet sind – als privates Lebensmittel schlichtweg untauglich ist, nämlich die Arbeitskraft ruiniert und als Einkommensquelle vollends versagt, sobald der Mensch, sei es zeitweilig oder endgültig, verbraucht ist oder nicht gebraucht wird.
Allerdings läßt sich auch hier die Trennung zwischen öffentlicher und privater „Sphäre“ nicht ganz durchhalten. Zwar bestimmen die „Millionen Einzelschicksale“ der eigentumslosen Klasse die politische Ökonomie der Nation nicht weiter, schon gar nicht auf so prekäre und widersprüchliche Weise wie die Konkurrenz der kapitalistischen Eigentümer, so daß das ökonomische Gemeinwohl ein Eingreifen der öffentlichen Gewalt gebieten würde. Vom Standpunkt des politischen Gemeinwesens aus beurteilt, ist es aber ein Problem, wenn die Masse der Mitglieder mangels gesichertem Lebensunterhalt weder fähig ist, in der Gemeinschaft freier Rechtssubjekte eine konstruktive Rolle zu spielen, noch eine hinreichende Bereitschaft dazu erwarten läßt. Diese Leute stehen dann glatt außerhalb des politischen Zusammenhangs, gefährden dessen Bestand moralisch und sogar physisch, bleiben nämlich am Ende die Dienste schuldig, die die nationale Wirtschaft doch von ihnen braucht. Die bürgerliche Staatsmacht steht daher vor der Daueraufgabe, die proletarische Abteilung ihrer Gesellschaft politisch zu integrieren. Das setzt bei den Betroffenen den Willen voraus, ihr Dasein vom Gelderwerb durch Lohnarbeit abhängig zu machen. Und der läßt sich nur erzwingen, wenn das auch geht.
Also greift der Staat in den privaten Lebensunterhalt seiner lohnarbeitenden Untertanen ein. Früher mehr „paternalistisch“ und „bevormundend“; in der modernen sozialen Demokratie auf eine sehr sachgerecht funktionelle Weise: Mit der politischen Gleichberechtigung, die er ihnen gewährt, läßt er ihre Interessenvertreter als unter der Bedingung der Systemkonformität legalisierte Opposition, als „Säule der Demokratie“ oder sogar, nach entsprechender „Reifung“, als Regierungspartei auf eine Sozialgesetzgebung hinwirken, die nach dem Gemeinwohl verpflichtetem politischem Ermessen ein proletarisches Dasein dauerhaft vollziehbar macht – den Beweis haben die Betroffenen praktisch abzuliefern.
Was für Regelungen da im einzelnen für die „soziale“ Klientel nötig und fürs Gemeinwesen und dessen Wirtschaftskraft zumutbar sind, ist ebenso national verschieden wie die Geschichte von Klassenkampf und Repression, faschistischer Volksfürsorge und demokratischer Gleichschaltung, die zu dem jeweiligen Ergebnis geführt hat. In der Natur der Sache liegt es, daß die öffentliche Gewalt sich generell mit den beiden Seiten der Lohnarbeit – genauer: ihrer Untauglichkeit als Lebensmittel zu befassen hat: mit den Folgen der im Lohn vorgegebenen Armut sowie mit dem Verschleiß der gegen Lohn verkauften Arbeitskraft.
- Die Notwendigkeit, ein ganzes Leben lang von dem Lohn zu leben und sogar noch für Nachwuchs zu sorgen, den hart kalkulierende, weil konkurrierende Unternehmen für den „Produktionsfaktor Arbeit“ aufwenden, regelt der bürgerliche Sozialstaat im exemplarischen deutschen Fall bislang durch „Versicherungspflicht“ und „Generationenvertrag“, durch Vorschriften also zur Streckung des individuell bzw. zur Umverteilung des kollektiv verdienten Lohns. Das Konkurrenzkalkül der kapitalistischen „Arbeitgeber“ bleibt so im Prinzip unangetastet; sozialgesetzlich umverteilt wird nichts als der Gesamtpreis der national benötigten und für lohnenden Einsatz bezahlten Arbeit. Das Ergebnis ist ein staatlich administriertes nationales Niveau des proletarischen Lebensstandards, zurechtreguliert nach den Konjunkturen des kapitalistischen Arbeitskräftebedarfs und gemäß den Imperativen sozialer Gerechtigkeit abgestuft.
- Das in der Lohnarbeit zum Einsatz gebrachte Erwerbsmittel ist das Leistungsvermögen, das die Arbeitgeber gemäß den Fortschritten ihres Unternehmenswachstums und den Konjunkturen ihrer Konkurrenz dem „Produktionsfaktor Arbeit“ abfordern. Dieses „Vermögen“ muß sich in einer Lebenszeit ohne Arbeit und Verdienst erst einmal herstellen; es braucht eine den sich wandelnden Ansprüchen der Arbeitswelt genügende Ausbildung; seine Schädigung durch kapitalistischen Gebrauch muß gebremst und funktionell kompensiert werden; seine Verwahrlosung im Falle zeitweiligen Nicht-Gebrauchs ebenso – und für nichts davon kann ein Lohnarbeiter selber sorgen. Also hilft der soziale Staat: mit gesetzlicher Beschränkung der zumutbaren Arbeitszeit und Aufsicht über Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz; mit Familienlastenausgleich und medizinischer Betreuung; mit einem allgemeinen Ausbildungswesen, das die Wissensvermittlung nicht übertreibt, sondern zur sachgerechten Verteilung der nachwachsenden Privatpersönchen auf die verschiedenen Stufen der marktwirtschaftlichen Berufshierarchie nutzt… Und mit Arbeitslosenhilfe und Maßnahmen zur Umschulung Entlassener gestaltet er sogar die abschließende Verelendung eines Bürgers zur hoheitlich betreuten Karriere aus, deren Endpunkt dann erst der offiziell so genannte „Asoziale“ ist.
Alles das kostet viel Geld; und wenn man, wie es sozialstaatlich-marktwirtschaftlicher Brauch ist, die innerhalb der Lohnarbeiterklasse bloß umverteilte Summe als Teil des Sozialhaushalts verbucht und als zusätzliche Kost neben dem Preis der Arbeit, als „Lohnnebenkosten“ rechnet, die der Staat sich und seinen Lohnzahlern eigentlich auch ersparen könnte, dann handelt es sich um eine gewaltige Last für „die Wirtschaft“, die im bürgerlichen Gemeinwesen schließlich nicht in einer arbeitsteiligen Güterproduktion für die Versorgung aller mit einem guten Leben besteht, sondern Geld herstellt, um kapitalistisch angewandtes Eigentum zu vergrößern. Ob die Sozialausgaben sich für diesen Zweck wirklich bezahlt machen, indem sie „sozialen Frieden“ bewirken und proletarische Leistungsstärke verbürgen, unterliegt allemal großen Zweifeln; in ökonomisch „harten“, nämlich kapitalistischen Krisen-Zeiten werden sie denn auch gern als Fundus für Streichungen herangezogen, mit denen der nationale Gesamtpreis der Arbeit politisch gesenkt oder auch umgekehrt eine allgemeine Lohnsenkung zu einem neuen sozialpolitisch austarierten nationalen Lebensstandard ausgearbeitet wird. Dennoch: Im Prinzip ist auch dieser Aufwand für die Marktwirtschaft unentbehrlich. Gerade wenn es nämlich den Kapitalisten nicht bloß gestattet, sondern möglich bleiben soll, Arbeitskraft zu ihren Bedingungen zu verbrauchen und zu bezahlen, führt kein Weg daran vorbei, mit sozialstaatlicher Gewalt zu erzwingen, was die Sachgesetze des Lohnsystems ständig vereiteln: die Erhaltung und Reproduktion einer ganzen Klasse benutzbarer Arbeitskräfte, was die kostengünstige Betreuung und Verwaltung auch der unbrauchbaren Armut einschließt.
3. Schadensbilanz und Kostenmanagement bei der Naturzerstörung
Zum Standardkatalog staatlicher Aufgaben, die mit Haushaltsposten dotiert werden, gehört in fortschrittlichen Ländern mittlerweile die Umweltpolitik. Freunde einer intakten Natur finden das erfreulich, ganz ebenso wie sozial denkende Menschen die Existenz einer Sozialpolitik; an der Höhe des Aufwands, den ein Staat sich für Entgiftungsaktionen u.ä. leistet, messen sie dessen Güte und das Problembewußtsein seiner Regierenden. Kritik erfahren derartige Aktivitäten dagegen von Fanatikern der Marktwirtschaft, die grundsätzlich keine Geldausgabe einsehen, die nicht unmittelbar die Rendite eines konkurrenztüchtigen Unternehmens erhöht.
Verkehrte Welt. In Wahrheit liegt in der Anerkennung der Umweltpolitik als fixer Staatsaufgabe nichts anderes vor als das Eingeständnis, daß die Vergiftung und Zerstörung der Natur durch ihren marktwirtschaftlichen Gebrauch zu den bleibenden Errungenschaften des Systems gehört und an eine Abschaffung dieses „Problems“ überhaupt nicht mehr zu denken ist, seine Dimensionen vielmehr das nationale Gemeinwohl tangieren. Daß der bürgerliche Staat deswegen anfangen würde, „auf Kosten der Ökonomie Ökologie“ zu betreiben, ist außerdem schon dadurch ausgeschlossen, daß er zwischen beiden Dingen – „Wirtschaft“ und „Umweltschutz“ – einen Gegensatz sieht, den er im Interesse ökologischer Anliegen zu „versöhnen“ bestrebt ist oder auch leugnet; die hätten sonst nämlich bei ihm keine Chance. Und wer angesichts dieser Klarstellung für eine andere „Gewichtung“ des Naturschutzes gegenüber dem „bloßen Profitstreben“ oder der Umwelt- gegenüber der Wirtschaftspolitik plädiert, hat das Entscheidende ohnehin schon verpaßt.
Die Erhebung der „Ökologie“ in den Rang eines eigenständigen Politikfeldes macht nämlich vor allem deutlich, was alles zu unterscheiden geht und dann auch in Gegensatz zueinander tritt, wenn erst einmal systematisch Nutzen mit Eigentum, Arbeit mit Gelderwerb und Wirtschaft mit Kapitalvermehrung gleichgesetzt ist. Dann rangiert nämlich auch „die Natur“ nicht mehr als mehr oder weniger brauchbare Vorlage für die Herstellung von Gütern, die die Menschheit besser leben lassen, also als die eine Quelle des gegenständlichen Nutzens, den die gesellschaftliche Arbeit – die andere Quelle – aus ihr herausholt. Sie ist dann tatsächlich bloße „Umwelt“ jenes wüsten marktwirtschaftlichen Produktionsprozesses, in dem das Eigentum arbeiten läßt, um sich zu vermehren – maß- und rücksichtslos gegen die beiden materiellen Quellen aller Gebrauchswerte ebenso wie gegen den daraus zu gewinnenden materiellen Nutzen selbst. Und bei dieser negativen Zweckbestimmung der natürlichen Lebensgrundlagen bleibt es auch, bis sich die Folgen störend bemerkbar machen, und zwar – wie auch sonst – nach den Kriterien dieser Ökonomie der Eigentumsvermehrung. Wenn Schäden an jemandes Eigentum eintreten, einem produktiv genutzten womöglich, oder allgemeine Gefahren, deren Abwendung oder Beseitigung Kosten verursachen, dann tritt die Umweltpolitik auf den Plan. Sie ist der öffentliche Kampf darum, diese Kosten möglichst gering zu halten.
Was dafür aufgewandt wird, zählt zu den unerläßlichen Unkosten, die der Staat für das Wirtschaftswachstum, das er will, in Rechnung stellen muß. Und wie es in der Marktwirtschaft so geht: Diese Unkosten sind die sichere Grundlage für einen ganz neuen Geschäftszweig. Eine bei der Ruinierung der Natur führende Industrienation besitzt nämlich die besten Voraussetzungen, um sich mit „Umwelt-Technologie“ die denkbar sichersten „Zunkunftsmärkte“ zu erobern.
4. Die Finanzierung der Grundrente
Wo alle Gebrauchsgüter und Produktionsmittel Privateigentum sind, da gilt dieses Rechtsverhältnis auch für Grund und Boden – der bürgerliche Staat jedenfalls findet es ganz natürlich, daß das Territorium, auf das sich seine Hoheit erstreckt, im Hinblick auf irgendeine wirkliche oder bloß denkbare ökonomische Verwendung die Verfügungsmasse privater Eigentümer ist, und stellt diese natürliche Rechtslage her. Wo überdies aller wirtschaftliche Nutzen am Eigentum hängt, indem nämlich das staatlich garantierte Verfügungsrecht dem Eigentümer die Macht gibt, aus anderer Leute zahlungsfähigem Bedürfnis für sich Geld zu machen, da wirft selbstverständlich auch das Grundeigentum Erträge ab – auch das erkennt der bürgerliche Staat als natürliche Erwerbsquelle an und schafft damit die gesellschaftliche Klasse der Grundrentner. Sie beziehen eine Monopolgebühr für die Benutzung ihres Grundeigentums, ohne dafür irgendetwas produziert und die Marktwirtschaft um einen wirklichen Tauschwert bereichert zu haben. Ihre Revenue begründet daher für den Rest der Gesellschaft Kosten eigener Art: Sie fügt dem Produktionspreis von Nahrungsmitteln und anderen Agrargütern einen Aufschlag hinzu; sie belastet die Erträge aller kapitalistischen Unternehmungen, die schließlich irgendeinen Standort brauchen, mit einem Abzug; sie macht sich in der Wohnungsmiete als direkte Aneignung fremden Einkommens geltend.
Den Staat gehen diese ohne weitere Gegenleistung erhobenen Ansprüche der Grundeigentümerklasse auf den von der übrigen Gesellschaft erarbeiteten abstrakten Reichtum erst einmal nichts weiter an. Er setzt sie ins Recht und betreut mit einschlägigen Gesetzen die Interessengegensätze, die daraus folgen; das Kassieren und Zahlen, die Ausnutzung monopolistischer Angebots-Nachfrage-Verhältnisse, das Hochrechnen der Grundrente zum Grundstückspreis, die Spekulation auf zukünftige Monopolpreise, die Verknüpfung der Immobilienspekulation mit dem Kredit – alles Geschäftliche also ist Privatsache seiner mündigen Bürger.
Für das, was sich in dieser Privatsphäre zwischen Grundeigentümern und dem Rest der Gesellschaft abspielt, muß er sich dann aber doch interessieren, wenn die Interessengegensätze zur Gefährdung des funktionellen Zusammenwirkens aller mit allen in seinem sozialfriedlichen Gemeinwesen ausarten. Das ist – wieder einmal – grundsätzlich dort der Fall, wo die Revenuequelle Lohn, die schon zur Reproduktion der Lohnarbeiter nur reicht, weil der Sozialstaat es so herbeiregelt, für die Geldbeträge geradestehen muß, von denen die Grundeigentümer ihren Lebensunterhalt bestreiten. Bei den kapitalistisch durchkalkulierten Löhnen werden damit die landwirtschaftlich erzeugten Lebensmittel zu teuer für eine gesicherte Volksernährung; umgekehrt gerät – bei allem agrartechnologischen Fortschritt – der Bauernstand in Gefahr, wenn er ohne Grundrente bloß von bezahlbaren Preisen leben soll oder sich diesen Ertrag sogar noch mit Grundrentnern teilen muß. Und Wohnungsmieten sind überhaupt in dem Maße unerschwinglich, wie das Verhältnis von Angebot und Nachfrage in den Städten die Monopolpreise für Bauland in die Höhe treibt.
In beiden Fällen kommt der Sozialstaat nicht darum herum, wenigstens einen Teil der sozialen Kosten, die er mit der Einrichtung eines Grundeigentums seiner Erwerbsgesellschaft aufbürdet, zu verstaatlichen, um den Grundeigentümern auch dort das Ihre zu sichern, wo die Zahlungskraft des lohnabhängigen Publikums versagt. So leistet sich die EU bekanntlich für ihre Bauern einen Agrarmarkt mit subventionierten Garantiepreisen und der gewollten Konsequenz, daß Ackerbau und Viehzucht zu kapitalistischen Industrieunternehmen und deren Produkte zu Nährmitteln mit zweifelhaftem Gesundheitswert mutieren; manches fällt auch unter die Rubrik Umweltschutz. Die gerechte Revenue seiner Hausbesitzer hat der bundesdeutsche Staat in Zeiten großer Wohnungsnot durch zweckgebundene Subventionen beim Sozialwohnungsbau sichergestellt; mittlerweile erreicht er denselben Effekt lieber durch Mietbeihilfen für Slumbewohner, so daß die Ausgaben der Sozialhilfe insoweit wenigstens ein marktwirtschaftlich nützliches Werk tun.
Billig ist das alles nicht; aber umsonst ist das Recht des Eigentums auf eine Rendite für den Staat, der es gewährt, nun einmal nicht zu haben. Und manches kann sich sogar richtig lohnen; wenn z.B. mit entsprechend zielgerichteten Subventionen der Aufbau eines nationalen Agrarexportgeschäfts gelingt, das der Nation abstrakten Reichtum von auswärts einbringt.
5. Die Verwendung öffentlicher Mittel als Kapital
Der bürgerliche Staat finanziert die Voraussetzungen und Unkosten eines kontinuierlichen kapitalistischen Wachstums, damit „die Wirtschaft“ erfolgreich „in der Wirtschaft stattfinden“ kann, wie es ein begnadeter Experte im Amt des Wirtschaftsministers einmal unübertrefflich luzide ausgedrückt hat. Er kennt aber auch immer wieder unabweisbare Gründe – in der Geschichte eines nationalen Wirtschaftswachstums immer wieder neue –, die gesamtgesellschaftliche Geldvermehrung doch nicht bloß dem privaten Bereicherungsstreben zu überlassen, sondern öffentliche Gelder direkt als Kapital wirken zu lassen.
So bleibt den politischen Verantwortungsträgern die Schlüsselrolle des Kreditgewerbes nicht verborgen – wie auch, wenn sie schon in einer eigenen Behörde die Bereitstellung eines nationalen Kreditmittels organisieren: Von ihm geht alles kapitalistische Wachstum aus, es ist also die positive Bedingung aller sonstigen Geschäfte; es verdient zugleich an jeder Geschäftstätigkeit mit und steht darüber in einem Interessengegensatz zu den übrigen Erwerbszweigen. Das eine wie das andere kann für die öffentliche Gewalt zum Argument werden, sich mit eigenen Kreditinstituten einzumischen und das private Geldkapital im Extremfall zu ersetzen oder zu beschränken oder wenigstens zu ergänzen, um die Geschäftstätigkeit in vom Bankgewerbe schlecht behandelten Branchen voranzubringen – im wiederangeeigneten Ostdeutschland z.B. hat die aus den Tagen des Marshallplans überkommene bundeseigene ‚Kreditanstalt für Wiederaufbau‘ erst in den letzten Jahren wieder viel zu tun bekommen. Oft genug wird eine Regierung außerdem in gewerblichen Geschäftsbereichen unternehmerisch tätig; und das keineswegs nur, um den konkurrierenden Kapitalisten notwendige Wachstumsdienste zu leisten, und auch nicht nur, um „marode“ Unternehmen zu sanieren oder ohne Schaden fürs Eigentum „abzuwickeln“. Viel lieber werfen sich Wirtschaftspolitiker mit Haushaltsgeldern auf Zukunftsbranchen, in denen die für aussichtsreiche Firmengründungen erforderliche Kapitalmasse oder das damit verbundene Geschäftsrisiko der nationalen Unternehmerschaft zu groß oder zu unüberschaubar vorkommt. So treten in dem einen Jahrzehnt Autofabriken als Staatsunternehmen in die Welt, in einem andern Atomkraftanlagen und Firmen für den Bau und Start von Weltraumraketen, dann auch global konkurrenzfähige Flugzeugwerke und nationale Fluglinien sowieso.
Solche „Staatseingriffe“ gelten manchem als – je nach politischer Vorliebe – systemwidrig oder systemkritisch. Wenn „Kritik“, dann wäre es jedenfalls die immanenteste, die sich überhaupt denken läßt: Ihr Ziel ist die Vergrößerung der Erfolge des nationalen Kapitalismus. Und „widrig“ wäre allenfalls die nicht-private „Unternehmerpersönlichkeit“ – die Maßnahmen selber sind es so wenig, daß der fordernde Vorwurf der Systemfremdheit staatlichen Firmeneigentums überhaupt nur dann aufkommt, wenn dieses ein privates Bereicherungsinteresse weckt, die Staatsfirma also nicht bloß nach allen Regeln der Kunst kapitalistisch geführt wird, sondern das auch noch erfolgreich. Wird dann ein solches Interesse laut, kommt der Staat ihm auch schon entgegen; meist bringen überhaupt die zuständigen Politiker das Projekt auf, öffentliches Unternehmenseigentum zu privatisieren, und tun das dann auch glatt. Denn wenn der bürgerliche Staat als Kapitalist agiert, will er nicht zu seinen privaten Geschäftsleuten in Konkurrenz treten, sondern das private Geschäftsleben insgesamt auf ein höheres Wachstumsniveau heben. Er handelt dann als nationaler Gesamtkapitalist – in einer Konkurrenz, die über die Konkurrenzgesellschaft, die er selber betreut, hinausreicht und überhaupt eine dritte Abteilung kostenaufwendiger staatlicher Maßnahmen nötig macht.
C. Politik für einen gesicherten weltweiten Geschäftserfolg der Nation
1. Außenwirtschaft
Was der Staat unternimmt, um seine Gesellschaft zur zunehmend produktiven Geldmaschinerie herzurichten, setzt sein unbestrittenes Monopol auf rechtsetzende Gewalt voraus; dieses schließt die Abgrenzung gegen auswärtige Autoritäten ein. Damit ist eine Beschränkung der Interessensphäre seiner Bürger verbunden, die dem schrankenlosen Gelderwerb widerspricht, zu dem der bürgerliche Souverän selbst sie anstachelt. Die Errichtung einer Grenze zwischen der eigenen und jeder fremden Hoheit geht daher immer mit dem Anspruch an die anderen Hoheitsträger einher, die Handlungsfreiheit seiner Bürger nicht an ihrer Grenze enden zu lassen, sondern dem berechtigten Privatinteresse der Einheimischen gleichzustellen. Umgekehrt ist der nationale Staat durchaus daran interessiert, daß auch auswärtige Geschäftsleute sich mit ihrem Vermögen am Wachstum im eigenen Land beteiligen. So kommt es zu einem allseitigen Interesse an grenzüberschreitendem Kommerz.
Für dessen Einrichtung und Abwicklung unterhalten die Staaten einen lebhaften diplomatischen Verkehr; sie vereinbaren ein Recht auf die konsularische Betreuung ihrer Bürger im Ausland und einigen sich darauf, ihre lokalen Kreditgelder, mit denen engagierte Firmen losziehen, um im Ausland ihr Kapital zu vermehren, für konvertibel zu erachten. Wenn diese Gelder dann, als Resultat allseitigen Importierens und Exportierens, in den Händen auswärtiger Eigentümer landen, die diesen ihren Besitz in Staaten ihrer Wahl zum Einsatz bringen wollen, dann stehen die souveränen Geldschöpfer mit einer wechselseitigen materiellen Sicherheitsleistung dafür ein, daß ihre Währungen auch wirklich immer und überall kapitalistischen Reichtum gültig repräsentieren – schließlich darf der Fortgang des internationalen Geschäfts nicht an den Zufällen der Handelsbilanz zwischen den Nationen scheitern. Sie garantieren einander ihre Bereitschaft und Fähigkeit, eigene Währung jederzeit als wirkliches, universell verwendbares Geld zu bestätigen und in Geld jeder gewünschten anderen Denomination umzutauschen.
Dafür benötigen sie einen Vorrat an fremden Geldern – oder auch an traditionell weltweit anerkannter Geldmaterie –, mit dem ihre Nationalbank für die auf ihre Banknoten lautenden Guthaben geradestehen kann, die zum Umtausch an sie zurückgereicht werden: einen staatseigenen Gold- und Devisenschatz. Der bürgerliche Staat bewirtschaftet daher die Außenbeziehungen, zu denen er seiner nationalen Geschäftswelt verhilft. Er bilanziert das nationale Gesamtergebnis des seine Grenzen überschreitenden und bei der Devisenkasse seiner Notenbank zusammenlaufenden Geldeinnehmens und -ausgebens, weil der Saldo direkt auf seine Reserven wirkt, mit denen er die internationale Geschäftsfähigkeit seiner nationalen Geldbesitzer herstellt. Je nach Ergebnis greift er in den Geldverkehr ein, modifiziert gegebenenfalls seine Umtauschgarantie und den garantierten Wechselkurs mit dem Ziel einer Bilanzverbesserung, behält sich außerdem die letzte Zuständigkeit für den Einzug verdienter Devisen wie für deren Zuweisung an die Geschäftswelt vor. Und ganz gleich, wie gut oder schlecht seine Bilanzen ausfallen: Er kümmert sich um die nationalen Grundlagen des Auslandsgeschäfts seiner Kapitalisten. Sämtliche Maßnahmen, die ein Souverän für die Sicherung und Förderung des Wachstums ergreift, unterwirft er dem Kriterium der Zahlungsbilanz, also eines Erfolgs in der Konkurrenz um Weltmarktanteile, der sich nicht bloß im Profit der erfolgreichen Firma niederschlägt, sondern den Bilanzen der Nation zuzurechnen ist. An diesem nationalen Konkurrenzziel entscheidet der Staat letztinstanzlich – und keineswegs unfehlbar – die Frage, ob ein Unternehmen oder ein ganzer Geschäftszweig Förderung verdient und wieviel, wo er durch eigene Unternehmertätigkeit eine zukunftsträchtige Branche eröffnen soll, welche Subventionen andererseits bloße Geldverschwendung sind.
Daß derartige Fragen um so freier zu entscheiden sind, je besser das nationale Aggregat der Konkurrenzerfolge einheimischer Geldbesitzer resp. der Besitzer einheimischen Geldes auf dem Weltmarkt ausfallen, versteht sich von selbst. Aus dauerhaften und nachhaltigen Erfolgen dieser Art erwächst dem Staat aber auch eine neue Aufgabe: Um der Kontinuität seines außenwirtschaftlichen Wachstums willen muß er sich um die Geschäftsfähigkeit der anderen Nationen kümmern, die, komplementär zu seinen Erfolgen, mit ihren Bilanzen unter die Räder kommen. Darüber hat das internationale Kreditgewerbe einen enormen Aufschwung genommen; denn den führenden Weltwirtschaftsmächten ist die sehr systemgemäße Lösung eingefallen, staatliche Devisenschulden – selbstverständlich nur unter strengen Bedingungen – als Ersatz für einen abhanden gekommenen Staatsschatz anzuerkennen. Weil manche Staatsgebilde diesen Bedingungen nicht genügen, dennoch aber zum ausnutzbaren Geschäftspartner hergerichtet werden sollen, sind sogar so idealistisch klingende Dinge wie „Entwicklungshilfe“ in den Katalog der ernsthaften, mit Haushaltsgeldern dotierten Staatsaufgaben geraten.
Selbst die Erfolge also, die eine potente Nation im Kampf um Weltmarktanteile erringt, sind eine kostspielige Angelegenheit: Sie begründen eine Zuständigkeit fürs Funktionieren des internationalen Geschäfts. Und die ist keineswegs auf Währungsprobleme und Fragen der „internationalen Liquidität“ begrenzt.
2. Sicherheitspolitik & Weltfrieden
Wenn der bürgerliche Staat sein nationales Wachstum zielstrebig von funktionierenden Weltmärkten abhängig macht, dann überläßt er es nicht einfach dem souveränen Ermessen anderer, in der erforderlichen Weise als Mittel und Quelle seines Reichtums zu fungieren. Um sich des unbedingten Kooperationswillens seiner Partner zu versichern, verläßt er sich auch nicht allein auf die zivilen, nämlich ökonomischen Erpressungsmittel, die sich im Maße seiner Konkurrenzerfolge bei ihm akkumulieren, deren Einsatz aber allemal auf ein eigennütziges Kalkül der anderen Staatsmacht zielt. Er kümmert sich um zwingendere Garantien für seinen Zugriff auf auswärtige Geschäftssphären. Daß die Geschäftsordnung, die die Bedingungen und Freiheiten dieses Zugriffs fixiert, bzw. ihre allseitige Einhaltung Weltfrieden heißt, ist kein Zufall: Diese Welt„lage“ ist das Ergebnis erfolgreich abgeschlossener Kriege – einschließlich eines „kalten“ –, die mittlerweile nur noch die „eine Welt“ des globalen Kapitalismus unter „westlicher“ Kontrolle übriggelassen haben. Und deren Stabilität ist ohne die dauernd präsente Alternative, die Drohung mit kriegerischem Terror – „Abschreckung“ –, nicht zu wahren.
Wie die Dinge derzeit liegen, machen die paar großen und mächtigen bürgerlichen Staaten hierbei gemeinsame Sache; nicht bloß gegen aktuelle Abweichler von der gültigen Ordnung, sondern im Hinblick auf alle möglichen Bemühungen Dritter, das friedenssichernde Abschreckungsregime durch unbefugte Veränderungen am internationalen Kräfteverhältnis in Frage zu stellen. Solche vorbeugende Friedenspolitik setzt voraus, daß ihre Veranstalter sich sicher sind, jeden denkbaren militärischen Konflikt durchhalten und entscheiden zu können, und ihre möglichen Gegner auch keinen Zweifel daran haben können. Sie erfordert also eine Menge ständig abrufbarer Kriegsfähigkeit und eine jederzeit aktualisierbare Kriegsbereitschaft. Der Rüstungsaufwand der Staaten, die sich ihre weltpolitische Verantwortung nicht nehmen lassen. sieht entsprechend unverhältnismäßig aus – und läßt nebenbei noch erkennen, daß über aller „Arbeitsteilung“ beim Weltordnen ihre Konkurrenz gegeneinander keineswegs abgestorben ist. Zwischen bürgerlichen Großmächten ist die Kompetenz zur maßgeblichen Definition des Weltfriedens und seiner „Lage“ notwendigerweise umstritten; denn auf der „Ebene“ entscheidet sich, wieweit ein Staat wirklich und in letzter Instanz Herr der polit-ökonomischen Existenz- und Erfolgsbedingungen ist, die er selber für seine Gesellschaft wie für sich in Kraft setzt. Gar nicht notwendig hingegen ist die derzeitige prekäre Bereitschaft der relativ schwächeren kapitalistischen Mächte, der strategischen Kooperation mit ihrem größten Konkurrenten einen gewissen Vorrang vor ihrem Bemühen um volle imperialistische Autonomie einzuräumen.
Gespart wird dadurch nichts. Die weltweite „Projektion von Macht“, und zwar einer jedem eventuellen Gegner vor Ort überlegenen, in welcher Bündniskonstellation auch immer, setzt voraus, daß die öffentliche Gewalt ganze Industriezweige finanziert, deren Gebrauchswerte auf dem Feld des Kaputtmachens konkurrenzlos sind und dank unermüdlichem technischem Fortschritt auch bleiben. Da trifft es sich gut, daß dieselben Produkte – bzw. ihre jeweils veralteten Modellvarianten – sich wie keine andere Ware dazu eignen, Außenhandelsbilanzen zu vergolden: Für kein anderes Produkt gibt es weltweit eine dermaßen kaufwillige und zahlungsfähige Kundschaft. So kommen Industrie- und Militärpolitik des bürgerlichen Staates auf einen Nenner – und nichts beweist schlagender die historische Berufung des Kapitalismus zur politischen Ökonomie der Weltherrschaft: Er benötigt nicht bloß ein universelles Abschreckungsregime, um zu funktionieren; er bilanziert sogar die dafür notwendigen Vernichtungsmittel als Bestandteil des Reichtums der Nationen und den verschwenderischen Aufwand dafür als ein Herzstück des Wirtschaftswachstums. Das soll ihm irgendein Sozialismus erst einmal nachmachen!
D. Systemkonforme Mittelbeschaffung
Die Mittel für sein ausgedehntes Wirken entnimmt der bürgerliche Staat seiner Klassengesellschaft – wem auch sonst; die politische Herrschaft produziert ja nicht, bloß die Produktionsverhältnisse. An deren Systematik hält sie sich bei ihrer Mittelbeschaffung. Sie bedient sich der beiden Seiten des kapitalistischen Geld-Machens: Sie mobilisiert die Potenzen des Kredits, von dem alle kapitalistische Geschäftstätigkeit ihren Ausgang nimmt, in analoger Weise für ihre geschäftsdienliche Tätigkeit; und an der privaten Revenue, die aus dem so zustandegebrachten kapitalistischen Wachstum entsteht, sowie an deren Verausgabung, dem Rückfluß des verdienten Geldes in „die Wirtschaft“, partizipiert sie buchstäblich: sie nimmt sich ihren Teil per Steuern.
1. Die Steuereinnahmen
Wo Arbeit identisch ist mit Gelderwerb, Reichtum darin besteht, daß er jemandem gehört, und der gesellschaftliche Produktionsprozeß nur ein einziges Wirtschaftsgut hervorbringt, nämlich in Währungseinheiten gemessenen Tauschwert, da bestehen auch die Machtmittel der Staatsgewalt in der gesellschaftlichen Macht des Geldes, das sie sich abliefern läßt – sie „lebt“ von verstaatlichtem Privateigentum. Sie nimmt ihre Untertanen auf diese Weise als Privatleute in Anspruch, die bei aller anerkannten und gesetzlich geschützten Privatheit ihrer Arbeit und ihres Vermögens doch noch etwas Höheres kennen als ihren aufs Eigentum festgelegten Materialismus, nämlich den Staat als den Ihren, als ihren ideellen, abstrakt frei- und gleichheitlichen, eben: politischen Zusammenschluß. Die bürgerliche Obrigkeit ehrt ihre Landesbewohner als die wahren Subjekte der über sie ausgeübten Herrschaft, indem sie sie alle, ohne Ansehen der Person und ohne Diskriminierung, als opferbereite Privatleute zum elementaren Staatsdienst des Steuerzahlens heranzieht.
Dieser egalitäre Zugriff auf die Gesellschaft als Ensemble geldverdienender Citoyens – die sich im Gegenzug als radikale Bourgeois gebärden, denen ihr Eigenstes beschnitten wird – verlangt freilich nach einer Anpassung der Steuerlast an die individuelle Leistungsfähigkeit; schließlich bedeutet ein und dieselbe Summe für verschiedene Mitglieder des nationalen Steuerzahlervereins je nach Einkommen eine unterschiedliche Belastung. Diese tiefe Einsicht in die Dialektik der Gleichheit ist die Quelle unabschließbarer politischer Bemühungen um Steuergerechtigkeit, also das rechte Verhältnis zwischen gleicher Summe und gleicher Last für alle. Die modernen Staaten haben es hierbei zu kunstvollen Systemen des Steuerab- und -einzugs gebracht, die jede Transaktion von Geld mit einer sinnreich bemessenen Gebühr belegen und so das marktwirtschaftliche System des Geldverdienens und -ausgebens mehr oder weniger vollständig nachbilden. Noch ein wenig komplizierter werden diese Systeme dadurch, daß der Staat auch in seiner Eigenschaft als Fiskus die der Marktwirtschaft eigenen Zwecke, Prioritäten und Abhängigkeiten nicht vergißt, die er zu gesellschaftlichen Sachzwängen macht: Er handhabt die Verteilung der Steuerlast als Instrument seiner Infrastruktur-, Sozial-, Umwelt-, Agrar- und Wirtschaftsförderungspolitik und etabliert damit Wirkungszusammenhänge, die deren Schöpfer am Ende selbst nicht mehr ganz überblicken, weil sie nämlich immer anders wirken als geplant und die ideologisch feststehenden Wirkungen so selten eintreten.
Allgemein üblich ist die Erhebung von „direkten“ Steuern auf die Revenue der gesellschaftlichen Klassen und von „indirekten“ auf den Konsum. Bei den letzteren, die den ökonomischen Vorteil haben, für „die Wirtschaft“ nur ein durchlaufender Posten zu sein, gibt es aus sozial-, bildungs- und informationspolitischen Gründen unterschiedliche Steuersätze, außerdem aus Gerechtigkeitsgründen eine Zuordnung gewisser Güterklassen zu so privaten Kategorien wie Luxus und Vergnügen, aus Billigkeitsgründen eine Sondersteuer auf das Massenkonsumgut Mineralöl, aus Gesundheitsgründen eine willkommene Sondereinnahme aus dem Verkauf der ideellen Gesamtkrebsursache Tabak usw.usf. Die direkten Steuern werden nach Einkommenshöhe prozentual gestaffelt und gleich mit der Freiheit ausgestattet, bei kapitalistisch produktiver Anwendung des Verdienten Abgaben zu sparen. Eingezogen werden sie auf unterschiedlichem Weg je nach Einkommensart: per Abzug „an der Quelle“ beim „unselbständig“ empfangenen Lohn – ein hübsches Eingeständnis nebenbei, wie sicher sich der Fiskus ist, daß man einer gewissen Klasse das Erworbene gar nicht erst aushändigen darf, wenn davon für die Staatskasse noch etwas zu holen sein soll; per eigenverantwortlicher Steuererklärung im Nachhinein bei „selbständig“ verdientem Geld – da gibt es dann das Problem der Steuerehrlichkeit und ein Arbeitsplätze schaffendes Dauergefecht zwischen den ehrenwerten Berufsständen des Steuerberaters und des Steuerprüfers.
Das Steueraufkommen, das bei alledem herauskommt, ist die reale, nämlich staatskassenmäßig praktisch wirksame und insofern einzig objektive periodische Zusammenfassung der privaten Wirtschaftstätigkeit im Land: die ökonomische Leistungsbilanz der Nation. Eben deswegen kann es der Staat dabei nicht belassen. Schließlich will er mit seinen Maßnahmen produktiv in die Zukunft wirken; nicht bloß den Status quo fortschreiben und dafür dessen wirkliche Erträge abwarten, sondern ein Wachstum anstoßen. Über das, was die jeweils vergangene Wirtschaftstätigkeit an verstaatlichtem Überschuß zustandegebracht hat, geht er daher hinaus.
2. Das Schuldenmachen
Um seine Gesellschaft zu dauerhaft wachsender Kapitalvermehrung zu befähigen, macht sich der Staat vom jeweils eingegangenen Steueraufkommen unabhängig und bedient sich des Mittels, mit dem sich schon jedes kapitalistische Unternehmen von den Schranken seines Umsatzes befreit, um für die Eroberung neuer Märkte und Marktanteile fit zu werden: des Kredits. Er macht Schulden bei den Geldkapitalisten, längst nicht mehr bloß der eigenen Nation, und gewinnt dadurch Handlungsfreiheit.
Schon damit hat er fürs kapitalistische Wachstum einen wesentlichen Dienst erbracht. Mit seinen Schulden verschafft er dem Kreditgewerbe sichere, quasi geldgleiche, zinstragende Vermögenstitel; Forderungen von so hoher Qualität, daß darauf jede Menge neuer Ausleihungen gegründet werden können. Der Staat erweitert so die Basis des nationalen Kredits, dessen allgemeine Verwendung als Geld er durch die Banknoten seiner Zentralbank bereits sichergestellt hat. Seine Schuldenaufnahme befähigt die Kreditunternehmen, neuen Kredit und mit diesem immer mehr von seinem Geld zu „schöpfen“ und damit den Umfang der privaten Geschäftstätigkeit insgesamt auszuweiten.
Natürlich hat dieses nicht bloß systemkonforme, sondern quasi automatisch systemdienliche Finanzierungsverfahren seinen Preis. Ganz buchstäblich kostet es den Zins, der die Geldausleihungen des Staates zu geldkapitalistischer Vermögenssubstanz macht; dessen Höhe orientiert sich am ortsüblichen „Preis für Geld“ und gibt zugleich seinerseits ein Maß vor, an dem sich die Kalkulationen privater Geldanleger orientieren können und die Kreditkosten privater Schuldner ausrichten. Mit der Verzinsung setzt der Fiskus aber vor allem für sich selber das Maß fest, in dem er mit einem nationalökonomischen Erfolg seiner Politik rechnet. Er nimmt nämlich damit das zukünftige Wachstum seiner Finanzbasis, der Steuern abwerfenden nationalen Ökonomie, nicht bloß vorweg, sondern in vorab festgelegtem Umfang bereits in Anspruch – ganz analog zu einem kapitalistischen Schuldner, der für die Bedienung seines Kredits Teile des Profits verpfändet, den er damit zu erwirtschaften gedenkt. Darüber treten die Steuern, die dem Staat nicht genügen, zu den Schulden, die er deswegen aufnimmt, in ein neues, nämlich umgekehrtes Verhältnis: Die Schulden müssen sich in Gestalt steigender Steuereinnahmen bewähren, diese also den staatlichen Schuldenberg einschließlich der darauf zu zahlenden Zinsen rechtfertigen. Denn das Steueraufkommen ist ja die maßgebliche Erfolgsbilanz des nationalen Kapitalismus, der praktisch verbindliche Indikator dafür, ob und in welchem Maß die Vorschüsse der öffentlichen Hand sich in wachsender Kapitalverwertung niedergeschlagen haben.[12] Es fungiert daher als entscheidende Beglaubigung der Staatsschuld.
Mit Tilgung hat das nichts zu tun; im Gegenteil. Steuereinnahmen, die eine befriedigende nationale Wachstumsbilanz darstellen, sind die beste Voraussetzung für Großzügigkeit bei der Kreditaufnahme: Sie beweisen die gestiegene Verschuldungsfähigkeit des Gemeinwesens. Umgekehrt tritt mit jeder ungünstigeren Entwicklung der Steuereinnahmen ein wachsender staatlicher Kreditbedarf zutage: Ganz offensichtlich hat die Regierung dann ja fürs Wachstum entschieden zu wenig getan. So oder so tendiert die Staatsverschuldung dazu, eher zu- als jemals abzunehmen. Und das hat Folgen.
3. Inflation
Mit dem staatlichen Finanzbedarf, der durch Schulden gedeckt wird, wächst nicht bloß das Kreditvolumen, mit dem das nationale Geldkapital wirtschaftet. Über die Masse des im Zuge gelungener Kapitalvermehrung verdienten Geldes hinaus werden fortlaufend und dauerhaft zuschüssige Massen an gesetzlichen Zahlungsmitteln in die Zirkulation geschleust: Kreditzeichen, die kraft staatlicher Autorität gar nicht bloß den Schuldenstand repräsentieren, dem sie ihre Schöpfung verdanken, sondern Einheit für Einheit einen davon unabhängigen festen Wert. Dieser Wert, der gesetzlich fixierte Geldcharakter der amtlichen Zahlungsmittel und aller darin gemessenen Vermögenssummen, wird durch die staatlich verursachte und per Notenbank autorisierte Aufblähung der nationalen Kreditgeldmasse seinerseits affiziert: Wie die Staatsschuld steigende, so zeigt der durch die nationale Währungseinheit bezeichnete Geldwert sinkende Tendenz. Das ist die notwendige Konsequenz des Widerspruchs, den der bürgerliche Staat sich hier leistet: Er erklärt Banknoten, die den nationalen Kredit repräsentieren, zum Geld der Nation, so als würden sie zuverlässig den kapitalistischen Ertrag des Kredits beziffern; dabei läßt er gleichzeitig seine eigenen Schulden, die überhaupt keinen kapitalistischen Ertrag enthalten, in eben diesem Kredit-Geld-Zeichen als wirklichen Reichtum der Nation zirkulieren. Unweigerlich repräsentiert die nationale Währung dann in jeder ihrer gesetzlich gültigen Einheiten ein Stück dieses gar nicht verwerteten, aber weiter als gültig behaupteten Kredits, also einen schlechterdings nicht existierenden Wert mit.
In welchem Maß sie das tut, das hängt davon ab, wie gut die Staatsverschuldung beim Kapitalwachstum „anschlägt“, hoheitlich verausgabter Kredit also durch vermehrte Wertproduktion gerechtfertigt wird; in dem Maße relativiert sich eben auch die Minderung des wirklichen Werts, für den das nationale Kreditgeld gesetzlich geradesteht. Ein Wertverfall tritt aber allemal ein: Er ist, andersherum betrachtet, die notwendige Konsequenz der ökonomischen Wahrheit, daß wirklicher Geldwert nur durch Produkte konstituiert wird, in denen sich kapitalistisch lohnend angewandte Arbeit vergegenständlicht hat. Diese Eigenart des kapitalistischen Reichtums, die dessen Liebhabern so fremd ist, wird nicht dadurch außer Kraft gesetzt, daß der bürgerliche Gewaltmonopolist mit der Macht seiner Gesetze den von ihm ausgenutzten Funktionalismus einer durch Schulden geschaffenen „Liquidität“ zur nationalen Geldsache erklärt. Sie macht sich im Gegenteil eben darin geltend, daß sich das so dekretierte Staatsgeld, Maß aller Dinge im kapitalistischen Erwerbsleben der Nation, als einigermaßen relative Angelegenheit herausstellt: Es muß sich selber am eigentlichen Geldwert messen lassen und erweist sich darin als bloßer Geldersatz, daß es im Laufe der Zeit eine immer geringere Portion jener privaten Macht enthält, deren Maß und schlagkräftiger Inbegriff es doch daheim wie in aller Welt darstellt.
Dieser „Offenbarungseid“ stellt sich praktisch als naturwüchsige Folge der kapitalistischen Sitte ein, die Zahlungsfähigkeit des Publikums nach Kräften auszunutzen. Die zunehmende Masse liquider Mittel in der Gesellschaft, die gar nicht durch die – gelaufene oder im Kredit antizipierte – Produktion käuflicher Güter entstanden sind und trotzdem kraft staatlicher Setzung als definitives kapitalistisches Kauf-, Zahlungs- und Wertaufbewahrungsmittel gelten und fungieren, gestattet es den Verkäufern, bei aller Konkurrenz untereinander ihre Ware insgesamt zu steigenden Preisen zu verkaufen. Die so zustandegebrachte allgemeine Teuerung läßt sich, statistisch kunstvoll aufbereitet, am Kaufmittel als prozentuale Entwertung ausdrücken und wird dann als Inflationsrate bekanntgegeben. Was deren praktische Auswirkungen betrifft, so ist mit dieser Entstehungsgeschichte immerhin schon soviel klar, daß die Kapitalisten, bevor sie dadurch in irgendeine Verlegenheit gebracht werden, im Durchschnitt erst einmal ihren Nutzen gewahrt haben: Sie machen ja die immer höheren Preise, aus denen sich dann irgendein Mittelwert errechnen läßt. Ebenso selbstverständlich ist auf der anderen Seite eine prozentuale Schädigung derjenigen, die mit einer gleichbleibenden, weil tarifvertraglich festgelegten Einkommenssumme ihren immer teureren Konsum zu bestreiten haben. Beide Effekte haben auf alle Fälle nichts Systemwidriges an sich.
Es bleibt freilich ein gewisser Widerspruch, daß über all dem aufwendigen Einsatz, den der Staat für das Wachstum des kapitalistischen Reichtums in seiner Nation leistet, die Maßeinheit dieses Reichtums und damit das Maß des Wachstums in Mitleidenschaft gezogen wird. Nominelles und reales Wachstum treten auseinander; nomineller und realer abstrakter Reichtum überhaupt unterscheiden sich, weil die Wertminderung ja nicht bloß den Zuwachs, sondern die in nationaler Währung bezifferte und existierende Vermögenssubstanz selbst betrifft. Tatsächlich treten in dieser Differenz – so verfremdet und so dinglich, wie sich das für eine kapitalistische Wirtschaft gehört – das kreditfinanzierte staatliche Wachstumsprogramm und dessen Erfolg zueinander ins Verhältnis; sie ist selber eine praktische Bilanz über das erreichte im Verhältnis zum per Staatsverschuldung antizipierten nationalen Kapitalwachstum – also über das politökonomische Gelingen der Herrschaft im bürgerlichen Staat.
Dessen Macher nehmen sich denn auch die Inflationsrate als ein wichtiges Kriterium ihrer Politik zu Herzen. Zuerst einmal bringen sie sie aber tatkräftig zustande: Sie verarbeiten Aufgaben und Mittel der Staatsgewalt zu einem großen politökonomischen Plan; und den setzen sie unverdrossen Jahr für Jahr in die Tat um (Kap. III.). Mit dem Ergebnis haben sie dann so ihre Probleme (Kap. IV.).
III. Der Haushalt: Die staatliche Planung in Nationen, in welchen „Marktwirtschaft“ herrscht
Die jährlichen Haushaltsdebatten sind Auseinandersetzungen über die mehr oder minder gelungenen Leistungen der im Amt befindlichen Regierung. Und sie münden in Haushaltsbeschlüsse, die den künftigen Gebrauch der Staatsmacht umreißen. Daß die Entscheidungen über den zweckmäßigen Einsatz des Gewaltmonopols, über Gebote und Verbote, darüber, was der Staat von seinen Bürgern fordert und was er ihnen gewährt – daß sämtliche Maßnahmen der politischen Herrschaft als Akte korrekter bzw. verfehlter Kassenführung gewürdigt werden, hat seinen guten Grund. Die Macht wirtschaftet mit Geld, sie finanziert ihre Betreuung des nationalen Kapitalismus sowohl mit Geld, das sie der Gesellschaft entzieht, als auch mit Kredit, der auf das Geldwachstum im Lande berechnet ist; also teilt sie sich ein, und alles Regieren ist zugleich eine Frage des Haushaltens.
Daß mit der Einteilung des staatlichen Haushalts regiert wird, hat andererseits auch Folgen. Denn die bleibenden und in den diversen Ressorts für unabdingbar erklärten Aufgaben, die der Staat erledigen will, erfahren durch die Frage nach den verfügbaren Mitteln eine entscheidende Relativierung. Sie werden nicht einfach erfüllt und bezahlt; vielmehr überprüft der Staat jedes seiner Projekte, alles, was in seine Zuständigkeit fällt, daraufhin, ob es sich lohnt. Diese Prüfung nimmt ihren Ausgang bei einer Erfolgsbilanz, deren Erstellung naturgemäß die Parteien, die um die Ermächtigung durch die Wähler konkurrieren, zu einigem Eifer anstachelt. In ihren Kontroversen kommen einerseits die Titel zum Zug, die sich die Wahlvereine für die publikumswirksame Deutung der kapitalistischen Zustände zugelegt haben; andererseits kommt der Sachverstand in Sachen „Marktwirtschaft“ allemal zu seinem Recht, so daß über Ziele und Bedingungen eines ordentlichen Haushalts kein Dissens herrscht. Die Lage der Nation gilt allen Beteiligten – ob sie nun eher prächtig oder miserabel dargestellt wird – als Werk der Politik, die sich an der Zurichtung der Gesellschaft zu einem Hort kapitalistischen Geschäftslebens zu schaffen gemacht hat. Zwar kommt es vor, daß die Regierung angesichts unleugbarer Mißerfolge auf „Ohnmacht und Unschuld“ – mit Verweis auf die unberechenbaren Märkte und dergl. – plädiert; das praktische Dementi jedoch liefern dieselben Politiker postwendend ab, nachdem die Opposition auf „Versäumnis und Unfähigkeit“ entschieden hat: Sie danken nicht ab eingedenk der Fährnisse der Konkurrenz, denen sie sich ausgeliefert sehen. Vielmehr schreiten sie voller Tatkraft zu Maßnahmen, die der Nation zur Konkurrenzfähigkeit verhelfen. Und das Argument der „Ohnmacht“ reservieren sie für die Interessen, die darüber zuschanden werden: Die „können“ sie nicht bedienen …
1. Die Gestaltung des Haushalts
Die Erfolgsbilanz, an der die Politik Maß nimmt, um sie zu verbessern, verdankt sich der Beobachtungsgabe von regierungsfähigen Zeitgenossen. Die sehen und zählen nach – das Parlament wahrt den alten Brauch der Teichoskopie – was „draußen im Lande“ so los ist. Auf diese Weise erfahren sie zielsicher ihren Handlungsbedarf. Desgleichen sehen und zählen sie nach, was drinnen ist, in den staatlichen Kassen. Nachdem ermittelt ist, wieviel Betriebe pleite gehen, wieviel Jugendliche arbeitslos sind, wieviel Kinder nicht in Gärten gehen, worunter der Einzelhandel leidet, aber auch Polizei und Wehrmacht, entwerfen die für die Unterabteilungen kapitalistischer Lebensbewältigung zuständigen Ministerien ihre Programme. Die sind im demokratischen Rechtsstaat immer auch mit neuen Gesetzen verbunden; und weil alles staatliche Handeln auf seine Finanzierung angewiesen ist, sind mit einem Male etliche Anträge an das Finanzministerium in der Welt. Dieses Ressort ist mit der Verwaltung der staatlichen Konten betraut, aus denen die Mittel für die Wahrnehmung der Verantwortung genommen werden. Vom Vorhandensein bzw. von der kontinuierlichen Beschaffung des Geldes, das in der Staatskasse zur Verfügung steht, hängt die Realisierung der für fällig erachteten Regierungsvorhaben ab. Umgekehrt erwächst der Führung der Staatsfinanzen aus der Rolle des Zahlmeisters der Nation das höchstförmliche Gebot, haushälterisch mit den Summen umzugehen, die auf seinem Konto stehen. Der Standpunkt der Sparsamkeit ist die bleibende Pflicht des Finanzministeriums, das bei der Gewährung von Mitteln die Zahlungsfähigkeit der Staatskasse garantieren, erhalten muß.
Daran ändert sich auch nichts, wenn das Budget angesichts unabweisbaren Bedarfs mit Kredit aufgestockt wird. Wegen der Belastung des Etats, die verzinsliche Staatsschulden so mit sich bringen, ist die Kunst des Sich-Einteilens nicht hinfällig, sondern erst recht gefragt. Die gesicherte Finanzierung der mannigfaltigen Staatsaufgaben, die, als politische Notwendigkeiten begründet, lauter konkurrierende Ansprüche auf Teile des Etats darstellen, wird durch die eben diesen Etat belastende Staatsschuld zur ausdrücklichen Anforderung an den Finanzminister. Aufgrund der Gewohnheit, das Regieren mit Kredit zu bezahlen, gerät das Generve mit der Finanzierbarkeit aller inskünftigen guten Werke des Staates auf die Tagesordnung aller Haushaltsdebatten.
Den Beweis, einen soliden Haushalt zu managen, treten die Geschäftsführer ganzer Marktwirtschaften gleich auf dreifach Weise an. Erstens demonstrieren sie, daß sie Haushaltsmittel nicht nur gewähren, sondern auch kürzen und verweigern. Sie sparen also immer auch beim Geldausgeben. Zweitens unterrichten sie das Parlament und alle, die es wissen wollen, darüber, daß ihre Buchführung jeder Überprüfung standhält. Das Kunststück gelingt durch die Darlegung von Zahlen, denen zu entnehmen ist, daß sie in ihrer Eigenschaft als Geldbeschaffer mindestens genauso tüchtig sind wie beim Ausgeben. Ihre Geldquellen sind intakt, so daß die Einnahmen die Ausgaben – einschließlich derer für Schulden – decken und rechtfertigen. Im Zweifelsfall führt auch eine rechtzeitige Steuererhöhung zum gewünschten Ergebnis. Drittens schließlich bestehen sie darauf, daß die dem nationalen Kassenwart übertragene Aufgabe, per solider Haushaltsführung die kontinuierliche Finanzierung der Politik zu gewährleisten, sowieso nur zu erfüllen ist, wenn das Verhältnis zwischen den anfallenden Ausgaben und den Einnahmen in Ordnung gebracht wird. Finanzministerien lassen sich nicht auf die Pflicht beschränken, Ein- und Ausgänge sowie die unvermeidlichen Schulden zu bilanzieren; ihrem Amt entnehmen sie das Recht, die Politik, die sie finanzieren, darauf festzulegen, daß sie ihrer Bilanz dient. Ein großes Zerwürfnis zwischen den Waigels dieser Welt und ihren Kanzlern braucht man deswegen nicht zu befürchten – der Standpunkt der Finanzpolitik ist fester Bestandteil kapitalistischen Regierens und genießt höchste Autorität. Mit ihm legt die politische Herrschaft an sämtliche Abteilungen ihrer Machtausübung den unerbittlichen Maßstab an, den der Bedarf des Etats vorgibt: Alternativen des Regierens sind daraufhin zu begutachten, ob sie Geldquellen für den Haushalt der Nation mobilisieren.
Die Erstellung und Modifizierung des Staatshaushalts vollziehen demokratische Politiker zwar stets mit dem Gestus von Leuten, die eifrig bemüht sind, mit dem Geld des Staates ganz viel nützliche Dinge für Volk und Jugend, Gesundheit und Zukunft zu finanzieren. Über die betrübliche Feststellung, was in dieser Hinsicht wieder einmal nicht (mehr) möglich sei, bis hin zur Rechtfertigung der Haushaltsbeschlüsse mit dem Argument, sie wären ein vorzügliches Instrument der Geldbeschaffung, machen sie dann doch unübersehbar deutlich, worum es geht: Mit dem Haushalt organisiert der Staat die Sorte Wachstum im Lande, von dem er lebt
. In den Entscheidungen darüber, was finanziert werden muß und was nicht finanziert werden darf bzw. kann, – Entscheidungen, die alle im Namen eines soliden Rechnungswesens gefällt werden – verabschiedet er seinen kapitalistischen Einjahresplan, dessen Wirkungen freilich auch auf längere Dauer gemünzt sind. Der dritte Beweis für solides Haushalten beruft sich auf die Effizienz der Politik, die finanziert wird.
2. Haushaltsdebatten
sind daher auch keine eintönigen Veranstaltungen, in denen die einen behaupten, es sei genug Geld da, während die anderen beschwören, es reiche nicht. Die Veranstalter beziehen die fehlenden wie vorhandenen Finanzmittel immer auf ein „Wofür“. Der beklagte Geldmangel ist deswegen bedauerlich, weil eine Staatsleistung entfällt; und vorhandenes Geld wird in falsche Projekte gesteckt, so daß richtige Maßnahmen unterbleiben. Haushaltsentscheidungen verdanken sich einer an jeder staatlichen Maßnahme vorgenommenen Güterabwägung zwischen Kosten und Wirkung. Und da Kosten eben solche sind und der politökonomische Sachverstand weit und breit keine anderen Wirkungen entdeckt und für wünschenswert hält als die, welche den Erfolg einer nationalen Marktwirtschaft ausmachen, gerät der Streit um die Verwendung der Staatskasse doch recht eintönig. Für Wachstum und Arbeitsplätze läßt es sich ebenso trefflich sparen wie Schulden machen. Unter dem Gesichtspunkt der Nützlichkeit von Ausgaben für Einnahmen des Staates sind beide Ziele auch gar nicht mehr zu unterscheiden; desgleichen ist rentable Ökologie mit der Ökonomie versöhnt worden, so daß man mit zukunftssicherndem Naturschutz keinen Fanatiker der Wirtschaft mehr auf die Nerven zu fallen braucht. Daß es beim Gewaltapparat darauf ankommt, ihn ebenso schlank wie effektiv zu machen, steht ohnehin fest; das spart und kostet etwas …
Weil das Rechnen mit preiswerter Regierungstätigkeit den Leitfaden für das Streiten um einen gescheiten Haushalt abgibt, ist ein von der Regierung „eingestandener“ Geldmangel ein Zeugnis falscher Politik. Jedenfalls für die Opposition, die deswegen aber nicht zur Absage an die zentrale Ideologie von Haushaltsbeschlüssen schreitet. Sie kennt zwar allerlei Alternativen in bezug auf vergangenes wie künftiges Regieren, läßt jedoch nicht von der Verklärung der nationalen Finanzlage zum Sachzwang. Diese Manier, das Zahlenwerk der aktuellen Bilanz in eine Liste zwingender Gebote zu übersetzen, ist geeignet, sich ebenso zu den „Sachzwängen“, die der verabschiedete Haushalt in Kraft setzt, zu bekennen wie sich von ihnen zu distanzieren. Durch die Anerkennung des nationalen Geldwesens als Leitfaden ihrer Entscheidungen legt sich die Politik zugleich auf den Respekt vor den paar kapitalistischen Grundrechnungsarten fest, die für die Geldbeschaffung gelten. Staatsmänner brauchen dabei gar nicht mehr von ihrem marktwirtschaftlichen System zu verstehen als den Unterschied von „Wirtschaft“ und „Soziales“, zwischen „wachstumsfördernden“ und „wachstumshemmenden“ Maßnahmen; gute Dienste tut da die Trennung von „investiven“ und „konsumtiven“ Staatsausgaben; natürlich trägt die Politik Verantwortung für Arbeitsplätze im Lande, zumal die staatlichen Kassen unter der Arbeitslosigkeit erheblich leiden – da die Politik aber keine Arbeitsplätze schaffen kann, sondern die Wirtschaft dafür zuständig ist, steht schon alles fest. Falsch wäre es, staatliches Geld für Arbeit auszugeben; die Wirtschaft – das sieht man an den Arbeitslosen – zahlt schließlich deswegen so wenig Arbeit, weil sie – Lohn(neben)kosten – zuviel für Arbeiter wie Arbeitslose bezahlen muß …
Solch aktuellen Demonstrationen des Sachverstandes, der sich an der Erstellung eines soliden Haushalts bewährt, ist der Wille zu sämtlichen Notwendigkeiten zu entnehmen, die einmal den Stoff für Kapitalismuskritik aller Art abgegeben haben. Unter Berufung auf die Nöte, die das Gemeinwesen mit seinem Geld hat, geht die Vollstreckung des handelsüblichen Zynismus aber unbehelligt ihren Gang. Arbeit, die ihren Mann eher schlecht als recht ernährt, gilt fachkundigen Verwaltern des Etats genauso als verwerflicher „Besitzstand“ wie der Standard an Sozialleistungen, den Haushaltspolitiker zum entschieden überhöhten Armutsniveau erklären. Für den Reichtum der Nation, den es auch noch gibt, bleibt die einzig senkrechte Verwendung übrig, die sich Demokraten in der Marktwirtschaft vorstellen können – nämlich die, die zu seiner Vermehrung beiträgt.
Deswegen besteht auch ein Haushalt in den 90er Jahren, in denen die Politik zugegebenermaßen großen Wert auch nützliche Armut legt, nicht nur in der moralisch heftig diskutierten, aber sachlich gebotenen Kostensenkung bei der „Lebenshaltung“. Der Etat gilt nach wie vor auch der Finanzierung aller Umstände, in denen Wachstum allein gedeihen kann; es wird nach allen, also beiden, Gesichtspunkten: des Sparens und der Effizienz jede Staats„funktion“ (vgl. Kap. II) durchgemustert – und da kann manches gar nicht teuer genug sein.[13]
Daher mangelt es auch heute nicht an Bemühungen, von Grund und Zweck, den die zu Selbstverständlichkeiten gewordenen Staatsaufgaben haben, vornehm abzusehen, um ihnen bzw. ihrer Finanzierung einen guten Grund anzudichten. Diese Übung fällt um so leichter, als das staatliche Geldausgeben allemal in irgendein Geschäft mündet, Einkommen und Arbeitsplätze „erzeugt“ und sich irgendwie im Bruttosozialprodukt niederschlägt. In bisweilen abenteuerlichen Berechnungen von ökonomischen Wirkungen, die sich durch großzügige Finanzierung eines Projekts einstellen, rechtfertigt die mit VWL-Verstand begabte Politik die Belastung des Budgets, die eigentlich gesenkt gehört. So ist jede Haushaltsdebatte ein Tummelplatz für Ideologien, die allerlei Wirkmechanismen zwischen Sparen und Wachstum erfinden. Daß die behaupteten Zusammenhänge – als Theorie der „Marktwirtschaft“ ernstgenommen – nicht ganz stimmen, tut der Legitimation, der sie dienen, keinen Abbruch. Man läßt die wachstumsförderliche und arbeitsplatzstiftende Wirkung einfach bei den Staatsmaßnahmen gelten, bei denen der Preis keine Rolle spielen darf; in anderen Abteilungen wird der segensreiche ökonomische Effekt dann abgestritten und sich darauf besonnen, daß verstaatlichtes Geld und seine Verausgabung nie ein Ersatz für das Wachsen privaten Eigentums sein kann, weil es letzteres eher beschränkt. Im Reich der haushaltspolitischen Güterabwägungen pflegt die Politik den Glauben an ihre Ideologien eben dosiert: Fortschritte in der nationalen Kriegskunst schaffen natürlich Arbeitsplätze; sie unterhalten ja auch den rentablen Geschäftsgang der Rüstungsindustrie; so daß das Geld der Gesellschaft sinnvoll angelegt ist. Andererseits ist die Förderung der Kriminalität einfach nicht im Staatshaushalt unterzubringen, obwohl das Verbrechen für einige Arbeitsplätze gut ist. Zwischen den eindeutig positiven oder negativ entschiedenen Fällen existiert ein weites Feld staatlichen Handlungsbedarfs, dessen Notwendigkeit zwar feststeht, dessen Erfüllung unter dem Gesichtspunkt des „Sich-Lohnens“, der Rechtfertigung des finanziellen Aufwands aber fraglich ist. Der gute Rat kommt da von den Konjunkturen des nationalen Geschäfts; und manche „Investition in die Zukunft“ ist ihrer Untauglichkeit überführt, wenn die „Staatsquote“ am nationalen Wirtschaftsleben, also im Verhältnis zu ihm, unerträglich „hoch“ ausfällt. So disparaten Angelegenheiten wie Atomkraftwerken, der Volksgesundheit und den Renten widerfährt dann dasselbe Schicksal des Ab- und Umbaus …
Unvermeidlich bei der Verabschiedung eines ordentlichen Haushalts, der ausgehend von einem Kontostand des Staates die Bezahlung notwendiger Staatstätigkeit wachstumsnützlich zu organisieren hat, ist der prüfende Blick auf die Geldmittel, die zur Verfügung stehen. Deren Zusammensetzung – Steuereinnahmen addieren sich zu den Schulden und bilden die Manövriermasse der Nation – veranlaßt noch jeden Finanzminister, die Ökonomisierung der Schulden in Angriff zu nehmen. Die Verbesserung des Verhältnisses zwischen beiden Bestandteilen des Etats ist Pflicht – ob es nun um die Vermeidung neuer Schulden, um deren Rechtfertigung oder um dauerhafte Bedienung alter Kredite geht. Vom elementaren Standpunkt des Sich-Einteilens sinnt jede Haushaltspolitik nicht nur darauf, über die Wirkungen geplanter Marktbetreuung lang- und mittelfristig den Etat finanzieren zu lassen; die der freien Wirtschaft zugedachte Rolle, sich als Geldquelle der Nation zu bewähren, ist allemal eine Frage des Maßes, in dem die Regierung die Bürger zur Unterhaltung des Staates heranzieht.
Weil Steuererhöhungen die Politik dazu befähigen, mehr von ihren guten Werken zu finanzieren, begleitet die Fahndung nach Gelegenheiten zum Abkassieren einiger Prozente das ganze Jahr über die haushälterische Gesetzgebung. Deswegen findet die Anhebung von Steuersätzen auch immer wieder statt – allerdings nicht umstandslos. Eingedenk des Haupt- und Generalzwecks des Haushalts – der Beförderung des Wachstums – sucht die Politik nach Wegen der Besteuerung, die dem Wachstum nicht schaden. Sie versetzt sich allen Ernstes in die Rolle der „Wirtschaft“, deren Erfolgskriterium im Verhältnis von Kosten und Überschuß liegt, und befindet, daß Steuern das Wachstum behindern, zumindest empfindlich einschränken. Darauf bedacht, möglichst viel Steuern einzusammeln, achtet der Regisseur des Etats auf die Schonung seiner Quellen, damit aus niedrigen Raten große Massen an Geld in die Staatskasse fließen. Die Verfolgung dieses Prinzips, die sich dem Ideal verschreibt, der „Wirtschaft“ nur das abzuknöpfen, was sie im wahrsten Sinne des Wortes übrig hat, führt zu ideologischen Höchstleistungen und zu steuertechnischen Lösungen, die dem Ideal recht nahe kommen.
Steuersenkungen sind geboten, weil sich wegen der Steuern die Geschäfte nicht rentieren, also „Leistung bestraft“ wird. Wenn Politiker bemerken, daß die von ihnen regierte Marktwirtschaft das Wachstum nicht hinkriegt, für das sie ihren Haushalt Jahr für Jahr neu einteilen und ausbauen, werden sie zu selbstkritischen Komikern. Sie erklären dann schon einmal den Staat
mit seinem Etat zum untragbaren Hindernis für das nationale Geschäft, zu einer einzigen Belastung „der Wirtschaft“. Freilich schreiten sie anschließend nicht zur Vereinsauflösung, sondern zum nächsten Haushaltsbeschluß, den sie um eine Steuerreform ergänzen. Die muß eine deutliche Entlastung der Wirtschaft bringen, welche einerseits vom Rest der Welt „gegenfinanziert“ werden muß. Gerechterweise besteht die Haushaltspolitik andererseits darauf, daß die Geschäftswelt dann aber brav ihrer Tributpflicht nachkommt und ohne die alte Form der Entlastung – die „Steuerschlupflöcher“ – blüht und gedeiht.
Wenn im Parlament und in der Öffentlichkeit über Alternativen des Staatshaushalts beraten wird und die kontroverse Suche nach dem effizientesten Umgang mit Geld und Schulden tobt, versteigt sich der nationalökonomische Eifer zu manch verwegener Theorie. Das ist erstens nicht zu vermeiden, wenn alles, was Gegenstand staatlicher Fürsorge ist, als Faktor des Wirtschaftswachstums behandelt wird; und zweitens nicht weiter schlimm, weil jeder Haushalt den vorhergehenden korrigiert. Der Staat lernt in Gestalt seiner Bilanzbuchhalter aus der Praxis; und die stellen an den Wirkungen früherer Entscheidungen auf die nationale Bilanz immer wieder fest, was sich als lohnende Investition von einer kostspieligen Subvention unterscheidet. Daß sich trotz aller ideologischer Auffassungen bezüglich nationalökonomischer Ursachen und Wirkungen – in Deutschland profilieren sich Politiker mit einer gesicherten Hypothese über die Zahlungsfähigkeit des breiten Publikums, die an den Ladenöffnungszeiten zuschanden wird; daß der Staat eben diese Zahlungsfähigkeit zu beschränken hat, wenn sie als Lohnniveau in Betracht kommt, gilt ihnen als genauso gewiß. Sogar als Beschaffer von Kriegsgerät denken Staatsmänner strikt ökonomisch. Da kommt es schon mal zum „kostenwirksamsten Jagdflugzeug der Welt“ usw. – eine beachtliche Zielsicherheit in der Entscheidungsfindung einstellt, ist kein Wunder. Denn sämtliche Einfälle speisen sich aus den schlichten und fundamentalen Fragen: Was steigert die Rentabilität im Land? Was steht dem Gang der Geschäfte im Wege? Was trägt zur Verbesserung der staatlichen Haushaltslage bei? Was entlastet den Etat, was erweist sich als unnütze Belastung? Mit diesem Handwerkszeug bringt es jede Regierung dahin, ihre Gesellschaft zu einem Kapitalismus herzurichten, wie er im Buche steht. Und wer einmal Marx studiert hat, stellt gar nicht erstaunt fest, daß alle Bestimmungen, die dieser Theoretiker von den Notwendigkeiten der kapitalistischen Produktionsweise aufgeschrieben hat, selbst heute noch und sogar in der Praxis vorkommen: als Bedingungen, die der Gesellschaft für Produktion, Verteilung und Konsum von Reichtum aufgeherrscht werden…
Wenn Politiker das nationale Haushaltswesen fortschreiben und auf die Perfektionierung der Bedingungen des kapitalistischen Geschäftsgangs dringen; wenn sie ihr Regieren mit dem Instrument des nationalen Geldwesens zur Verordnung von immer neuen „Sachzwängen“ ausgestalten; wenn die Befolgung dieser „Sachzwänge“ und die Ausnützung staatlicher Leistungen umgekehrt auf das Ziel verpflichtet ist, über die Ausdehnung der Privatmacht des Geldes – und nichts anderes ist „Wirtschaftswachstum“ – die Staatsmacht mit Geld auszustatten; dann ist nicht nur eine „volkswirtschaftliche Gesamtrechnung“ in der Welt. Sondern auch die Frage, ob sie aufgeht.
Die stellt sich aufgrund der staatlichen Gewohnheit, die freie Konkurrenz mit Kredit zu bewirtschaften, und wegen der Internationalisierung des Geschäfts dauernd – und in der Form des Problems, ob das Wachstum in der Nation die Unversehrtheit des Geldes gewährleistet.
IV. Das letzte Erfolgskriterium des Haushalts: Stabilität des Geldes
Wenn die ausgiebige Betreuung der nationalen Marktwirtschaft ein Wachstum hervorruft, dann war die Haushaltsführung in Ordnung; die Bilanz des Etats, der als Ausgangspunkt für die Fortsetzung der Regierungskunst dient, zeigt an, daß von der staatlichen Geldmacht ein korrekter Gebrauch gemacht worden ist. Daß ganz viel, möglichst Voll-Beschäftigung stattfindet, registriert jede Regierung ebenso als Ausweis ihres Erfolgs. „Beschäftigung“, die in der Marktwirtschaft sowieso nur stattfindet, wenn sie rentabel ist, drückt eben auch aus, daß das Geschäft geht. Zur Ehre eines eigenständigen Kriteriums für eine gesunde Nationalökonomie ist sie deswegen gekommen, weil Wachstum und Beschäftigung überhaupt nicht im Gleichschritt marschieren. Respektable Erfolge in Sachen Rentabilität beruhen auf Rationalisierung, auf der Einsparung bezahlter Arbeitskräfte. Und der Staat mit seiner Abteilung Soziales verbucht diese Konsequenz des Wachstums als Belastung seines Etats. Daß das Gelingen des Geschäfts, zu dem die Nation die „Wirtschaft“ ermächtigt, nicht automatisch mit einem Etat zusammenfällt, der das Finanzministerium und die Bank der Nation, die den Staatsschatz verwaltet, zufriedenstellt, tritt auch beim auswärtigen Handel zutage. Findige Volkswirtschaftler, die das kapitalistische Treiben vom Standpunkt des intakten Haushalts begutachten, kennen daher ein drittes Gebot für nationalkapitalistische Planung. Zumindest eine ausgeglichene Handelsbilanz sollte sich schon einstellen, wenn sich der Verkehr von Ware und Geld, Arbeitskraft und Kapital über die Grenzen hinweg bewegt. Sonst kriegt nämlich die Nation Schulden beim Ausland und wird gefragt, womit sie diese saldiert. Das Geld, das in der Nation verdient wird, landet in den Kassen der anderen. So wird die Internationalisierung des Geschäfts, der unverzichtbare Hebel des Wachstums, zur Gefahr für die Bilanz der Nation, für ihr Geld.
Daß ihr Geld im Interesse des internationalen Handels, des kontinuierlichen Zugriffs auf preiswerte „Faktoren“ des Wachstums prinzipiell Anerkennung genießt, führt freilich dazu, daß der Staat diese Gefahr noch in anderer Weise und ständig zu gewärtigen hat. Sein souveränes Recht, Kredit aller Art mit der Privatmacht des Geldes auszustatten, die sich im Erwerb von Eigentum und seiner Mehrung betätigt, hat auf dem Weltmarkt eine Beweispflicht zur Folge, der seine Währung tagtäglich genügen muß. Weil der Staat seinen Haushalt durch die Vermehrung seiner Schulden bestreitet, die sich in einer steigenden Anzahl von zirkulierenden Geldeinheiten niederschlagen, relativiert sich deren Brauchbarkeit. Der Inflation, der Veränderung der Kaufkraft einer Geldeinheit, trägt auf dem Weltmarkt der Währungsvergleich Rechnung. Über die Ermittlung von Wechselkursen erhalten Besitzer der verschiedenen Nationalgelder nicht nur die Auskunft, daß sie über weltweit anwendbares Geld verfügen; sie erfahren auch, in welchem Maß ihnen der Zugriff auf Reichtum jeder Sorte und Provenienz offensteht. Und zu diesen Besitzern zählen nicht nur Privatmenschen, die mit der praktischen Elementarfrage befaßt sind, was sie besitzen und wieviel sie sich für ihr Geld kaufen können, nicht nur Geschäftsleute, deren Kalkulation über Preisvergleiche läuft, die vom „Preis“ der nationalen Gelder entscheidend beeinflußt werden. Auch die Geldmacht der Nation, was sie mit ihrem Etat zur Betreuung des Landes wie bei der Regelung ihrer Zahlungsbilanz leisten kann, hängt von der internationalen Kaufkraft ihres Geldes ab. So nimmt es nicht wunder, daß das Ziel der Geldwertstabilität die Kriterien soliden Haushaltens zum „magischen Viereck“ komplettiert.
1. Vom Scheitern und Gelingen der Haushaltspolitik
Die Güterabwägungen, die in Haushaltsdebatten vorgenommen werden, fallen durch die Berücksichtigung der Imperative, die das magische Viereck der VWL zu befolgen empfiehlt, nicht einfacher aus. Wenn es gar ein Stabilitätsgesetz gibt, lassen sich alle Entscheidungen mit dessen Buchstaben wie Geist aufs Trefflichste verteidigen wie kritisieren. Damit kommt es anläßlich der Suche nach einer Balance zwischen nützlichem Sparen hie und notwendigen Schulden da zu jenen notorischen Generalabrechnungen mit der Politik, die den ganzen nationalen Laden heruntergewirtschaftet hat. Und für einen Regierungswechsel sind mißratene Bilanzen stets gut, wenn sich Leistungen der Politik in den diversen Unterabteilungen zu einem Verstoß gegen die obersten Prinzipien des ökonomischen Nationalismus zusammenzählen lassen.
Diesem Brauch tut auch die betrübliche Entdeckung keinen Abbruch, daß Wachstum ohne Arbeitslose nicht zu haben ist und seine Betreuung durch den Staat immer Inflation mit sich bringt; daß das Viereck „magisch“ heißt, weil seine Ziele gar nicht miteinander zu erreichen sind, nehmen Regierende sogar ausdrücklich zur Kenntnis und bekennen sich – wenn die Ausschließlichkeit sich als tatsächlicher „Sachzwang“ bemerkbar macht – zu den Notwendigkeiten ihrer Wahl. Da ist einem deutschen Kanzler einst das Schwinden der Preisstabilität als ein Preis vorgekommen, den man zahlen könne, um das Ansteigen der Arbeitslosigkeit zu vermeiden. Zwanzig Jahre später heißt die Devise – wg. Europa – erstens „Stabilität“; zweitens wird das Wachstum von Kapital, aus dem das Geld der Nation seine Kraft bezieht, als einzige Quelle von „Beschäftigung“ gepriesen, was auch die Entlassungen rechtfertigt, die das Kapital zum Wachsen braucht.
Anlaß zu der Annahme, daß sich hinter den beiden Phasen deutscher Regierungskunst und den verschiedenen Akzenten ihrer Selbstdarstellung zwei verschiedene, womöglich gegensätzliche Arten der Haushaltsregie verbergen, besteht allerdings nicht. Das mit „Stärke“ und „Stabilität“ des Geldes formulierte Programm setzt die „Preisstabilität“ und die „Beschäftigung“ stets zu Mitteln herab – der Erfolg der Nation fällt nicht damit zusammen, daß diese beiden Größen hoch oder niedrig geraten. Obwohl es sehr auf sie ankommt, demonstriert die Praxis gerade erfolgreicher Nationen, wieviel bei diesen Kriterien soliden Haushaltens „in Kauf genommen“ werden muß.
Wenn solche Nationen ihr Wachstum am letzten Erfolgskriterium ausrichten: wenn sie damit befaßt sind, ihren Kredit für den internationalen Gebrauch mit den Garantien auszustatten, die ihn zu Geld machen, dann buchstabiert sich das Gelingen bzw. Scheitern ihres Haushalts auch etwas anders als in den volkstümlichen Haushaltsdebatten…
Die Fortsetzung handelt von der Pflege nationalen Wachstums zur Herstellung und Wahrung internationaler Geldmacht.
[1] Das Geld ist das reale Gemeinwesen, insofern es die allgemeine Substanz des Bestehens für alle ist, und zugleich das gemeinschaftliche Produkt aller.
Die wechselseitige und allseitige Abhängigkeit der gegeneinander gleichgültigen Individuen bildet ihren gesellschaftlichen Zusammenhang. Dieser gesellschaftliche Zusammenhang ist ausgedrückt im Tauschwert, worin für jedes Individuum seine eigene Tätigkeit oder sein Produkt erst eine Tätigkeit und ein Produkt für es wird; es muß ein allgemeines Produkt produzieren, – den Tauschwert oder, diesen für sich isoliert, individualisiert, Geld. Andrerseits die Macht, die jedes Individuum über die Tätigkeit der anderen oder über die gesellschaftlichen Reichtümer ausübt, besteht in ihm als dem Eigner von Tauschwerten, von Geld. Es trägt seine gesellschaftliche Macht, wie seinen Zusammenhang mit der Gesellschaft, in der Tasche mit sich.
(Marx, Grundrisse S.137 u. S.74f.)
[2] Historisch war es ein großer Schritt bei der Erzwingung kapitalistischen Wirtschaftens, daß der feudale Souverän von Naturalabgaben abging und anfing, Geldsteuern einzutreiben. Das Geld, das er den Untertanen wegnahm, hatten diese sich erst zu beschaffen. Am Auftrag, für den Verkauf zu produzieren, haben sich die Bauern und Handwerker geschieden. Die Erfolgreichen mauserten sich zu Warenproduzenten und Unternehmern, die Steuern zahlen konnten; die anderen verloren durch die Ablieferungspflicht, der sie nicht entsprechen konnten, ihre Subsistenz. Marx bezeichnet die Merkantilisten als Dolmetscher dieses historischen Übergangs: Es ist das der Periode der kapitalistischen Entwicklung, die sie darstellen, Adäquate darin (in ihrer Theorie), daß es bei der Verwandlung der feudalen Ackerbaugesellschaften in industrielle und bei dem entsprechenden Kampf der Nationen auf dem Weltmarkt auf eine beschleunigte Entwicklung des Kapitals ankommt, die nicht auf dem sog. naturgemäßen Weg, sondern durch Zwangsmittel zu erreichen ist. Es macht einen gewaltigen Unterschied, ob das nationale Kapital allmählich und langsam sich in industrielles verwandelt, oder ob diese Verwandlung zeitlich beschleunigt wird durch die Steuer, die sie vermittelst der Schutzzölle hauptsächlich auf Grundeigentümer, Mittel- und Kleinbauern und Handwerk legen, durch die beschleunigte Expropriation der selbständigen unmittelbaren Produzenten … Der nationale Charakter des Merkantilsystems ist daher nicht bloße Phrase im Munde seiner Wortführer. Unter dem Vorwand, sich nur mit dem Reichtum der Nation und den Hilfsquellen des Staates zu beschäftigen, erklären sie in der Tat die Interessen der Kapitalistenklasse und die Bereicherung überhaupt für den letzten Staatszweck und proklamieren sie die bürgerliche Gesellschaft gegen den alten überirdischen Staat. Aber zugleich ist das Bewußtsein vorhanden, daß die Entwicklung der Interessen des Kapitals und der Kapitalistenklasse, der kapitalistischen Produktion, die Basis der nationalen Macht und des nationalen Übergewichts in der modernen Gesellschaft geworden ist.
(Marx, Das Kapital Bd. 3, S.793)
[3] „Die Deutsche Bundesbank ist eine bundesunmittelbare juristische Person des öffentlichen Rechts. Das Grundkapital der Bundesbank beträgt 290 Mio. DM. Es gehört dem Bund als dem Träger der Währungshoheit. Ihm fließt auch der Gewinn zu.“ (Die Deutsche Bundesbank, Geldpolitische Aufgaben und Instrumente, Sonderdrucke der Deutschen Bundesbank Nr. 7, 6. Aufl. Frankfurt am Main 1993, S.7)
[4] „Inzwischen ist es allgemein akzeptiert, daß es für die Werterhaltung des Geldes weder erforderlich ist, noch genügt, die ausgegebenen Noten durch Gold oder Devisen zu ‚decken‘, sondern daß es letztlich auf eine knappe Geldversorgung ankommt.“ (a.a.O., S.4f.)
[5] Im Zuge der Vorbereitungen auf die europäische Währungsunion und anläßlich des Streits über deren Ausgestaltung erfährt das allgemeine Publikum Sachen, die sonst nur Spezialisten wissen. Deutschland streitet sich z.B. mit den Nachbarn um den zukünftigen Anteil der deutschen Bundesbank an den Notenemissionsgewinnen der europäischen Zentralbank. Das sind Einkünfte aus Vermögenswerten, die sie als Gegenposten zum Bargeldumlauf und zu ihren Verbindlichkeiten aus Einlagen der Kreditinstitute hält. Im Klartext geht es um Geldschöpfungsgewinne der Zentralbanken. Jede Zentralbank macht Gewinne aus dem Umfang und der Erweiterung des Zentralbankgeldes, denn sie verkauft das neue Geld gegen zinsbringende Wertpapiere an die Geschäftsbanken. In der Bilanz der Notenbank stehen diese zinsbringenden Vermögenswerte dem Bargeldumlauf und den Bankeinlagen der Passivseite gegenüber.
(FAZ 5. Juli 1997)
[6] Manche traditionsreiche Banknoten unterscheiden sogar noch explizit, eingedenk ihrer Herkunft aus dem privaten Banknotengeschäft und entgegen ihrer wirklichen Funktion als gesetzliches Zahlungsmittel, zwischen sich als bloßem Geldversprechen und dem Geld, auf das sie eine Anweisung wären. 10 Pfund Sterling, steht z.B. auf dem entsprechenden britischen Geldschein, seien „zahlbar dem Halter dieser Note.“
[7] Der Banknotenumlauf erscheint als Verbindlichkeit auf der Passivseite der Zentralbankbilanz; Gläubiger sind die jeweiligen Besitzer der Noten. … Geld in modernen Geldwirtschaften hat Kreditcharakter. … Zentralbankgeld ist eine Verbindlichkeit der Notenbank. Es entsteht durch Aktivgeschäfte der Notenbank mit Nichtbanken und Geschäftsbanken. Die Zentralbank erwirbt Forderungen, indem sie dem Ausland und den inländischen öffentlichen Haushalten und Banken Kredite gewährt oder von ihnen Finanzaktiva ankauft. Deren Gegenposten schlagen sich in gleicher Höhe auf der Passivseite der Notenbankbilanz in verschiedenen Formen des Zentralbankgeldes nieder.
(Obst/Hintner, Geld-, Bank- und Börsenwesen, 39.Aufl. Stuttgart 1993, S.6f. und 25)
[8] Die Bundesbank hat allein das Recht, auf D-Mark lautende Banknoten auszugeben (Notenmonopol). Diese Noten sind in Deutschland zugleich das einzige unbeschränkte gesetzliche Zahlungsmittel. Jeder Gläubiger einer Geldforderung muß sie in unbegrenztem Umfang als Erfüllung seiner Forderung annehmen.
(Die Deutsche Bundesbank, a.a.O.. S.16f.)
[9] Der Gewaltmonopolist herrscht den Leuten die Konkurrenz ums Eigentum als ihre „conditio humana“ auf; dann feiert er sich als zivilisatorische Errungenschaft, weil er die gesellschaftliche Gewalt, die er damit ins Werk setzt, für sich reserviert und nur nach sinnreichen, dem Eigentum gemäßen Regeln exekutiert. Das wäre zynisch zu nennen, hätte es sich jemand ausgedacht.
[10] Die DDR hat es vier Jahrzehnte lang zu spüren bekommen – und ist am Ende nicht zuletzt daran zugrundegegangen –, daß ein Staat als Machtsubjekt überhaupt erst fertig ist, wenn sein Monopol auf sein Volk unbestritten und ohne Alternative ist; nur dann weiß auch das Volk, wo es hingehört, und kann er sich auf die Seinen verlassen. Derselben „Logik“ der Staatsangehörigkeit folgen Separatisten, die mit der Durchlöcherung des geltenden Gewaltmonopols die Eröffnung eines eigenen betreiben, ebenso wie die von solchen Umtrieben betroffenen höchsten Gewalten, die alles tun, um eine solche Alternative nicht bloß zu kriminalisieren, sondern zu eliminieren.
[11] Generell gilt immer noch folgendes Prinzip: „Die Ablösung der travaux publics vom Staat und ihr Übergehen in die Domäne der vom Kapital selbst übernommenen Arbeiten zeigt den Grad an, wozu sich das reelle Gemeinwesen in der Form des Kapitals konstituiert hat. … Die höchste Entwicklung des Kapitals ist, wenn die allgemeinen Bedingungen des gesellschaftlichen Produktionsprozesses nicht aus dem Abzug der gesellschaftlichen Revenue hergestellt werden, den Staatssteuern, sondern aus dem Kapital als Kapital. Es zeigt dies den Grad einerseits, worin das Kapital sich alle Bedingungen der gesellschaftlichen Produktion unterworfen, und daher andererseits, wieweit der gesellschaftliche reproduktive Reichtum kapitalisiert ist und alle Bedürfnisse in der Form des Austauschs befriedigt werden.“ (K. Marx, Grundrisse…, S.437 f.) Diese Entwicklungstendenz ergibt sich schon daraus, daß das Kapital sich leicht tut, mit „Infrastrukturleistungen“ Profit zu machen, wenn der Staat sein Land erst einmal damit ausgestattet hat, die gewichtigsten Investitionen getätigt sind, die Marktverhältnisse und beispielsweise das entsprechende Verkehrsaufkommen sich berechnen lassen und so wundervolle Erfindungen wie das „Road-pricing“ alle technischen Probleme des Kassierens lösen. Am Ende kann dann sogar das staatsbürgerliche Informationsbedürfnis auf dem Wege des Werbeeinnahmen bringenden „Infotainment“ – auch einer „Form des Austauschs“! – bedient werden.
[12] Diese Bilanz ist selbstverständlich völlig unabhängig davon, in wievielen Einzelfällen sich ein solcher Zusammenhang nachweisen lassen mag. Es geht darum, daß ein nationales Wirtschaftswachstum die gelungene Verwandlung staatlichen Kredits in akkumulierendes Kapital beweist.
[13] So ist es so weit gekommen, daß an den zu Kindertagesstätten verkommenen Unis, wo wirklich keiner wissen will, wie Imperialismus geht, der Eurofighter dafür herhalten muß, den Sparzwang ins Unrecht zu setzen, unter dem der Universitätsbetrieb leidet. Und keiner erklärt den Studenten, daß die vielen Studienplätze, auf denen sie sich tummeln, ebenso wie die Enge, unter der sie leiden, die Konsequenz ein und desselben Haushaltskalküls sind. Der Ausbau der Universitäten war einmal Bestandteil deutscher Standortpolitik, also darauf gemünzt, die Konkurrenzfähigkeit der deutschen Nation zu steigern. Inzwischen ist den Politikern aufgefallen, wie wenig eine „Akademikerschwemme“ zum Reichtum der Nation beiträgt – jetzt ist der Betrieb „zu teuer“.