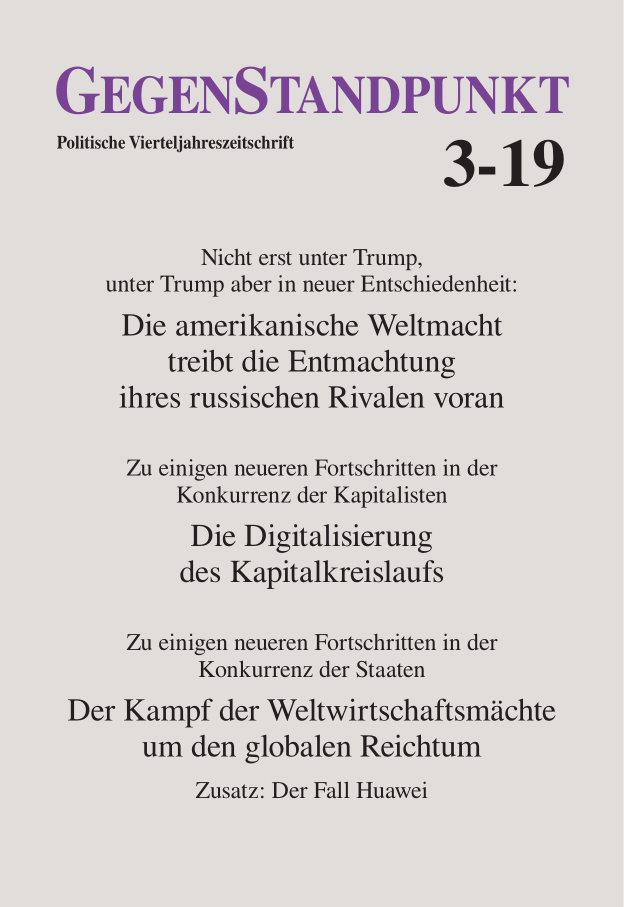Zu einigen neueren Fortschritten in der Konkurrenz der Kapitalisten
Die Digitalisierung des Kapitalkreislaufs
Vor ein paar Jahren ist im „Silicon Valley“ in Kalifornien der Kapitalismus neu erfunden worden. Das macht die VR China seither nach und im Geschäft mit der „künstlichen Intelligenz“ mittlerweile einiges vor. Um von diesem epochalen Fortschritt nicht abgehängt zu werden, betreibt die Berliner Politik mit großem Nachdruck die „Digitalisierung der Wirtschaft“. Die paar sachlichen Fortschritte in der kapitalistischen Konkurrenz, um die es tatsächlich geht, werden dabei leicht übersehen.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Siehe auch
Systematischer Katalog
Zu einigen neueren Fortschritten in der Konkurrenz der Kapitalisten
Die Digitalisierung des Kapitalkreislaufs
Vor ein paar Jahren ist im „Silicon Valley“ in Kalifornien der Kapitalismus neu erfunden worden. Das macht die VR China seither nach und im Geschäft mit der „künstlichen Intelligenz“ mittlerweile einiges vor. Um von diesem epochalen Fortschritt nicht abgehängt zu werden, betreibt die Berliner Politik mit großem Nachdruck die „Digitalisierung der Wirtschaft“.
Die paar sachlichen Fortschritte in der kapitalistischen Konkurrenz, um die es tatsächlich geht, werden dabei leicht übersehen. Die betreffen insbesondere:
- das Kaufmannsgewerbe,
- den Prozess der produktiven Wertschöpfung,
- den Kapitalvorschuss,
- Umfang und Art der Lohnarbeit.
I. W’ – G’: Die Nahtstelle zwischen Kapital und Endverbraucher
1. Facebook und Facebookartige: Die Perfektionierung der Kundenwerbung
Die Gemeinde der User, die sich in den sozialen Medien herumtreiben, versteht sich als Subjekt der Kommunikation, die da stattfindet, und täuscht sich in der entscheidenden Hinsicht. Mit ihrem lebhaften Meinungs-, Bilder- und sonstigen Austausch ist sie das Anhängsel kommerzieller Interessen, nämlich des Bemühens kapitalistischer Produzenten und Kaufleute, für ihre Waren zu werben, per Rückmeldung zu erfassen, ob und wie ihre Reklame ankommt, deren Erfolg mit personalisierter Werbung zu steigern und sich am Ende der Bedürfnisnatur der erreichten Kundschaft zu bemächtigen, nämlich diese Natur en gros und en detail nach ihren Verkaufsbedürfnissen zu bilden. Dieses Geschäftsinteresse bedienen die Konzerne der „Social-Media“-Branche in der Weise, dass sie viel Geld in einen für die User – was denen zu denken geben könnte – kostenlosen permanent verfügbaren universellen Vermittlungsdienst investieren, der bei jedem Gebrauch werbende Angebote mittransportiert und Rückmeldungen darüber sammelt, bei wem sich welche kommerziell eventuell ausnutzbaren Bedürfnisse abzeichnen bzw. stiften lassen. Dafür lassen sie sich aus dem Werbeetat ihrer kapitalistischen Kundschaft bezahlen.[1] In den Händen einiger weniger, im Prinzip weltweit und flächendeckend präsenter Unternehmen konzentriert, also wegen ihrer enormen Reichweite wird aus dieser Hilfsfunktion fürs Verkaufen ein Geschäft, das den Hauptveranstalter zu einem der größten Großkapitalisten weltweit gemacht hat. Sein Kapitalvorschuss – auch für den Aufkauf kleinerer Konkurrenten – ist beträchtlich; der Gewinn, den er den Warenhändlern aus aller Welt abknöpft, auch.
2. Google: Das globale Schaufenster
Apropos Weltmarkt. Den haben Industrielle und Handelskonzerne über die letzten anderthalb Jahrhunderte hinweg schon ganz gut alleine hingekriegt, ohne Internet und Suchfunktion. Dass das völkerverbindende elektronische Netz, das die USA für die Belange eines bis zum amerikanischen Sieg durchführbaren Atomkriegs geschaffen haben, für die kommerzielle Gier nach der Zahlungsfähigkeit der Weltbevölkerung aber auch einiges hergeben kann, das haben engagierte Telekommunikationsexperten dann ziemlich fix herausgefunden. Die Durchdringung der bürgerlichen Privatsphäre mit omnipräsenter Leuchtreklame – siehe 1. – geht auf ihr Konto. Und damit Hand in Hand geht die Einrichtung des totalen – globalen und allgegenwärtigen – Schaufensters, in dem die gigantische Warensammlung, die den materiellen Reichtum der kapitalistisch produzierenden Welt ausmacht und die Tag für Tag umgeschlagen werden will, mit Preisschildern versehen für den Zugriff der weltweiten Kundschaft bereitliegt. Daraus hat Google sein Geschäft gemacht.
Groß geworden ist die Firma mit ihrer Suchmaschine. Was immer jemand im Netz sucht, findet er schnell und treffsicher bei ihr. Ihr Suchalgorithmus durchforstet permanent das ganze Netz, rubriziert und indexiert Myriaden von Webseiten und zeigt sie dem breiten Publikum auf Anfrage; den Webbrowser, um Informationen abzurufen, bietet sie gleich mit an. Ebenso wie die Kollegen von den sozialen Medien betreibt sie Datenspeicher, Datenleitungen, verlegt sogar selber Überseekabel usw. Und ebenso wie bei Facebook & Co ist dieser Dienst für die Nutzergemeinde umsonst. Bezahlt wird er wieder von den kommerziellen Nutznießern, die darin die großartige Chance finden, sich mit ihrem Warenangebot einer nach oben offenen Zahl von Kunden zu präsentieren, die sie selber gar nicht erreichen könnten. Über den Dienstleister sind sie auffindbar, gegen ein gewisses Extra-Entgelt sogar auf einem guten Listenplatz vor anderen Bewerbern. Die ansehnlichen Summen, die Google damit verdient, zeugen von dem unbedingten schrankenlosen Bedarf der Geschäftswelt, Kunden aufzutun – und auf der anderen Seite davon, dass Google es geschafft hat, sich für die Geschäftswelt praktisch unentbehrlich gemacht zu haben. So fließen mit jedem neuen Kunden neue Einnahmen; und was die Sache so richtig ergiebig macht: ohne dass jedes Mal neue Ausgaben fällig werden.
3. Amazon: Vom findigen Buchhändler zum allgegenwärtigen Versandhändler, mit mehrfacher Vorbildwirkung
Der Schritt von der universell aktiven Such- und Vermittlungsfunktion zum die ganze Warenwelt umfassenden, global aktiven Versandhandel ist für die internetgestützte Abteilung des Handelskapitals konsequent, logisch und in dem Sinn nicht weit, jedenfalls nicht weiter als der von der ganz nebenher aufgedrängten personalisierten Reklame zum Kundenkontakt per Suchalgorithmus oder von der Suchmaschine zur Werbung. Für eine praktische Umsetzung, die über die bloße Kontaktvermittlung hinausgeht, sind allerdings eine materielle Vorratshaltung und der Aufbau einer Logistik nötig, die Investitionen in erst einmal abschreckender Größenordnung erfordern. Es ist deswegen kein Zufall, dass dieser Fortschritt von einem Marktsegment her in Angriff genommen worden ist, das für ein Handelsgeschäft vermittels elektronischer Zeichen eine besonders gute Voraussetzung bietet: Als Buchhändler hat Amazon sein Geld vorher schon mit einer Ware verdient, deren Tauschwert sich aus dem Honorar für die einmal erbrachte Leistung, einen Text zu verfassen, und der Produktion einer Menge verkäuflicher materieller Träger dieser Geistesleistung zusammensetzt. Im Internet hat die Firma die Chance entdeckt oder jedenfalls konsequent ausgenutzt, sich vom Druckwerk und dessen Kosten zu befreien: Einmal digital reproduziert und in einem hauseigenen Datenspeicher quasi telefonisch abholbar bereitgehalten, lässt sich der Konsum der Ware ohne jeweils neuen Aufwand an jeden zahlungswilligen Käufer liefern, der an seinem Ende des Netzes über ein passendes Lesegerät verfügt; das erspart dem Kunden die Einrichtung einer Bibliothek und eignet sich gleichzeitig gut als Handelsartikel der herkömmlichen Art. Den fälligen Streit mit den Rechteinhabern, die für ihr Geistesprodukt doch wieder am Absatz pro Stück beteiligt werden wollen, führt Amazon mit der Macht des zunehmend unentbehrlichen Vermittlers. Und ganz automatisch hat die Firma schon damit, mit ihren mit lauter Sinn und Unsinn gefüllten Rechenmaschinen mit Internetanschluss, den Übergang zu der Errungenschaft gemacht, die unter dem Namen Cloud inzwischen allgemein bewundert wird.
Amazon hat damit das Tor aufgetan zur ohne großen Kostenaufwand vervielfachten kommerziellen Verwendung all des geistigen Eigentums, das in grauer vordigitaler Vorzeit nur in Verbindung mit materiellen Ton- und Bildträgern seine zahlende Kundschaft gefunden hat. Aktiv sind in dem Bereich verschiedene Streaming-Dienste; sie verkaufen Kunstgenuss in Form einer jederzeit abrufbaren Endlosschleife und machen damit nicht bloß Schallplatten und Kinos überflüssig, sondern akkumulieren genug Erlöse, um nicht bloß fertigen Unterhaltungsstoff zu vermarkten, sondern selbst in dessen Produktion einzusteigen. Die Firma Netflix z.B., die einst mit der Versendung von DVDs per Post angefangen hat, macht etablierten Filmstudios Konkurrenz; und für die weltweite Vermarktung ihrer Produkte bedient sie sich wiederum der längst enorm erweiterten Datenspeicher – der Cloud – von Amazon.
Damit schließt sich der Kreis natürlich noch lange nicht. Neben seinem Buchhandel, materiell und elektronisch, ist Amazon nach und nach in den Versandhandel mit allen möglichen materiellen Produkten eingestiegen und hat über das Internet als Bestellmedium die Welt des Zwischen- und Einzelhandels gründlich aufgemischt. Mit seinen weltweiten Niederlassungen fungiert der Konzern als Vorratslager, Anbieter und Absender für jeden Warenproduzenten oder -händler, der von seinem Verkaufserlös den geforderten Anteil abzutreten bereit ist, und auch selbst als Verkäufer von allem, was sich in Kartons verpacken lässt, und an jeden Ort, für den sich ein Zusteller findet. Und was, je auf seine Art, mit Büchern und Tintenpatronen funktioniert, das klappt natürlich ebenso gut mit Dienstleistungen der verschiedensten Art. Für die Vermarktung von Fahrdiensten oder Ferienwohnungen auf Zeit, für die Vermittlung von Liebschaften an zahlungsbereite Endverbraucher oder von Arbeitsstellen finden sich neben Amazon zahllose spezialisierte Plattformen. Die arbeiten an immer effektiveren Algorithmen und verdienen an der Gebühr, die sie, je nachdem, dem Geschäfts-, dem Endkunden oder beiden berechnen, in dem Maß, wie ihr Angebot genutzt wird.
Dass die fälligen Zahlungen auch gleich per Endgerät und Internet eingezogen werden, ergibt sich im Bereich des digitalisierten Versandhandels und Vermittlungsdienstes quasi aus der Sache. Es ist aber natürlich überhaupt nur konsequent, dass der Blick der geschäftstüchtigen IT-Experten des Handelskapitals sich auf den finalen Akt des Kontakts zwischen Kapital und Kunde richtet, in dem sich der Zweck aller Werbung und aller Vermarktungskünste erfüllt: die Bezahlung. Das bietet sich schon deswegen an, weil die etablierten Geldhändler selber schon längst die Tauglichkeit von Zeichen, die sich durchaus auch elektronisch darstellen und übermitteln lassen, für die Übertragung des abstrakten Reichtums von einem Eigentümer auf den anderen entdeckt und die entsprechenden virtuellen Transaktionen zu ihrem Metier gemacht haben. Die sehen sich nun der Konkurrenz von IT-Unternehmen ausgesetzt, die die Funktion der Kreditkarte mit ihren Rechenschritten, auf ihren Datenspeichern und per Abruf durchs Endgerät reproduzieren. Umgekehrt greifen Banken und Sparkassen gern auf das Angebot von Amazon und anderen zu, Kundendaten in ihren Großrechnern – ihrer Cloud – zu speichern und Zahlungsvorgänge dort abzuwickeln. Sie sparen sich damit viel von dem Aufwand – für Geschäftsstellen, Personal und eigene elektronische Infrastruktur –, den sie treiben, um an dem Aufwand für die finale Verwandlung von Ware in Geld zu verdienen, den sie der Geschäftswelt ersparen.
4. Apple: Die bürgerliche Existenz im Endgerät
Die freundliche Übernahme des gesamten Kontakts zwischen kapitalistischen Verkäufern und Endverbrauchern durch IT-Konzerne beruht darauf, dass die Masse der zahlungsfähigen Konsumenten schon längst mit einem handlich transportablen Gerät zur permanenten Teilhabe am Internet ausgestattet ist. Umgekehrt entfaltet sie eine beträchtliche Produktivkraft fürs kapitalistische Geschäft mit dieser Ware. Denn jede neue Dienstleistung will auf dem Endgerät untergebracht sein, ohne die Bedienung zu erschweren. So ist das einstige Handy zum Smartphone aufgerüstet worden, das den Besitzer durch sein komplettes bürgerliches Dasein als allzeit erreichbarer Konsument; als durch die sozialen Medien definiertes Gesellschaftswesen – im Übrigen auch als jederzeit erreichbarer, also benutzbarer Arbeitnehmer, aber das gehört schon in ein anderes Kapitel – begleitet. Damit realisiert das Ding weitgehend den Traum des Handelskapitals vom Menschen als personifizierter Zahlungsfähig- und -willigkeit.
Weil der User jedoch in seiner Eigenschaft als selbstbewusstes Individuum die Sache umgekehrt versteht, nämlich die Welt, so wie sie sich auf seinem smarten Endgerät präsentiert, gerne als seine persönliche Verfügungsmasse ansieht, ist er bereit, für das Ding zu zahlen; gerne auch in kürzeren Abständen für ein teureres neues, wenn die Zahl der angebotenen Dienste gewachsen, das vorhandene Gerät also veraltet ist und ein neues erforderlich für eine zeitgemäße Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Mit dem kostspieligen Entwicklungsaufwand, den sie sich ihr Geschäft kosten lassen, und dank der Patente, die ihr geistiges Eigentum an den Ergebnissen vor der Konkurrenz schützen, machen die Produzenten einander das Überleben so schwer, dass sie sich an einer Hand abzählen lassen – bis dann doch irgendein Chinese mit ganz besonders billigen Produktionskosten oder Microsoft mit ganz viel Kapital und eigener Soft- und Hardware ins Oligopol der Etablierten einbricht...
II. Die Unkosten des Regimes des Kapitals über die Produktion
1. Kapitalistische Qualitätskontrolle
Kapitalistische Unternehmer – das ist nichts Neues – nutzen ihr Regime über die gesellschaftliche Arbeit und deren Produktivkraft für ihren Gewinn: Kein Produkt verlässt den Betrieb, kein Auftrag ist abgearbeitet, ohne dass der absehbare Gelderlös den Geldaufwand übersteigt. Das ist jedenfalls das klare und eindeutige Kriterium der Qualitätskontrolle, der der Produktionsprozess im kapitalistischen Unternehmen unterliegt: Er muss neues, zusätzliches geldwertes Eigentum schaffen; nicht nur viel, sondern in gehöriger Proportion zum aufgewandten Kapital, denn darin misst sich dessen Produktivität.
Daraus ergeben sich – auch das ist nichts Neues – spezielle hohe Anforderungen an die Gestaltung des Produktionsprozesses. Die betreffen die angewandte Technik ebenso wie die Organisation ihres Gebrauchs. Es geht um Kosteneffizienz beim Einsatz von Maschinen und Reaktoren, von Arbeitskräften und Material. Geboten ist die Einrichtung von Arbeitsplätzen, die ein Maximum an Output-Leistung mit einem Minimum an Bezahlung kombinieren. Strikt zu vermeiden sind Unterbrechungen im Arbeitsgang; menschengemachte, aber auch solche, an denen der Markt, die Abhängigkeit von Zulieferern schuld ist, usw. In jeder erdenklichen Hinsicht haben die Industriellen es, nach vielen Jahrzehnten des kapitalistischen Fortschritts, für ihre Belange weit gebracht; zu vollautomatisierten Produktionsstraßen etwa, sowie zu einer unternehmenseigenen Bürokratie, die keineswegs bloß die gewinnbringende Perfektionierung der Herstellungstechnik zu managen hat: Sie kontrolliert mit erprobter und fortschreitender Routine das betriebliche Geschehen insgesamt unter dem Kostengesichtspunkt, organisiert es auf Ertragssteigerung hin, bringt Buchhaltung und Produktionssteuerung zweckmäßig überein und tut, was immer sich für die Mehrung des Eigentums tun lässt, unter dessen Regime der ganze Laden steht. Der Haken ist nur: Das alles kostet Geld. Nicht nur der technische Fortschritt hat seinen Preis: Den planmäßig so zu gestalten, dass dadurch der Profit steigt, ist eine Aufgabe, deren Erledigung durch eine smarte Unternehmensbürokratie einen ganz eigenen Geldaufwand erfordert. Der mindert, nach den Regeln kapitalistischer Rechenkunst, die Kapitalproduktivität, um deren Sicherstellung und Steigerung es doch geht. Das ist schlecht.
Natürlich haben kapitalistische Unternehmer auch hier nichts anbrennen lassen. In den vergangenen Jahrzehnten haben sie in konstruktiver Zusammenarbeit mit Computerfirmen und Software-Fachleuten auch diesen traditionell personalaufwändigen Bereich technisch aufgerüstet und dabei personell ausgedünnt, also kapitalistisch rationalisiert. Das gesamte kapitalistische Procedere – die kostensparende Organisation des Herstellungsprozesses und seine Verknüpfung mit den Anforderungen des Markts resp. des Unternehmens an den Markt – haben ihre Experten unternehmens- und sogar branchenübergreifend auf stereotyp auftretende Muster hin durchforstet. Nachdem Generationen von Meistern und Managern Standards der Planung, Verwaltung und Steuerung etc. entwickelt und durchgesetzt haben, sind sie natürlich fündig geworden. Das kapitalistische Regime über die Betriebsabläufe haben sie in die Form komplexer Gebrauchsanweisungen gebracht und diese zu Abfolgen selbsttätig aufeinander aufbauender und einander kontrollierender Rechenoperationen verarbeitet: zu Computerprogrammen, die einerseits beliebig vielfach anzuwenden sind, andererseits auf besondere Bedürfnisse zugeschnitten werden können. Hardware und – selbst entwickelte oder von einschlägig aktiven IT-Firmen zu kaufende – Software mindern den Personalaufwand, effektivieren die nötige bürokratische Arbeit, sparen also Kapitalvorschuss. Aber natürlich kosten sie Geld, und das immer wieder von Neuem, weil ein flotter Fortschritt sowohl bei der Erfassung der für die kapitalistische Qualitätskontrolle wichtigen Daten und ihrer Verarbeitung zu wirkungsvollerer Software als auch beim dafür nötigen technischen Gerät den erreichten Kostenvorteil immer schnell schwinden lässt.[2]
Folglich ist die Unternehmenswelt sehr empfänglich für das Angebot, das die Großen der IT-Branche auf dieser Grundlage entwickelt haben: Sie erledigen das alles. Zur Auswahl stehen: „Platform as a Service“ – ein Unternehmen kauft sich Zugriff auf externe Hard- und Software, um mit fertigen Bausteinen eigene betriebsspezifische Anwendungen zu entwickeln –, „Infrastructure as a Service“ – man mietet beim Anbieter Server, Netzwerke, Datenspeicher, Betriebssysteme, überhaupt was man sich nicht selbst anschaffen will und womöglich bald wieder abschreiben muss – oder „Software as a Service“ – der Kunde muss benötigte Programme nicht mehr kaufen, installieren und aktualisieren, sondern greift auf die vom Dienstleister bereit- und immer auf dem neuesten Stand gehaltenen Rechenoperationen zu, die er für die Leitung seines Unternehmens braucht.
Auch das kostet natürlich Geld. Zuerst und vor allem einen beträchtlichen Kapitalvorschuss von Seiten der Anbieter. Die müssen eine voluminöse technische Infrastruktur aufbauen, unterhalten, bedarfsgerecht erneuern und gemäß den Fortschritten ihres Geschäfts erweitern; sie müssen die nachgefragte Software bereithalten, pflegen, den Kundenwünschen gemäß bzw. dergestalt perfektionieren, dass sie damit bei alten und neuen Kunden Zahlungsbereitschaft stiften; sie müssen, soweit die Kunden das nicht selber tun, die Schnittstellen mit den Datensystemen der Firmen einrichten und permanent aufrechterhalten, deren Bürokratie sie ganz oder teilweise durch ihre Dienste ersetzen. Das alles lassen sie sich natürlich von ihrer Kundschaft bezahlen; natürlich so, dass ihr eigener Kapitalaufwand sich für sie lohnt und folglich den Kunden die Berechnung nicht erspart bleibt, ob und wie das Versprechen der Verbesserung der Produktivität ihres Kapitals durch Kostenminderung und Effizienzsteigerung von Planung und Leitung wahr wird. Das kapitalistische Kalkül kann für beide Seiten aufgehen, weil die IT-Konzerne für die Amortisierung des größten Teils ihres Vorschusses mit einer Menge von Abnehmern rechnen, die es ihnen erlaubt, den verlangten kostendeckenden und gewinnbringenden Preis pro Abnehmer geringer ausfallen zu lassen als deren sonst nötigen eigenen Aufwand; abgerechnet wird nach dem Muster „Pay per Use“ sekunden-, megabyte- und centgenau nach Inanspruchnahme der Dienste oder mit einem Pauschalbetrag für einen festgelegten Zeitraum. Der Geschäftserfolg der Dienstleister hängt dementsprechend direkt von der Anzahl ihrer Kunden ab; nur die Masse macht den enormen Kapitalvorschuss lohnend, den sie auf jeden Fall leisten müssen – und zu dem gerade deswegen nicht zuletzt ein erheblicher Personalaufwand für die Akquisition von Abnehmern gehört. Das unbedingte Streben nach Größe gehört folglich ganz essenziell zum Geschäftsmodell der Konzerne, deren Humor die eigenen Dienste in einer überirdischen Cloud verortet. Ihr Ziel ist flächendeckende weltweite Präsenz, ihre Perspektive das globale Monopol; eine Cloud, nämlich ihre, für alle Bedürfnisse wäre das Ideal. Realität ist immerhin ein Quartett aus drei amerikanischen Anbietern und einem chinesischen, die momentan drei Viertel des weltweiten Cloud-Geschäfts beherrschen, mit Amazon Web Services einsam an der Spitze. Sie verdienen nicht schlecht – an dem Beitrag, den sie zur Steigerung der Kapitalproduktivität ihrer Firmenkundschaft leisten.
2. Das Firmen-, Branchen- und Staatsgrenzen überschreitende Wertschöpfungsnetzwerk und sein Widerspruch [3]
Die Steuerung des Betriebsgeschehens durch Programme, die im Internet bereitliegen und ganz oder teilweise von IT-Konzernen gepflegt und vermietet werden, schließt das Angebot einer Vernetzung mit Lieferanten und Abnehmern in aller Welt ein, auch mit Kunden, die sich Maschinen liefern, Teile ihrer Produktion einrichten, ihren Gerätepark in Schuss halten lassen, ebenso mit Firmen, die solche Dienste für den eigenen Laden erbringen; auch das in Form von Gebrauchs- und Verfahrensanweisungen, die in Abfolgen von Rechenschritten vergegenständlicht sind und automatisch abgearbeitet werden. Auch diesem Fortschritt können die Unternehmen sich kaum verschließen. Er sichert ihnen die pünktliche und passende Lieferung alles Benötigten, die prompte Abnahme ihrer Produkte, die zeitliche und technische Abstimmung der aufeinander aufbauenden Produktionsprozesse in verschiedenen Betrieben, gerade auch im immer wieder eintretenden Fall technischer und organisatorischer Neuerungen; er bewahrt sie vor allerlei Risiken, Verzögerungen, eigenen und fremden Versäumnissen; er setzt ihr Geschäft von Umständlichkeiten und Behinderungen technischer und logistischer Art frei. Im Idealfall beschert er ihnen per Saldo die Vorteile einer planmäßigen Arbeitsteilung über die Grenzen des eigenen Betriebs hinweg, steigert insoweit die Produktivität des eingesetzten Kapitals. Tatsächlich werden die kapitalistischen Konkurrenten tendenziell zu Teilen in einem sich selbst regulierenden integrierten Wertschöpfungsprozess.
Das ist freilich auch der Haken an diesem wunderbaren Fortschritt. Mit der automatisierten Arbeitsteilung über die eigenen Unternehmensgrenzen hinweg betreiben die beteiligten Firmen schließlich kein Gemeinschaftswerk, sondern die Steigerung der Produktivität ihres Kapitals. Mit ihren kapitalistischen Potenzen, ihrer Produktivität, der Wichtigkeit ihres Teilgeschäfts für den Gesamtprozess, bei dem es ja immerhin explizit um Wertschöpfung geht, konkurrieren sie mit ihren Partnern und gegen alle, die sich an ihrer Stelle in das produktive Netzwerk einschalten wollen, um ihren Anteil am Reichtum in Geldform, der am Ende herauskommt; genauer: um dessen Steigerung im Verhältnis zum eigenen Aufwand – nur deswegen ist die Sache ja überhaupt ein attraktives Angebot für kapitalistische Unternehmer. Entscheidend dafür ist die Bestimmungsmacht über den Gesamtprozess, als dessen Teil jede Firma fungiert. Dafür setzt sie ihr spezielles Potential als Waffe ein. Das geht andererseits nicht, ohne dass wichtige Teile dieses Potentials, die in einer Welt der kapitalistischen Konkurrenz den Rang hochsensibler Geschäftsgeheimnisse haben – alle möglichen Interna von den Vermögensbilanzen bis zu Betriebsabläufen und von patentierten Verfahren bis zur politischen und geschäftlichen Landschaftspflege –, erfasst und überbetrieblich verallgemeinert werden. Das liegt in der Natur der produktivitätsfördernden Kooperation; was dafür an Verknüpfungen per Internet nötig ist, muss und soll ja gerade für alle Beteiligten von jedem Standort aus verfügbar und nutzbar sein; und was das einzelne Unternehmen zu leisten vermag, muss offengelegt werden, damit Abläufe und Regelmechanismen immer auf den effektivsten Stand gebracht werden können.
Einen Beitrag leisten, um einen eigennützigen Zugriff auf den Beitrag anderer zu bekommen, und das, ohne die exklusive Verfügungsmacht über die eigenen Produktivkräfte preiszugeben: Das ist die nicht wirklich neue, durch den digitalisierten Kooperationszusammenhang aber kräftig verschärfte Konkurrenzsituation, die die Unternehmen zu bewältigen haben. Da steht nicht bloß jeder gegen jeden. Es geht außerdem ganz extra um das Kräfteverhältnis zwischen Unternehmen – meist solchen der IT-Branche, aber auch „klassische“ Technologiefirmen mischen da aktiv mit –, die die Vernetzung organisieren und maßgeblich pflegen, also durchsetzen, und denen, die von dieser Verknüpfung profitieren wollen, ohne sich einem externen Regime unterzuordnen. Zu den prominenten Streitfragen in diesem Interessengegensatz gehören die praktische Verfügung über die und das geschäftlich ausnutzbare Eigentumsrecht an den Firmendaten, die notwendigerweise in den Algorithmus des Wertschöpfungsprozesses einfließen und die logischerweise die Grundlage bilden für die Weiterentwicklung der Plattformen, auf denen, und der Verfahren, nach denen die einzelnen Konkurrenten kooperieren; auch für die Entwicklung neuer Wirkungsketten, mit denen womöglich Geld zu verdienen ist. Doch nicht nur da, sondern generell bescheren die Dienstleistungen rund um die produktive Vernetzung der Unternehmen denen ein besonderes Konkurrenzverhältnis zu den Anbietern, deren Dienst so heftig zu einer Art Regime tendiert – im vernetzten Kapitalismus fällt eben beides zusammen. Das Ideal der einen ist da die Existenzangst der anderen: dass der IT-Dienstleister mit seiner Regie über die Wertschöpfungskette den Wert abschöpft und den verketteten Produzenten nur noch die stoffliche Umsetzung eines fremdbestimmten vorgegebenen Produktionsprozesses zu erledigen bleibt.[4] Die Realität ist der Streit darum, für wen der Fortschritt sich am meisten lohnt. Der geht genau so seinen Gang.
3. Die faux frais der Verwaltung des Gemeinwesens, oder: Die smarte Nation
Nicht nur die betriebliche Bürokratie belastet das kapitalistische Unternehmen, mindert seine Produktivität. Ebenso notwendig – auch wenn die herrschende Klasse das nur ungern einsieht – und fürs einzelne Unternehmen mindestens ebenso kostspielig sind die unproduktiven Kosten, die der kapitalistischen Produktion aus den Notwendigkeiten der öffentlichen Versorgung und der staatlichen Verwaltung des Gemeinwesens erwachsen. So ähnlich – einerseits als unentbehrlich und wertvoll, andererseits als Belastung der Wirtschaft, die unbedingt wachsen muss, insgesamt als „faux frais“ – ordnet die bürgerliche Politik selbst den Aufwand für den Alltag staatlicher Gewaltausübung ein.
Umso willkommener sind die Angebote der Unternehmen der IT-Branche, mit ihrer erprobten Expertise auch hier für Kosteneinsparung und Effektivierung zu sorgen. Denen fällt es nicht schwer, in der bürokratischen Organisation und Kontrolle des gesellschaftlichen Lebens ebenso wie in der technischen Betreuung anerkannter allgemeiner Bedürfnisse gleichartige Regelungen und stereotype Verhaltensmuster ausfindig zu machen, die sich in Rechenschritten abbilden und durch Rechenautomaten managen lassen. Hardware und Software, die von der Wasserversorgung über die Volksgesundheit bis zur Rasterfahndung alle möglichen Lebensbereiche mehr oder weniger automatisch steuern, sind längst eingeführt. Auf der Basis kommt das Angebot zum Zuge, die ideelle, organisatorische Seite des öffentlichen Dienstes für „Pay per Use“ in eine Cloud auszulagern. Dass die Technologie der automatisierten, sich selbsttätig perfektionierenden Mustererkennung, die unter dem Titel „KI“ läuft, ungeahnte neue Möglichkeiten der Überwachung und Lenkung des Volkskörpers eröffnet, macht für die Behörden eine Zusammenarbeit mit den fortschrittlichsten IT-Konzernen erst recht interessant: So wird nicht bloß das herkömmliche Verwaltungsgeschäft billiger, Herrschaft preiswerter, sondern mancher subtile Zugriff auf die Bürger in ihren verschiedenen politisch relevanten Rollen und Funktionen – als Autofahrer, Krankheitsfälle, Extremisten ... – finanziell machbar.
Völlig klar, dass der bürgerliche Staat die Branche als positive Herausforderung wahrnimmt, die er pflegen und der er sich stellen muss.
4. Der private Konsum als letzter Akt im kapitalistischen Produktionsprozess
Die Kunst der gebührenpflichtigen Vernetzung voneinander abhängiger Funktionen erproben die IT-Konzerne auch am bürgerlichen Individuum; nicht nur in seiner Eigenschaft als Werbe- und Versandhandelskunde, was den Warenanbietern Geld wert ist, sondern als dem Endverbraucher, mit dessen Konsum der kapitalistische Produktions- und Verkaufsprozess, richtig eingerichtet, erst an sein Ziel kommt. Über den Alltag des Smartphone-Users, den sie mit ihren sozialen Medien, den Rückmeldungen ihrer Suchmaschinen und den leicht verfügbaren Versandhandelsstatistiken schon gut durchleuchtet haben, machen sich die erfindungsreichen Experten der Branche her; mit dem Konzept der Mustererkennung durch künstliche Intelligenz, der Idee der Berechenbarkeit und dem klaren Ziel der Steuerung des individuellen Verhaltens. Gnadenlos decken sie auf, dass dieser Alltag zu großen Teilen aus stereotypen Verhaltensmustern zusammengesetzt ist, die sich, so ähnlich wie automatisierte Produktionsprozesse, in die Form mathematisch fassbarer Anleitungen und Anweisungen bringen lassen. Und sie arbeiten daran, daraus auch in dieser Sphäre etwas Verkäufliches zu machen.
Die leitende Idee ist die Zerlegung des alltäglichen Warenkonsums in einen stofflichen Anteil und in den Prozess des Ge- und Verbrauchens als solchen; dergestalt, dass sich beides, egal ob getrennt oder durch denselben Anbieter, verkaufen lässt; ungefähr so, wie seit jeher das Telefon und das Ferngespräch. Damit haben sie es schon zu vielen Apps gebracht, deren Aktivierung sich zusätzlich zu dem Smartphone verkaufen lässt, auf dem sie untergebracht sind (und das seinerseits schon gar nicht mehr ohne diese Funktion zu verkaufen ist). Der Ehrgeiz geht aber weiter; dahin nämlich, alle möglichen Konsumgüter „smart“ zu machen, i.e. ihre sachgerechte Inbetriebnahme durch einen Algorithmus zu steuern, der übers Internet zu aktivieren ist; also an die Sache eine beliebig oft abrufbare Dienstleistung dranzuhängen, die das Produkt gewissermaßen erst vollendet. Und die – gegebenenfalls – jedes Mal eine kleine Gebühr kostet. Denn immerhin erspart das Gerät seinem Besitzer so, wenigstens im Idealfall, die Umständlichkeit und den Zeitaufwand, sich selbst um die Organisation seines Privatlebens zu kümmern. Am Ende soll das „Smart Home“ dem Konsumenten seine entsprechend standardisierte Lebensführung aus der Hand nehmen und dies ganz zum Geld bringenden Schlusspunkt der produktiven Leistung des kapitalistischen Anbieters machen.
Den Fortschritt des Jahrhunderts in dieser Angelegenheit verspricht sich die – dementsprechend aufgeregte – Geschäftswelt jedoch vom Geschäft mit der Verdoppelung des Pkw in ein käuflich zu erwerbendes oder zu mietendes „Smartphone auf Rädern“ und dessen – im Preis eingeschlossene oder, für beide Seiten besser, nach dem Muster „Pay per Use“ extra zu bezahlende – Lenkung „von A nach B“. Einmal entwickelt, zigmillionenfach installiert, milliardenfach abgerufen, wäre ein solcher selbstfahrender Algorithmus eine feine Einnahmequelle neben den ständig neu zu fabrizierenden, IT-mäßig aufgerüsteten Blechkisten; zu berappen durch eine Kundschaft, der die einst versprochene „Freude am Fahren“ ohnehin längst vergangen ist.
III. Der Kapitalvorschuss und seine Rendite
Die führenden IT-Unternehmen und ihre Nachahmer machen viel Eindruck – nicht nur auf professionelle Geldanleger – mit dem enormen Börsenwert, den sie, und durch die enorm kurzen Fristen, in denen sie den erreicht haben: von der Garage zum Weltkonzern in wenigen Jahren. Folgt man ihrem Selbstbild und dem verbreiteten Image des „Silicon Valley“, dann braucht es für diese Karriere eigentlich nur zwei Dinge: einen Haufen hochmotivierter Intelligenzbestien – „die besten Köpfe“ –, die sich in entspannter Atmosphäre und in herrschaftsfreiem Dialog über den „natürlichen Reichtum“ der modernen Welt, den Rohstoff „Daten“, hermachen, sich dazu schlaue Verwendungsweisen einfallen lassen und zu denen die passenden Programmzeilen für die effektivsten Computer der Welt aufschreiben; außerdem aufgeschlossene Mäzene, die mit dem Einsatz von „Wagniskapital“ im Handumdrehen aus jungen „Startups“ „Einhörner“ mit mindestens 1 Milliarde US-Dollar Börsenwert machen. Wer am schnellsten am meisten Geld bringt, beweist damit, dass er der Beste ist. Die Besten der Besten fühlen sich berufen und auserwählt, aus der Welt „a better place“ zu machen, indem sie die Weltbevölkerung immer weiter „vernetzen“ und damit die dafür nötigen Mittel verdienen.
Die ganze Geschichte ist das nicht.
1. Staatliche Vorleistungen: Schutz des geistigen Eigentums und eine Menge Infrastruktur
Was in der Erzählung fehlt, das sind – unter anderem – die ebenfalls enormen Vorleistungen imperialistischer Staatsgewalten, derer das IT-Gewerbe sich ganz locker bedient.
Zum einen sind die besten Einfälle der IT-Fachleute nichts wert, wenn sie nicht als geistiges Eigentum von Staats wegen zur exklusiv verfügbaren Ware gemacht werden. Die erste Sorge freier Denker und Entwickler resp. ihrer Auftraggeber gilt deswegen dem Patentschutz für jedes Quantum Programmzeilen, das in der Abteilung „Research & Development“ entsteht, damit das kostbare Gut nicht in die Hände wirklicher oder möglicher Konkurrenten gerät. Das ist insbesondere dann entscheidend wichtig, wenn es nicht um die marginale Verbesserung vorhandener und bereits geschützter Programme oder die Schließung von Sicherheitslücken geht – was allerdings wohl die schlecht bezahlte Hauptmasse der so stolz verbuchten intellektuellen Arbeit am Fortschritt ausmachen dürfte –, sondern tatsächlich einmal um ein neues Dienstleistungsangebot für Kapitalisten oder Endverbraucher. Damit das sich richtig lohnt, wird gleich die allemal nur begrenzt zahlungswillige Gesamtheit möglicher Nutzer als Einkommensquelle veranschlagt; denn nur die große Zahl macht die Preise, die sich für einen weiteren Informations- oder Vermittlungsdienst oder für die Einsparung noch nicht bereinigter Geschäftsunkosten vom einzelnen Kunden kassieren lassen, zu der wuchtigen Geldgröße, auf die der Aufwand zielt. Deswegen ist das Bedürfnis der hyperaktiven „Denkfabriken“ des „Technologie“-Sektors nach Rechtsschutz für ihr geistiges Eigentum auch nicht auf den Bereich beschränkt, in dem ihr nationaler Hausherr mit seinem Patentamt für die Exklusivität der ihrer Natur nach allgemeinen „R&D“-Produkte sorgen kann und gegen entsprechende Gebühren auch sorgt. Die geschäftliche Heimat der Branche ist von vornherein und ganz entschieden der Weltmarkt. Den nehmen sie mit der größten Selbstverständlichkeit als ihr Geschäftsfeld in Anspruch und verlangen, dass die dafür nötige Rechtslage weltweit gilt. Wie viel und was für eine weltweit durchsetzungsfähige Gewalt dafür nötig ist, braucht sie als geborene Weltverbesserer nicht zu interessieren. Die richtige Adresse für ihren Bedarf wissen sie freilich sehr wohl. Deren Imperialismus verbuchen sie als fraglos zur Verfügung stehende Gratisgabe.
Zum andern hat die fürs „Silicon Valley“ zuständige Staatsmacht, zusammen mit ein paar anderen öffentlichen Gewalten, die materiellen Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die IT-Konzerne mit ihrem Geschäftsmodell erfolgreich aktiv werden können. Die Infrastruktur, das Internet selbst, hat aus bekannten strategischen Gründen die Weltmacht USA eingerichtet und so funktionstüchtig gemacht, dass die private Geschäftswelt mit ihren Dienstleistungen darauf einsteigen konnte. Die nötigen technischen Hilfsmittel, immer bessere Computer vor allem, sind ebenso durch staatliche Investitionen, nicht zuletzt für militärische Belange, in die Welt gekommen. Das Gleiche gilt für die extrem fokussierte Gelehrsamkeit, die heute in den Forschungsabteilungen der privaten Konzerne ihre Blüten treibt, und speziell für das, was Leute, die dafür keinen Begriff von der Verstandesleistung des Einsehens brauchen, „künstliche Intelligenz“ nennen.
2. Spekulative Finanzblasen als Geburtshelfer
Alle staatliche Großzügigkeit erspart den Firmen der Branche natürlich nicht die Notwendigkeit eines Kapitalvorschusses, der schon von ansehnlicher Größe sein muss, weil das Angebot einer neuartigen Dienstleistung erstens aufwändig erarbeitet, zweitens einer im Prinzip weltweiten Kundschaft nahegebracht und schmackhaft gemacht werden und sich drittens dadurch empfehlen muss, dass es überall und jederzeit abrufbar bereitliegt. Dem beträchtlichen Aufwand stehen die ebenso großen Versprechungen des besonderen Geschäftsmodells der Branche gegenüber. Die macht ihr Geld nämlich nur zum Teil mit der Herstellung nützlicher Güter oder Dienstleistungen. Was die führenden Unternehmen so groß gemacht hat und macht, sind ihre Dienstleistungen für den gehobenen Bedarf der Kapitalisten dieser Welt, die Produktivität ihres Eigentums durch Verbilligung und Beschleunigung seines Kreislaufs zu steigern. Diese Dienstleistung beruht darauf, dass sie von einer Vielzahl kapitalistischer Unternehmen in Anspruch genommen wird: Die Werbe-, Verkaufs-, Vermittlungs- und sonstigen Plattformen sind ja nur so attraktiv wie ihre Reichweiten und die Reichweiten nur so groß wie die Menge der Firmen, die sich darauf finden. Nicht bloß das Ziel, sondern notwendige Erfolgsbedingung der Branche ist es daher, mit ihren Angeboten für die ins Auge gefasste Kundschaft unentbehrlich zu werden – was wiederum entscheidend von der möglichst kompletten Abdeckung der Masse möglicher Interessenten abhängt. Geboten ist daher von der Sache her das Bemühen um die Monopolisierung des Geschäftsinteresses, das der jeweilige Dienstleister zu bedienen gedenkt. Das treibt natürlich den nötigen Vorschuss in die Höhe und macht auch von da her eine große Zahl von Kunden zur Erfolgsbedingung des Unternehmens; dies umso mehr, weil der Einzelpreis für den angebotenen Dienst, den Kapitalkreislauf zu beschleunigen, erst einmal in keinem Verhältnis zum Aufwand für die Etablierung dieses Dienstes steht. Umgekehrt liegt darin allerdings auch die große Chance, dass das elektronische Produkt nach dem Muster „eine Ware – auf Dauer unendlich viele Abnehmer“ sich als phantastisch sprudelnde Geldquelle erweist. Da erlebt tatsächlich das Geschäftsmodell des transkontinentalen Eisenbahnbaus oder des Ozeane verbindenden Kanals seine Neuauflage im „Cyberspace“; mit dem nicht unwichtigen Unterschied, dass die Möglichkeiten der beschleunigten Kapitalzirkulation sich hier nicht auf die Überwindung banaler geographischer Hindernisse beschränken, sondern womöglich noch gar nicht alle bekannt und schon gar nicht ausgeschöpft sind. Das ist jedenfalls die Hoffnung der Nachzügler, die mit der Karriere von Facebook oder Amazon vor Augen an neuen Diensten tüfteln, die für die kommerzielle Kundschaft eventuell attraktiver sind als die bestehenden. So lockt, für Aktivisten des Gewerbes unwiderstehlich, ein Geschäft, das ein Renner werden könnte, eventuell oder sogar mit überwiegender Wahrscheinlichkeit aber auch gar nichts taugt. Und das auf jeden Fall nach der Anfangsinvestition eine unabsehbar lange Durststrecke zu überstehen hat, auf der kaum erste Einnahmen fließen, die aber im günstigsten Fall dadurch abgekürzt und vergoldet wird, dass ein etablierter Konkurrent oder ein Haufen Spekulanten den Nachkömmling aufkauft.
Denn Geld dafür ist da; das ist die zu dieser Problematik passende gute Nachricht. Die Aussicht auf einen zwar unsicheren, aber womöglich enormen Gewinn war schon im Vorfeld der ersten „Dotcom-Krise“ nur allzu attraktiv für die Sorte Spekulation, die an den Börsen der Welt sowieso an der Tagesordnung ist. Und eine Krise später verfügt die dort engagierte Gemeinde einerseits über außerordentlich viele anzulegende Finanzmittel, findet andererseits außerordentlich wenige Anlagemöglichkeiten; beides aus demselben Grund, in dem schon wieder die politische Gewalt der führenden Weltwirtschaftsmächte die entscheidende Rolle spielt. Deren Notenbanken haben zwecks Abwehr bzw. Überwindung der vor 12 Jahren von Amerika ausgegangenen Finanzkrise den beinahe totalen Wertverlust des zuvor spekulativ vervielfachten Kredits durch „Überschwemmung der Märkte“ mit Liquidität kompensiert, die allein staatlichem Beschluss entstammt. Damit haben sie den Bankensektor der kapitalistischen Welt gerettet, sein normales Kredit- und Geldanlagegeschäft allerdings weitgehend lahmgelegt. Mit der anschließenden Krisenbewältigung per Niedrigzins-, Nullzins-, schließlich Minuszinspolitik haben sie die Besitzer der geretteten Geldvermögen einerseits in eine Zwangslage gebracht, aus der die keinen anderen Ausweg finden als den, umso mehr auf spekulative Börsengeschäfte aller Art als Gewinnquelle zu setzen; auf der anderen Seite haben die Zuständigen mit ihrer Rettungspolitik die Sicherheit gestiftet, dass es auch im Fall einer neuerlichen Krise nicht an staatlich gestifteter Liquidität fehlen wird. Es mangelt daher nicht an „Wagniskapitalgebern“. Deren Gier nach investitionswürdigen Risiken steigert folgerichtig den fiktiven Kapitalwert der Spekulationsobjekte, lässt insoweit also die Spekulation auf Bereicherung wahr werden, ohne dass die finanzierten „Startups“ irgendeinen nennenswerten Gewinn gemacht haben müssen. Und wenn die maßgeblichen Politiker „die Digitalisierung“ als die brennende, alles entscheidende Zukunftsfrage ihres Wirtschaftsstandorts und der Welt überhaupt beschwören, dann drücken sie diesem fachgerechten finanzkapitalistischen Irrsinn ihren amtlichen Stempel auf.
IV. v: Der Gebrauch des Faktors Arbeit
Wie jeder größere Fortschritt im bürgerlichen Wirtschafts- und Gesellschaftsleben, so gibt auch „die Digitalisierung“ Anlass zu kontroversen Debatten über „Fluch und Segen“. Wesentlicher Stoff ist in dem Fall der schon realisierte und vor allem der vorausgesagte Abbau von Arbeitsplätzen. Deren Verschwinden wird nur von wenigen Freunden des kapitalistischen Geschäftserfolgs richtig gut gefunden, insgesamt aber, wie jeder Fortschritt, als sowieso nicht aufzuhaltende Entwicklung mit Bedauern akzeptiert. Bedenken werden laut, aber gleich relativiert und korrigiert: Auf jeden Fall entstehen auch neue Arbeitsplätze. Wie viele, bleibt offen; mit Sicherheit solche mit neuen Aufgaben und Anforderungen, und zwar, so die Vermutung, überwiegend geistiger Art. Für deren Bewältigung müssen das von Entlassung bedrohte Personal und der bereitstehende Nachwuchs für den weltweiten Arbeitsmarkt umgeschult bzw. anders als bisher qualifiziert werden. Denn sonst sind neben menschenleeren Fabriken zahllose Arbeitslose und zugleich ein Mangel an Fachkräften zu erwarten.
An der Prognose ist sicher was dran. Sie stammt schließlich nicht nur von Zukunftsforschern, sondern von Vertretern des Kapitals, das die Macht hat, die unerforschliche Zukunft zu machen; auch und speziell die des Faktors Arbeit und derer, die ihn verkörpern. Die politökonomische Logik, nach der diese Zukunft gestaltet wird, ist deswegen kein allzu großes Rätsel.
1. Das Ideal der Fabrik ohne Arbeiter und die Realität der Einsparung von Lohnkosten
Seit die kapitalistische Produktionsweise flächendeckend in Gang gekommen ist, betätigen sich die Unternehmer als Arbeitgeber, wollen das auch durchaus positiv verstanden haben, nämlich als Dienst an den Leuten, die darauf angewiesen sind, bei ihnen Arbeit zu „nehmen“. Gleichzeitig ringen sie darum und lassen sich das auch einiges kosten, möglichst wenig Personal zu benötigen, Arbeiter durch Maschinen zu ersetzen, die Produktion automatisiert ablaufen zu lassen. Das Ideal einer Fabrik, die keine menschliche Arbeit mehr braucht, mag zwar unrealistisch sein, ist aber nicht einfach aus der Luft gegriffen. Es liegt in der Logik des Bemühens kapitalistischer Produzenten, sich vom Willen und Können ihrer angestellten Kräfte – Leute mit einem dem ihren entgegengesetzten Interesse an Arbeit in ihrem Betrieb und dem Entgelt dafür – unabhängig zu machen.
Die Dienstleistungen der IT-Konzerne helfen da weiter; gerade was den ärgerlichen Widerspruch betrifft, dass nicht bloß der Produktionsprozess selbst Lohnarbeiter erfordert: Die durchgängige Gestaltung dieses Prozesses nach dem Prinzip der maximalen Rendite, die Rechnungsführung, das Ein- und Verkaufsgeschäft usw., das alles ist im modernen Kapitalismus zu einer Aufgabe geraten, für deren Bewältigung oft schon mehr Hilfspersonal nötig ist als für die längst durchrationalisierte Güterherstellung selbst. Auch in diesem Bereich gilt aber, auch im Zeitalter der in Clouds ausgelagerten Datenverarbeitung: Der Zweck, den kapitalistische Arbeitgeber mit ihren immer neuen Rationalisierungsrunden verfolgen, ist mitnichten die Eliminierung des Faktors Arbeit aus ihrem Unternehmen. Die Ersetzung von Büroarbeit durch Rechenmaschinen, von Personal durch Automaten folgt allemal einem Kalkül, das Geldgrößen zueinander ins Verhältnis setzt. Es langt nicht, dass verbesserte, womöglich selbsttätige und selbstlernende Produktionsmittel in Funktion treten, die ganz und gar Eigentum des Unternehmers sind und weder eigene Interessen noch einen mit Geld zu kommandierenden Willen haben: Rechnen muss sich deren Anschaffung schon; und zwar schlicht nach dem Prinzip, dass sie über die Dauer ihrer Funktionstüchtigkeit mehr Lohn sparen bzw. aus den bezahlten Arbeitskräften mehr geldwerte Leistung herausholen, als sie auf dem Markt für Produktionsmittel kosten. Das ist ja das entscheidende Kriterium für den kapitalistischen Gebrauch von Lohnarbeit überhaupt und deswegen auch für jede Maßnahme mit dem Ziel, den Zwang zur Lohnzahlung zu mindern: Was an Lohn gezahlt wird – egal ob für Büro- oder Handarbeit, für Maschinenbedienung oder Buchhaltung –, muss sich geschäftlich lohnen, einen Überschuss an Reichtum einbringen; und ob das Ergebnis reicht, das bemisst der Unternehmer an dem Verhältnis seines Profits zu seinem Kapitalvorschuss insgesamt, den Ausgaben für Produktionsmittel und für Angestellte: an seiner Profitrate. Deswegen bezahlt er Arbeit so lange, wie sie als Faktor seiner Bereicherung fungiert und nicht mit Gewinn durch totes Gerät zu ersetzen ist; was durchaus auch dazu führen kann, dass Experimente mit der Automatisierung von Arbeitsschritten abgebrochen werden und Arbeitnehmer alte oder neue Lücken im Produktionsprozess ausfüllen, die durch – in der Regel extra schlecht – entlohnte Arbeit besser und billiger zu schließen sind als durch Roboter.
Mit diesem berechnenden Gebrauch von Arbeit und Technik konkurrieren die kapitalistischen Unternehmer gegeneinander. Mit ihren technologischen Fortschritten und den entsprechend teuren Investitionen führen sie einen zunehmend härteren Kampf nicht gegen die Arbeitnehmer, sondern auf deren Kosten gegen ihresgleichen, machen einander den ökonomischen Erfolg streitig und am Ende das Überleben schwer.
*
Kleiner Exkurs zu der heißen Frage, ob der Kapitalismus nicht irgendwann demnächst vollautomatisch funktioniert
Eine Welt ohne Lohnarbeit wäre toll. Ein Kapitalismus ohne Lohnarbeit wäre keiner. Fabrikhallen und Büros voller Roboter und ohne Arbeitsstress: das ist und bleibt eine Sache kommunistischer Planwirtschaft. Der Kapitalismus verknüpft auf seine schöpferische Art die Automatisierung von Unternehmensabläufen, seinen Arbeit sparenden Fortschritt, mit der quantitativ und qualitativ fortschreitenden Unterwerfung der Menschheit unter unterschiedliche, überwiegend stupide und armselig bezahlte Arbeitsdienste.
Der erste Grund dafür liegt in der Eigenart dessen, was in dieser Welt Reichtum ist. Natürlich lebt man auch im Kapitalismus nicht wirklich von der Kreditkarte, sondern von materiellen Gütern, von Gebrauchswerten, die beständig reproduziert werden müssen. Als Reichtum zählt aber, wie jeder weiß, das Geld, das für diese Güter zu zahlen und umgekehrt mit ihrem Verkauf zu verdienen ist. Was nicht so allgemein gewusst wird, obwohl es unweigerlich jeder irgendwie merkt, das ist das eigentümliche gesellschaftliche Verhältnis, das im Geld objektiv, als Gegenstand existiert. Eigentümlich im Wortsinn: Geld ist Eigentum in Reinform, zugleich in bestimmter Quantität; es ist zivile Zugriffsmacht auf ein Quantum nützlicher Güter, die erst einmal ihrem Produzenten gehören und selbst, ausweislich ihres Preisschilds, ein Quantum Geld repräsentieren, in das sie sich verwandeln sollen und verwandeln müssen, um ihren Produzenten wirklich zu bereichern. Geld ist quantifizierte Zugriffsmacht auf fremdes Eigentum, die durch eigene Geldwert schaffende Arbeit verdient sein will. Oder umgekehrt: Arbeit ist auch im Kapitalismus ein Beitrag zum gesellschaftlichen Reproduktions- und Lebensprozess; ihr gesellschaftlich gültiges Resultat ist aber, im Widerspruch dazu, die ausschließende private Verfügungsmacht über diesen Beitrag, worin auch immer er sachlich besteht, qualitativ vergegenständlicht und quantitativ bestimmt in einer Geldsumme.
Ein Geheimnis ist das, wie gesagt, überhaupt nicht. Schon die triviale funktionalistische Bestimmung des Geldes als Tauschmittel gibt, wenn man’s genau nimmt, eben diese Auskunft über die Eigenart des gesellschaftlichen Reichtums in der bürgerlichen Welt. Denn der Tausch, um den es allemal geht, ist eine Sache zwischen Personen, die gegeneinander die im Geld wirksam realisierte Verfügungsmacht ihres wohlverdienten Eigentums ausüben: die sich aneignen, was bis dahin einem andern gehört, und dafür eigenes, in einer Geldsumme schlagkräftig vorliegendes Eigentum hingeben.
Der als Zweites zu nennende Grund ist der: Das übers Geld vermittelte Verhältnis zwischen Menschen als Eigentümern existiert nur deswegen universell, flächendeckend und alternativlos, weil es gar nicht in dieser Elementarform existiert, sondern als Zugriffsmacht in einem viel spezielleren Sinn. Die Mittel, nützliche Güter zu schaffen und sich damit Geld zu verschaffen, sind selber Eigentum, und zwar einer exklusiven Minderheit von Kapitaleignern. Der große Rest hat keine Chance, nennenswertes Eigentum für sich zu schaffen, braucht sie in dieser Welt aber auch nicht. Denn er lässt sich kaufen: Für ein Geld, das Entgelt für Arbeit, lässt die Person ohne Eigenmittel sich durch kapitalistische Arbeitgeber in Gebrauch nehmen. Als deren Instrument wird sie funktionalisiert für eine Produktion, die – siehe oben – als ihr gesellschaftlich entscheidendes Produkt Eigentum in Geldform schafft; jetzt aber – natürlich! – nicht persönliches Eigentum der benutzten Arbeitskraft, sondern eines, das ihrem zahlenden Anwender gehört. Das menschliche Instrument hat mit der Schaffung nicht einfach von nützlichem Zeug, sondern von geldwertem Eigentum daran das Seine getan und seinen Lohn verdient; der geschaffene Geldwert ist Eigentum des kapitalistischen Veranstalters. In dessen Händen bewährt sich das Geld also als Zugriffsmacht nicht auf einen Gegenwert, der damit bezahlt wird, sondern auf eine eigentumslose menschliche Geldquelle. Oder wieder andersherum: Auch im Kapitalismus reproduziert sich die Gesellschaft in einem arbeitsteiligen Gesamtprozess. Aber die Arbeitsteilung, auf die es hier ankommt, ist die zwischen den Inhabern der mit Geld ausgeübten Macht über das in irgendeiner Form werktätige Fußvolk, die über alles gesellschaftlich Produzierte verfügen und darauf ihre Gewalt über die gesellschaftliche Arbeit gründen, und den derart „abhängig Beschäftigten“; die reproduzieren mit ihrer Arbeit die Macht des über sie ausgeübten Kommandos und in Abhängigkeit davon sich selbst.
Der ganze Witz an der gesellschaftlichen Natur des geldförmigen Reichtums, und dass er, wie es heißt, die Welt regiert, ist also dieses Verhältnis: zwischen der Kapitalseite, die ihr in Geldeinheiten nachgezähltes Eigentumsquantum dadurch vermehrt, dass sie durch fremde gekaufte Arbeit für sich „Wert schöpfen“, i.e. neues Eigentum herstellen lässt – und der Gegenseite der gekauften Arbeit, die ihre Eigentum schaffende Tätigkeit an und mit fremdem Eigentum und für dessen Eigentümer wirksam werden lässt. Mit all ihren Bemühungen, die Produktion zu automatisieren und bezahlte Arbeit überflüssig zu machen, verschiebt die Kapitalseite – übrigens seit jeher – das quantitative Verhältnis zwischen dem Geldaufwand für geldschaffende Arbeit und deren Produkt zu ihren Gunsten. Dass sie dabei, quasi aus Versehen, die Lohnarbeit abschafft und sich damit den Ast absägt, auf dem sie sitzt, steht leider nicht zu erwarten.
*
2. Smarte Belegschaften und eine international vernetzte Arbeiterklasse
Wenn IT-Konzerne zum Kapitalumschlag beim Kontakt zwischen Unternehmen und Markt, bei der Einrichtung oder Effektivierung eines automatisierten Produktionsprozesses und bei der Abstimmung von Produktionsprozessen über Unternehmensgrenzen hinweg ihre Dienstleistungen beisteuern, dann wird dadurch ohne Zweifel eine Menge Lohnarbeit überflüssig, im Bereich der kapitalistischen Bürokratie ebenso wie im Bereich der Produktion im engeren Sinn. Dabei liegt es in der Logik dessen, was man Rationalisierung nennt, dass vor allem solche Arbeiten entfallen, die schon hinreichend schematisiert sind, um gut durch Automaten erledigt werden zu können, solche, die nach unternehmerischer Konkurrenzrechnung – zu – viel Lohn kosten, und erst recht solche, auf die beides zutrifft. Der digitale Fortschritt steuert dazu keine neuen Kriterien bei. Er hilft aber sehr bei der Identifizierung und Überwindung derartiger Schwachstellen in der betrieblichen Kosten- und Leistungsstruktur. Dass auch neue Arbeitsplätze entstehen, ist kein Wunder: Für die Einrichtung und Pflege der digitalen Dienstleistungen braucht es Personal; und bei der Durchleuchtung der vorgefundenen Strukturen im Unternehmen wird sich allemal ergeben, dass kompliziertere wie schlichtere Tätigkeiten nur mit größerem Aufwand automatisierbar sind und ein Mensch mit seinem speziellen Anpassungsvermögen bei bescheidener Lohnzahlung betriebswirtschaftlich die beste Lösung ist.
Einen qualitativ weiterführenden Nutzen für den kostenbewussten Umgang mit dem Faktor Arbeit bieten die IT-Konzerne mit der Herstellung und denkbar einfach auszunutzenden Erschließung eines globalen Arbeitsmarkts. Jahrzehnte des Welthandels, der Mobilität des Kapitals und der Arbeitsmigration haben da schon bestens vorgearbeitet. Es gibt schon lange keine Weltgegend mehr, in der nicht die kapitalistische Produktionsweise mit ihrer Technologie, ihren Anforderungen an brauchbare Arbeitsleistungen, ihrer praktischen Herrichtung der Bevölkerung zur lohnabhängigen Arbeitskraft und mit ihren Entgeltzahlungen als mehr oder weniger alternativloses Lebensmittel der Massen durchgesetzt ist. Und wo Kapitalismus herrscht, da sind dessen kommerzielle Veranstalter, kapitalistische Multis mit ihrem spezifischen Arbeitskräftebedarf, vor Ort – oder wenn nicht, dann aus betriebswirtschaftlichem Kalkül. Diese Omnipräsenz des Kapitals wird effektiver und billiger, seit Unternehmen der IT-Branche übers Internet die Weltbevölkerung, soweit sie über einen internetfähigen Anschluss verfügt – und da ist mit Facebook und Billig-Handys schon viel erreicht –, für jede kapitalistische Nachfrage nach Personal verfügbar machen. Es wird leicht für kosmopolitische Unternehmer, über alle Grenzen hinweg Leute, die einen Arbeitgeber brauchen, nach den eigenen Geschäftskriterien ideell zur Konkurrenz antreten zu lassen und über ihre Beschäftigung zu entscheiden. Übers Internet lassen sich Dienstleistungen der verschiedensten Art, die nicht am Unternehmensstandort verrichtet werden müssen, auch direkt abrufen; an digital vernetzten armen Leuten mit ebenso dringenden wie bescheidenen Honoraransprüchen besteht kein Mangel.
Letzteres machen sich speziell Firmen der IT-Branche selber zunutze. Denn in der Arbeitsplatzfrage glänzen sie zwar gerne mit den Spitzengehältern, die sie ihren Spitzenleuten zahlen, denen nämlich, die ihnen ein Stück geistiges Eigentum liefern, das sich vielfach zu Geld machen lässt. Das verdient dann zwar immer noch erst einmal der Auftrag- oder Arbeitgeber – erfolgreiche Firmengründer mit einer Karriere von der Garage zum Weltkonzern sind so prominent wie selten –; der lässt seine hauseigenen Erfinder aber gegebenenfalls an den Börsenkursen teilhaben, die wagemutige Spekulanten erzeugen. Zu deren Spitzenleistung – und vor allem dazu, dass die sich spitzenmäßig lohnt – gehört aber regelmäßig ein Heer von Dienstkräften, von denen ein großer Teil als Clickworker übers Internet den großen Haufen geistloser Routinearbeit erledigt, die fürs Alltagsgeschäft nötig und von alphabetisierten Weltbürgern immer noch billiger zu haben ist als von Automaten, die nicht auf einen denkbar bornierten Verstandesgebrauch reduziert, sondern erst einmal künstlich intelligent gemacht werden müssten.
Ihrem Werk, der „Digitalisierung“, verschafft die IT-Industrie so den guten Ruf, nicht bloß Arbeitsplätze abzuschaffen, die ohnehin nicht mehr ins „digitale Zeitalter“ passen, sondern Menschen mit Arbeit zu versorgen. Deren bekannte Qualitäten, insbesondere die Billigkeit der Dienste, die übers Internet direkt greifbar sind, tragen durchaus mit dazu bei, dass der Bedarf des Kapitals an menschlichen Lückenbüßern im globalisierten Wertschöpfungsprozess nicht ausgeht und bestens bedient wird – durch eine automatisch immer neu und in Echtzeit bedarfsgerecht durchsortierte und angepasste, wahrhaft internationalisierte Arbeiterklasse.
[1] Allein aufgrund ihrer Masse kommen die einlaufenden – gesammelten und sorgfältig aufbewahrten – Rückmeldedaten der User für allerlei Verwendungszwecke zahlungswilliger Interessenten in Frage; z.B. für solche aus dem Bereich der politischen Meinungsumfrage, auch für überhaupt noch nicht definierte Vorhaben, so dass sie sich vielfach zu Geld machen lassen. Nicht zuletzt das hat den „Daten“ – welchen auch immer – den absurden Ruf eingebracht, selber quasi der moderne Reichtum zu sein.
[2] Inzwischen wird am Ideal eines Modells des Unternehmens herumgedacht, das dessen geschäftsrelevante Abläufe bis hin zu den physikalischen Prozessen der Produktion komplett widerspiegelt: eines „digitalen Zwillings“ der Firma, mit dessen Hilfe sogar auch (noch) nicht existente, sich in Planung befindende Objekte und Prozesse nachgestellt werden könnten
(aus Googles Angebot zum Stichwort ‚Digitaler Zwilling‘ herausgegriffen).
[3] Zum vorigen und zum folgenden Abschnitt stehen notwendige und hilfreiche Erläuterungen in Heft 2-16 dieser Zeitschrift in dem Artikel ‚Industrie 4.0‘: Ein großer Fortschritt in der ‚Vernetzung‘ und in der Konkurrenz um die Frage, wem er gehört. Der Abschnitt I. dieses Artikels behandelt bereits ausführlich die ‚vierte industrielle Revolution‘ und ihre systembedingten Widersprüche
.
[4] Die Bewirtschaftung der bäuerlichen Landwirtschaft durch global aktive Konzerne kommt dieser Perspektive schon ziemlich nahe, siehe: Zum Beispiel Bayer-Monsanto. Von der Monopolkonkurrenz in der Landwirtschaft in Heft 2-19 dieser Zeitschrift.
Für regierende und ideell mitregierende Nationalisten ist in dieser Konkurrenz die Nationalität der Cloud-Betreiber das entscheidende Problem, nämlich eines der nationalen Abhängigkeit, der fremdländischen Herrschaft über unverzichtbare Erfolgsbedingungen der nationalen Ökonomie. Für Europa und speziell die Deutschen ist es ein Missstand nahe an der Katastrophe, dass, wie erwähnt, vier auswärtige Firmen sich den Weltmarkt für diese Dienstleistung aufteilen. Der Aufbau einer europäischen Alternative, nach dem Vorbild der erfolgreichen europäischen Konkurrenz gegen die USA im Flugzeugbau schon pränatal „digitaler Airbus“ getauft, ist im Programm. Die große Chance sieht man in einem speziellen Angebot zur Vernetzung „klassischer“ Industrien, die es so noch nicht gibt.
Hierzu und zum Folgenden steht mehr im schon empfohlenen Artikel in Heft 2-16 über die Industrie 4.0, außerdem im nachfolgenden Aufsatz Zu einigen neueren Fortschritten in der Konkurrenz der Staaten.