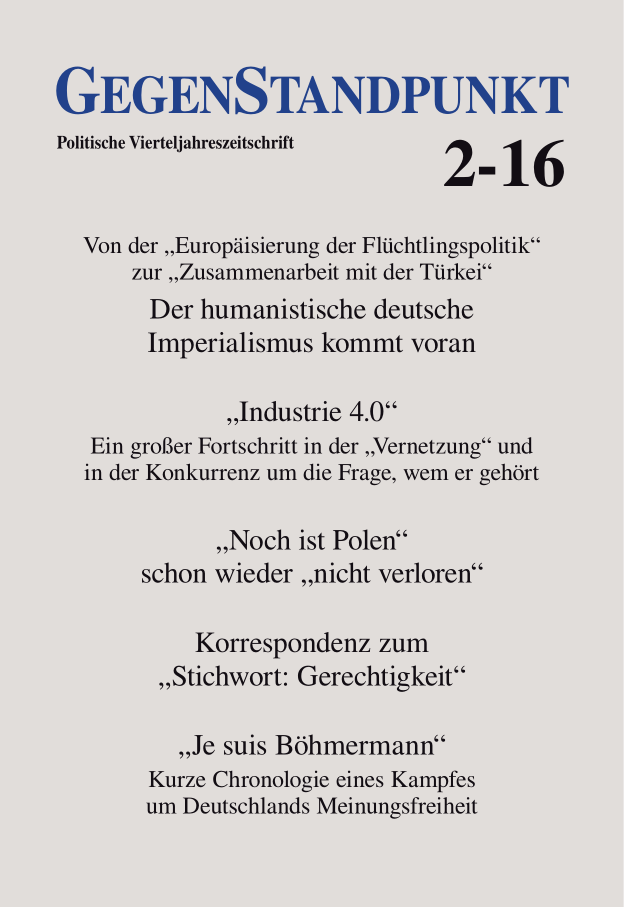„Industrie 4.0“
Ein großer Fortschritt in der „Vernetzung“ und in der Konkurrenz um die Frage, wem er gehört
Unter dem Titel „Industrie 4.0“ wird nicht weniger als eine Zeitenwende verkündet, die zwar dem Namen nach nur die Industrie betrifft, aber der Sache nach die ganze Art und Weise verändern soll, wie in Zukunft produziert und konsumiert wird. Diese neue Welt lernt der Zeitungsleser zunächst und vor allem in Gestalt einer bunten Ansammlung von Stichworten kennen, die von „intelligenter Fabrik“ über „Internet der Dinge“ bis hin zu „Big Data“ reicht und gerne mit der „Digitalisierung aller Lebensbereiche“ zusammengefasst wird.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
- I. Die „vierte industrielle Revolution“ und ihre systembedingten Widersprüche für die Konkurrenz der Kapitalisten
- 1. Die „Verschmelzung“ von Industrieproduktion mit Informations- und Kommunikationstechnologie
- 2. Die Widersprüche und Probleme, die sich kapitalistische Konkurrenten mit ihrer „Revolution“ einhandeln
- a) Der Widerspruch zwischen der Vernetzung und ihrem Zweck – und die vorwärtsweisende Lösung: Konkurrenz und Kooperation um „Standards“ und „Daten“
- b) Das Problem konkurrierender Kapitale mit der Verschmelzung von IT und Industrie – und die vorwärtsweisende Lösung: Der Kampf um die Beherrschung der gesamten industriell-digitalen „Wertschöpfungskette“
- II. Deutschlands „digitale Transformation“ – einer europäischen Führungsmacht würdig
- 1. Gesamteuropäische Rechtssicherheit unter deutscher Federführung
- 2. Europa als Standort deutscher IT-Kapitale, die denen der USA gewachsen sind
- 3. Die technische Aufrüstung des deutschen Standorts
- 4. Staatliche Moderation der Kooperation von Konkurrenten
- 5. Die Transformation einer Produktivkraftentwicklung zur Souveränitätsfrage
- III. Die Arbeitswelt 4.0
„Industrie 4.0“
Ein großer Fortschritt in der „Vernetzung“ und in der Konkurrenz um die Frage, wem er gehört
Unter dem Titel „Industrie 4.0“[1] wird nicht weniger als eine Zeitenwende verkündet, die zwar dem Namen nach nur die Industrie betrifft, aber der Sache nach die ganze Art und Weise verändern soll, wie in Zukunft produziert und konsumiert wird. Diese neue Welt lernt der Zeitungsleser zunächst und vor allem in Gestalt einer bunten Ansammlung von Stichworten kennen, die von „intelligenter Fabrik“ über „Internet der Dinge“ bis hin zu „Big Data“ reicht und gerne mit der „Digitalisierung aller Lebensbereiche“ zusammengefasst wird.[2]
Einerseits soll die neue digitale Ära mit lauter Verheißungen aufwarten. Das fängt an in der Welt der Produktion, die sich künftig in smart factories
abspielen wird, in der die physikalische und die virtuelle Welt
zu cyber-physikalischen Systemen
verbunden werden. Automaten werden immer mehr Arbeiten übernehmen – gerade der körperlich schweren oder stumpfsinnigen
Art; Maschinen werden aus ihren Schutzkäfigen entlassen und mit ihren menschlichen Mitarbeitern Seit‘ an Seit‘, zunehmend sogar Hand in Hand und stets harmonisch
ihr Werk verrichten. Dazu gesellt sich eine neue Welt von flexiblen Arbeitszeiten
mit ungeahnten Home-Office
-Möglichkeiten, die dem Verlangen des modernen Menschen nach Selbstbestimmung entgegenkommen. Auch die Konsumwelt wird mit der Digitalisierung und Automatisierung neuer und besser: Für die Kunden werden nicht mehr bloß Massenwaren ausgespuckt, sondern ganz auf ihre jeweiligen Sonderbedürfnisse zugeschnittene Produkte angefertigt. Außerdem werden die homes
, in denen die Menschen zunehmend ihre offices
unterbringen, smart
: Kühlschrank, Herd, Heizung, Jalousie und Fernseher werden miteinander vernetzt, sodass auch das Wohnen effizienter, komfortabler und sicherer wird; und was den Häusern recht ist, ist den Autos billig. Freuen darf sich schließlich auch die Wirtschaft: Mit innovativer Technik in der Produktion und mit ganz neuen Geschäftsmodellen steht eine neue Ära des Geldverdienens vor der Tür:
„In ihren Studien jonglieren Forscher, Berater und Lobbyisten euphorisch mit einem Wachstumsschub in Milliardenhöhe.“ (SZ, 22.4.16)
Andererseits ist das alles nur die eine Seite der brave new world
der Digitalisierung. Bei all diesen Verheißungen handelt es sich nämlich um Chancen
, und von denen weiß der moderne Mensch allzu gut, dass sie stets mit besorgniserregenden Risiken
einhergehen: Wenn Roboter in den zunehmend menschenleeren Fabriken
immer mehr Arbeiten übernehmen, dann stehen womöglich immer mehr Arbeiter arbeits- und einkommenslos vor dem Arbeitsamt und fallen große Teile der gesellschaftlichen Kaufkraft aus. Die neu gewonnene Selbständigkeit
der Beschäftigten könnte sich für die meisten eher als eine bloße Scheinselbständigkeit
entpuppen – mit einer Entgrenzung
der Arbeitsleistung und -zeit und einer flächendeckenden Prekarisierung
der Arbeitsverhältnisse. Mit dem Aufstieg von Daten zu einem einträglichen Geschäftsmittel droht wiederum ein Verlust an informationeller Selbstbestimmung
, sowohl für Bürger als auch für Unternehmer. Soziologen und ihre Kollegen in den Feuilletons entwerfen direkt neben ihren Träumen von einer besseren, digitalen Welt ein albtraumartiges Bild vom Aufstieg der Roboter
und dem damit einhergehenden Abstieg der Menschen.
In diesem Hin und Her zwischen Traum und Albtraum, zwischen der Beschwörung einer technologischen Morgendämmerung und der Angst vor ihren Schattenseiten sorgt ein Machtwort der deutschen Kanzlerin, die die Sache damit zur Chefsache erklärt, für Klarheit. Sie erinnert ihr Publikum daran, in welcher Welt das neue, vielversprechende und zugleich unsichere Zeitalter anbricht, wie ihm also einzig zu begegnen ist:
„Wir müssen die Verschmelzung der Welt des Internets mit der Welt der industriellen Produktion schnell bewältigen, weil uns sonst diejenigen, die im digitalen Bereich führend sind, die industrielle Produktion wegnehmen werden.“ (Merkel vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos, WISU-Magazin 4/15)
Die Verschmelzung dieser zwei Welten spielt sich also in der Welt der grenzüberschreitenden Konkurrenz ums Geschäft ab, und in dieser Welt – gerade in Deutschland zählt das zu den Grundweisheiten – kommt es bei der Technik auf den Vorsprung an. Hat man den nicht, ist die Technik nicht nur nichts wert: Sie wird umgekehrt zu einer existenziellen Bedrohung, die von denen ausgeht, die uns
voraus sind. Wenn deutsche Unternehmer an der digitalen Hauptfront nicht entschlossen vorangehen, dann laufen nicht nur sie, sondern auch wir alle
Gefahr, den Anschluss zu verpassen
und bald endgültig abgehängt
zu werden. Industrie 4.0 ist also vor allem das: eine Herausforderung
(Merkel, Gabriel et al.), die sich nicht umgehen lässt, bei der vielmehr alles daran hängt, sie als Erster zu meistern. Da weiß der moderne Mensch zwar immer noch wenig darüber, womit er es bei dieser Revolution
zu tun hat, aber immerhin, worauf es bei ihr ankommt.
I. Die „vierte industrielle Revolution“ und ihre systembedingten Widersprüche für die Konkurrenz der Kapitalisten
1. Die „Verschmelzung“ von Industrieproduktion mit Informations- und Kommunikationstechnologie
Der Terminus „Industrie 4.0“ wurde einer breiteren Öffentlichkeit bekannt durch die Gründung der gleichnamigen „Plattform Industrie 4.0“ durch die Branchenverbände ZVEI (Elektronikindustrie), VDMA (Maschinen- und Anlagenbau) und Bitkom (IT) – einer Kooperation zwischen Kapitalisten, die ganz genau wissen, was sie aneinander haben: Die IT-Kapitale wollen die industrielle Produktion mit ihrer Hard- und Software noch weiter, nämlich in „revolutionärer“ Weise als Geschäftsfeld für sich erschließen; und bei der Industrie, die sie so ins Auge fassen, treffen sie damit ins Schwarze. Denn auch sie verspricht sich durch die Aufrüstung zur „digitalen Industrie“ einen großen Sprung nach vorne für ihre eigenen Geschäftspotenzen.
Das fängt an mit der umfassenden Automatisierung und Digitalisierung ihrer Produktionsprozesse: Mit der Vernetzung sämtlicher Produktionselemente, die – mit Sensoren ausgestattet und per Software gesteuert – miteinander in der Produktion „kommunizieren“, kann der Produktionsprozess weitgehend autonom und automatisch abgewickelt werden.[3] Das verspricht einen großen Fortschritt bei der Verringerung der notwendigen Arbeit in der Produktion. Der besteht allerdings nicht darin, dass dann für Arbeiter immer weniger Arbeitsaufwand anfällt, sondern darin, dass für Unternehmer der Geldaufwand für Arbeit verringert wird. So sparen sie sich die Lohnkosten für den Lebensunterhalt der Arbeiter, die nicht mehr gebraucht werden – in der Tat ein großer Fortschritt für Produzenten, die zwar alle möglichen nützlichen Produkte, aber das alles nur als Träger für ihr eigentliches Produkt herstellen lassen: den per Verkauf erzielten Überschuss an Geld über ihren Vorschuss. Ganz gemäß der Vernunft, die die Marktwirtschaft regiert, heißt diese Sorte Effektivierung der Arbeit „Rationalisierung“ – und sie verschafft den Unternehmen das entscheidende Mittel, ihre Preise zu senken und sich so in der Konkurrenz um Marktanteile zu bewähren. Dabei macht das Stichwort „menschenleere Fabrik“ deutlich, wie weit die Unternehmer diese Ratio voranzutreiben gedenken: Nicht nur sollen die unterschiedlichsten Arbeitsverrichtungen fast gänzlich von Robotern ausgeführt werden, auch Entscheidungen und Kontrollfunktionen bezüglich des Produktionsverlaufs können zunehmend von – entsprechend programmierten – Automaten und ihren Algorithmen übernommen werden.[4] Neben der Einsparung an bezahltem Personal sorgt das weitgehende Herauskürzen des menschlichen Faktors aus der Produktion auch für eine erhebliche Verkürzung der Produktionszeit.[5] Auch das ist ein Fortschritt für die Veranstalter der Produktion, für die bekanntlich Zeit nicht bloß Zeit, sondern auch Geld ist, für die deswegen jede Minute, die während der Produktion verstreicht, eine Minute zu viel ist. Solange bleibt nämlich ihr investiertes Kapital gebunden, statt wieder für die Fortsetzung und Erweiterung des Geschäfts zur Verfügung zu stehen – ein eindeutiger Widerspruch zum Zweck, für den die ganze Produktion überhaupt unternommen wird. Was dieses Gebot der Beschleunigung für die Arbeiter bedeutet, die noch gebraucht werden, liegt auf der Hand: Sie müssen mit-, also das neue Tempo aushalten.[6]
Diesem Fortschritt der marktwirtschaftlichen Vernunft soll vor allem durch die zweite, als eigentlich revolutionär geltende Leistung der Industrie 4.0 zum Durchbruch verholfen werden: Durch das „Internet der Dinge“ werden Maschinen, Werkstücke, Produkte etc. über die Grenzen der jeweiligen Unternehmen hinweg vernetzt. Zwischen Zulieferern, Händlern und Kunden werden darüber nicht nur allerhand Daten ausgetauscht, sondern auch Prozesse, wie z. B. Bestellung und Bezahlung von Material, Einsatz und Abrechnung von Servicekräften o.ä. automatisch angestoßen So werden auch die der eigentlichen Produktion vor- bzw. nachgelagerten Zirkulationsakte, die auch Zeit kosten, effektiviert: das Einkaufen der benötigten Rohstoffe, Arbeitsmittel, Vorprodukte etc. und der über den Erfolg des ganzen produktiven Aufwands entscheidende erfolgreiche Verkauf der fertigen Waren. Dank der Automatisierung muss nicht länger auf die Entscheidungen der einschlägigen Figuren im Betrieb gewartet werden, sodass auch hier nicht nur Zeit, sondern Geld gespart wird – diesmal nicht für den Lebensunterhalt der benötigten Arbeiter in der Fabrik, sondern für das Personal, das lauter Herrschaftsfunktionen über die Produktion ausübt. Da ist dann die Rede von „flacheren Hierarchien“, die man durch die Beseitigung einiger Zwischenebenen der Verwaltung erreichen kann.[7]
Die Digitalisierung und Automatisierung sowohl der Produktion als auch der Zirkulation sorgt zudem für ein ganz neues Maß an Flexibilität in der Produktion: Erstens wird die Umrüstungszeit der Produktionslinien aufgrund der Beschaffenheit der neuen Produktionsmaschinen, vor allem aber wegen ihrer Software-Steuerung, radikal verkürzt. Zweitens und auf der Basis können unmittelbar – „in Echtzeit“, wie allgemein geschwärmt wird – einkaufsrelevante Informationen aus dem Zulieferungsbereich (z.B. Preisentwicklung bei den Energieträgern) sowie verkaufsrelevante Informationen aus den Absatzmärkten (z.B. Entwicklung der Verkaufszahlen und Kundenwünsche) in den Produktionsprozess einfließen und ihn automatisch an die Marktlage anpassen. Auftragslage, Bestellungen etc. können hinsichtlich ihrer Quantität und Qualität mit dem Auslastungsgrad, den aktuellen Produktionsabläufen, dem Vorratsbestand etc. abgeglichen, die Produktion tendenziell ohne Zeitverzögerung umprogrammiert und benötigte Materialien automatisch geordert werden [8] – womit sich schon wieder Einsparpotenzial auftut, nämlich beim Geldaufwand für die Lagerhaltung. Dieser Zusammenschluss der Produktions- und Zirkulationsprozesse verschafft den Unternehmen außerdem neue Waffen in ihrem Kampf um die zahlungsfähige Nachfrage. Dazu gehört an prominenter Stelle die zeitnahe Realisierung von Kundenwünschen – einmal online losgeschickt, kann die Kundenbestellung unmittelbar in der Produktion umgesetzt werden – sowie die vielzitierte „Losgröße Eins“: eine Kombination der Vorzüge der Massenfertigung und der Maßanfertigung. Die Produktion geringster Stückzahlen wird rentabel, also auch gemacht.
Dieses Interesse an der Einsparung von Zeit und Kosten durch die Vernetzung von Produktion und Zirkulation führt zu einer neuen, folgenreichen Form der Kooperation zwischen kapitalistischen Konkurrenten. Zwischen Industrieunternehmen und Zulieferern bzw. Abnehmern, aber auch zwischen Betrieben, die im Prinzip das Gleiche herstellen, entstehen „Wertschöpfungsnetzwerke“: Der Bedarf des einen Unternehmens – an Zulieferung oder Übernahme eines Teils der eigenen Produktion, etwa wegen eines außerordentlich hohen Auftragsvolumens – setzt unmittelbar die Produktion in einem anderen Unternehmen in Gang, und zwar in genau der benötigten Menge und Qualität. Ihre jeweiligen Produktionsprozesse greifen also automatisch ineinander, sie überschreiten die Unternehmensgrenzen und relativieren damit die exklusive Verfügung der Betriebsherren über ihr produktives Eigentum – damit ihr Eigentum besser dem Zweck entspricht, sich zu vermehren.
Mit dem Medium für diese unternehmensübergreifende Vernetzung von Produktion und Markt, dem Internet, machen IT-Unternehmer schon länger ihr Geschäft. Netzwerkbetreiber und -dienstleister stellen mit Kabeln, Funkfrequenzen, Routern, Datenübertragungssystemen und Clouddiensten die harten und soften Bedingungen dafür her, dass Geschäfts- wie Privatleute das Netz für ihre jeweiligen Zwecke benutzen können. Mit ihren diversen „platforms“ können Betriebe ihre Produktionsprozesse vernetzen, die mit dem Anwachsen der Datenmengen erforderlichen Speicherkapazitäten in Clouds auslagern und benötigte Software von externen Großrechnern abrufen etc. Schließlich können Lieferanten, Käufer und Verkäufer, Kunden und Geschäftspartner in Echtzeit und weltweit zueinander finden. Eine besondere Bedeutung kommt dabei IT-Unternehmen wie Google, Amazon, Facebook und Co. zu, die sich inzwischen zu unumgehbaren Vermittlern zwischen den jeweiligen Ansprüchen und dem Netz gemacht und damit einen entscheidenden Beitrag zu dessen globaler Verbreitung geleistet haben: Nicht zuletzt durch ihr Wirken ist das Internet zu dem globalen Kommunikations- und Zirkulationsmedium geworden, das es heute ist. Sie bieten die Zentralisierung und Koordinierung sämtlicher Zirkulationsakte an – organisieren Internet-Plattformen, statten Kaufinteressenten mit Suchmaschinen aus, versenden Werbung mittels sozialer Netzwerke gleich an Milliarden von potentiellen Kunden etc. Die Plattform-Anbieter etablieren sich damit als eine Art virtuelles Gesamthandelskapital und stiften einen virtuellen Gesamt-Marktplatz für den Einkauf von Arbeitsmitteln, Rohstoffen, Vor- und Endprodukten, für die Erschließung weltweiter Märkte und für die Möglichkeit, Käufer an sich zu binden.
Mit den neuen, „revolutionären“ Angeboten des IT-Sektors lässt sich schließlich aus den Unmengen an Daten, die in der vernetzten Welt von Produktion und Konsum anfallen, ein eigenes Geschäftsmittel machen. Digitalisierte Informationen über die „Kommunikation“ zwischen den „Dingen“, massenhafte „Clicks“ und „Footprints“, die bei jeder Nutzung des Internets hinterlassen werden, „Kenntnisse“ über das Einkaufs-, Partnersuch- oder Urlaubsverhalten usw. – diese Daten sind zum „Öl des 21. Jahrhunderts“, zum „Kapital der Zukunft“ ausgerufen worden, deren Speicherung, Auswertung und Verknüpfung mit Daten aus anderen Datenquellen für eine ganz neue Welt an Geschäftsmöglichkeiten mit Big Data
sorgen sollen. Wie diese Verwandlung von digitalen Abfallprodukten in sprudelnde Geschäftsquellen vonstattengeht, lässt sich jetzt schon studieren: In der Industrie fungieren die in Produktion und Zirkulation anfallenden Datenmassen vor allem als Instrumente für die Optimierung von Produktionsabläufen, Logistik, Lagerhaltung etc. Damit können Fehlerquellen, die zu Stockungen, Qualitätseinbußen und ähnlichem führen, schnell zugeordnet und abgestellt werden; aus Verlaufsdaten gewonnene Vorhersagemodelle erlauben es, Verschleiß und Ausfälle von Maschinen vor ihrem Eintreten zu erkennen und Abhilfe zu schaffen; Einkauf, Transport etc. werden datenmäßig erfasst und für die Perfektionierung einer „just in time“-Produktion optimiert; für zielgenaue Kundenwerbung und -betreuung werden deren Daten gesammelt und mit der aus allen möglichen anderen Datenquellen prognostizierten Nachfrage nach dem jeweiligen Produkt verknüpft. Schon länger praktiziert das Handelskapital – die Online-Plattformen sowieso – diese Sorte Datenerhebung und -verknüpfung, um Kundenprofile zwecks „Microtargeting“ zu erstellen. Hier werden Daten massenhaft und gezielt akkumuliert, damit man sie zur Optimierung von Werbung, Kundenbindung, Angebotsstruktur, Preispolitik etc. nutzen kann. Das Erheben und Sammeln von Daten wird zum eigenen Zweck,[9] aus den digitalen Abfallprodukten ein eigenständiges Produkt und Geschäftsmittel, das man entweder selbst nutzt oder anderen Unternehmen, die daran zur datenbasierten Effektivierung ihres jeweiligen Geschäfts interessiert sind, zum Kauf anbieten kann. Die zum Verkaufsobjekt fortentwickelten Datenmassen werden nicht nur von industriellen oder Handelskapitalen nachgefragt, sondern finden auch in so disparaten Feldern Anwendung wie in medizinischen Forschungsprogrammen, die aus der Verknüpfung von Millionen von Patientendaten Schlüsse auf Therapiemöglichkeiten ableiten wollen, in Wetterdiensten, an deren Daten Versicherungen oder Energieunternehmen interessiert sein könnten, bis hin zu Wasserwerken, die Datenmassen aus unterschiedlichsten Quellen miteinander verbinden, um damit Rohrbrüchen und anderen Ausfällen vorzubeugen.[10]
Das alles gibt der gesamten Geschäftswelt schwer zu denken – genauer: über neue Geschäftsmodelle nachzudenken: Neue Produkte wie das komplett vernetzte Haus, in dem nicht nur alle digitalisierbaren Funktionen im Inneren miteinander, sondern diese mit Außentemperatur, Wettervorhersage, Smartphone des Hausbesitzers, Autoschlüssel etc. zu einem „Smart Home“ vernetzt sind, könnten da ebenso die Konkurrenz um die abzuschöpfende Kaufkraft bereichern wie neuartige Dienstleistungen, durch die etwa industrielle Unternehmen ihre herkömmlichen Geldquellen um Angebote erweitern, die bislang das Geschäftsmittel von Unternehmen z.B. aus der Versicherungsbranche waren.[11] Das regt manche Vordenker des Produktionsgewerbes zu Überlegungen an, ob mit solchen Serviceleistungen künftig vielleicht mehr Geld zu verdienen ist als mit den bisherigen Produkten, die dann nur noch – wie schon heute das Handy – die dafür notwendige Hardware darstellen würden. Und das soll alles bloß der Anfang sein: Obwohl die Verkünder dieser neuen Geschäftssphäre, die alle Branchengrenzen sprengen soll, zum Teil selbst (noch) nicht wissen, womit da im Einzelnen Gewinne zu machen sind, stachelt sie das nur umso mehr an, entsprechende künftige Geschäftsideen zu suchen und zu entwickeln, um Daten irgendwie zu Geld zu machen.
*
Angesichts all dieser Leistungen und der Möglichkeiten, die sie eröffnen, ist für das industrielle Kapital einerseits klar: Die „Industrie 4.0“ stellt ein entscheidendes Mittel für seine Konkurrenz um Märkte dar; durch die Inanspruchnahme der einschlägigen Technik fällt sein Fortschritt als industrielles Kapital sogar zunehmend mit dem digitalen Fortschritt zusammen. Wer als Industrieunternehmer seinen Erfolg sichern und ausbauen will, darf den großen Sprung nach vorne nicht verpassen, der sich auf dem digitalen Feld abspielt; dort entscheidet sich letztlich die Tauglichkeit seiner Produktion als kapitalistisches Bereicherungsmittel. Andererseits: In dem Maße, wie die industriellen Kapitalisten diese Technik in Anspruch nehmen, bekommen sie es mit nicht nur in übertragenem Sinne eigentümlichen Problemen zu tun.
2. Die Widersprüche und Probleme, die sich kapitalistische Konkurrenten mit ihrer „Revolution“ einhandeln
a) Der Widerspruch zwischen der Vernetzung und ihrem Zweck – und die vorwärtsweisende Lösung: Konkurrenz und Kooperation um „Standards“ und „Daten“
Das erste Problem scheint zunächst ein bloß technisches zu sein: Wenn Unternehmen und ihre smarten Dinge mit ihresgleichen in der ganzen Welt kommunizieren und automatisch Zirkulations- bzw. Produktionsakte anstoßen sollen; wenn Maschinen-Automaten in alle Welt verkauft werden, mit dem Produktionssystem des Käufers kompatibel sein und überdies per Internet in Echtzeit gesteuert und gewartet werden sollen; wenn noch jede Schraube nicht nur ihre technischen Eigenschaften und ihren Standort mitteilen können soll, sondern auch noch sich selbst neu bestellen, sobald sich ihr Bestand dem Ende zuneigt, und das auch noch möglichst beim weltweit billigsten Lieferanten; wenn im neuen Verkaufsschlager „Smart Home“ lauter Haushaltsgeräte, womöglich von unterschiedlichen Herstellern, miteinander vernetzt werden sollen etc.: Dann erweist sich das Nebeneinander von tausendfach verschiedenen, weil von den jeweiligen Unternehmen bei sich etablierten technischen Spezifikationen als Schranke fürs Geschäft. Deren Überwindung ist also gefordert. Die hat aber zugleich einen bedeutenden Haken. Generell sind solche Spezifikationen nämlich Waffen in der Konkurrenz der Kapitalisten. Sie fungieren als Mittel, eine einmal eroberte Marktmacht zu verstetigen, Käufer des eigenen Produkts und Kunden der angebotenen Dienstleistung an sich „zu binden“. Im Idealfall sichern sie die Monopolstellung ab, die man sich mit seinem Betriebssystem, mit seinen Airbags oder was auch immer verschafft hat: Sie sind der etablierte State of the Art, der „de-facto-Standard“, der im Weltgeschäft gilt und an dem kein Wettbewerber vorbeikommt. An diese Usancen der Konkurrenz rührt der digitalisierte Fortschritt der Technik: Mit der Entstehung eines „Internet of Everything“ avanciert die Standardisierung – vereinheitlichte Datenformate, Schnittstellen, Basissoftware etc. – zum wichtigsten Treiber der vierten industriellen Revolution
(FAZ, 17.11.15); und es wird sofort klar, dass es hier um viel mehr als um eine technische Frage der Normierung geht. Das Interesse der industriellen Kapitalisten an der Vernetzung ihrer Betriebsabläufe stößt sie auf eine Schranke, die sie ihrer marktwirtschaftlichen Natur nach für einander darstellen: private Unternehmer mit ihren jeweiligen Spezifikationen, die Resultat wie Absicht ihrer konkurrierenden Geschäftsbemühungen sind. Genau diese Privatheit tritt ihnen hier in Gestalt der „Inkompatibilität“ ihrer Produkte als Hindernis für eine Vernetzung entgegen, die sie zur Beförderung ihrer Geschäfte ins Auge fassen. Und weil der Fortschritt, den die Vernetzung bringen soll, ganz im Dienst ihrer privaten Geschäftsinteressen steht, ist es nur konsequent, wenn ihre Konkurrenz die neue Verlaufsform findet, mittels der Herstellung von allgemeinen Standards, durch die Datenverarbeitungs- und Datenübermittlungs-Systeme harmonisiert werden sollen, exklusive Gewinninteressen zu verfolgen. Da diese Konkurrenz im Bereich der industriellen Produktion – im Unterschied zu anderen IT-Feldern, wo meistens US-amerikanische Monopole dominieren – noch nicht entschieden ist, sehen entsprechend ambitionierte Unternehmen ihre große Chance für den Sieg in der Schlacht um die Entwicklung und Durchsetzung der technischen Voraussetzungen des Geschäfts. Gerade deutsche bzw. europäische Unternehmen wollen auf diesem Feld der „Interoperabilität“ von Maschinen, Werkstücken etc. ihre Position als „Maschinenausrüster der Welt“ dafür nutzen, sich zu maßgeblichen Subjekten der Normierung zu entwickeln, weil eben daran ihr zukünftiger Weltmarkterfolg hängt.[12] Dabei gibt es prinzipiell zwei Strategien, die nebeneinander und in Abhängigkeit von Konkurrenzstand und -aussichten, praktiziert werden. Unternehmen können allein oder im Zusammenschluss mit anderen Standards entwickeln und in ihre Maschinen, Roboter-Systeme etc. implantieren, um diese dann als allgemeine Norm zu etablieren. Hier hängt die Verallgemeinerung des exklusiven Standards davon ab, inwieweit sich der Standard-Entwickler mit seinen Produkten in der Konkurrenz um den Markt durchsetzt. Andere setzen dagegen auf „offene Standards“ mit dem besonderen Verkaufsargument für ihre Kunden, die das Eingehen allzu großer Abhängigkeiten von ihren Dienstleistern scheuen und sich generell den Zugang zu einer „second source“ offenhalten wollen, dass ihre Maschinen oder sonstige Produkte beliebig mit anderen Produkten oder Anwendungen verknüpft werden können. In diesem Fall geht man gerade von der Exklusivität ab, um eine überlegene geschäftliche Position über den Weg der allgemeinen Zugänglichkeit zu Vernetzung und Interoperabilität zu erringen.
Daneben schließen sie sich mit ihresgleichen, mit Forschungsinstituten, Verbänden etc. in nationalen oder internationalen Kooperations-Plattformen wie der „Plattform Industrie 4.0“ oder der US-amerikanischen IIC (Industrial Internet Consortium) zusammen, um so etwas wie eine Lingua franca der digitalen Fabrik
(FAZ, 2.3.16) zu schaffen. Mit dieser Kooperation zollen sie einerseits dem universellen Charakter der Sache Tribut, die da angegangen wird: Immerhin geht es um eine allgemeine Vernetzung über Länder- und Unternehmensgrenzen hinweg, an deren Existenz alle Beteiligten interessiert sind, weil daran der geschäftliche Fortschritt hängt, der mit dem Internet der Dinge erreicht werden soll; daher sind alle von den ungelösten technischen Fragen der Interoperabilität digitalisierter Systeme betroffen. Andererseits stellt auch diese Kooperation nichts anderes als eine Form der Konkurrenz dar: Auch die Unternehmen und Nationen übergreifende Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Standardisierung verfolgt nicht den Zweck, Standards zu entwickeln und zu verbreiten, damit es sie gibt und jeder sie nutzen kann. Die einschlägigen Gremien, Plattformen und Konferenzen ähneln der zwischenstaatlichen Praxis der Diplomatie, bieten Gelegenheiten herauszubekommen, wie weit die anderen auf welchem Gebiet sind, sowie Chancen, sich mit seinen Lösungen für die Probleme der anderen einzubringen, um darüber die eigenen Standards weiter zu verankern. Womöglich lassen sich – dies die schönste, kapitalistisch adäquate Form der Kooperation – Koalitionen schmieden, um sich gegen Dritte durchzusetzen. Adäquat deswegen, weil es bei dieser Sorte Sistierung ihrer kapitalistischen Konkurrenz [13] um nichts Geringeres als die Voraussetzung für die Steigerung ihrer jeweiligen Konkurrenzmacht geht – und zwar für den Kampf um einen wahrhaft globalen Markt.[14]
*
Der Widerspruch, dass das Mittel, die eigene Konkurrenzfähigkeit gegen die Konkurrenten zu steigern, in der Vernetzung mit anderen Konkurrenten besteht, macht sich in Gestalt eines Dilemmas
geltend, das in Bezug auf das Schicksal der eigenen Daten problematisiert wird: Das fängt an mit dem Funktionieren der Wertschöpfungsnetzwerke, die Unternehmer eingehen, um die Kosten und die Dauer der Produktion und Zirkulation ihrer Waren zu senken. Die Integration der Produktionsprozesse erfordert zwischen den Beteiligten ein Agreement, das eine Offenlegung und gegebenenfalls Anpassung der jeweiligen Abläufe, Datensysteme etc. umfasst. Auch das ist keineswegs bloß eine technische Frage, sondern ein grundsätzliches Problem: Schließlich ist und bleibt der „Clusterpartner“, dem man derart Einsicht in die eigenen betriebsinternen Abläufe konzediert, ein misstrauisch beäugter Konkurrent und daraus erwachsen den Herren der kapitalistischen Betriebe die nächsten „Problemfelder“[15]: Wenn, wie sie es so sehen, die Kontrolle über und die Beherrschung der Betriebsabläufe nicht mehr exklusiv in ihren Händen liegt, könnten ihre Partner nicht nur Störungen verursachen, die den Betriebsablauf unter ihrem Kommando betreffen; sie könnten auch auf das „Know-how“ zugreifen, das das Konkurrenzmittel der eigenen Firma ist und bleiben soll und zu dem so gut wie alles gehört, was sich auch nur irgendwie zu dem Sammelbegriff einer ‚Corporate Identity‘ assoziieren lässt. Der Umgang mit diesem Dilemma erfordert konsequent das Tätigwerden einer höheren Gewalt: die rechtliche Regelung der Gegensätze, die auf dem üblichen Vertragsweg kooperationsfähig gemacht werden sollen.[16] Darüber wird Datensicherheit zu einer Gretchenfrage
der neuen Ära. Denn mit der allgemeinen und globalen Zugänglichkeit, die das Internet herstellt, werden die eigenen Daten, Algorithmen, Protokolle etc. – ein mit dem Fortschritt der Digitalisierung zunehmend entscheidendes Herzstück und Augapfel jedes Unternehmens – dem Risiko ihres unbefugten Abgreifens, der Wirtschaftsspionage und Sabotage ausgesetzt. Kaum wird ein allgemein verfügbares Mittel für universelle Vernetzung, zum Fluss von Daten und deren Nutzbarmachung für Produktion und Verteilung hergestellt, erwächst den kapitalistischen Konkurrenten genau daraus ein grundsätzliches Dilemma: Durch ihre geschäftsdienliche Vernetzung bauen die Unternehmen sich und ihr gesamtes Inventar an Daten, Ressourcen und geschäftlichen Strategien in einen allgemeinen Zusammenhang ein, der sie womöglich dem geschäftsschädigenden Zugriff von Konkurrenten und Feinden aussetzt. Insofern ist das, was sich ihnen als Dilemma darstellt, der Sache nach nichts anderes als der grundlegende Widerspruch ihres Systems: Die gesellschaftliche Kooperation, die sie für ihr Geschäft brauchen, steht im Widerspruch zum Ziel, für das sie sie brauchen – die Vermehrung ihres Eigentums auf Kosten der Konkurrenten.
Um nicht die ganze schöne Idee vom gewinnsteigernden Internet der Dinge und der Vernetzung mit anderen Unternehmen an diesem Widerspruch scheitern zu lassen, stehen die Konkurrenten vor der aparten Aufgabe, das, was sie im Interesse ihres Geschäfts unbedingt freisetzen wollen, zugleich zu begrenzen. Die Allgemeinheit des Mediums einerseits und der sich darauf richtende exklusive Nutzungsanspruch andererseits müssen miteinander vereinbar gemacht werden. An den Daten selbst ausgedrückt: Man soll die eigenen Daten weitergeben können, ohne ihr exklusives Nutzungsrecht zu verlieren. Umgekehrt gesagt: Man soll sie als Eigentum behalten, also gegen Konkurrenten, Daten-Diebe und Saboteure abschotten können, ohne sie deswegen für sich behalten und gegen einen nützlichen Zugriff von Partnern abschotten zu müssen. So wird die Fähigkeit, andere von der Kenntnis und Nutzung der eigenen Daten auszuschließen, zur entscheidenden Voraussetzung für die geschäftsdienliche Nutzung ihrer Verallgemeinerung. Inzwischen beschäftigen Unternehmen ganze Abteilungen mit der Aufgabe, per Verschlüsselung, Sicherheitssoftware, Firewall u.ä. den unerwünschten Zugriff durch feindliche Interessenten beim allseitigen Datenverkehr soweit wie möglich auszuschließen. Und es wäre nicht der Kapitalismus, wenn findige Geschäftemacher es nicht verstünden, aus diesem Widerspruch des kapitalistischen Geschäfts ein eigenes Geschäft und einen eigenen Konkurrenzgegenstand zu machen, so dass Datensicherheit zu einer stets wachsenden Geschäftssphäre wird. Damit ist der Widerspruch allerdings nicht aufgelöst: Die exklusive Verfügung über die eigenen Daten und die darin lauernden Konkurrenzmittel scheinen für viele Firmen – gerade im deutschen Mittelstand – so entscheidend zu sein, dass sie wegen des befürchteten Daten-Sicherheitsrisikos den Einstieg in die neue Vernetzungs-Technologie nach wie vor scheuen.[17]
Doch das für die Nutzung der neuen Technologie erforderliche Überschreiten der Unternehmensgrenzen wirft nicht nur gewisse Entscheidungsprobleme für den Mittelstand, sondern auch einige juristische Probleme auf, die schon wieder nichts mit der Technik, aber alles mit deren privateigentümlicher Anwendung zu tun haben. Um nur ein Beispiel zu nennen, mit dem die Rechtsanwälte und Gerichte noch ganz gut klarzukommen scheinen, wenn es darum geht, diese Verschmelzung unter die Prinzipien des Eigentums- und Vertragsrechts zu subsumieren: Wer haftet für die Funktionsfähigkeit der „hybriden Produkte“, wenn diese eine Kombination aus IT und physikalischen Elementen darstellen? Der industrielle oder der IT-Kapitalist?[18] Bei „Big Data“ stellt sich die Frage der exklusiven Verfügung in sehr grundsätzlicher Weise: Wem gehören eigentlich die digitalisierten Informationen, die bei der Nutzung des Internets anfallen?[19] Eine absurde Frage, die sich nur im Kapitalismus, dort aber sehr dringlich stellt, weil es sich dabei um den Stoff für ein großes Geschäftsfeld handelt. In diesem Fall steht die kapitalistische Eigentumsfrage allerdings in gewisser Weise Kopf: Da ist nicht wie sonst üblich das Eigentum an den Sachen der feststehende Ausgangspunkt von Produktion und Verteilung, sondern es wird wegen des Geschäftsinteresses an dieser „luftigen“ Materie zur offenen Frage. Die faktische Verfügung über die Daten und die technische und ökonomische Fähigkeit zu ihrer Auswertung ist eine Sache; die kapitalistisch entscheidende Frage ist aber, wer exklusiv über sie verfügt, wer sie unter welchen Bedingungen als Geschäftsmittel benutzen darf – und dieser Klärungsbedarf ruft die hoheitliche Gewalt auf den Plan: Die Eigentumsfrage wird zum Gegenstand juristischer Auseinandersetzungen bzw. Konstruktionen, die der Inkommensurabilität zwischen dem Eigentumsanspruch und der Sache, auf die er sich richtet, seit sie in der Welt ist und geschäftliche Begehrlichkeiten weckt, Rechnung tragen. Das alles auf gewohnte Weise den vorhandenen Paragraphen zu subsumieren, scheint nicht immer so ganz einfach zu sein – so dass auch an solchen juristischen Drangsalen der Fortschritt deutlich wird, der mit der Industrie 4.0 bzw. dem Internet der Dinge in die Welt gekommenen ist: Der als „vierte industrielle Revolution“ ausgerufene Fortschritt der Produktivkräfte besteht im Kern in der Fortentwicklung der Gesellschaftlichkeit des Produktionsprozesses – und stellt zugleich das Mittel für nichts anderes als die Konkurrenz der Privatunternehmen um die Vermehrung ihres jeweiligen Eigentums dar.
b) Das Problem konkurrierender Kapitale mit der Verschmelzung von IT und Industrie – und die vorwärtsweisende Lösung: Der Kampf um die Beherrschung der gesamten industriell-digitalen „Wertschöpfungskette“
Dass der Fortschritt der Industrie auf ihrer Verschmelzung mit IT beruht, gibt vor allem hierzulande Anlass zu einer sehr prinzipiellen Sorge: Je weit- und tiefgreifender die Leistungen der IT-Kapitale genutzt werden, desto größer wird auch die Befürchtung der Industrie-Kapitale, in eine schädliche Abhängigkeit von den Konkurrenten zu geraten, denen sie die Mittel ihres eigenen industriellen Fortschritts verdanken. Noch so eine Schönheit der Arbeitsteilung im Kapitalismus also: In dem Maße, wie eine Technologie ihre Nützlichkeit beweist, wird sie zu einem Machtmittel der Anbieter über diejenigen, die daraus ihren geschäftlichen Nutzen ziehen. Die erste Form, in der das industrielle Kapital die Macht seiner IT-Partner teils schon zu spüren bekommt, teils für die Zukunft befürchtet, besteht in dem Preis, der für die diversen Leistungen des IT-Kapitals zu entrichten ist – sei es für die Software, mit der sie ihre Produktion vernetzen, für die Erschließung eines virtuellen Gesamt-Marktplatzes, für Cloud-Dienste oder für die Technik zur Erhebung und Auswertung von Big Data. Bei alledem geht es allerdings nicht um den einmaligen Kauf eines Stücks Technik, sondern eben um die dauerhafte Verschmelzung von IT mit ihrer Produktion und ihren Produkten – sodass die Sorge aufkommt, ebenso dauerhaft der monopolartigen Marktmacht ihrer IT-Partner ausgeliefert zu sein.[20]
Der Gegensatz, der sich an die gewachsene Bedeutung des IT-Kapitals knüpft, führt inzwischen weit über die Preisfrage hinaus. Wenn Autos zu „Apps auf Rädern“ und so gut wie alle industriellen Produkte „hybrid“ werden; wenn IT-Unternehmen das Handelsgeschäft mit der ganzen Welt vermitteln und in dieser Funktion umso attraktiver werden, je mehr sie es schaffen, den Weltmarkt lückenlos aufzubereiten, ihre Domäne also dermaßen umfassend zu beherrschen, dass kein Unternehmen und kein Kunde an ihnen vorbeikommt; wenn schließlich ihre Verfügung über die Datenmassen und die Kapazitäten zu ihrer Aufbereitung monopolverdächtig werden – dann kommt gerade bei deutschen Industriekapitalisten die Sorge auf, zur verlängerten Werkbank
der IT-Unternehmen zu verkommen, gewissermaßen zu austauschbaren Lieferanten des Krimskrams, den die IT-Platzhirsche für das große Geschäft, das sie machen, auch noch brauchen. So stellen sich deutsche Industriekapitale und Weltmarktführer ihre industrielle Revolution nicht vor, dass das wirklich große Geschäft mit ihren Produkten nicht sie, sondern die Zulieferer der IT-Anteile zur Industrie 4.0 machen. Mit dem Selbstbewusstsein, das sie aus ihrem gewohnten Erfolg beziehen, nehmen sie die Konkurrenz um das verschmolzene Geschäft auf – und die dreht sich jetzt um die Frage, wer über die zunehmende Verzahnung zwischen IT, Industrie und Handel, also über den digitalisierten Produktionsprozess überhaupt bestimmt. Um es in der Sprache der Experten auszudrücken: Wer ist hier Lead Firm
und wer bloßer Zulieferer? Wer kann dem Konkurrenten den geschäftlichen Nutzen aus der Verschmelzung von IT und Industrie wegnehmen bzw. ihn zum Gehilfen des eigenen Geschäfts degradieren?
Diese Konkurrenz betreiben auf der einen Seite IT-Unternehmen zum Beispiel so, dass sie sich die Hardware für ihre Produkte einkaufen, wie Apple, das die physikalischen Anteile seiner Produkte im Billiglohnland China fertigen lässt, oder wie Google, das in die Auto-Produktion einsteigt und damit den etablierten Industrieunternehmen auf deren ureigenstem Feld als Konkurrent gegenübertritt. Die Grundlage für diesen machtvollen Auftritt ist neben ihrer Verfügung über die zentralen soften „Innovations-Instrumente“ und ihre Etablierung als Marke vor allem die beeindruckende Kapitalgröße, zu der sie es mittlerweile gebracht haben. IT-Monopolisten nutzen ihre „Datenhoheit“ – genauer: die Kapitalmacht, zu der sie es mit der Verwertung ihrer Daten gebracht haben und die ihnen überhaupt den Sphärenwechsel in dem gigantischen Umfang gestattet, den sie ins Auge fassen – , um in die Konkurrenz um die neuartigen „Ökosysteme“, das heißt die Verknüpfung von Produkten mit damit verbundenen Serviceangeboten, einzusteigen: Sie ergänzen ihr Imperium um Produktionsbetriebe aller Art, um derart den etablierten industriellen Unternehmen vor allem auf dem Gebiet zukunftsträchtiger Produkte jede geschäftliche Zukunftsperspektive zu nehmen.
Spätestens da wird deutschen Industriekapitalisten auf der anderen Seite klar: Das alles muss man selbst können. Sie müssen sich selbst die IT-Fähigkeiten verfügbar machen, die für die Beherrschung der vernetzten Produktion nötig sind – und machen sich daran, den Spieß umzudrehen, sich die benötigte IT-Kompetenz durch den Ausbau eigener IT-Abteilungen [21] bzw. den Aufkauf von Softwarefirmen zu verschaffen und sich so deren Leistungen einzuverleiben.[22] Da geht es längst nicht mehr bloß darum, einer Abhängigkeit zu entgehen – das wäre viel zu defensiv gedacht. Die Furcht, zur Werkbank degradiert zu werden, verwandeln ambitionierte deutsche Industriekapitale in den Anspruch, selbst die Kapitalisten zu sein bzw. zu werden, die den größten Anteil der „Wertschöpfungskette“ okkupieren, also den Löwenanteil des Geschäfts machen, das mit der Produktidee anfängt und mit dem Recycling des Produkts immer noch nicht aufhört, sondern mit der Verwertung der Daten weitergeht, die bei alledem so massenhaft anfallen. Sie widmen sich dem neuen Konkurrenzgegenstand „Datenhoheit“, besorgen sich die benötigten Daten und Auswertungskapazitäten und werden darüber selbst ernstzunehmende Konkurrenten im Big-Data-Geschäft. Was der Chef einer ehrgeizigen deutschen Autofirma lapidar so ausdrückt:
„‚Die Wertschöpfung verschiebt sich von der Hardware in Richtung Software und Services,‘ sagt der BMW-Chef [Harald Krüger]. Ein Satz, den man auch so übersetzen könnte: Bisher haben wir unser Geld nur mit Autos verdient. Demnächst werden wir unser Geld auch mit digitalen Diensten und anderen Dienstleistungen verdienen“ (SZ, 17.3.16),
gilt genauso für andere deutsche Großkapitale wie z.B. Bosch, das vom intelligenten Haus (smart home) über das autonome Auto bis zur vernetzten Fabrik Lösungen
anbietet, oder Siemens, das nicht nur die gesamte Wertschöpfungskette
bestimmen will, sondern zusätzlich über drei ‚Cyber Security Operation Center‘ in München, Lissabon und Milford (Ohio) den Schutz von Industrieanlagen rund um den Globus vor Hackern
liefert (FAZ, 25.4.16).
Der Kampf wird also von beiden Kapitalfraktionen um die Beherrschung des zur Einheit von IT und Industrie verschmolzenen Geschäfts geführt – jenseits der obsolet gewordenen Branchengrenzen und der jeweiligen Startposition. Doch offenbar ist auch in dieser Konkurrenz Platz für Kooperation. Schließlich hängt der Sieg in der Konkurrenz – dieses schlichte marktwirtschaftliche Prinzip bleibt auch in der neuen digitalen Industriewelt in Kraft – von der Kapitalgröße ab, mit der man antritt. Eine schier erdrückende Marktmacht – dieses Erfolgsrezept, das über alle Branchengrenzen hinweg seine Gültigkeit behält – wird angestrebt, wenn sich etablierte Marktführer der Industrie mit solchen aus der IT-Branche zusammentun und auf diese Weise herkömmliche Branchengrenzen auflösen: Siemens und SAP, Google und Fiat/Chrysler, Apple und IBM [23] sind prominente Beispiele dieser Kooperationen, die dem „hybriden“ Charakter der zu „Ökosystemen“ gewordenen Produktionsprozesse und Produkte so Rechnung tragen, wie sich das für Konkurrenten um das kapitalistische Geschäft mit ihnen geziemt: Ihr Anspruch auf Monopolisierung des zur Einheit von IT und Industrie verschmolzenen Weltgeschäfts soll durch ihren Zusammenschluss gegen andere verfolgt und durch die zusammengeworfene ökonomische Macht unwidersprechlich werden.
*
Die Frage, wer diesen Kampf um die Industrie und das Weltgeschäft der Zukunft gewinnt, ist nicht nur für die beteiligten Firmen, sondern auch und gerade für den deutschen Staat ein wichtiges Anliegen – viel zu wichtig, um es einfach dem Lauf der Konkurrenz zu überlassen.
II. Deutschlands „digitale Transformation“ – einer europäischen Führungsmacht würdig
„Wir sind jetzt an einer entscheidenden Stelle angelangt, bei der Frage: Wie durchdringt die Digitalisierung auch die industrielle Produktion? Das ist für uns volkswirtschaftlich von allergrößter Bedeutung, denn es ist nicht entschieden, ob die klassische industrielle Produktion eines Tages der hintere Teil der verlängerten Werkbank wird oder ob wir es schaffen, eine gleichberechtigte Balance von digitaler Technologie und klassischer industrieller Fertigung zu erreichen, mit der wir dann auch weiter weltweit reüssieren können... Das ist nämlich im Kern der Kampf, der zurzeit ausgefochten wird.“ (Merkel auf dem Kongress „Wirtschaft 4.0 – Chancen für Deutschland“, 4.11.15)
Auch und gerade auf internationaler Ebene ist die digitale Revolution also kein Fall von bequemer Arbeitsteilung; alles Wissen über Informationstechnologie und alle Ingenieurskunst, die in der Kombination von IT- und Produktionstechnik steckt, haben ihren höheren Sinn darin, das einschlägige Wissen und die angewandte Kunst der anderen Länder in den Schatten zu stellen. Auch Merkel sieht es so, dass es bei der Produktion auf die Dominanz über die „Wertschöpfungskette“ ankommt; die äußerst unwürdige Rolle einer Nation, die als „Werkbank“ bloß Zeug produziert, mit dem andere ihren Profit machen, kommt für Deutschland nicht in Frage; die Rolle ist selbstverständlich für andere Nationen reserviert. Die Balance
, die Merkel im Auge hat, herrscht genau dann, wenn es zwischen Deutschland und den anderen Nationen gerade keine Balance
gibt, sondern die Überlegenheit der deutschen Industrie gewahrt wird. Die sieht der Weltmarktführer im Maschinenbau durch ganz bestimmte Nationen angegriffen: China, aber vor allem die USA bzw. die amerikanischen IT-Konzerne, die mit ihrer überlegenen Informationstechnologie die hiesige Industrie bald beherrschen könnten. Zur Verteidigung von Deutschlands Status als führendem Industriestandort verordnet die Regierung ihrer Nation eine umfassende „digitale Transformation“ – allerdings nicht bloß ihrer Nation. Weil Deutschland seine globale industrielle Führungsrolle verteidigen will, braucht ganz Europa eine digitale Revolution unter deutscher Führung. Und so viel steht dabei fest: Angriff ist die beste Verteidigung.
1. Gesamteuropäische Rechtssicherheit unter deutscher Federführung
Die Hauptkampflinie befindet sich in der Sphäre des Rechts. Damit die neuen digitalen Reichtumsquellen für die Ansprüche taugen, die der deutsche Staat an sie stellt, muss dafür gesorgt werden, dass deren einzig entscheidende Eigenschaft, nämlich Eigentum zu sein, zuverlässig gilt. Angefangen bei der Definition, wie überhaupt Daten als Eigentum zu fassen sind, über die Anpassung der Rechte der Verbraucher oder des Wettbewerbs für die Online-Handelsplattformen bis hin zu neuen Haftungsfragen, wovon die banalste wohl die ist, wer für die Downloads in freien WLANs haftet, lässt der deutsche Staat seinen ganzen Katalog von rechtlichen Regelungen daraufhin überprüfen, ob sie für die widersprüchlichen Ansprüche und Friktionen seiner digitalisierten Gesellschaft noch taugen. Dass ein Großteil der rechtlichen Neuregelungen sich auf die Geschäfte mit Daten bezieht, ist insofern kein Wunder, als sie nicht mehr nur ein einfaches Wirtschaftsgut, sondern Leitwährung der digitalen Ökonomie
(Gabriel auf der „Konferenz zur digitalen Transformation“, 18.9.15) sind. Die Rechtssicherheit, auf die es hier ankommt, wird dabei gleich als Konkurrenzmittel ins Auge gefasst:
„Datensicherheit ist eine unabdingbare Voraussetzung für die Digitalisierung. Auch da sollten wir uns ein ehrgeiziges Ziel setzen: der sicherste Datenstandort der Welt. Das wäre mal ein schöner Wettbewerb mit den USA, denen da nicht sehr viel zugetraut wird.“ (Gabriel im Handelsblatt, 24.4.16)
Deutschland präsentiert sein neues IT-Sicherheitsgesetz als Marke, als Sicherheit made in Germany
und Deutschland als künftiges Verschlüsselungsland Nummer eins
in Europa. Gerade das Big-Data-Geschäft, das der deutsche Staat unbedingt unter seiner Hoheit versammeln möchte, soll durch ein trusted cloud-label
besonders vertrauenswürdig und damit attraktiv für die interessierten Geschäftemacher gemacht werden. Nur logisch, dass Gabriel sich dabei mit den USA messen will, denn genau darin besteht ja das Sicherheitsproblem, das ihn stört: Die falschen, nämlich die US-amerikanischen Konzerne haben es bislang geschafft, den Nutzen aus dem Geschäft mit den Daten auch der deutschen Bürger und Unternehmer mehr oder weniger mit Beschlag zu belegen. Dabei bleiben IT-Riesen wie Google, Apple oder Facebook weitgehend unbehelligt von deutschen Datenschutzbestimmungen, machen Gebrauch von den vergleichsweise „laxen“ der USA oder Irland. Das ist eine Sorte Kapitalismus, die ein moderner deutscher Sozialdemokrat mit Regierungsverantwortung wirklich nicht leiden kann; daher muss nicht nur Deutschland, sondern auch ganz Europa dem brutalen ‚Informationskapitalismus‘ die Stirn ... bieten, dessen Infrastruktur beherrscht wird von einer Handvoll amerikanischer Internetkonzerne, die als globale Trusts nicht nur das Wirtschaftsleben des 21. Jahrhunderts dominieren könnten.
(Gabriel in der FAZ, 13.5.16). Dabei ist klar: Ein so ehrgeiziges
Ziel verfolgt Deutschland nicht für sich selbst allein. Es tritt vielmehr als europäische Führungsmacht an, die dem ganzen Kontinent die „digitale Transformation“ vorschreibt, die Deutschland für sich anpeilt:
„Deutschland, aber auch alle anderen Partner, die sich dem Diktat der Internetmonopolisten widersetzen wollen, haben ein großes Interesse daran, dass Europa gemeinsam handelt. Denn nur so können wir verhindern, gegeneinander ausgespielt zu werden – mit immer neuen Schlupflöchern, mit Datenschutz- oder Steuerdumping. Europäische Solidarität ist hier wirklich ein Machtfaktor.“ (Ebd.)
Dass Europa sich nicht länger auseinanderdividieren lässt, haben sich in erster Linie die anderen Europäer hinter die Ohren zu schreiben.[24] Dass die europäischen Nationen in dieser Frage bislang keine gemeinsame Linie haben, kommt nicht von ungefähr. Was der Wirtschaftsminister da Schlupflöcher
nennt, sind für ein Land wie z.B. Irland entscheidende Hebel seiner Standortpolitik: Seine im europäischen Vergleich günstigen Steuer- und Datenschutzbedingungen, welche die IT-Konzerne insbesondere aus den USA zu schätzen wissen, sind gerade die Art und Weise, wie es sein Geschäft in der „digitalen Ära“ macht. Doch wenn die europäische Vormacht zum Angriff gegen die US-Übermacht bläst, dann haben sich die europäischen Reihen zu schließen. Da mögen sogar deutsche Geschäftsleute von der Freizügigkeit amerikanischer oder irischer Gesetze im Umgang mit Daten profitieren (zum Beispiel SAP), seine Bürger ihre Privatkonkurrenz freudig weltöffentlich über Facebook austragen oder über Amazon auf dem Globus billig einkaufen gehen. Der Nutzen, den Deutschland in der digitalen Ära anpeilt, besteht nicht bloß darin, dass deutsche Bürger und Unternehmer diese Dienstleistungen in Anspruch nehmen, sondern darin, dass Deutschland das Geschäft mit diesen Dienstleistungen dominiert.
2. Europa als Standort deutscher IT-Kapitale, die denen der USA gewachsen sind
Deswegen ist das Stopfen der eben genannten Schlupflöcher bloß der Anfang; die neue „Europäische Datenschutzgrundverordnung“ mag für gleiche Datenschutzbedingungen in Europa sorgen, doch auch wenn sich Apple, Google, Facebook
nicht mehr den Standort aussuchen können, an dem das Datenschutzrecht am schwächsten ausgeprägt ist oder die Kontrolle nicht stattfindet
(Vortrag Günther Oettinger zur Sonderreihe „BMF im Dialog“: „Wachstumstreiber Digitalisierung“, BMF, 6.3.15), ist damit nur die eine Seite des Ärgernisses mit den IT-Monopolen aus den USA beseitigt. Die richtige Balance
zwischen den widerstreitenden Ansprüchen von Datenschutz einerseits und einem innovativen Big-Data-Management
(Merkel auf der Cebit, 15.3.15) andererseits ist erst dann gegeben, wenn wir ganz vorne auf der Welt mit dabei
(ebd.) sind. Wenn in dem Sinn ein Sozialdemokrat dem brutalen Informationskapitalismus die Stirn bietet
, dann mit dem Ziel, genau dieses Geschäft für den Erfolg Deutschlands in Beschlag zu nehmen:
„Unsere Vorstellung von Datenschutz muss sich auch ändern. Der klassische Datenschutzbegriff fordert zur Minimierung der Daten auf. Das ist so ziemlich das Gegenteil eines Big-Data-Geschäftsmodells. Dabei geht es ja gerade darum, aus möglichst vielen Daten Erkenntnisse zu gewinnen und daraus Geschäftsmodelle zu entwickeln.“ (Gabriel im Handelsblatt, 24.4.16) Das ist es, „was wir für die Wettbewerbsfähigkeit in einem digitalen Zeitalter brauchen“ (Gabriel auf der „Konferenz zur digitalen Transformation“, 18.9.15).
Siemens, Bosch, SAP und die deutschen Telekommunikationsfirmen sollen schließlich eigene Clouds bauen und Big Data als ihr eigenes Geschäftsfeld erobern. Es soll also nicht bloß ein Bollwerk gegen US-Monopole errichtet, sondern es sollen die rechtlichen Bedingungen für einen europaweit einheitlichen, also riesengroßen, nämlich kontinentweiten gemeinsamen Markt geschaffen werden, auf dem europäische Großfirmen gedeihen können. Erst dann entfaltet die europäische Einheit in Datenfragen ihre volle Wucht als Machtfaktor
. So soll die Kapitalgröße zustande kommen, die es braucht, um gegen die Amerikaner anzutreten. Die europäische Kommission muss aus Sicht der deutschen Chefs noch lernen, dass diese Größe das entscheidende Ziel ist, dass das Störende an den amerikanischen Monopolen darin liegt, dass es eben amerikanische Monopole sind:
„Wir hätten Probleme, heute einen europäischen Flugzeugkonzern wie Airbus aufzubauen. Die Wettbewerbskommission würde mit der Beihilferichtlinie winken und zudem noch ins Feld führen, es dürften in Europa keine Monopolisten entstehen. Das halte ich für kleinmütig, das ist der falsche Ansatz. Wir müssen europäische Champions zulassen. Es gilt, in der Wettbewerbsordnung den relevanten Markt zu erkennen – denn der ist oft global… Unser Problem besteht doch nicht darin, dass wir zu große Player haben, sondern dass die Internet-Giganten aus den USA uns immer mehr in die Abhängigkeit zwingen.“ (Gabriel im Handelsblatt, 24.4.16)
Daher brauchen die Europäer keine Angst zu haben, wenn Deutschland auf eine Neuregelung des europäischen Telekommunikationsmarkts pocht, dabei auf Fusionen und die Verdrängung europäischer Konkurrenten durch die deutsche Telekom setzt. Gegen die kleinmütigen Standortkonkurrenten wettert Merkel:
„Wie definiere ich ‚Markt‘ innerhalb der Europäischen Union, wo wir mehr als 20 Telekommunikationsunternehmen haben und trotzdem bei jeder europäischen Fusion Angst haben müssen, dass dadurch eine beherrschende Marktmacht definiert wird?“ (Merkel auf der Deutsch-Französischen Digitalen Konferenz am 27.10.15)
Für das, was Deutschland als Führungsmacht des europäischen Clubs will, kommt es auf die Marktmacht gerade an! Also sollen sich die anderen europäischen Staaten durch die einschlägigen rechtlichen Regelungen und finanziellen Mittel für die Vernetzung und Digitalisierung herrichten, damit Europa als einheitlicher und großer Markt für das Wachstum der Kapitalgröße deutscher Firmen taugt.[25]
3. Die technische Aufrüstung des deutschen Standorts
Wenn die „Digitalisierung aller Lebensbereiche“ ein gelungener Sprung für deutsche Geschäfte sein soll, müssen auch die entsprechenden menschlichen und technischen Voraussetzungen am Standort vorhanden sein. Um Erstere in gewünschtem Maße herzustellen, nimmt der deutsche Staat sein Bildungswesen in die Pflicht und verordnet ihm eine Bildungsoffensive für die digitale Wissensgesellschaft
. Insbesondere müssen die Schulen für die zunehmende Digitalisierung gewappnet [sein], bei der Ausstattung mit Elektronik, ebenso wie bei der Qualität der Lehrer. Programmiersprachen müssen ebenso selbstverständlicher Unterrichtsstoff werden, wie es Fremdsprachen heute glücklicherweise bereits sind.
(Gabriel in der FAZ, 1.7.15) Die zu schaffenden technischen Voraussetzungen müssen gewährleisten, dass bis in den letzten Winkel des Landes, bis ins letzte „home office“ der profitdienliche Datenverkehr fließen kann. Dafür nimmt der Staat den Geschäftssinn seiner Netzkapitalisten in Anspruch, unterstützt die Deutsche Telekom mit finanziellen „Anreizen“ für den schnellen Ausbau der Netzinfrastruktur mittels „Vectoring“[26] und schließt die Konkurrenten zu einer „Netzallianz“ zusammen, damit der zukunftsfähige Glasfaserausbau in Kooperation und als deren eigennütziges Geschäft vorangetrieben werden kann. Und dabei bleibt es nicht: Wenn Kapitalisten, die in der globalen Vernetzung ihr Mittel der Produktivkraftsteigerung sehen, den Standort Deutschland als ihr Geschäftsfeld schätzen lernen sollen, dann sind besonders schnelle Netze auf dem begrenzten deutschen Territorium einfach zu wenig. Auch bei diesem Baustein eines europäischen digitalen Binnenmarkts, dem europäischen Netzbau, gilt: Mut ist jetzt gefragt und nicht Kleinmut.
(Gabriel im Handelsblatt, 24.4.16) Weil es hier um ein Projekt geht, das sich daran misst, inwieweit es für die Konkurrenz mit den USA taugt, ist es nur passend, dass Gabriel sein Vorhaben, die modernste digitale Infrastruktur der Welt
(Gabriel auf der Hannover Messe 2016) zu schaffen, als Man to the Moon Projekt
(Gabriel im Handelsblatt, 24.4.16) bezeichnet. In diesem Projekt, in der Herstellung weltweiter europäischer Überlegenheit im Wachstumsmarkt der Zukunft, den Deutschland dominieren will, wären die neulich beschlossenen europäischen Investitionsmilliarden allemal besser angelegt als fürs Anzetteln von lauter Strohfeuern im europäischen Süden.[27]
4. Staatliche Moderation der Kooperation von Konkurrenten
Damit alle deutschen Unternehmen ihren Teil zum Erfolgsprogramm beitragen, das Deutschland für sich und für sie vorgesehen hat, ist auch daheim einiges an Kooperation nötig, wofür eine „Plattform Industrie 4.0“ mit staatlicher Zusammenarbeit den erforderlichen Rahmen abgeben soll. Mittelständler, IT- und Telekommunikationskapitalisten sowie Industrielle sollen Technologien und Wissen rund um die smarten Fabriken und Produkte in Kooperation erarbeiten, damit diese als allgemeine Voraussetzungen für ihr Geschäft auf dem deutschen Standort zur Verfügung stehen. Forschungsgelder, Plattformen, Vorzeige-„smart factories“, „Labs“, Allianzen und IT-Gipfel sollen deren egoistisches Geschäftsinteresse für das nationale Kampfprogramm fruchtbar machen. Standards und „Architekturen“ sollen erarbeitet, best-practice-Anwendungen ausgetauscht werden. Seinen konkurrierenden Betriebsführern leuchtet der staatlich initiierte „Dialog“ dort ein, wo sie die Ergebnisse in „Investitionssicherheit“ und eigennützige Geschäfte ummünzen können, worauf es dem deutschen Staat insbesondere bei seinen Mittelständlern ankommt. Und auf die wird kräftig eingeredet, sich endlich für die digitale Revolution entsprechend aufzurüsten, für deren Beherrschung sie und ihre größeren Kollegen vorgesehen sind.
Auch auf dem Feld der Standardisierung ist ein Zusammenschluss angezeigt, denn dass Software, Netzwerke und Daten zueinander passen, ist nicht nur Gegenstand der Konkurrenz der Kapitalisten untereinander, sondern für Deutschland von strategischer Bedeutung. Wer Standards entwickeln und durchsetzen kann, verschafft sich Vorsprünge im internationalen Wettbewerb
(bmwi.de). Die Erreichung des Ziels, bei der Erarbeitung der noch fehlenden Standards und 200 bis 300 neuen Normen
(FAZ, 16.4.15) federführend zu sein, wird also nicht den Unternehmern überlassen. Deutschland will auf dem Feld der industriellen Produktion dorthin, wo die Internet-Giganten aus den USA bei den Kommunikations- und Verkaufsplattformen schon sind, und für dieses Ziel, die USA auf einem Feld zu schlagen, das die eigenen Kapitale noch nicht besetzt haben, kooperiert man sogar mit den USA – dann lässt sich endgültig die ganze Welt auf die Standards verpflichten, mit denen deutsche Produkte kompatibel sind.[28]
5. Die Transformation einer Produktivkraftentwicklung zur Souveränitätsfrage
Der derzeitigen Übermacht der IT-Kapitale aus den USA gewinnt der deutsche Staat einen ganz speziellen Gesichtspunkt ab, den er bei seiner Industriepolitik in Anschlag bringt. „Digitale Souveränität“ heißt das einschlägige Stichwort –
„Wir haben derzeit keine europäische, keine deutsche, keine eigene digitale Souveränität und zu wenig digitale Autorität. Die zu gewinnen, muss ein Ehrgeiz Europas sein, ansonsten sind wir eher in Lebensgefahr, als dass das Ganze eine Chance ist“ (Oettinger, ebd.) –
und diesem zur „Lebensgefahr“ stilisierten Mangel liegt folgendes Problem zugrunde:
„Problematisch ist hier vor allem, dass gerade in der Informations- und Kommunikationstechnik die faktische Kontrolle eines Gesamtsystems durch die technische Kontrolle bestimmter Teilbereiche ermöglicht werden kann – vergleichbar mit den Zugbrücken einer Ritterburg. Viele dieser digitalen Zugbrücken sind heute von US-amerikanischen und asiatischen Unternehmen durch Standardisierungsentscheidungen bereits besetzt.“ (BMWE: „Industrie 4.0 und Digitale Wirtschaft“, April 2015)
Um in der Bilderwelt des BMWE zu bleiben: Problematisch
sind nicht die Zugbrücken vor der deutschen Ritterburg, sondern die ausländischen Konkurrenten, die auf ihnen sitzen: Das kommt in der Sicht der Sachverständigen einem Verlust der politischen Hoheit über den deutschen Standort gleich. [29] Unter diesem Blickwinkel betrachtet, gelten dem Hüter des Standorts IT-Standards, technische Beherrschung von Netzwerken und die faktische Kontrolle eines Gesamtsystems
als so ziemlich dasselbe, nämlich als Einfallstore für einen potenziellen Feind, als Gefährdung seiner souveränen Verfügungsmacht über alle wirtschaftlichen, zivilen und militärischen Bereiche seiner Gesellschaft. Die Behauptung der eigenen Souveränität im digitalen Raum
ist freilich kein defensives Programm. Deutschlands IT-Kapital soll eigene „Zugbrücken“ als Mittel gegen fremde Zugriffe schaffen; anderen Souveränen die Kontrollmacht über die eigene Datenwelt wirksam zu bestreiten, fällt damit zusammen, sich selbst die Macht über die Kontrolle fremder „digitaler Räume“ zu verschaffen. Sicherung vor fremdem Zugriff ist im Reich der Daten nur dann zu haben, wenn man seinen Feinden im Cyberspace stets einen Schritt voraus ist, sich selbst also erfolgreich die erforderlichen Einsichten in deren technologische Potenzen und strategischen Machenschaften verschafft hat. Ziemlich nahtlos geht so die Standortpolitik zur Beförderung der Geschäfte der deutschen IT-Kapitale zum Auftrag über, ihrem staatlichen Förderer auch alle nötigen Mittel zur Absicherung seines nationalen Besitzstandes und Gewaltbedarfs bereitzustellen. Sie sollen den Zugriff auf eigene und fremde Daten fürs Geschäft so bemeistern, dass sie nicht nur Angriffe von „außen“ auf den digitalen Bestand der Nation durch möglichst hohe technische Hürden verhindern: Sie sollen ihrem Staat auch alles Nötige liefern, was der für die Wahrnehmung seines Gewaltmonopols in diesem neuen Zeitalter braucht, vom souveränen Zugriff auf die Daten seiner Bürger über das Ausspionieren seiner Konkurrenten bis hin zum „cyber war“.
III. Die Arbeitswelt 4.0
Kein Bericht über die neue, digitale Welt kommt aus ohne die Thematisierung ihrer Konsequenzen für die Arbeitswelt. Dabei ragt eine prognostizierte Wirkung ziemlich heraus: das massenhafte Verschwinden von Arbeitsplätzen. Obwohl man erst am Anfang des neuen Zeitalters steht, sind sich die Prognostiker ziemlich einig, dass in den kommenden Jahrzehnten ungefähr die Hälfte aller existierenden Arbeitsplätze wegfallen wird.[30] Und weil in der Marktwirtschaft das kreuzvernünftige Prinzip gilt, dass die Arbeit nicht einfach der nötige Aufwand ist, bei dem man froh ist, wenn er weniger wird, sondern die Einkommensquelle, von der der Großteil der Menschheit abhängt, gilt die Vision von „menschenleeren Fabriken“ eben nicht nur als Verheißung, sondern auch als Horrorvision
(Arbeitsministerin Nahles). Diesen Wegfall von Arbeitsplätzen und die damit einreißende Verarmung als Wirkung, als eine Art ungewolltes Nebenprodukt oder „Schattenseite“ der anrollenden Automatisierungswelle zu besprechen, ist eine bodenlose Dummheit. Das ist schon der Sinn der Sache, wenn Unternehmer die notwendige Arbeit für die Produktion und Verkauf ihrer Waren reduzieren; sie tun es genau zu dem Zweck, sich die Bezahlung der Arbeiter zu sparen und ihre betriebliche Kostenrechnung von dem Geld zu entlasten, vom dem ihre Angestellten leben. Der ganze Sinn der Sache ist das allerdings auch nicht. Denn wie bei jedem technischen Fortschritt und jeder Runde „Rationalisierung“ macht das industrielle Kapital auch bei diesem Sprung in seiner Produktionstechnik nicht nur viel Arbeit überflüssig. Es macht im selben Zug auch in neuer Form von seiner Macht über sie Gebrauch, und wenn es da beruhigend heißt, dass die neue Technik auch neue Arbeitsplätze schaffen soll, lohnt sich schon der Blick auf das, was da geschaffen wird.
1. „Modern Times“ 2016 ff
Auch wenn der Produktionsprozess künftig idealerweise vorwiegend selbsttätig, durch Software gesteuert, ablaufen soll, muss er trotzdem überwacht und in Stand gehalten werden; bei Störfällen muss auch gelegentlich sachkundig eingegriffen werden. Man kann an der Stelle also schon einmal aufatmen – denn dafür braucht es ja echt menschliche Arbeiter, die einigermaßen verstehen, was sie auf den Bildschirmen sehen, und wissen, welche Knöpfe sie im Bedarfsfall drücken müssen.[31] Und es gibt auch andere Tätigkeiten, für die Computer entweder immer noch zu ungeschickt [32] oder einfach zu teuer[33]) sind. Roboter können wiederum die besonders unangenehmen Tätigkeiten übernehmen [34] und gleichzeitig dafür sorgen, dass ihre menschlichen Kollegen ihre Arbeit im Sinne der betrieblichen Rechnung möglichst effizient verrichten. Die Maschinen dirigieren die Handgriffe am Band, bestimmen die Laufwege in der Lagerhalle und takten den Warenfluss; sie vermessen die Leistung der Arbeiter und bringen ihnen damit praktisch bei, wie viel Arbeit wirklich in eine Stunde passt; sie halten die Menschen auf Trab und liefern zugleich der Firmenleitung eine nützliche Handreichung für die Personalentscheidungen, die noch von Menschen getroffen werden müssen, solange Roboter weder Verwarnungen aussprechen noch Entlassungen tätigen können. „Revolutionär“ ist das alles nicht. Dass ein Arbeitsplatz nichts anderes ist als ein Ensemble vergegenständlichter Leistungsanforderungen für seinen ‚Besitzer‘, wird bei dieser „industriellen Revolution“ nur besonders anschaulich, und das gilt auch für ihre weiteren Errungenschaften.
Mit der enormen Flexibilisierung der Produktion, die die Technik der Industrie 4.0 ermöglicht, mit der Produktion „am Puls der Kunden“ ist natürlich vom verehrten Mitarbeiter verlangt, dass er sich als Rädchen in das System einfügt und, je nach Bedarf, mehrere Arbeitsplätze ausfüllt.[35] Dabei erhält er auch Unterstützung vom Roboter an seiner Seite, der ihm per „gezielter Assistenz“ die visuellen Informationen liefert, die er benötigt, um immer das jeweils Passende zu tun. Etwaige Überlegungen des Arbeiters bezüglich seiner Aufgaben werden damit überflüssig. Dafür wird seine Arbeit abwechslungsreich, denn er kann an fast jeden beliebigen Arbeitsplatz beordert werden; er kann auch allein mehrere verschiedene Teilprozesse gleichzeitig virtuell, durch Beobachtung verschiedener Bildschirme, beaufsichtigen. An der nahtlosen Anpassung der Beschäftigen an den wechselnden Arbeitsbedarf im Betrieb entdecken das Fraunhofer Institut und andere einen großen Vorteil für die Beschäftigten:
„Flexibilität muss in Zukunft zielgerichtet und systematisch organisiert werden – ‚Pauschal-Flexibilität‘ reicht nicht mehr aus… Auch der Personaleinsatz kann adaptiv in Echtzeit erfolgen. Und das hat auch durchaus Vorteile für die Mitarbeiter, weil weniger Leerlaufzeiten anfallen. Die Leerlaufzeiten werden dann besser nutzbar. Damit weichen die festen Arbeitszeitstrukturen auf.“ (Dieter Spath, a.a.O., S. 80)
Wenn Leerlaufzeiten entfallen, es also keine Differenz mehr gibt zwischen Anwesenheitszeit und Arbeitseinsatz des Beschäftigten, dann ist nicht nur dem Betrieb gedient, sondern auch dem Arbeiter, dessen Arbeit dadurch verdichtet wird. In die Leerlaufzeiten, die trotzdem – vom betrieblichen Produktionsplan programmiert – noch anfallen, kann er ja sein Privatleben einpassen.
Die digitale Technologie, die den Kern der gesamten Produktion und Zirkulation im neuen, revolutionären Zeitalter ausmachen soll, schafft eine ganz eigene Welt neuer Jobs. Unternehmer brauchen schließlich Fachkräfte, die die für die vollautomatische Produktion passende Software entwickeln, den für den reibungslosen Betriebsablauf erforderlichen Datenfluss gewährleisten, Software und Programme pflegen, sich Innovationen ausdenken usw. Die jederzeitige Verfügung über ausreichend kompetentes Fachpersonal lassen sie sich etwas kosten, sie machen IT-Spezialisten zu Angestellten oder kaufen deren Leistungen bei einer Softwarefirma ein.[36] Auch solche Arbeitskräfte lassen sich der betrieblichen Rechnung optimal anpassen: In zunehmendem Maße nutzen Unternehmen freiberuflich tätige IT-Fachkräfte, die de jure selbst als „Unternehmer“ in eigener Sache und auf eigene Rechnung tätig sind, und schließen mit ihnen Werk-, Dienst- oder Beraterverträge ab. So befreit sich das Unternehmen von den Kosten und Schranken eines regulären Arbeitsverhältnisses: von Arbeitszeitregulierungen jeglicher Art, von kontinuierlich zu zahlenden Gehältern, von Zahlungsverpflichtungen für Kranken-, Alters- und Arbeitslosenversicherungen – und damit von Aufwendungen, die zum Erhalt einer Arbeitskraft zwar immer notwendig sind, für die die Unternehmen bei der Indienstnahme von freien Mitarbeitern aber vertragsgemäß unzuständig sind.[37]
Mit den Mitteln des Internets lässt sich für solche Tätigkeiten sehr reell ein ganzer Welt-Arbeitsmarkt erschließen. Auf „People Clouds“ – global zugänglichen Internet-Plattformen, die als transparente „Jobbörsen“ fungieren – treten die freien Selbständigen der Welt gegeneinander an, durchaus auch gegen angestellt beschäftigte IT-Abteilungen.[38] Dort bewerben sie sich um Aufträge, indem sie sich mit ihren Angeboten in Sachen Leistung gegenseitig überbieten, in Sachen Bezahlung unterbieten. Es wird auch einiger Aufwand darauf verwandt, größere und komplexe IT-Projekte in kleine und kleinste Teilaufgaben zu zerlegen, so dass die externen Zuarbeiter nur noch einzelne „Bausteine“ produzieren. Das läuft auf eine neue Form der Industrialisierung geistiger Arbeit hinaus
, mit dem bezweckten Resultat, die einschlägigen Qualifikationen für solche Tätigkeiten zu entwerten:
„Programmierer, die auf der ganzen Welt verteilt arbeiten, könnten die Einzelaufgaben dann in kurzer Zeit erledigen. So verlieren sie nach und nach ihren Expertenstatus und werden mehr und mehr austauschbar.“ (FR, 23.4.15)
Damit wird der www.Arbeitsmarkt in noch umfassenderer Weise für die Erledigung von IT-Aufgaben erschlossen. Denn für die Beteiligung daran braucht es nicht viel mehr als einen Internetzugang, etwas informationstechnologisches Anwenderwissen und hinreichende Englischkenntnisse. So lässt sich eine weltweite „Crowd“ zusammentrommeln, die darum konkurriert, von Auftraggebern „gesourced“ zu werden. Das erlaubt es den Unternehmern, bei der Vergütung am Lohn-Niveau asiatischer, lateinamerikanischer und osteuropäischer Länder Maß zu nehmen, wenn sie mit Programmierern aus Erstweltnationen verhandeln.[39] Es gibt immer weniger Tätigkeiten, die sich nicht auf diese Weise erledigen lassen; auch ganz kleine Dienstleistungen – einen Werbespruch verfassen, eine Gebrauchsanweisung übersetzen, Recherchen und Umfragen im Netz bis hin zum professionellen Setzen von „Likes“ für ein Produkt des Unternehmens – werden als Kleinstaufträge („Minitasks“, „Sprints“ oder „Turks“) auf Internet-Plattformen wie „clickworker.com“, „mylittlejob“ u.ä. vergeben. Das gewünschte Ergebnis bekommt das Unternehmen zu jeder Tages- und Nachtzeit geliefert, und das zu Preisen, die sich auf Bruchteile der Gehälter hiesiger Fachkräfte oder „Kreativer“ belaufen. Schön, dass mit den menschlichen Robotern der Clickworker, die fast umsonst zu haben sind, wenigstens die Plattformen ihr Geschäft machen, auf denen die sich anbieten – das sind längst privatwirtschaftlich organisierte Unternehmen, deren Aufgabe darin besteht, aus einer Crowd eine ökonomisch verwertbare Produktivkraft zu machen.
(„IBM-Studie“, a.a.O., S. 55)
Von wegen also, die Technik der Industrie 4.0 würde die Arbeit überflüssig machen – ein ganzes Sammelsurium an vielen neuen Arbeitsplätzen tut sich im Zuge der Abschaffung der alten auf! Die zeugen davon, wie sehr das Kapital mit seinem technischen Fortschritt auch seine Macht steigert, die geforderte Arbeit den Kriterien seiner Rentabilitätsrechnung anzupassen.
2. Sozialstaatliche Folgenbewirtschaftung
Doch die digitalisierte Industrie stellt ihre Ansprüche nicht nur an ihre Belegschaften, sie lässt auch den Staat wissen, was sie von ihm erwartet. Die erste Hälfte der Forderung besteht in einem entschiedenen „Finger weg!“, denn die Freiheiten, die das industrielle Kapital im Umgang mit seinen vielen Dienstkräften pflegt, haben sich bislang prächtig bewährt:
„Wichtig ist, dass die Flexibilität, die die Digitalisierung durch neue Arbeitsabläufe und neue Kommunikationsinstrumente mit sich bringt, nicht durch Regulierung behindert wird.“ (Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Positionspapier zur Digitalisierung von Wirtschaft und Arbeitswelt, Mai 2015, S. 2)
Das gilt insbesondere für Leiharbeit und Werkverträge, die in der digitalen Arbeitswelt, vor allem bei den outgesourcten IT-Tätigkeiten, so richtig zum Zuge kommen. Und die Leute wollen es ja auch so! Die Konkurrenz der Anbieter auf diesem Markt ist offenbar groß, Unternehmen können sich problemlos aus einem Pool von Leuten bedienen, die unter solchen Bedingungen jede nachgefragte Internet-Auftragsarbeit übernehmen – weltweit soll es laut ZEIT-Online auf Internet-Plattformen an die 13 Millionen freie Anbieter von Internet-Dienstleistungen geben. Es gibt das Angebot, es gibt die Nachfrage – was will man mehr? Außerdem geht es auch gar nicht, auf solche Arbeiter die üblichen Schutzregelungen anzuwenden – das widerspräche der Sozialgesetzgebung und auch der Realität:
„Arbeitsschutz ist Arbeitnehmerschutz“: „Arbeitsschutzregelungen für Arbeitnehmer können nicht auf selbstständige Erwerbsformen ausgedehnt werden. Auch wenn neue Formen der Arbeitsorganisation wie ‚crowdworking‘ auftreten, bleibt es dabei, dass Selbstständige ihre Arbeitsbedingungen und Arbeitszeiten nur selbst bestimmen können. Crowdworking und crowdsourcing sind neue Formen freier Tätigkeiten und freier Mitarbeit im Internet, die sich gesetzlich nicht fassen lassen. Es handelt sich auch nicht um Beschäftigungsformen, die irgendwie regelbar wären. Gesetzlicher oder tariflicher Handlungsbedarf erscheint nicht gegeben... Überlegungen, ein Mindestentgelt für crowdworker festzusetzen, sind abwegig. Wer aus freien Stücken eine solche Aufgabe im Internet übernehmen will, sollte und kann daran weder gesetzlich noch in anderer Weise gehindert werden.“ (BDA, Positionspapier, a.a.O., S. 5 f)
Ausgesprochen rührend, wie der Arbeitgeberverband sich da für die Freiheit ins Zeug legt. In der zweiten Hälfte des Forderungskatalogs sollte der Staat durchaus Hand anlegen, damit die Anforderungen der Kunden an die Flexibilität der Produktion nicht daran scheitern müssen, dass die Firma über ihre Dienstkräfte nicht entsprechend frei verfügen kann. Der Acht-Stunden-Tag gehört endgültig auf den Misthaufen der Geschichte geworfen und durch flexiblere Arbeitszeitkonten ersetzt.
Mit solchen und anderen Forderungen trifft das deutsche Kapital beim Staat auf großes Verständnis, denn dass die Industrie 4.0 ein Erfolg für die deutsche Wirtschaft sein soll, ist offizielle Regierungslinie – geht es doch um die Sicherung des Wirtschaftsstandorts Deutschland und Europa, eine Neuverteilung der Märkte, um enorme Wachstumspotenziale und den Traum eines ‚digitalen Wirtschaftswunders‘
(Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Grünbuch „Arbeiten 4.0“, 2015, S. 6). Und dass dieser „Traum“ einen entsprechenden Umgang mit der Arbeit erfordert, gilt gleichfalls als unabdingbar, gibt aber schon auch Anlass für Bedenken:
„ … so erscheint das Normalarbeitsverhältnis heute längst nicht mehr so normal, wie es einmal war. Die Grenzen zwischen ‚typisch‘ und ‚atypisch‘ (Teilzeit unter 20 Wochenstunden, Leiharbeit, Befristung) verschwimmen zunehmend… Es ist problematisch, wenn sich atypische Beschäftigungsformen verfestigen und keine dauerhaft existenzsichernden Einkommen ermöglichen. Dann müssen gegebenenfalls steuerfinanzierte Leistungen für die notwendige Existenzsicherung sorgen…“ (Grünbuch, S. 24)
Der Sozialministerin kommt bei Arbeitsverhältnissen also die Scheidung von „typisch“ und „atypisch“ abhanden – nachdem ihre Partei mit Leiharbeit, Werkverträgen, Minijobs usw. alles dafür getan hat, dass bei Normalarbeitsverhältnissen nichts mehr normal ist. Für „problematisch“ befindet sie das Ergebnis, dass die Unternehmen von den ihnen eröffneten rechtlichen Freiheiten so regen Gebrauch machen, unter dem Gesichtspunkt der Kosten, die dem Staat daraus erwachsen könnten, dass er seinem arbeitsamen Volk ja so etwas wie ein Existenzminimum garantiert: Mit der Zunahme von Arbeitsverhältnissen im Zuge von Industrie 4.0, von denen feststeht, dass die gezahlten Löhne nicht einmal zur bloßen Existenzsicherung reichen, könnten dem Staat und seinen Sozialkassen Belastungen ins Haus stehen – die und sonst nichts sind die Herausforderung
, der sich eine deutsche Sozialministerin entschlossen stellt:
„Die wesentliche Herausforderung wird darin bestehen zu prüfen, ob mit einem Wandel der Erwerbsformen neue Sicherungsdefizite auftreten. Kernanalyse wird sein, ob neue Tätigkeitsformen als ‚Beschäftigung‘ zu bewerten sind, der Grundbegriff, an den die Versicherungspflicht in der Sozialversicherung im Wesentlichen anknüpft. Darüber hinaus wird es auch darauf ankommen zu prüfen, ob eine Ausweitung des Schutzbereichs notwendig wird. Auf jeden Fall aber muss bei einer zukünftigen Wertschöpfung in der digitalen Welt auch die wirksame Implementation der Versicherungspflichten sowie die nachhaltige Finanzierung mit bedacht werden.“ (Grünbuch, S. 80)
Auch beim Sozialstaat ist also absolut nichts Revolutionäres in Sicht im Zuge dieser „industriellen Revolution“. Der zur Lohnarbeit gehörende Pauperismus war auch schon vor der „Wertschöpfung in der digitalen Welt“ eine öffentliche Angelegenheit und bleibt es auch in der digitalen Zukunft: Der Staat verspricht, sein Anwachsen mit wachsender Aufmerksamkeit zu begleiten und stets zu „prüfen“, was ihm alles an Fürsorgepflicht aus dem Umstand erwächst, dass der Dienst am Eigentum für zusehends mehr tätige Mitglieder der lohnabhängigen Klasse zu einem Schicksal wird, das vor diesem „Wandel der Erwerbsformen“ denen ohne jeden Erwerb vorbehalten war.
3. Gewerkschaftlicher Epilog zu Fluch & Segen des technischen Fortschritts
Die deutschen Gewerkschaften möchten unbedingt, dass die neue industrielle Revolution nicht nur für die Unternehmer gelingt, deren Erfolg genau dadurch gesichert wird, dass sie mit ihren Arbeitskräften in neuer Weise umspringen, sondern auch für die Arbeiter. Der gute Wille ist also da – nur erfordert diese Vision vom Vorteil für beide Seiten einen etwas schiefen Blick auf die Sache: „Industrie 4.0“ wäre eine Sache, von der „wir alle“ betroffen sind und die hie Chancen, da Risiken birgt. Die Gewerkschaften nehmen den neuen industriellen Fortschritt nicht als das Rationalisierungsmittel der Unternehmer, das er ist, sondern als eine Ansammlung von offenen Fragen, die ein anonymer Geist namens „Digitalisierung“ aufwirft und bei denen es darauf ankommt, dass „die Gesellschaft“ darauf die richtigen Antworten findet:
„Es geht um neue Chancen durch die Digitalisierung – genauso aber auch um Risiken. Die Digitalisierung kann zu neuem Wachstum und höherwertigen Arbeitsplätzen führen. Digitale Technik kann – auch wenn es widersprüchlich klingen mag – die Arbeitswelt humaner machen: Technische Assistenzsysteme können zum Beispiel bei schweren körperlichen Arbeiten für Entlastungen sorgen. Die Digitalisierung kann genauso zu Arbeitsplatzabbau, De-Qualifizierung und höheren, vor allem psychischen Belastungen führen.“ (DGB-Vorsitzender Reiner Hoffmann, DGB-Digitalisierungskongress, Berlin, 3.11.15)
Immerhin nimmt man beim DGB auch noch bei solchen Eiertänzen das gegensätzliche Interesse zur Kenntnis, das das Kapital mit der neuen Technik verfolgt, spätestens dann, wenn dieses Interesse den Vertretern der Arbeiter in einschlägigen Verhandlungen in Gestalt lebendiger Vertreter der „Arbeitgeberseite“ gegenüber sitzt. Da schließen sie praktisch Bekanntschaft mit Forderungen, die allesamt auf Verschlechterung der Arbeitsverhältnisse ihrer Mitglieder hinauslaufen, so dass für sie einiges offensichtlich
ist: Dass die Digitalisierung als Vorwand genutzt werden soll, um die betriebsexterne Flexibilität der Arbeitgeber zum zentralen Standortfaktor zu erklären
, zum Beispiel, und ebenso offensichtlich
geht es der BDA darum, dass die Regelungskompetenz grundsätzlich von der tariflichen auf die betriebliche Ebene gehoben wird.
(DGB-Kommentar zum BDA-Positionspapier, Juni 2015) Dieses Interesse legen die Gewerkschaften aber in seltsamer Weise auseinander. Sie entnehmen ihm sowohl eine unverantwortliche neoliberale Färbung
, die auf marktradikale Hardliner
zurückgeht – also mehr Ideologie als ein echtes Interesse ist, als auch eine komplette Einfallslosigkeit, was die Bewältigung der gemeinsamen Aufgaben angeht:
„Das BDA-Positionspapier ist ein Neinsager-Papier mit neoliberaler Färbung… Eigene Gestaltungsambitionen der BDA sind nicht erkennbar – sie will alles dem Markt überlassen.“ (Ebd.)
Die Gestaltungsambitionen der Gewerkschaft sind dagegen sehr gut erkennbar:
„Sicher ist, dass wir dafür eine Offensive für mehr Qualifizierung brauchen. Es geht um den Ausbau moderner Kompetenzen – IT-Verständnis, vernetztes Denken und Arbeiten, Kommunikation und neue Kollaborationsformen – und zwar lebensbegleitend… Wir brauchen eine solche Qualifizierungsoffensive auf allen Ebenen – auch und nicht zuletzt für Arbeitslose und für diejenigen, denen Arbeitslosigkeit droht. Nur so können wir eine weitere Polarisierung am Arbeitsmarkt – und damit der Gesellschaft – vermeiden. Und so schaffen wir ein Upgrade der Arbeit.“ (DGB-Vorsitzender Reiner Hoffmann, DGB-Digitalisierungskongress, 3.11.15)
Was die Gewerkschaft gestalten will, ist die fortlaufende Anpassung der Belegschaften an den wechselnden Bedarf des Kapitals. Wenn in der veränderten digitalen Arbeitswelt andere und neue Kenntnisse verlangt werden, dann drückt sie darauf, dass die nötigen Maßnahmen auch wirklich ergriffen werden, mahnt bei der Arbeitgeberseite an, von Anfang an
den Blick auf Fragen der Arbeitsorganisation und Qualifikation
zu lenken und bloß nicht zu verpassen, diese Potentiale, Fertigkeiten und Lern-Fähigkeiten zu nutzen und zu erweitern.
Und sie gibt den Unternehmern schließlich zu bedenken, dass ein Gelingen der Digitalisierung ohne gewerkschaftliche Beteiligung nicht zu haben ist:
„Für die Digitalisierung gilt grundsätzlich: Innovation funktioniert nur mit dem Wissen und Engagement der Beschäftigten und nicht gegen sie.“ (DGB-Pressemitteilung, 3.11.15)
Nur mit den Beschäftigten und nicht gegen sie „funktioniert“ all das, was mit der unter dem Titel „Innovation“ abgenickten Rationalisierungsoffensive namens Digitalisierung auf dem Programm steht, denn:
„Nur wer auf Mitbestimmung und Partizipation vertraut, kann sich sicher sein, dass erforderliche Veränderungen von den Betroffenen akzeptiert und auf Dauer getragen werden.“ (Detlef Wetzel, ehemaliger Vorsitzender der IG-Metall: „Arbeit 4.0, Was Beschäftige und Unternehmen verändern müssen“, 2/2016, S. 12)
In der Tat: Wenn „Veränderungen“ nicht nur „erforderlich“ sind, sondern seitens der von ihnen Betroffenen auch noch „akzeptiert“ wird, dass sie einfach sein müssen, kann nichts mehr schief gehen beim technischen Fortschritt.
[1] Mit Industrie 4.0 ist die – nach der Dampfmaschine, der Massenfertigung am Fließband und der Automatisierung der Produktion – vierte industrielle Revolution gemeint, die derzeit stattfindet. Im Mittelpunkt steht die Digitalisierung und die Vernetzung der industriellen Fertigung. Beides bewirkt, dass Maschinen entlang der Wertschöpfungskette miteinander kommunizieren und die Produktion teilweise selbständig organisieren, was die Effizienz beträchtlich steigert.
(WISU-Magazin 4/15)
[2] Die Digitalisierung, das sind nicht ein paar Computer hier, ein paar Smartphones, Netze und Sensoren dort. Das ist ein Paradigmenwechsel. In vielen Bereichen kann man ihn schon spüren, und die Tendenz ist klar: Dieser Paradigmenwechsel wird weitergehen und er wird sich beschleunigen.
(SZ, 26.4.16)
[3] Die Fabrik der Industrie 4.0. sieht folgendermaßen aus: Intelligente Maschinen koordinieren selbständig Fertigungsprozesse, Service-Roboter kooperieren in der Montage auf intelligente Weise mit Menschen, intelligente (fahrerlose) Transportfahrzeuge erledigen eigenständig Logistikaufträge
(Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE): „Industrie 4.0: Digitalisierung der Wirtschaft“, www.bmwi.de)
[4] Welches Waschmittel gehört in die Flasche? Wie muss der Rohling geschliffen werden? Wohin muss das Ersatzteil gesandt werden? Im Zeitalter der Industrie 4.0 geben die Produkte selbst die Antwort und informieren die Maschinen, was mit ihnen passieren soll. Kurz: Die Objekte werden intelligent. Sie tragen Barcodes oder RFID-Chips auf der Oberfläche, die die entsprechenden Informationen enthalten. Scanner und Computer lesen die Daten aus, übermitteln sie online weiter – und sorgen dafür, dass die Maschinen richtig agieren.
(BMWE: „Plattform Industrie 4.0“, www.plattform-i40.de). Interessant, was der bürgerliche Verstand unter „Intelligenz“ versteht...
[5] Eine Fabrik der Augsburger Firma Kuka in Toledo im US-Bundesstaat Ohio... Das Werk ist ein Beispiel für die sogenannte Industrie 4.0… Mehr als 60 000 elektronische Bauteile wie Rechner, Server, Sensoren und Klemmen sind vernetzt. 246 Roboter, 372 Arbeiter. ‚Früher haben wir etwa vier Stunden gebraucht, um eine Karosserie zu bauen, heute ungefähr 90 Minuten.‘
(SZ, 22.4.16)
[6] Diese und andere Konsequenzen der Industrie 4.0 für die Arbeitswelt werden im Teil III behandelt.
[7] Wenn die Aufträge des Kunden künftig direkt in die Produktionssteuerung einfließen, dort simuliert und in den Ablauf eingespeist werden, erübrigen sich viele Arbeitsplätze heutiger Disponenten. Unternehmen stellen aber auch zunehmend fest, dass die bisher hierarchisch strukturierte Organisation den neuen Anforderungen an Flexibilität und Geschwindigkeit nicht mehr gewachsen ist.
(FAZ, 25.4.16) Klar ist: Die automobile Produktion muss sich verändern – und das fordert durchaus prominente Opfer. ‚Wir haben die Werkleiterebene komplett eliminiert‘, sagt Markus Schäfer, Bereichsvorstand Mercedes-Benz.
(Wirtschaftswoche, 18.4.16)
[8] Waren Maschinen früher auf ausgewählte Arbeitsschritte festgelegt, ist künftig dank IT eine schnelle Reaktion auf sich ändernde Anforderungen möglich. Egal, ob ein Produkt blau oder rot lackiert werden soll – die Maschine kann beides und entscheidet selbst, was zu tun ist. Umständliches Umprogrammieren ist nicht nötig. Auf diese Weise lässt sich rasch auf individuelle kundenspezifische Wünsche reagieren. Selbst die Produktion von Einzelstücken und Kleinstmengen kann rentabel werden… Die resiliente Fabrik: In Zeiten der Industrie 4.0 muss eine Produktionslinie nicht auf ein Produkt festgelegt sein. Durch IT-Unterstützung wird es möglich, die Bearbeitungsstationen flexibel an einen sich verändernden Produktmix anzupassen – und Kapazitäten optimal auszulasten.
(Dieter Spath, Produktionsarbeit der Zukunft – Industrie 4.0, Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, 2013)
[9] Jede Ampel, jedes Smartphone, jeder Regensensor einer Autoscheibe kann nützliche Informationen liefern, lautet die Devise… Das permanent mit dem Internet verbundene Auto sei im Zusammenspiel mit dem Menschen und seiner Umwelt eine gigantische Daten-Generierungsmaschine. ‚5 000 vernetzte Autos könnten mehr Umsatz generieren als 50 000 nicht vernetzte. Es wird nicht mehr das Produkt Auto allein sein, sondern die intelligent vernetzte Dienstleistung, die dies ermöglichen wird‘, sagt Pawelke (Digitalexperte bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG).
(FAZ, 8.12.15)
[10] Der Trinkwasserlieferant einer australischen Metropolregion hat eine Predictive-Maintenance-Lösung für sein Kanalisationssystem aufgebaut, mit der er verlässliche Voraussagen zu Rohrbrüchen und Ausfällen machen kann. Zu diesem Zweck werden mehrere Datenquellen, die bisher nicht miteinander in Verbindung gebracht werden konnten, auf einer Smart-Data-Plattform vernetzt und visualisiert: Das sind neue Sensoren an Anlagen und Leitungen, Wetter- und Niederschlagsvorhersagen sowie geographische Daten – insbesondere Baumstandorte wegen des Laubabwurfs. Auch anonymisierte Social-Media-Daten werden als Frühindikator für Verstopfung einbezogen, denn Leute neigen dazu, die Geruchsentwicklung in der Straße via Facebook oder Twitter zu kommentieren.
(FAZ, 17.11.15)
[11] Industrie 4.0 – also die Digitalisierung und Vernetzung der gesamten Produktion im Unternehmen und über das eigene Unternehmen hinaus – verändert vor allem Geschäftsmodelle. Und mit der Veränderung der Geschäftsmodelle werden auch teilweise jahrzehntealte Branchengrenzen obsolet… Autohersteller lassen sich inzwischen in Kaufverträgen zusichern, dass alle Daten, die das Fahrzeug liefert, ausschließlich dem Hersteller gehören und von ihm genutzt werden dürfen – auch um Haftpflichtversicherungen oder andere Dienstleistungen anzubieten, die bisher von Dritten (Versicherungsunternehmen) kamen.
(FAZ, 30.5.15)
[12] Normen als weltweite Sprache der Technik erleichtern den freien Warenverkehr und fördern den Export: Europäische Normen öffnen den Binnenmarkt, globale Normen den Weltmarkt. Normen können Katalysator für Innovationen sein, um technische Lösungen am Markt zu verankern. Denn Normen definieren Schnittstellen und Kompatibilitätsanforderungen. Wer Normen missachtet, kann schnell im Wettbewerb zurückfallen. Wie die Anwendung von Normen, so bringt auch die Beteiligung an ihrer Erarbeitung Vorteile. Normung ist ein strategisches Instrument für das Management und nicht nur ein Thema für Spezialisten. Normung muss Chefsache sein… Wer die Norm macht, hat den Markt.
(DIN, DIHK, ZDH, „Kleines 1x1 der Normung – ein praxisorientierter Leitfaden für KMU“, 4/2011)
[13] Dafür müssen wir den nackten Kapitalismus kurzzeitig außer Kraft setzen. In diesem historischen Fenster müssen wir kooperieren und einen digitalen Standardisierungsprozess einleiten. Danach können wir durch Operational Excellence wieder miteinander konkurrieren.
(Dr. Alexander Markowetz, Juniorprofessor für Informatik an der Uni Bonn, im Interview mit md-automation.de)
[14] Deshalb sehen sich im Übrigen nicht nur Unternehmen und deren Verbände, sondern auch Ministerien und staatliche Institute mit ihrem jeweiligen nationalen Standpunkt zur „Kooperation“ aufgerufen. Mehr dazu im Teil II.
[15] In den neuen Wertschöpfungsnetzwerken werden Informationen und die Vernetzung zu einem zentralen Gut. Durch das Teilen oder Bereitstellen von Informationen werden neue Möglichkeiten geschaffen. Gleichzeitig ergibt sich natürlich (!) die Frage nach dem Eigentum an diesen Informationen und den Rollen und rechtssicheren Verantwortlichkeiten der beteiligten Parteien. Der Mehrwert durch die Auswertung von Informationen, die bei Partnern und Lieferanten erfolgt, ist abzuwägen gegen den möglichen Abfluss von Know-how.
(Umsetzungsstrategie Industrie 4.0, Ergebnisbericht der Plattform Industrie 4.0, April 2015)
[16] In deutschen Modell-Clustern sieht das so aus: Dass niemand heimlich abkupfert oder keine Daten geklaut werden, wurde am Anfang geregelt. 40 Juristen haben geklärt, wer was sehen darf, wie in den Projekten berichtet wird – und wer welcher Schweigepflicht unterliegt.
(FAZ, 1.7.15)
[17] Die Angst der Firmen vor der vernetzten Fabrik: Vor allem der Mittelstand in Deutschland zögert beim großen Zukunftsthema Industrie 4.0. Die Unternehmen fürchten um die Sicherheit ihrer Daten – und damit ihre Wettbewerbsvorteile.
(Die Welt, 14.4.15) Es ist jetzt ca. 30 Jahre her, dass die Idee des supply-chain-managements entstanden ist. Die großartige Idee war, dass alles mit allem vernetzt wird und jeder in der gesamten Versorgungskette sofort weiß, wo was wann wie steht und wann produziert wird. Und was ist davon übrig geblieben? Fast nichts! (…) Warum hat die Idee nicht funktioniert? Weil keiner damals und auch heute seine Daten und Informationen freiwillig preisgeben will. Der Grund für diese Weigerung ist die Preis- und Produktdatentransparenz.
(FAZ, 9.4.15)
Damit das nicht so bleibt, bemühen sich Institute wie das staatliche Fraunhofer-Institut bevorzugt um die Entwicklung von Systemen zu Datensicherheit und Datenschutz (vgl. FAZ, 24.9.15) – 40 % der über die „Plattform Industrie 4.0“ verteilten Forschungsgelder sollen sich um „Datensicherheit“ drehen –; und Konzerne wie Allianz, Bayer, BASF und Volkswagen gründen ein gemeinsames „Zentrum für Computer- und Internetsicherheit“ und erklären zur Begründung: Sichere Cyber-Systeme sind eine grundlegende Voraussetzung für unternehmerischen Erfolg.
(FAZ, 19.9.15 Industrie macht IT-Sicherheit zum Topthema
)
[18] Auch die zunehmende Übernahme von betrieblichen Tätigkeiten durch Automaten schafft einerseits absurd anmutende, in der Welt des Eigentums aber sachgerechte Fragen, ob z.B. automatisierte Bestellungen durch eine Maschine eher einer natürlichen oder (eher) juristischen Person zuzurechnen sind. Teilweise wird diskutiert, hierauf das Stellvertreterrecht anzuwenden
(Beiten Burkhardt, Wirtschafts-/ Rechtsanwaltskanzlei, Industrie 4.0 – Ein Überblick über rechtsgebietsübergreifende Herausforderungen
, Mai 2015). Aber auch hier gibt es von höchster Stelle Entwarnung. Bundesjustizminister Heiko Maas sieht die Rechtsordnung zwar unter Druck durch die Entwicklung hin zur ‚Industrie 4.0‘. Sie müsse aber nicht auf den Kopf gestellt werden: ‚Ein Kaufvertrag bleibt ein Kaufvertrag.‘
(FAZ, 17.2.16) Juristische Gelehrte sekundieren mit absolut überzeugenden Überlegungen: Der Juraprofessor Dirk Heckmann von der Universität Passau verwarf utopische Ideen, etwa eine neue Rechtsfigur der ‚E-Person‘ – wie einst jene der juristischen Person – einzuführen. ‚Das würde uns nicht wirklich weiterhelfen‘, gab Heckmann zu bedenken: ‚Was nützt es mir, wenn ich den Roboter verklagen kann, er aber kein Vermögen hat, in das ich vollstrecken könnte.‘
(FAZ, 17.2.16)
[19] Noch ist ungeklärt, wem die Daten zufallen, die während der Fertigung in einer Smart Factory entstehen. Dem Nutzer? Dem Hersteller? Dem IT-Dienstleister? Jeder dieser Ansprüche lässt sich begründen, jede dieser Möglichkeiten hat weitreichende Folgen für die Ablaufsteuerung im Herstellungsprozess, für Logistikkoordination und Wartungszyklen sowie für Optimierungen auf dem Shopfloor.
(Die digitale Transformation der Industrie
– Eine europäische Studie von Roland Berger Strategy Consultants im Auftrag des BDI, Februar 2015)
[20] Bebildert wird das u.a. mit dem sogenannten Lock-in-Effekt
sowie mit den hohen Migrationskosten
, die für einen Wechsel zu einem anderen Anbieter anfallen würden – und zwar sehr mitfühlend, nämlich mit einer ordentlichen Dosis patriotischer Parteilichkeit für die armen, ausgebeuteten deutschen Industriekapitalisten: Schauen Sie sich den aktuellen B2B(Business-to-Business)-Markt an: Man kauft heute eine beliebige Software, die im Hintergrund läuft. Das funktioniert immer über einen Lock-in. Tatsächlich heißt das, die Firma XY verkauft Ihnen eine Software. Aus dieser wieder herauszukommen ist aufgrund extrem hoher Migrationskosten extrem schwierig. Die Firma XY hat also ein De-facto-Monopol und erhöht dann munter jedes Jahr den Preis. Das ist dann kein effizienter Markt, man kann nicht mehr weiter wechseln, daher die unglaublich hohe Prämie. Die meisten Firmen in diesem Umfeld kommen aus den USA. Man kann das als eine Form des digitalen Kolonialismus bezeichnen: der deutscher Mittelstand darf weiter arbeiten wie bisher, nur die Erlöse führen wir in Form von Softwarelizenzen in die USA ab.
(Markowetz, a.a.O)
[21] So beschäftigt beispielsweise VW weltweit rund 10 000 IT-Spezialisten, deren Aufgabenspektrum ständig größer wird. Im vergangenen Jahr setzte sich CIO Martin Hofmann öffentlich dafür ein, die interne IT-Kompetenz zu steigern und weniger Aufgaben nach außen zu vergeben. Es müssten konzerninterne Innovationsinseln entstehen, von ‚IT-Labors‘ war die Rede. IT werde Teil des Produkts, die ‚Apps auf Rädern‘ seien eine technische Herausforderung, für die das Unternehmen Know-how vorhalten müsse.
(Horst Ellermann: „Die Rolle der IT in der Volkswagen-Strategie“, in: CIO, www.cio.de, 13.4.15)
[22] Dürr investiert in Digitalisierung: Anlagenbauer übernimmt Softwarespezialisten
(Überschrift in FAZ, 5.12.15)
[23] Apple kooperiert nach IBM auch mit dem deutschen Software-Konzern SAP, um stärker ins Geschäft mit Unternehmen zu kommen.
Google fährt mit Fiat-Chrysler: Konzerne schließen Kooperation für selbstfahrende Autos.
(FAZ, 6.5.16)
Gemeinsam mit Siemens bietet man [SAP] den industriellen Kunden an, die mit Siemenssteuerungen versehenen Maschinen weltweit und in Echtzeit zu überwachen. SAP bringt die Echtzeitverarbeitung ein sowie die Verbindung zur kaufmännischen Verwaltungssoftware, Siemens die Maschinen, beziehungsweise Produktionssteuerung. Künftig werden beide Systeme miteinander verbunden. Damit können Daten aus der Fertigung gesammelt, gespeichert und analysiert werden. Aus den Ergebnissen ziehen Computer in riesigen Rechenzentren Schlussfolgerungen für die weitere Produktion, für das automatische Entgegennehmen von Aufträgen, für die Verteilung der Arbeit auf einzelne Maschinen und für die Wartung der Anlage.
(FAZ, 2.3.16)
[24] Solange es 28 fragmentierte, nationale Datenschutzgesetze in Europa gibt, sucht sich der Dritte, sucht sich Apple, sucht sich Google, sucht sich Facebook den Standort aus, an dem das Datenschutzrecht am schwächsten ausgeprägt ist oder die Kontrolle nicht stattfindet ... und nimmt den Staubsauger und saugt von dort die Daten Europas ab, sammelt sie, nimmt sie mit in die USA, speichert sie, mixt sie und verkauft sie neu.
(Vortrag Günther Oettinger zur Sonderreihe „BMF im Dialog“: Wachstumstreiber Digitalisierung, BMF, 6.3.15)
[25] Entsprechend wirkt Deutschland in Europa darauf hin, Änderungen und Vereinheitlichungen z.B. des Wettbewerbs-, Telekommunikationsrechts, im Urheber- und Verbraucherschutz etc. durchzusetzen, um günstige Bedingungen für die Geschäfte mit Clouds, Plattformen, Netzwerken etc. durch die Aufhebung nationaler Schranken zu schaffen.
[26] Technik zur Realisierung von 50 Mbit/s auf Basis der in Deutschland flächendeckend verlegten Kupferkabel.
[27] Wir sollten aufhören, die Mittel aus dem Juncker-Fonds für Kleinkram auszugeben. Wir brauchen ein ehrgeiziges Großprojekt zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit Europas.
(Gabriel im Handelsblatt, 24.4.16)
[28] ‚Es geht hier und jetzt darum, den Rahmen abzustecken‘, sagt Siemens Vorstand Russwurm... Als international agierendes Unternehmen helfen Siemens beispielsweise keine deutschen Standards, auch keine europäischen, sondern globale Normen und Regeln. Deshalb müssen wir an einem Tisch sitzen und unsere Ziele gemeinsam voranbringen.‘ Angesichts neuer Technik und neuer Standards suchen die Industrien über alle Grenzen hinweg den Schulterschluss. Das in Amerika gegründete Industrial Internet Consortium (IIC) und die deutsche Plattform Industrie 4.0 loten derzeit eine weitreichende Zusammenarbeit aus. Damit gehen nicht nur zwei der größten Industrienationen aufeinander zu, damit wird auch die Basis für die Zukunft des verarbeitenden Gewerbes in aller Welt gelegt.
(FAZ, 14.3.16)
[29] Gabriel erhebt den Umgang mit personenbezogenen Daten europäischer Bürger in den USA in seiner Rede auf dem 9. IT-Gipfel 2015 explizit zur Frage der „digitalen Souveränität“. Die EU hat inzwischen das Geschäft mit personenbezogenen Daten (dominiert von Google, Amazon oder Facebook) europäischer Bürger sowie den staatlichen Zugriff auf solche Daten beschränkt und sich selbst innerhalb der USA das Recht auf Überprüfung und Einspruch einräumen lassen.
[30] Die sich zunehmend beschleunigende Technologisierung bedroht mittel- und langfristig mehr als die Hälfte aller Arbeitsplätze in Deutschland.
(Die Welt, 24.9.15) Die Wahrscheinlichkeit, dass etwa Büroangestellte bald durch Computer ersetzt werden, beläuft sich laut einer Studie auf über 90 Prozent. Taxifahrer, Kassierer und Buchhalter wird es in 20 Jahren als Beruf nicht mehr geben… Anders als bisher werden auch gut Qualifizierte betroffen sein.
(NZZ am Sonntag, 3.1.16)
[31] In einigen Branchen, ich denke da z.B. an die chemische, die Papier-, die Druck- oder auch die Nahrungsmittelindustrie, ist diese Entwicklung bereits weit fortgeschritten. Produktionsprozesse werden hier über informationstechnische Hilfsmittel virtuell abgebildet und aus Leitständen heraus gesteuert und überwacht, teilweise auch fernüberwacht. Zunächst sind hier deutlich weniger Fachkräfte notwendig. Arbeitsaufgaben konzentrieren sich z.B. auf die Sicherung des Produktionsanlaufs, das Testen, Überwachen, Instandhalten von Anlagen und Produktionsprozessen, das Verhindern, Erkennen und schnelle Beheben von Störungen, auf die Produktionssicherung – und Sicherheit hat dabei eine sehr umfassende Bedeutung – , auf Logistik und Ablauforganisation.
(Interview mit dem BIBB-Forscher Dr. Gerd Zinke im WAP, dem Berufsbildungsportal der IG Metall, 25.1.16)
[32] Beispielsweise erfordert das Polieren von Oberflächen sensorische Fähigkeiten, die keine Maschine erfüllt. Bis heute kann nur der Mensch Glanz und Reflexion von Oberflächen sicher beurteilen.
(Deutsche Bank Research, 4.2.14, S. 8)
[33] Die Beschäftigung von Geringqualifizierten habe zuletzt in vielen Ländern sogar leicht zugenommen. Häufig lohne es sich nicht, die oft als ‚McJobs‘ geschmähten Arbeitsplätze durch teure Maschinen zu ersetzen.
(FAZ, 6.8.15)
[34] Kuka, Hersteller von Assistenzrobotern, berichtet auf seiner Homepage: Damit kann der sensitive Roboter beispielsweise als flexibler Produktionsassistent in der Fertigung eingesetzt werden und Mitarbeiter entlasten, indem er bisher nicht automatisierbare, ergonomisch ungünstige manuelle Arbeitsschritte übernimmt. Beispielsweise durch die Übernahme von Über-Kopf-Arbeiten oder schweren Lasten können Mitarbeiter stark entlastet werden. Reproduzierbare Prozesse werden so qualitativ hochwertig ausgeführt.
[35] Es gibt auch keine Wochenplanungen mehr. Künftig können Aufträge auch schnell dazwischengeschoben werden. Das System plant optimal ein und erstellt eine neue Ablaufplanung für die kommenden Stunden.
(Johann Soder, Geschäftsführer des Elektromotorenherstellers SEW, in der FAZ, 16.11.15)
[36] Die Digitalisierung der deutschen Wirtschaft schreitet mit hohem Tempo voran. Dadurch steigt der Bedarf der Wirtschaft nach Spezialisten für Informationstechnologie (IT) dermaßen schnell, dass laut Branchenverband Bitkom mehr als 40 000 offene Stellen nicht besetzt werden können. Und wie das Statistische Bundesamt berichtet, klagt fast jedes zweite einstellungswillige Unternehmen in Deutschland über Probleme bei der Stellenbesetzung. Für die Computerfachleute sind das gute Nachrichten. Denn die hohe Nachfrage treibt die Gehälter sprunghaft in die Höhe.
(FAZ Gehaltsatlas – Was IT-Spezialisten verdienen. Beruf und Chance, 12.12.15)
[37] Tim Ringo, IBM Personalvorstand, bringt in einem Interview mit der Zeitschrift Personnel Today, 4-2010, bei der Präsentation seines Plans, 300 000 der weltweit 400 000 IBM-Mitarbeiter durch Freelancer zu ersetzen, den Zweck der Sache entwaffnend schlicht auf den Punkt: There would be no building costs, no pensions and no healthcare costs, making huge savings
. Was sonst!
[38] Um diese Konkurrenz zu optimieren, haben Unternehmen wie IBM eigene Plattformen eingerichtet, auf denen auch angestellte eigene Mitarbeiter, die über freie Zeitkonten verfügen, mit Freelancern um Aufträge konkurrieren können. Die Freelancer können sowohl ‚additiv‘ als auch ‚substitutiv‘ zu der Stammbelegschaft in Stellung gebracht werden. Durch die strukturelle Gleichstellung beider Arbeitskraftformen im Informationsraum werden zwei vollkommen unterschiedliche Rechtssysteme zueinander in Konkurrenz gebracht. Es liegt auf der Hand, dass die Personen in der PeopleCloud aus der Sicht der fest Beschäftigten eine permanente aktive Bedrohung darstellen.
(Cloudworking und die Zukunft der Arbeit („IBM-Studie“), Andreas Boes u.a., August 2014, S. 51)
[39] Egal, von welchem Ort der Welt solche Freiberufler dem auftraggebenden Unternehmen zuarbeiten – die Kontrolle ihres Arbeitseinsatzes bezüglich der Effektivität ihrer Leistung, ihrer Zuverlässigkeit und ihres Arbeitstempos ist auf Grundlage der Vernetzung aller Datenströme kein Problem; bzw. ein preisgünstig zu lösendes. Denn dafür stehen Firmen parat, wie die SAP-Tochter Success Factor, die die web-basierte Leistungskontrolle als Softwarelösung für das Human Capital Management
in der digitalisierten Fabrik anbieten. Deren Verkaufsschlager ist es, mit ihrer Software die Leistungsunterschiede verschiedener Projektgruppen innerhalb eines Unternehmens rund um die Uhr digital zu analysieren und auch die Datenwolke
, die über die Arbeitseffektivität von Externen Auskunft gibt, in den Vergleich einbeziehen zu können.