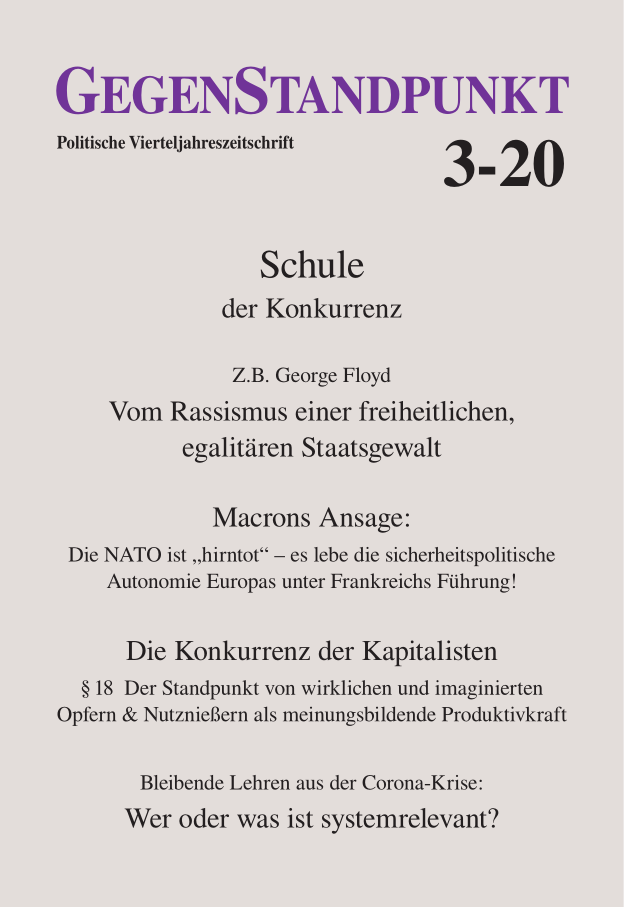Z.B. George Floyd
Vom Rassismus einer freiheitlichen, egalitären Staatsgewalt
Die etablierte rassistische Sittlichkeit, die in polizeiliche und private Brutalität ausartet, hat ihren Ausgangspunkt und ihren Antrieb weder in einer biologischen Rassentheorie noch im moralischen Unvermögen, den Wert schwarzen Lebens zu erkennen, sondern in der politischen Moral, die Trump auf so ehrlich ergriffene Art zelebriert: in der Liebe zur amerikanischen Ordnung, zu der freien und gleichen Konkurrenzgesellschaft, die sie ordnet, und zum Volk, das diese Ordnung als seinen ‚way of life‘ lebt und liebt.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Siehe auch
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Z.B. George Floyd
Vom Rassismus einer freiheitlichen, egalitären Staatsgewalt
Man kann es offenbar nicht oft genug enthüllen. Es hilft auch nichts, dass der Mann beinahe eine ganze Amtszeit hinter sich hat. Unter gestandenen Journalisten gilt es immer noch als abschließender Befund, dass Donald Trump vor allem das ist: ein Mann ohne Anstand. Dreieinhalb Jahre America first!
, die Durchsetzung beeindruckender Visionen und Revisionen der amerikanischen Weltpolitik, des ‚Homeland‘ und des mächtigsten Amts der Welt – alles, was er dabei und daneben treibt, wird in ein defektes moralisches Sensorium aufgelöst. Zumindest den Anschein einer politischen Kritik verpasst die seriöse Presse ihrer vernichtenden Stilkritik freilich auch: Sie verlängert sie in das Urteil, Trump gehe das moralische Rüstzeug ab, die Nation zu einen, wo sie das so dringend nötig hätte. Mit martialischer Rhetorik und rassistischen Anspielungen heize er die Spaltung an, die sich auf den Straßen Amerikas abspielt, statt sie zu überbrücken. Klar, wovon sollen Antirassismus-Proteste und die Empörung ihrer Gegner auch sonst zeugen, wenn nicht vom dringenden Bedürfnis beider Seiten, das Streiten zu lassen und die Einheit zu genießen?
Aufschlussreich ist die Anklage schon. Zwar nicht über die ausgemachte Spaltung im Volk selbst, an der ja nur interessiert, dass es sie – schon wieder – gibt. Aber genau darum gibt sie sehr viel Aufschluss über das Vermögen demokratischer Journalisten, abstrakt zu denken. Sie schaffen es Jahr für Jahr, in jedem Streit von nationaler Bedeutung unter den freiesten, selbstverantwortlichsten Bürgern der Erde immer denselben Wunsch nach einer Führung zu entdecken, hinter der sie geschlossen stehen können. Sonderlich schwierig ist die Abstraktionsleistung also doch wieder nicht, man muss nur die Abstraktion nachvollziehen, die demokratische Politiker ohnehin dauernd vorgeben, in einem Wahljahr schon gleich. Und schon stehen auch die aktuellen Proteste, bei denen das eine oder andere alte Reiterstandbild zu Bruch gegangen ist, für nichts als die Sehnsucht nach einer neuen reiterstandbildwürdigen Führungspersönlichkeit; nach einer, die den Bürgern ein so glänzendes Bild von ihrem Gemeinwesen zeichnet und selbst verkörpert, dass jedes Gezänk davor verblasst. Das haben Faschisten und Monarchisten also nicht für sich gepachtet: die Be- und Verurteilung von Machthabern am ungemütlichen Ideal der gelungenen Einheit zwischen Führern und Geführten.
Verkehrt ist die Anklage außerdem. Es ist schlicht nicht wahr, dass Trumps Reaktion auf die jüngste, bislang größte Auflage amerikanischer Antirassismus-Proteste von einem moralischen Defizit zeugen würde, gar von einem, das ihn für sein Amt disqualifiziert. Gewiss, für Freunde einer echt harmonischen Volksgemeinschaft ist es nicht schön, wenn Trump wohlmeinenden Demonstranten das Feindbild antiamerikanischer Horden überstülpt, die nur Chaos anrichten wollen. Befürworter einer aufgeklärten und inklusiven Vaterlandsliebe mögen auch zusammenzucken, wenn Trump am Nationalfeiertag die fälligen Lobreden auf die Helden der amerikanischen Geschichte in den Dienst der Auspinselung der Bösartigkeit besagter Horden stellt. Noch schlimmer ist es, wenn er dabei mit dem Einsatz des schönsten Militärs auf Erden
droht, beim Fotoshooting mit Bibel eine Kostprobe davon gibt und dann mit grünen Männchen in Portland, Chicago ff. nachlegt. Doch wie kommt man darauf, dass hier eine moralische Unterversorgung vorliegen würde? Seine Entschlossenheit, Amerikas wunderbare Ordnung und seine superfantastischen Polizeikräfte – abzüglich einiger denkbar unbedeutender fauler Äpfelchen – in genau der Form zu bewahren, gegen die protestiert wird, beseitigt alle Zweifel: Sein moralischer Kompass ist perfekt geeicht. So perfekt, dass er aus dem Stegreif, ganz instinktiv, und zwar ohne ein einziges Mal Nigger!
zu sagen, vorführt, wie der Rassismus der amerikanischen Staatsgewalt und eines gar nicht kleinen Teils des amerikanischen Volkes geht.
Denn die etablierte rassistische Sittlichkeit, die in polizeiliche und private Brutalität ausartet, hat ihren Ausgangspunkt und ihren Antrieb weder in einer biologischen Rassentheorie noch im moralischen Unvermögen, den Wert schwarzen Lebens zu erkennen, sondern in genau der politischen Moral, die Trump auf so ehrlich ergriffene Art zelebriert: in der Liebe zur amerikanischen Ordnung, zu der freien und gleichen Konkurrenzgesellschaft, die sie ordnet, und zum Volk, das diese Ordnung als seinen ‚way of life‘ lebt und liebt.
I. Eine großartige Ordnung und ihr innerer Feind: kriminelle Charaktere
Ohne Verklärung ihres Objekts ist diese Liebe nie ausgekommen. Was nicht heißt, gute Amerikaner wären sich nicht im Klaren darüber, dass ihr ‚pursuit of happiness‘ als verbissenes Gegeneinander der Konkurrenz abläuft; auch, dass die Heimat der Freien und Gleichen eine soziale Hierarchie aufweist, deren obere und untere Enden drastisch ausfallen. Warum sollte man das auch leugnen, wenn doch feststeht, dass die amerikanische Marktwirtschaft ein ‚land of opportunity‘ ist? Eine Klassengesellschaft ist das sicher nicht, können doch die Mitglieder aller Klassen, die auch dort bekannt sind und gelegentlich so genannt werden, sich gleichermaßen frei entfalten und im Prinzip auch von der einen in die andere aufsteigen. Auch wenn sehr auffällig ist, wie sehr die Amerikaner für ihre Aufstiegsgeschichten auf Hollywood zurückgreifen, sollen die Fantasien bisweilen auf wahren Begebenheiten beruhen. Doch es sind ohnehin nicht die Resultate der Konkurrenz, die wirklichen Lebensverhältnisse oben wie unten, die diese Konkurrenzgesellschaft so schön machen – und wenn nicht immer so schön, so doch letztlich über Kritik erhaben. Auch die unterschiedlichen und gegensätzlichen Mittel und Zwecke der jeweiligen Konkurrenten können der Schönheit nichts anhaben. Entscheidend sind nämlich die Tugenden der Konkurrenz, die auf allen Rängen der sozialen Hierarchie gefragt sind, insofern auch jeden Rang dieser Hierarchie von Kritik freisprechen: Tüchtigkeit, Ehrgeiz, Beharrlichkeit, List, der richtige Riecher und vor allem: die gute alte amerikanische Selbstverantwortung. Kurz: Gute Amerikaner, alte wie junge, besingen ihre kapitalistische Konkurrenz- und Klassengesellschaft also auf denkbar unsachliche Art als ein einziges Moraltheater.
Doch eines tun sie dabei nicht: die dazugehörigen Härten weichzeichnen. Ihren ‚way of life‘ kennen sie als eine sehr fordernde moralische Bewährungsprobe. Deren Härten sprechen nicht gegen das marktwirtschaftliche Glücksstreben selbst, sondern umso mehr für diejenigen, die sich in ihm bewähren. Für die Erfolgreichen gilt das erst recht, deren Tugendhaftigkeit damit schon ziemlich feststeht. Wenn sie sich im Dienste ihres geschäftlichen Erfolgs und ihres privaten Glücks Gesetzesübertretungen erlauben, ist das ärgerlich, wird ihnen aber immer wieder nachgesehen; falls derlei Nachsichtigkeit doch skandalisiert wird, nutzt sich die Aufregung schnell ab; Sozialneid fällt in Amerika auf die zurück, die ihn nicht zu eigenen Aufstiegsträumen veredeln oder wenigstens verstecken können. Schließlich ist auch den nicht ganz anständigen Erfolgreichen genau das gelungen, worum es ja allen freien Glücksrittern geht; und man muss auch zugeben, dass ziemlich viel und ziemlich viele von deren Glück abhängen. Von diesem Moralüberschuss in der Heimat der freien Konkurrenz ist die Bewunderung für einen Donald Trump nur das aktuellste Zeugnis.
Mit Verlierern des freiheitlichen Lebenskampfs rechnet die Community der Konkurrenten natürlich auch. Dieses Schicksal zu erleiden, ist keine Schande, aber es berechtigt zu nichts. Verlierer, die meinen, Ansprüche an so etwas wie eine staatlich verwaltete Solidargemeinschaft stellen zu können, oder gar eine anklagende Kritik an ihrer Lage erheben, entlarven sich als ‚losers‘. Sonst würden sie doch ihren angeknacksten Stolz in das verbissene Bemühen stecken, endlich ein bisschen zu den Gewinnern zu gehören, statt denen ihren Erfolg wegnehmen zu wollen. Solch unanständige Verlierer grenzen sich selbst aus der Gemeinschaft selbstverantwortlicher Konkurrenten aus und rutschen sehr nahe an die nächst darunterliegende Stufe in der moralischen Hierarchie der amerikanischen Klassengesellschaft. Die ist von den zahlreichen Verlierern bevölkert, die es nicht schaffen, ihre Armut gesetzeskonform abzuwickeln; damit geben sie sich als Kriminelle zu erkennen – als ‚bad hombres‘, böse Charaktere, untauglich für die Ordnung und gefährlich für die Erfolgreichen und Anständigen. Kombiniert man das eine mit dem anderen, eine soziale Kritik mit ein bisschen ungesetzlicher Unruhe, ist man endgültig am sittlichen Bodensatz der freien Gesellschaft angekommen und nagt an ihrem Fundament. Die einzige Sprache, die solch unanständige Verlierer verstehen, ist strafende Gewalt.
Das ist nicht bloß die entgleiste Sichtweise rechtschaffener Bürger, sondern kennzeichnet auch die Funktionsweise des amerikanischen Justizwesens selbst. Seine elementar rassistische Logik wird nur dadurch verschleiert, dass darin nicht – jedenfalls nicht offiziell – nach Rassen sortiert und bestraft wird. Gleichwohl beeindruckend sind das Ausmaß und die Konsequenz, mit denen die Justizabteilung des großen Freiheitsstalls von Armut und Kriminalität auf untaugliche Charaktere, auf Verbrechernaturen schließt und diese entsprechend behandelt. Genauso wenig wie die Härten der marktwirtschaftlichen Konkurrenz wird also auch die Gewalt, die für das ordnungsgemäße Funktionieren des freien Glücksstrebens nötig ist, irgendwie beschönigt oder heruntergespielt, eher glorifiziert und als unerlässliches Werkzeug im Wahlkampfarsenal nicht nur eines jeden Sheriffs, sondern auch aller Politiker bis hin zur präsidentiellen Spitze gewürdigt. In diesem Sinne führt Amerika seit über einem halben Jahrhundert einen Krieg gegen zwei unpersönliche Feinde im Innern: ‚crime‘ und ‚drugs‘. [1] Der Kriegsauftrag wird andererseits sehr persönlich vollstreckt, und zwar vor allem – im Einklang mit der etablierten moralischen Hierarchie des Landes – an den schlechten Charakteren, die weniger an der Wall Street und an den diversen Universitäten, sondern in den bekannten Vierteln hausen. Dort schlagen sich die Verbrecher zwar mit haargenau den gleichen Konkurrenztugenden, aber mit illegalen Techniken des Glücksstrebens durch und entlarven dabei sich und ihre Nachbarn als böse Buben. Mit dieser praktizierten Liebe zur besten Ordnung der Welt, also diesem Krieg gegen die Unordnung der unanständigen Armen, bringt die Heimat der Freien es zu Strafmaßen und einer Gefängnisbevölkerung, die sich hinter den Feindbildern fremder ‚Gewaltherrschaften‘ nicht zu verstecken brauchen; sie gehen schon deswegen in Ordnung, weil ihre Notwendigkeit mit ihrer Existenz Jahr für Jahr bewiesen wird. Gemäß der Logik der Bestrafung, dass sich im Verbrechen der böse Charakter zeigt, ist die Strafe mit dem Gefängnisaufenthalt nicht vorbei, muss nicht einmal mit ihm anfangen; der Verbrecher kriegt seinen offiziellen und moralischen Status als solchen eben nicht so leicht abgeschüttelt. In den meisten Bundesstaaten wird verknackten Straftätern eine Reihe von bürgerlichen Rechten entzogen, was eine Existenz nach den offiziellen Richtlinien so gut wie verunmöglicht. [2] Da ist gelegentlich von einem Teufelskreis
die Rede, der die ganz weichen Herzen zu höflichen, folgenlosen Bedenken hinsichtlich der Effektivität einer solchen Kriminalitätsbekämpfung bewegt – Gipfel der Barmherzigkeit. Was die zuständigen Politiker selbst betrifft: Von einer ‚Spaltung‘ zwischen den Parteien ist zumindest in dieser Frage nichts zu sehen, eher herrscht ein Überbietungswettbewerb.
II. Ein großartiges Volk und sein farbiges Gegenbild
Der Dauerkrieg gegen das Verbrechen ist einerseits eine multikulturelle Angelegenheit. Die armen Mitglieder aller Ethnien begegnen einander nicht nur in den unteren Rängen der sozialen und moralischen Hierarchie, sondern auch auf unterschiedlichen Stufen der Bestrafung durch das Justizwesen. Andererseits ist das, wogegen die Black lives matter!
-Bewegung auf die Straße geht, nicht zu übersehen: Gleichberechtigung und farbenblinde offizielle Moral hin oder her, die Schwarzen werden von der Staatsgewalt wie von einem stattlichen Teil der Bevölkerung als ein verdächtiges Kollektiv betrachtet und behandelt. Der Krieg gegen Verbrechen trifft die Schwarzen in besonderem Maße, er zielt nämlich auf sie. Ihre Hautfarbe weist sie als Mitglieder einer gefährlichen Community aus, sodass sie selbst erst recht gefährlich leben. [3] Das ist natürlich nicht der offizielle Standpunkt der amerikanischen Staatsgewalt, ist sogar offiziell verpönt; von ihren Agenten wird er gemäß dem polizeilichen Insiderwitz Racial Profiling gibt es nicht ... aber es funktioniert!
dennoch vollstreckt und von einem bedeutenden Teil der Gesellschaft geteilt. Den Schwarzen wird die so überaus menschenfreundliche Unterscheidung zwischen guten und bösen, anständigen und kriminellen Konkurrenzcharakteren nicht zugestanden; in ihrem Fall gilt, was für die weiße Mehrheitsbevölkerung nicht gilt: Ihre Rechtsbrüche zeugen nicht von faulen Äpfeln, sondern von einem verkorksten Stammbaum, von einer kollektiven Untauglichkeit für die Ordnung und von einer kollektiven Gefahr für die Ordentlichen. [4]
1.
Ihren Protest gegen diesen Umstand erheben die Demonstrierenden in der Gewissheit, dass sie damit gegen einen Machtgebrauch und einen Geist antreten, die den Verfassungsprinzipien und dem Selbstverständnis der Nation widersprechen. Die geht schließlich davon aus, dass alle Menschen gleich geboren sind
, gleichermaßen nach ‚happiness‘ per Teilnahme an der marktwirtschaftlichen Konkurrenzgesellschaft streben.
In einer Hinsicht haben sie recht – freilich nicht in dem Sinne, dass Amerika es versäumt hätte, ‚dem Menschen‘ gerecht zu werden. Die damit benannte abstrakte Kunstfigur, der die amerikanische Staatsgewalt laut Verfassung zu dienen verspricht, steht für den Menschen, der in die kapitalistische Konkurrenzgesellschaft entlassen wird – in eine Produktionsweise, in der es zwar von Gegensätzen, Über- und Unterordnungsverhältnissen zwischen den Menschen wimmelt, in der aber diese privaten Herrschaftsverhältnisse versachlichter Art sind: Die Macht der einen über die anderen entscheidet sich nicht an der Hautfarbe, sondern am Besitz von Eigentum und Geld und daran, ob sie ihr Geld mit eigener oder fremder Arbeit verdienen. Wenn der amerikanische Staat, wie in jeder erfolgreichen kapitalistischen Demokratie, andere Formen von Unterscheidung und Unterordnung verbietet, dann deswegen, weil er auf diese Unterscheidungen und Unterordnungen Wert legt, näher: auf deren Produktivkraft für den kapitalistischen Reichtum, aus dem er auch seine Machtmittel bezieht. Die amerikanische Verfassung legt dabei auch Wert darauf, dass die freien Konkurrenten aller Couleur aus ihren versachlichten Konkurrenz- und Klassenverhältnissen eine nationale Identität und Selbstliebe schöpfen – und dass das geht, haben sie mit ihrem 250 Jahre alten ‚grand experiment in democracy‘ längst bewiesen. Und zwar mit genau der oben beschriebenen Konkurrenzmoral: Amerika ist das Land der ‚hard-working‘ Konkurrenzgeier, die so lange in Harmonie leben, wie sie die Freiheit hochhalten, sich also auf ihre jeweilige Selbstverantwortung an ihrem jeweiligen Platz besinnen. Dieser offiziell amerikanische, ‚liberale‘ Standpunkt findet nichts dabei, die Regie des Kapitals, d.h. der Kapitale als ‚offene Gesellschaft‘ zu feiern, als einzig menschengerechte Herrschaftsform, kurz: als die Freiheit des Menschen, zu zeigen, was in ihm steckt.
2.
Die rassistische Sonderbehandlung, mit der die Schwarzen konfrontiert werden, ist die Kehrseite eines in der weißen Mehrheitsbevölkerung fest etablierten Selbst- und Rechtsbewusstseins, das diesen Prinzipien und dieser Moral der Konkurrenz zwar widerspricht, aber als Einspruch gegen sie überhaupt nicht gemeint ist. Im Gegenteil: Das Kollektiv ‚echter‘ Amerikaner pflegt das Bewusstsein, nicht bloß das größte Kollektiv im Land der Freien und Gleichen zu stellen, sondern auch die wahren Subjekte dieser einzigartig menschengerechten Ordnung zu sein, die im Regime der Freiheit nicht bloß die bestmöglichen Lebensbedingungen vorfinden, sondern ihr eigenes Werk – und vor allem: ihre eigene völkische Besonderheit. Dabei ist es offensichtlich gleichgültig, ob sie überhaupt die ökonomischen und politischen Machtmittel besitzen, an diesen Lebensbedingungen irgendetwas zu bestimmen außer ihren eigenen Willen, dabei mitzumachen. Entscheidend für die Einbildung, das Subjekt der freiheitlichen Ordnung zu sein, ist vielmehr die Gewissheit, dass die moralischen Idealisierungen des marktwirtschaftlichen Konkurrierens ihre besonderen Attribute sind, die die anderen allenfalls auch lernen können; dass sie das wahre Konkurrenzvolk, also die vollkommenen Menschen sind, auf die die Verfassung der Nation mit ihrer Apotheose des Menschen, frei und gleich geboren, sich in Wahrheit bezieht – und deren Vorfahren diese Verfassung sich einmal gegeben haben. Das verschafft den Ärmsten unter ihnen zwar sonst nichts, aber immerhin einen ideellen Lohn: das eingebildete Vorrecht, darüber zu urteilen, ob und inwiefern die anderen Sub-Kollektive der Bevölkerung, die ‚racial minorities‘, für die Freiheit der Konkurrenz überhaupt reif sind, ob sie den Schutz der freiheitlichen Staatsmacht beanspruchen können oder ihn eher fürchten sollen. Dieses Recht wird zwar in Wahrheit nur von den wirklichen Herren im Staat und in der Wirtschaft ausgeübt, das sprechen sie aber auch sich als Mitglieder des gleichen Herrenvolks zu.
Die amerikanische Geschichte ist eine wahre Schatztruhe von Beispielen für den ausschließenden Charakter dieses praktizierten Selbst- und Rechtsbewusstseins. [5] Die Schwarzen sind davon ein besonderer Fall, lange nach der Abschaffung der Sklaverei. Denn auch ihre Emanzipation ändert nichts daran, dass ihre Hautfarbe alles Nötige über sie verrät: Ihre Anwesenheit auf amerikanischem Boden entspringt nicht dem Willen, das Glück in der freien Konkurrenz zu suchen und darüber einen Beitrag zum Gemeinwesen zu leisten. Dieser Wille ist ihnen also auch nicht zu unterstellen; die Schwarzen sind und bleiben insofern fremd – es ist nicht ihre Ordnung, nicht Ausdruck ihres Freiheitsdrangs.
Das unterscheidet die Schwarzen von den anderen Fremden, die über die Jahrhunderte in kleineren und größeren Wellen Richtung Amerika schippern und zu denen das einheimische Herrenvolk seit jeher ein gespaltenes Verhältnis pflegt. Als Konkurrenten – zunächst um Land, später um Arbeitsplätze in der aufblühenden Industrie, noch später in der wachsenden ‚Dienstleistungsgesellschaft‘ – stoßen die je letzten Immigranten bei ihren einheimisch gewordenen Klassenbrüdern traditionell auf Skepsis bis Ablehnung. Was die mittellose Abhängigkeit der eingeborenen stolzen Proletarier Amerikas nicht schafft, das schaffen auch nicht ihre neu eingewanderten Ebenbilder, nämlich den leisesten Zweifel daran zu säen, dass die marktwirtschaftliche Freiheit ein schönes Privileg ist. [6] Bei den wirklich entscheidenden Subjekten kommen die Einwanderer tendenziell besser an: anfänglich als Kräfte zur Besiedlung und Bewirtschaftung des eroberten Kontinents und damit zur Konsolidierung der kontinentalen Eroberung; zur Erledigung der Drecksarbeiten beim Aufbau der Infrastruktur, die für die kapitalistische Erschließung des eroberten Landes erforderlich ist; zur Befriedigung des Heißhungers des industriellen Kapitals nach rentabler Arbeit; als Kanonenfutter für den Sieg über den abtrünnigen Süden und später für die Durchsetzung einer immer amerikanischeren Weltordnung; als Wähler für den Sieg in der Konkurrenz um die Macht... Die Frage, ob die für Amerika, nämlich für seine herrschenden Instanzen so nützlichen Einwanderer auch als Amerikaner tauglich sind, ist damit überhaupt nicht beantwortet. Wovon Chinesen, irische und italienische Katholiken, Mexikaner u.v.a.m. ihr Lied singen können: Das Land der Freien besteht auf der Freiheit der Kalkulation mit den ‚armen, geknechteten Massen‘, die es bei sich aufnimmt; [7] und ein freies ‚einheimisches‘ Volk besteht auf seinem Vorrecht.
3.
In einem solchen kalkulierenden Verhältnis – dies das Leiden rechtsbewusster weißer Nationalisten – steht der amerikanische Staat zu den Schwarzen von Haus aus nicht. Die sind aus diesem Blickwinkel zwar wie Ausländer, nämlich verdächtige Fremde, können aber nicht als Ausländer behandelt werden. Sie können nicht einmal die Ehre für sich verbuchen, Bürger eines fremden Staats zu sein, also wenigstens anderswo ihre Heimat zu haben. Sie sind nicht ‚foreigners‘, sondern eben ‚niggers‘, eine untaugliche Rasse, deren ‚Fremdheit‘ rein in ihrer Untauglichkeit und Gefährlichkeit für die heimische Ordnung besteht, die nicht bloß ‚unsere‘ Ordnung ist, sondern die einzig vollkommen menschliche. Ausnahmen bestätigen die Regel. Und das ist nicht bloß das Bild, das dessen Anhänger von den Schwarzen pflegen, sondern war bekanntlich auch lange Zeit das offizielle Prinzip ihrer Behandlung durch die amerikanische Staatsgewalt. Nach ihrer Entlassung in die freie Konkurrenz werden sie – in den Südstaaten – in die Rolle von de jure eigenständigen Bauern gedrängt, die aber de facto als billigste Arbeitskräfte der Willkür ihrer Geschäftspartner ausgeliefert sind; politisch werden sie im besten Fall als Bürger zweiter Klasse behandelt, ansonsten von Bürgern und Beamten systematisch terrorisiert. Im Zuge von zwei ‚great migrations‘ fliehen sie in die Metropolen des Nordens und Westens, wo die Herren der kapitalistischen Industrie und der Kriegswirtschaft sie als billige Arbeitskräfte gebrauchen können – und werden dort mit einer staatlichen Bevölkerungspolitik konfrontiert, die nicht gewillt ist, sie als betreuungsbedürftige Lohnarbeiter zu behandeln. Die außerordentliche Ehre, als eine nicht existenzfähige Arbeiterklasse staatliche Betreuung zu genießen, bleibt den Weißen an entscheidender Stelle vorbehalten – sowie der Genuss, in ihren Vierteln nur auf Exemplare ihrer eigenen Rasse blicken zu dürfen. [8]
Mit dieser ausschließenden Behandlung der Schwarzen konkurrieren die äußerst guten Erfahrungen, die die herrschenden Instanzen mit ihnen machen: als Arbeitskräfte, Soldaten und – wo sich die Sorgen um ihre politische Verlässlichkeit legen – als eine beträchtliche potenzielle Wählerklientel. Kennedy und die anderen Herren des US-Imperialismus sollen zudem gewisse propagandistische Reibungsverluste bei der Versöhnung ihres imperialistischen Anspruchs als Anführer der freien Welt mit der Lage der Schwarzen daheim erlitten haben. Das verschafft der damaligen Bürgerrechtsbewegung eine gewisse Anerkennung von oben und damit entscheidenden Auftrieb. Am glücklichen Ausgang der Bürgerrechtsbewegung steht dann die offizielle Gleichberechtigung – während ‚black power‘ zum Staatsfeind Nummer Eins avanciert. [9] Haarspalterei wird dabei nicht betrieben. Die Militanz und die revolutionäre Rhetorik der ‚black panthers‘; die friedlichen Märsche und patriotischen Töne der Bürgerrechtsbewegten; die Unruhen in den Metropolen als Reaktion auf den Terror der Polizei und vieler inoffizieller Vertreter der echten weißen Amerikaner; das Verbrechen und der Drogenkonsum, die sich in den schwarzen Elendsquartieren ausbreiten – alles steht für dasselbe: für eine allgemeine Missachtung von Amerikas großartiger Ordnung und ihres ‚way of life‘. Dies die Geburtsstunde des ‚Kriegs gegen das Verbrechen‘, dessen personelle Besetzung schon im Moment der Ausrufung feststeht.
4.
Der Rassismus, den die Schwarzen heute durch Polizei und Justiz erfahren, ist eines bestimmt nicht: eine ungerechte Verallgemeinerung schlechter Erfahrungen mit Einzelnen. Es ist genau umgekehrt: Die praktizierte Feindschaft gegen die Schwarzen ist die Weise, wie die Agenten der guten Ordnung und Schutzkräfte des Rechtsfriedens mit dem Auftrag Ernst machen, dass sie es nicht ‚nur‘ mit vielen Bösewichtern zu tun haben, sondern – ganz gemäß der Logik eines Kriegs gegen Kriminalität – mit einem inneren Feind, der ganz bestimmt nicht zum guten amerikanischen Gemeinwesen der Selbstverantwortlichen gehört. Dieser Feind wird ausgeschrieben, gesucht und gefunden. Worauf die Suche trifft: eine fix und fertige, subalterne schwarze Community, wie geschaffen für diese Rolle. [10] Von Amerikas bewaffneten Friedenswächtern bekommen die Schwarzen es mit einer Offensive zu tun, die der Wirksamkeit der Jim-Crow-Gesetze in nichts nachsteht. [11] Der private rassistische Terror wird zwar geächtet, findet aber als störende Begleitmusik zum offiziellen Wirken von ‚law and order‘ weiterhin statt. Er findet sein schwaches, aber wirksames Echo in den kleinen alltäglichen Demonstrationen der Angst vor und der Verachtung für die Schwarzen.
Stolze weiße Nationalisten oben und unten verstehen sich dabei gut. Die Regierten unter ihnen haben keine Mühe, in den offiziellen rassenneutralen Umschreibungen der inneren Feinde die einheimischen Fremden zu erkennen – zumal die Regierenden mit Hilfe der freien Presse an eindeutigen Bebilderungen von schwarzen Drogensüchtigen und Schwerverbrechern nicht sparen. Der Umstand, dass dabei das letzte Zipfelchen an Eindeutigkeit dann doch fehlt, begründet schon seit Jahren einen amerikanischen Volkssport und Exportschlager der politisch korrekten Art: Manche führen Aufsicht darüber, dass wirklich nur ganz neutrale Ausdrücke in die öffentliche Beratschlagung über den Umgang mit bösen Kriminellen Eingang finden; andere verlegen sich auf die überflüssigste aller Entlarvungen – auf die Aufdeckung und Entzifferung der offensichtlichen ‚code words‘ und ‚dog whistles‘, mit denen eine rassistische Ordnungspolitik für ein zu egalitären Moralbezeugungen erzogenes Volk verdaulich gemacht wird, ohne dass in der Übersetzung zu viel verloren geht. Dem ist vor allem zu entnehmen, wie wenig es da zu verschlüsseln gibt – wie klein der Schritt ist von der Konstruktion eines inneren, verbrecherischen Feinds zu dessen personeller Besetzung. Es ist auch so: Wenn eine rassistische Politik gar nicht mit einer rassistischen Terminologie begründet und betrieben wird, sondern mit Beschwörungen der schönen Ordnung, ihrer Werte und des großartigen Volkes, dann wird die rassistische Praxis weniger verdeckt als vielmehr ihre wahre Grundlage im anerkannten Patriotismus offenkundig.
*
Eine beachtliche Bilanz haben die Schwarzen also vorzuweisen: Dieses Kollektiv wird konfrontiert erstens mit den Härten, die der Kapitalismus seinen mittellosen Freien und Gleichen beschert, zweitens mit der Verachtung, die ein egalitäres Konkurrenzvolk für seine minderbemittelten Mitglieder bereithält, drittens mit einer unmöglichen Beweislast: Sie sollen den Verdacht entkräften, sie würden als leibhaftiger Rechtsbruch herumlaufen – das Gegenteil steht den Schwarzen ja schon buchstäblich auf die Stirn geschrieben, und das kriegen sie mit keinem Kapuzenpulli der Welt verdeckt. Dafür sollen sie auch und gerade gegenüber der Polizei mit jederzeit sichtbaren Gesten der Unterwürfigkeit den Vorbehalt anerkennen, der gegen sie gepflegt wird; alles andere ist Widerstand und wird bestraft – wie, das ist nun schon wieder auf Video festgehalten worden.
III. Eine neue antirassistische Protestbewegung und ihre Resonanz
Dagegen geht eine neue Antirassismus-Bewegung seit sechs Jahren unter der Parole Black lives matter!
auf die Straße und bringt es dieses Jahr sogar zu den größten Protesten der amerikanischen Geschichte. Die Parole selbst sorgt seit Jahren für viel Irritation und Ärger: An deren Anhänger ergeht immer wieder die empörte Aufforderung, doch gefälligst „All lives matter!“ auf ihr Panier zu schreiben, um den schönen egalitären Prinzipien des Landes statt einer erneuten rassistischen Spaltung das Wort zu reden. Die Aufforderung weisen die Demonstranten entschieden zurück – nicht nur deswegen, weil sie oft genug als Zurückweisung der Behauptung gemeint ist, es gäbe überhaupt den Rassismus, gegen den sie antreten, sondern auch und vor allem deswegen: Angesichts der Lage ist die weitere Beteuerung der offiziellen, egalitären Moral für sie nicht nur ein Hohn, sondern bringt aus ihrer Sicht das ganze Problem auf den Punkt.
1.
Denn hinter der Gleichberechtigung und der offiziellen Moral eines farbenblinden Egalitarismus erblickt die Protestbewegung – Belege sammeln die Schwarzen seit mehr als einem halben Jahrhundert – eine Feindschaft, die seit den Tagen der Segregation wenig von ihrer Schärfe verloren, stattdessen neue, egalitäre Gewänder bekommen hat. Die Bewegung verweist dabei auf alles, was mit Gleichberechtigung und Egalitarismus offenbar zusammengeht: auf Lebensbedingungen, die so elend und so segregiert sind wie zu Zeiten der offiziellen Rassendiskriminierung in den Südstaaten; auf ‚mass incarceration‘ und ein ‚prison-industrial complex‘, durch die die Schwarzen massenhaft ins Gefängnis geschickt und als Bürger zweiter Klasse ausgespuckt werden; auf polizeiliche und private Schikanen und mörderische Gewalt, der sie zahlreich zum Opfer fallen. Der entnimmt die Bewegung, dass die Schwarzen von der Staatsgewalt und von der weißen Mehrheit nach wie vor als gefährliche Fremde im eigenen Land behandelt werden; und dass die Weißen, die sie nicht verachten, großteils unbeteiligt und gleichgültig zuschauen. Zwar gibt es immer wieder Wellen der Empörung über Fälle von rassistischer Polizeigewalt, die auf Handys festgehalten werden und dann ‚viral‘ gehen, doch mit deren Verlauf hat die Community genügend ernüchternde Erfahrungen gesammelt: Polizeiliche und private Täter werden in der Regel freigesprochen oder nur geringfügig bestraft, die öffentliche Empörung legt sich schnell wieder, mündet allenfalls in ein folgenloses Bedauern – nach dem Motto: furchtbar, was denen mal wieder passiert ist. In den moralischen Kreis des nationalen ‚Wir‘ sind die Schwarzen trotz aller offiziellen Beteuerungen des Gegenteils nie aufgenommen worden. Und bei allen Ausnahmen, die zitiert werden, um das ewige amerikanische Rassenproblem für erledigt zu erklären – Hat nicht ein Schwarzer sogar zwei Amtszeiten im Weißen Haus verbracht?
–, bleibt es dabei: Die Schwarzen sind und bleiben ‚die anderen‘ im amerikanischen Schmelztiegel, geächtet, angefeindet und ausgeschlossen.
Das trotzige Beharren der Bewegung darauf, dass der Wert schwarzen Lebens doch endlich etwas zu zählen habe, ist insoweit Ausdruck sowohl einer drastischen Lage als auch einer Desillusionierung. Wo die Feindschaft der Staatsgewalt und der Bevölkerung feststeht, kann es beim Beharren auf gleichen Rechten und den universellen Werten der Konkurrenz nicht bleiben: Ihre rechtliche Gleichstellung und ihre offizielle Aufnahme in den Kreis der vollwertigen Amerikaner schließen ihre praktische Anerkennung als gleichermaßen wertvolle Mitglieder des Gemeinwesens nicht nur nicht ein, sondern sind bloß die Form, in der die Feindschaft gegen sie perpetuiert wird. Daher: So sicher die Protestierenden sein mögen, dass sie die rechtlichen und offiziellen moralischen Prinzipien der Nation auf ihrer Seite haben, und so sehr sie auch ‚wahre Gleichheit‘ als Ziel ausgeben, so wenig wollen sie ihren Protest bloß als ein nochmaliges Ersuchen um Gleichberechtigung und als eine wieder mal aufgewärmte Beschwörung des Egalitarismus verstanden haben. Diese Nation soll vielmehr ihren Rassismus endlich einsehen und das moralische Unrecht anerkennen, das Amerikas Schwarze erleiden, statt das alles mit Beteuerungen ihrer ‚eigentlichen‘ egalitären Unschuld abzustreiten und alles, was diesem Prinzip widerspricht, den berühmten ‚faulen Äpfeln‘ anzulasten. Wenn die Bewegung dafür auf die Straße geht, dann entsprechend rabiat; der Empörung über die Schäden, die dabei dem Eigentum ihrer unternehmerischen Nachbarn – ‚in ihren eigenen Vierteln!‘ – angetan werden, hält sie entgegen: Die Schwarzen werden ja offensichtlich nicht als Teil dieses freien und gleichen Gemeinwesens akzeptiert; dessen Ordnung erfahren sie zum größten Teil nur als Feindschaft gegen sie; Gründe für Gehorsam haben sie somit keine.
2.
Wie flächendeckend und institutionell verankert diese rassistische Feindschaft ist, wie verwoben mit dem ökonomischen, politischen und sittlichen ‚way of life‘ in den USA – das fällt politisch bewussten Schwarzen nicht zum ersten Mal auf. Vor gut 50 Jahren ist diese Überzeugung der Ausgangspunkt für eine ‚black power‘-Bewegung, die es beim gewaltfreien, verfassungstreuen Ethos der von Martin Luther King angeführten Bürgerrechtsbewegung, bei deren Appellen an die Regierung in Washington, die soeben beschlossene Gleichberechtigung und Integration wirklich ernst zu nehmen und beherzt durchzusetzen, nicht belassen will. Das zeugt in ihren Augen zwar von höchst ehrenwerten Motiven, aber eben auch von einer hoffnungslos idealistischen Ignoranz gegen die Feindschaft und Gewalt der regierenden wie regierten weißen Rassisten. Stattdessen besinnt sich diese Fraktion auf eine gewaltsame Offensive gegen die etablierten Autoritäten eines Landes, das das ihre offenbar nicht ist: Sie ruft zu einer Übernahme der von den Weißen monopolisierten Macht auf, und zwar by the ballot or by the bullet
(Malcolm X). [12] Sie reagiert auf den weißen Nationalismus ihrer Gegner mit einem eigenen, schwarzen Nationalismus, der aus der kollektiven Anfeindung der Schwarzen eine eigene, positive rassische Identität drechselt; die ist zwar – bis hin zur Kopie des rassistischen Kampfspruchs ‚white power!‘ – nach dem weißen Rassismus modelliert, soll aber ein guter sein, weil von den Opfern gegen die Bösen gepflegt. Die praktische Aktivität dieser Bewegung besteht zum großen Teil darin, ihren schwarzen ‚Brüdern und Schwestern‘ beizubiegen, dass sie nicht nur Opfer eines weißen Rassismus, sondern Mitglieder einer stolzen Rasse und eines verhinderten Volkes sind; dass ihr Volk und dessen Gedeihen vor ihren eigenen Berechnungen zu kommen haben; und dass ihr bisheriges Zaudern, gegen die weißen Machtstrukturen anzutreten, auf Volksverrat hinausläuft. Dieser schwarz-nationalistische Befreiungswille ist schließlich auch der wesentliche Gehalt des Antikapitalismus, den manche Vertreter dieser Bewegung auch noch pflegen: Der ist gewissermaßen das ökonomische Pendant zum politischen Programm, die gesellschaftliche Macht für eine wahrhaft selbstbestimmte schwarze Community zu erobern.
Von einem solchen Kampf ist die Black lives matter!
-Bewegung, die in der gleichen Ernüchterung ihren Ausgangspunkt hat, weit entfernt. Sie überführt die desillusionierte, militante, schwarz-nationalistische Offensive in eine aufrührerische Defensive:
Den Kampf gegen die amerikanische Staatsgewalt hat sie gegen eine Forderung eingetauscht, die für noch mehr Irritation als die ‚spalterische‘ Hauptparole sorgt: Defund the police!
, manchmal sogar Abolish the police!
[13] Die Parole bezieht sich auf die Erfahrung, dass die amerikanische Polizei gegenüber der schwarzen Community innerhalb und außerhalb ihrer Wohnviertel zunehmend wie eine Besatzungsmacht gegenüber einer von Feinden durchsetzten Bevölkerung auftritt – militärisch bewaffnet und mit der Lizenz, Jagd auf alles zu machen, was ihr verdächtig vorkommt. Dagegen setzt die Bewegung nicht den bewaffneten Kampf, sondern eine Forderung nach Abrüstung, nach einem Rückzug von der Front. Mit dieser Forderung wird beim Staat auf einen fundamentalen Standpunktwechsel gedrungen – auch und gerade gegenüber dem Drogenkonsum und dem Verbrechen, denen er den Krieg erklärt hat und die die Schwarzen in ihren Vierteln durchaus auch beklagen. Das soll er nicht länger als ein Problem behandeln, das die Schwarzen sind, sondern als eines, das sie haben: als Fälle von beschädigter Volksgesundheit statt einer beschädigten Ordnung; als Erkennungsmerkmal nicht einer gefährlichen, kriminellen Community, sondern armer, perspektivloser, also gefährdeter Mitbürger. [14] Einen solchen Perspektivwechsel – darauf verweist die Bewegung immer wieder – hat es in der Geschichte des amerikanischen Staates durchaus schon einmal gegeben, nämlich bei der Gründung des amerikanischen Sozialstaates vor einem knappen Jahrhundert. Mit dem berühmten ‚New Deal‘ sollte der damaligen amerikanischen Arbeiterklasse ermöglicht werden, von ihrer ausgiebigen Benutzung durch das amerikanische Kapital auch tatsächlich leben zu können – womit sich auch der praktische Bezug des Staates auf das Elend und die Unordnung unter den damals verachteten Iren und Italienern änderte. Und auch heute plädiert der sozialdemokratische, für amerikanische Verhältnisse weit links stehende Flügel der demokratischen Partei für eine sozialstaatliche Reform nach diesem Muster – auch und gerade als Lösung, zumindest als Linderung der Lage in den schwarzen Ghettos. Mit dieser denkbar affirmativen, mit aller humanitären Selbstverständlichkeit geforderten Gleichung, wonach kapitalistische Armut nur als Schrei nach der Betreuung durch den kapitalistischen Staat zu verstehen ist, verlangt die Black lives matter!
-Bewegung also gewiss nicht das Unmögliche. Was sie dabei gegen sich hat, ist allerdings nicht wenig: nicht nur den breiten politischen Konsens im Lande, dass man dem ehernen amerikanischen Grundsatz bloß nicht zu nahe treten darf, wonach der gute Amerikaner für sich selbst sorgt, mit seinem Elend also selbst zurechtkommt, sondern auch den ganzen objektiven Stand des amerikanischen Kapitalismus. Der hat mit der subproletarischen Existenz eines Großteils der schwarzen Bevölkerung einfach kein Problem: Wie die armen Schwarzen mit ihrer Überflüssigkeit oder ihrer geringfügigen Beschäftigung und mit allen Folgen davon zurechtkommen oder eben auch nicht – das bereitet der Nation wirklich nur das Problem, das die Ordnungswächter in ihm sehen und mit dem sie auf ihre Art durchaus klarkommen. Gleiches gilt übrigens auch für ihre weißen Klassenbrüder, deren viel beklagter Abstieg aus der ‚middle class‘ im Problembewusstsein der Öffentlichkeit vor allem deswegen mehr Raum einnimmt, weil der aktuelle Präsident sich auf sie für alles beruft, was er unter der Losung America first!
beschließt. Was die Bewegung daraus folgert, ist eine Parole, die zur Abwechslung keine Irritation auslöst: Jobs!
Kein Wunder, ist das doch die Lösung aller Feindschaften in dem freiesten Land der Erde, erst recht in Zeiten von America first!
: die produktive kapitalistische Benutzung der Armut, die dann keine mehr ist. Angesichts dessen ist es seltsam ironisch, dass es der amerikanischen Öffentlichkeit wie ein großer Zynismus vorgekommen ist, als Trump mitten im Niederschlagen der Proteste verkündet, die positive Entwicklung der nationalen Beschäftigungszahlen würde dem im Himmel verweilenden George Floyd gewiss ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Zumindest in der Frage, in der sich wirklich alle guten Amerikaner einig sind, auch die sozial gesinnten Black lives matter!
-Protagonisten, trifft Trump ins Schwarze.
Auch vom ‚black power‘-Nationalismus hat die Bewegung ihren Antirassismus getrennt. Mit ihrer neuen Losung hat sie allerdings auch den Rassismus, gegen den sie antritt, von dem freiheitlichen Nationalismus geistig abgetrennt, dem er überhaupt entspringt. Der politische und patriotische Gehalt der Unmoral, die sie anprangert, wird so in ein moralisches Defizit, in eine inhumane Gleichgültigkeit aufgelöst. Zwar ist die moralische Anerkennung, die die Bewegung damit verlangt, sicher nicht so bescheiden gedacht; sie will dabei gewiss auf mehr hinaus als das billige Bekenntnis, das sie dem Wortlaut nach einfordert: die Zustimmung zur denkbar bescheidenen Überzeugung, dass schwarzes Leben nicht einfach egal ist. So viel steht allerdings fest: Die vielen unverhofften Anhänger, die die Bewegung dieses Jahr auf die Straße begleiten und ihr öffentlichkeitswirksam moralisch die Daumen drücken, nehmen die Bewegung beim Wort – und führen ihr so vor, welchen affirmativen Gehalt ihre inzwischen weltweit millionenfach geteilte und mitgeteilte Marschparole wirklich hat. Was überhaupt nicht heißt, dass die Bewegung mit ihrer Parole nichts bewirkt hätte. Im Gegenteil: Abertausende weiße Amerikaner gehen mit auf die Straße, bilden vielerorts sogar die Mehrheit der Demonstranten, was bei den protestierenden Schwarzen den nicht unbegründeten Verdacht schürt, dass die erfreuliche aktuelle Resonanz – im gewaltigen Kontrast zu den gleichen Protesten vor fünf Jahren – sich weniger einer Einsicht in den ‚strukturellen Rassismus‘ gegen Schwarze als vielmehr der Empörung über die singuläre Unanständigkeit des blonden Ekels im Weißen Haus verdankt. Daneben stürzen sich Millionen weiße Amerikaner in eine moralpsychologische Nabelschau, suchen nach dem inneren Rassisten, den sie in sich unwissentlich beheimatet haben, und bescheren dabei den Verlegern von antirassistischen Selbsthilfebüchern unverhoffte Umsätze. Wo sie es können, überfallen sie befreundete wie wildfremde Schwarze mit Bekenntnissen ihres Mitgefühls und ihrer eigenen Mitschuld aufgrund ihres ‚weißen Privilegs‘ – identifizieren sich höchstpersönlich mit ihrer Rasse, um es dann lauthals zu bedauern. Derweil überbieten sich die Herren des Kommerzes im äußerst lukrativen Massensportsegment in Respektbekundungen für die Community, aus deren ärmlichen Verhältnissen sie so viele lohnende Figuren herausfischen und aufs Feld schicken. Und eine echte politische Wirkung gibt es auch noch: Eingefleischte ‚law and order‘-Politiker aus der demokratischen Partei, die auf Defund the police!
im besten Fall sehr ambivalente Antworten geben, knien sich beim eigenen Fotoshooting hin – auffällig statuenhaft, zwar ohne Bibel, dafür mit afrikanischen Tüchern um den Hals – und unterschreiben die Anklage, um sie an den faulen Apfel im Weißen Haus weiterzureichen. Als dessen passenden Ersatz bringen sie so ihre Partei und ihren Kandidaten ins Spiel – eine halbschwarze Vize-Kandidatin mit ‚law and order‘-Vita hat sich auch schon gefunden. In den Korridoren der demokratischen Politik ist die Bewegung angekommen.
[1] Den Krieg gegen Verbrechen und Drogen führt es unter anderem mit dem ‚three-strikes law‘ (sinngemäß: ‚Drei-Verstöße-Gesetz‘) ... ein Gesetz, nach dem bei der dritten Verurteilung wegen einer Straftat in den meisten Bundesstaaten automatisch eine besonders schwere Strafe ausgesprochen wird und in wenigen Bundesländern (z.B. Kalifornien) sogar lebenslang vorgesehen ist. Der Begriff kommt vom Baseball, wo ein Schlagmann nach dem dritten Fehlschlag (‚strike‘) ausscheidet und bis zur nächsten Runde nicht mehr am Spielgeschehen teilnehmen darf.
(Wikipedia, s.v. Three-strikes law)
[2] Nach einem Gefängnisaufenthalt bekommen viele Amerikaner kein Bein mehr auf den Boden. Nicht nur ihr Arbeitsplatz ist weg, sondern oft auch die Wohnung, denn viele Kommunen verbieten Straftätern das Betreten von Sozialsiedlungen. Für Vorbestrafte ist ein Job als Putzkraft oft schon wie ein Lottogewinn. Doch wer aus der Haft kommt, braucht nicht nur Geld zum Überleben. In aller Regel muss er Hunderte bis Tausende Dollar Schulden bei der Justiz abstottern: Geldbußen und Gebühren, deren Zahl sich immer weiter vergrößert... Für arme Amerikaner kann deshalb selbst ein Bagatelldelikt zu einer Art lebenslanger Strafe führen, denn sie geraten in einen Kreislauf aus Strafbefehlen und Mahngebühren. Oft wird der Führerschein eingezogen, wenn ein entlassener Häftling säumig ist. Fährt er dennoch Auto, weil er anders nicht zu seiner Arbeitsstelle kommt, droht ihm eine Festnahme wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Dann gibt es wieder Gefängnis, wieder Bußgeld, wieder Gebühren. Ein Gefängnisaufenthalt muss nicht unbedingt am Anfang dieser Spirale stehen.
(FAZ, 6.7.20) Den in vielen Bundesstaaten üblichen und viel beklagten zeitweisen Entzug des Wahlrechts kann man da eher als wohlverdiente Pause verbuchen.
[3] Für ein moralisch gefestigtes Volk wird das vor allem daran augenfällig, dass ein schwarzer Professor – einer der Guten! – vor seinem eigenen Haus – in einer guten Nachbarschaft! – von der Polizei für einen Einbrecher gehalten wird. Auf einem ‚beer summit‘ 2010 in gemütlicher Runde mit dem schwarzen Präsidenten findet eine zivilisierte Aussprache der Beteiligten statt. Das erfreuliche Ergebnis: großes Missverständnis.
[4] Als Mitglieder von einer ethnisch definierten Community beurteilt zu werden und sich auch als solche zu betätigen ist für sich genommen keine Besonderheit der Schwarzen. Überhaupt präsentiert sich die amerikanische Klassengesellschaft als ein Sammelsurium von ethnisch definierten Communitys mit objektiven und subjektiven Eigenarten, Eigen- und Fremdbeurteilungen anhand der moralischen Messlatte der freien Konkurrenz. Das liegt nicht nur an Amerikas zuwanderungsreicher Geschichte, sondern auch daran, was die moderne kapitalistische Konkurrenz den alten und neuen Zugewanderten abverlangt, die in ihr heimisch werden wollen. (Siehe Zum Beispiel Ferguson: Rassismus in den USA – woher er kommt und warum er nicht weggeht in GegenStandpunkt 1-15.) Die offensichtliche Besonderheit der Schwarzen in dieser gesellschaftlichen Beurteilung der Konkurrenten durch Staatsgewalt und Mehrheitsvolk – als ein für die freie Konkurrenz untaugliches und für die anständigen Konkurrenten gefährliches Kollektiv – ist im Folgenden Thema.
[5] So geht die Nationalgeschichte überhaupt los: Das erste untaugliche Kollektiv stellen bekanntlich die Indianer, die es auf dem Kontinent zwar zu einer Bevölkerung, aber nicht zu einer Eigentumsordnung bringen. Zwar leben sie auf amerikanischem Boden und benutzen ihn auch, aber sie haben ihn nicht zum Geldverdienen hergerichtet, sich ihn insofern auch nicht angeeignet. Sie sind daher rechtlose ‚Wilde‘ und werden von den eingewanderten Siedlern – mal mehr, mal weniger systematisch – vertrieben, ausgerottet. Für ein zivilisiertes Geschäftsleben mit den Produkten dieses herrenlos gemachten Bodens werden von Anfang an massenhaft schwarze Sklaven importiert, gezüchtet und gehandelt – ein von freien Eigentümern bewirtschaftetes Menschenkollektiv, dessen Mitglieder sich zwar für eine freie Landwirtschaft als außerordentlich nützlich erweisen, aber eben nicht als freie Konkurrenten. An deren Nützlichkeit für die Bereicherung ihrer Herren merken diese vor allem, wie sehr es der Natur der Schwarzen entspricht, das arbeitsame Eigentum freier Menschen zu sein. Eine aufschlussreiche Nebenrolle zur Zeit der amerikanischen Kolonien spielen die französischen Katholiken im Norden, durch die die geschäftstüchtigen und expansionsfreudigen amerikanischen Siedler sich in ihrem Freiheitsdrang gehemmt fühlen. Diese Figuren sind durchaus zu Eigentum und Geldverdienen fähig, sind also schon mal Menschen; zur Freiheit in Selbstbestimmung taugen sie aber nicht viel, setzen sie doch ihr ‚trust‘ nicht direkt in Geld und Gott, sondern zumindest Letzteres bloß vermittelt über einen fremden Despoten in Rom. Wenn also die britische Krone ihre amerikanischen Siedler, mit denen sie soeben einen großartigen Sieg über Frankreich im „Siebenjährigen Krieg“ auf dem nordamerikanischen Schlachtfeld eingefahren hat, allen Ernstes auf annähernd die gleiche Stufe stellt wie die Wilden, die Negersklaven und die französisch-kanadischen Sklavenchristen, indem sie die Gebiets- und Rechtsansprüche der diversen Untermenschen gegen die Ansprüche der Siedler auf fruchtbares Land und menschliches Arbeitsvieh durchsetzt, dann sehen die Siedler darin ihre eigene Degradierung zu Sklaven; und wenn ihnen obendrein immer mehr Steuern aufgedrückt werden, um eine stehende Armee zu finanzieren, die ihre Ansprüche beschneidet – dann ist offensichtlich eine amerikanische Unabhängigkeit fällig.
[6] Wenn Immigranten solche Zweifel ausdrücklich wecken wollen, dann versteht die amerikanische Staatsgewalt keinen Spaß. Die Gefahr ist zwar längst gebannt, aber in der goldenen Ära des industriellen amerikanischen Kapitalismus machen sich Kommunisten und Anarchisten in den industriellen Zentren des Landes störend bemerkbar: Sie lehnen Eigentum und freie Lohnarbeit ab und kritisieren das Geld, kennen somit keine Freiheit und keinen Gott. Mit ihren ‚unamerican activities‘ entlarven sie sich nicht bloß als Kinderfresser, sondern als unverbesserliche Fremde – nicht bloß metaphorisch: Nach einem Bombenanschlag im Zuge des „Haymarket Riot“ 1886 bringt ein scharfsinniger Journalist das Prinzip des amerikanischen Antikommunismus auf den Punkt: Einen amerikanischen Anarchisten kann es nicht geben. Der amerikanische Charakter enthält kein Element, das jemals für eine so verkehrte Nutzung gewonnen werden könnte.
(Public Opinion)
[7] Zum Beispiel wird nach dem ‚Chinese Exclusion Act‘ (1882) mit einem ‚National Origins Act‘ (1924) die jährliche Einwanderung auf 2 % der aus dem jeweiligen Land stammenden Bevölkerung in den USA beschränkt, was vor allem auf den Ausschluss unerwünschter Asiaten (aus China durften ca. 100 Menschen pro Jahr einreisen), Afrikaner sowie Süd- und Osteuropäer hinausläuft – und mehr oder weniger explizit dem Ziel dient, eine nord- und westeuropäische Mehrheitsbevölkerung zu bewahren. Der amerikanische ‚Nativismus‘ – vor dem auch Hitler nur seinen Hut ziehen konnte: Die amerikanische Union lehnt die Einwanderung von körperlich ungesunden Elementen kategorisch ab und schließt die Einwanderung bestimmter Rassen einfach aus.
(1925) – gegen Immigranten bestimmter Provenienz erlebt in dem Maße seinen Abstieg, wie die USA zur weltweit zuständigen imperialistischen Macht aufsteigen. Damit verwandelt sich das dominierende Selbstbild der Nation im Innern, in den Zeiten des Kalten Kriegs dann endgültig: Amerika wird von einem Land der ‚pilgrims‘, der weißen Protestanten auf der Suche nach selbstbestimmter Freiheit, zu einem Land der hard-working ‚immigrants‘, die aus aller Welt nach Amerika strömen und damit beweisen, wie universell das amerikanische Glücksstreben wirklich ist. Der mythische Gründungsort der Nation verlagert sich entsprechend von ‚Plymouth Rock‘, wo die ersten Pilgerväter 1621 an der Ostküste an Land gingen, nach ‚Ellis Island‘, jahrelang die zentrale Sammelstelle für Einwanderer aus der alten Welt. Damit werden auch die weißen Neger von gestern – die katholischen Iren und Italiener, Ost- und Südeuropäer – in das weiße Herrenvolk aufgenommen. Für die endgültige Wende in dieser Frage steht der irischstämmige Katholik und Kommunistenfresser im Dienste der amerikanischen Weltordnung, J. F. Kennedy. Mit dem ‚Immigration and Naturalization Services Act‘ (1965) schafft sein Nachfolger die oben erwähnte Zwei-Prozent-Regelung ab und ersetzt sie durch eine Deckelung der Immigration aus der östlichen Hemisphäre auf maximal 170 000, aus der westlichen Hemisphäre auf 120 000 Personen pro Jahr. In der Praxis läuft die Reform auf eine verschärfte Einschränkung der massenhaften mexikanischen Immigration hinaus, die man bis zu dieser Zeit im Rahmen eines Gastarbeiterprogramms für die Landwirtschaft erlaubt hat. Ab diesem Moment wird der rassenneutral benannte „illegale Immigrant“ zum neuen Feindbild, bei dem sich niemand darüber täuscht, dass die Mexikaner gemeint sind. Bei der Bewirtschaftung dieses Einwandererkollektivs pflegt der amerikanische Staat zwar im Prinzip ein kalkulierendes Verhältnis, stets abwägend zwischen dem Geschäftsbedarf der Landwirtschaft und der Dienstleistungsindustrie auf der einen Seite und einer gar nicht verhohlenen Sorge vor Überfremdung auf der anderen Seite. So richtig hat der amerikanische Staat das Hin und Her dieser Einwanderer aber nie unter Kontrolle gehabt. In der Frage kommt er allerdings gut voran – und es ist denkbar ungerecht von Trump, die einschlägigen Fortschritte für sich zu verbuchen, bloß weil er dauernd von der Mauer schwafelt. Obama, dessen Deportationsleistungen bislang unübertroffen sind, gönnt er einfach nichts. Siehe „Die USA streiten über ihre illegalen Ausländer: Wer ist eigentlich ein richtiger Amerikaner?“ in GegenStandpunkt 4-10.
[8] Ein Kernstück dieser Betreuung und zugleich das hauptsächliche Mittel der segregierenden Bevölkerungspolitik in den industriellen Zentren Amerikas besteht ab 1935 in der staatlichen Förderung von Wohneigentum. Der Zentralstaat subventioniert den Kauf von Häusern durch die Versicherung der einschlägigen Hypothekenkredite, macht so den Bau von Häusersiedlungen, Vororten und Kleinstädten für die Arbeiterklasse der Nachkriegszeit zu einem extrem profitablen Geschäft und ermöglicht damit die Schaffung dessen, was man nun als ‚Suburbia‘ kennt. Die Förderung gilt bis in die 1970er allerdings weder für schwarze Siedlungen – der Verweis auf das notorisch hohe Ausfallrisiko bei dieser besonderen Klientel steht in einem humoristischen Kontrast zu der Notwendigkeit der Subventionierung überhaupt – noch für weiße Siedlungen, falls Schwarze sich dort oder auch nur in der Nähe niederlassen. Deren schiere Anwesenheit, so die Begründung, senkt die weiße Nachfrage nach den dortigen Häusern, folglich auch deren Wert – in dem Fall erscheint dem Staat die Subventionierung armer Hausbesitzer definitiv als zu risikoreich, die Subventionierung integrierter Siedlungen auch als unzumutbarer Verstoß gegen die Freiheit der Weißen. Das Resultat dieser Wohnungspolitik, die unter dem Stichwort ‚red-lining‘ rückblickend skandalisiert wird: Der Staat verhilft der weißen Arbeiterklasse zu der erlesenen Sorte Wohlstand namens ‚middle class‘, die darin besteht, sich mit einem eigenen Haus im Rücken bis über beide Ohren verschulden zu können. Die Schwarzen in den urbanen Zentren werden in dicht besiedelte Ghettos gedrängt – dabei oft in sogenannten „public housing projects“ untergebracht, die Hip-Hop-Fans weltweit als „da projects“ kennen. Dort wohnen sie denkbar elend zur Miete, also ohne das häusliche Stück ‚Vermögen‘ bilden zu können, mit dem die anderen armen Amerikaner zu stolzen Bankkunden werden. Das ist nämlich – dies nebenbei – die wirklich große Leistung dieser staatlichen Subventionierung: Die auf Basis dieser staatlichen Förderung massenhaft vergebenen Hypothekenkredite werden zum Eckstein des tiefsten Finanzmarkts der Welt und eines weltweit getätigten, inzwischen berüchtigten Kreditgeschäfts.
[9] Zu dieser Bewegung siehe den Abschnitt III.2. in diesem Aufsatz.
[10] Siehe nochmals Zum Beispiel Ferguson: Rassismus in den USA – woher er kommt und warum er nicht weggeht in GegenStandpunkt 1-15, insbesondere den 4. Abschnitt „African Americans: die etwas andere Unterschicht“, S. 48 ff.
[11] Journalisten auf beiden Seiten des Atlantiks haben eine gewisse Kunst darin entwickelt, sich Vergleichsmaßstäbe einfallen zu lassen, die die Drastik der nackten Zahlen hervorheben. Hier ein Exemplar aus heimischen Gefilden: Afroamerikaner machen etwa 13 Prozent der Bevölkerung aus. In dieser Größenordnung liegt laut Studien auch ihr Anteil am Drogenkonsum und -handel. Doch die Polizei verhaftet ungleich mehr Afroamerikaner wegen Drogenvergehen... In den mehr als 7000 Gefängnissen der Vereinigten Staaten sind weit mehr als zwei Millionen Menschen inhaftiert. Das waren 2015 nach Angaben des damaligen Präsidenten Barack Obama etwa ein Viertel aller Häftlinge der Welt, obwohl in den Vereinigten Staaten weniger als vier Prozent aller Erdenbürger leben. Heute sitzen mehr Schwarze hinter Gittern, als es im Jahr 1850 Sklaven in dem Land gab. Alle drei Sekunden wird ein Amerikaner festgenommen, das summiert sich auf fast elf Millionen Festnahmen im Jahr. Für einen schwarzen Mann ist die Gefahr einer Festnahme fünfmal größer als für einen weißen. Noch unter Präsident George W. Bush prognostizierte das Justizministerium, dass jeder dritte männliche Schwarze, der im Jahr 2001 geboren wurde, irgendwann im Gefängnis landen würde.
(FAZ, 6.7.20)
[12] Sinngemäß: Was uns mit dem Stimmzettel nicht gegeben wird, müssen wir mit Gewehrkugeln holen.
[13] Der Polizei die Mittel entziehen!
resp. Die Polizei abschaffen!
[14] In dem Zusammenhang wird auf den offensichtlichen Unterschied in der Wahrnehmung von und dem Umgang des Staates mit dem schwarzen Drogenproblem und mit der ‚Opioid-Krise‘ gedrungen, die derzeit vornehmlich die weiße Bevölkerung heimsucht.