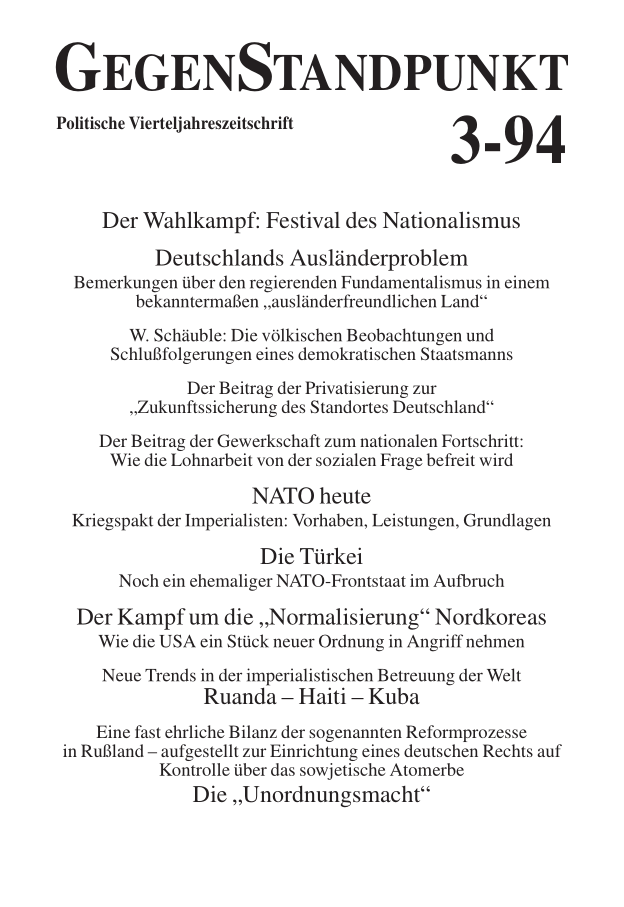NATO heute
Der Kriegspakt der Imperialisten:
Vorhaben, Leistungen, Grundlagen
Die Nato nach dem Zerfall der SU: Der Widerspruch einer Weltherrschaft im Kollektiv der imperialistischen Konkurrenten. Weltpolitische und strategische Gemeinsamkeiten und Differenzen bzgl. der Verteidigung Europas, der Neutralisierung Russlands, der Kontrolle Jugoslawiens und der weltweiten Kontrolle und Krisenreaktion. Die Berechnungen Amerikas und Deutschlands sind genauso komplementär wie widersprüchlich: Für die Amerikaner soll die Einbindung Europas eine „Versicherung gegen strategischen Macht- und Bedeutungsverlust“ sein. Für die Deutschen soll die Teilhabe an der kollektiven Weltmacht gerade das Mittel zu ihrer Instrumentalisierung und Emanzipation sein (WEU).
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
NATO heute
Der Kriegspakt der Imperialisten:
Vorhaben, Leistungen, Grundlagen
I. Die neue NATO: Der Widerspruch einer Weltherrschaft im Kollektiv der imperialistischen Konkurrenten
Die NATO ist ein Kriegsbündnis.[1] Zwar hat sie ihren Weltkriegsgegner verloren, deswegen aber noch lange nicht ihre Gründe, Krieg ins Auge zu fassen und gemeinsam vorzubereiten. Zu denen bekennt sie sich in Floskeln wie der folgenden:
„Wir begrüßen das neue Klima der Kooperation, das sich in Europa mit dem Ende der durch den Kalten Krieg verkörperten Periode weltweiter Konfrontation eingestellt hat. Wir müssen aber auch feststellen, daß andere Ursachen für Instabilität, Spannung und Konflikt entstanden sind. Wir bekräftigen daher die bleibende Gültigkeit und Unverzichtbarkeit unserer Allianz.“ (NATO-Gipfelkonferenz in Brüssel 1994, Bulletin Nr. 3/94, S.20)
Auf irgendeine, geschweige denn eine bestimmte Bedrohung von außen, gegen die sie bedingungslos zusammenhalten müßten, mögen sich die Bündnispartner nicht festlegen. Das käme ihnen wie eine viel zu begrenzte, bedingte und bedingungsweise Begründung ihres Zusammenschlusses vor. Damit dessen unbedingte „Unverzichtbarkeit“ zutage tritt, kennzeichnen sie die Gefahrenlage dermaßen allgemein, daß ein Verfallsdatum wegen Zweckerfüllung überhaupt nicht mehr absehbar ist. Das läßt auf der anderen Seite natürlich offen, ob, wie und in welchem Sinn es ihnen gelingen mag, sich auf die Identifizierung und kriegerische Behandlung irgendeines bestimmten Falles von „Instabilität, Spannung und Konflikt“ zu einigen. Doch davon gerade unabhängig bestehen sie grundsätzlich darauf, bei der Kriegsvorbereitung und beim Kriegführen gemeinsame Sache zu machen. Diesen Willen bekräftigen sie mit einer Gewaltideologie, die ihren Pakt – schon wieder, wie zu Zeiten des Kalten Krieges – als defensive Reaktion auf die Schlechtigkeit der Welt definiert.
Damit machen sich die Allianzpartner dann doch einer gewissen Tiefstapelei schuldig. Sie haben schon auch selber etwas vor auf der Welt; und zwar mehr, als bloß gemeinsam auf Krisen u.ä. zu reagieren, deren Ursachen „entstanden sind“. Was – das ist der Politik der NATO zu entnehmen.
Verteidigung Europas
Verteidigung war für die NATO schon immer mehr, als gegnerische Soldaten am Einmarsch ins Bündnisgebiet zu hindern. Im Rahmen ihrer „Vorwärtsverteidigung“ mit für den Gegner unkalkulierbarem offensivem Einsatz von konventionellen Kräften, taktischen und strategischen Atomwaffen hat die Allianz stets geplant und sich darauf vorbereitet, in die „Aufmarschzonen“ des Feindes „hineinzuwirken“ und in der Tiefe des gegnerischen Raumes Fronten zu eröffnen; nicht zuletzt in der Erwartung, die Bündnispartner des „Ostblocks“ wären auf diese Weise vom sowjetrussischen Hauptfeind abzuspalten. Diese ausgreifende Konzeption von Verteidigung entsprach der Bündnis-„Doktrin“ der „Abschreckung“, die für den vereinigten Westen auch schon immer etwas mehr enthielt als das Programm, dem Feind für den Fall eines Angriffs unannehmbar große Schäden in Aussicht zu stellen. Der „abschreckende“ Zwang zum Stillhalten, die Einschüchterung des Gegners war die unerläßliche militärische Absicherung und insofern die Grundlage für mannigfache Anstrengungen, politisch und ökonomisch in den feindlichen Block hineinzuwirken, ihn zu schwächen und zu zersetzen. „Verteidigung“ war, dem politischen Inhalt nach genommen, NATO-Jargon für die mit militärischen Drohungen bewerkstelligte Erpressung der Sowjetmacht, auf weltpolitische „Abenteuer“ zu verzichten, sich zurückzuziehen und den Westen in ihre Parteiherrschaft und Planwirtschaft hineinregieren zu lassen. Daß die Sowjetunion sich dazu im Laufe der „Entspannungs“-Ära immer positiver gestellt hat, weil sie in zivilen Beziehungen eine Friedens- und insofern, völlig verkehrterweise, für sich eine Bestandsgarantie sehen wollte, nimmt vom erpresserischen Charakter der mit „Wettrüsten“ untermauerten „Abschreckung“ nichts weg, beweist vielmehr, wie gründlich die politische Offensive gewirkt hat – bei dermaßen friedens- und anerkennungssüchtigen Kontrahenten wie den Kreml-Sozialisten.
Nun hat die „Abschreckungspolitik“ über jede vernünftige Erwartung hinaus ihre Wirkung getan. Nicht zuletzt aus Hoffnung auf eine friedenssichernde westliche Existenzgarantie hat die Sowjetmacht selbst ihre eigene Existenz zunehmend zur Disposition gestellt; am Ende zur Disposition neuer Nationalisten, die das ganze „Lager“ und seine Hauptmacht selbst aufgelöst haben. Für die NATO ist damit ihre überkommene Strategie an ein Ende gekommen; ihre Kalkulation mit der taktische und strategische Atomwaffen einschließenden „Triade“ erübrigt sich. Was bleibt, ist die atomare Abschreckung im engeren Sinn einer letzten Garantie für die Sicherheit, die strategische Herausgehobenheit des unter den „Atomschirm“ der USA gestellten Bündnisgebiets. Von da aus gilt es nun das militärisch nicht mehr definierte Gebiet östlich davon unter Kontrolle zu nehmen: Was in der alten „Verteidigungs“-Konzeption als „Vorfeld“ und „Aufmarschraum“ des Feindes zu kalkulieren war, muß – und kann nun als eigene äußere Sicherheitszone, mehr noch: als Zuwachs an befreundeten Kräften verbucht und eingeordnet werden.
Denn es ist ja nicht bloß einseitiger Anspruch der NATO, daß die nationalistisch erneuerten osteuropäischen Staaten sich auf die westliche Weltmacht hinorientieren und als deren Anhängsel einstufen lassen, kaum daß sie ihre nationale Emanzipation vom „sozialistischen Völkergefängnis“ zustandegebracht haben. Diese Staaten selbst definieren sich als sicherheitspolitische Interessensphäre der NATO-Mächte und wollen keine andere nationale „Sicherheitsidentität“ für sich gelten lassen. Die NATO muß weder drohen noch werben, um jedes gewünschte „Wohlverhalten“ der Osteuropäer zu erreichen; sie sieht sich lauter dringlichen Anträgen aus ihrem eurostrategischen östlichen Vorfeld gegenüber, das Vor- zum voll integrierten Hauptfeld der europäischen NATO aufzuwerten. Es ist an der Allianz, diesen Ansturm zu bremsen und Zwischenstufen der immer engeren Kooperation und Einbindung einzuschieben, bevor sie den Nachbarn im Osten den Übergang vom Außenposten zum mitentscheidungsbefugten Subjekt ihres Verteidigungssystems für Europa gewährt. Die NATO sieht da nämlich die Gefahr, undifferenzierte und unbesonnene Erweiterung könnte ihre wohlerworbene „Sicherheitsidentität“, ihre Einigkeit in der Definition eines militärischen Sanktuariums und darauf bezogener strategischer Vorfelder, verwässern und womöglich auflösen. Sie stellt die mannigfachen noch unausgetragenen Konflikte der östlichen Kandidaten in Rechnung sowie das „Problem Rußland“.[2] Entsprechend umständlich arbeitet sich das Bündnis daher auf das rein von ihm her definierte Ziel hin, den national befreiten Staaten im Osten im Zuge ihres militärischen Um- und Neuaufbaus jede strategische Selbständigkeit und nationale Verteidigungskalkulation zu nehmen und sie funktionell in ein militärisches Gesamtsystem einzufügen. In dem sollen dann alle Armeen auf europäischem Boden ein und demselben Auftrag dienen: „Europa“ zu garantieren.[3]
Mit dieser Perspektive sind die ehemaligen „Satelliten“ der Sowjetunion in den NATO-Kooperationsrat aufgenommen worden, werden im Rahmen der „Partnerschaft für den Frieden“ einzeln je nach ihrer Fähigkeit, also Nützlichkeit für die Brüsseler Sache an die NATO angebunden und haben sich nach deren Vorgaben zu „entwickeln“.[4] Die Allianz kommt ihnen mit allen möglichen Unterstützungs- und Beratungsangeboten entgegen, stellt sich auch schon auf gemeinsame Unternehmungen ein, baut dafür bei sich selber passende Strukturen auf und geht bereits die ersten gemeinsamen Manöver an.[5]
Diese „Fortschreibung“ der NATO-„Vorneverteidigung“ entspricht den Fortschritten der Sache, die die Allianz in Europa zu schützen hat. Im Osten des Kontinents ist an die Stelle der Herrschaft einer realsozialistischen Partei, deren Gewaltmonopol es nach Kräften zu zersetzen galt, über Nationalökonomien, die der Freiheit kapitalistischen Zugriffs verschlossen blieben und nur am Rande auszunutzen, zu stören und zu verändern waren, flächendeckend die Doktrin des freiheitlichen Kapitalismus getreten. Bzw. genauer: die Staatsräson des katastrophenmäßigen Umsturzes aller vorhandenen ökonomischen Beziehungen mit dem noch fernen Ziel, durch Teilhabe am Weltmarkt eine nationale kapitalistische Akkumulation in Gang zu bringen. Die Staaten des erfolgreichen Kapitalismus brauchen diesen Menschheitsfortschritt bloß mit ebenso dämlichen wie ruinösen Ratschlägen zu betreuen, müssen nur gelegentlich mit handels- und finanzpolitischen Erpressungen gegen sozialfürsorgerische Abweichungen vom Grundsatz der vorbehaltlosen Auslieferung an den Weltmarkt vorgehen, sehen sich noch nicht einmal ernstlich zu so etwas wie „Kapitaltransfer“ herausgefordert: Ihre östlichen Nachbarn haben sich ganz von selbst dem Grundsatz verschrieben, ihr ökonomisches Dasein völlig vom Interesse des kapitalistischen Weltgeschäfts an ihren Ländern abhängig zu machen. Insofern gibt es definitiv keine Alternativen mehr „abzuschrecken“; die Nachbarn diesseits der GUS haben sich mit ihrem neuen Nationalismus eine so noch nie dagewesene Art von „passivem Imperialismus“ zugelegt.
Dennoch stehen die NATO-Staaten auf dem Standpunkt, daß die weltmarktwirtschaftliche Staatsräson der ehemals sozialistischen Staaten mehr Sicherheit braucht als die Entschlossenheit ihrer Regierungen, keine Alternativen kennen zu wollen. Schließlich tun die politischen Ökonomen des Westens nichts dazu, damit aus den ruinösen Umstellungsbemühungen ihrer östlichen Kollegen eine kapitalistische Erfolgsgeschichte wird, im Gegenteil: Die Geschäftswelt nutzt, was zu nutzen ist, unterbricht so, was noch an Arbeitsteilung funktioniert, und weiß nichts von „Entwicklungshilfe“; die in eigene nationale Konkurrenzoffensiven verstrickten Politiker des Westens reklamieren Einfluß, begrüßen alle Bemühungen, die von ihren Nationalbanken herausgegebenen Devisen zu verdienen und Schulden zu bedienen, haben aber auch nichts zu verschenken, schon gar keine nationalen oder europäischen Marktanteile. Von da her sind alle Bedingungen dafür gegeben, daß die Staatsdoktrin der „Systemtransformation“ scheitert und in offenen Widerspruch tritt zum erneuerten Nationalismus dieser Staaten, der – vorläufig noch – keinen anderen Erfolgsweg kennen will. Insofern ist auf die Stabilität dieser Staaten nicht allzuviel Verlaß; um so weniger, als den regierenden Nationalisten des Westens all die Übergänge zu einer Politik der sittlich-moralischen Schadloshaltung an dem einen oder anderen schon immer hinderlich gewesenen Ausland geläufig sind, auf die sich ihre Kollegen aus dem „Völkergefängnis“ auch ganz von selbst verstehen. Für die NATO in ihrer Vorsorglichkeit ist das jedenfalls Grund genug, um Vorkehrungen gegen „Instabilität, Spannung und Konflikt“ zu treffen.
Und zwar die denkbar weitgehendsten; schließlich geht es um Garantien für politökonomische Beziehungen, die ihrerseits über Außenhandelskontakte zwischen autonomen Staaten grundsätzlich hinausgehen, nämlich ganze Volkswirtschaften zu Anhängseln auswärtiger Geschäftsinteressen machen. Man will sich daher gar nicht erst Problemfälle einhandeln, die man dann mit Gewalt auf die Linie der europäischen Räson bringen muß. So versucht die NATO, alles, was die östlichen Reformstaaten als Militärmächte noch oder jemals wieder darstellen, unter die Mechanismen eines gesamteuropäischen Kontrollsystems zu subsumieren: Es soll gar nicht dazu kommen können, daß ein abweichender Nationalismus in diesen Ländern eine frei verfügbare nationale Macht findet, die er ergreifen könnte, oder daß eine freischwebende nationale Macht sich berufen fühlt, das nationale Wohl anders, „Europa“-feindlich zu definieren.[6]
So verwirklicht die NATO ihr Ideal von europäischer Sicherheit: In Gestalt eines supranationalen Systems der militärischen Kooperation will sie nichts geringeres garantieren als die Unmöglichkeit, daß Mitgliedsstaaten aus der Disziplin der politischen Ökonomie des Kontinents und der dazugehörigen politischen Verhaltensregeln ausscheren. Natürlich stellt sich die Frage, gegen wen sich dieses europaweite Verteidigungswesen richtet. Es gibt auch NATO-Politiker, die sie aufwerfen, um sie mit dem einzigen Gedanken zu beantworten, den sie zeit ihres politischen Lebens gefaßt haben: gegen die Russen.[7] Und natürlich treffen sie damit mehr als eine alte Angewohnheit der Allianz: Deren Kontrollbedürfnis einschließlich des defensiven Moments der Gefahrenabwehr ist nach wie vor hauptseitig nach Osten gerichtet; sie rechnet damit, Kriege im und Übergriffe aus dem Bereich der ehemaligen Sowjetunion niederhalten oder auch vorsorglich-„humanitär“ dort eingreifen zu müssen, und stellt sich darauf ein. Diese „Gefahr“ steht allerdings nicht mehr auch nur annähernd so im Zentrum der Bündnisstrategie wie bislang die „sowjetische Bedrohung“. Die NATO plant und disponiert inzwischen noch viel offensiver imperialistisch: Wenn sie im Osten Europas „Raum“ okkupiert, und zwar in der Größenordnung ganzer Nationen, dann nicht primär unter dem beschränkten defensiven Aspekt des strategischen Vorfelds gegen einen Feind, an dem sie sich und ihre ganze Politik ausrichten würde, sondern unter dem Gesichtspunkt eines abzusichernden Besitzes, eines Umfelds, in dem garantiert alles ihr zuarbeitet, den ökonomischen Interessen ihrer Mitglieder ebenso wie ihren eigenen quasi internen, auf den eigenen Bereich bezogenen Kontrollbedürfnissen.[8]
Damit stehen sie aber, und das ist das Bemerkenswerte, nicht bloß vermeintlich, sondern wirklich in einer gewissen Opposition zu dem Vereinnahmungskonzept, das der neuen Europapolitik der NATO und ihrer „Partnerschaft für den Frieden“ zugrundeliegt.
Neutralisierung Rußlands
Für die ehemaligen Ostblockstaaten deckt sich ihre nationale Emanzipation deswegen mit ihrer Unterordnung unter die NATO, weil ihr Nationalismus sich gegen die alte sozialistische Führungsmacht richtet[9] und sich deswegen durch Rußland bedroht sieht, ganz gleich, ob die russische Regierung tatsächlich Ansprüche auf oder auch nur an sie erhebt – derzeit hält sie ja noch nicht einmal die Nachbarn beisammen, mit denen Rußland bis neulich noch eine Großmacht gebildet hat. Mit dem Standpunkt der NATO fällt diese Frontstellung nicht ganz zusammen. Der ist komplexer.
In den Nachfolgestaaten der Sowjetunion hat der Westen politische Gebilde vor sich, die für ihre Nationalökonomie und ihren inneren Aufbau genauso wie die anderen osteuropäischen Länder nur eine Staatsräson kennen: die der Unterwerfung unter die Maxime des Geldverdienens, unter westliche Devisen als einzig wahres Geld und unter die den Weltmarkt beherrschenden Bedingungen des Geschäftemachens. Auch und erst recht aus Rußland & Co macht der gute Wille aber noch keine brauchbaren Partner. Und noch ganz anders als bei seinen nähergelegenen östlichen Nachbarn rechnet der Westen bei Rußland auch auf lange Sicht mit bleibender ökonomischer Unbrauchbarkeit und Unintegrierbarkeit. Zwar kennt man interessante ökonomische Potenzen in dem großen Gebiet. Dazu zählt aber nichts von dem, was die Sowjetmacht dort an Industrie aufgebaut hat – atomare Brennstoffkreisläufe, Flugzeugfabriken, Weltraumbahnhöfe immerhin –; höchstens unter dem Interesse, davon auszuschlachten, was geht. Ein paar westliche Großprojekte zur Erdgasgewinnung gibt es, so wie andernorts im Urwald oder im offenen Meer: Von so armseliger Art ist der Nutzen, der aus Rußland kapitalistisch herauszuholen ist – und um dessen Monopolisierung sich gleich schon wieder die Konkurrenten aus dem Westen streiten. Den wirtschaftlichen Ruin Rußlands und seiner GUS-Partner aufhalten, ihn auch nur bremsen helfen, geschweige denn aus dieser Gegend eine entwicklungsfähige Domäne des EU-Wirtschaftsraums machen, das kommt für die Heimatländer des kapitalistischen Erfolgs nicht in Frage.
Schon von da her stellt sich für die NATO also gar nicht die Aufgabe, die sie im nähergelegenen Osteuropa sieht: der Ausdehnung der ökonomischen Interessens- und Zugriffssphäre der kapitalistischen Gemeinschaft die Absicherung durch militärische Integration folgen zu lassen. Stattdessen hat die Allianz mit dem Rechtsnachfolger ihres alten Feindes ein viel schwierigeres Problem: Sie trifft dort auf eine nicht beherrschbare Mischung von militärischer Macht und staatlicher Ohnmacht.
Das eine ist Rußlands Militärmacht, die auf alle Fälle viel zu groß ist, um in die Ordnungsstrategie des Westens problemlos vereinnahmt werden zu können; zumal sie nach wie vor das zweitgrößte Nuklearwaffenarsenal der Welt besitzt. Zwar ist die Staatsführung auch in strategischen Fragen extrem gutwillig; was sie überhaupt an eigenen außen- und sicherheitspolitischen Interessen zustandebringt, hat keinerlei antiimperialistischen Inhalt, sondern geht auf „Kooperation“ um jeden Preis; umgekehrt hat kein NATO-Staat ein Interesse daran, Rußland wieder zum Hauptfeind aufzubauen, geschweige denn die eigene Weltpolitik an einer solchen Konfrontation auszurichten. Deswegen hat die NATO auch ihren Kooperationsrat mit den Ost-Staaten einschließlich Rußlands eingerichtet und den Russen wie allen anderen Zusammenarbeit im Rahmen der „Partnerschaft für den Frieden“ angeboten. Sie hat aber auch keinen Zweifel daran gelassen, daß ein Einschluß der russischen Militärmacht in das europäische Sicherheitssystem unmöglich ist. Selbst wenn die Russen alles mitmachen, würden sie alle inneren Proportionen des europäischen NATO-„Pfeilers“ sprengen und die dort herrschende militärische Hierarchie über den Haufen werfen.
Zu dieser Gefahr kommt es allerdings gar nicht erst, weil Rußland überhaupt nicht bereit ist, sich einen Status irgendwo zwischen Polen und der Türkei anweisen zu lassen. Es fühlt sich militärisch noch allemal stark genug und nimmt sich wichtig genug, um der europäisch-amerikanischen Allianz als eigenständiges weltpolitisches Subjekt mit autonomen Ordnungsvorstellungen, zumindest für die GUS, und mit den Mitteln zu deren souveräner Durchsetzung gegenüberzutreten. Das hat die NATO an den russischen Widerständen gegen eine sofortige Erweiterung der Allianz bis an die Westgrenze der GUS klar erkannt; den gleichzeitigen Moskauer Anträgen auf Vollmitgliedschaft im Pakt hat sie dieselbe Absicht entnommen, sich nicht einzuordnen, vielmehr ein Gegengewicht zur alten Allianz in die Allianz selbst einzubringen und so am Ende den Bündniszusammenhalt aufzulösen. Mit seinem Widerstreben gegen das „Angebot“, sich strategisch und militärisch mit dem Status eines „PfP“-Partners unter einigen 20 anderen zufriedenzugeben, hat Rußland schon wieder seine fehlende Bereitschaft erkennen lassen, sich und seine Militärmacht auf eine handliche Größenordnung zurückzunehmen; für seine Bereitschaft mitzumachen hat es sich die formelle diplomatische Anerkennung eines Sonderstatus ausgehandelt – was immer der praktisch bedeutet. Der politische Wille und die militärische Masse Rußlands verhindern somit seinen Einbau in eine NATO-Ordnung, die seinen Nationalismus in seinen Machtmitteln auf die Bündnisräson festlegen und an Brüsseler Vorgaben fesseln könnte.
Dieses Sicherheitsproblem kann die NATO zwar nicht beseitigen; sie weiß aber damit umzugehen. Sie bringt ihr altvertrautes Repertoire an Drohungen und erpresserischen Angeboten zur Anwendung und knüpft dabei sogar ein wenig an ihre alte ostpolitische „Arbeitsteilung“ an. Russische Ansprüche auf ein eigenständiges strategisches Mitspracherecht in und über Europa – etwa vermittels der KSZE – werden strikt zurückgewiesen, sei es mit oder ohne diplomatische Verbeugung vor der bedeutenden Größe und großen Bedeutung des eurasischen Landes.[10] Gegen russische Einwände, einen NATO-Beitritt der früheren „Satelliten“ des Warschauer Pakts betreffend, hat die NATO die Sprachregelung aufgebracht, Moskau maße sich damit ein Veto-Recht in inneren Angelegenheiten der Allianz an; der ergänzende Vorwurf des Rückfalls in „altes“ Block- und Konfrontationsdenken ist unschwer als die Drohung zu entschlüsseln, fortgesetzten Bemühungen der Russen um Einfluß westlich ihrer Grenzen mit westlicher Konfrontationspolitik zu begegnen.[11] Die BRD begleitet diese Politik mit einer Diplomatie der betonten Freundlichkeit, setzt sich für Jelzin als Dauergast bei den G7-Treffen ein, setzt wohl auch am meisten von allen kapitalistischen Nationen auf die Möglichkeit, aus Rußland eine Art zuverlässiges, schuldendienstfähiges slawisches „Entwicklungsland“ zu machen; so bemüht man sich, den russischen Nationalismus zu beschwichtigen, für den der „Weg nach Westen“, den das Land eingeschlagen hat, unweigerlich in Verdacht geraten muß, ein nationaler Irrweg zu sein. Umgekehrt betonen die Amerikaner die Wohlverhaltensregeln, denen das Land sich unterwerfen muß, um weltpolitisch überhaupt geschäftsfähig zu bleiben; offensiv bestreiten sie russische Rechte bezüglich der anderen ehemaligen Sowjetrepubliken, weisen die Moskauer „Doktrin des Nahen Auslands“ zurück und tun offenbar in Kiew und anderswo auch einiges für eine entsprechende politische Linie bei Rußlands Nachbarn.[12]
Alle diese Initiativen, Rußland auf den Status einer beherrschbaren Außenregion jenseits von Europa zurückzuschneiden, tun zwar in Moskau ihre Wirkung; aber diese Wirkung ist noch aus einem ganz anderen Grund als wegen der Unhandlichkeit des russischen Nationalismus und der Menge seiner Mittel äußerst beschränkt: Sie reicht über die Absichten des guten Präsidenten Jelzin und seiner Mannschaft nicht so recht hinaus. Deren Machtlosigkeit ist das Problem; denn die besten Klarstellungen verfangen nicht, wenn der einsichtige Partner sich gar nicht ordentlich durchsetzen kann in seinem Land. Mittlerweile muß die NATO registrieren, daß ein Armeegeneral, den der Präsident abberufen will, sich einfach nicht absetzen läßt, weil er, seine Offiziere und übrigens auch die Russen in Moldawien, wo er den Befehl innehat, eine starke bewaffnete Schutzmacht fürs russische Volk wichtiger finden als Papiere aus der Moskauer Staatskanzlei – ein Indiz mehr, daß die ehemals Rote Armee weiter in quasi-autonome Bestandteile zerfällt. Die NATO muß sich sorgen, daß aus russischen Rüstungs- und Atom-Fabriken unkontrolliert Atomenergie freigesetzt wird. Denn egal, ob deutsche Geheimdienste den Handel mit Nuklearwaffen-Rohstoff abgefangen oder womöglich überhaupt erst inszeniert haben: Es zeigt sich daran drastisch, was sich der Westen mit der von ihm begrüßten, verlangten und unterstützten „Liberalisierung“ des Sowjetsystems eingehandelt hat. Jetzt ist die Zersetzung der Staatsmacht so weit vorangekommen, daß die westlichen Rußlandpolitiker gar keine ordentliche Adresse für ihre Ultimaten mehr finden. Solche „Entwicklungen“ lassen die NATO immer mehr um die Abrüstungsvereinbarungen fürchten, die sie mit den einst regierenden Kommunisten zu ihrer Zufriedenheit ausgehandelt hatte – nicht nur, weil neurussische Nationalisten sie womöglich kündigen, sondern weil die Macht fehlt, die ihre Erfüllung garantiert.[13]
Die Allianz reagiert auf diese horrende „Instabilität“ mit den Mitteln, über die sie als Militärpakt verfügt: Sie mahnt bei der russischen Regierung wirksame Kontrollen an, fordert vom Präsidenten Durchsetzungsfähigkeit, läßt deutsche Minister und andere Experten in Moskau Druck machen, verlangt von dem Land, das nach ihrem idealen Drehbuch zugrundegegangen ist, gebieterisch eine intakte politische Macht, die ein Mindestmaß an brauchbaren Verhältnissen gewährleistet, und kommt mit alldem doch nicht darüber hinweg, daß eine machtlose Regierung schlecht zur Souveränität zu erpressen ist.
Zumal es andererseits ja nicht bloß nicht in der Macht der NATO steht, den Russen eine souveräne Obrigkeit zu spendieren, sondern auch überhaupt nicht in ihrem Programm. Denn neben all ihren Sorgen um die definitive Unregierbarkeit Rußlands treibt die Allianz ihr Geschöpf im Kreml immer weiter voran auf dem Weg ruinöser „Reformen“, verbittet sich den Einsatz von Gewalt zur Wiederherstellung von ein paar Kooperationsbedingungen in der GUS, bekämpft eigenmächtige Stabilisierungsversuche als „Rückfall“. Und vertieft so ihr eigenes imperialistisches Dilemma. Ihre letzte Antwort darauf ist dann endgültig die einzig bündnisgemäße: Der Kriegspakt sieht sich vor.[14] Insofern ist seine strategische Interessenlage am Ende dann doch ziemlich deckungsgleich mit der Russenfeindschaft seiner neuen östlichen Kooperationspartner – die freilich aufpassen müssen, daß sie nicht doch noch so heillos kaputtgehen, daß sie selber zu nicht mehr handhabbaren Problemfällen werden.
Kontrolle Jugoslawiens
Noch bevor sie ihr System der militärischen Einordnung Osteuropas auf den Weg bringen, geschweige denn fertigstellen konnte, hat die NATO es mit dem praktischen Problemfall zu tun bekommen, daß ein staatliches Zerfallsprodukt der alten europäischen Ordnung mit Waffengewalt seinen eigenen Weg probiert: Jugoslawien hat sich nicht einfach friedlich in handliche Kleinstaaten zerlegt, dem politökonomischen Umkreis der EU eingefügt und aus Brüssel eine neue nationale „Sicherheitsidentität“ abgeholt, sondern in Staatsgründungskriege verstrickt; die Serben führen einen Kampf um ihre nationale Zuordnung. Sie fordern damit die Herren der Neuordnung des alten Kontinents in ihrer exklusiven Ordnungsbefugnis heraus und werden mit ihrem Bürgerkrieg von außen auf eine Weise betreut, daß die Schlächterei sich in die Länge zieht. Denn die NATO-Mächte behalten sich die „Konfliktlösung“ vor, verhindern autonome Siege und Niederlagen und bringen die Sache selber nicht zum Abschluß.
Der Grund für dieses einstweilen offene Ende liegt darin, daß die selbsternannten Ordnungsmächte sich in dem einen entscheidenden Punkt einig sind: Die Kompetenz, Europas nationalstaatliche Arrangements zu verändern, liegt exklusiv bei ihnen. Folglich wird zwischen Ihnen ausgehandelt, wie mit Abweichungen und Eigenmächtigkeiten umzugehen ist. Und damit steht unausweichlich die viel höhere und wichtigere Streitfrage zur Entscheidung an, welche der Europa beherrschenden Nationen sich im Kreis ihrer Verbündeten durchzusetzen vermag. Die Einigkeit bei der Wahrnehmung der Regelungskompetenz, die nur deswegen so fraglos bei den NATO-Partnern liegt, weil diese zu einem konkurrenzlosen Pakt zusammengeschlossen sind, ist logischerweise der erste Gegenstand einer ordnungspolitischen Konkurrenz zwischen ihnen; und weil es im jugoslawischen Bürgerkrieg um wirkliches gewaltsames Eingreifen geht und nicht „bloß“ um dessen umfassende Vorbereitung, sind die Alliierten in ihrem Konkurrenzkampf hier ein gutes Stück vorangekommen. Sie haben die Klärung erreicht, daß es in solchen Ordnungsfragen auch dann, wenn die Westeuropäer sich zuerst einmal als EU das entscheidende Eingreifen vorbehalten, ohne die USA doch nicht geht. Sie haben die Erfahrung gemacht, daß ihr internes Ringen um die Richtlinienkompetenz beim gemeinsamen Vorgehen den Russen die Gelegenheit bieten kann, sich als zwar konstruktiver, aber autonomer Dritter ins Spiel zu bringen, ohne den eine definitive Entscheidung über die neue politische Landkarte des Balkan dann so leicht auch nicht mehr zu haben ist. Sie haben darüber zu gemeinsamer Aktion gefunden, und zwar in ihrer Eigenschaft als NATO; in deren Rahmen organisieren sie die Einhegung des innerjugoslawischen Kriegsgeschehens, seine Beschränkung auf begrenzte Kämpfe am Boden, und haben mittlerweile auch schon gegen serbische Unbotmäßigkeit zugeschlagen. Daß die NATO diese Rolle spielt, hat sich zwar keineswegs von Beginn an von selbst verstanden; die zunächst in anderen Eigenschaften aktiven NATO-Mächte haben ihren Pakt dann aber doch als die Körperschaft betätigt, also bestätigt, die neben ihrer fortdauernden Konkurrenz für das Maß an kollektivem militärischem Eingreifen zuständig ist, auf das sie sich einigen können, um der kollektiven Ordnungsmacht den nötigen Respekt zu verschaffen, um die es ihnen schließlich zu tun ist in ihrem Streit um das entscheidende letzte Wort.
Das Bündnis als solches kann somit einen bedeutenden Erfolg verbuchen: Es hat – endlich, in seinem fünften Jahrzehnt! – seine militärische Handlungsfähigkeit bewiesen und – wie in Brüssel nicht ohne Stolz hervorgehoben wurde – seine ersten Abschüsse feindlicher Kräfte zustandegebracht.[15] Natürlich sind diese Einsätze die Reaktion auf das bosnische Kriegsgeschehen; und doch ist das nicht die Wahrheit über die NATO-Aktion: Es ging, übrigens erklärtermaßen, darum, am Fall der unermüdlich weiterkämpfenden post-jugoslawischen Vaterlandsfanatiker die Ordnungsgewalt über Europa praktisch anzuwenden, die die Allianzpartner prinzipiell für sich in Anspruch nehmen und mit der sie den Kampf gegen jeden unbefriedigten europäischen Nationalismus aufnehmen, der aus der Reihe tanzt.
Krisenreaktion weltweit
Auch von außerhalb Europas sieht die NATO „Instabilität, Spannung und Konflikt“ auf sich zukommen, denen sie mit ihrer kombinierten Militärmacht begegnen muß:
„In der Wahrnehmung unserer gemeinsamen transatlantischen Sicherheitserfordernisse wird die NATO zunehmend aufgefordert werden,[16] Aufträge durchzuführen, zusätzlich zur traditionellen und grundlegenden Aufgabe der kollektiven Verteidigung ihrer Mitglieder, die eine Kernfunktion bleibt. Wir bekräftigen unser Angebot, von Fall zu Fall in Übereinstimmung mit unseren eigenen Verfahren[17] friedenswahrende und andere Operationen unter der Autorität des VN-Sicherheitsrats oder der Verantwortung der KSZE zu unterstützen…“ (Erklärung der Staats- und Regierungschefs der NATO im Januar in Brüssel, Bulletin Nr.3/94, S.20f.)[18]
Räumliche Schranken ihrer Einsatzbereitschaft definiert die NATO nicht; die Partner eröffnen insoweit einander die Möglichkeit, sich wechselseitig über den Bündniszusammenhang für Unternehmungen in Anspruch zu nehmen, die sie von ihrer nationalen Rechnung her für fällig halten – wo auch immer. Denn grundsätzlich erklärt das Bündnis seine weltweite Zuständigkeit für stabile Verhältnisse.
Auch dieser Standpunkt ist durchaus nicht neu. Zwar hat die NATO in der Konfrontation mit der Sowjetmacht „bloß“ das Gebiet der Bündnispartner und den Atlantik nördlich des nördlichen Wendekreises unter ihren unbedingten Schutz gestellt; schon die Luftüberwachung Bosniens gilt als – erster – Einsatz „out of area“.[19] Die „Abschreckung“, die von diesem auch schon nicht bescheiden dimensionierten Gebiet 40 Jahre lang ausging, war aber immer auf einen globalen Gegensatz bezogen, auf einen Welt-Krieg gemünzt, selber schon als „kalter Krieg“ um Sieg oder Niederlage im Weltmaßstab, als Ringen um die Weltmacht gemeint. In dem Sinne wurde, nach einem geflügelten Wort der 60er Jahre, „die Freiheit Berlins in Vietnam verteidigt“, und das war sogar bloß die uninteressantere Hälfte des grenzenlosen „Ost-West-Konflikts“. Mit der Bedrohung, die die NATO in Europa gegen die Ostblock-Partner und das europäische Kernland der Sowjetunion aufgebaut hat, ist umgekehrt die Konfrontation aufgemacht worden, die den gesamten Rest der Staatenwelt vor die alles entscheidende Alternative „Freiheit oder Sozialismus“ – nämlich: gemeinsame Sache mit dem Imperialismus des vereinigten Westens oder Abhängigkeit von der Sowjetunion – gestellt hat. In Europa und von Europa aus hat die NATO der übrigen Welt ihre strategische Lage zudiktiert – und damit die entscheidende Grundlage für 40 Jahre „Weltordnung“ geschaffen. Was immer es warum auch immer an „Instabilität, Spannung und Konflikt“ gab, war als Teil des großen Ringens und Front in der universellen Bekämpfung des sowjetischen Störenfrieds definiert; und dementsprechend wurde gehandelt: unterstützt oder zugeschlagen, ein Putsch in Auftrag gegeben oder eine Opposition abgeschlachtet usw. Im Zeichen der großen Konfrontation war grundsätzlich jeder Staat samt inneren Verhältnissen im guten oder bösen Sinn Gegenstand eines weltpolitischen Interesses und entsprechender Betreuung; Waffen und Gelder, die unerläßlichen Lebensmittel staatlicher Gewalt, wurden nötigenfalls verschenkt – so daß unter wohlmeinenden Menschen für zwei bis drei Jahrzehnte sogar die Ideologie aufkam, der Westen unterstützte dritte Staaten dabei, zu kapitalistisch ebenso erfolgreichen Gebilden zu werden wie er selbst, und leistete „Entwicklungshilfe“.
Daß es den sowjetischen Feind nicht mehr gibt, hat die NATO auch in dieser Hinsicht von einer gewaltigen Last befreit: Sie braucht den Rest der Welt nicht länger vor dem Kommunismus zu schützen. Rechte Erleichterung schafft dieser Erfolg allerdings nicht. Denn kaum ist die „Gefahr aus dem Osten“ erledigt, stellt sich auch schon heraus, daß sie die Notwendigkeit für die kapitalistischen Führungsmächte, sich strategisch und mit Waffengewalt um die vielen nachgeordneten Mitglieder der Völkerfamilie zu kümmern, gar nicht geschaffen hat. Die abschreckende Bekämpfung des „Weltkommunismus“ hat dieses Kontrollbedürfnis mit einbegriffen, politisch definiert und gewissermaßen nebenher miterledigt. Nach dem Abtritt des großen Gegners bleibt die Aufgabe, alle anderen Souveräne den Richtlinien einer von den westlichen Metropolen entworfenen Weltfriedensordnung zu unterwerfen, erstens bestehen; zweitens stellt sie sich ganz anders als bisher. Und zwar sowohl nach der Seite der aufsichtführenden imperialistischen Subjekte, die sich ihr Kontrollbedürfnis nun ohne den alles subsumierenden Weltgegensatz politisch zurechtdefinieren und mit passendem Aufwand und befriedigendem Ertrag erfüllen müssen, als auch nach der Seite jener Kräfte und Mächte, die der Einweisung in eine Weltordnung ohne sowjetische Gegenmacht bedürfen.
Fest steht dabei erstens der politökonomische Inhalt des Weltfriedens, den die NATO-Mächte beaufsichtigen wollen: Es geht um die Indienstnahme der restlichen Staatenwelt für Geschäfte, um deren Erträge sich nicht bloß die Kapitalisten streiten, die sie machen, sondern auch die wenigen Staaten – in Westeuropa, Nordamerika und Fernost –, deren Geld dadurch zu Weltgeld wird. Fest steht zweitens ganz abstrakt und grundsätzlich, daß diese politische Ökonomie Schutz durch überlegene militärische Gewalt braucht, und zwar prinzipiell, d.h. ohne daß sich irgendwo eine umstürzlerische Bedrohung rührt. Nicht mehr fest steht jedoch, was sich da rührt und bewaffneter Kontrolle bedarf. Es ist ja ersatzlos außer Kraft gesetzt, was den Souveränen dieser Welt als „Lage“ vorgegeben war und für die Ausrichtung ihrer politischen Motive an dem einen großen Entweder-Oder gesorgt hat. Der Wegfall der sowjetischen Gegenmacht zum Imperialismus hinterläßt in der Hinsicht ein „Machtvakuum“; er läßt nämlich lauter eigenwillige Berechnungen zu, wo bislang Gleichschaltung geherrscht hat. Und diese Freiheit wird tatkräftig genutzt: Von Saddam Hussein bis zu den exilierten Tutsi-Führern, von den kurdischen Nationalisten bis zu den islamischen Fundamentalisten macht sich eine unübersichtliche Vielfalt von „Kräften“ und Machthabern auf und vollstreckt in der eigenen Umgebung allerlei Korrekturbedürfnisse, die unter den Bedingungen der alten „Ost-West-Lage“ entstanden, aber nie zu ihrem Recht gekommen sind. Es ist schon enorm, was für offene Rechnungen die buntscheckigen Geschöpfe des Imperialismus gegeneinander haben und begleichen, nachdem nicht mehr in jeder Urwaldrevolte der Kampf zwischen Freiheit und Sozialismus gekämpft wird, sondern nur noch die Freiheit herrscht, die Auswirkungen des weltweiten Geschäftslebens und der konkurrenzlos gewordenen demokratischen Kultur mit gewalttätigen Selbstbehauptungsversuchen zu quittieren.
Diese „Lage“ fassen die Alliierten in den Blick, wenn sie den gemeinsamen Plan fassen, sich als Militärpakt von sich selbst in ihrer Eigenschaft als tonangebenden UNO-Mächten zu bewaffneten Interventionen bitten zu lassen. Daß sie sie so ins Auge fassen: als Ansammlung möglicher Interventionsfälle, verrät eine eigentümliche Art von Illusionslosigkeit: Sie rechnen mit Krieg als Alltagserscheinung, und sie setzen dieser Perspektive kein übermäßiges positives Interesse an einer politischen Alternative entgegen. Nicht als ob sie früher unter dem Zeichen des Anti-Sowjetkommunismus eine wunderbare Zukunft für Mitmacher in aller Welt geplant hätten; aber die rechte Einordnung kooperativer Staatsmänner war ihnen allemal das Angebot wert, Waffen, Militärberater und Subventionen für den Staatshaushalt vorbeizuschicken. Soviel politisches Interesse können die Betreuer der Weltordnung der absehbarerweise instabilen Staatenwelt von heute und morgen nicht mehr abgewinnen. Ihr Bezug auf Kriege und Krisen ist negativ und abstrakt: Gewalt gegen Störungen. Darauf bereiten sie sich mit ihren „Krisenreaktions“-Kräften vor.
Die Kalkulation, so die Welt in Ordnung zu halten, geht allerdings nicht so einfach auf. Es ist nämlich mehr als fraglich, was die Alliierten unter Aufbietung ihrer kollektiven militärischen Supermacht gegen die Kriege und Krisen, mit denen sie fest rechnen, überhaupt ausrichten können: Wie interveniert man denn zweckmäßig gegen Parteien, die einander abschlachten, um dadurch Korrekturen an ihrer Lage zu erkämpfen, an deren Erfolg die imperialistischen Mächte allesamt genausowenig Interesse haben wie an deren Verhinderung? Lassen sich mit Atomwaffen und Flugzeugträgern bewaffnete Kräfte von störenden Unternehmungen abschrecken, wenn diese Unternehmungen den Charakter von Bandenkriegen haben? Für welche „Lektionen“ sind die supermodernen Waffen der NATO gut, wenn die Störenfriede sich jeder Konfrontation mit diesen Waffen entziehen, weil sie mit einem ganz anderen Waffengebrauch beschäftigt sind, nämlich zur Eliminierung falscher Nachbarn? Der Westen mag sich ja vornehmen, alle Regungen in der Staatenwelt sicher zu beherrschen – und dazu das paradoxe Ideal der erzwungenen Gewaltlosigkeit verkünden –; dafür müßte er aber, so wie heute die Dinge liegen, schon selber mit überlegenen Truppen überall hingehen, die „Missetäter“ verhaften und die Völker mit dem Frieden einer neo-kolonialen Herrschaft beglücken, in der alle Unbefugten ihre Gewalt los sind. Tatsächlich tun die führenden Mächte der Allianz das ja auch; die USA sind, wo sie es unerläßlich fanden, auf diese Weise militärisch hingegangen, an den Golf und nach Somalia; und ihre Partner haben mitgezogen. Die Notwendigkeit, den dort tätigen Unruhestiftern Schranken zu setzen, hat auch ihnen eingeleuchtet – nachdem die USA sonst alleine die Maßstäbe dafür gesetzt hätten. Eine Weltordnung nach amerikanischem oder gar gesamtwestlichem Geschmack ist dabei allerdings nicht herausgekommen. Dazu wäre eben doch noch mehr nötig gewesen als die eindrucksvolle Demonstration überlegener Waffenmacht; nämlich die Übernahme der politischen Macht dort, wo sie nicht wunschgemäß funktioniert – und das ist auch nicht gerade die Ordnung, die die USA und ihre Verbündeten sich wünschen. Nicht als ob sie die militärischen und moralischen Fähigkeiten dazu nicht besäßen. Aber solange keine von den großen Mächten diese Art der „Weltbeherrschung“, nämlich per Okkupation, die allemal „nur“ Erd-Teile bewältigen kann, in Angriff nimmt, haben auch alle anderen keinen selbstverständlichen Grund, ihre Mittel an solche Vorhaben zu verschwenden. Sie wollen Aufsicht führen über fremde Staaten und Regie über deren Konflikte; aber sie wollen das nicht um den Preis, daß sie sich damit am Ende bloß in fremde Machtkämpfe verstricken – wenn schon, dann müßten sie auf diese Weise einen eigenen Machtkampf um Anteile an der Welt eröffnen.
Und das liegt ihnen einstweilen fern. Deswegen belassen sie es bei einer gemeinsamen Krisenvorsorge und hierfür bei „Krisenreaktionskräften“ – einem Mittel, das sie im Fall Somalia ausprobiert und nicht bloß für diesen Fall als untauglich verworfen haben, das ihnen aber, gemeinsam eingerichtet, die Fähigkeit verschaffen soll, wirksam zuzuschlagen, wenn ihnen irgendein Potentat in der Welt zu weit geht oder irgendein auswärtiges Durcheinander zu nahe kommt. So, meinen sie und nehmen es sich fest vor, ließen sich die negativsten „Auswüchse“ ihrer eigenen Weltordnung mit einem vertretbaren Verhältnis von Gewaltaufwand und Ordnungsertrag in erträglichen Grenzen halten.
Einen Störfall von allgemeinerer Art, durch den sie sich militärisch durchaus herausgefordert sehen und den sie daher auf gar keinen Fall auf sich beruhen lassen können, haben die NATO-Partner bereits identifiziert: Keines ihrer Treffen vergeht, ohne daß sie sich über die Gefahr einer unkontrollierten Weiterverbreitung – „proliferation“ – von Atomwaffen einig werden und beschließen, nach Wegen zu suchen, um dagegen wirksam einzuschreiten. Dabei rechnen die Verbündeten, denen drei nationale Atomwaffenarsenale, darunter das weltweit wuchtigste, zu Gebote stehen, nicht einmal mit einer Wiederkehr des strategisch so unseligen „atomaren Patt“, durch das sie sich 40 Jahre lang trotz erbitterter Aufrüstung letztlich doch haben zwingen lassen, die Existenz eines gegnerischen „Lagers“ hinzunehmen. Alarmiert sind sie durch die Gefahr, daß Staaten, bei denen sie den Willen vermuten, sich ohne imperialistische Genehmigung eine bedeutendere Stellung in der Welt zu erobern, sich mit der Atomwaffe die Fähigkeit verschaffen könnten, die Ordnungskompetenz der berufenen Führungsmächte des Weltfriedens zu ignorieren. Offenbar ist ja die Welt, die die NATO intakt erhalten will, so geordnet, daß ihre Mitglieder in dem Maße zu respektablen politischen Subjekten werden, in dem sie Massenvernichtungsaktionen organisieren können. Eben deswegen dürfen die bedeutendsten Instrumente internationaler Achtung nicht in „unzuverlässige“ Hände geraten – wobei das Kriterium fehlender Zuverlässigkeit nichts anderes ist als die fehlende Lizenz der NATO.
Für die Allianz geht es also um ihr letztinstanzliches Gewaltmonopol über die Staatenwelt. Sie unterstützt daher die amerikanische Offensive gegen das von Washington zum Präzedenzfall erkorene Nordkorea. Eigenes militärisches Einschreiten behält sie sich vor:
„Jüngste Ereignisse in Irak und Nordkorea haben gezeigt, daß die Verbreitung von MVW (sc. Massenvernichtungswaffen) trotz internationaler Nichtverbreitungsnormen und -Übereinkünfte vorkommen kann. Um ihrer Rolle als Verteidigungsbündnis gerecht zu werden, muß sich die NATO daher mit der Frage befassen, welche militärischen Fähigkeiten benötigt werden, um der Verbreitung und dem Einsatz von MVW entgegenzuwirken…“ (Anlage zum Kommuniqué der Ministertagung des Nordatlantikrates im Juni in Istanbul: Bulletin Nr.58/94, S.551)
Kontrolle der Konkurrenz vs. Konkurrenz um Kontrolle
Die zukunftsweisenden Initiativen und Vorhaben der NATO lassen die anspruchsvolle Zielsetzung erkennen, durch Bündelung der Kräfte, die die Nationen kapitalistischer Staatsräson in Europa und Nordamerika unterhalten, eine Art kollektiver Weltherrschaft auszuüben. Sicherheit definieren diese Staaten als durchorganisiertes Gewaltmonopol erstens über Europa, zweitens von Europa aus über alle möglichen Krisenherde; Leistung dieses Gewaltmonopols soll nichts geringeres sein als der Weltfrieden; und dieser Menschheitstraum besteht realiter keineswegs in der Abwesenheit von Krieg, schon gar nicht im Dahinschwinden seiner Ursachen, sondern in einem globalen Geschäftsverkehr, der alle Nationalökonomien für die Akkumulation des in drei bis fünf Währungen beheimateten Kapitals nützlich macht. Die „zivile Weltgesellschaft“, die dieser supranationalen politischen Ökonomie unterworfen ist, existiert nur unter dem Diktat militärischer Gewalt, die dafür sorgt, daß die teilnehmenden Staaten ihren Völkern mit Gewalt das Nötige diktieren und sich auch dann nichts Abweichendes vornehmen, wenn sie darüber Schaden nehmen. So eine oberhoheitliche militärische Weltkontrolle schafft kein Staat allein, nicht einmal der US-amerikanische und nicht einmal mit Atomwaffen, die bloß zerstören können, was doch zum Funktionieren gebracht werden soll. Im Kollektiv trauen sich die NATO-Partner aber „Krisenmanagement“ und „Kräfteprojektion“ im nötigen Umfang zu. Darum geht es jedenfalls bei ihrem Zusammenschluß.
Und der hat, bei allen Treueschwüren, doch einen gewissen Haken. Die Häuptlinge der Allianz werden offenbar selbst bisweilen von bangen Ahnungen heimgesucht – warum sonst die wiederholten Treueschwüre? Und sie selber vermissen bei jeder Gelegenheit die „stabilisierende“ Wirkung, die bis neulich noch vom Druck ihrer selbstgewählten Weltkriegsaufgabe auf ihr Bündnis ausging. Dabei wäre der Verlust des Hauptfeinds wirklich nicht weiter schlimm, wenn das Bündnis für alle Beteiligten eine feine Sache wäre; dann käme ja bloß, endlich einmal, uneingeschränkt der positive Bündniszweck zum Zuge. Wenn dessen Gültigkeit umgekehrt ohne Weltkriegsperspektive prekär erscheint, dann hat die Einigkeit der Imperialisten selber einen gewissen Widerspruch an sich – und hat ihn schon immer gehabt; nur daß der gemeinschaftlich eröffnete und durchgehaltene offensive Gegensatz gegen ein gleichfalls atomar und für einen Weltkrieg gerüstetes „sozialistisches Lager“ die abhängige Beteiligung an der US-Weltmacht zur obersten strategischen Staatsräson der europäischen Verbündeten Amerikas gemacht hat – und der angeblich so bedrohlich aggressive Feind viel zu sehr auf Frieden und Anerkennung aus war, um die Solidarität seiner Gegner jemals praktisch auf die Probe zu stellen.
Tatsächlich leidet das so prachtvoll elaborierte Projekt eines kollektiven Imperialismus an wenigstens zwei Mißverhältnissen. Erstens ist der imperialistische Zweck, anderen Staaten die eigenen nationalen Interessen als unbedingt zu beachtende Friedensordnung vorzuschreiben, mit dem Mittel der Unterordnung unter Bündnisentscheidungen, also des Souveränitätsverzichts, nur vom Standpunkt der Schwäche aus vereinbar, grundsätzlich also unverträglich. Und zweitens ist die Rechnung der Stärksten, durch Konkurrenzverbot in der Weltfriedensfrage beim weltfriedlichen Konkurrieren zu gewinnen, in die Krise geraten.
a) Die maßgeblichen europäischen NATO-Staaten sind in dem Bündnis, weil sie darüber, mehr als sie es sonst fertigbrächten, bestimmendes Subjekt der Weltpolitik sein wollen. Indem sie sich aber der Bündnisdisziplin ein- und der transatlantischen Führungsmacht unterordnen, machen sie sich, wie partiell und wie berechnend auch immer, zur Manövriermasse fremder Dispositionen. In den vier antisowjetischen Jahrzehnten der NATO hat sich zwar nur die französische 5. Republik praktisch bemüht, diesen Widerspruch zugunsten ihrer nationalen Autonomie aufzulösen, ohne den Nutzen der Allianz zu verlieren: Sie hat ihre strategische Abhängigkeit von den Atomwaffen der USA als Überantwortung ihres Allerheiligsten, der nationalen Sicherheit, an amerikanische Ermessensentscheidungen begriffen, die nach französischem Urteil unmöglich zugunsten der Westeuropäer ausfallen konnten, weil die USA damit ihr Allerheiligstes für andere aufs Spiel gesetzt hätten. Frankreich hat deswegen eine eigene Nuklearmacht aufgebaut, die freilich mehr den politischen Willen zu strategischer Autonomie manifestierte als die Fähigkeit dazu herstellte: Selbst mit seiner Force de Frappe kam das Land von der Atomkriegsplanung und -vorbereitung der NATO nicht los. Die anderen westeuropäischen Mächte haben sich auf denselben Widerspruch eines Souveränitätsgewinns durch Souveränitätsverzicht anders bezogen. Sie haben erst einmal die durch Amerikas Atomkriegskonzept definierte strategische Lage und damit ihre einseitige Abhängigkeit von amerikanischen Garantien akzeptiert: Großbritannien mit dem Selbstbewußtsein des siegreichen Weltkriegsalliierten und quasi gleichberechtigten Teilhabers der atomaren Rüstung der USA; die BRD vom Standpunkt des Weltkriegsverlierers, dem mit der NATO-Integration überhaupt die Wiederkehr als Militärmacht ermöglicht wurde. Und alle haben sich angestrengt, die Bündnisstrategie, wenn sie ihr schon unterworfen waren, für ihre autonom definierte nationale Sache auszunutzen – die BRD unter anderem, am Ende sogar erfolgreich, für ihr Projekt der Angliederung der DDR. Dennoch: Alle Partner der USA haben sich an deren Führungsrolle abgearbeitet und dauernd, vor allem mit ihrem europäischen Zusammenschluß, um ihre strategische Aufwertung gerungen – die Deutschen z.B. bis hin zu dem NATO-„Doppel“-Beschluß, ihnen durch die Aufstellung einer „eurostrategischen“ Atomraketenwaffe ein Stück strategischer Gleichrangigkeit ihres kostbaren Frontstaatbodens mit dem US-Sanktuarium zu gewähren. Das unendliche politische Gezerre der vergangenen 40 NATO-Jahre um nationale Rechte und Pflichten im Bündnis zeugt von dem unaufgelösten Konflikt zwischen Autonomie und Einigkeit der Bündnispartner – und von der unaufhebbaren relativen Schwäche der europäischen Partner Amerikas, die das Bündnis haltbar gemacht hat.
Nach dem Ende des „Ost-West-Gegensatzes“ macht sich dieser Widerspruch nun nicht mehr bloß als Streit um die Lastenverteilung im Weltkrieg und um das Recht nationaler Sonderzwecke geltend, sondern schon bei der Frage, wie die strategische Lage in Europa und darüber hinaus überhaupt zu beurteilen und wie welcher Fall in die „Krisenreaktions“-Strategie des Bündnisses einzubeziehen ist. Die Schwierigkeiten bei der gemeinsamen Betreuung des post-jugoslawischen Bürgerkriegs geben dafür ein Beispiel. An ihnen zeigt sich das Bemühen der Hauptmächte Europas, das alte Mißverhältnis zwischen Bündnisdisziplin und nationaler Autonomie neu aufzulösen, nämlich vom Standpunkt gewachsener relativer Stärke und darauf begründeter Gleichrangigkeit mit der alten Führungsmacht. Sie konkurrieren um die Macht, „die Lage“ verbindlich zu definieren und ihre Bewältigung herbeizuführen. Und natürlich fordern sie damit den Führungswillen der USA heraus, die als Inhaber einer gesamtwestlichen Richtlinienkompetenz noch lange nicht abgedankt haben.
Nun mag die NATO mit der Entwicklung des „Falles“ Jugoslawien zufrieden sein, das Zuschlagen in Bosnien sogar als musterhaften Präzedenzfall für ihre innere Einigungsfähigkeit und Entschlußkraft ansehen; und vielleicht darf sie demnächst sogar noch mehr an angewandter Waffenbrüderschaft organisieren, die dann die Partner so richtig aneinanderschweißt. Und was den grundsätzlichen Widerspruch zwischen dem Ziel konkurrenzloser Beherrschung der Lage und dem Preis der Einordnung ins Kollektiv betrifft, so mag die NATO ihn auch weiterhin von ihrem bürokratisch-bündnistechnischen Standpunkt aus ignorieren bzw. als im Einzelfall allemal lösbares Abstimmungsproblem ansehen und stets von neuem beschließen, daß mehr jedenfalls nicht daran sein soll. Es ist nur inzwischen so, daß die Konkurrenz der nationalen Lageanalysen und alle abstrakten und konkreten Abstimmungsprobleme noch einen ganz anderen imperialistischen Widerspruch widerspiegeln, den seine Urheber schon gar nicht mehr recht erträglich finden.
b) Es stimmt nämlich die Grundgleichung nicht mehr, daß die NATO mit dem Weltfrieden die Bedingungen des politökonomischen Erfolgs der maßgeblichen kapitalistischen Nationen und insbesondere der mächtigsten von ihnen sicherstellt. Genaugenommen war ja schon in der Vergangenheit nicht der nationalökonomische Nutzen der verbündeten kapitalistischen Staaten das Schutzobjekt ihrer Allianzversicherung, sondern dessen Methode: die freie Konkurrenz der Kapitalisten und der geregelte Kampf der Staaten um gute Bilanzen und hartes Geld. Zusammengefallen sind Methode und gutes Ergebnis zunächst einmal nur bei der Wirtschaftsmacht Amerika, die den Weltkrieg als konkurrenzloser Gewinner überstanden hatte und mit den Methoden des modernen Weltmarkts ihrem Kapital den geregelten Zugriff auf die restliche Welt eröffnet hat. Für die ökonomisch Schwächeren mußten schon mehrere Bedingungen zusammenkommen: eine allgemeine Expansion des Welthandels und des internationalen Finanzgeschäfts sowie die Sicherung der konkurrierenden Währungen durch viel Bündnisdisziplin bei ihrer wechselseitigen Stützung, damit die Beteiligten bei allen Konkurrenzerfolgen der einen und Niederlagen der anderen doch im Ganzen Wachstum verbuchen konnten. Immerhin war es aber lange Zeit so; die Nationen, auf die es ankam, hielten ihren zivilen Konkurrenzkampf gegeneinander für eine hinreichend ertragreiche Angelegenheit, um diesem Friedenszustand gemeinsam den nötigen Schutz vor dem „Weltkommunismus“ angedeihen zu lassen. Sie hielten an ihrer Einigkeit im Strategischen fest, ohne ihre Konkurrenz in Sachen internationaler Geldvermehrung zu vernachlässigen, und schenkten sich in ihrem ökonomischen Konkurrenzkampf nichts, ohne ihn auf ihre militärische Kooperation übergreifen zu lassen.
So relativ problemlos passen das weltweite Sicherheitssystem, für das die NATO einsteht, und die zu sichernde politökonomische Sache heute nicht mehr zusammen. Als erste – logischerweise, weil sie die geborenen Nutznießer des Systems waren und nach wie vor daran festhalten, daß es eigentlich ihr Recht auf Erfolg verbürgen muß – sind die USA mit einer tiefen Unzufriedenheit an der Verteilung von Aufwand, Ertrag und Schaden in der imperialistischen Welt hervorgetreten und haben ihren Verbündeten den Skandal vorgehalten, daß die Erwirtschaftung von Reichtum und Verlusten seit längerem gegen Amerika läuft.[20] Deutlich gemacht haben sie damit, daß die Konkurrenz der Großen schon längst nicht mehr um die höchsten nationalen Akkumulationsraten geführt wird, sondern um die Verteilung von Krisenverlusten. Es geht mittlerweile um die Eroberung von Märkten nicht auf Kosten sowieso konkurrenzunfähiger Dritter, sondern zum Nachteil der Verbündeten; um die Sicherung des jeweils eigenen nationalen Kreditgelds unter Schädigung „befreundeter“ Währungen, über deren Stützung bis vor kurzem noch Absprachen getroffen und sogar eingehalten wurden; überhaupt um Standortvorteile und Kapitalvernichtung in nationalem Maßstab. Davon bleibt die jahrzehntelang – mehr oder weniger – für alle so funktionale Scheidung zwischen der Welt des Geschäfts, in der Freiheit der Konkurrenz herrschen sollte, und der Welt der Sicherheitspolitik, in der alle Kräfte zwecks Verteidigung eben dieser Freiheit gebündelt sein sollten, nicht ganz unberührt. Militärs achten auf einmal auf die politische Ökonomie: Anträge auf einvernehmliche Verteidigung der Weltordnung – vom Irak bis Somalia – werden mit Abwägungen über nationalen Aufwand und nationalen Ertrag des strategisch eigentlich fälligen Durchgreifens verknüpft und vom Rechenergebnis abhängig gemacht. Nicht als ob in der NATO nicht schon immer um die Lastenverteilung gefeilscht worden wäre; aber mitten in Strategiefragen Nutzenkalkulationen sprechen zu lassen, ist schon ein Fortschritt. Vielleicht noch bedeutender das Umgekehrte: Regierende Politökonomen beurteilen neuerdings zunehmend den Stand und die Zuspitzung ihrer zivilen Konkurrenz unter dem Aspekt, was daraus für ihre Bündnisbeziehungen, nämlich an Zerrüttung folgt. Gewiß liegt keine Kündigung auf dem Tisch; und die NATO ist nach wie vor nicht der Ort, wo die Vertreter der verbündeten Nationen im Streit auseinandergehen. Aber was heißt das noch, wenn sie das in anderen Zusammenhängen immer öfter tun? Der europäisch-amerikanische Streit ums neue GATT z.B. hat in allem Ernst Fragen nach der Haltbarkeit der grundsätzlichen Kompromißfähigkeit und Einigungsbereitschaft der G7 aufgeworfen.[21] Und was soll man davon halten, wenn dem deutschen Außenminister für einen Vortrag vor dem Council on Foreign Relations in Washington, in dem er für die weitere Pflege der transatlantischen Beziehungen warb, als neues Bündnisproblem die Frage einfiel:
„Wie verhindern wir, daß das Ringen um technologische Vorherrschaft die drei großen Industrieregionen zu Gegnern macht?“ (Bulletin Nr.36/94, S.322)
Bei soviel Problembewußtsein ist es kein Wunder, daß die NATO-Politiker bei der Festlegung der Leistungen, die ihr Kriegspakt erbringen soll, zielstrebig auf eine einigermaßen kuriose, nämlich nicht objektbezogene, sondern reflexive Funktion verfallen: die Aufgabe, die Verbündeten überhaupt beieinanderzuhalten, zwischen ihnen die „Ursachen für Instabilität, Spannung und Konflikt“ unter Kontrolle zu halten und unliebsame Übergänge zu verhindern. Der verewigte Generalsekretär der Allianz hat das schon vor drei Jahren klar so gesehen:
„Wörner: … Viele Konflikte entstehen gar nicht erst, weil es die NATO gibt. Denken Sie sich die NATO weg, dann wird die Gefahr von Kriegen und Konflikten in Europa mit Sicherheit größer. Spiegel: Sie übertreiben. Wörner: Keinesfalls. Die NATO bindet Nordamerika und Europa – die beiden großen Machtzentren dieser Welt – zusammen. Nehmen sie die Allianz weg, und Nordamerika und Europa werden auseinanderbrechen. Das hätte verheerende Folgen für die Stabilität Europas und der gesamten Welt. Denn die transatlantische Achse ist das eigentlich stabile Element in der Weltpolitik unserer Tage. Ohne die Allianz wäre eine Renationalisierung der Verteidigung zu befürchten, und es bestünde die Gefahr, daß das alte europäische Machtspiel wieder anfangen würde: Allianzen, Gegenallianzen.“ (Der Spiegel 45/1991)
Der Denksport: Was wäre, wenn…? taugt zwar zu nicht mehr als dazu, eine furchtbare Prophezeiung loszuwerden, und bringt keinen Erkenntnisgewinn. Wenn ihn aber der zivile NATO-Chef anstellt, dann ist das verräterisch. Denn wenn sich die Mitglieder und Manager des Bündnisses schon so explizit und jenseits ihrer eigentlichen strategischen Vorhaben um ihre Einigkeit als solche kümmern, dann haben sie erstens das Problem, und das ist zweitens durch seine fortwährende sorgenvolle Begutachtung ganz gewiß nicht aus der Welt zu schaffen. Die Alliierten haben angesichts ihrer imperialistischen Erfolge und Niederlagen national zu rechnen angefangen; und da ist es zwar konsequent, hilft aber nicht viel, wenn sie einander vor dem „Rückfall“ in nationale Abrechnungen warnen.
Einstweilen lebt die NATO aber weiter. Und zwar keineswegs bloß als traditionsreicher Formalismus und leere Hülle. Sie wahrt noch den Charakter einer strategischen Allianz, in der nicht bloß verschiedene autonome und im Grunde selbständig handlungsfähige Militärmächte sich in einem bedingten und begrenzten Interesse, Krieg betreffend, zusammenfinden – Wörners „Allianzen, Gegenallianzen“ –; vielmehr machen die USA über die NATO ihre europäischen Partner zu Teilhabern ihrer Weltmacht, und diese Partner – oder wenigstens einige davon – definieren sich selbst militärisch als Teil eines Ganzen. Offenbar gehen die imperialistischen Kalkulationen der maßgeblichen Nationen doch noch am besten in der seltsamen Konstruktion einer kollektiven Weltmacht auf.
Wer rechnet da wie?
II. Die deutsch-amerikanische „Achse“: Komplementäre Berechnungen imperialistischer Konkurrenten
Die NATO hat 16 Mitglieder; aber diese korrekte Feststellung ist keine Wahrheit über die Allianz. Sie besteht nämlich erstens aus der amerikanischen Führungsmacht, die sich nach dem Weltkrieg in Westeuropa ihre Partner für die Einschnürung und Einschüchterung der sowjetischen Gegenmacht gesucht hat. Und über eine schlichte Fortsetzung der Weltkriegsallianz ist das US-Bündnis im wesentlichen dadurch hinausgewachsen, daß Amerika sich zweitens in der BRD einen mächtigen, dabei abhängigen, und zwar bewußt und aus freier nationaler Berechnung abhängigen Erfüllungsgehilfen seiner antisowjetischen Kriegsdispositionen in Europa herangezogen hat. Dieses spezielle deutsch-amerikanische Ergänzungsverhältnis hat die Grundlage dafür geschaffen, daß die NATO zum supranationalen Pakt unter US-Regie geraten ist, der seinen europäischen Mitgliedern ihre wesentlichen strategischen Grundentscheidungen gewissermaßen unverfügbar vorgegeben hat.
An der BRD und Amerika und der Komplementarität ihrer strategischen und sonstigen nationalen Kalkulationen hängt das, was die NATO heute noch ist und will und vermag, einerseits nach wie vor, andererseits in völlig neuer Weise, weil von den Rechnungen der antisowjetischen Ära keine mehr so einfach stimmt. Die USA haben ihre Gründe, ihre Weltmacht in Europa fest verankern zu wollen; und Deutschland hat neue Gründe, den USA zum Rang des fortwährend beschworenen „Stabilitätsankers für Europa“ zu verhelfen.
A. Das post-antisowjetische Bündnisinteresse der amerikanischen Weltmacht
1.
Bei seinem Berlin-Besuch Mitte Juli hat US-Präsident Clinton in bewußter Anknüpfung an seines Vorgängers Kennedy Durchhalteparole für Frontstadt und -staat die unverbrüchliche deutsch-amerikanische Freundschaft beschworen: „Amerika steht an Ihrer Seite – jetzt und für immer!“ und: „Nichts wird uns aufhalten, alles ist möglich. Berlin ist frei.“
Dieses Zukunftspathos war – der Hinweis auf Berlins „Befreiung“ zeigt es überdeutlich – vor allem einmal eine rückwärtsgewandte Sentimentalität: beschwörender Rückblick auf Jahrzehnte einer Waffenbrüderschaft zwischen Besatzungsmacht und Vorposten, mit der es – das Pathos kommt eben nicht von ungefähr – vorbei ist: Die gemeinschaftliche Weltkriegsdrohung trifft auf keinen kampfbereiten Gegner mehr. Ein auch nur annähernd gleichrangiges Ziel transatlantischer Waffenbrüderschaft: ein Gegner, der mit den überdimensionalen Waffen des Atomkriegs niederzuhalten, notfalls niederzukämpfen wäre, ist nicht in Sicht; also auch kein äquivalenter strategischer Bündnisgesichtspunkt „jetzt und für immer“. Der Weltkrieg als Bündnisgrund, die Atomwaffen als Argument für Amerikas Führungsrolle sind entwertet.
Deshalb hat der US-Präsident seinen gefühlvollen Rückblick auf den „Freiheitskampf“ um Berlin usw. mit einem vorwärtsweisenden Angebot an den deutschen Partner verbunden: Der soll „führen“, Europa nämlich in Richtung auf eine auch den ehemaligen Ostblock umfassende Integration unter Einschluß amerikanischer Interessen, und überhaupt soll er in der Weltpolitik, auch militärisch, den Ton angeben helfen. Nun ist es ja weder so, daß die USA gewissermaßen den Posten einer europäischen Hegemonialmacht zu vergeben hätten; noch ist es so, daß die USA sich in ihrer Weltpolitik fortan nach deutschen Vorgaben richten wollten. Die US-Regierung rechnet aber offenkundig mit dem politischen Willen der neuen Berliner Republik, die europäischen Verhältnisse ihren Interessen gemäß zu gestalten und über den europäischen Bereich hinaus auch militärisch so in Erscheinung zu treten – „Macht zu projizieren“, wie das militärdiplomatisch heißt –, wie sie als Finanzmacht längst präsent ist. Diesem Willen bietet der Präsident mit seinem laut geäußerten Wunsch nach deutscher Führerschaft amerikanische Rückendeckung.[22] Er setzt also auf einen deutschen Hegemonialanspruch auf Europa von solcher Reichweite und auf einen globalen Willen zu so weitgehender Bevormundung anderer, daß diese Ambitionen ohne Unterstützung der USA gar nicht zu realisieren sind. Die Größe der Vorhaben, zu denen er Deutschland ermuntert, soll für alle Zukunft die Unentbehrlichkeit Amerikas für die deutsche Politik begründen. Dafür steht Clintons drohende Verheißung unterm Brandenburger Tor: „Nichts wird uns aufhalten, alles ist möglich“ – eben wenn BRD und USA bloß weiterhin so „immer und ewig“ zusammenhalten wie zu antisowjetischen Zeiten.
2.
Das Angebot der USA, mit dem schon Clintons unmittelbarer Vorgänger die Deutschen beehrt hat, ist nicht selbstlos. Es ist von einer Sorge diktiert, die amerikanische Politiker durchaus auch direkt aussprechen: Sie fürchten bei ihren europäischen Freunden einen Trend zu einem „geschlossenen Europa“ – was soviel heißt wie: die USA könnten im Zuge der Formierung der Europäischen Union aus Europa herausgedrängt werden. Diese Sorge bezieht sich auf unterster Stufe ganz materiell auf Marktanteile. Daß der Kampf um Konkurrenzerfolge kapitalistischer Unternehmen nirgends schlicht mit den „ehrlichen“ Mitteln der Ausbeutung ausgetragen, sondern von den beteiligten Staaten – nun auch im Rahmen der EU – mit den Waffen des Protektionismus und staatlichen Kredits unterstützt oder überhaupt betrieben wird, das wissen US-Politiker so gut wie ihre europäischen Kollegen, denn sie führen ihn ja so. Deswegen ist ihre Sorge auch gleich grundsätzlicher: Die Amerikaner wollen von der politischen Willensbildung ihrer Verbündeten, von deren wirtschafts-, handels- und überhaupt europapolitischen Entscheidungsprozessen nicht als außenstehender Dritter bloß betroffen sein, sondern darin bestimmenden Einfluß haben. Alles andere ruiniert nach amerikanischem Urteil die politökonomische Ordnung, nach der sie bislang mit den europäischen Wirtschaftsmächten in gedeihlicher Symbiose gelebt haben, verletzt also das internationale System, für das sie und ihre NATO-Partner doch immer eingestanden sind. Von den außenwirtschaftlichen Besorgnissen der USA ist es daher nur ein Schritt zu der fundamentalen Befürchtung, mit der konkurrenzmäßigen Abschließung der Europäer, nämlich einer Definition innereuropäischer Angelegenheiten ohne gleichberechtigte amerikanische Beteiligung, wäre über kurz oder lang unweigerlich der Verlust des „Brückenkopfes“ verbunden, den die USA in ihren Verbündeten haben. Ohne den wiederum wäre ihre Weltmacht nur noch die Hälfte, als Macht zur Beherrschung des Globus also gar nichts mehr wert. Denn auf der zuverlässigen Abstützung auf den wichtigsten „Gegenküsten“ beruht ihre Fähigkeit, Ordnungsansprüche – und darüber auch materielle nationale Interessen – weltweit geltend zu machen. Umgekehrt würde mit einem „geschlossenen Europa“ nicht bloß ein für ihre Weltmacht unerläßlicher Helfer entfallen; Amerika hätte darin einen unbeherrschbaren Konkurrenten vor sich; und das nicht bloß, wie heute schon, auf wichtigen Märkten, sondern in Fragen der Weltordnung überhaupt. Das wiederum wäre ungefähr dasselbe wie ein strategischer Gegner.
Um nicht dermaßen in die Defensive zu geraten, fordern die USA ein „offenes Europa“. Darunter verstehen sie nichts geringeres, als daß ihnen von ihren NATO-Alliierten der Status einer europäischen Macht zugebilligt wird. Das schließt außenwirtschaftspolitische Forderungen ein, die auf freien Marktzugang lauten und amerikanische Markterfolge meinen. Doch jenseits des Kleinkriegs, der da zu führen ist, hat der Anspruch der USA grundsätzlichen Charakter. Politisch, also was die staatliche Ordnung des alten Kontinents betrifft, und strategisch, beim kontrollierenden Zugriff auf die Militärpotentiale der europäischen Staaten, wollen sie so intensiv und dauerhaft eingemischt sein, als wären sie allen europäischen Nationen der nächste und wichtigste Nachbar. Und gerade in strategischer Hinsicht können sie diesen Anspruch auch ganz gut begründen: Militärisch sind sie eine Euro-Macht. Mit ihren 100.000 Mann samt festen Einrichtungen, Gerät und Flotten „vor Ort“ sind sie in Europa stärker präsent als fast alle dort beheimateten Souveräne; und weil sie so präsent sind, sind sie nicht bloß mit diesen Truppen, sondern als transatlantische Supermacht direkt in Europa anwesend, also praktisch Euro-Macht. Umgekehrt wird ihre Macht nur darüber, daß sie in Europa verankert ist, so global und so intensiv wirksam, wie die Amerikaner das für unabdingbar halten.
Dieses „Argument“ der militärischen Präsenz tut seine Wirkung allerdings nur, wenn die Macht, die die USA nach Europa „projizieren“, dort nicht bloß verloren herumsteht, sondern von den Europäern als politische Anwesenheit Amerikas in Europa anerkannt, den USA also der Status einer Euro-Macht auch wirklich zugebilligt wird. Dafür baut der amerikanische Präsident auf Deutschland. Er zählt auf die BRD – nicht mehr als bedingungslosen Frontstaat, sondern einerseits als die stärkste und entscheidende politische Macht Europas, auf die es für Amerikas Verankerung in Europa also auf alle Fälle maßgeblich ankommt, andererseits als diejenige Nation, für deren eigene eurostrategische Vorhaben Amerika am meisten und Entscheidendes zu bieten hat. Nämlich eben „Partnerschaft beim Führen“: eine konkurrenzlose deutsch-amerikanische Doppel-Hegemonie über Europa.
3.
Den übergreifenden und insoweit unverfänglichen Bezugsrahmen für so eine einzigartige imperialistische Symbiose braucht man nach amerikanischer Auffassung nicht erst zu schaffen: In der NATO ist die gewünschte Verschränkung deutscher und amerikanischer Gewaltmittel und Ordnungsinteressen und ihre durch Mittun beglaubigte Anerkennung durch die anderen Europäer bereits realisiert. Die traditionsreiche „Arbeitsteilung“ innerhalb der Allianz, die immer für die USA die Rolle der strategischen Führungsmacht vorsah und fürs demokratische Deutschland diejenige des integrierten Teils und militärisch halb-autonomen Teilhabers, soll auch in Zukunft die doppelte Gewähr bieten: einerseits, daß die BRD auf Amerikas strategische Rückendeckung angewiesen bleibt; andererseits soll sie daraus soviel nationalen Nutzen ziehen, daß sie darauf verzichtet, diese Abhängigkeit zu kündigen und nicht bloß ökonomisch, sondern auch als Militärmacht zu den USA in Konkurrenz zu treten. Im Atomwaffenverzicht der Deutschen und ihrer abhängigen Beteiligung an Teilen seines Arsenals verfügt Amerika überdies nach eigener Auffassung über eine Art Pfand fürs deutsche Bündnisinteresse.[23]
So wird die NATO in neuer Weise interessant für deren Führungsmacht: als Versicherung gegen strategischen Macht- und Bedeutungsverlust. Ob die USA auf diese Weise abwenden, was sie von einem „geschlossenen Europa“ befürchten, und ob durch Deutschlands Anerkennung die Weltordnung für sie wieder in Ordnung kommt, nachdem sie nach amerikanischen Begriffen ökonomisch längst gegen sie läuft und auch strategisch aus dem Ruder zu laufen droht, ist eine andere Frage. Die wird in Washington einstweilen offenbar so beantwortet, daß, wenn Amerikas Führungsmacht schon sonst überall in der Krise ist, wenigstens die über die NATO erhalten bleiben muß.
Auf so interessanten Abwägungen basiert heute der Kriegspakt der Imperialisten. Und auch das nur, weil die Deutschen ihre komplementären Berechnungen haben.
B. Der Sonderweg des deutschen Militarismus: Teilhabe an einer kollektiven Weltmacht als Mittel zu ihrer Instrumentalisierung
1.
Die deutsche Regierung ist nicht mit gleichem Pathos auf Clintons Aufforderung eingestiegen, gemeinsam „leadership“ zu üben. Sie hütet sich vor der offenen und offensiven Inanspruchnahme einer europapolitischen Rolle, die sich jeder Kenner griechischer Fremdworte als „Hegemonie“ erklären kann. Pathetische Bekenntnisse legen deutsche Machthaber derzeit noch immer am liebsten zur „gewachsenen Verantwortung“ ihrer Nation und zu den „Pflichten“ und „Lasten“ ab, die mit den Rechten einer „normalen“ Nation unabweisbar verbunden seien.
Das ist nun freilich eine besonders verlogene Art, neue deutsche Ansprüche anzumelden; Ansprüche, die durchaus nichts mit dem weit überwiegenden „Normalfall“ einer modernen Souveränität zu tun haben. Seine Kriterien für die „Normalität“, die ihm noch fehlt, entnimmt das Deutschland der 90er Jahre nicht etwa den Maßstäben, die es selbst beispielsweise für Rußland oder Nordkorea für angebracht hält, sondern dem Vorbild der Amerikaner und insofern auch dem der britischen und französischen Bundesgenossen, als die es für sich völlig normal finden, die restliche Staatenwelt als Objekt ihrer ordnenden Aufsicht und militärischen Kontrolle zu behandeln und – mit argwöhnischem Blick aufeinander und auf mögliche Dritte – frei zu entscheiden, welche „Fälle“ sie als unabwendbare Eingriffstatbestände definieren und mit Interventionen beglücken. Mit ihrem Bekenntnis zu internationalistischer Pflicht und Verantwortung reklamiert die BRD für sich einen Platz in dem elitären Zirkel imperialistischer Mächte, die über Recht und Unrecht auswärtiger Kampfeinsätze befinden, sich gewaltsames Einschreiten vorbehalten und dabei ihrem nationalen Interesse alle nötigen Völkerrechtstitel zu verschaffen wissen.
Die heuchlerische Selbstkritik des NATO-Frontstaats, bislang zu bequem gewesen und geblieben zu sein; die absurde Selbstbezichtigung des christlichen „Nachrüstungs“-Kanzlers, „beiseite gestanden“ zu sein, wenn es international um Mord und Totschlag ging; solche Töne zeugen darüberhinaus von einer tiefen nationalen Unzufriedenheit mit den militärpolitischen Verhältnissen, in denen die BRD sich heute vorfindet, bloß weil sie in 40 Jahren antisowjetischer Bündnispartnerschaft so entstanden sind. Was in Wirklichkeit ein kostspieliger und risikobereiter Einsatz der Nation war, nämlich die ins Bündnis eingepaßte „Vaterlandsverteidigung“ im Rahmen der NATO-„Triade“, das erscheint deutschen Politikern heute als Flucht vor handfester Einmischung in die „Unwetter der Geschichte“; und so etwas halten sie für „nicht akzeptabel mit der Würde unseres Landes“ (Original Kohl vom Brandenburger Tor, Juli 94). Das ist schon beinahe im Klartext die Absage an den überkommenen Bündnisstatus, nämlich immerhin die Klarstellung, daß Deutschland sich zu würdevoll vorkommt, um in irgendeiner Hinsicht militärisch eine geringere Rolle zu spielen als seine größten Verbündeten.
Dieser Standpunkt wird noch unterstrichen, wenn der Kanzler sich im gleichen Atemzug umgekehrt dagegen verwahrt, nun marschierten die Deutschen überallhin. Damit will er nämlich weniger einen feindseligen Verdacht als eine freundschaftliche Zumutung zurückgewiesen haben. Gegen die durch die regierungsamtliche Rhetorik womöglich erzeugte Hoffnung, die Deutschen stünden ab sofort für kriegerische Auftragsarbeiten im Dienste der Völkerfamilie bereit, verweist er aufs nationale Interesse, das noch allemal für oder gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr den Ausschlag geben wird: „Wann und wo Deutschland sich engagiert, wird in Deutschland entschieden“ (gleicher Ort und Zeitpunkt).[24] Das hört sich so an und soll auch so wirken, als wären ausgerechnet im Falle Deutschlands die nationalen Interessen nicht Grund, sondern Bremse für kriegerisches Eingreifen. Und das ausgerechnet da, wo jedem unfreiwilligen Gewaltverzicht eine entschiedene Absage erteilt und zugleich die bislang akzeptierte Bündnisdisziplin gekündigt wird: die Funktionalisierung für einen supranationalen Gesamtauftrag, die, bestünde sie fort, für die neue BRD einen Mangel an strategischer Selbständigkeit, militärpolitischer Autonomie und weltpolitischer Souveränität bedeuten würde, wie ihn die alte BRD nie verspürt hat.
2.
Um so bemerkenswerter nimmt sich die Politik aus, mit der die deutschen Machthaber ihren Entschluß zu mehr bewaffneter Weltpolitik aus entschiedenerem nationalem Interesse in die Tat umsetzen. Sie tun nämlich alles, um mit dem alten überkommenen Bündnis nicht zu brechen, vielmehr die deutsch-amerikanische „Achse“ zu pflegen und die darum herum gebaute transatlantische Allianz mit ihren Einrichtungen und Gepflogenheiten der militärischen „Arbeitsteilung“ zu erhalten und zu erneuern. So definiert sich die deutsche Republik strategisch und betätigt sich militärpolitisch in Anknüpfung an ihre herkömmliche Rolle als integraler Bestandteil und unselbständiger Teilhaber einer supranationalen Weltmacht, zu der die USA den wichtigsten Anteil beisteuern. Nicht zuletzt mit ihren Atomwaffen, für deren Einsatz das demokratische Deutschland nach wie vor eigene Flugzeuge bereitstellt, um „nukleare Teilhabe“ zu verwirklichen – es ist also durchaus nicht so, daß man in Bonn/Berlin atomare Kriegsmittel für überflüssig hielte; man kennt im Gegenteil, bei aller Fragwürdigkeit ihres operativen Nutzens, ihre überragende Bedeutung für das strategische Gewicht einer Militärmacht.[25] Doch ist das für Deutschland – einstweilen – kein Beweggrund, auf kürzestem Weg die schwarz-rot-goldene Atombombe anzustreben; die nicht-autonome Teilhabe am US-Arsenal scheint die bis auf weiteres interessantere Option zu sein. Ebensowenig meldet sich das vergrößerte Deutschland gleich mit dem Ehrgeiz in den Club der eigenständigen militärischen Großmächte zurück, auf eigene Faust und dementsprechend mit eigenen Mitteln in dem Umkreis, den es doch als seine engere Interessen- und Zuständigkeitssphäre ansieht, einen ungenehmigten Krieg niederzuschlagen: Zwar mischt es sich in die Liquidierung des ehemaligen Jugoslawien und in die gewalttätige Gründung von Nachfolgestaaten von Beginn an ein; mit Ansprüchen auf eine Schiedsrichterrolle, die ohne massiven Kriegseinsatz gar nicht durchzusetzen sind; den nimmt es aber gar nicht in Angriff, überläßt die Entsendung von Truppen unterm UNO-Blauhelm völlig den großen EU-Partnern; freilich ohne sich nun auch politisch zurückzuhalten. Bei ihren vorbereitenden Weichenstellungen für die Kontrolle Osteuropas sowie für die gewaltsame Aufmischung entfernterer Krisenherde verfolgt die deutsche Militärpolitik eine ähnliche Linie: Sie untermauert die Regelungskompetenz, die sie beansprucht, mit strategischen Arrangements und rüstungstechnischen Initiativen, die deutlich machen, daß für Deutschland nicht bloß viel zu tun bleibt, um autonom handlungsfähig zu werden, sondern daß es auch gar nicht – jedenfalls nicht gleich und auch nicht gleich morgen – militärisch alles können will. Natürlich baut man die eigenen Fähigkeiten aus; man setzt dabei aber auf „Arbeitsteilung“ und macht sich nichts weiter aus bewußt eingegangener Unselbständigkeit, wenn die fehlenden Mittel durch die Verbündeten bereitgestellt werden.[26]
Verglichen mit dem Bemühen Frankreichs um eine autonome strategische Rüstung und mit seiner quasi-kolonialen Interventionspolitik, oder mit Großbritanniens Seemacht und einer Unternehmung wie dem Falkland-Krieg, oder erst recht mit der universalen Militärpräsenz der USA, an denen Deutschland doch Maß nimmt, verglichen auch mit dem erklärten Willen der Bundesregierung, aus dem Zustand der angeblichen selbstverschuldeten militärischen Unmündigkeit herauszukommen, mag man diese Militärpolitik als – begrüßenswerte oder unglaubwürdige oder rätselhafte – Zurückhaltung ansehen und hätte sie damit gründlich mißverstanden. Sie ist nämlich unerläßlicher Bestandteil des überhaupt nicht zurückhaltenden Bemühens der Deutschen, die Militärmacht ihrer Partner für den eigenen nationalen Nutzen zu instrumentalisieren. Wenn sie sich so diszipliniert und „bescheiden“ in die militärische „Arbeitsteilung“ der Allianz einfügt – durch die sie gleichzeitig doch nicht mehr entselbständigt sein will –, dann geht die BRD davon aus, daß ihre nationalen Interessen und die supranationalen sicherheitspolitischen Anliegen der Allianz allemal ineins gehen; daß ihr spezieller Bedarf an militärisch herzustellender Sicherheit per se ein allgemeines Bedürfnis aller verbündeten Nationen ist oder, dasselbe umgekehrt, daß ihre Interessen in jedem Fall gewahrt sind, wenn das Bündnis sicherheitspolitisch weiterfunktioniert und ordentliche Verhältnisse garantiert. Wenn die BRD sich den Widerspruch leistet, ihre überkommene Bündnisabhängigkeit verlogen selbstkritisch zu kündigen und gleichzeitig eine Militärpolitik der „wechselseitigen Abhängigkeit“ „schon in Friedenszeiten“ weiter zu betreiben, dann will sie und drängt darauf, daß eben diese Gleichungen, von denen sie ausgeht, auch in Kraft bleiben. Und wenn Deutschlands Chefpolitiker soviel Wert auf ihre guten Beziehungen zu Amerika legen, dann wissen sie jedenfalls das Eine: was sie für den Erfolg dieser Bündnispolitik an den USA und deren Europa-bezogenen Weltmachtinteressen haben.
3.
Tatsächlich ist die widersprüchliche Bündniskalkulation, durch Souveränitätsverzicht Souveränität zu gewinnen, für keinen NATO-Staat so perfekt aufgegangen, und für kein Mitglied hat sich die „den Westen“ kennzeichnende Kombination von Bündnisdisziplin und Konkurrenzfreiheit dermaßen ausgezahlt, wie für die BRD. Der selbsternannte und anerkannte Rechtsnachfolger des zerstörten und demilitarisierten deutschen Reiches hat als militärisch unselbständige Teilmacht der Allianz seine Remilitarisierung geschafft, seine Rückkehr in den kleinen Kreis der maßgeblichen Weltordner, effektivsten Waffenproduzenten, gefragtesten weltpolitischen Adressen. Wie kein anderer Staat hat die DM-Nation die gesicherten Konkurrenzbedingungen auszunutzen vermocht, die sich unter dem Regime der NATO-„Abschreckung“ entwickelt haben. Unter dem Diktat einer Strategie, die größere politische Feindseligkeiten zwischen den kapitalistischen Nationen unterbunden und deren militärische Kräfte für die gemeinsame Sache gegen den Osten reserviert hat, haben die Deutschen Erfolge in der zivilen Konkurrenz der Nationen um Weltmarktanteile und Währungsqualität akkumuliert, wie sie ohne verpflichtenden Supranationalismus von den Unterlegenen kaum so friedfertig hingenommen worden wären. Am Ende ist sogar die Europas Kräfteverhältnisse umstürzende Vergrößerung der BRD um die DDR von den betroffenen Nachbarn akzeptiert worden. Die Deutschen selbst hätten es nie geglaubt, aber sie haben der Welt praktisch vorgeführt, wieviel zivilen Imperialismus ein funktionierendes Abschreckungsregime über die Welt freisetzen kann. Die abhängige Teilhabe an der bündnismäßig organisierten Weltmacht der USA ist darüber zur weltpolitischen Staatsräson der BRD geworden.
Diesen Nutzen der „alten Weltordnung“ will das neue Deutschland sich unbedingt erhalten. Allerdings von dem etwas geänderten Standpunkt aus, daß die alte Abhängigkeit nicht länger „akzeptabel ist mit der Würde der deutschen Nation“. Daß der NATO ihr selbstgewählter Feind im Osten abhanden gekommen ist, wird als Chance zur Befreiung von alten Zwängen der Bündnisräson genommen; und mit der „Wiedervereinigung“ und der formellen Beendigung letzter Souveränitätsvorbehalte sieht die deutsche Politik sich berechtigt und verpflichtet, die eigene Nation als autonomen Mittel- und Ausgangspunkt einer neuen Strategie für Europa ins Spiel zu bringen.
Mit diesem Anspruch will die BRD mit ihren gewohnten Partnern bündnispolitisch neu ins Geschäft kommen – mit Partnern, die ihrerseits auch nicht mehr zufrieden sind mit dem Bündnis, allerdings aus entgegengesetzten Gründen und in ganz anderer Hinsicht. Gerade die wichtigsten Alliierten sehen nämlich die Trennung zwischen einer zivilen Konkurrenz, in der sie unter Deutschland leiden, und einer militärischen Kooperation, mit der sie deutsche Erfolgsbedingungen anerkennen und schützen, nicht mehr ein. Nicht als ob sie gewaltsam gegen deutsche Erfolge an den Export- und Finanzmärkten der Welt einschreiten wollten – obwohl in den Grenzfragen des blühenden deutschen Waffen- und Waffenproduktionsmittelhandels seit dem Golfkrieg auch so etwas nicht mehr völlig undenkbar erscheint. Im Rahmen des Nordatlantischen Paktes beschweren sich die Partner nicht über Deutschlands zivile Erfolge, sondern über die andere Seite der von ihnen gesehenen Ungleichung: seinen zu geringen militärischen Aufwand – mit der Frage: zu gering wofür? wäre man natürlich gleich bei der anderen Seite; aber so wird in einem Kriegspakt eben nicht gefragt. Deswegen können die bundesdeutschen Militärpolitiker auch ebenso elegant wie perfide die Unzufriedenheit ihrer Partner mit ihrem eigenen Leiden an fehlender strategischer Autonomie ineins setzen und so tun, als würden sie von allen Seiten zu mehr Machtentfaltung ermuntert – wo sie in Wahrheit mit dem wenig schlagkräftigen Versuch ihrer Kollegen konfrontiert sind, Deutschland eine Rechnung für seinen aus der NATO-Weltordnung herausgezogenen Welterfolg zu präsentieren, seit nicht mehr der Druck der gemeinsamen antisowjetischen Sache solche Abrechnungsgedanken unterdrückt oder auf das NATO-übliche Feilschen um Stationierungskosten und Kompensationsgeschäfte beim Rüsten beschränkt. Die Wahrheit ist nämlich, daß Deutschland als zunehmend harter imperialistischer Konkurrent genau den Konsens untergräbt, dem es nicht nur seine bisherige Erfolgsgeschichte verdankt, sondern auf den es auch in Zukunft seinen Imperialismus bauen will. Einen Imperialismus, der die Ungleichung zwischen ziviler und militärischer Macht im entgegengesetzten Sinn wie die alliierten Kompagnons korrigieren will, seine Erfolgsbedingung also nicht mehr „bloß“ politökonomisch in Frage stellt, sondern auch auf der Ebene militärpolitischer und strategischer Entscheidungen angreift.
Die NATO-Politik Deutschlands ist der Versuch, die schon eingetretenen und die absehbaren negativen Wirkungen seines eigenen erfolgreichen Konkurrenzgebarens auf die ausgenutzten Konkurrenzbedingungen aufzufangen und die Leistungen des Bündnisses nicht bloß zu wahren, sondern im Sinne seiner neuen Freiheiten zu erweitern, die Allianz zum Mittel einer ganz national kalkulierten Gleichung zwischen zivilen Erfolgen und militärisch untermauerten weltordnungspolitischen Rechten zurechtzumachen. Dafür setzt dieser Staat erstens voll auf die USA – und zweitens auf die Karte des europäischen Anti-Amerikanismus; einstweilen in dieser Reihenfolge.
4.
Deutschland braucht und benutzt die USA vor allem, um jenes militärische Gesamtsystem für Europa auf den Weg zu bringen, das mit der Fortführung der NATO-Integration in Westeuropa und nach Osten hin mit dem Kooperationsrat und der „Partnerschaft für den Frieden“ Gestalt annimmt. Der Nutzen dieses Systems für die BRD liegt auf der Hand: Es stiftet den zuverlässigen gewaltmäßigen Rückhalt für die den gesamten Kontinent ergreifende politische Ökonomie des DM-Kapitalismus. Es stiftet ihn außerdem so, daß Deutschland als Militärmacht dabei hinter der Allianz zurücktreten und sich sogar als „Hegemonialmacht“ in dem milden Sinn anbieten kann, daß es seine östlichen Nachbarn ans Bündnis „heranführt“. So gewinnt die BRD neben dem allgemeinen, bündnismäßigen, auch noch einen ganz besonderen nationalen Einfluß auf die nach Westen strebenden „PfP“-Kandidaten und macht sich dabei noch nicht einmal dessen verdächtig, was sie betreibt, nämlich des „machtpolitischen“ Hegemoniestrebens. Was Deutschland dafür leisten muß, ist nichts anderes, als seine Bundeswehr in erneuerte „integrative Strukturen“ einzubauen – was praktisch so läuft, daß es von der eigenen Truppe her die Vereinnahmung „befreundeter“ Armeen durchorganisiert.[27]
Die Teilnahme der USA an diesen „integrativen Strukturen“ ist erstens um der Stärke des Systems willen und im Interesse seiner daraus resultierenden inneren Festigkeit vonnöten. Sie ist zweitens unerläßlich, um jede Alternative auszuschließen; sei es ein alternatives Bedürfnis auf Seiten der Partner, etwa nach strategischen Beziehungen ohne Abhängigkeit von der BRD, sei es ein konkurrierendes amerikanisches Bündnisangebot, sei es der Aufbau konkurrierender Ententen und Waffenbrüderschaften durch irgendwelche Dritte. Amerika schafft drittens die nötige Sicherheit gegen Rußland, drängt diese mit deutsch-europäischen Mitteln allein nicht sicher beherrschbare Nation nämlich in den Status eines neutralisierbaren Randstaats; daß die transatlantische „Supermacht“ mit besonderer Härte auf rigoroser Beschränkung der russischen Handlungsfreiheit nach außen, auf „Wohlverhalten“ und Unterordnung besteht, ist für die deutsche Politik extra günstig, weil ihr das eine Diplomatie des vereinnahmenden Entgegenkommens gestattet[28] – im Dienst einer Politik der versuchten Erpressungen in ökonomischen und militärpolitischen Fragen.[29]
Viertens schließlich benutzen die Deutschen Amerikas Präsenz und Status als militärische Euro-Macht, um ganz andere Kräfte-Mißverhältnisse auszugleichen als das der vereinigten West- und Ost-Mitteleuropäer gegenüber Rußland; nämlich ihre militärischen Defizite gegenüber den Intimpartnern Frankreich und Großbritannien. Daß diese beiden Mächte in der Sphäre kriegerischer Gewaltanwendung mehr vermögen oder jedenfalls – bislang! – mehr unternehmen als die Bundeswehr, spielt in der Konkurrenz um bestimmenden Einfluß auf die Definition gemeinsamer strategischer Vorhaben schon gar keine so entscheidende Rolle mehr, wenn die USA mit dem Gewicht ihrer Weltmacht mitentscheiden. In der Konkurrenz, in der sie ihren europäischen Unions-Partnern gegenüber auf die eigenen nationalen Mittel bauen, nämlich in der um Kredit und kapitalistische Standortvorteile, sind die Deutschen die Stärksten; wo sie nicht die Stärkeren sind, nämlich in der Konkurrenz um strategische Führungskompetenz, bauen sie auf die USA: Das ist die Logik der deutschen Amerika-Freundschaft.
Den berechnenden Rückgriff auf die europäischen Interessen der Amerikaner haben die Bonner Politiker am Jugoslawien-Konflikt erprobt – neben einer gegenläufigen Testreihe übrigens, wie sich das Übergewicht der USA durch europäische Solidarität relativieren läßt.[30] Angesichts britischen und französischen Widerstrebens gegen deutsche Kompetenzanmaßung bei der Zerlegung der jugoslawischen Bundesrepublik haben sie die USA – die auch nicht übermäßig gedrängt werden mußten – als Interventionsmacht hereingezogen; geradezu triumphierend blickt der deutsche Außenminister auf diese Leistung zurück:
„Auch bei diesem Konflikt hat sich wieder gezeigt: Ohne die USA geht es nicht. Deshalb haben wir Amerika von Beginn an zu einem stärkeren Engagement gedrängt.“[31] (Kinkel im Frühjahr 94 vor US-Außenpolitikern, Bulletin Nr. 36/94, S.324)
Der militärische Beitrag, den die Deutschen dann im Gefolge der Einmischung von USA und NATO über das große Bündnis bei der Luftüberwachung Bosniens, daneben als WEU-Mitglied zur Seeüberwachung der Adria geleistet haben, ist zwar immer noch vergleichsweise geringfügig ausgefallen. Schon der hat aber gelangt, um ihnen ihren gleichberechtigten und gewichtigen Platz in der „Kontaktgruppe“ – dem Fünfer-Gremium der vier Westmächte sowie Rußlands, das die Entscheidung über Fort- und Ausgang des Bosnienkriegs mittlerweile an sich gezogen hat – zu sichern.
Außer für seine europapolitischen Interessen braucht Deutschland die USA ganz genauso für all die Initiativen, die in der bundesdeutschen Diskussion unter dem Stichwort „out of area“ verhandelt werden. Worum es da geht, das bleibt hinter der allseitigen Pflege des Scheins, deutsche Militäraktionen könnten nie anderer als humanitärer Natur sein, ein wenig verborgen. Es gilt einfach als feststehender Sachzwang der nationalen Würde, daß eine Wirtschaftsmacht von der Reichweite der deutschen auch entsprechend weitreichend mit Gewalt für brauchbare Verhältnisse zu sorgen hat. Das kommt schon nahe an das Eingeständnis heran, daß zwischen souveränen Staaten noch der friedlichste Verkehr ein Gewaltverhältnis ist und daß sich ein Staat, der das Geschäftsleben und die Zahlungsfähigkeit anderer Nationen von seinem Kreditgeld abhängig macht und für dessen Welterfolg in Dienst nimmt, auf seine ökonomische Macht letztlich doch nur verlassen kann, wenn er mit außerökonomischen Mitteln Respekt zu erzwingen vermag. So will natürlich kein deutscher Weltpolitiker den dauernd beschworenen inneren Begründungszusammenhang zwischen deutschem Kapitalerfolg in aller Welt und deutschem Militarismus verstanden wissen; kaum daß der oberste Soldat der Republik sich und seinen Befehlsempfängern den neuen Auftrag der Bundeswehr mit dem Verweis auf lebenswichtige Wirtschaftsinteressen, Rohstoffzufuhr z.B., plausibel zu machen versucht.
Die Notwendigkeit, allzeit für Auslandseinsätze bereit zu sein, ergibt sich für die deutsche Politik freilich in der Tat nicht so sehr aus allenthalben drohender staatlicher Piraterie gegen Tanker nach Hamburg; und die stereotype Versicherung, man werde die fälligen Auswärtsspiele nur im Bündnis abwickeln, ist mehr als die vorsorgliche Verwahrung gegen den ohnehin albernen Verdacht, die Bundeswehr plante in alle Himmelsrichtungen „Alleingänge“. Es geht den Deutschen primär ums Grundsätzliche: um eine Bündniskonstruktion, die die Sicherung geordneter internationaler Geschäftsverhältnisse auf dem Globus nicht bloß deklaratorisch, sondern am besten sachzwangmäßig zum Gegenstand gemeinsamer Sorge der kapitalistischen Nationen macht.[32] Mit solchen supranationalen Militärstrukturen will die BRD sicherstellen, daß trotz allem Widerstreben der Partner die gewaltsame Sicherung der Bedingungen und Regeln zwischenstaatlicher Konkurrenz nach wie vor ein der Konkurrenz enthobenes Werk aller maßgeblichen Staaten bleibt. Um den Vorteil, daß die Wahrung deutscher Interessen nicht allein auf deutsche, sondern auf gemeinschaftliche Rechnung geht, ist es ihr dabei ebenso zu tun wie um die konkurrenzlose Überlegenheit der notfalls einzusetzenden Militärmacht. Mindestens ebensosehr geht es ihr aber um den Effekt nach innen, daß keiner der Beteiligten die Kündigung dieser gemeinsam umsorgten Konkurrenzprinzipien je für eine vollziehbare Option hält und als Alternative zur Hinnahme nationaler Verluste ins Auge faßt. Was seinem Inhalt nach der politökonomische Kampf der Nationen um die möglichst einseitige Schädigung der je anderen ist, das soll nach deutschem Willen als internationale Rechtsordnung Gemeinschaftswerk der Kontrahenten sein.
Nun ergibt sich diese für Deutschland so nutzbringende Konstruktion nicht mehr quasi automatisch aus der Zwangssolidarität der Imperialisten unter dem selbstauferlegten Druck ihrer antisowjetischen Weltkriegsstrategie. Die Bonner Politik muß damit rechnen, daß ihre Partner den deutschen Bedarf an militärischer Machtentfaltung nicht automatisch an gleicher Stelle und im gleichen Sinn verspüren; umgekehrt umgekehrt; und daß solche Diskrepanzen der Natur der Sache nach eher die Regel als die Ausnahme sind, das bezeugt Kohl selbst mit seinem „Ja – aber“ zu weltweiten Bundeswehreinsätzen. Um dennoch einen verläßlichen Supranationalismus der andern herzukriegen, gibt die BRD mit ihrer Bundeswehr ein Beispiel für Kollektivismus in der Weltsicherheitspolitik und macht damit eben vor allem den USA ein Angebot, das diese aus Bonner Sicht kaum ausschlagen können: Sie erkennt Amerika den Rang der Führungsmacht, auch für die europäischen Staaten in deren weltweiten Ordnungsinteressen, freiwillig zu und erklärt sich zum Mittun bereit. So sollen die US-Politiker es jedenfalls begreifen, wenn ihre Bonner Kollegen sie in alle europäischen Affären hereinziehen. Dafür, daß sie es ernst meinen, haben die Deutschen, jedenfalls nach ihrer eigenen Meinung, nicht zuletzt mit dem – einstweilen – fortgesetzten Verzicht auf eigene Atomwaffen gewissermaßen ein materielles Pfand hinterlegt – um dessen wirklichen politischen Wert man zwar streiten kann; aber in der Welt der Waffen und Strategien ist es allemal so, daß die freie Verfügung über die „absolute“ Vernichtungswaffe einen Staat respektabel, weil im Ernstfall unbeherrschbar macht.
5.
Damit ist der Widerspruch zu Deutschlands Politik der nationalen Emanzipation aus überkommener Unterordnung perfekt; und weil diese Politik für die BRD genauso essentiell ist wie die Strategie der deutsch-amerikanischen Bündnis-„Achse“, ist der Widerspruch auch nicht aufzulösen.
Um ihn gleichwohl zu bewältigen, ist die deutsche Politik darauf verfallen, ihr Bündniswesen zu reformieren und zu vervielfältigen. Die BRD meldet an der NATO ein Bedürfnis nach „Europäisierung“ an, den Anspruch nämlich auf – allmähliche – Gleichberechtigung der europäischen mit der amerikanischen Seite. Und sie organisiert und bedient neben der NATO einen weiteren, konkurrierenden militärischen Zusammenschluß, arbeitet nämlich mit Frankreich zusammen an der Wiederbelebung der WEU und will daraus, jedenfalls nach Maßgabe des Maastricht-Vertrags, die militärische Komponente der EU machen. So wird Deutschland als EU-Führungsmacht militärisch mehr als bloß das deutsche Ende der transatlantischen Beziehung und schafft sich auf diese Weise – zumindest ist das die Absicht – eine europäische Garantie gegen das Moment der Unterordnung, das es um der Aufrechterhaltung des eigentlichen Weltmacht-Bündnisses, der NATO, willen am Ende doch den Amerikanern zugestehen muß.
Die Inhalte dieser „europäischen Sicherheitsidentität“ sind exakt dieselben wie die neuen Aufgaben der NATO: militärische Integration im Westen Europas, zunehmende organisatorische Anbindung der Armeen des europäischen Ostens, „Heranführung“ der nicht mehr sozialistischen Staaten an die EU, Neutralisierung Rußlands, Überwachung der Kriegsfortschritte auf dem Balkan, Einsatzfähigkeit für nötige „Krisenreaktionen“ weltweit… Die deutsche Seite erkennt deswegen auch keinerlei Gegensatz oder Widerspruch zwischen dem Zusammenschluß der Europäer mit und dem ohne Amerika an und hat ihre harmonisierende Sicht sowohl in der WEU als auch in der NATO durchgesetzt. Dabei liegt der Widerspruch in der Verdoppelung selbst: im Gegensatz zu den USA, der eben damit konstituiert ist, daß man die transatlantisch gemeinsame Sache noch einmal eigens europäisch aufzieht. Denn damit wird immerhin der Standpunkt eingenommen, daß man eben diese Sache im transatlantischen Arrangement für nicht hinreichend aufgehoben hält. Und dieser Standpunkt wird auch durchaus explizit gemacht: Mit der WEU wollen die Europäer auch dann „militärisch handlungsfähig“ sein, wenn die USA an Kriegsaktionen nicht interessiert sind – also in Konkurrenz gegen deren Lagebeurteilung.
Den Ministern, die sich selbst in WEU-Politiker und NATO-Ratsmitglieder verdoppeln, bleibt dieser Widerspruch genausowenig verborgen wie den Amerikanern, die bei der Beschlußfassung über dieselben Fragen einmal dabei sind und einmal nicht. Eine Klärung des Verhältnisses war also nötig, und sie ist in genau dem Sinne herbeigeführt worden wie der zu lösende Widerspruch selbst: Der NATO wurde in aller Form der Vorrang vor der WEU zuerkannt und das Monopol auf supranationalen Streitkräfteeinsatz genommen; den soll die WEU in eigener Verantwortung und nach ihren „eigenen Planungsverfahren und -fähigkeiten“[33] auch anordnen dürfen. Die Verbindlichkeit der transatlantischen Allianz für ihre Mitglieder ist damit in Frage gestellt; aber die Frage wird sorgfältig umgangen, und zwar mit einer Kompromißformel, die den verdoppelten Allianzmitgliedern so gut gefällt, daß sie sie bei jeder Gelegenheit zitieren, so als hätten sie damit alle Widersprüche bereinigt und nicht erst eröffnet: Es ginge um „trennbare, jedoch nicht getrennte militärische Fähigkeiten“, die – jedenfalls in erster Linie – von und bei der NATO organisiert, für die WEU aber jederzeit abrufbar sein sollen.[34]
Im ersten Ernstfall, bei den Jugoslawien-Einsätzen, hat das alles funktioniert – weil die Konflikte zwischen den Alliierten um die Definition der Lage und der Eingriffsnotwendigkeiten in wieder anderen Gremien und auf noch anderen Ebenen ausgetragen worden sind. NATO und WEU haben sich Einsatzfelder, Kommandos und militärische Mittel nach denkbar verzwickten Regeln, aber einvernehmlich geteilt; die Flugzeuge fliegen als NATO-Maschinen, die Schiffe überwachen teils als US-, teils als NATO-, teils als WEU-Marine die Adria; von der Landseite organisieren WEU-Einheiten das Embargo gegen Rest-Jugoslawien. Gleichzeitig treiben die Europäer nach der Wiederbelebung der WEU deren allmähliche Emanzipation aus dem Status des Schmarotzers an NATO-Arsenalen vorsichtig voran, z.B. auf dem für moderne Gewaltapparate so interessanten Gebiet der Satelliten-Aufklärung: Ausgerechnet da scheint die Europäer ihre Abhängigkeit von NATO-Fähigkeiten am meisten zu schmerzen, und so „bekräftigten“ ihre Minister in ihrer „Kirchberg-Erklärung“ „ihren Wunsch, ein unabhängiges europäisches Satellitensystem aufzubauen.“[35] Was da aus- und aufgebaut wird, geht auf jeden Fall zu Lasten der überkommenen, an die NATO gebundenen Strukturen und Potenzen. Und daß die WEU-Politik der Europäer so auch gemeint ist, verraten sie am deutlichsten in ihrem stereotypen Dementi: der Vorrang der NATO werde damit nicht in Frage gestellt, alles sei mit der kollektiven Verteidigung im nordatlantischen Rahmen vereinbar.[36] Tatsache ist: Wenn es darum gehen soll – und darum geht es erklärtermaßen –, der EU ein eigenes, frei einsetzbares Militär zu verschaffen, dann betreiben die Europäer neben ihrem Bündnis mit Amerika ihren Aufstieg zur Gleichrangigkeit mit den USA, also die Beseitigung des Vorrangs der transatlantischen Supermacht, dessen Anerkennung die NATO so eigentümlich supranational gemacht hat.
Genau deshalb stellen die Deutschen den Ausbau der WEU, den sie vorantreiben, zugleich nachdrücklich unter den Vorbehalt, daß er nicht sein soll und werden darf, was er ist, nämlich die Eröffnung einer Konkurrenz mit den USA um strategische Fragen. Die BRD besteht auf einer „Ökonomie“ einander widersprechender Bündnisverpflichtungen, die alle Vorteile der transatlantischen „Achse“ sichern soll, ohne die Nation weiter unter dem Nachteil der Abhängigkeit von den USA leiden zu lassen.
6.
Das mag gehen, solange es eben geht. Dafür, daß es fürs erste gutgeht, bürgen die überkommenen und derzeit im entsprechenden Sinn umgebauten Militärstrukturen der Allianz und die im Rahmen der WEU neu aufgebauten Verflechtungen. So werden die NATO-Truppen auf deutschem Boden in mehrere multinationale Armeekorps umgebaut – zwei deutsch-amerikanische, das eine unter deutschem, das andere unter amerikanischem Kommando; ein deutsch-belgisch-amerikanisches; ein deutsch-niederländisches; ein deutsch-dänisches; eine deutsch-belgisch-niederländisch-britische Eingreiftruppe; daneben das der NATO nicht integrierte, aber verfügbare deutsch-französisch-belgisch-spanische Euro-Corps als designierte Keimzelle einer späteren Euro-Streitmacht… Auf niedrigerer Ebene, aber durchaus auf Ausbau angelegt, werden feste bi- und trilaterale Kooperationsbeziehungen eingerichtet, insbesondere zu den östlichen Nachbarn, neben oder innerhalb der „Partnerschaft für den Frieden“ oder der entsprechenden WEU-Verdoppelungen: mit Polen einmal unter Einschluß Dänemarks, einmal gemeinsam mit Frankreich; mit der tschechischen Republik; mit der Slowakei… Ein groß dimensioniertes Rüstungsgeschäft mit Schweden unterstreicht die strategische Weiterentwicklung der Ostsee zum deutsch-europäischen Binnenmeer… Und so weiter. In allen Himmelsrichtungen baut die BRD mit ihrer Bundeswehr multinationale „Strukturen“ auf.
Die immanenten Argumente für die hier angestrebte Integration von Truppen verschiedener Nationalität sind Effektivität und Ersparnis. Sie hat aber daneben eine politische Bedeutung; und es ist unverkennbar, daß es den Deutschen nicht bloß in Sonntagsreden darum ganz wesentlich geht: Vorkehrungen gegen einen fortschreitenden Rückzug der USA aus der Verstrickung mit Euro-Kräften zu treffen und für eine Handlungsfähigkeit der Europäer zu sorgen, die mit deren Einbindung in ein eurostrategisches Gesamtnetz steht und fällt. So versucht Deutschland seiner berechnend-widersprüchlichen NATO-WEU-Politik möglichst viel materielle Realität zu geben. Der deutsche Militarismus arbeitet daran – das ist sein neuer „Sonderweg“! –, Europa bis an die Grenze der GUS mit einem Netzwerk supranationaler militärischer Strukturen zu überziehen; durchaus auch mit festen Verbindungslinien zum großen transatlantischen Partner, dessen taktische Atomwaffen auch weiterhin auch von deutschen Maschinen transportiert werden sollen; und zwar alles von Deutschland aus und auf Deutschland hin. Militärisch soll viel laufen auf dem alten Kontinent – und nichts an Deutschland vorbei: Das bringt die BRD mit ihrer Bundeswehr in Gang.
So will sie einen reibungslosen Übergang hinkriegen von der dominierenden Wirtschaftsmacht Europas zur Konkurrenz um die strategische Hegemonie: in aller Freundschaft zu Amerika, die sie damit untergräbt.
[1] NATO ohne Hauptfeind – Von der Abschreckung zur totalen Kontrolle, in: GegenStandpunkt 1-92, S.167. Daß Staaten, wenn sie ihre Apparate zur technologisch perfektionierten Massentötung zusammenlegen, kein Kriegsbündnis, sondern eine Wertegemeinschaft bilden, sagt alles über Werte. Daß sie damit ausschließlich dem Frieden dienen, sagt alles über den Frieden und die Bedingungen, unter denen Staaten ihn halten.
[2] Dazu mehr im nächsten Abschnitt.
[3] Im Jargon der NATO-Gipfelkonferenz Anfang des Jahres in Brüssel: „Aufbauend auf der engen und langjährigen Partnerschaft zwischen den nordamerikanischen und europäischen Bündnispartnern treten wir dafür ein, Sicherheit und Stabilität in ganz Europa zu stärken. Wir haben den Wunsch, Bindungen zu den demokratischen Staaten im Osten von uns zu festigen. Wir bekräftigen, daß die Allianz, wie in Artikel 10 des Washingtoner Vertrags vorgesehen, für eine Mitgliedschaft anderer europäischer Staaten offenbleibt, die in der Lage sind, die Grundsätze des Vertrages zu fördern und zur Sicherheit des nordatlantischen Gebiets beizutragen. Wir erwarten und würden es begrüßen, wenn eine NATO-Erweiterung demokratische Staaten im Osten von uns erfassen würde, als Teil eines evolutionären Prozesses, unter Berücksichtigung politischer und sicherheitspolitischer Entwicklungen in ganz Europa.“ (Bulletin Nr.3/94, S.21) Und Außenminister Kinkel im März in Paris: „Wir streben eine multidimensionale, abgestufte Vernetzung der Sicherheitsinteressen aller Staaten der Region an. Es wäre schlichtweg falsch, den Staaten Mittel- und Osteuropas in diesem Europa einen Platz zwischen West und Ost zuweisen zu wollen.“ (Bulletin Nr.29/94, S.258)
[4] Das „Rahmendokument“ der „Partnerschaft für den Frieden“, das die NATO-Gipfelkonferenz im Januar 94 verabschiedet hat, sieht in seinem Punkt 3 dazu folgendes vor: „Die anderen unterzeichnenden Staaten dieses Dokuments werden mit der NATO gemeinsam auf die folgenden Ziele hinarbeiten: a) Förderung von Transparenz nationaler Verteidigungsplanung und Haushaltsverfahren; b) Gewährleistung demokratischer Kontrolle über die Verteidigungskräfte; c) Aufrechterhaltung der Fähigkeit und Bereitschaft, zu Einsätzen unter der Autorität der VN und/oder Verantwortung der KSZE beizutragen, vorbehaltlich verfassungsrechtlicher Erwägungen; d) Entwicklung kooperativer militärischer Beziehungen zur NATO mit dem Ziel gemeinsamer Planung, Ausbildung und Übungen, um ihre Fähigkeit für Aufgaben auf den Gebieten Friedenswahrung, Such- und Rettungsdienst, humanitäre Operationen und anderer eventuell noch zu vereinbarender Aufgaben zu stärken; e) auf längere Sicht Entwicklung von Streitkräften, die mit denen der Mitgliedsstaaten der Nordatlantischen Allianz besser gemeinsam operieren können.“ (Bulletin Nr.3/94, S.24) Die leitende Absicht bringt ein Sicherheitsberater der US-Regierung folgendermaßen auf den Punkt: „Der Weg zu kollektiven Verteidigungsverpflichtungen und militärischer Integration würde die Verteidigungspolitik entnationalisieren und Mißtrauen der Mitgliedsstaaten untereinander aus deren jeweiliger Kalkulation des Sicherheitsrisikos entfernen.“ (Daniel Hamilton, Jenseits von Bonn. Amerika und die ‚Berliner Republik‘ Frankfurt/M – Berlin 1994, S.115)
[5] Verbindungsbüros sind eingerichtet, Verbindungsoffiziere abgestellt, politische Konsultationen für jeden Bedarfsfall zugesagt; in Belgien arbeitet bereits eine „Partnerschaftskoordinierungszelle“. Die Eingreiftruppen, auf die die NATO ihre Streitkräfte zum großen Teil umstellt, sollen als „Combined Joint Task Force“ unter dem Kommando eigener, alle Waffengattungen übergreifender Hauptquartiere stehen: eine für Militärfachleute offenbar aufregende Neuerung, die es u.a. erleichtern soll, auch NATO-fremde Streitkräfte an NATO-Unternehmungen mitwirken zu lassen. Ein Beispiel für den neuen Blick auf Europa als ganzheitliche strategische Sphäre unter NATO-Kommando ist die Gründung eines eigenen Ostsee-Kommandos (BALTAP), übrigens unter dänischem Oberbefehl. Und für den Herbst dieses Jahres sind im Rahmen der „PfP“ ein erstes Seemanöver mit neuen Kooperationspartnern sowie das erste NATO-Manöver in Polen vorgesehen.
[6] Der Bundesverteidigungsminister sieht das alles als Gesamtpaket: „Wenn wir ihnen (sc. den „zentraleuropäischen Staaten“) helfen wollen im Aufbau demokratischer Verhältnisse, in der Herstellung einer funktionierenden sozialen Marktwirtschaft und in ihrer sicherheits- und verteidigungspolitischen Neuorientierung, dann müssen wir bereit sein, sie als Mitglieder in der Union (sc. der EU) aufzunehmen. Dabei kann es natürlich keine Schieflagen geben – etwa wirtschaftliche Gemeinschaft ja, Sicherheitsgemeinschaft nein.“ (V. Rühe vor dem Bergedorfer Gesprächskreis im März 94 in Petersburg; Bulletin 29/94 S.261)
[7] Nach Erkenntnissen
des ehemaligen US-Außenministers und
Friedensnobelpreisträgers H. Kissinger ist der Russe
seit altersher folgendermaßen beschaffen: In seiner
Geschichte hat Rußland nur selten die Grenzen seiner
Nachbarn infrage gestellt. Seine Politik bestand
vielmehr darin, die Nachbarn unter Druck zu setzen oder
zu erpressen.
Offenbar einfach nur so, aus Bosheit.
Rußland hat sich auch niemals als rein europäische
Macht betrachtet. …und hat sich niemals ernsthaft mit
dem Gedanken befaßt, seine Beziehungen zu seinen
Nachbarn – einschließlich jener in Europa –
internationalen Entscheidungen zu unterwerfen.
So
wie das Amerikaner, Deutsche, Briten usw. immer mit
ihren weltweiten Affären getan haben. Und es ist
nicht anzunehmen, daß es mit der Partnerschaft für den
Frieden eine solche Verpflichtung verbindet.
Obwohl
die doch genau so gemeint ist! Der Zusammenbruch des
sowjetischen Imperiums, das ja eine Fortsetzung des
zaristischen Großreiches war, ist von vielen Russen als
Demütigung empfunden worden; im nun demokratischen
Rußland ist die Versuchung zu erkennen, den
Nationalismus zu benutzen, Einheit anzustreben…
(Welt am Sonntag Nr.33,
S.4)
[8] Genau diese
Priorität mißfällt manchen unverbesserlichen Haudegen
des „Ost-West-Konflikts“ als Konfusion und
Zersetzungsgefahr für den guten alten Pakt. Sie
fordern: Eine sinnvolle atlantische Politik muß …
zwei Erfordernisse erfüllen: Einmal den Kern der
Atlantischen Allianz wieder in eine eindeutige Richtung
zu bringen, zum andern die Aktivitäten der
Partnerschaft für den Frieden organisatorisch von denen
der Allianz zu trennen.
(H.
Kissinger in der Welt am Sonntag Nr.33, S.4)
[9] Schon die regierenden Realsozialisten mochten Klassenkampf von nationaler Autonomie und proletarischen Internationalismus von Völkerfreundschaft nicht unterscheiden. Für die jetzt herrschenden Nationalisten fallen bei ihrer Absage an die Disziplin des „sozialistischen Lagers“ die Abkehr vom Sozialismus hin zum Nationalismus und die nationalistische Abneigung gegen Rußland erst recht ineins.
[10] Die Deutschen tun
sich hier gern mit Verständnis für die Russen hervor.
Verteidigungsminister Rühe in Sankt Petersburg:
„Rußland knüpft an die Teilnahme an diesem
Programm (sc. „PfP“) die Erwartung, daß die
NATO mit Rußland eine Kooperationsbeziehung von
besonderer Qualität entwickelt. Die Atlantische Allianz
ist gut beraten, auf die russische Erwartungshaltung
einzugehen.“ Zum Inhalt dieser „Sonderbeziehungen“
wird dann allerdings gar nichts weiter angegeben, als
daß das inskünftige Groß-Europa sie verspricht. Fest
steht das „aber“, daß nämlich aus Rußlands Größe keine
gleichberechtigte Mitsprache über Europa folgen darf.
Rühe: Wir müssen allerdings darauf achten, daß die
besondere Qualität der Partnerschaft zwischen der NATO
und Rußland nicht den Integrationsprozeß anderer in die
westlichen Institutionen erdrückt.
(Bulletin Nr.29/94, S.263) Oder in
einer Rede im Mai in Ludwigsburg: Rußland und die
NATO brauchen eine tragfähige Partnerschaft. Rußland
muß das Gefühl haben
– und das wird sich ja wohl
noch vermitteln lassen! –, als Großmacht und Partner
behandelt zu werden. Aber Rußland muß dabei vor allem
durch sein eigenes Handeln das Vertrauen seiner
Nachbarn und Partner erhalten.
(Bulletin Nr.43/94, S.378)
Aufschlußreich auch die klaren Worte, mit denen der
deutsche Außenminister im Juni in Istanbul beim Treffen
mit seinen NATO-Kollegen die heftig angestrebten guten
Beziehungen zu Rußland umrissen hat: Rußland hat im
Hinblick auf Größe, geographische Lage, Bevölkerung und
Militärpotential wie auch als ständiges Mitglied des
VN-Sicherheitsrats für Sicherheit und Stabilität in
Europa besondere Bedeutung. Ich sehe daher die
Notwendigkeit, über den Rahmen der Partnerschaft für
den Frieden hinaus zu einer vertieften Beziehung
zwischen NATO und Rußland zu kommen.
Soweit ein
doppeldeutiges Entgegenkommen: Rußland sprengt den
Rahmen, den Deutschland und die NATO um Europa ziehen
wollen; es hat ein Anrecht auf Sonderbehandlung. Wie
die gemeint ist, folgt sogleich: Rußland gehört auf gar
keinen Fall zu den Mächten, die um Europa einen
Sicherheitsrahmen ziehen dürfen. Eines muß
allerdings außer Zweifel stehen: Damit ist keinesfalls
ein Direktorium der NATO und Rußlands für europäische
Sicherheitsfragen gemeint.
Dieses Direktorium ist
noch immer die NATO allein: Die NATO bleibt auch
nach Ende des Kalten Krieges der Sicherheits- und
Stabilitätsanker in Europa.
(Bulletin Nr. 58/94, S.545)
[11] Daß die Russen zu
Jugoslawien eine eigene Meinung haben, weist
NATO-Denker in dieselbe Richtung: Die auf dem Balkan
und im ‚nahen Ausland‘ sichtbar gewordene
selbstbewußtere russische Außenpolitik hat die
Notwendigkeit westlicher kollektiver
Sicherheitsvorsorge wieder in Erinnerung gerufen.
(Senior Planning Officer M. Rühle
von der NATO-Abteilung für Politische Angelegenheiten
in dem „Informationsdienst zur Sicherheitspolitik“: Der
Mittler-Brief Nr.2/2. Quartal 1994, S.2) Wenn so
wenig reicht, um NATO-Offiziere an einen Krieg gegen
Rußland denken zu lassen, dann können sie diese Option
kaum sehr vergessen haben.
[12] Deutlicher als
die regierenden Politiker drücken sich deren Vordenker
aus. Der schon zitierte Clinton-Berater Hamilton mahnt
u.a. an: … müssen wir unsere zeitweilig etwas
gönnerhafte Haltung aufgeben, die politischen Führer in
Moskau dürften nur mit Samthandschuhen angefaßt werden.
Rußland … verdient ohne Frage unseren Respekt. Dies
bedeutet jedoch keinesfalls, daß wir jedem russischen
Wunsch oder Verlangen zustimmen müßten. Wir haben
beispielsweise zu häufig das russische Argument
akzeptiert, Rußland müsse angesichts der Tatsache, daß
25 Millionen Russen in seinen Nachbarstaaten lebten,
auch ein Recht zur Verteidigung dieser Konationalen
erhalten. … müssen wir uns daran erinnern, daß
Deutschland Ende der dreißiger Jahre ähnliche Argumente
vorbrachte und schließlich die Vereinigten Staaten mit
Deutschland Krieg führten. … Wenn wir Rußland ein Recht
auf eine derartige Politik einräumen, dann wird dies zu
weitergehenden russischen Forderungen führen, zu einer
Stärkung der russischen Armee und des
militärisch-industriellen Komplexes und – im Ergebnis –
zu Rückschritten im Reformprozeß.
(a.a.O. S.108f.) Zu den
rußlandpolitischen Differenzen zwischen den USA und
Deutschland äußert sich Hamilton im Hinblick auf
zukünftige Gefahren für die deutsch-amerikanische
Freundschaft so: Das Ende der Reformen im Osten
würde höchstwahrscheinlich einen bitteren Streit
zwischen Deutschland und den USA über Gründe und Folgen
auslösen. Aus Furcht vor einer weiteren
Destabilisierung oder gar erneuten Bedrohung aus dem
Osten wären die Deutschen aufgrund der geographischen
Nähe wahrscheinlich eher geneigt, sich auf
stabilisierende Maßnahmen zu konzentrieren, als die
distanzierteren Amerikaner, die eher auf gewisse
Kriterien nationalen Verhaltens pochen und schneller
bereit wären, zur Unterstreichung ihrer Haltung ein
Instrumentarium politischer, wirtschaftlicher und sogar
militärischer Maßnahmen einzusetzen.
(a.a.O. S. 105)
[13] Erst im Mai hat
die Nukleare Planungsgruppe der NATO bei ihrer
Ministertagung in Brüssel wieder einmal Gründe zur
Besorgnis ausgemacht: Einer der wichtigsten ist die
Notwendigkeit, daß die Kontrolle über das
Nuklearwaffenarsenal der ehemaligen Sowjetunion
erhalten bleibt.
(Bulletin Nr.
55/94, S. 523)
[14] Dazu gibt es von
deutscher Seite schöne Floskeln: Wir müssen alles
tun, daß Rußland in schwieriger Lage den richtigen Weg
geht. Aber wir müssen auch dagegen gefeit sein, daß
dort die falschen Kräfte die falschen Entscheidungen
treffen.
(Verteidigungsminister Rühe im Mai bei der
Verabschiedung der Bundeswehr aus Ludwigsburg: Bulletin
Nr. 43/94, S.378)
[15] Mit dem
erfolgreichen Sarajewo-Ultimatum war ein
entscheidender Schritt in eine gesamteuropäische
Sicherheitsrolle der NATO vollzogen worden. Der Ende
Februar erfolgte Abschuß von vier die Flugverbotszone
verletzenden serbischen ‚Galeb‘-Jägern wirkte vor
diesem Hintergrund wie eine Bestätigung dieser neuen
Rolle.
(M.Rühle, a.a.O.
S.4)
[16] Das ungelöste sprachliche Problem, ein aktives Subjekt, das seine eigenen Erfordernisse wahrnimmt, ins Passiv des Adressaten auswärtiger Anforderungen zu versetzen, sagt alles darüber, wer hier wen wozu auffordert.
[17] Auch dies ein interessanter sprachlicher Kunstgriff, um klarzustellen, daß die NATO nur macht, was sie beschließt.
[18] Die Militärplaner
der Allianz bestimmen das Verhältnis zwischen der NATO
und ihren supranationalen „Auftraggebern“ etwas klarer,
weil sie den dauernden diplomatischen Eiertanz um jedes
bißchen Eingreifen nicht leiden können. So schlägt der
bereits zitierte Senior Planning Officer M.Rühle im
Mittler-Brief vor: Die Option einer von Mandaten
unabhängigen Handlungsfähigkeit der Allianz sollte
untersucht und gegebenenfalls konkretisiert werden. …
Die gegenwärtig sich abzeichnende Zweiteilung
jedenfalls, derzufolge die NATO entweder nach Artikel 5
und 6 des Washingtoner Vertrages oder unter UN-Mandat
handelt, genügt einer umfassenden westlichen
Krisenbeherrschungsstrategie nicht und kann daher
bestenfalls als eine Übergangsphase betrachtet werden,
in deren Verlauf sich – so bleibt zu hoffen – ein neues
Allianzverständnis durchsetzt, das auch eigenständige
Handlungsoptionen einschließt.
(a.a.O. S.7)
[19] Zugleich als letzter: Mit der Emanzipation des Bündnisses von seiner alten „Abschreckungs“-Aufgabe fällt auch die Scheidung zwischen einem angestammten Zuständigkeitsgebiet, der „area“, und dem Rest der Welt, „out of…“, weg.
[20] Näheres in GegenStandpunkt 4-92, S.121: Die USA in der Krise, sowie GegenStandpunkt 3-93, S.79: IWF heute: Supranationaler Kredit unter der Bedingung der Krisenkonkurrenz. Schon der Golfkrieg der USA war nicht zuletzt ein machtvoller Einspruch gegen die Art, wie die konkurrierenden Nutznießer des Weltmarkts sich unter dem Schutzschirm und zugleich auf Kosten Amerikas eingerichtet hätten. Seither sind die einschlägigen Vorwürfe an die Japaner und Europäer immer deutlicher zur Sache gekommen – vgl. die Artikel zum Fortschritt vom GATT zur WTO: Szenarien für einen Weltwirtschaftskrieg neuen Typs in GegenStandpunkt 2-94, S.26, sowie zur amerikanisch-japanischen Partnerschaft: So frei ist der Welthandel, in GegenStandpunkt 2-94, S.40.
[21] Daß britische Kriegsschiffe zum Schutz der königlichen fish&chips-Produktion auf spanische Fischerboote schießen, ist noch kein Krieg, aber auch nicht gerade liebe Gewohnheit unter EU-Partnern.
[22] Daß die
Vereinigten Staaten „Deutschlands unersetzlicher
Partner in der Welt bleiben“, begründet der schon
zitierte Berater der Clinton-Regierung, D. Hammilton,
u.a. mit folgender aufschlußreicher Einschätzung des
innereuropäischen Einigungswillens: Die Vereinigten
Staaten sind die einzige Nation, die in Europa ohne
innere Vorbehalte gegenüber oder sogar latente Angst
vor Deutschland engagiert ist. Sie können offene und
freundschaftliche Beziehungen unterhalten, ohne von
Mißtrauen geplagt zu werden, während so gleichzeitig
ein beruhigendes Gegengewicht jenen gegenüber
geschaffen wird, die Deutschlands neue Größe nervös
macht.
(a.a.O. S.88)
Sprachlich ist zwar nicht ganz klar, ob die Amerikaner
ein – für die andern trostreiches und insofern für
Deutschland nützliches – Gegengewicht gegen
Deutschland oder gegen seine mißtrauischen
Nachbarn sein wollen. Sachlich ist dafür um so
klarer, daß Amerika anbietet, Vorbehalte gegen eine
deutsche Hegemonie in Europa brechen zu helfen.
[23] Berater Hamilton legt den Deutschen diesen Aspekt als besonderen bleibenden Nutzen der NATO für sie ans Herz: Die NATO „erlaubt es Deutschland auch, sich selbst den Besitz oder die Kontrolle nuklearer Waffen weiterhin zu versagen, während sie ihm gleichzeitig in nuklearen Fragen eine Stimme gibt, die es sonst nicht hätte“ (a.a.O. S. 114) – und die, darf man wohl ergänzen, die USA ihm auch vorzuenthalten wüßten.
[24] Zur Klarheit in dieser Grundfrage des deutschen Militarismus trägt auch die innenpolitische Debatte zwischen Regierung und Opposition bei. Die SPD mahnt unaufhörlich die gute alte „Kultur der Zurückhaltung“ an – so absichtsvoll mißdeutet die Partei des Kanzlers der eurostrategischen „Nachrüstung“ 40 Jahre militärischen Aufwuchs der BRD zum Eckpfeiler der „Abschreckung“. Sie gibt sich genau dann betont anti-interventionistisch, wenn sie die nationale Bereitschaft zu bewaffneten Interventionen im Zeichen völkerrechtlicher Legitimationen bekräftigt. So sorgt sie für den Schein internationalistischer und zugleich friedensmoralischer Gewissenhaftigkeit beim Bundeswehreinsatz – und läßt es gar nicht dabei: Ihren Moralismus legitimiert sie nationalistisch, indem sie nachdrücklich fordert, alle militärischen Unternehmungen strikt am nationalen Interesse auszurichten, das mit der bisherigen „Zurückhaltung“ doch gut gefahren sei. Die Christlich-Liberalen antworten darauf mit der Polemik, die Sozialdemokratie bestände wieder einmal auf einem „nationalen Sonderweg“, während es ihnen darum ginge, unpassende deutsch-nationale Abweichungen vom imperialistisch Normalen zu beseitigen: weltweites Zuschlagen gewissermaßen als Richtschnur eines angepaßten, unauffälligen staatlichen Verhaltens. So streiten zwei Spielarten moralischer Legitimation um die Legitimation des Gleichen: des nationalen Aufbruchs aus strategischen Verhältnissen, unter denen das neue Deutschland sich mittlerweile unerträglich fremdbestimmt vorkommt.
[25] Die aktuelle
Sprachregelung der NATO dazu lautet: Wir haben … die
wesentliche Rolle der Nuklearstreitkräfte bekräftigt
einschließlich substrategischer Kräfte, die in
europäischen Mitgliedsstaaten stationiert und auf dem
zur Gewährleistung von Sicherheit und Stabilität
erforderlichen Mindestniveau gehalten werden.
(Kommuniqué der Ministertagung des
Verteidigungsausschusses und der Nuklearen
Planungsgruppe der NATO – die gibt es nämlich nach wie
vor – im Mai in Brüssel, Bulletin Nr.55/94,
S.521)
[26] Der
Verteidigungsminister erklärt diese Politik so: „Wir
haben uns schon in Friedenszeiten bewußt in
gegenseitige Abhängigkeiten begeben“ – das „wir“ sind
die NATO-Partner. Dieses Maß an Integration ist der
größte Fortschritt in Europa, den gerade Deutschland
nicht in Frage stellen darf. Sonst zerstört man die
europäische Integration, sonst zerstört man die
NATO-Integration und öffnet den Weg zur
Renationalisierung der Politik, die am allerwenigsten
wir Deutsche uns leisten können.
(V.Rühe am 6.5.94 in Ludwigsburg, Bulletin
Nr.43/94, S.378) Solche Sprüche sind kein
propagandistisches Ablenkungsmanöver, sondern
rüstungspolitische Leitlinie. Nicht nur bei der
Luftraumüberwachung durch die AWACS-Systeme der NATO,
die Rühe in diesem Zusammenhang erwähnt, sondern auch
z.B. bei der Marine: „FR: Kann man stärker
international zusammenarbeiten? Weyher (sc. Inspekteur
der Bundesmarine): Das tut man bei der Marine bereits.
Es gibt keinerlei Pläne einer deutschen Marine, sich
ein strategisches Potential zuzulegen. Also nukleare
U-Boote oder Flugzeugträger oder ähnliche Fahrzeuge,
das machen im Bündnis ohnehin andere.“ Immerhin:
Für Transportzwecke planen wir zusammen mit Heer und
Luftwaffe ein Mehrzweckschiff als eigenständige
Möglichkeit, Heeres- oder Luftwaffeneinheiten zu
internationalen Einsätzen zu bringen.
(Interview in der Frankfurter Rundschau,
16.7.94)
[27] Dazu ein paar Details in Punkt 6.
[28] Dazu gehören auch
militärdiplomatische Gesten der folgenden Art: „Nach
dem Abzug der russischen Truppen aus Deutschland ist
die Fortentwicklung unserer verteidigungspolitischen
Beziehungen von besonderer Bedeutung“ – schließlich
sollen die Russen nicht auf die Idee kommen, sie
könnten jemals wieder vor der Notwendigkeit stehen,
sich gegen Deutschland verteidigungspolitisch zu
behaupten. Ich habe daher mit meinem russischen
Kollegen beschlossen, in diesem Jahr noch eine
gemeinsame Marineübung durchzuführen, der 1995 eine
deutsch-russische Stabsrahmenübung in Rußland und 1996
ein deutsch-russisches Manöver in Deutschland folgen
werden.
(Rühe im März in Sankt
Petersburg, Bulletin Nr.29/94, S.263)
[29] Zu den gestanzten
Formeln der deutschen Amerika- und NATO-Diplomatie
gehören Beteuerungen wie die folgende des
Bundesaußenministers: Ohne Bündnis kein
Gleichgewicht in Europa, vor allem aber keine
gleichgewichtige Partnerschaft mit Rußland, wie wir sie
gemeinsam anstreben.
(Kinkel
in Washington, Bulletin Nr.36/94, S.322) Ohne
Position der Stärke geht also kein deutsches
Rußland-Engagement; für die stehen die USA gerade.
Umgekehrt wissen auch die Amerikaner, was sie an den
Deutschen haben: eine Wirtschaftsmacht, die Rußland –
ähnlich wie die anderen Osteuropäer – auf die
politische Ökonomie der Unterwerfung unter den
Weltmarkt festlegt, die für sie immer noch ihre
Weltordnung ist: Ohne Deutschland wird es sich als
unmöglich erweisen, Osteuropäer und Russen in westliche
Strukturen einzugliedern. Ohne Deutschland ist es
unwahrscheinlich, daß diese Länder sich wirtschaftlich
erholen.
(D. Hamilton, a.a.O.
S.104)
[30] Zu deren Logik s. Punkt 5.; zur Sache vgl. zuletzt GegenStandpunkt 1-94, S.165: Die Paten des „Friedens für Jugoslawien“.
[31] Eine schöne Dialektik der Reihenfolge: Die Lehre vom Ende haben die Deutschen von Anfang an beherzigt. Sie waren sich eben von Anfang an sicher, wozu sie im Bedarfsfall die Amerikaner brauchen!
[32] Was und wen die
Deutschen mit-meinen, wenn sie sich selbst
„Bündnisfähigkeit“ abverlangen, das hat ihr
Verteidigungsminister Rühe im Mai in Ludwigsburg sehr
schön klargestellt: Internationale Einsätze der
Bundeswehr sind in erster Linie eine politische, viel
weniger eine militärische Frage. Wir werden
bündnisunfähig, wenn wir nicht in der Lage sind,
grundsätzlich dasselbe zu machen wie unsere Verbündeten
und Freunde. … Die Geschäftsgrundlage muß für alle
gleich sein. Niemand darf Exklusivklauseln
beanspruchen.
(Bulletin der
Bundesregierung 43/94, S.378) Die
Verfassungslage, die die Deutschen eine Zeitlang als
„Exklusivklausel“ strapaziert haben, weil sie sich auf
gar keinen Fall als Helfershelfer fremder Anliegen
hergeben wollten, so wie sie es ihrerseits ihren
Partnern zumuten: diese Verfassungslage ist ja nun
höchstrichterlich in Ordnung gebracht; rechtzeitig und
passend zur allmählich in Fahrt kommenden neuen
deutschen Außenpolitik. Nach der Dialektik der
deutschen Bündnispolitik haben die Karlsruher Richter
damit gleiche Bedingungen für alle geschaffen: Niemand
„darf Exklusivklauseln beanspruchen“!
[33] Aus der „Kirchberg-Erklärung“ der WEU vom Mai dieses Jahres, Bulletin Nr. 46/94, S.406.
[34] Die Staats- und
Regierungschefs der NATO haben Anfang des Jahres auf
ihrer Gipfelkonferenz in Brüssel beschlossen, den Um-
und Ausbau der Paktstreitkräfte im Hinblick auf die
neuen Zielsetzungen des Bündnisses unter Beratung
durch die Militärbehörden und in Abstimmung mit der WEU
… so an(zu)gehen, daß trennbare, jedoch nicht getrennte
militärische Fähigkeiten entstehen, die durch die NATO
oder die WEU genutzt werden können.
(Bulletin Nr.3/94, S.21) Der
Ministerrat der WEU hat dann im Mai in Luxemburg in
seiner „Kirchberg-Erklärung“ ‚begrüßt‘, „daß
das Gipfeltreffen“, nämlich eben jenes der NATO, „den
Grundsatz bestätigte, wonach kollektive Ressourcen und
Fähigkeiten des Bündnisses für WEU-Operationen zur
Verfügung gestellt werden können, um die WEU als
Verteidigungskomponente der Europäischen Union und als
Instrument zur Stärkung des europäischen Pfeilers der
Allianz zu stärken“, ‚betont‘. „wie wichtig
die laufenden Arbeiten in der WEU zu den mit der WEU
zusammenhängenden Aspekten der Anpassung der Strukturen
des Atlantischen Bündnisses sind“, und
‚unterstrichen‘, wie wichtig eine
Abstimmung mit dem Bündnis über die Umsetzung des
Konzepts alliierter Streitkräftekommandos und die
Entwicklung trennbarer, jedoch nicht getrennter
militärischer Fähigkeiten ist, um gegebenenfalls ihren
effektiven Einsatz durch die WEU und in diesem Falle
unter ihrem Kommando zu gewährleisten.
(Bulletin Nr.46/94, S.406) In ihrer
Eigenschaft als NATO-Minister haben dieselben
regierenden Häupter gemeinsam mit ihrem amerikanischen
Kollegen im Juni in Istanbul wiederum die
Standpunkte der WEU-Minister in der Kirchberg-Erklärung
… zur Kenntnis genommen
, „messen“ der Arbeit zur
weiteren Anpassung der Strukturen und Verfahren der
Allianz
große Bedeutung bei, die die Fähigkeit
der Allianz verstärken wird, auf Krisen zu reagieren
und trennbare, jedoch nicht getrennte militärische
Fähigkeiten bereitzustellen, die durch die NATO oder
die WEU eingesetzt werden können
, und bekennen sich
zu einem „Kurs“, der die Bereitschaft der Allianz
einschließt, auf der Grundlage von Konsultationen im
Nordatlantikrat ihre kollektiven Ressourcen für
WEU-Operationen zur Verfügung zu stellen, die von den
europäischen Bündnispartnern in der Verfolgung ihrer
gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik durchgeführt
werden.
(Bulletin Nr.58/94,
S.547) Die letztere Formulierung hat den
Ministern so gut gefallen, daß sie sie 10 Punkte weiter
noch einmal wörtlich genauso aufschreiben.
[35] Bulletin Nr. 46/94, S.407. Der deutsche
Außenminister hatte zuvor für dieses Projekt geworben:
Dies ist ein sehr ehrgeiziges Konzept. Wir stehen
hier vor der Entscheidung, ob wir … in die Projektphase
übergehen. Ich glaube, wir sollten diese
Herausforderung im Prinzip annehmen. Denn ohne eine
gemeinsame europäische (!) Aufklärungskapazität ist
eine gemeinsame (!) Krisenbekämpfung letztlich kaum
realisierbar.
(ebd.
S.410)
[36] „Die Minister (sc. die des WEU-Ministerrats im Mai in Luxemburg) verwiesen auf die längerfristige Perspektive einer gemeinsamen Verteidigungspolitik in der Europäischen Union, die im Laufe der Zeit zu einer gemeinsamen Verteidigung führen könnte, die mit der des Atlantischen Bündnisses vereinbar ist.“ (Bulletin Nr.46/94, S.406) Zur einschlägigen deutschen Heuchelei gehört die auch in zahllosen Dokumenten niedergelegte Sprachregelung, mit der Emanzipation der WEU würde letztlich doch nur dem alten amerikanischen Wunsch nach „Stärkung des europäischen Pfeilers“ entsprochen. Die USA haben zu Zeiten klarer strategischer Ost-West-Verhältnisse von ihren Alliierten mehr Bündnisleistungen verlangt und diese Forderung ins Bild vom „eigenständigen Pfeiler“ gefaßt. Was die EU jetzt mit der WEU anstrebt, haben sie damit ebensowenig gemeint wie das, was die Deutschen tun, um Amerikas Präsenz in Europa national emanzipiert auszunutzen.