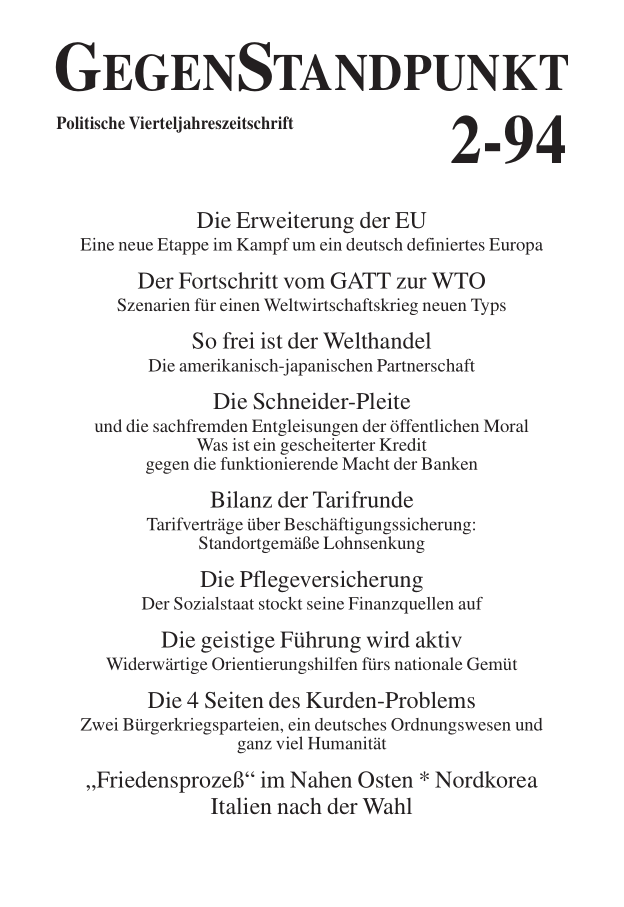Neueste Entwicklungen in der amerikanisch-japanischen Partnerschaft
So frei ist der Welthandel
Die USA sind unzufrieden mit den bilateralen Bilanzen und dem wachsenden Einfluss Japans auf Basis von dessen ökonomischer Macht. Getreu dem Selbstverständnis vom laissez–faire-Kapitalismus als dem amerikanischen Erfolgsweg interpretiert die Clinton-Regierung die japanischen Erfolge als Resultat „unfairer“ staatlicher Wirtschafts-Manipulationen und verlangt Kompensation in Gestalt staatlicher Aktivitäten zugunsten der US-Bilanzen: Von Konjunkturprogrammen zur Förderung der US-Ökonomie und einer Aufwertung des Yen bis zu nach Plan abgetretenen, „numerisch“ garantierten Marktanteilen für US-Firmen im Rahmen eines „managed trade“. Das Vorgehen der USA ist durchaus zwieschlächtig, indem ihre ökonomischen Waffen gar nicht so eindeutig und einseitig in ihrer Wirkung sind.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Neueste Entwicklungen in der
amerikanisch-japanischen Partnerschaft
So frei ist der Welthandel
Zwischen den USA und Japan geht es schon ziemlich lange hoch her. Japan akkumuliert unermüdlich einen bilateralen Rekordhandelsbilanzüberschuß nach dem anderen – nach amerikanischer Auffassung nur durch extensiven Gebrauch unlauterer Mittel. Die Stimmung in den USA wird immer feindseliger, Reagan, Bush und jetzt Clinton verlangen immer weiterreichende Abkommen zur „Stärkung des japanischen Imports“, für die „Abtretung japanischer Marktanteile an US-Firmen“, für die „Förderung der japanischen Binnennachfrage“, zur „Normalisierung japanischen Wettbewerbsverhaltens und Beseitigung wettbewerbsverzerrender Strukturen auf dem japanischen Markt“ usw.usf. – und sie setzen sie durch. Trotz allem steigt derweil der japanische Handelsbilanzüberschuß.[1] Allerdings nimmt gleichzeitig der amerikanische Export nach Japan zu, so daß der japanische Markt mittlerweile der zweitgrößte Exportmarkt der USA ist.
Das ist aber nur die eine Hälfte des amerikanischen Ärgers. Über die andere wird nicht mit derselben Offenheit gesprochen:
Den USA ist in dem Raum, den sie „pacific rim“ nennen und wie selbstverständlich als ihren gigantischen Hinterhof ansehen, mit Japan ein ernsthafter imperialistischer Konkurrent entstanden. Dieses Japan, das nach amerikanischer Lesart eigentlich zu diesem Hinterhof dazugehört, hat sich mit den vertrauten Mitteln der Kreditvergabe und des Kapitalexports zum geschätzten und begehrten „Partner“ einer ansehnlichen Reihe der dortigen Anrainer-Staaten gemacht und macht sich daran, den USA zunehmend den gewohnten Einfluß und die reibungslose Umsetzung amerikanischer „Wünsche“ zu bestreiten. Was den USA neuerdings als Mangel auffällt, nämlich eine mit reichlich Flottenstützpunkten etc. präsente Macht zu sein, die nach dem Ende des „Kalten Krieges“ eigentlich so leger wie nie zuvor ihre ordnungspolitischen Vorstellungen darlegen und sich ihrer Befolgung sicher sein könnte, zugleich aber am vielzitierten „asiatischen Wachstumsmarkt“ immer geringere Anteile abzubekommen, paßt haargenau zu dem, was Japan in den letzten Jahren so schön gelungen ist: sich eben unter dem amerikanischen „Schutzschirm“ zur wirtschaftlichen Vormacht aufzuschwingen und gerade so die diesem „Schutzschirm“ bislang inhärente Verpflichtung der Nationen auf amerikanisches Interesse aufzuweichen. Und nicht nur dies: Japan macht sich auch anheischig, dem einen oder anderen politischen Interesse der USA in der Region zu widersprechen und eigene Vorstellungen dagegenzusetzen.
In diesem Zusammenhang erscheint das Argument vom „unberechtigten Exporterfolg Japans“ in einem neuen Licht: Es ist nicht ausgerechnet dieses Defizit, das Amerika so schwer an die Nieren geht, es ist nicht dieses Defizit, das der ökonomische Erholung Amerikas grundsätzlich entgegensteht – es steht für eine aus der Ökonomie herrührende und über das Ökonomische hinausgehende Emanzipation Japans, die Amerika anscheinend gründlich gegen den Strich geht. Aber nicht nur das: Die Emanzipation Japans steht wiederum dafür, daß die Welt überhaupt zu „unamerican activities“ neigt und wieder, beginnend mit Japan und mit seiner Hilfe, in Ordnung gebracht werden muß.
Kürzlich drohten die USA Japan offiziell einen Handelskrieg an, ohne jedoch genau zu sagen, wie sie ihn zu führen gedenken, und zugleich mit dem Zusatz versehen: Diese Drohung soll nicht eigentlich wahrgemacht werden, sondern ein weiteres Mal und noch mehr als bislang Wohlverhalten erzwingen. Verschärfend verkünden die USA, daß sie Japan diesmal die letzte Chance einräumen, da sie sich nun lange genug von dessen scheinheiligem Entgegenkommen hinters Licht hätten führen lassen und mittlerweile alle Tricks der Gegenseite durchschaut hätten:
„Die US-Regierung ist auch skeptisch, inwieweit die jüngste Entscheidung der Japaner, mehr amerikanische Autoteile zu kaufen, freiwillig war. ‚Wir haben den starken Verdacht‘, meinte ein Clinton-Berater, ‚daß die Regierung dies getan hat, um die Lage zu entschärfen.‘“ [2]
Eine eigenartige Beschwerde: Die USA setzen Japan unter Druck und kritisieren zugleich, daß sich Japan eventuell bloß berechnend dem Druck beugt, um den amerikanischen Ärger zu besänftigen. In diesem Verdacht drückt sich eine ganz eigene Anspruchshaltung aus. Japan soll die amerikanischen Drohungen überflüssig machen, sich also von sich aus den amerikanischen Wünschen entsprechend verhalten und mit seiner nationalen Wirtschaftstätigkeit quasi automatisch amerikanische Ertragsinteressen erfüllen. Das heißt, daß Japan sich die nationalen Ziele der Wirtschaftspolitik von Amerikas Bedürfnissen vorgeben lassen und sich daran ausrichten soll, wie wenn sie das wohlverstandene Eigeninteresse Japans wären.
Dabei bleibt kein Bereich der Wirtschaftspolitik ausgeklammert. Vom Geld über die Wirtschaftspolitik bis zum Territorium:
Amerika spricht mit
a) Ein „Konjunkturprogramm“ unter amerikanischer Kuratel
Die japanische Regierung hat ein langfristiges Wachstumsprogramm größten Umfangs aufgelegt – bis ins Jahr 2000 sind 7 Billionen DM für „Konjunkturankurbelungsmaßnahmen“ vorgesehen, die durch eine sprunghaft wachsende Staatsverschuldung finanziert werden sollen. Ein rein japanischer Beschluß zur Bewältigung der aktuellen Krisenlage ist dieses Programm nicht. Es ist nämlich spätestens 1991 in der „Structural Impediment Initiative (SII)“ zwischen Japan und den USA – auf amerikanischen Druck – beschlossen worden; jetzt haben die USA für 1994 zum ersten Mal ultimativ die Einlösung der „ersten Tranche“ gefordert. Und es wurde auch kein Zweifel gelassen, wem dieses Staatsgeld zugutekommen soll: amerikanischem Geschäft und Wachstum – über den Umweg einer mit diesem Geld „angekurbelten“ Inlandsnachfrage und eines erhöhten Imports Japans. Der Anspruch steht: Dieses Geld steht nicht zur freien nationalen Verfügung des japanischen Staates, sein Haushalt untersteht nicht seiner autonomen Entscheidung, sondern er hat sich an der „Gestaltung der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen“ auszurichten.
Ob er den wirtschaftspolitischen Bedürfnissen Japans entspricht und sich mit seinen Haushaltsgesichtspunkten verträgt, geht die USA nichts an. So häßliche Sachen wie Geldmengenausweitung, Inflation, Spekulationsanheizung, vor denen alle Lehrbücher als Folgen „unsolider Staatsfinanzen“ warnen, sind Amerika egal; weniger egal sind ihm die unbefriedigenden Wirkungen seiner eigenen gestiegenen Verschuldung der letzten Jahre, und zwar unter dem Gesichtspunkt, daß diese offenbar hauptsächlich ausländisches Geschäft befördert habe. Wenn Amerika die Ausweitung der japanischen Staatsschuld explizit fordert und begrüßt, so geht es davon aus, daß die Verwandlung dieses Staatskredits in solides Geschäft gewährleistet ist, nämlich durch die Beförderung des Geschäfts bei sich. Bislang hat das ja auch funktioniert, bloß falsch herum: Die USA haben sich zur „Wachstumslokomotive“ für Japan gemacht – das waren die falschen Wirkungen des „deficit spending“.
Das soll dank der Verpflichtung Japans jetzt anders werden, so das amerikanische Anliegen. Das beruht allerdings auf einem Idealismus, weil nach wie vor überhaupt nicht ausgemacht ist, ob und wieweit japanische Wachstumsbemühungen das US-Geschäft fördern. Bisher hat sich der erwartete Niederschlag des „Wachstumsimpulses“ in den USA-Bilanzen ja überhaupt nicht eingestellt. Für Amerika ein Beweis, daß sich Japan um die Erfüllung seiner Pflicht mal wieder herumgeschwindelt hat. Deshalb drängt der amerikanische Staat jetzt auf Einlösung des Versprechens und bringt darüberhinaus noch ganz andere Mittel in Anschlag.
b) Der US-Staat will die Aufwertung des Yen
Der amerikanische Zugriff erstreckt sich nämlich nicht nur auf Höhe und Gestaltung des japanischen Haushalts, er will auch über die internationale Gültigkeit und Wirkung des japanischen Geldes ein mehr als gewichtiges Wörtchen mitreden. Eine bedeutende Politiker- und Ökonomen-Fraktion vertritt die ökonomische Lehrmeinung, unbefriedigende Exporterfolge und im Vergleich dazu überschießende Importe eines Landes hätten ihren entscheidenden Grund in der „künstlichen“ Überbewertung des Geldes dieser Nation. Diese Auffassung machen die USA zum offiziellen Rezept für die Bewältigung ihrer Bilanzprobleme, indem sie sich zum Fürsprecher eines möglichst hohen Yen machen. Serienweise ergehen Aufforderungen an die japanische Zentralbank, den Yen-Kurs nach oben zu treiben, umgekehrt unterstützt die amerikanische Zentralbank alle Bewegungen zur Verbilligung des Dollars. Dabei setzt sich der US-Staat darüber hinweg, daß in einer Abwertung seiner Währung allemal ein negatives Urteil über die Qualität der in Dollar abgewickelten Geschäfte im weitesten Sinne steckt. Vielmehr behauptet er, diese Abwertung wäre wesentlich sein Werk und daher auch rundum positiv für den Gang der Dollargeschäfte – und wenn nicht, dann einzig deswegen, weil die laufende Abwertung immer nie radikal genug ausfiel. In seiner feindseligen Absicht gegen einen Pfeiler des japanischen Wirtschaftserfolgs, den Überschuß in Japans US-Handel, übersieht er also – absichtsvoll und ideologisch – alle „Schattenseiten“ der Währungsverschlechterung und behauptet glatt, es läge in seiner Macht, eine auswärtige Währung „hochzureden“ – und zwar ganz zum nationalen Vorteil.
Herausgekommen ist in den letzten Jahren eine Halbierung des Yen-Dollar-Verhältnisses. Dem liegt sicherlich eben das angefeindete Handelsbilanzdefizit zugrunde, das schließlich für einen dauerhaften Überhang von Yen-Nachfrage sorgt, sowie der massive Anstieg der japanischen Staatsverschuldung, der ebenfalls in diese Richtung ausschlägt.[3] Ob obendrein – wie immer wieder mal vermeldet – ein US-japanisches Währungsabkommen, das der Yen-Aufwertung gewidmet sein soll, ob umfangreiche Yen-Aufkäufe (gegen Dollar) der US-Zentralbank und/oder ob der vorauseilende Gehorsam der Devisenmärkte, die das „politische Datum“ eines amerikanische Machtworts einzuschätzen wissen, ihr Werk getan haben, soll hier nicht entschieden werden. „Die Devisenmärkte“ haben auf jeden Fall bis vor kurzem die Absicht des amerikanischen Staates wie bare Münze genommen und seinem politischen Willen insofern „rechtgegeben“, als sie auf die Aufwertung des Yen spekuliert haben. Für sie galt: Je größer die Unzufriedenheit und die Drohung mit noch schärferen Maßnahmen, je wahrscheinlicher die Schärfung amerikanischen Ärgers aufgrund „unzureichenden Entgegenkommens der japanischen Seite“, desto stärker der Yen. Störrigkeit Japans oder auch nur mangelnde Eile oder Geschicklichkeit beim Erfüllen amerikanischer Vorschriften wird mit Yen-Aufwertung „bestraft“. So hat man das bislang noch nicht gehört: „Glaubwürdigkeitsproblem + Handlungsunfähigkeit = Aufwertung“:
„Im Bereich von Reformen im administrativen und wirtschaftlichen Bereich hat sich die Regierung Hosokawa bisher eher schwergetan, über allgemeine Formeln hinauszukommen und auch gegen den Willen der beharrungsträchtigen Bürokratie veritable Reformschritte durchzusetzen. Nach den jüngsten vagen Absichtserklärungen ergibt sich für die Koalitionsregierung nun verstärkt ein Glaubwürdigkeitsproblem; man zweifelt allmählich an ihrer Handlungsfähigkeit. So sehen es offenbar auch die Finanzmärkte: Der Yen geriet wieder unter Aufwertungsdruck, weil man bereits eine negative Reaktion Washingtons auf Tokios Maßnahmenpaket voraussieht. Die Vereinigten Staaten könnten daher wieder versucht sein – dahin geht die Vermutung der Devisenhändler –, verstärkt über eine Yen-Aufwertung den japanischen Außenüberschüssen zu Leibe zu rücken.“ [4]
Was die Macht des US-Staates angeht, Wechselkurse zu manipulieren, mögen sich Politiker und Devisenhändler schwer täuschen. Der Kampfeswille des US-Staates ist jedoch klar: Einer autonomen Währungspolitik, wie sie sich die japanische Zentralbank vorstellen mag, fährt er auf jeden Fall in die Parade; er fordert kategorisch eine „Abstimmung“ des Yen mit dem Dollar, die amerikanischen Vorstellungen und Wünschen entspricht.
c) Eine neue Erfindung: „Numerische Ziele“
Das amerikanische Drängen auf japanische Importsteigerung hat sich neuerdings eine „Konkretisierung“ einfallen lassen, die tatsächlich originell und unerhört im Verkehr zwischen Staaten ist. Die USA verlangen vom japanischen Staat, er solle sich verpflichten, amerikanischen Kapitalisten festgelegte und wachsende Einfuhrmengen und abgesteckte und wachsende Segmente der verschiedenen „inneren Märkte“ zu garantieren. Die alte (Selbst-)Verpflichtung Japans[5] zum Abbau des Außenüberschusses und zur „Normalisierung“ des Imports wird hier schlichtweg negiert, zugleich erklärt der amerikanische Staat seine eigenen früheren diesbezüglichen Vorstöße für läppisch. Es wird ja schließlich nicht weniger verlangt, als daß der japanische Staat seine Kapitalisten anweist, bestimmte Mengen von amerikanischem Zeug zu amerikanischen Preisen abzunehmen und Teile des eigenen Geschäfts abzutreten – und all das will die amerikanische Administration auf Cent und Prozent genau nachgeprüft und abgerechnet haben.[6] Hier wird die japanische Regierungsgewalt in vollem Umfang eingefordert, und zugleich werden ihr wesentliche Freiheiten bestritten: Sie hat im Dienste ausländischer Souveränität eine Neu-Regulierung des nationalen Geschäftslebens durchzusetzen, die die eingefahrenen Verhältnisse und Methoden des japanischen Wirtschaftserfolgs – seien es solche der Konkurrenz der Kapitalisten, seien es solche des nationalen Zusammenwirkens von Staat und Kapital – gründlich durcheinanderwürfelt.
d) Japan telefoniert amerikanisch
Im Fall Motorola[7] beharrt der amerikanische Staat zum einen auf einem garantierten US-Exporterfolg. Er exerziert zugleich aber auch ein Beispiel durch, wie „Herstellung von Inlandsnachfrage“ nach amerikanischen Vorstellungen zu funktionieren hat. Setzt der japanische Staat dieses erste „numerische Ziel“ nicht durch, folgt eine „äquivalente“ Schädigung seiner Außenhandelsbilanz auf dem Fuß, und zwar auf indirektem Wege. Im ersten Schritt wird durch Importzölle bei amerikanischen Importeuren abkassiert, deren Geschäft wird erschwert oder auch verunmöglicht; dadurch wird japanischer Export verringert. Die Gleichsetzung ist interessant: Bekommt Motorola nicht die ihm „eigentlich“ zustehende Summe in Japan, hat der gesamte japanische Außenhandel dafür zu bezahlen – dem nicht eingeräumten Geschäft steht ein entsprechender Verlust gegenüber.
Es geht aber nicht „bloß“ um die Kompensation eines – aus amerikanischer Sicht – Geschäftsausfalls, die Sache reicht weiter: Die Gestaltung des nationalen (Wirtschafts-)Territoriums ist eine grundlegende Leistung des Staates für seine Kapitalisten. Er schafft ihnen damit nicht nur unabdingbare Voraussetzungen, die sie selbst nicht oder kaum zuwegebringen (wollen), sondern erzwingt damit auch von allen auswärtigen Kapitalisten Anpassung an die von ihm gewünschten Arten, sich des „inneren Marktes“ zu bedienen. Ein Staat läßt sich beim Bau einer Autobahn oder eines Telefonnetzes nicht vom Kriterium der Rentabilität leiten; es handelt sich da um allgemeine Produktionsbedingungen, die in Vorhandensein und Qualität über die Zukunft des Kapitalwachstums auf diesem Boden zentral mitentscheiden – und die allemal national „geprägt“ sind. Darüber hinaus sind hierin hoheitliche Funktionen eingeschlossen: Mit ihnen sichert sich der Staat sein Kommando über Territorium und Bürger und die ungehinderte Abwicklung aller Aufträge, die er seinem Volk erteilt.
Der amerikanische „Antrag“ sieht in all dem ungerechtfertigte Behinderungen: Der Aufbau der Telekommunikations-Infrastruktur hat sich von vornherein an ausländisches Geschäftsinteresse anzupassen, ihm Vorleistungen zu erbringen, zumindest seinen „harmonischen“ Einbau zu ermöglichen. So greift Amerika wieder direkt in die Finanzen des japanischen Staates ein und bestreitet ihm an zentraler Stelle die Verfügung über sein eigenes Territorium. Und es maßt sich an, über Entwicklungsart und -tempo des Landes – worüber mit den allgemeinen Produktionsbedingungen ja wesentlich mitentschieden wird –, über den Gang des „moralischen Verschleißes“ der nationalen Wertproduktion mitzubestimmen.
e) Gewisse Geschäfte gehen nicht
In einem interessanten Fall japanischer „Entwicklungshilfe“, der Vergabe eines Kredits für ein iranisches Wasserkraftwerk, verlangt der US-Staat die Stornierung mit dem Argument des „Terrorismus“. Daß der Iran im imperialistischen Lager nicht besonders herzlich geliebt wird, wird man auch im Fernen Osten wissen. Wenn Japan dennoch einen mehr entgegenkommenden wirtschaftlichen Schritt tut, wird es wohl Zwecke separat und etwas jenseits der offiziellen Marschroute verfolgen und eigene Beziehungen zum Iran vertiefen wollen, denen eine konkurrenzlerische Absicht unschwer anzusehen ist. Damit steht es sicherlich nicht allein im imperialistischen Lager; aber eine so schroffe Zurechtweisung, die das ganz große und abstrakte Argument „Terrorismus“ – Du läßt dich mit den Feinden jeder Ordnung ein und gefährdest unser aller Sicherheit! – auffährt und entsprechend rigorose Konsequenzen fordert, ist nicht gerade das übliche Vorgehen und schon eine rechte Zumutung für eine Hauptmacht des Imperialismus.
Amerika = Kapitalismus – eine alte Liebe in neuem Licht
Die Vorkommnisse, die sich in den zentralen Bereichen Staatsfinanzen, Außenhandel und Währung, Infrastruktur und Außenpolitik abspielen, belegen eine außerordentliche Respektlosigkeit der USA gegenüber der Souveränität des japanischen Staates. Diese Respektlosigkeit begründet sich in einem Vorwurf gegen Japan, der wiederum amerikanischem Selbstverständnis entspringt: Der japanische Staat würde sich in unzulässiger Weise in die Wirtschaft „einmischen“ und die von den USA hervorragend respektierten und gehüteten großen Freiheiten des Kapitalismus – „Freiheit des Handels“ und „Freiheit des Kapitalverkehrs“ – in eklatanter Weise mißachten. Der japanische Wirtschaftserfolg verdankt sich in dieser Sicht einem Mißbrauch der Souveränität, dem von der obersten Instanz des Kapitalismus Einhalt geboten werden muß. Wenn die USA ihr Handelsbilanzdefizit in den Mittelpunkt stellen, so ist das nicht dahingehend mißzuverstehen, daß es ihnen auf eine spezielle, nur-nationale Bilanzkorrektur ankommt; vielmehr korrigieren sie damit (anti-)kapitalistisches, systemwidriges Fehlverhalten. Das berechtigt sie dazu, nicht nur den Willen des japanischen Staates zu negieren, sondern ihm sogar den Gebrauch seiner Souveränität vorzuschreiben. Das ist amerikanische Ideologie, zweifellos. Aber sie reflektiert eine neue Linie der amerikanischen Wirtschaftspolitik – ebenso verkehrt wie passend.
Staaten betreiben Wirtschaftspolitik. Sie entwickeln immer umfänglichere Maßnahmenkataloge, wie Geschäftszweige hochzusubventionieren, gegen ausländische Konkurrenz zu schützen, durchzurationalisieren, dann aber auch dem „Wind der freien Konkurrenz“ auszusetzen sind – bis hin zu dem, daß auch mal die eine oder andere Branche im nationalen Wirtschaftskreislauf keine Rolle mehr spielt. Die USA hingegen behaupten von sich, dieses staatliche Herumfuhrwerken im „free enterprise“ nicht zu brauchen, umgekehrt sei gerade die wirtschaftspolitische Abstinenz Grund für den jahrzehntelang unangefochtenen Erfolg der US-Wirtschaft.
Das ist natürlich nicht wahr, der US-Staat hat die Unterstützung seiner Kapitalisten höchstens anders organisiert – z.B. in Gestalt des Lobbyisten, mithilfe dessen sich ein Unternehmen spezielle Zuwendungen von Kongreß-Abgeordneten oder Ministerialbeamten durch spezielle Selbst-Anpreisungen und Darstellungen der Allgemeinwohl-Förderlichkeit und durch die diversen Methoden des Eine-Hand-wäscht-die-andere „verdienen“ muß; – z.B. in Form humanitärer Aktionen von ganz oben, wenn etwa einem Ronald Reagan die Versorgung der sowjetischen Bevölkerung so sehr am Herzen lag, daß er unbedingt die Weizenüberschüsse seiner Farmer dorthin transportieren mußte (gegen harte Währung, versteht sich); – z.B. im Rahmen der „Verteidigung des Freien Westens“, die Amerika ein gigantisches Rüstungsprogramm aufnötigte – lange Zeit leicht finanzierbar durch die reichlich zufließenden Mittel und die unumschränkte Verschuldungsfähigkeit, die dem US-Staat sein weltweit begehrtes Geld eintrug: die wirkungsvollste und zugleich einfachste Art von Wirtschaftspolitik,[8] eine Wirtschaftspolitik nämlich, die ohne „anti-zyklisches“, konjunkturtheoretisches Brimborium einfach immer und überall „ankurbelt“. Eine ganz wesentliche Abteilung der amerikanischen Wirtschaftspolitik bestand aber in Ermahnungen und Forderungen an die „Partner“, sie sollten ihre Wirtschaftspolitik besser unterlassen, nämlich immer dann, wenn sie Schutz- und Förderungsmaßnahmen zugunsten ihrer Wirtschaft ergriffen, die mit dem bösen Verdacht des „Protektionismus“ und des „Dumping“ belegt wurden. Amerika erhob den Anspruch, Oberanwalt weltweiten „Freihandels“ zu sein, und das war gleichbedeutend mit dem Anspruch, zum dauernden ökonomischen Erfolg berechtigt zu sein; nach amerikanischem Geschmack nicht zufriedenstellende nationale Erträge konnten also bloß Werk auswärtiger protektionistischer „Verfälschung“ der an sich fälligen proamerikanischen Konkurrenzresultate sein. Soweit der Anspruch. Dieser Anspruch gründete sich lange Zeit auf eine ökonomische Sonderstellung der USA. Sie konnten sich lange Zeit darauf verlassen, daß ihre Gleichsetzung von Binnen- und Weltmarkt bzw. die Beseitigung von Schranken im weltweiten Hin und Her – was sie bei Gelegenheit auch einmal außer Kraft setzten, wenn nämlich ein Konkurrent ausgerechnet auf ihren angestammten Märkten unangenehm reüssierte – sie und ihre Wirtschaft im Prinzip als ersten Sieger aus der internationalen Konkurrenz hervorgehen ließ – die amerikanischen Multis erledigten das schon. Das ökonomische Problem des bürgerlichen Staates: Kann er seinen Kredit in ein „wirtschaftliches Umfeld“ hineinpflanzen, das durch jeden zusätzlichen – auch staatlichen – Geldanreiz nur angestachelt wird, vorhandene Produktivität und Kapitalgröße noch weiter zu steigern und den zunächst ganz und gar unökonomisch fundierten Kredit des Staates in eine Vermehrung echt verdienten harten Geldes auf ihren Konten „umzusetzen“, oder macht sich der Staatskredit nur unangenehm in der Zahlungskraft der Gesellschaft bemerkbar und resultiert aus ihm kein neu geschaffener Wert, sondern nur Umverteilung zur Staatsseite hin? – dieses Problem war dem US-Staat über lange Jahre hinweg praktisch unbekannt; Staatsausgaben und Wirtschaftswachstum mußten nicht einmal in ein Verhältnis gesetzt werden, vielmehr tat jeder „das Seine“, und alle florierten prächtig. Kein Wunder, daß es im Selbstverständnis der USA ausgemachte Sache war: Im „land of the free“ würden sich „die Marktkräfte“ sowohl ungehindert als auch ungefördert vom Staat frei entfalten.
Dieses Selbstverständnis unterwarf die vielfältigen und einfallsreichen wirtschaftspolitischen Maßnahmen und Hilfen, die andere Staaten gezwungen waren, ihren Kapitalisten zukommen zu lassen, um sie überhaupt erst mal wieder hochkommen zu lassen – angesichts der amerikanischen Übermacht keine leichte Sache und immer mit einem sorgenvollen Blick auf die Staatsschulden verbunden, bei denen sich ja tatsächlich bei nur sehr wenigen Staaten der vorsichtige Optimismus halten ließ, daß ihr Wachstum durch ein gleichlaufendes Wachstum der „Realwirtschaft“ gerechtfertigt werden würde –, immer schon dem Verdacht der Verfälschung der Konkurrenz und der Unfairness; aber im Namen der „westlichen Wertegemeinschaft“, d.h. für die gemeinsame Anstrengung gegen den Feind im Osten, die nun mal auch wirtschaftlichen Aufschwung – auch etwas, nach amerikanischen Maßstäben, erschwindelten – brauchte, gaben sich die USA jahrzehntelang duldsam. Europa erlaubten sie die große „Ausnahme“ der Bildung einer Zollunion samt der immer weitergehenden Verhärtung dieser „Ausnahme“; Japan stellten sie sogar den eigenen Markt zum Zwecke der Entwicklung von Exportfähigkeit zur Verfügung und hielten sich über seine merkantilistischen Anstrengungen nicht weiter auf[9] – was heute so vehement angegriffen wird.
In diesem Verdacht der Unfairness artikuliert sich natürlich nichts anderes als der kaum verklausulierte Standpunkt der Gewinnernation und keine ewig gültige kapitalistische Sachgesetzlichkeit. Staaten, die die unattraktiveren Tabellenplätze in der Konkurrenz einnehmen und ebenfalls auf den Kapitalismus als ihr Mittel zur Durchsetzung in dieser Konkurrenz setzen, nehmen die Einrichtungen des „freien Handels“ und des „freien Kapitalverkehrs“ nicht als Emanationen des kapitalistischen Weltgeistes, sondern wissen, daß es sich dabei um Einrichtungen handelt – der führenden Macht oder Mächte nämlich: um die Rahmenbedingungen der Konkurrenz. Und bei denen kommt es sehr darauf an, welcher Staat sie setzen kann, setzt er doch damit auch seine eigenen Besonderheiten, Pluspunkte und Vorteile als staatenübergreifende „Notwendigkeiten“ durch. Die zweitrangigen Staaten wissen, daß sie sich darin zu bewähren haben, daß es um erfolgreiches Ausnutzen der Möglichkeiten geht, die mit den von oben garantierten Rahmenbedingungen eben auch gegeben sind. Um ganz oben mitmischen zu können, bedarf es freilich auch einer gehörigen Portion kapitalistischen Glücks – in Form der „Ausnahmen“; seien es gewährte oder seien es – mit zunehmendem Erfolg ist auch mehr Wagemut angebracht – selbst herausgenommene. Japan und Deutschland zum Beispiel – viel mehr gibt es nicht – hatten dieses Glück.
In dem Maße, wie Nationen die Rahmenbedingungen für sich zu nutzen oder auch erfolgreich umzumodeln verstehen, sieht die Gewinnernation ihren Status zerfließen. Für sie, die die Welt gewaltsam zusammenhält und ihrem Ordnungswillen unterwirft, ist es eine Selbstverständlichkeit, daß ihre Gewalt wie von selbst ökonomisch einträglich ist. Machen sich nun andere Staaten, die dieses Privileg nicht genießen, innerhalb dieser Rahmenbedingungen und gegen die Führungsnation erfolgreich bemerkbar, so führt dies nicht zu der Erleuchtung, daß ein allgemeines Regelwerk wohl kaum auf Dauer den besonderen Erfolg einer Nation garantieren kann. Vielmehr können sich die USA das gar nicht anders zurechtdefinieren denn als – Regelverletzung.[10]
Amerikanische Selbstkritik – gegen andere
Vom Standpunkt der USA aus war und ist also so ziemlich alles, was der japanische Staat unternimmt, eine unter dem Schutzschirm der Duldsamkeit ausufernde Regelverletzung. Allerdings eine erfolgreiche; und deswegen muß die Gewinnernation feststellen, daß sie sich zwar noch im Besitz der Prinzipien ihres Erfolgswegs befindet, ihr Erfolg aber schwindet. Kaum leben die Ideologie von der „Freiheit des Kapitals“ und der Nutzen, der lange Zeit so selbstverständlich schien, in Scheidung, rückt der amerikanische Staat mit der Wahrheit über seinen angeblichen Dienst an der „Freiheit des Kapitals“ heraus. Es handelt sich dabei keinesfalls um eine Sache, die von möglichst großer Zurückhaltung des Staates geprägt ist; vielmehr ist auch seinerseits massiver Staatseinsatz erforderlich, um die Gleichung „Freiheit des Kapitals = Nutzen Amerikas“ wieder zusammenzuzwingen. Die Leistung des Staates besteht nicht darin, das Kapital gewähren zu lassen; vielmehr vollzieht er einen expliziten Übergang: Er muß für den nationalen Wirtschaftserfolg gegen einen anderen Staat einstehen. Dabei tritt er wieder im Namen eines gänzlich „unverfälschten“ Kapitalismus an, aber oberdeutlich ist nun, daß es dabei um nichts anderes als um die Wiedererringung seiner Einzigartigkeit geht. Und die soll sich im aktuellen Fall darin beweisen und rekonstituieren, daß es den USA gelingt, die Macht des japanischen Staates zur Regelverletzung, die Macht zum „eigenen Weg“ zu brechen. Das Kapital tut es nicht, also muß der Staat das leisten, und zwar im doppelten Sinne: statt seiner und für es.
Einerseits ist das Auftreten des amerikanischen Staates gegenüber Japan durchaus konservativ: Er beharrt auf der Kompetenz der Regelsetzung und dem daraus entspringenden nationalen Erfolg. Andererseits geht der US-Staat aber auch einen bedeutenden Schritt weiter: Er glaubt an den Erfolg der Regelsetzung nur noch, wenn er sich zugleich Garantien verschafft. Er tut so, als ginge es nur darum, den guten, alten Regeln, hinter die er dann wieder zurücktreten kann, erneut Geltung zu verschaffen – tatsächlich gefallen ihm die Resultate seines Regelwerks nicht mehr. Und unter Vorgabe, nur die guten, alten Regeln hochzuhalten, will er weniger die, sondern die Eindeutigkeit ihres Nutzens für sich sichergestellt wissen. Mit einer billigen „Kompensation des erlittenen Schadens“ will Amerika gar nicht erst anfangen, aber auch die alten Forderungen nach „mehr Freiheit“, „Liberalisierung“, „Öffnung“ etc. hat es als unzulänglich verworfen.
Amerika hat also nicht gesagt: „Kapitalismus, dein Wille geschehe – wir fangen von weiter unten wieder an“, sondern hat sich auf seine immer noch überlegene politische Macht besonnen und sich an die Umwertung aller (wirtschaftlichen) Werte gemacht. Wirtschaftlichen Resultaten beugt sich ein Staat wie der amerikanische – und da steht er nicht alleine da – nur dann, wenn er nichts mehr dagegen unternehmen kann. Darum läßt er es dazu gar nicht erst kommen und handelt genau nach der Maxime, die seine erfolgreichen Konkurrenten beherzigt haben: Die Resultate kapitalistischen Wirtschaftens gehen nicht nur sehr wesentlich auf Vermögen und Mittel des Staates zurück, seinem Kapitalismus auf die Sprünge zu helfen; diese Resultate gelten für sich selbst auch nur bedingt und sind im Verkehr zwischen Staaten revidierbar.
Das verschafft der Auseinandersetzung mit Japan die ganz spezielle Note. Es geht „ökonomisch“ zu, wenn die Deckungsgleichheit von ökonomischer und politischer Macht und die Macht zur Regelsetzung wieder hergestellt werden sollen – am „Fall“ Japan und mit Hilfe Japans. Die USA unterwerfen sich dem Maßstab des abstrakten Reichtums, der die kapitalistische Welt zusammenhält und gegeneinander aufhetzt – Kanonenboote sollen nicht vor der japanischen Küste aufkreuzen, und vom Zurückbomben in die Morgenthau-Zeit hat auch noch keiner geredet. Es soll schon darum gehen, die Bilanzen auszugleichen, eine eindrucksvolle Exportmacht zu sein, den Staatshaushalt zu konsolidieren, die Weltgeldqualität des Dollars aufzupolieren, attraktiver Standort für Kapitalimport aus aller Welt und Ausgangsbasis für Kapitalexport in alle Welt zu sein – und das alles in einer Größenordnung, die die Konkurrenz Mores lehrt. Zugleich pflegen die USA mit diesem Maßstab aber auch einen sehr herrschaftlichen Umgang. Nicht, daß sie die Anstrengungen der gewöhnlichen kapitalistischen Konkurrenz unterlassen würden, aber sie wollen sich darauf auch nicht verlassen. So, als würden sie das Spiel nur unter der Voraussetzung beginnen, daß sie als sicherer Sieger daraus hervorgehen, wollen sie sich von Japan Garantien geben lassen des Inhalts: Bei jeder nationalen, staatlichen Maßnahme muß der Nutzen Amerikas im Mittelpunkt stehen.
Für die USA ist dies der zwingende Schluß aus einer überfälligen Selbstkritik. Diese Kritik hat ihren Ausgangspunkt nicht in der Entdeckung „innerer“ Versäumnisse, seien es „fehlgeleitete oder ungenügende Subventionen“, seien es „Vernachlässigung der Infrastruktur“, seien es „Mängel im Ausbildungswesen“ –; Amerika bezichtigt sich der Blauäugigkeit und des fahrlässigen Umgangs mit anderen Staaten, denen erlaubt wurde, die amerikanische Großmütigkeit ziemlich schamlos auszunutzen.[11] Alle bisherigen Appelle an Japan und auch Abmachungen mit ihm waren noch von einem Geist bestimmt, der Japan die Interpretation und Ausführung überließ. Dieser Geist nahm zuviel Rücksicht auf die Souveränität des anderen Staates und stand im Widerspruch zur an und für sich schon gefaßten Einsicht, daß der Erfolg der anderen Nation sich auf ihren Willen zur „Staatseinmischung“ und zur Regelverletzung zurückführen ließe, daß also von ihr kein regelgerechtes Verhalten zu erwarten sei.
Idealistisch ist von dieser Warte aus im Nachhinein die Aufforderung früherer amerikanischer Präsidenten an Japan – wie z.B. in „SII“ ausgemacht –, ein Wachstumsprogramm anzuleiern, Häfen und Flugplätze zu bauen, das Land endlich zu kanalisieren, Großmärkte statt Tante-Emma-Läden einzurichten usw.usf, in dem Glauben, diese „Wachstumsimpulse“ würden zweifelsfrei bei lieferbereiten und hochproduktiven US-Unternehmen ankommen. Solche Programme ließen Japan ja tatsächlich noch die Möglichkeit, die Importförderung zu betreiben, die ihm in seine Wirtschaftsplanung paßte – dauerhaft die günstigen Angebote des Weltmarkts auszuschlagen, liegt ja ohnehin gar nicht im japanischen Interesse der Entwicklung des nationalen Marktes und der Verbesserung der Exportfähigkeit –, solche „Konjunkturprogramme“ waren Japan ja vielleicht sogar ganz recht, um seinen Kapitalisten Aufträge, Kredit und Subventionen zukommen zu lassen, die der Bewährung auf dem Weltmarkt förderlich waren.
Realistisch ist es in amerikanischer Sicht jetzt, genau dieselben Forderungen wieder zu stellen und ein paar dazu, nun aber mit dem nachdrücklichen Zusatz: Dem japanische Staat muß die Freiheit im Umgang mit diesen „Wachstumsimpulsen“ zumindest partiell weggenommen werden, nämlich so, daß er einen Teil des intendierten Wachstums garantiert für US-Kapital reserviert. Die Frage, ob die US-Unternehmen nun tatsächlich so lieferbereit und hochproduktiv sind wie immer behauptet, ist irrelevant: Wenn ihnen ein Teil des japanischen Geschäfts staatsgarantiert zugeschlagen werden soll, dann nicht aufgrund dieser „Verdienste“, sondern weil der US-Staat das so will, also auf die großen Schiedsrichter Produktivität und Rentabilität usw. zur Zeit ziemlich pfeift. Die Frage nach der Wettbewerbsfähigkeit der US-Industrie und welche Produktivitätssteigerungen, Rationalisierungen etc. sie braucht, interessiert ihn weniger; er geht davon aus, daß sich seine Kapitalisten um ihre kapitalistischen Angelegenheiten schon selbst kümmern und die Lobbies mit ihren Forderungen ankommen. Er kümmert sich um die neuen Rahmenbedingungen, die seine Hoheit wirksam gestalten bzw. anderen Staaten abverlangen kann.
Wenn der japanische Erfolg einen dauerhaften Abzug an amerikanischen Bilanzen darstellt, so steht er wie ein Mahnmal für die ökonomische Schieflage, die der amerikanischen Nation ihre Einzigartigkeit zunehmend verdirbt und ihre Macht unterhöhlt – eben darum ist Japan, und nicht Australien oder Korea, eine herausragende „Rahmenbedingung“ und dazu prädestiniert, der angeschlagenen Weltmacht beim Schließen der – nicht zuletzt durch Japan – entstandenen „Lücken“ zur Seite zu stehen. Den Verlust der Selbstverständlichkeit, mit der einmal der Weltmarkt zum Reichtum der amerikanischen Nation beitrug, soll Japan sozusagen kompensieren. Jedoch nicht – bloß – in dem billigen Sinn: Abpressen von ein paar wirtschaftlichen Sonderkonditionen, Abtransport von ein paar Schiffsladungen Dollar/Yen auf amerikanische Konten, sondern anspruchsvoller: Das ganze japanische „Wirtschaftswunder“ soll als Mittel amerikanischen Wirtschaftserfolgs eingespannt werden. Ein erster Beweis, daß dies möglich ist, und auch ein erster Silberstreif am Horizont ist der gestiegene amerikanische Export nach Japan; hintertrieben wurde dieser verheißungsvolle Ansatz durch das gleichzeitige „überproportionale“ Wachstum japanischer Exporte nach Amerika – daran muß gedreht werden.
So kommt es einerseits Amerika schon sehr darauf an, das Handelsbilanzdefizit umzudrehen, es stellt sich den merkantilistischen Methoden Japans gegenüber auch einmal auf den Standpunkt einer Handelsnation; andererseits steht dieses ärgerliche Defizit als Symbol dafür, wie sehr der Test in der Prinzipienfrage ge-/mißlungen ist: Folgt Japan den amerikanischen Ordnungsentwürfen? Als Ordnungsmacht stellen die USA Japan nämlich vor die Alternative: Es habe viel zu verlieren, wenn es sich dem „american way“ verschließt, es kann viel hinzugewinnen, wenn es sich in den Dienst am amerikanischen Wirtschaftsaufschwung einreiht. Eigentlich handelt es sich dabei nicht um eine Alternative, sondern nur um eine Drohung: Amerika ist mächtig genug, Japan großen Schaden zuzufügen – wenn es den vermeidet, kann sich Japan das dann als „Gewinn“ anrechnen.
„Managed trade“
Die Drohung mit Feindschaft, zumeist als Drohung eines harten Wirtschaftskriegs vorgetragen, hat jedoch etwas Widersprüchliches und Zahnloses an sich; diese Feindschaft kann nämlich aus amerikanischem Interesse heraus gar nicht durchgezogen werden, muß sich selbst immer wieder bremsen. Das scheinen die USA selbst zu wissen, wenn sie regelmäßig auch wieder freundlichere Töne von sich geben:
„Dabei beharrte Kantor (US-Handelsbeauftragter) nicht nur auf der von Tokio bisher entschieden zurückgewiesenen Forderung nach ‚qualitativen und quantitativen Indikatoren‘“ (das sind die ‚numerischen Ziele‘) „zur Messung des amerikanischen bzw. ausländischen Zugangs zum japanischen Markt; vielmehr verlangte er von Tokio auch eine ‚bedeutsame neue Verpflichtung zur makroökonomischen Stimulierung‘.[12] Kantor schien jedoch seine Kritik an der innenpolitisch ohnehin schon fragilen japanischen Regierungskoalition etwas dämpfen zu wollen. So betonte er, daß die Tür zur Wiederaufnahme der Verhandlungen (bzw. Abwendung von Sanktionen) offen geblieben sei. Zudem sagte der Handelsdelegierte, daß der neue japanische Vorschlag bloß noch nicht ausgegoren sei und bearbeitet werde. Die zurzeit demonstrative Zurückhaltung der Administration Clinton, die Japan aber tatsächlich unentwegt mit der Androhung möglicherweise massiver Sanktionen, etwa im Rahmen der reaktivierten ‚Super 301‘-Gesetzgebung, unter Druck zu setzen versucht…“[13]
Die wortgewaltige Androhung schwerer wirtschaftlicher Schäden hat ein Argument auf ihrer Seite: Mit seinem Export ist Japan immer noch sehr auf den US-Markt angewiesen. Aber erstens ist noch gar nicht ausgemacht, ob Japan US-Kampfmaßnahmen nicht auch einiges entgegenzusetzen hat; zweitens stellt sich sofort die Frage: Was haben dann eigentlich die USA von einer solchen Auseinandersetzung? In ihrem ganzen großmächtigen Anspruch haben sie sich schließlich ebenfalls als abhängig erklärt – sie brauchen Japan mit seiner wirtschaftlichen Leistungskraft, um die Dominanz (wieder) herzustellen. Sie bauen sich Japan gegenüber in der Pose des Überlegenen auf, um von ihm die ökonomische Unterstützung zu erzwingen, ohne die ihre ganze Überlegenheit ausgewaschen ist – ruinöse Maßnahmen gegenüber Japan würden also auch kaputtmachen, was sie an Unterstützung benötigen bzw. einfordern.
Das moderne Verfahren, das diesen Widerspruch auflösen soll, heißt „managed trade“. Hierin ist die Gegensätzlichkeit der verhandelnden Staaten ausdrücklich anerkannt, zugleich soll sie aber auch überflüssig und überwindbar sein. Ungleichgewichte zwischen Staaten und daraus entspringender Unfriede werden zu bloßen Resultaten staatlicher Eingriffe erklärt, was zum einen dem Konflikt eine besondere Schärfe verleiht; zum anderen ist damit aber auch der Königsweg zum Handelsfrieden vorgezeichnet: Es müssen sich eben nur die Staaten einigen und die unbefriedigenden Resultate korrigieren. Die Staaten wollen nicht zu außerökonomischen Feindseligkeiten schreiten, sondern zwischen sich, also über die Köpfe von Waren und Kapital hinweg, den „trade“ so regulieren, daß ein für beide Seiten zufriedenstellender „Ausgleich“ zustandekommt. Getan wird so, als ließen sich in freier Verständigung zwischen den Beteiligten, in einem ausführlichen Rechten über die „verzerrenden“ „Einmischungen“ des anderen Staates, lauter Vor- und Nachteilsposten in einem erlesenen Schacher gegeneinander ver- und abgleichen mit dem Resultat, daß dieses „Management“ die Konfliktmasse zwischen ihnen ausräumt und sogar zu einem „Wohlfahrtszugewinn“ führt. Mit einer ehrlichen Kritik der Resultate weltweiten Wirtschaftens des Kapitals hat das nichts zu tun, wenn Staaten im Namen der unverfälschten Konkurrenz politische Absprachen treffen zum Zwecke der kontrollierten Abschaffung der – ausgerechnet – „Staatseinmischung“ beim anderen. Solange der eigene Vorteil sich nicht genügend eingestellt hat, ist unter diesem Blickwinkel der Handel nicht frei und weiterhin höchste staatliche Aufmerksamkeit und Kontrolle des anderen Staats erforderlich.
Auch nicht ehrlich ist die Anfangsbehauptung, gleichberechtigte Partner würden sich hier an einen Tisch setzen und nach der besten gemeinsamen Lösung suchen: In Wirklichkeit handelt es sich im Ausgang immer um das Begehren eines ins Hintertreffen geratenen Staates, der sich das nicht gefallen lassen will und noch genügend machtvolle Gegenwehr auf Lager hat, um dem Partner vor Augen zu führen, daß er sich doch wohl besser „aus eigenem Interesse“ auf Zugeständnisse einläßt. Das funktionierte eine Zeitlang mit Hilfe der – gerade zwischen Japan und den USA reichlich ausgehandelten – „Freiwilligen Selbstbeschränkungsabkommen“, „Marktöffnungsabsprachen“ etc. Im „managed trade“ haben sie es aber schließlich soweit getrieben, daß der gesamte Wirtschaftsverkehr und das jeweilige wirtschaftspolitische Vorgehen der staatlichen Revision und Absprache unterworfen wird. Das macht den Widerspruch nicht weg, sondern treibt ihn nur noch weiter hervor: Der politische Wille ist jederzeit massiv präsent, er ist ja das Subjekt des „managen“, aber er legt sich selber Zügel an, tritt auf als Wille zum „ökonomischen Ausgleich“ und tut so, als müßten nur dort „gerechte Lösungen“ gefunden werden. Den Beteiligten sind also außerökonomische Weiterungen ihrer Streitmaterie nicht recht – aber sie stehen dauernd vor der Tür. „Gehen“ tut das tatsächlich nur so lange, wie der, der auf zwischenstaatliche Verwaltung des Wirtschaftsverkehrs dringt, bei seinem Gegenüber Gehör und Einsicht in Form von Nachgeben findet.
Die amerikanisch-japanische Partnerschaft: Unterfall und Beispiel für das rechte Verständnis der WTO – oder: Was Amerika will und was Amerika erreicht
Die USA haben sich da einen komischen Mischmasch zurechtgelegt. Mit Angriffen auf die japanische Souveränität wollen sie die eigene ökonomische Schieflage beheben, wofür sie wiederum das Einverständnis des japanischen Souveräns benötigen. Der Verweis auf die überlegene Souveränität der USA soll helfen, ihre ökonomischen Ansprüche zufriedenzustellen, und der ökonomische Erfolg soll umgekehrt dazu führen, die volle souveräne Handlungsfreiheit zurückzugewinnen. Indem die USA Japan für sich gewinnen wollen, wollen sie seine imperialistischen Ambitionen brechen – und umgekehrt. Die USA schlagen Japan vor, seinen Wirtschaftsnationalismus im amerikanischen aufgehen zu lassen, mit dieser Einordnung wäre es besser bedient als zuvor – diese Besserstellung hat als Basisindex die Vergeltung, die Japan ansonsten ins Haus steht. Japan soll sich von der Drohung imponieren lassen, Teile seines bzw. des von ihm besetzten Weltmarktes abtreten und so das alte US-Ideal der Gleichsetzung von Geschäft und Gewalt – zumindest teilweise – wieder ins Recht setzen. Die Wahrheit sieht etwas anders aus.
Mit dem jetzigen Begehren sind die USA erstens politisch an einem kritischen Punkt angelangt. Der durchaus ernst gemeinte Schein des Verhandelns und der Absprache wird immer fadenscheiniger angesichts der in Diktate übergehenden Verhandlungsvorschläge der USA und des zunehmend zornigen Widerstandes Japans gegen die Anschläge auf seine Souveränität: Japan ist sich bewußt, daß es hier nicht mehr Zugeständnisse machen soll, die es sich vielleicht noch abringen, als Verlust abbuchen und durch Anstrengungen an anderer Stelle kompensieren könnte, sondern daß überhaupt sein imperialistisches Programm auf dem Spiel steht und von den USA gebrochen werden soll. Die japanische Regierung mag dem Drängen der USA auf eine „bilateral abgestimmte Wirtschaftspolitik“ nachgeben und darauf setzen, den amerikanischen Willen zur Verhandlung und zum „Ausgleich“ ausnutzen zu können. Je mehr sie aber den diktatorischen Vorgaben der USA nachkommt, um ihre Position als Verhandlungspartner mit Recht auf Gehör und gebührende Berücksichtigung zu retten, desto klarer tritt hervor, daß sie sich selbst zum Störenfried ihrer Ökonomie macht und alle gewohnten Arten der nationalen Wirtschaftssteuerung und der internationalen Expansion gefährdet.
Für die USA stellt sich die Sache hingegen so dar, daß ein durchschlagender Verhandlungserfolg gegenüber Japan den Verhandlungspartner in Schwierigkeiten stürzt und neue Widerstände provoziert, was auch wieder ins Kalkül gezogen werden muß. Das heißt: Um ihr auf diesem Weg vorgetragenes (diktatorisches) Anliegen durchzukriegen, müssen sie es verwässern, eben auch auf die Intaktheit, also die wirtschaftspolitische Handlungsfähigkeit und die politische Handlungswilligkeit ihres Partners achten. Die Diktate wollen auf staatsverbürgte und -garantierte Partizipation am japanischen Wirtschaftserfolg hinaus; wollen sie darin erfolgreich sein, müssen sie als Diktate ernst gemeint sein und durchgehalten werden, werden sie durchgehalten, ist es sowohl um den japanischen Wirtschaftserfolg als auch um die Partizipation schlecht bestellt. Es ist eben eine widersprüchliche Angelegenheit, eine gegnerische Wirtschaftsmacht benutzen und gleichzeitig unterordnen zu wollen.
Zweitens zeitigt das amerikanische Bemühen, Amerika Weltmarkterträge zu sichern, indem Japan politisch auf entsprechende Dienste am amerikanischen Reichtum festgelegt wird, ökonomische Wirkungen. Allerdings nicht die, die von den USA beabsichtigt sind. Welcher Art sie sind, zeigt sich schlagend an den Folgen, zu denen Amerikas Anstrengung, den Dollar zur Waffe im Kampf um außenwirtschaftliche Erträge zu machen, geführt hat. Die Absicht, den Handel durch eine politisch erzeugte Aufwertung des Yen nachhaltige im amerikanischen Sinn zu lenken, hat den amerikanischen Nationalkredit nämlich nachhaltig zu schädigen gedroht – in seiner Rolle als Geschäftsmittel und Spekulationsobjekt der Finanzmärkte und als staatliches Finanzierungsmittel. Der Wertverlust des Dollar hat prompt die nationalen Geldhüter auf den Plan gerufen:
„Es hat sich in der Administration die Ansicht durchgesetzt, es müsse den Märkten klar gezeigt werden, daß entgegen dem Schein nicht eine Politik der endlosen Abwertung verfolgt werde. Die Ökonomen… weisen darauf hin, daß eine anhaltende Schwäche des Dollars für die Vereinigten Staaten kontraproduktive Wirkungen hätte. Sollten ausländische Investoren sich auf einen sinkenden Dollar einstellen, wäre eine weitere Schwächung der Aktien- und Kapitalmärkte zu erwarten, die nicht nur die Refinanzierungsbemühungen des Schatzamtes behindern würde, sondern auch realwirtschaftlich und politisch unerwünschte Folgen hätte.“ [14]
Die USA haben also zu spüren bekommen, daß am Außenwert des nationalen Geldes ganz andere Sachen hängen als ausgerechnet Exporterfolge; daß also mit dem dauernden Verfall der Währung der nationale Reichtum schwindet und die Qualität des Dollars als Weltgeld ausgerechnet durch ihre eigenen währungspolitischen Machenschaften erschüttert wird. Deswegen haben sich auch wieder andere Stimmen zu Wort gemeldet, und es ist auf amerikanisches Drängen zu einer internationalen Stützungsaktion des Dollar gekommen.
Die Schädigung des Dollars und die entgegenwirkenden politischen Bemühungen sind mehr als ein Indiz dafür, daß Amerika mit seiner Außenwirtschaftspolitik gegenüber Japan die internationale Geschäftswelt in nicht geringe Zweifel stürzt, was die Haltbarkeit der Bilanzen, die Kreditlinien, die Posten in den Auftragsbüchern angeht. Statt sich Geschäfte national zuzueignen, stiftet die mächtigste Welthandelsnation eine ziemliche Verunsicherung für den Gang der sowieso krisengeschädigten internationalen Geschäfte vom Handel bis zur Spekulation mit Aktien und Devisen. Sie gefährdet z.B. mit der laufenden Drohung, unliebsamen Handelsergebnisse mit Sanktionen im Rahmen des „Super 301“-Gesetzes zu korrigieren, die Verläßlichkeit der Handelsbeziehungen; sie beschädigt die Vertrauenswürdigkeit, also die Geschäftsfähigkeit des nationalen Geldes. Und sie entlarvt mit ihrer betätigten Unzufriedenheit nachhaltig den öffentlich gepflegten Glauben an die geschäftsfördernden neuen Sicherheiten, die mit den GATT-Einigungen für den Welthandel gestiftet worden seien.
[1] Da Japan den größeren Teil seines Außenhandels immer noch mit den USA abwickelt und sich überwiegend in Dollar bezahlen läßt, kommt es zu der – bei führenden kapitalistischen Nationen sonst nicht zu beobachtenden – Eigentümlichkeit, daß die Bilanz in zwei Währungen ausgedrückt wird, wobei sich wiederum die Salden aufgrund der Wechselkursveränderungen der letzten Zeit (s.u.) entgegengesetzt bewegen.
[2] SZ, 31.3.94
[3] Am Euromarkt tauchen vermehrt Yen-Anleihen auf, die das „Anlageverhalten“ dahingehend beeinflussen, daß in Dollar angelegtes Kapital in diese Yen-Anleihen „abwandert“. Dabei gehen solche Anleihen nicht ausschließlich auf den japanischen Staat zurück; es haben überhaupt die um Kapital nachsuchenden Schuldner in aller Welt mitbekommen, daß es sich bei dem Yen um eine aufstrebende und dabei Aufwertungsgewinne verheißende solide Währung handelt, die dem sich darin verschuldenden Anleihebegeber ein „nachhaltiges Anlageinteresse“ sichert.
[4] NZZ, 31.3.94
[5] Die japanische Regierung bezeichnet ihre angestrebten Reformen als „Harmonisierung der japanischen Wirtschaft mit der internationalen Gemeinschaft“ (SZ, 30.3.1994), gibt also dem amerikanischen Vorwurf des Aus-dem-Rahmen-Fallens indirekt recht, ohne jedoch unlautere staatliche Machenschaft einzugestehen.
[6] Vorkehrungen dafür sind schon in der SII-Abmachung getroffen, die gemeinsame Überwachungs- und Beratungsgremien auf hoher Beamtenebene vorsieht.
[7] Motorola hat das „Handy“ erfunden und ist überhaupt in der modernen Telekommunikation mit tonangebend. Den Zugang zum japanischen Markt – auf dem es keinen vergleichbaren nationalen Anbieter gibt – fand es jedoch versperrt, und zwar dadurch, daß der japanische Staat sein Gebiet in zwei Zonen unterteilte: in den Korridor Tokio-Nagoya – das ist der japanische Geschäftsraum – und in den ganzen Rest. In dem Korridor wurde Motorola zu einer Partnerschaft mit dem nationalen Anbieter IDO gezwungen, der wiederum die Produkte der eigenen NTT bevorzugte; der Marktanteil Motorolas verblieb dort bei nicht ganz zwei Prozent, während er im übrigen Japan auf 50% stieg. Dabei sollte ein Handelsabkommen aus dem Jahr 1989 Motorola in dem interessanten Gebiet einen Anteil von einem Drittel verschaffen. Dem Durchbruch Motorolas stand jedoch nicht nur der angeblich böse Wille des nationalen Partners entgegen, sondern auch ein objektives Hindernis: Die amerikanische Technik braucht eine bestimmte Infrastruktur (Funktürme), und die wird nicht nur in Japan in erster Linie von der Post aufgebaut. Die hielt sich natürlich erst einmal an ihre eigenen Normen bzw. an die technischen Anforderungen ihrer nationalen Kapitalisten. Den amerikanischen Handelsbeauftragten irritierte das nicht weiter: Er ließ sich von Motorola den entgangenen Gewinn auf 250-300 Mio $ beziffern und drohte, exakt diese Summe durch Importzölle auf japanische Güter hereinzuholen. Was er nicht sagte, war, auf welche Güter genau diese Zölle erhoben werden sollten und ob der Erlös dann an Motorola weitergeleitet würde. Als Ausweg bot er der Post und IDO an, daß sie etwa 150 Funktürme zwei Jahre früher als geplant für die Bedürfnisse Motorolas zu bauen und sofort etwa 230000 Funktelefone abzunehmen hätten. „Der Vorstandschef von IDO bezeichnete die Forderungen als einseitig und exorbitant. Sie verstießen möglicherweise gegen das Kartellrecht. Zudem würden notwendige zusätzliche Investitionen die finanzielle Basis der Firma gefährden.“ Dieser Einwand wurde nicht gehört – die USA setzten sich mit ihrer Forderung durch.
[8] Vgl. GegenStandpunkt 4-92, S.121 „Die USA in der Krise“
[9] Vgl. GegenStandpunkt 2-93, S.87 „Japan: Erfolgsweg und aktuelle Krise der dritten Weltwirtschaftsmacht“
[10] Solchen Staaten, die klar und deutlich dazu stehen, daß der Kapitalismus aller Staatsmacht bedarf, bleibt es natürlich unbenommen, in dem Maße, wie sie selbst zu regelsetzenden Mächten werden, sich fortan zu den wahren Hütern der Freiheit des Kapitals zu ernennen und beim alten Hüter immer erstaunter und empörter einen nie für möglich gehaltenen „allumfassenden Staatszugriff“ zu entdecken, in der Rüstungsindustrie, in der Flugzeugindustrie, bei den Farmern, in der Stahlwirtschaft usw…
[11] Wie es sich für
einen Rechtsstaat gehört, haben es sich die USA
angewöhnt, „Länder auf die Anklagebank zu setzen“ (die
EU hat sich nicht lumpen lassen und das
Gegen-Kommissariat in Brüssel eingerichtet): Zum
neuntenmal hat das Büro des US-Handelsdelegierten den
Bericht über Behinderungen im Außenhandel
veröffentlicht. Wer erwartet hatte, daß das
Sündenregister nach Abschluß der Uruguay-Runde im Gatt
kürzer ausfallen würde, sah sich eines Besseren
belehrt: mit 280 Seiten fiel das Werk noch voluminöser
aus. 39 Länder und Handelsblöcke wurden unter die Lupe
genommen… Der größte Abschnitt ist Japan gewidmet, und
breiten Raum nimmt wiederum die Europäische Union
ein.
Dabei ist dem Handelsdelegierten auch ein
Kriterium eingefallen, wie er die Größe des Verbrechens
messen und mit unmittelbarem amerikanischem Gegenerfolg
bestrafen kann: Das USTR (Büro des
Handelsdelegierten) ist dabei, eine Prioritätenliste
derjenigen Handelspraktiken zu erstellen, deren
Beseitigung das größte Potential für eine Steigerung
der US-Exporte verspricht.
(NZZ, 3.4.94)
[12] Das schon beschlossene „Konjunkturprogramm“ reicht also immer noch nicht.
[13] NZZ, 1.4.94
[14] NZZ, 3.5.94 (Hervorh.i.O.)