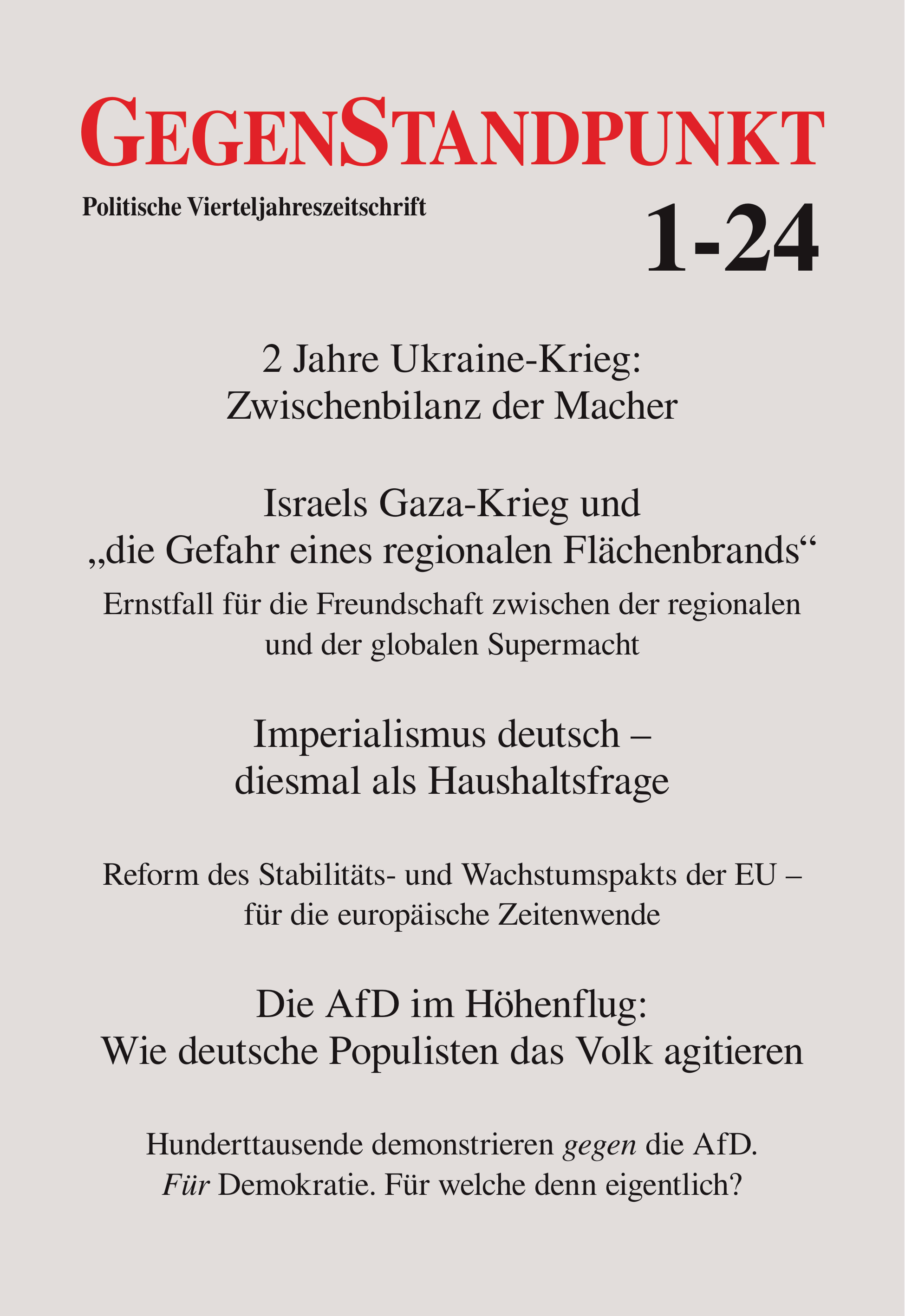2 Jahre Ukraine-Krieg: Zwischenbilanz der Macher
Russen töten und sterben für den Status ihres Heimatlandes als weltpolitisch ernst zu nehmende militärische Weltmacht; einen Status, den das große Militärbündnis der USA mit Europa nicht duldet, gegen den die NATO gerichtet ist und ausgebaut wird. Sie sind die menschliche Manövriermasse in einer blutigen Konkurrenz der nationalen Ressourcen, die ihre Staatsmacht auf dem Schauplatz Ukraine austrägt: gegen die ukrainische Armee als unmittelbaren Feind; dabei für den allerhöchsten strategischen Zweck, dem Monopol des Westens als weltweit zu wirksamer Abschreckung fähige Gewalt eine letztlich ebenbürtige Gegen-Abschreckung als wirksamen Einspruch entgegenzusetzen.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
2 Jahre Ukraine-Krieg: Zwischenbilanz der Macher
1.
Russen töten und sterben für den Status ihres Heimatlandes als weltpolitisch ernst zu nehmende militärische Weltmacht; einen Status, den das große Militärbündnis der USA mit Europa nicht duldet, gegen den die NATO gerichtet ist und ausgebaut wird. Sie sind die menschliche Manövriermasse in einer blutigen Konkurrenz der nationalen Ressourcen, die ihre Staatsmacht auf dem Schauplatz Ukraine austrägt: gegen die ukrainische Armee als unmittelbaren Feind; dabei für den allerhöchsten strategischen Zweck, dem Monopol des Westens als weltweit zu wirksamer Abschreckung fähige Gewalt eine letztlich ebenbürtige Gegen-Abschreckung als wirksamen Einspruch entgegenzusetzen. Russlands weltmachtpolitischer Unvereinbarkeitsbeschluss gegen die amerikanisch-europäische Kriegsallianz geht in seiner Umsetzung in Form einer auf die Ukraine beschränkten „militärischen Spezialoperation“ – so heißt der Krieg in Moskau noch immer – nicht auf, fällt damit aber praktisch zusammen: Dort ringt der Staat um ein Kriegsergebnis, das der Regierung als hinreichende westliche Niederlage und russischer Erfolg erscheint.
Der ursprüngliche Plan, mit einem Überfall für eine Entmachtung der als NATO-Vasall agierenden Regierung in Kiew zu sorgen, ist vom Westen vereitelt und auch die nächste Phase des Krieges, die Eroberung der ostukrainischen Gebiete, ist weitestgehend gestoppt worden; mit NATO-Mitteln hat die ukrainische Armee den russischen Feind in einen ruinösen Abnutzungskrieg verwickelt; zudem muss Russland mit einer massiven ökonomischen Schädigung durch den immer weitergehenden Ausschluss vom westlich beherrschten Weltmarkt fertigwerden. Gleichwohl: Anfang 2024 zieht Russland über den Stand dieses doppelten Kampfs der Ressourcen, für den es sein Volk an der Front und in der Heimat in Haftung nimmt, eine dreifache positive Bilanz.
Die betrifft erstens die ökonomische und menschliche Basis der Staatsmacht. Die nationale Wirtschaft ist unter den Kosten des Krieges nicht nur nicht zusammengebrochen, sondern erfolgreich auf Kriegswirtschaft umgestellt. Der hochgefahrene militärisch-industrielle Komplex, [1] finanziert durch ca. ein Drittel des gesamten Staatshaushalts (mehr als 6 % des BIP), produziert und ersetzt die benötigten, massenhaft verschlissenen Kriegsgeräte. Die restliche Wirtschaft ist dabei, sich aus der Abhängigkeit vom Westen, die der zur Schädigung Russlands einsetzt, zu befreien. Der Energie- und Rohstoffsektor kann eine Steigerung bei den Exporteinnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft verbuchen. Damit sorgt der Staat trotz aller Sanktionen im Zuge des westlichen Wirtschaftskriegs für ein Wirtschaftswachstum insgesamt, für das sich Ex-Präsident Medwedjew sarkastisch-hämisch bei der EU bedankt. Auch in Bezug auf die Ressource Mensch, die so großzügig auf dem Schlachtfeld verbraucht wird, sieht sich Russland in der Lage, den Krieg besser auszuhalten als sein Gegner: Eine weitere Mobilmachung hält der russische Präsident trotz hoher Todeszahlen an der Front in der aktuellen Phase nicht für geboten, weil das Militär genug Soldaten rekrutieren kann – auch im Ausland; für eigene Bevölkerungsteile wie für etliche fremde Völker ist ein russischer Sold durchaus attraktiv.
Seine derzeitige Übermacht an Ressourcen nutzt Russland, umauf dem Schlachtfeld den Stellungskrieg zu überwinden und in die Offensive zu gehen. Aus Sicht Putins hat Russland nämlich zweitensden Kriegsverlauf nach der Abwehr der ukrainischen, mit modernsten Panzern ausgestatteten Offensive endlich unter Kontrolle gebracht; und das eröffnet ihm die Freiheit, öffentlich Überlegungen anzustellen, wie der Erfolg einer nächsten Kriegsetappe auszusehen hätte. Da kann er sich z.B. große Teile der Ukraine als militärische Pufferzone vorstellen:
„Und diese Linie muss derart sein und in einer solchen Entfernung zu unseren Territorien verlaufen, dass sie die Sicherheit gewährleistet, ich denke da an weitreichende Waffen, vor allem aus ausländischer Produktion.“
Auf Basis dieser Erfolge ist für Putin drittens klar: Russland kann der NATO aus einer Position der Stärke gegenübertreten. Die Lage auf dem Schlachtfeld macht er zum Hebel für eine Kriegsdiplomatie mit dem Westen: Den will er zu der Einsicht bringen, dass Russlands Militärmacht nicht zu zerstören, der russische Anspruch auf Weltmachtgeltung also unbedingt zu berücksichtigen ist:
„Bislang war das Geschrei groß, Russland auf dem Schlachtfeld eine strategische Niederlage beizubringen. Jetzt scheinen sie zu erkennen, dass dies schwer zu erreichen ist, wenn überhaupt möglich. Meiner Meinung nach ist es per Definition unmöglich, es wird niemals geschehen. Ich habe den Eindruck, dass nun auch die Machthaber im Westen zu dieser Erkenntnis gelangt sind. Wenn das so ist, wenn die Erkenntnis eingesetzt hat, dann müssen sie überlegen, was sie als Nächstes tun. Wir sind bereit für diesen Dialog.“ (Putin, 9.2.24)
Dass Putin damit bisher nur auf Absagen seitens der USA und der europäischen Führungsnationen stößt, ist für ihn umso mehr der Stachel, auf dem Schlachtfeld weitere Fakten zu schaffen. Die verheerenden Opfer auf Seiten des eigenen Volkes, deren Ende nicht absehbar ist, fangen endlich an, sich zu lohnen – so die zynische Sicht eines kriegführenden Staatenlenkers.
2.
Ukrainer sterben und töten für eine mehrfache Mission. Zuerst und vor allem für ihre Heimat. Die fällt nicht nur räumlich damit zusammen, sondern ist dadurch definiert, dass der zuständige Machthaber das gesamte Gelände der ehemaligen Sowjetrepublik wieder unter Kiews Herrschaft bringen will, um damit in respektabler Weise Staat zu machen.
Mit diesem Vorhaben steht es nach 2 Kriegsjahren allerdings nicht gut. Aus der schon vom Sommer auf den Herbst ’23 verschobenen Offensive, die einen Durchbruch durch die russische Frontlinie bringen sollte, ist nichts geworden. Die eigene Armee ist inzwischen mehr in der Defensive; und selbst für die fehlt es an Munition und an frischen Kräften. Und nicht nur das: Die militärischen Probleme sorgen für einen zunehmend zersetzenden Streit zwischen politischer und militärischer Führung um Schuld und Verantwortung; einen Streit, in dem die Seiten sich wechselseitig vorwerfen, mit den knappen Mitteln verkehrt umzugehen und so der gemeinsamen Sache zu schaden. Dieser Streit endet schließlich fürs Erste mit dem Austausch der Militärführung. Der neuen stehen allerdings auch keine weiteren Optionen zur Verfügung: [2] Der Antrag, 500 000 weitere Soldaten zu rekrutieren, stößt nicht nur auf die Schwierigkeit, dass der Staat weder die nötige Ausrüstung hat noch die Mittel, diese zu beschaffen. [3] Die Einberufung selber ist ein Problem: Es fehlt an Personal; von ausgebildeten Soldaten ganz zu schweigen. Ein Gesetzesvorhaben, das auf eine beträchtliche Ausweitung der Wehrpflicht zielt, kommt erst gar nicht zustande. Ein großer Teil der Dienstpflichtigen tut alles, um der Einberufung zu entgehen. Das immerhin mit so viel Erfolg, dass der Staatschef schon vor Monaten die Leiter der zuständigen Behörden pauschal entlassen hat. Schuld daran ist nach amtlicher und allgemeiner Diagnose das „Erzübel“ der Korruption. Und das ist auch deswegen aufschlussreich, weil an demselben „Missstand“ – und nicht nur an den russischen Angriffen u.a. auf die Energie-Infrastruktur des Landes – der Aufbau einer halbwegs funktionsfähigen Ökonomie scheitert, mit der der Staat seine Gesellschaft bewirtschaften, Schuldenbedienung, Lohnauszahlung, Renten sicherstellen, geschweige denn die fortlaufende Unterhaltung der Armee leisten könnte. Es kommt nicht nur zu wenig Geld in den Haushalt: Die Staatsgewalt bringt den zuverlässigen Zugriff auf Land und Leute, die ordentliche Verfügung über menschliche und sachliche Ressourcen, die wirksame Bürokratie nicht zustande, die ihrem Anspruch auf Souveränität die nötige Grundlage verschaffen würde.
Nach 2 Jahren Krieg ist der Status der Ukraine – nach wie vor – nahe an dem eines „failing state“: Der Staat kämpft, mitten im Krieg, um die Reichweite seiner Macht, im Innern um sein funktionstüchtiges flächendeckendes Gewaltmonopol.
Für die Regierung in Kiew folgt aus der unübersehbaren, auch gar nicht übersehenen Zerrüttung ihrer Herrschaft als Erstes, siehe oben, die Schuldfrage. Gestellt und beantwortet wird sie, wie es sich in der Politik gehört, mit einem Machtkampf. Den entscheidet der Präsident fürs Erste und bis auf Weiteres für sich und damit für den unbedingten Willen zum Sieg, als dessen Inkarnation er nicht nur zu Hause, sondern bei jeder Gelegenheit in jedem befreundeten Ausland auftritt. Das tut er dort, um Unterstützung durch Geld und Waffen für sein Land einzuwerben. Damit leistet er ein doppeltes Eingeständnis. Nämlich erstens, dass sein Land zu dem Krieg, dem er es vollständig unterwirft, für den und von dem allein es überhaupt noch lebt, von sich aus gar nicht fähig ist. Dass es ihn führt, ist eine nationale Auftragsarbeit. Für welchen externen Zweck die Ukrainer aufgerieben werden, wenn sie für ihr heiliges Vaterland töten, sterben und leiden, bringt ihr Präsident bei seinen Auslandsbesuchen – und den Besuchen des wohlgesonnenen Auslands in Kiew – mit dem stereotypen Appell an den strategischen Eigennutz der freien Welt im Allgemeinen, den Sicherheitsbedarf der Europäer im Besonderen in Erinnerung. Das tut er mit zunehmender Dringlichkeit; und darin liegt das zweite Eingeständnis: Sein Land hält diesen Krieg immer weniger aus.
Diesem Befund setzt der Präsident seinen unerschütterlichen Siegeswillen entgegen. Zum einen, damit sein Volk ihn teilt und – wieder – vermehrt zu den Waffen strömt, statt sich vom Verheizt-Werden freizukaufen. Zum anderen, damit seine Sponsoren an dem Standpunkt festhalten – und zwar ehrlich und praktisch und nicht nur ideell –, dass ein ukrainischer Kriegserfolg für ihre weltpolitische Sache unentbehrlich ist, und damit sie ihr williges Werkzeug für den gewünschten Erfolg tauglich machen, weil der Präsident ihnen Erfolgstüchtigkeit verspricht, auch wenn Erfolge momentan ausbleiben. Für beides hat Selenskyj einen guten Grund, der wieder zu dem ersten hohen Zweck schrankenloser ukrainischer Opferbereitschaft zurückführt: Ein Gewaltapparat unter seinem Kommando, der sich – wenn auch in fremdem Auftrag und Interesse – gegen das russische Militär durchsetzt, wäre zumindest der Auftakt zu einem wirklichen Gewaltmonopol über alles, was von der Ukraine dann noch übrig ist, und insofern womöglich der Gründungsakt für einen Staat, der sich als Souverän sehen lassen kann. Dann wäre eine Generation abkommandierter Bürger wirklich für ein ukrainisches Vaterland draufgegangen.
3.
Die westliche Kriegsallianz, Russlands eigentlicher Gegner, lässt Ukrainer sterben und mit viel freiheitlich-demokratischem Kriegsgerät Russen töten. Mit ihrem Engagement – ohne das es, wie jeder weiß, den Krieg gar nicht gäbe – nimmt sie den russischen Einspruch gegen ihre Politik der fortschreitenden Dezimierung russischer Weltmacht ernst, nämlich als Angriff auf ihr Weltordnungs- und strategisches Gewaltmonopol. Sie beantwortet Russlands gewaltsame Selbstbehauptung dort und auf dem Niveau, auf dem Russland sie sucht: im Kampf um die Ukraine, den Moskau als Entscheidungsfall für den eigentlichen großen Konflikt definiert und durchficht. USA und NATO nehmen das als historische Gelegenheit, gewaltsam gegen Russlands Ausnahmestellung in der Staatenwelt, seinen Status als Gegenmacht gegen das Abschreckungsregime der westlichen Weltmacht vorzugehen, ohne die strategische Substanz dieser Ausnahmestellung, die auf Atomwaffen gegründete Gegen-Abschreckung, direkt anzugreifen, also in all ihrer Bedrohlichkeit ins Spiel zu bringen. Dass auf die Art Russlands Fähigkeit zur Selbstbehauptung als Weltmacht nicht definitiv zu eliminieren ist, nimmt der Westen berechnend in Kauf. Dank schrankenloser ukrainischer Opferbereitschaft führt er, risikobewusst und ohne eigene Menschenopfer, einen verheißungsvollen Angriff auf Russlands konventionelle Militärmacht inklusive ihrer ökonomischen und menschlichen Ressourcen; in der erklärten Absicht und tatsächlich mit der Option, die feindliche Macht zu zerstören. Das hat man sich bisher viel Geld kosten lassen. Dabei kommen die beiden NATO-Pfeiler zu Beginn des dritten Kriegsjahres allerdings zu keiner gemeinsamen Bilanz mehr.
a)
In den USA herrscht mittlerweile ein politischer Streit um die Freigabe von 61 Milliarden Dollar an Unterstützungsleistungen für die Ukraine. Dem Beharren der Biden-Administration auf der absoluten Notwendigkeit dieses Hilfspakets nicht nur für die Ukraine, sondern für die Unanfechtbarkeit der amerikanischen Kontrolle über die gesamte Weltordnung, stellen nicht nur einige Republikaner, sondern auch und gerade ihr Chef Trump den Befund gegenüber, dass weiteres amerikanisches Geld für diesen Krieg weder nötig noch nützlich ist. Amerika hat sich für eine größere, dringlichere Feindschaft jenseits des Pazifik in Stellung zu bringen – gegen den einzigen Feind, der gefährden kann, was laut Trump und Co das einzige globale Anliegen der Nation, abgesehen von einem effektiven Schutzwall gegen globales Elend, zu sein hat: ihre Suprematie. Wenn Amerika die Ukraine und die Ukrainer für das Verschleißen der russischen Macht verschleißt, dann denkt es eben nicht genug an sich; es wird benutzt, statt andere zu benutzen. Damit wäre der noch grundsätzlichere Zweifel ausgedrückt, den diese Fraktion gegen den Nutzen des ganzen NATO-Bündnisses hegt, was im Bild von säumigen Schuldnern zweckgemäß formuliert wird.
Die Unentschiedenheit dieses Streits konkurrierender imperialistischer Selbstbilder bedeutet vorerst den Stopp weiterer Waffenlieferungen an die Ukraine und macht sich auf dem Schlachtfeld schon geltend – dort, wo die Biden-Regierung ohnehin schon die strategische Bilanz gezogen hat, dass es in der Ukraine so wie bisher nicht weitergehen kann: Der Krieg braucht ein neues militärisches Ziel; die Amerikaner erzwingen die Beendigung der ukrainischen Offensivbemühungen und eine Umstellung auf Defensive auf der ganzen Frontlinie. [4] Die finanzielle Unterstützung wird nicht mehr auf die Aufrüstung einer neuen Offensive ausgerichtet, sondern soll als Erstes insgesamt reduziert werden. Zweitens soll in der Ukraine mit amerikanischen Geldern eine ukrainische Industrie inklusive einer militärisch-industriellen Basis aufgebaut werden, die diese in die Lage versetzt, die für den Abnutzungskrieg mit Russland benötigten Waffen und Munition selbst herzustellen und insgesamt eine Ökonomie am Laufen zu halten, die ihr als Quelle für die Finanzierung des Krieges dienen kann. Das ukrainische Kriegsziel, die Rückeroberung der besetzten Gebiete, ist damit bis auf Weiteres vom Tisch: [5]
„Aber was die umfassendere Frage betrifft: Nein, es hat keine Änderung der Strategie stattgefunden... Wir haben immer deutlich gemacht, dass wir wollen, dass die Ukraine ein unabhängiges Land ist, und das bedeutet, dass sie auf eigenen Beinen stehen kann. Wir werden die Ukraine weiterhin unterstützen. Das ist die Politik der Vereinigten Staaten... So lange es dauert. Das bedeutet nicht, dass wir sie weiterhin mit der gleichen militärischen Finanzierung unterstützen werden wie in den Jahren 2022 und 2023. Wir glauben nicht, dass das notwendig sein sollte, denn das Ziel besteht letztendlich darin, die Ukraine umzustellen, dass sie auf eigenen Füßen steht, und der Ukraine dabei zu helfen, eine eigene Industriebasis und eine eigene militärisch-industrielle Basis aufzubauen, damit sie selbst Waffen finanzieren, bauen und erwerben kann. Aber wir sind noch nicht so weit, und deshalb ist es so wichtig, dass der Kongress das Gesetz zur zusätzlichen Finanzierung verabschiedet, denn wir sind noch nicht an dem Punkt angelangt, an dem die Ukraine sich allein aus eigener Kraft verteidigen kann. Und deshalb ist es für den Kongress weiterhin wichtig, die Ukraine zu unterstützen, und für unsere europäischen Verbündeten und andere auf der ganzen Welt ist es weiterhin wichtig, die Ukraine zu unterstützen.“ (Miller, Sprecher des US-Außenministeriums, 4.1.24)
Dafür sind die 61 Milliarden Dollar, die die Biden-Administration einplant, dann gut angelegt. So versuchen die USA, das Verhältnis von nötigem eigenem Aufwand für die Unterstützung der Ukraine und dem militärisch-strategischen Ertrag zu ökonomisieren, und nehmen sich damit die Freiheit, die eigenen Ressourcen ganz frei den jeweils für prioritär erachteten Weltordnungsfragen zu widmen. Die um ein Fünftel geschrumpfte Ukraine bekommt den widersprüchlichen Auftrag, sich in ein eigenständiges, selbstverantwortliches Kriegsfeld der NATO zuverwandeln, die diesen Krieg nicht selbst führt und sich zu nichts verpflichtet. Der ganze Existenzzweck der Ukraine hat in seiner Funktion zu bestehen, Russland in einen dauerhaft schädigenden Abnutzungskrieg zuverwickeln. An dieser Rolle der Ukraine gibt es in Washington durchaus Interesse.
b)
Europa registriert zu Beginn des dritten Kriegsjahres eine gestiegene und zunehmende Gefährdung seines fortbestehenden Kriegsziels, dem viel zu mächtigen feindlichen Nachbarn Russland in der Ukraine eine nachhaltige Niederlage beizubringen und seine militärische Macht – jedenfalls unterhalb seiner strategischen Atomwaffen – auf ein beherrschbares Maß zu reduzieren.
Die Gefahr geht auf der einen Seite von sorgenvoll diagnostizierten Schwächen der ukrainischen Armee aus. Gefasst wird sie in Form der – nicht neuen, aber starkgemachten – Befürchtung, ein russischer Erfolg würde Putin zu weiteren, weitergehenden Über- und Angriffen auf ehemalige Besitzstände des einstigen „Sowjetimperiums“, womöglich sogar auf die baltischen EU- und NATO-Mitglieder ermutigen; was dem westlichen Bündnis noch viel größere Anstrengungen abverlangen würde als ein Sieg über Russland an der Ukraine-Front. Diese antirussische Neuauflage der alten antikommunistischen Dominotheorie, mit der der Westen sich seinerzeit zur Unterdrückung jedes linken Umsturzes selbstverpflichtet hat, weil sonst ein Verbrechen gegen die Freiheit nach dem anderen folgen würde, ist offenkundig weniger eine Bilanz als ein Aktionsprogramm. Aber in der Logik einer „regelbasierten“ westlichen Weltherrschaft fällt beides sowieso zusammen: Je anspruchsvoller, je kriegerischer das Vorhaben, desto mehr folgt es unabweisbar aus einer unverschuldeten Notlage.
Eine echte, gar nicht erst zukünftige Gefahr stellt für Europa auf der anderen Seite die offene Frage der amerikanischen Führerschaft im laufenden antirussischen Krieg für die Freiheit dar. Die ist zwar noch längst nicht obsolet, der gemeinsame Kreuzzug gegen Putins Reich des Bösen keineswegs abgesagt; nicht einmal unbedingt im Fall einer Präsidentschaft Trumps, wenn das nächste Kriegsjahr beginnt. Ein Schaden ist aber jetzt schon da: Nach zwei Jahren eines gemeinsamen Ukrainekriegs-Sponsoring entfällt erst einmal die übergroße, bislang entscheidende Finanz- und Waffenhilfe der USA. Und schon die Aussicht auf die Möglichkeit einer europakritischen, NATO-widrigen Trump-Politik nötigt die europäischen Verbündeten in Rechnung zu stellen, dass die strategische Geschäftsgrundlage ihres tapferen antirussischen Engagements zweifelhaft werden könnte: Amerikas Politik der atomaren Abschreckung, die ihnen überhaupt die gesicherte Freiheit für ihre aggressive indirekte Kriegführung gegen Russland verschafft. [6]
Aus der doppelten Schadensbilanz ziehen die Europäer als Erstes die praktische Konsequenz, dass sie sich der Notwendigkeit stellen müssen, die bis auf Weiteres ausbleibenden Subsidien aus den USA durch vermehrte bzw. vorgezogene Geld- und Waffenlieferungen an die Ukraine zu ersetzen. Dass die Beschlussfassung darüber einmal mehr die innereuropäischen Rivalitäten und wechselseitigen Vorbehalte aufleben lässt, verhindert den Beistand nicht: Was geht, wird geliefert, um den auf langfristige Ruinierung der russischen Kräfte berechneten Bedarf weiterhin zu decken. Die Durchhaltefähigkeit der Russen, zusammen mit durch Nachschubmängel mitverursachten Schwächen der Ukrainer, stellt die europäischen Ausstatter aber vor das Problem, dass die schrittweise Steigerung ihres Kriegshilfswerks womöglich nicht mehr reicht, und damit vor die politisch zu entscheidende Alternative, ob es bei einer Eskalation des Einsatzes nach dem bisherigen Muster bleiben soll oder ob nicht schon ein qualitativ bedeutsamer Fortschritt in der Wahl der Waffen auf die Tagesordnung zu setzen ist, um die Ukraine als für den Bedarf Europas taugliches Kriegswerkzeug zu erhalten. Das Drehbuch dafür gibt es längst. Es folgt dem bewährten Muster, dass die „rote Linie“ von heute die akzeptierte Praxis von morgen ist; die fälligen Stationen sind mit „F-16“, „Taurus“, „Ausgleich des Personalmangels der ukrainischen Armee durch westliche Soldaten in der Etappe“, schließlich – wenn schon, denn schon – mit „Boots on the ground“ schon mal in der Debatte. Das würde allerdings bedeuten, dass Europas Engagement die Grenze zu direkten Angriffen auf Russland definitiv zu überschreiten beginnt – bzw. nur nach einer winkeladvokatischen Auslegung des Völkerrechts unterhalb der Schwelle aktiver Kriegführung bleibt; einer Spitzfindigkeit, die in der Sache bestätigt, was sie juristisch dementiert. So geht diese Entscheidungsfrage nahtlos über in die Alternative, die für die Europäer aus der großen amerikanischen Verunsicherung folgt: Will man tatsächlich, in der Praxis, auch ohne letzte Sicherheit über die strategische Abschreckungsmacht der USA dem Dogma von der letztendlichen Feigheit des russischen Monsters folgen und die feindliche Atommacht bis zum Letzten herausfordern? Oder soll man nicht doch besser in Rechnung stellen, dass an Putins Warnung vor einsatzbereiten russischen Atomwaffen etwas dran sein könnte und dass angesichts einer gewissen Ambivalenz der amerikanischen Politik eine gewisse Vorsicht beim Eskalieren geboten sein könnte?
Unstrittig ist auf jeden Fall das langfristige Projekt, das für Europa aus der unbefriedigenden Bilanz der ersten 2 Jahre Ukrainekrieg folgt: Die NATO-Mächte diesseits des Atlantiks, die EU noch einmal speziell, Deutschland als ambitionierte Führungsmacht in beiden Bündnissen müssen autonom kriegstüchtig werden. Spätestens in 5 Jahren. Und das am besten zusammen mit der Ukraine. Egal, ob von der dann noch mehr als eine Trümmerwüste mit Friedhof übrig ist.
[1] „Putin behauptete, dass 6 000 russische Unternehmen und 3,5 Millionen Arbeitnehmer Teil der russischen DIB [defence industrial base] seien und dass 10 000 weitere Unternehmen in Hilfs- oder Unterstützungsfunktionen mit der DIB verbunden seien. Putin erklärte, dass die russische DIB in den letzten 16 Monaten 520 000 neue Arbeitsplätze geschaffen habe; die Produktion von gepanzertem Personenschutz um den Faktor 2,5 gesteigert habe; und die Produktion von gepanzerten Fahrzeugen und anderer Ausrüstung für die Kriegführung mit verbundenen Waffen um einen nicht näher bezeichneten Prozentsatz gesteigert habe... Putin betonte auch wiederholt, dass Russland seine DIB mit technologischer Innovation und Anpassung prioritär erweitere, und behauptete, dass alle neuesten Waffen Russlands den von NATO-Ländern hergestellten Waffen überlegen seien.“ (Institute for the Study of War, 2.2.24)
[2] „‚Eine weitere Quelle von Spannungen ist die Kluft zwischen dem, was Saluschnyj für das ukrainische Militär gefordert hat, und dem, was die politische Führung Kiews von Verbündeten und Partnern erhalten hat‘, sagte eine zweite Person, die mit dem Treffen am Montag vertraut war. ‚Er sagt in Gesprächen mit dem Verteidigungsminister: Es ist nicht meine Aufgabe, das zu besorgen, sondern Ihre‘, so die Person.“ (Washington Post, 31.1.24)
[3] „Saluschnyj schlug vor, fast 500 000 Soldaten zu mobilisieren, eine Zahl, die Selenskyj angesichts des Mangels an Uniformen, Waffen und Ausbildungseinrichtungen sowie der potenziellen Probleme bei der Rekrutierung als unpraktisch ansah, so die Personen. Selenskyj hat auch öffentlich erklärt, dass der Ukraine die Mittel fehlen, um so viele neue Wehrpflichtige zu bezahlen.“ (Washington Post, 31.1.24)
[4] „Die Vereinigten Staaten intensivieren ihre persönliche militärische Beratung für die Ukraine und entsenden einen Drei-Sterne-General nach Kiew, der längere Zeit vor Ort verbringen wird. US-amerikanische und ukrainische Militäroffiziere hoffen, im nächsten Monat in einer Reihe von Kriegsszenarien in Wiesbaden, Deutschland, die Einzelheiten einer neuen Strategie ausarbeiten zu können.
Die Amerikaner drängen auf eine konservative Strategie, die sich darauf konzentriert, das Territorium der Ukraine zu halten, sich einzugraben und im Laufe des Jahres Vorräte und Streitkräfte aufzubauen. Die Ukrainer wollen zum Angriff übergehen, sei es am Boden oder mit Fernschlägen, in der Hoffnung, die Aufmerksamkeit der Welt auf sich zu ziehen.“ (nytimes.com, 11.12.23)
[5] „Noch immer unter dem Eindruck der gescheiterten Gegenoffensive in der Ukraine im letzten Jahr stellt die Regierung Biden eine neue Strategie zusammen, die den Schwerpunkt nicht auf die Rückgewinnung von Territorium legt und sich stattdessen darauf konzentriert, der Ukraine zu helfen, neue russische Vorstöße abzuwehren, während sie sich auf das langfristige Ziel der Stärkung ihrer Kampfkraft und Wirtschaft zubewegt.
Der sich abzeichnende Plan stellt eine deutliche Veränderung gegenüber dem letzten Jahr dar, als die USA und verbündete Militärs Kiew mit Ausbildung und hochentwickelter Ausrüstung versorgten, in der Hoffnung, die russischen Streitkräfte, die die Ost- und Südukraine besetzen, schnell zurückdrängen zu können. Dieser Versuch scheiterte vor allem an den stark befestigten Minenfeldern und Frontgräben Russlands.“ (Washington Post, 26.01.24)
[6] „Die Vorstellung, Deutschland könnte bei einem Ausstieg der USA ziemlich einsam an vorderster Front der Militärhilfe stehen, ist Scholz nicht geheuer. ‚Es wäre keine gute Nachricht, wenn Deutschland, sollten die USA als Unterstützer wegfallen, am Ende der größte Unterstützer der Ukraine wäre‘, sagte er kürzlich in einem ‚Zeit‘-Interview. ‚Wir sind, wie Helmut Schmidt gesagt hat, nur eine Mittelmacht.‘ Auch Europa als Ganzes wäre kaum in der Lage, die US-Hilfen vollständig auszugleichen. Und die Vorstellung, die europäischen Nato-Länder könnten von heute auf morgen alleine für ihre Sicherheit sorgen, wird von Experten einhellig als Illusion eingestuft. Die USA kommen trotz einiger im Zuge des Ukraine-Kriegs erhöhter Militäretats in Europa für mehr als zwei Drittel (68 Prozent) der Militärausgaben des Bündnisses auf.“ (Zeit Online, 7.2.24)