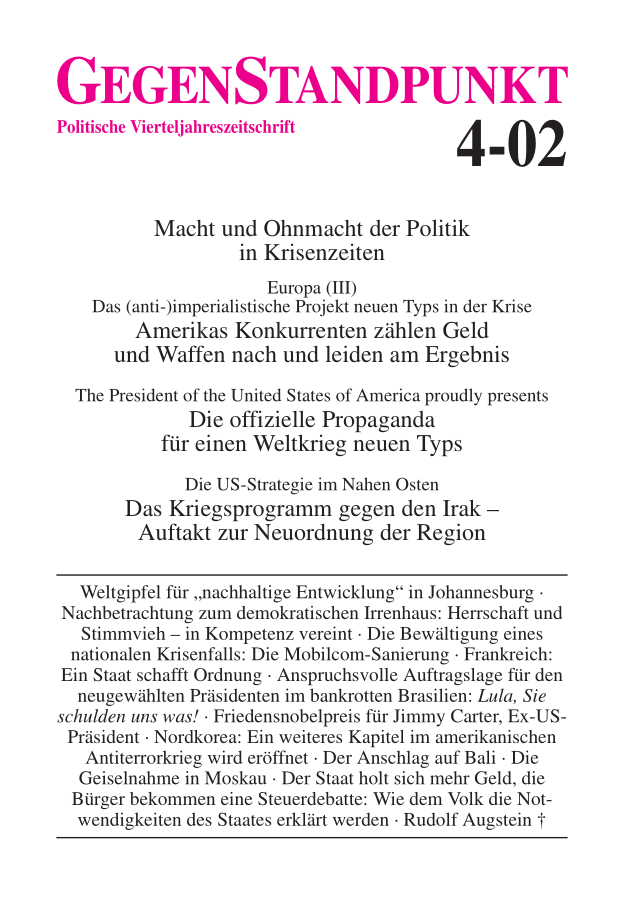Macht und Ohnmacht der Politik in Krisenzeiten
Der Staat, der sich vom Erfolg des Kapitals abhängig gemacht hat, steht dem unproduktiven Überschuss an Geldmitteln ohnmächtig gegenüber; seine Geldmacht leidet. Zur Bewältigung der Krise setzt er seine politische Gewalt ein: er agiert als Manager der Kapitalentwertung. National setzt er die Verarmung des Volkes durch. International wird die Krise zur Machtfrage zwischen den Nationen um die Herrschaft über die weltweiten Geschäftsbedingungen.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Gliederung
- Staat und Krise I: Die Ohnmacht der Staatsmacht in der Krise – Politische Wege aus der Ohnmacht
- Staat und Krise II: Krisenkonkurrenz international – Abrechnung bis zur Enteignung und das politökonomische Kräfteverhältnis
- Exkurs zum Aufschwung der politischen Kultur in Zeiten des ökonomischen Abschwungs
- Staat und Krise heute:Fortschritte in der Frage des Staatsbankrotts
Macht und Ohnmacht der Politik in Krisenzeiten
Staat und Krise I: Die Ohnmacht der Staatsmacht in der Krise – Politische Wege aus der Ohnmacht
Die Krise sucht die Börse und den Einzelhandel, die Automobilproduktion und die Lohnabhängigen heim – und nicht nur die. Was vom Standpunkt der diversen Betroffenen aus der Welt des bürgerlichen Erwerbslebens so aussieht, dass ihre Rechnungen nicht mehr aufgehen, das gerät für den Staat und in der Wahrnehmung seiner Agenten zu einem Schadensfall ganz anderer Größenordnung: Leistungen für ihn, die er seiner Gesellschaft auferlegt hat, fallen aus. Das fängt ganz unten mit den Steuern und Abgaben an, die die in wachsender Menge auftretenden Arbeitslosen schuldig bleiben: Entgangene Einzahlungen in die staatlichen Kassen bilden den einen großen Negativposten, an dem die Unerträglichkeit der Millionen „Einzelschicksale“ von Lohnabhängigen ohne „Beschäftigung“ allgemeinwohlorientiert vorgerechnet wird. Das geht weiter mit den Löhnen und Gehältern, die auch in Krisenzeiten noch gezahlt werden und die unverhofft, allerdings auch nur im Irrealis eine seltsam positive Würdigung erfahren – ausgerechnet da, wo sie konjunkturgemäß und durchaus im Sinne des gemeinen Wohls abgesenkt werden: Unter dem Gesichtspunkt, dass die „öffentlichen Hände“ sich daran hätten bedienen und ihre Bilanzen hätten in Ordnung bringen können, wären die ‚wg. Krise‘ gestrichenen Weihnachtsgelder, Erfolgsbeteiligungen und sonstigen Lohnbestandteile, womöglich sogar Tarifabschlüsse oberhalb der vereinbarten Promille-Grenze, nicht schlecht gewesen. Jetzt leidet die Macht des Staates, den Lohnabhängigen praktisch nachzuweisen, wieviel Geld sie eigentlich übrig haben, unter deren immer schlechterer Bezahlung.[1] Dass Leute, die nichts mehr oder weniger verdienen, sich nicht viel kaufen können, stört die Herrschaft dann noch einmal, wenn sie ihre zweite große Einnahmequelle neben den Löhnen, den Umsatz ihrer Kaufmannsgilde, besichtigt und feststellen muss, dass alle Verbrauchssteuern „eingebrochen“ sind. Unter demselben Gesichtspunkt macht sich der Konsumverzicht negativ bemerkbar, den bisweilen auch die bessere Gesellschaft übt, wenn ihre Vermögensverwaltung sinkende Erträge und sogar einen Wertverfall des verwalteten Portefeuille meldet. Immerhin lässt sich vom Gelderwerb und Geldausgeben der Privatleute, auch wenn beides in der Masse zusehends ärmlicher ausfällt, immer noch etwas wegsteuern. Dagegen wirft eine Geschäftstätigkeit, die schon das investierte Kapital nicht mehr zum Wachsen bringt, fürs Allgemeinwohl erst recht keine Überschüsse ab; schon gleich nicht, wenn es nach allgemeiner und allgemeinverbindlicher Einschätzung für den erhofften nächsten Aufschwung auf liquide Mittel und gute Laune bei den Kapitalisten ankommt. So versagen alle sozialen Charaktere und Institute dem Staat die Dienste, auf die er sie verpflichtet hat – und das, ohne dass sich in der Gesellschaft ein Funken Widerstand gegen die höchsten Gewalten regen würde; wenn man einmal von den Besserverdienenden absieht, die sich in pseudo-anarchistischen Anklagen gegen eine ungeliebte, weil falsch kolorierte Regierung gefallen, die ihrerseits harte Töne gegen die Ausnutzung der „Steuer-Schlupflöcher“ anschlägt, die sie zu guten Teilen selbst für die Elite unter ihren Steuerzahlern eingerichtet hat. Von einer Bevölkerung, die sich erzählen lässt, „dem Bürger“ würde ausgerechnet dann „der letzte Cent aus der Tasche gezogen“, wenn der Finanzminister einen Widerruf der Steuerbefreiung von Spekulationsgewinnen in Aussicht stellt, hat eine Regierung jedenfalls keine Kündigung pünktlicher Dienstbereitschaft zu befürchten. Das ändert aber nichts daran, dass auch eine verschärfte Spekulationssteuer dem Fiskus nichts hilft, wenn allenfalls Spekulationen auf einen fortschreitenden Wertverfall von Wertpapieren noch aufgehen: In der Krise macht sich negativ geltend, dass die Staatsgewalt vom Kapital und dem diesem zuarbeitenden Rest ihrer Gesellschaft lebt.
Dem Staat fehlt zum Regieren also Geld; doch das ist bloß die eine Hälfte des Leidens. Auch mit dem Geld, das sie noch hat, bleibt die politische Herrschaft ihrerseits, obgleich nach wie vor besten Willens, ihrem kapitalistischen Standort in der Krise die Dienste schuldig, die sie sich vorgenommen hat und die in normalen Zeiten ihre Agenda bestimmen. Sie versagt nicht einfach in dem Sinn, dass es unter dem „Diktat leerer Kassen“ von allem, was sie für ihre politische Ökonomie tut und ihrer Bevölkerung antut, bloß ein bisschen weniger gibt, weil für mehr das Geld fehlt. Die Krise macht vielmehr in einem ziemlich grundsätzlichen Sinn alle Haushaltsposten unhaltbar, mit denen der Staat seinen Standort pflegt und in denen sich seine wohltätige Herrschaft materialisiert: Was als Aufwand geplant war und ins staatliche Budget eingestellt worden ist, um die gedeihliche Entwicklung des Gemeinwesens, also in der einen oder anderen Form das Wachstum des kapitalistischen Reichtums der Nation zu fördern, das „schlägt um“ in einen unüberschaubaren Haufen unproduktiver Zahlungsverpflichtungen.
Auch das fängt ganz „unten“, beim Sozialhaushalt an. Den richtet sich der bürgerliche Staat in besseren Zeiten so ein, dass das Management der üblichen Mangelerscheinungen seiner Klassengesellschaft per Umverteilung der ohnehin gezahlten Lohnsumme, also „kostenneutral“ für die kapitalistischen Nutznießer der produktiven Armut der lohnabhängigen „Erwerbsbevölkerung“, zu Lasten der potentiell Betroffenen wie der aktuellen Sozialfälle finanziert wird; das noch dazu so, dass sich bei den gesetzlichen Kassen zwangsgespartes Volksvermögen sammelt, das dem Staatshaushalt billig zur Verfügung steht. Von diesem Arrangement bleiben in Krisenzeiten lauter gesetzlich verbriefte Leistungsansprüche des bedürftigen Fußvolks der Nation bestehen, die mit der allgemeinen Notlage zunehmen, die sinkenden Einnahmen ständig zu überschreiten drohen, das angesammelte Vermögen aufzehren und womöglich echte Kosten verursachen – so war’s wirklich nie gedacht! Aber es hilft nichts: Was der Sozialstaat eingerichtet hat, um das notwendige Maß an gesellschaftlicher Armut funktional zu bewältigen, wird in der Krise zur dysfunktionalen Last.
Um die Ausgaben für produktivere Zwecke, für Infrastruktur und für Bildung, steht es kaum besser. Gedacht und unter besseren ökonomischen Umständen auf den Weg gebracht worden sind sie mit dem Ziel, das Kapital im Land mit möglichst günstigen Wachstumsbedingungen zu bedienen. Gerade in der Krise wird in diesem Sinn Klartext geredet, entgegen allen sonst gepflegten Ideologien von der großen Verantwortung der Politik für „die Menschen“, „die Zukunft“ und dergleichen, und stattdessen auf dem banalen politökonomischen Zweck des gesamten Aufwands bestanden – genau deswegen, weil der nicht mehr aufgeht: Mit der Krise stellt sich heraus, dass es sich bei all den berechnend gepflegten Ausstattungsmerkmalen eines erfolgreichen Kapitalstandorts eben doch bloß um Wachstumsbedingungen handelt, um notwendige vielleicht sogar, aber keineswegs um hinreichende Wirkursachen für kapitalistisches Wachstum; um Aufwendungen also, die sich gar nicht automatisch amortisieren und nach den Regeln kapitalistischer Rechenkunst lohnen und die deswegen in den Verdacht der Überflüssigkeit, der „Fehlallokation von Ressourcen“, wenn nicht sogar der staatlichen Verschwendungssucht geraten. Wenn „Krise herrscht“, schwinden die Voraussetzungen, unter denen diese Ausgaben nützlich und langfristig lohnend erschienen und beschlossen wurden; was bleibt, sind offene Rechnungen für nutzlos gewordene Projekte und für die Ablösung „unbezahlbar“ gewordener Selbstverpflichtungen des Staates.
Gleiches gilt verschärft für die Budgets, mit denen die öffentlichen Hände wirklich nichts als Kunst, Kultur und sonstigen staatlichen Luxus finanzieren: Statt als Respektserweis der Macht vor dem Wahren, Guten und Schönen Anerkennung zu finden, müssen diese Aufwendungen sich als Hilfsmittel zur Attraktion von Kapital, als durchaus zählbar zu Buche schlagende nationale oder lokale Standortvorteile rechtfertigen – gerade dann, wenn es an anlagewilligem Kapital fehlt, dessen Agenten das attraktive Angebot einer lebenswerten Umwelt für ihr ödes Ausbeutungsgeschäft zu würdigen wüssten, und wenn daher von den hoheitlichen „Investitionen“ in „weiche Standortfaktoren“ nurmehr ererbte Unkosten übrig bleiben.
Dem Aufwand der Staatsmacht für die „harten“ Konkurrenzvorteile, die den Standort für Kapitalanleger unwiderstehlich machen und Wachstum mobilisieren sollen und in normalen Zeiten auch einiges in diesem Sinne leisten, geht es in Krisenzeiten aber auch nicht anders. Subventionen für die Ansiedlung oder den Weiterbetrieb von Firmen an nationalen Standorten oder für deren Expansion sind ein Gebot der wirtschaftlichen Vernunft, wenn die Konjunkturlage dafür spricht, dass ein dadurch vergrößertes und beschleunigtes Wachstum der öffentlichen Hand den getätigten Aufwand locker wieder einspielt; dieselben Finanzhilfen, in derselben guten Absicht vergeben, stellen sich in der Krise als öffentliche Fehlinvestitionen dar, als Dokumente staatlicher Unfähigkeit, „echtes“ Wachstum zu bewirken. Und so viel ist an diesem Vorwurf ja auch wahr: Wenn das Kapital überproduziert hat, sich deswegen nicht mehr ver- und folglich entwertet, dann ändern die schönsten staatlichen Wachstumsanreize daran nichts. Krise ist eben doch keine „Wachstumsschwäche“, der mit dem in normalen Zeiten so unwiderstehlichen Erfolgsrezept, mehr Geld, abzuhelfen wäre: Einem unproduktiven Überschuss von Kapital steht die Staatsmacht mit ihren Haushaltsmitteln – und das keineswegs bloß deswegen, weil die knapp werden – ohnmächtig gegenüber.
Die Zuständigen gestehen diese Ohnmacht im Übrigen auch ein, wenn sie ihre Experten darauf hin befragen, ihre Sachverständigenräte Gutachten darüber anfertigen lassen und gemeinsam mit Börsen-„Gurus“, Wirtschaftsjournalisten und der gesamten sachkundigen Öffentlichkeit herumspekulieren, ob es sich bei der schließlich offiziell eingeräumten „Rezession“ um eine „Wachstumsdelle“, ein w-förmiges „double-dip“ oder gar um eine „klassische“ Krise wie in den späten 20er Jahren des 20. Jahrhunderts handelt; ob man schon „auf der Talsohle angekommen“ ist oder noch mit weiteren „Abstürzen“ und „schwarzen“ Börsentagen rechnen muss; wann der „Konjunkturmotor“ wieder „anspringt“ usw. So gibt die wirkliche wie die ideelle Standortverwaltung zu Protokoll, dass das Kapital letztlich schon selber, nach seinen Kriterien, mit dem Akkumulieren wieder anfangen muss, damit die pflegerischen Maßnahmen der Regierung für „den Aufschwung“ verfangen können. Bis dahin, also ausgerechnet dann, wenn die Nation die ökonomischen Erfolge, die die politischen Machthaber sich und ihrem Volk von ihrer Politik versprechen, am nötigsten hätte, gehen alle Wachstums-Imperative, die die Staatsgewalt mit ihren Haushaltsmitteln praktisch in die Welt setzt, ins Leere.
Natürlich belassen die Inhaber der Regierungsmacht es nicht beim mehr oder weniger offenen Eingeständnis der Wirkungslosigkeit ihrer gewohnten Wachstumspolitik und beim Abwarten. Sie suchen Wege aus der Ohnmacht, unter der sie nicht bloß selber leiden, sondern ihr gesamtes Gemeinwesen leiden sehen. Und sie verfallen auf eine Krisenpolitik, die sich vom Normalprogramm demokratisch-marktwirtschaftlich-rechtsstaatlichen Regierens so grundsätzlich dann allerdings doch nicht unterscheidet. Mit der schaffen sie die Krise nicht aus der Welt: Sie exekutieren ihre Konsequenzen.
So unterwirft der Staat seinen Sozialhaushalt dem doppelten „Sparzwang“, dem er sich selber ausgesetzt findet: der Notwendigkeit, seiner Wirtschaft die Last der Lohnkosten zu erleichtern, derer die sich ohnehin schon mit Massenentlassungen und Lohnsenkungen entledigt, und zugleich die öffentlichen Kassen zu sanieren, die von den Lohnkosten zehren. Um durchgreifende „Innovationen“, die allesamt das uralte Rezept der stärkeren Inanspruchnahme der erwerbstätigen Massen sowie der härteren Drangsalierung und der finanziellen Schlechterstellung der bedürftigen Sozialfälle variieren, sind seine Sozialpolitiker auch nicht verlegen;[2] dazu, die zur Krise gehörende Verelendung der Lohnabhängigen politisch durchzuorganisieren, langt ihre Macht in Krisenzeiten allemal. Einen Königsweg aus der Krise haben sie damit freilich nicht gefunden – und behaupten das auch gar nicht: Den Geschädigten wird nicht mehr versprochen, als dass es ohne „harte Einschnitte“ ganz bestimmt nicht wieder besser wird mit dem allgemeinen Geldverdienen; und dem kapitalistischen Geschäftsleben wird mit der Absenkung seines menschlichen Kostenfaktors nicht weniger, aber auch nicht mehr als eine gute Bedingung für neues Wachstum geboten, mit dem das Kapital allerdings schon selber loslegen muss. So werden den niederen Abteilungen der Gesellschaft die Krisenfolgen machtvoll aufs Auge gedrückt – dies die soziale Seite staatlicher Krisenpolitik.
Eine tatkräftige Regierung drangsaliert in der Krise jedoch nicht nur ihre lohnabhängigen Massen. Auch bei ihren „Wirtschaftskapitänen“, die reihenweise zuvor blühende Firmen in den Sand setzen und dadurch sogar die materielle Basis der Staatsmacht selber beschädigen, schaut sie nach dem Rechten und lässt überprüfen, ob da immer alles mit rechten Dingen zugegangen ist – sie kennt eben die Neigung ihrer ökonomischen Elite zu Bilanzfälschung und betrügerischem Konkurs. Und weil zum kapitalistischen Erfolg allemal eine gewisse Grauzone von mehr oder weniger verbotenen Machenschaften gehört, lässt sich bei Misserfolg auch stets ein Vergehen aufdecken und ein guter Teil der Krise kriminalisieren. Wenn die Krise schlimm ausfällt, gehört es überdies zu ihrer politischen Bewältigung, der einschlägigen Strafverfolgung erweiterte Kompetenzen und schärfere Instrumente an die Hand zu geben, neue Vorschriften für die unternehmerische Buchführung und deren Offenlegung zu erlassen, neu entwickelte Techniken der privaten Bereicherung auf Kosten anderer – an die Lohnarbeit ist dabei nicht gedacht – neu zu verbieten, Börsen und Wirtschaftsprüfer einer genaueren Aufsicht zu unterwerfen usw. Das krisengeschüttelte Gemeinwesen wird so, per Schuldfrage samt machtvoller Beantwortung, wenigstens ideell für seine Verluste entschädigt; der ökonomische Sachverstand assistiert mit Theorien über eine ganz besonders unglückselige Kombination von Missmanagement, Rechtsverstößen, falscher Duldsamkeit der Behörden, eventuell sogar Korruption und anderen moralischen Faktoren, mit der die jeweils eingetretene Krise ganz speziell (weg) zu erklären wäre. Und auch wenn kein aufgeklärter Wirtschaftsbürger sich einbildet, das immer wiederkehrende „Phänomen“ einer Wirtschaftskrise ließe sich wirksam verbieten, so darf und soll man sich doch von der bewiesenen Tatkraft der Regierenden für die Zukunft, „beim nächsten Mal“, eine Minderung der anfallenden Einbußen versprechen. So sorgt die Staatsgewalt immerhin für eine in jeder Hinsicht, rechtsstaatlich wie demokratisch, geordnete Abwicklung des Krisengeschehens.
Ökonomische Mittel, um auf „die Lage“ einzuwirken, stehen ihr immerhin auch zu Gebote. Auf demselben Weg wie sonst auch, nämlich per Kreditvergabe der staatlichen Zentralbank an die Banken der Nation und Kreditaufnahme der öffentlichen Haushalte, kann der Staat zusätzliches, von niemandem zuvor verdientes Geld und Leihkapital in seine Geschäftswelt hineintun, um deren Aktivität in Sachen Geldvermehrung anzuregen. Und das tut er auch reichlich; allerdings aus dem schlechten Grund, weil ihm Steuereinnahmen fehlen, und mit dem kein bisschen besseren Ziel zu verhindern, dass im Zuge des allgemeinen Abrechnens allgemeine Zahlungsunfähigkeit um sich greift und mit der Geldzirkulation die nationale Geschäftstätigkeit überhaupt zusammenbricht. Als letztinstanzlicher Finanzier seines Finanzkapitals und seiner selbst steuert er so oder behebt sogar den einreißenden „Liquiditätsmangel“, hält kritisch gewordene Bankbilanzen über der Schwelle zum Offenbarungseid und wahrt so die Funktionstüchtigkeit des Kreditüberbaus, von dem im Kapitalismus die ganze Basis abhängt.
Produktiv ist das alles allerdings nicht; nicht einmal der guten Absicht nach dienen staatliche Geldschöpfung und Kreditvermehrung bei so negativer Verwendungsweise der bereitgestellten Zahlungsmittel einer Akkumulation, die dazu angetan wäre, daraus wirklichen, nämlich erfolgreich sich verwertenden Wert zu machen und dadurch die Kreditschöpfung zu rechtfertigen und die in Umlauf gebrachten Zahlungsmittel als Zuwachs an wirklichem Reichtum: als gutes Geld zu beglaubigen. Die „Liquidität“, die der Staat schafft, hält die Liquidierung illiquide gewordener kapitalistischer Unternehmungen und die Streichung wertlos gewordener Geldforderungen auf und allenfalls soweit in Grenzen, dass Kreditsystem und Geldwirtschaft weiter funktionieren; einen bereits produzierten und realisierten oder – wie Kreditgeld in besseren Zeiten – in Herstellung begriffenen kapitalistischen Reichtum repräsentiert sie nicht. Dem hoheitlich herausgegebenen Geld entsprechen Verluste; und weil es sich doch um gesetzlich gültiges Zahlungsmittel handelt, trägt dessen Vermehrung bloß dazu bei, dass die fiktiv vergrößerte Zahlungskraft der damit ausgestatteten Gesellschaft auf der einen, die wirkliche Reproduktion und Realisierung kapitalistischen Reichtums auf der andern Seite immer weiter auseinander klaffen. Das kann die Verlaufsform annehmen, dass die zuschüssigen „liquiden Mittel“ in der Geschäftswelt mit ihren Zahlungsnöten immer weiter gereicht werden und eine Zirkulation aufrechterhalten, mit der trotz steigender Warenpreise noch nicht einmal die einfache Reproduktion des gesellschaftlich vorhandenen Kapitals gelingt; ihre anschwellende Masse misst per Saldo schwindenden Reichtum, und der volkswirtschaftliche Sachverstand notiert eine unglückselige Kombination von „Rezession“ und Inflation. Der Gegensatz zwischen hoheitlicher Geldemission und wirklichem Kapitalumschlag kann sich auch in der Form abspielen, dass das vermehrte Staatsgeld die Sphäre der Bankbilanzen, denen es zu „schwarzen Zahlen“ verhilft, gar nicht verlässt, nicht zirkuliert, sondern gegen den Kreislauf von produktivem und Waren-Kapital festgehalten wird; die Entwertung des kapitalistisch angewandten gesellschaftlichen Reichtums stellt sich dann als Preisverfall der produzierten Waren dar, und die Kompetenzteams der Nationalökonomie diagnostizieren eine deflationäre „Abwärtsspirale“: ein fortschreitendes Einschrumpfen von Zahlungskraft und -willigkeit, an dem nach fachwissenschaftlichem Konsens der Verbraucher schuld ist, der in heimtückischer Spekulation auf immer noch weiter sinkende Preise der Geschäftswelt sein Geld vorenthält. Seine fällige Entwertung bleibt dem überproduzierten Kapital in der einen wie der anderen Form nicht erspart; doch die spielt sich unter finanzpolitischer Betreuung ab, als Werk einer staatlichen Krisenpolitik, die über Aufschub von Pleiten, Verteilung der Schäden, Konkurrenzerfolge und -niederlagen inmitten der Krise entscheidet und insgesamt für die Generalisierung, die nationale Verallgemeinerung des Durchstreichens von Reichtum sorgt. Mit dem Einsatz seiner Kredithoheit und seines wirtschaftspolitischen Instrumentariums in Krisenzeiten macht sich der Staat zum Manager auch noch des notwendigen Zusammenbruchs des Kapitalwachstums, das er betreut.
Staat und Krise II: Krisenkonkurrenz international – Abrechnung bis zur Enteignung und das politökonomische Kräfteverhältnis
Bei der krisenpolitischen Betreuung seines nationalen Kapitalismus hat der Staat es laufend mit den Konsequenzen zu tun, die die Krise im internationalen Geschäftsverkehr, also für die Konkurrenz der Nationen um den kapitalistischen Reichtum der Welt mit sich bringt. Der flächendeckende Fehlschlag von Geschäften, das große Abrechnen und das Einfordern von Zahlung: das bleibt ja nicht auf einzelne Standorte kapitalistischen Wachstums beschränkt, sondern pflanzt sich, einmal irgendwo begonnen, von einer Nation zur nächsten fort. Was an grenzüberschreitenden Geschäftsbeziehungen und Unternehmungen aufgebaut worden ist, ist wie alles andere von Abbruch bedroht oder betroffen; statt mit jeder bezahlten Rechnung neue zu eröffnen und Kapital für die weitere Teilhabe am Wachstum in anderen Ländern einzusetzen, wird abschließende Zahlung verlangt. Damit reißt zwischen den Nationen ein Abrechnungswesen ein, das sich reihum gegen alle Beteiligten wendet, weil es bei einem nach dem andern aufdeckt, dass und in welchem Umfang weltweit überakkumuliert, also überimportiert und überexportiert, an auswärtigen Standorten überinvestiert und ein Übermaß an Schulden bei auswärtigen Gläubigern angehäuft worden ist. Es schwinden die Erträge, die Gelegenheiten und die Mittel des Zugriffs auf auswärtige Reichtumsquellen; an ihre Stelle tritt der Zugriff der Geschäftswelt der einen Nation auf die Zahlungskraft der anderen Nationen, der die Zahlungsbilanz einer Nation nach der anderen in Schwierigkeiten bringt.
Die staatlichen Standort-Verwaltungen und Geldhüter finden sich dadurch herausgefordert, ihre Außenwirtschaftspolitik entsprechend umzustellen: vom Bemühen um die Maximierung des nationalen Nutzens aus den grenzüberschreitenden Manövern des weltweit akkumulierenden Kapitals auf den Kampf um die Minderung der nationalen Verluste an Kapital wie an internationaler Zahlungsfähigkeit, um Zugriff aufs Eigentum anderer Nationen und Schutz der eigenen vor Enteignung, um die Abwälzung der unvermeidlichen Krisenschäden auf die Partnerländer. Dafür verfügen sie über ein Repertoire an Handhaben und Maßnahmen teils mehr hoheitlich-gewaltsamer, teils mehr sachzwanghaft-ökonomischer Art, dessen Wirksamkeit in Krisenzeiten ganz von den Potenzen abhängt, zu denen ihre Nation es in den besseren Zeiten allgemeinen Wachstums und konkurrierender Bereicherung gebracht hat.
So werden die Staaten handelspolitisch aktiv. Sie fordern „Freihandel“ und nötigen das Ausland, dem die ehrenvolle Doppelrolle des billigen Lieferanten und zahlungskräftigen Kunden zugedacht ist, zur „Liberalisierung“ seines Außenhandelsregimes, um dessen Ressourcen wie vor allem dessen „Kaufkraft“ so einseitig wie möglich ihrer heimischen Wirtschaft nutzbar zu machen und für die Aneignung des dort in Form von Weltgeld greifbaren Reichtums durch heimische Kaufleute zu sorgen; gleichzeitig schirmen sie die eigenen nationalen Märkte „protektionistisch“ gegen auswärtige Konkurrenten ab, um die Zahlungskraft ihrer Gesellschaft möglichst exklusiv für den Kapitalkreislauf in ihren Gefilden zu reservieren. Das eine wie das andere betreiben sie auch in kapitalistisch normalen Zeiten; eine neue Handelspolitik brauchen sie insofern nicht zu erfinden. In der Krise entfällt aber auch für notorisch erfolgreiche Nationen die Sicherheit, mit Ex- wie Importen und durch Kapitalanlagen im wie aus dem Ausland vom Wirtschaftswachstum anderswo mit zu profitieren und in diesem Sinne offene Positionen in der Zahlungsbilanz für den weiteren Ausbau lohnender Geschäftsbeziehungen nutzen zu können. An die Stelle eines so umfassenden Zugriffs auf fremde Ressourcen tritt das umso dringlichere Bedürfnis, nationale Geldforderungen im grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr durchzusetzen, umgekehrt nationale Zahlungsnöte abzuwenden und mit dieser Zielsetzung in den Gang der kapitalistischen Konkurrenz über die Landesgrenzen hinweg korrigierend einzugreifen. Dabei ist von vornherein klar: Die Mittel für eine solche Politik stehen in umgekehrtem Verhältnis zu der zu bewältigenden Notlage. Die überlegene Erpressungsmacht, Ausschluss fremder Anbieter wie Öffnung fremder Märkte betreffend, liegt von Haus aus bei den Staaten, die über die in absoluten Zahlen größten Märkte, die Gesellschaft mit der größten internationalen Zahlungskraft und die potentesten kapitalistischen Firmen gebieten; umgekehrt umgekehrt. Zu handelsdiplomatischen Auseinandersetzungen der härteren Art, die von der Fachwelt dann schon mal als „Handelskriege“ eingestuft werden, kommt es in Krisenzeiten daher regelmäßig zwischen den paar halbwegs gleichrangigen Führungsmächten der Weltwirtschaft. Die haben sich dafür – wie für die friedlich-einvernehmliche Erpressung schwächerer Kunden – sogar schon besondere Regularien, Gremien und Schlichtungsinstanzen geschaffen und die schöne Gewohnheit entwickelt, sich wechselseitig ihre berechnende Kombination aus Protektionismus und Freihandels-Imperativen in Gestalt der freundlichen Aufforderung um die Ohren zu hauen, der jeweils andere möchte sich doch gefälligst als „Konjunkturlokomotive“ betätigen und für ein Wachstum sorgen, dessen Erträge sich dann in den eigenen nationalen Bilanzen wiederfinden…
Auf der nächsthöheren Ebene ihres kapitalistischen Betriebs konkurrieren die Staaten nach derselben Logik um eine für ihre Zahlungsbilanz vorteilhafte Kombination von Reglementierung und „Deregulierung“ beim ihre Grenzen überschreitenden Kapitalverkehr. Sie alle wollen verhindern, dass zur Entwertung von Kapital in ihrem Land der Abfluss von aktuell benötigten Zahlungsmitteln sowie von in Zukunft wieder Wachstum stiftendem Kapital und Kredit aus ihrer nationalen Wirtschaft hinzutritt; sie alle wollen umgekehrt nationale Schadensminderung durch Aneignung des Reichtums anderer Nationen erreichen. Sie bemühen sich daher, die „Weichen“ für die globalen „Ströme“ von Geld und Leihkapital, Investitionsmitteln und Finanztiteln so zu stellen, dass ein mehr als proportionaler Anteil davon auf ihr Land entfällt – ein Anliegen, das sie auch sonst konkurrierend gegeneinander verfolgen. In der Krise haben sie es aber mit Verlusten zu tun; und entsprechend erbittert kämpfen sie darum, mit ihrer Einflussnahme auf Zu- und Abfluss von Geld und Kredit den fälligen Geschäftsabbruch, die anstehenden Abrechnungen, die Kapitalentwertung und die Minderung des nationalen Reichtums durch das Wegzahlen von Weltgeld ans Ausland so zu lenken, dass der Schaden hauptsächlich anderswo anfällt. Sie dringen also auf Freizügigkeit des Kapitalverkehrs, soweit heimische Firmen sich durch Abrechnung mit auswärtigen Filialen oder Geschäftspartnern relativ schadlos zu halten versuchen. Im umgekehrten Fall bekämpfen sie die „Kapitalflucht“, so gut es geht, mit Verboten und „Verkehrskontrollen“ fürs Kapital; auch der konjunkturgemäß forcierte Kampf der Zöllner gegen „Geldwäsche“ und Steuerflucht tut da gewisse Dienste, wenn eine Regierung sich an einem direkten Verbot von Geldtransfers gehindert sieht; für die Rückgewinnung von Geld und Kapital fürs Heimatland locken manche krisengeschädigten Staatsgewalten wiederum mit großzügiger Legalisierung von „Schwarzgeld“ und „Fluchtkapital“. Insgesamt finden sich die wenigen Großmächte des Weltkapitalismus jedoch in der vergleichsweise komfortablen Lage, als Ursprungsländer der größten Kapital- und Kreditmassen auch die „natürlichen“ Refugien für das Eigentum krisengeschädigter Finanzkapitalisten zu sein; sie profitieren von der generellen Freizügigkeit auf dem globalen Weltfinanzmarkt, die sie den schwächeren Partnern aufgenötigt haben und auf der sie in Krisenzeiten mit der Macht des Gläubigers, die sie sich in den besseren Zeiten eines kreditfinanzierten weltweiten Wachstums erworben haben, erst recht bestehen. Die vielen anderen Länder, die dank der schönen Errungenschaft völliger Reisefreiheit für Geld und Kapital als Schuldnerstaaten „in die Weltwirtschaft integriert“ sind, finden sich auf Grund eben dieser Errungenschaft in Krisenzeiten einem Angriff auf ihre Finanzausstattung und ihre Zahlungsfähigkeit ausgesetzt, dem sie wenig entgegenzusetzen haben; ihr stärkstes „Argument“ ist noch der Schaden, den ihre Gläubiger davontragen, wenn sie zahlungsunfähig werden. Denen macht das auch enorm viel Eindruck: Die Verteilung der Verluste aus Engagements bei den ersten Krisenverlierern ist ein weiterer Gegenstand der Krisenkonkurrenz unter den Großen.
Den krisenbedingten Zahlungsnöten ihrer Geschäftswelt im Verkehr mit auswärtigen Partnern begegnen die Staaten schließlich mit der Mobilisierung der Zahlungskraft, die ihnen als den höchsten Gewalten und Herren über ein ganzes nationales Erwerbsleben zu Gebote steht: Sie bringen das ihrer politischen Verfügungsmacht unterstehende Geldvermögen ihrer Nation zum Einsatz. Dieses besteht schon längst nicht mehr bloß in dem Edelmetallschatz und den Devisenbeständen der staatlichen Zentralbank, sondern buchstäblich in dem, was das Geld der Nation international auszurichten vermag. In der Hinsicht bestehen zwischen den Ländern mittlerweile weit mehr als bloß quantitative Unterschiede: Vermögen und Unvermögen sind hier sehr eindeutig sehr einseitig verteilt; entsprechend unterschiedlich verläuft die Krise und fallen ihre Konsequenzen aus. Die Staaten, von denen bereits als vergleichsweise ohnmächtigen Schuldnern die Rede war, müssen feststellen, dass das Geld, das sie in eigener Regie als gesetzliches Zahlungsmittel ihrer Gesellschaft schaffen und sich daher allemal verschaffen können, auswärts und von kosmopolitischen Kapitalisten kaum bis überhaupt nicht als brauchbares Wertpapier für kritische Abrechnungen akzeptiert wird, also als Mittel zur Rettung der Nation vor internationaler „Illiquidität“ nichts taugt – nach den Maßstäben des Finanzkapitals ist es so gut wie kein Geld; und sie haben auch so gut wie kein Geld von der kapitalistisch gültigen und international gefragten Art – ihre Bestände an weltweit anerkannten Zahlungsmitteln, zusammengesetzt aus einem eventuellen positiven Saldo aus Exporterlösen und Importrechnungen, „Fluchtkapital“ und auswärtigen Investitionen, Forderungen ans Ausland und – vor allem und in zunehmendem Maß – Schulden bei auswärtigen Gläubigern, lösen sich in Nichts auf, sobald nicht mehr investiert und gestundet, sondern abgerechnet und Zahlung verlangt wird. Die Krise bringt in diesen Ländern daher nicht bloß die Zahlungsbilanz durcheinander; sie überführt sie der Zahlungsunfähigkeit und ihre höchsten Gewalten der finanziellen Ohnmacht; ganze Nationen erleben den Absturz vom „emerging market“, den auswärtige Kapitalisten sich als günstige Anlagesphäre ausgeguckt haben, zum nationalen Bankrotteur, dem sein Kredit und damit seine internationale Geschäftsfähigkeit – zeitweilig – entzogen werden. Für die Rettung ihrer internationalen Geschäftsfähigkeit sind diese Staaten – solange es ihnen vor allem andern eben darauf ankommt – alternativlos auf die Notwendigkeit zurückgeworfen, kreditiert zu werden und sich das dafür unerlässliche Minimum an Kreditwürdigkeit selbst erst ausleihen zu müssen. Dafür gibt es dank weitsichtiger Vorsorge von berufener Seite mit dem IWF und der Weltbank immerhin bereits internationale Agenturen.
Auf der anderen Seite ist aus der durch etliche Krisen hindurch unerbittlich fortgeführten Konkurrenz der Nationen um die Quellen kapitalistischen Reichtums und deren Erträge eine sehr überschaubare Anzahl von Staaten hervorgegangen, die über eine weltweit anerkannte und als Geschäftsmittel benutzte Währung verfügen, sich deswegen auch in Krisenzeiten zur Steuerung anfallender Zahlungsbedürfnisse so viel Weltgeld verschaffen können, wie sie Geld schaffen, und mit solchen Zetteln glatt auch noch als „Geldgeber“ und Garantiemächte der Kreditwürdigkeit ganzer fremder Nationen auftreten. Schranken bei der Wahrnehmung dieser Freiheit zur Weltgeld-Schöpfung setzt ihnen der Währungsvergleich durch kapitalistische Spekulanten, den sie in Gestalt eines freien „Geldmarkts“ untereinander eingerichtet haben. Da konkurrieren sie um das Maß an Anerkennung, das sie für ihre Geldware im Vergleich zu derjenigen der paar anderen Weltgeld-Emittenten erwirken können, also um den „Tauschwert“, den Wechselkurs ihrer Währung, sowie um das Maß an Geldschöpfung und staatlicher Verschuldung, um die Masse selbstgeschaffener fiktiver Zahlungsfähigkeit, die sie sich nach dem kritischen Urteil des internationalen Geldhandels leisten können. Dabei setzen sie – einerseits – auf die „Überzeugungskraft“ der Masse: auf die schiere Größe der kapitalistischen Ökonomie, über die sie gebieten; auf die Menge des Kredits, der dort generiert und weltweit benutzt wird; auf die hohen Anteile am Weltgeschäft, die in ihrer Währung abgewickelt werden; auf ihre daraus resultierende Macht, den Gang der Geschäfte auf dem Globus so zu lenken, dass sie mit ihrer Nationalökonomie und ihrem Geld vergleichsweise gut abschneiden. Mit der Gewalt dieser schönen ökonomischen „Sachzwänge“ konkurrieren sie in Krisenzeiten um das Maß ihrer Freiheit, die Welt auch dann mit ihren Schulden und den entsprechenden Geldzetteln zu überschwemmen, wenn mit denen international gar kein Wachstum finanziert, sondern bei eingetretenen und drohenden weiteren Verlusten Zahlungsfähigkeit hergestellt wird; eine international gültige Zahlungsfähigkeit, die insgesamt doch nichts anderes repräsentiert als den Ersatz von entwertetem Kapital und annulliertem Kredit, also aus nichts anderem besteht als einem Übermaß an kapitalistisch gar nicht bewährtem Kreditgeld, das über den einzigen Vorzug verfügt, aus der Werkstatt ihrer Notenbanken zu stammen – Alternativen haben sie ja erfolgreich weggeräumt.
Für diese Krisenkonkurrenz der gehobenen Art spielt – andererseits – ein entschieden weniger ökonomisches „Argument“ die in letzter Instanz entscheidende Rolle: In der Krise noch mehr als sonst machen die bedeutenden Weltwirtschaftsmächte den ansonsten „vaterlandslosen“ „Geldmärkten“ ebenso wie ihren Währungskonkurrenten den größten Eindruck mit ihrer Gewalt über die Geschäftsbedingungen des globalen Kapitalismus. Denn das versteht sich für sämtliche Agenten und Agenturen des friedlichen Welthandels sofort und von selber, auch wenn sie es von ihren Ideologen gerne dementieren lassen: Die Konditionen, zu denen die Nationen zur zivilen Konkurrenz um den Reichtum der Welt antreten, beruhen auf entschiedenen Gewaltverhältnissen; wirksam sind sie genau in dem Maße wie das Kontrollregime über die Staatsräson der übrigen souveränen Mächte, das die maßgeblichen Welthandelsnationen zu Stande bringen. Die verbinden denn auch den Dienst, den sie der Weltwirtschaft – und vor allem sich selber als deren ersten Nutznießern – mit ihrer Außenhandelspolitik, ihren Vertragswerken und ihrem weltweit benutzten Kreditgeld leisten, mit der Selbstverpflichtung, die Bereitschaft der Völker und Staaten zu sachgerechtem Mitmachen ausnahmslos und flächendeckend durchzusetzen und zu garantieren. Diese Pflicht lassen sie sich nicht nehmen, konkurrieren vielmehr ganz exklusiv mit Waffen und deren diplomatischer Verdolmetschung um ihren Stellenwert als maßgebliche Sachwalter der „Weltordnung“ und respektierte Oberaufseher der Staatenwelt. Was diese imperialistische Dienstleistung sie einerseits kostet, was ihnen andererseits an Erfolg beschieden ist im Kampf um globale Ordnungsgewalt, das beeinflusst schon in normalen kapitalistischen Wachstumszeiten und Friedensphasen das Maß an Anerkennung und die vergleichende Wertschätzung, die das auserlesenste ökonomische Produkt ihrer Macht, ihre Währung, auf den Weltfinanzmärkten findet. Und diese Kriterien werden – schon ohne die entsprechenden politischen Klarstellungen, die außerdem noch dazu kommen – entscheidend, wenn es in der Krise aufs Geld einmal nicht mehr „bloß“ als Vorschuss auf und für Wachstum ankommt, sondern als den zuverlässigen Inbegriff und die definitive Inkarnation kapitalistischen Reichtums: Dann tritt die Würdigung der politischen Durchsetzungsfähigkeit des Geldemittenten, seiner Macht, auch ökonomisch annähernd gleichrangige Konkurrenten auf Folgsamkeit gegenüber eigenen Vorgaben festzulegen, an die Stelle der durch die Krise blamierten Wachstumshoffnungen, die sich sonst mit dem Geld der konkurrierenden Wirtschaftsmächte verbinden.
Nach marktwirtschaftlich-imperialistischer Logik gilt derselbe Zusammenhang zwischen nationalem Geldvermögen und nationaler Gewalt nach außen im Übrigen auch andersherum: Wenn eine kapitalistische Großmacht sich am strategischen Kräfteverhältnis und der Hierarchie der konkurrierenden Weltordnungs-Subjekte vergreift, dann bestimmen ihre dabei errungenen Erfolge bzw. erlittenen Misserfolge den Währungsvergleich – sofern der überhaupt weiterhin seinen eigengesetzlichen Gang geht – allemal mehr als das Kalkül mit vergangenen und zukünftigen Wachstumsziffern; die werden ohnehin gründlich mit-korrigiert, wenn das Kontrollregime über den Gewalthaushalt der Staatenwelt neu festgestellt wird. Noch viel gründlicher als die Krise setzen also von der anderen Seite her ambitionierte imperialistische Aktivitäten bedeutender Nationen die ökonomischen Kriterien für die spekulative vergleichende Wertschätzung des Reichtums der großen Weltgeld-Schöpfer außer Kraft und Gesichtspunkte der strategischen Kompetenz an deren Stelle. Deswegen ist es der bürgerlichen Welt auch wieder völlig geläufig, dass die Krise des Kapitals bei den Staaten, die sich dafür gerüstet fühlen, das Bedürfnis nach gewaltsamer Korrektur – sei es im Sinne eines Umsturzes, sei es im Sinne einer entschiedenen Bekräftigung – der Gefolgschafts- und Unterwerfungsverhältnisse zwischen den Nationen weckt und deswegen leicht zu einer Krise der internationalen Beziehungen ausartet. Die Krise ist ein Testfall für den Respekt, den die imperialistischen Rivalen genießen; weltweit und vor allem bei einander. Und sie stehen auch nicht an, einander diesem Test zu unterziehen.
Exkurs zum Aufschwung der politischen Kultur in Zeiten des ökonomischen Abschwungs
In der Krise erleidet die bürgerliche Staatsmacht Einbußen an ihren zivilen Machtmitteln. Leider bedeutet das alles andere als eine Schwächung ihres gewaltmonopolistischen Regimes. Ihre ökonomische Ohnmacht macht im Gegenteil nur extra deutlich, wie vollständig sie ihr Gemeinwesen in allen seinen Abteilungen und Verhältnissen der Macht des Kapitals unterworfen hat. Nämlich eben so konsequent und so alternativlos, dass ihr selbst die Haushaltsmittel ausgehen und damit das Instrumentarium ihrer alltäglichen Herrschaftstätigkeit dahinschwindet, wenn in der Krise die Indienstnahme ihrer steuer- und abgabenpflichtigen Bürger für die Vermehrung kapitalistischen Eigentums zu wünschen übrig lässt. Sogar noch zu seinem eigenen Schaden respektiert der Staat die kapitalistische Zweckbestimmung und die daraus folgenden Verwendungsbedingungen des Geldes, für das er selber doch das Copyright besitzt. Er fügt sich den Sachzwängen des allgemeinen Gelderwerbs durch kapitalistische Geldvermehrung, die er selber seiner Gesellschaft aufoktroyiert. Seine Ohnmacht vor der Eigengesetzlichkeit kapitalistischen Wirtschaftens ist die Kehrseite dessen, dass er die Kommandogewalt des Geldes – i.e. derer, die genügend davon haben – über die gesellschaftliche Arbeit verabsolutiert.
Genau das lässt die bürgerliche Staatsmacht ihre Landesbewohner in der Krise auch spüren. Wo ihr die ökonomischen Mittel fehlen, da setzt sie ihre politische Kommandogewalt über ihre Bürger ein, um deren Lebensumstände immer noch perfekter an die Bedingungen anzupassen, die die Repräsentanten des kapitalistischen Eigentums einklagen. Sie blamiert ganz offen ihre Versprechungen aus besseren Tagen, ihre marktwirtschaftliche Politik brächte unweigerlich den Segen permanent wachsenden Wohlstands über die Masse der Erwerbsbevölkerung. Sie demonstriert praktisch und verkündet auch noch ohne Beschönigung, was unter ihrem Regime und in dem von ihr bevorzugten „marktwirtschaftlichen“ System nicht geht – nämlich auch bloß die Wahrung der bisherigen Lebensverhältnisse, wenn immer mehr Entlassene bezeugen, mit wie wenigen Kräften ein immer größerer sachlicher Reichtum her- und bereitgestellt werden kann; sie sagt an und setzt durch, was stattdessen sein muss und warum und wofür – mehr Armut nämlich und verschärfte Arbeitsbedingungen im Interesse der guten Laune des Kapitals, damit das eventuell wieder mehr investiert und neue Leute braucht und verbraucht. In der Krise gilt von Staats wegen, was in anderen Zusammenhängen als simplifizierende Systemkritik von links allgemeiner Verachtung verfällt: dass das soziale Gesamtkunstwerk aus Demokratie und Marktwirtschaft seine lohnabhängige Bevölkerung nur schlecht und recht und auch nur dann ernährt, wenn die Bedingungen für Lohn und Arbeit ganz im Sinne der Arbeitgeber gestaltet werden. In der Krise kommen alle Gründe zusammen, die gegen die kapitalistische Produktionsweise und ihren hoheitlichen Sachwalter sprechen; und der bekennt sich sogar dazu.
Dennoch ist gerade die Krise keine besonders gute Zeit für richtige Kritik; das beweist die Staatsmacht mit ihren offenherzigen Bekenntnissen zur Systemnotwendigkeit des von ihr organisierten Benutzungs- und Verelendungswesens leider auch. Sie verlässt sich darauf, dass Leute, die dieses System gewohnheitsmäßig als die ihnen zugemessenen und zukommenden Lebensumstände hinnehmen, sich auch dann nicht über dessen prinzipielle Ungemütlichkeit Rechenschaft ablegen, wenn das Kapital seine Verluste und der Staat seine Einbußen an ihnen auslässt und das auch noch für unumgänglich erklärt wird; dass sie dann vielmehr ganz im Gegenteil darauf setzen, dass Staat und Kapital für sie schon wieder etwas übrig haben werden, wenn es denen erst mal wieder besser geht, also die Geschäfte wieder laufen und die Staatseinnahmen wieder fließen. Demokratische Politiker gehen davon aus, dass, wenn sie in der Krise wie sonst auch die Forderungen „der Wirtschaft“ an ihren Bürgern vollstrecken und keine Alternative zulassen, die betroffenen Bürger sich einsichtig zeigen und akzeptieren, dass es wohl keine Alternative gibt. In diesem Sinne trauen sie ihren Landesbewohnern die „Schlussfolgerung“ zu, dass, wenn schon der Staat mit seinem unerschütterten Gewaltmonopol gegen die Krise und deren Konsequenzen nichts ausrichten kann, dann erst recht sie als wirklich ohnmächtig Betroffene keine andere Chance hätten, als sich zu fügen, zu arrangieren und auf bessere Zeiten zu hoffen. Dass der Staat mit seiner Gewalt über die Gesellschaft alle Alternativen zur politischen Ökonomie des Kapitals einschließlich seiner Krisen ausschließt, wird den Geschädigten dieser Ökonomie als absolut überzeugender und hinreichender guter Grund für die Geistes- und Willensleistung zugemutet, den eigenen Schaden als unumgänglich hinzunehmen und anzuerkennen. Und wenn sie schon mal dabei sind, sollen sie gleich auch noch ihren Schaden mit den Einbußen in eins setzen, die der Staat sich in seinem bedingungslosen Einsatz für seine politische Ökonomie einhandelt, die Sorgen ihrer Obrigkeit teilen und Solidarität üben. Unverfroren spekulieren die politischen Machthaber auf den Citoyen im Lohnarbeiter: den Parteigänger des Gemeinwohls, der einsieht, dass, wenn schon die höchsten Instanzen des Gemeinwesens sparen müssen – dass an ihm „gespart“ wird, darf da mal kurz vergessen werden –, dann auch alle anderen, darunter auch er selbst, um ein wenig Verzicht nicht herumkommen und Opfer zu bringen haben; weil es nicht anders geht, und außerdem, damit es irgendwann wieder aufwärts gehen kann mit „der Wirtschaft“. Denn von deren allgemeinwohldienlichen Erfolgen – und auch das ist keine kritische Klarstellung, sondern ein Verständnis und Einverständnis heischender sachdienlicher Hinweis! – hängt schließlich alles und jeder ab.
Natürlich bringt noch so viel Einsicht die Unzufriedenheit nicht zum Verschwinden, die sich in der Krise auch noch unter den treuesten Anhängern der Marktwirtschaft breit macht. Umso reichlicher wird diese Unzufriedenheit von der politischen Führung bedient: mit der Benennung von Schuldigen am ökonomischen „Desaster“ und Gesichtspunkten der Gerechtigkeit bei der Verortung der eigentlichen Schäden und bei der Verteilung der fälligen Opfer. Da langt schon eine kleine Verschiebung in der Wahrnehmung der Tatsache, dass in der Krise die Gesellschaft dem Gemeinwohl und dessen höchster Instanz die geschuldeten materiellen Dienste schuldig bleibt, um die Schuldfrage in jeder Richtung befriedigend zu beantworten: Geldgierige Manager und schmarotzende Schwarzarbeiter, gewerkschaftliche Besitzstandswahrer und superreiche Steuerflüchtlinge, Frührentner, die der jungen Generation auf der Tasche liegen, ebenso wie ältere Arbeitnehmer, die dem Nachwuchs keinen Einstieg ins Berufsleben gestatten, Lohnabhängige, die zu viel verdienen, und Konsumenten, die zu wenig kaufen, alle tragen das Ihre zur „schlechten Lage“ bei.[3] Für erfahrene Sozialpolitiker gehört nicht viel dazu, alle Ober- und Unterabteilungen ihrer Klassengesellschaft einschließlich der von ihnen definierten speziellen Interessengruppen nach Bedarf moralisch zu etikettieren, deren Angehörige gegeneinander aufzubringen und so dafür zu sorgen, dass ihnen aus ihrem zerstrittenen Volkshaufen ein einziger Ruf nach zielstrebiger gesetzlicher Gewaltanwendung gegen alle anderen, also gegen alle entgegentönt. Zu den unverwüstlichen Hauptschlagern dieser Agitation gehört, neben dem Parasitenverdacht gegen die arbeitslosen Hauptopfer der Krise, die Übersetzung des in Krisenzeiten ja tatsächlich alles andere als harmonischen Verhältnisses zwischen Kreditgewerbe und kreditbedürftiger Geschäftswelt in den sittlichen Konflikt zwischen habgierig „raffendem“ und redlich „schaffendem“ Kapital – wofür als Personae dramatis auch gefallene Helden des jeweils letzten Spekulations-Booms auf der einen, von ihren Hausbanken hängen gelassene „Mittelständler“ auf der anderen Seite eintreten können –: Konstruktiver lässt sich die Unzufriedenheit im Fußvolk wirklich nicht bedienen als mit einer Hetze im Namen der direkten, „Arbeitsplätze schaffenden“ Ausbeutung von Lohnarbeitern gegen die angeblich Schuldigen an ihrem Misslingen. Zumal sich daran ganz zwanglos ein zweites ganz wichtiges Kriterium zur Ermittlung der wahren Krisenursachen und für eine angemessene staatliche Reaktion anschließen lässt: Nicht bloß fragwürdige Elemente aus der Mitte des nationalen Gemeinwesens, auch und vor allem Kräfte und Personen von außerhalb sind da geschäfts- und gemeinwohlschädigend unterwegs; im Bedarfsfall langt der Kosmopolitismus des Finanzkapitals[4] als Beweis. Am anderen Ende der gesellschaftlichen Hierarchie, in der Unterwelt des ökonomischen Kosmos, werden die Stichwortgeber für eine politisch korrekte und sittlich hochstehende Verarbeitung der materiellen Unzufriedenheit im krisengeschädigten Volk natürlich genauso leicht in demselben Sinne fündig. Die Entdeckung armselig gestellter Ausländer in den Container-Baracken sei es eines Asylbewerberlagers, sei es einer Großbaustelle reicht schon für den unwiderleglichen Verdacht, dass die uns
, der Gemeinschaft eingeborener Citoyens, Geld und vor allem „Arbeitsplätze wegnehmen“, was in Zeiten massenhafter Arbeitslosigkeit zu den größten Verbrechen gegen das nationale Gemeinwohl gehört – dies die andere beliebte Variante, materielle Unzufriedenheit mit der Vorstellung zu bedienen, der Status der ausgebeuteten Arbeitskraft wäre ein ganz exklusives Privileg. Eine sehr gemäßigte Variante übrigens, verglichen mit der Figur des „jüdisch-bolschewistischen“ Klassenkampf-Agitators, gegen die früher einmal der gerechte Volkszorn aufgeregt und die anschließend erfolgreich eliminiert worden ist. Mittlerweile hat die von keinerlei Klassenkampf und keiner „kommunistischen Bedrohung“ gestörte universelle Herrschaft des kapitalistischen Systems sowie die nicht ganz so ungehinderte Mobilität des „Faktors Arbeit“ für jene multikulturelle Toleranz gesorgt, auf die die moderne Zivilgesellschaft stolz sein darf, ohne dass sie ihren Mitgliedern die Grundversorgung mit einem ganz persönlichen Recht auf Nationalismus versagen würde; wieviel Ausländerhass und Ausgrenzungswahn daraus folgen soll, darf im freiheitlichen Gemeinwesen jeder mündige Bürger dann ganz für sich selbst entscheiden. Derselbe ideelle Lohn, die Versorgung der unzufriedenen Opfer der Krise und der staatlichen Krisenpolitik mit Gesichtspunkten für eine umso härtere bedingungslose Parteilichkeit für die Urheber ihres Schadens, ist schließlich auch mit dem durch die Krise geschärften Blick aufs Ausland verbunden. Da hat bei den Regierenden wie bei den Regierten Anti-Imperialismus Konjunktur: der von der bürgerlichen Art, auf den sich die Chefs und die Anhänger noch der größten und gewalttätigsten „Imperien“ verstehen, weil er in der entschlossenen Absage an den – wirklichen oder auch nur unterstellten – Imperialismus der anderen besteht. Je nach Stand der internationalen Abrechnung und der Betroffenheit der jeweils eigenen Nation werden die Bewohner der kapitalistisch zivilisierten Welt darüber in Kenntnis gesetzt, wer unter den auswärtigen Freunden und Partnern derzeit die globale Interessenharmonie stört, die sich ansonsten zweifellos segensreich für die eigene nationale Sache auswirken würde, und wo jenseits aller auf besseres Einvernehmen zielenden Streitigkeiten Feindschaft am Platz ist.
So wird das Volk von seiner Führung höflich eingeladen und von einer freien Öffentlichkeit dringlich dazu angehalten, die private materielle Unzufriedenheit, die bei aller Einsicht ins Unabänderliche doch da ist, fruchtbar zu machen, nämlich mit dem Leiden „der Wirtschaft“ an ihren fehlenden Erfolgsbedingungen und der Staatsmacht an ihrer Ohnmacht zu identifizieren und nach hartem Durchgreifen gegen Hindernisse und Gegner des nationalen Aufschwungs zu verlangen – umso härter, je mehr die unzufriedene Privatperson selber von solchem Durchgreifen betroffen ist. „Oben“ und „unten“ sollen sich in dem Bedürfnis nach kapitalistisch zweckmäßig und wirkungsvoll ausgeübter öffentlicher Gewalt zusammenschließen. Die geforderte Koinzidenz ist noch nicht einmal spiegelverkehrt: Für genau das, was sie tun und lassen, berufen sich die „Oberen“ auf den Wunsch ihres Volkes nach gerechter Schuldzumessung und Schadensverteilung, und die „Unteren“ kommen sich wie die Auftraggeber genau dessen vor, was mit ihnen angestellt wird.
Dafür macht die Demokratie den Regierten ein unschlagbares Angebot. Sie gestattet es den Leuten, und eine institutionalisierte Opposition fordert sogar mit Nachdruck dazu auf, im Namen aller eingesehenen Notwendigkeiten effektvollen Regierens und im Interesse einer tatkräftig durchgesetzten Gerechtigkeit nicht bloß gegen fremde Nationen, die bloß Probleme machen, Ausländer, die gar nicht hergehören, und einheimische Interessengruppen, die in ihrem Dienst oder sogar ihren Dienst am Gemeinwohl versagen, sondern außerdem und überhaupt gegen die eigene Regierung ärgerlich zu werden, die augenscheinlich an allen diesen Fronten Erfolge schuldig bleibt. Unzufriedenheit wird geradezu angestachelt, um sie in die Bahnen einer aggressiv affirmativen und militant konformistischen Kritik an einer unzureichenden, nämlich hinter ihren eigenen Erfolgskriterien zurück bleibenden Ausübung der politischen Macht zu lenken. Die demokratische Wahl bietet dann die Chance, mit den vorgestellten Gründen der allgemeinen wie der höchstpersönlichen Finanzkrise abzurechnen, indem man mithilft, andere Politiker oder auch dieselben wieder zu souveränen Sachwaltern der wirklichen Krisenursache, nämlich des kapitalistischen Wachstums im Lande zu bestellen. Wem der kurze Wahlakt nicht reicht, um seinen Verdruss auszuleben, der kann sich überdies am Wahlkampf beteiligen und für die eine Partei, die den einzig richtigen Machtgebrauch verspricht, gegen die Anhänger einer anderen, die genau dasselbe verspricht, bis zur Handgreiflichkeit aktiv werden. Die Krise ist insofern eine gute Zeit zum Wählen: Sie politisiert Leute, die ihre eigenen Lebensumstände sowieso nach den Kriterien der Instanzen beurteilen, die darüber bestimmen. Eine gute Gelegenheit ist sie genau deswegen aber auch für diejenigen, die das demokratisch angestachelte und ausgenutzte Volksbedürfnis nach „überzeugender“ Führung und gerecht gehandhabter Gewalt zu einer Absage nicht bloß an die gerade amtierende Regierung, sondern an das System demokratischer Ermächtigung und Machtausübung überhaupt hochsteigern wollen. Faschisten halten die Ohnmacht nicht aus, die aus der strikten Festlegung der Staatsmacht auf das alleinige Regime des Kapitals über die nationale Ökonomie folgt, und möchten einen Kapitalismus, in dem sogar das Geld dem Führer gehorcht – was sich bis zu einem gewissen Grad sogar völlig systemkonform bewerkstelligen lässt; sie geben sich nicht mit der funktionellen Unterordnung aller gesellschaftlichen Konflikte unter das Gemeinwohl und aller widerstreitenden Interessen unter die Krisentugenden des einsichtigen Citoyen zufrieden, sondern betreiben die Eliminierung ausgemachter Störenfriede; für eine Korrektur nationaler Niederlagen in der Konkurrenz der imperialistischen Mächte kämpfen sie auch dann mit militärischer Gewalt, wenn das herrschende Kräfteverhältnis ihnen – noch – kein Auftreten als überlegener Schiedsrichter und weltpolizeilicher Ordnungsstifter gestattet; und im Hinblick auf alle diese großartigen Vorhaben halten sie es für völlig unter der Würde einer anständigen nationalen Vereinsleitung, sich einem fixen rechtsstaatlichen Reglement und sogar noch periodisch dem Geschmacksurteil der Regierten zu unterwerfen – was sie im Übrigen, auch das nur konsequent, überhaupt nicht daran hindert, nach bewältigter Krise bzw. erlittener Niederlage und nach dem Dahinscheiden des von der Vorsehung entsandten Häuptlings vom Ausnahmezustand wieder zur Normalform bürgerlicher Herrschaft zurückzukehren. Umgekehrt halten Demokraten sich viel darauf zugute, dass sie alles das, was Faschisten treiben, nur im Ausnahmefall praktizieren und ansonsten bloß propagieren, um sich auf Zeit ermächtigen zu lassen – ohne die Ambition, die nationalen und internationalen Kräfteverhältnisse ein für alle Mal
zu klären. Und angesichts dessen, wozu frei gewählte Machthaber auch so fähig sind und was sie ganz rechtsstaatlich in Krisenzeiten tun, kann man ihnen tatsächlich nur für alles dankbar sein, was sie mit Rücksicht auf ihr antifaschistisches Ethos lassen.
Staat und Krise heute:Fortschritte in der Frage des Staatsbankrotts
Krisen sind für die Wirtschaftspolitiker der kapitalistischen Welt nichts Ungewohntes. Neu sind allerdings die Sorgen, von denen sie in der Krise heimgesucht werden, mit der das neue kapitalistische Jahrhundert so verheißungsvoll losgeht. Die Chefs der führenden Weltwirtschaftsmächte und ihre fachkundigen Berater zweifeln an der Wirksamkeit und Zweckmäßigkeit der Methode, nach der sie mittlerweile schon etliche Male internationale Zahlungskrisen, nämlich die Zahlungsunfähigkeit verschuldeter „Entwicklungs-“ und „Schwellenländer“ abgewickelt haben: per Wiederherstellung der Kreditwürdigkeit dieser Nationen durch Darlehen des IWF und der Weltbank sowie durch zusätzliche zwischenstaatliche Beistandskredite, verbunden mit wirtschaftspolitischen Auflagen zur „Restrukturierung“ der jeweils betroffenen Nationalökonomie. Aus ihren bisherigen Erfahrungen leiten die Meister des globalen Kapitalismus die Befürchtung ab, dass sie auf die Art nurmehr auf eigene Kosten ein unabsehbar fortdauerndes Verlustgeschäft finanzieren. Was die mittlerweile offiziell eingestandene „Rezession“ in ihren eigenen Ländern angeht, so ist der anfänglich gepflegte Optimismus, der Geschäftseinbruch wäre in Amerika und Europa, kaum amtlich festgestellt, auch schon so gut wie vorbei und auch in Japan endlich demnächst überwunden, gründlich verflogen. Für Japan konstatieren wirklich Verantwortliche wie ideelle Verantwortungsträger endgültig eine „Deflation“; für den Dollar- und den Euro-Raum wird die Gefahr einer solchen „Abwärts-Spirale“ teils noch dementiert, teils bereits eingeräumt.
Beides ist gut gemeint; die besorgten Diagnosen sind Ausdruck des dringlichen Wunsches nach besserem Gelingen. Sie geben aber auch Aufschluss über den Grund der wohlmeinenden Sorgen: die aktuelle Krisenlage.
a) Schuldenkrise bis zum nationalen Konkurs. Der Fall Argentinien
Zwischen den Ursprungsländern des weltweit verwendeten Kredits und des dazu gehörigen Weltgeldes auf der einen, etlichen notorischen Schuldnerstaaten auf der anderen Seite sind Abrechnungen in Gang; und die meinen die großen Gläubiger auf Dauer nur noch mit Hilfe eines regelrechten Konkursrechts für insolvente Nationen sachgerecht bewältigen zu können. Argentinien mit seiner am Ende rasant verschlechterten Zahlungsbilanz und seiner Unfähigkeit zu weiterer Schuldenbedienung muss als praktischer Beispielsfall für die Erkenntnis herhalten, dass es doch gar keinen Zweck hat, „überschuldete“ und effektiv zahlungsunfähig gewordene Staaten mit IWF- und anderen politischen Krediten wieder „liquide“ zu machen und aus ihrer „Schuldenfalle“ herauszukaufen; denn damit sei nur der nächste Zusammenbruch programmiert. Um eine definitive Bankrotterklärung komme man am Ende doch nicht herum. Nötig sei deshalb ein vorab feststehendes Konkurs-Verfahren, mit dem alle Beteiligten, private Gläubiger ebenso wie öffentliche Schuldner, rechnen müssen, auf das sie sich aber auch verlassen können.
Natürlich denkt keiner der Initiatoren dieser zweifellos innovativen Idee im Ernst daran, ganze Staaten wie ein Pleite-Unternehmen zu schließen, aus dem internationalen Handelsregister zu streichen, Land und Leute zu vergessen und dafür im Gegenzug alle offenen Forderungen in den Wind zu schreiben. Diskutiert wird unter dem Gesichtspunkt der Neueröffnung des Geschäfts mit und in einem Bankrott gegangenen Land; Mittel dafür wäre eine offizielle Umschuldung, die auch die privaten Gläubiger in Haftung nimmt. Eine Art Schlussabrechnung mit der fraglichen Nation soll aber schon erst einmal sein. Und in der Forderung stecken, stillschweigend unterstellt, ein paar bemerkenswerte Befunde nicht bloß über die aktuelle Wirtschaftslage, sondern über den politökonomischen Status von modernen Pleite-Staaten überhaupt.
Denn immerhin geht die Idee eines Konkursrechts für Staaten, was die rechtliche Seite betrifft, von der Vorstellung aus, dass es sich bei denen um Wirtschaftssubjekte handelt, die gar nicht ihr eigener Herr sind, sondern unter die Jurisdiktion übergeordneter Instanzen gehören. Materiell liegt dieser wenig respektvollen Einschätzung ein noch viel respektloseres Urteil über das komplette Geldvermögen dieser Nationen und über ihre Leistungsfähigkeit als Produktions- und Reproduktionsstätte dieses Vermögens, als kapitalistische Geldvermehrungs-Maschinerie, zu Grunde: Was sie an Geld besitzen, das hat seine maßgebliche ökonomische Zweckbestimmung darin und geht darin auf, die Forderungen auswärtiger Gläubiger zu bedienen, gehört im Prinzip insgesamt zu deren Besitzstand, ist an sie schon von seiner Entstehung weg verpfändet – und genau dafür reicht es nicht. Die „Nationalökonomie“ dieser Länder produziert Reichtum eigentlich nur zu dem einen Zweck, Kredite zu bedienen, die von außen in sie hineingesteckt worden sind; und sie produziert dafür nicht genug, akkumuliert insofern, vom maßgeblichen übergeordneten Gläubiger-Interesse her betrachtet, nichts als Verluste – eben so, wie ein kapitalistischer Pleite-Betrieb mit all seiner Geschäftstätigkeit am Ende mehr Geld verbraucht als er produziert und realisiert und deswegen irgendwann seinen Gläubigern zur Ausschlachtung überantwortet wird. In Analogie dazu zählen die Kandidaten für ein internationales Insolvenzverfahren schon gar nicht mehr als souveräne Staaten, die mit einem eigenen hoheitlich garantierten Geld einen einheimischen Kapitalkreislauf kreditieren, der umgekehrt dieses Geld als anständiges kapitalistisches Geschäftsmittel beglaubigt; die mit dieser Ausstattung am Weltmarkt, also am grenzüberschreitenden kapitalistischen Konkurrenzgeschehen teilhaben; die da schon mal in Zahlungsschwierigkeiten geraten können und um Stundung nachsuchen müssen, im Prinzip aber das Zeug dazu haben, sich aus solchen Nöten wieder herauszuwirtschaften… Damit ist es vorbei. Lange genug hat man sie so behandelt; jetzt ergeht mit der programmatischen Idee eines Länder-Konkurses das Verdikt, dass von Zahlungsunfähigkeit bedrohte Staaten schon längst gar nicht mehr mit eigenem Geld und Kredit und auf eigene Rechnung kapitalistisch wirtschaften, sondern überhaupt nur mit geliehenen Finanzmitteln, also auf Rechnung und Risiko auswärtiger „Geldgeber“, denen daher auch gerechterweise die Entscheidungshoheit darüber zusteht, wann eine von ihnen finanzierte und sowieso nur zu Renditezwecken unterhaltene fremde „Nationalökonomie“ sich nicht mehr lohnt und folglich abgebrochen werden muss – um auf niedrigerem Level und zu verbesserten Konditionen eventuell neu gestartet zu werden. Die Staatsgewalt, die über einen solchen Laden herrscht und sich dabei womöglich noch wie der souveräne Herr über Geld und Geldvermehrung im eigenen Zuständigkeitsbereich vorkommt und aufführt, bekommt damit ihren Stellenwert zugewiesen: rechtlich den höchst minderwertigen einer Körperschaft, die sich wie eine Pleitefirma vor ihrem Konkursrichter rechtfertigen muss; und wie der Vorstand einer solchen Firma wird sie mit ihren eigenen Unterhaltskosten, Aufwand für ökonomische Aktivitäten und eventuelle Aufwendungen fürs eigene Volk oder Teile davon inklusive, als Unkostenfaktor verrechnet, der schon vor der Insolvenz im Grunde bloß die den Gläubigern zustehenden Erträge ungebührlich schmälert und im Konkursfall eigentlich gar kein Recht auf gar nichts mehr hat. Die Stichworte dafür lauten „Korruption“ und „Misswirtschaft“; sie benennen nicht das Ergebnis einer kriminalistischen Untersuchung, sondern formulieren das mit dem Schuldenstand des Landes feststehende Urteil, dass es sich eine politische Herrschaft mit bürokratischem Apparat und uniformierter Gewalt im Grunde gar nicht leisten kann und jeder dafür aufgewandte Dollar oder Euro sowieso verschwendet ist. Der Anspruch auf durchgreifende Ordnungsdienste der kritisierten Staatsgewalt ist damit selbstverständlich nicht gestrichen. Die sollen bloß nichts kosten; der verantwortlichen Regierung wird die Erpressung aufgemacht, die nötige Gewalt zum Nulltarif zu liefern. Dass ihre Herrschaft dadurch vollends untergraben wird, wird wiederum der Regierung als ihr Versagen zur Last gelegt.
Diese neue Art, mit zahlungsunfähigen Staaten umzuspringen, wird am Fall Argentinien wie zur Probe ausdrücklich durchexerziert. Das Land hat sich dafür ganz besonders qualifiziert: Schon vor Jahrzehnten hat es sich genötigt gesehen, für seine ehrgeizige Wachstumspolitik im Ausland Kredit in fremder Weltwährung aufzunehmen. In der Folge hat es in der internationalen Konkurrenz mehr kapitalistischen Ertrag an auswärtige Geschäftspartner verloren als fürs eigene Wachstum erwirtschaftet. Das nationale Kreditgeld, in immer geringerer Proportion durch kapitalistisch erfolgreiche Verwendung gerechtfertigt, hat dadurch erst recht jeden Wert für die grenzüberschreitenden Geschäfte der Nation eingebüßt; die war für ihre internationale Geschäftsfähigkeit in zunehmendem Maß auf geliehene Devisen angewiesen. Daraus hat die Regierung schließlich, durch Experten des freien Marktes bestens beraten, die radikale Konsequenz gezogen, ihr nationales Geld überhaupt nur noch als Statthalter einer gleich großen Summe verdienter oder geliehener US-Dollars fungieren zu lassen, um ausgerechnet dadurch die absolute Stichhaltigkeit des Peso als solides Geschäftsmittel zu beweisen. In Wahrheit hat sie damit genau das Gegenteil eingestanden: die definitive Untauglichkeit der Währung und die Unfähigkeit der nationalen Ökonomie, mit ihrem internen Wachstum für die Gültigkeit eines eigenen Kreditgelds einzustehen. In aller Form hat der argentinische Staat die tatsächlich längst eingetretene Degradierung seines nationalen Geldvermehrungswesens zur Hilfsmaschinerie fürs Kreditgeschäft seiner Dollar-Gläubiger anerkannt und zur Grundlage seiner nationalen Geldwirtschaft gemacht. Die versagt in dieser Funktion, Jahr um Jahr mehr, vor ihren wachsenden Verbindlichkeiten und bekommt schließlich die fällige Abrechnung präsentiert: Die Gläubiger schießen keine neuen Dollars nach, sondern bestehen auf Zahlung der offenen Rechnungen. Damit zwingen sie den Staat zu dem Offenbarungseid, dass er nicht bloß zu wenig Devisen eingesammelt hat, um die fälligen Forderungen zu bedienen und eine Abrechnung abzuwehren, sondern dass er buchstäblich überhaupt kein Geld besitzt. Die strikte Umtauschgarantie für den Peso war eben schon ein Nicht-Anerkennungs-Beschluss gegen das eigene Geld und gleichbedeutend mit der Entscheidung, das Land in toto auf Rechnung und zum Nutzen auswärtiger Dollar-Investoren arbeiten zu lassen. Mit deren Entscheid gegen weitere Finanzierungsmanöver wird Argentinien folgerichtig zum Musterfall eines Landes, das mit allen seinen ökonomischen Bemühungen letztlich nichts als Schulden akkumuliert und sich für seine Gläubiger also überhaupt nicht mehr lohnt – ein Fall von Staatsbankrott in genau dem Sinn, wie die Forderung nach einem Insolvenzverfahren gegen illiquide Schuldnerländer es unterstellt. An Argentinien wird gewissermaßen ausprobiert, wie das geht und wohin das führt, wenn ein Schuldnerstaat konsequent, bis zur vollständigen Annullierung seines Geldvermögens, einer Endabrechnung über seine Schulden unterworfen wird. Umgekehrt wird mit der Idee eines Konkursrechts für Staaten der Umgang mit Argentinien erklärtermaßen zum Modellfall für eine unabsehbare Zahl analoger Fälle.
Mit diesem Vorratsbeschluss zur Abwicklung von Staatsbankrotten liefern die Chefanwälte des Weltkapitalismus ein bemerkenswertes Eingeständnis ab. Einer unbestimmten Zahl von Ländern machen sie quasi auf Vorrat die Rechnung auf, dass sie tatsächlich nichts anderes als zur Kreditbedienung verpflichtete Geldanlagesphären sind und als solche dauernd auf der Kippe stehen oder schon laufend dabei sind, als Schuldner zu versagen und mehr Kredit zu verbrauchen und in den Sand zu setzen als zu verzinsen und dadurch zu rechtfertigen. Damit fällen sie ein bemerkenswert kritisches krisenpolitisches Urteil über ganze Weltgegenden: So wie sich innerhalb einer kapitalistischen Nation in der Krise ganze Abteilungen des kapitalistischen Wirtschaftslebens als überflüssig erweisen, so stellt sich nun gleich eine ganze Kategorie von Staaten als kapitalistisch nutzlos, als ein Haufen von „Verlustbringern“ heraus. Weniger parteilich betrachtet, geben die vorausschauenden globalen Konkursrichter damit zu, dass sich für einen Großteil der Staatenwelt, und zwar gerade infolge der unermüdlichen Bemühungen um marktwirtschaftliche Erfolge, die diese Länder anstellen, der Kapitalismus einfach nicht lohnt: Mit all ihren Anstrengungen, sich auftragsgemäß „in die Weltwirtschaft zu integrieren“ und zu Anlagesphären für kapitalstarke Investoren herzurichten, und mit all dem Kredit, der ihnen dafür gewährt worden ist, bringen sie es als Nationen doch zu nichts weiter als zum Bankrotteur; es stimmt eben doch nicht, dass Marktwirtschaft und freies Unternehmertum den Staaten – wenn schon nicht den Leuten, dann umso mehr der über sie ausgeübten politischen Herrschaft – all- und wechselseitig Nutzen brächten. Das maßgebliche Verdikt lautet allerdings genau umgekehrt: Diese Länder lohnen sich für den internationalen Kapitalismus nicht; sie rechtfertigen die Geschäfte nicht, die die kapitalkräftige „1. Welt“ mit ihnen angezettelt und durch etliche Krisen hindurch unermüdlich aufrechterhalten hat und noch unterhält – auf eigene Kosten, wie sich jetzt endgültig herausstellt.
Denn das ist das andere Eingeständnis, das in dem konkursrichterlichen Blick auf die Masse der Schuldnerstaaten enthalten ist: Die Insolvenz, die denen zur Last gelegt und als ihre prinzipielle kapitalistische Unzurechnungsfähigkeit angekreidet wird, geht geschäftlich zu Lasten derer, die den Konkurs veranstalten. Es ist das Geld aus den Zentren der Weltwirtschaft, aus den USA, Europa und Japan, das in seinen überschuldeten auswärtigen Anlagesphären abgeschrieben werden muss; das Anlagegeschäft der Gläubiger durchlebt seine Krise.[5] Der Offenbarungseid, der den Schuldnern aufgenötigt wird, ist tatsächlich ein Offenbarungseid über die kapitalistische Untauglichkeit des Kredits, den die großen Kreditschöpfer und Investoren in die Welt gesetzt und mit dem sie noch die letzten Erdenwinkel überschwemmt haben – davon ist zu viel unterwegs; Forderungen sind im Übermaß akkumuliert worden und müssen gestrichen werden. Natürlich geben die Herren des internationalen Finanzgeschäfts ihren Schuldnern die Schuld; und das tun sie gleich so einseitig und so gründlich, dass sie eben von der früheren Gepflogenheit, mit neuen international verbürgten Krediten die Geschäftsfähigkeit überschuldeter Partner immer wieder herzustellen, abrücken, auf einer Abrechnung bestehen, die zwar erklärtermaßen auf Neubeginn, tatsächlich aber erst einmal auf Abbruch der überkommenen Geschäftsbeziehungen zielt, also mit der Streichung ganzer Geschäftssphären kalkulieren. Das bedeutet umgekehrt aber ein drittes Eingeständnis: Mit ihren harten Anklagen und ihrem rigiden Vorgehen gegen bankrotte Hinterhöfe ihrer Weltwirtschaft geben sie ihre eigene Ohnmacht zu. Ihnen geht das Geld zwar nicht aus; den Pleite-Kandidaten die benötigte „Liquidität“ vorzustrecken, wäre ihnen ein Leichtes – zumal die ausgeliehenen Beträge gleich gegen offene Forderungen aufgerechnet würden, die Bücher des IWF und anderer Gläubiger also gar nicht zu verlassen bräuchten –; wenn sie es aus übergeordneten Gründen, etwa wegen der enormen kommerziellen Bedeutung des gefährdeten Geschäftspartners wie im Fall Brasilien oder im Hinblick auf die Waffenbrüderschaft in einem bevorstehenden Krieg wie bei der Türkei, für nötig erachten, sind die größten Milliardenbeträge sofort verfügbar. Das alles hilft aber nichts gegen die generelle Einschätzung, dass ihre geballte Kreditmacht gegen das eigentliche Übel nichts nützt: Der Erfolg, der eine erneute Kreditschöpfung rechtfertigen würde, ein Wachstum, mit dem die auf eine neue Finanzausstattung angewiesenen Partnerländer den entsprechenden Verbindlichkeiten gewachsen wären, ist nach Ansicht der höchsten Instanzen des Weltkredits selbst damit nicht hinzukriegen. Nicht bloß die früheren Kredite erweisen sich als Verlustgeschäft; auch eine neuerliche Kreditvermehrung wäre nichts als Geldvernichtung. Lohnende neue Geschäftsfelder sind kaum, lohnende Erträge aus den alten Anlagesphären gar nicht abzusehen;[6] stattdessen steht die Streichung von Geschäftsgelegenheiten in der Größenordnung von ganzen Nationen an, eine Dezimierung des Weltgeschäfts auf absehbare Frist. Das ist kein schöner Befund in Weltwirtschaftszeiten, in denen das Kapital – dasselbe andersherum betrachtet – ganz viele und große neue Geschäftswelten für lohnende Anlage so nötig braucht und so dringlich sucht wie noch nie. Doch so sehen die obersten Weltgeldhüter die Krisenlage auf ihrem kapitalistischen Globus. Und damit leisten sie einen Offenbarungseid über die – einstweilige – kapitalistische Untauglichkeit ihrer eigenen reichlich verfügbaren Finanzmittel.
b) Macht und Ohnmacht des Weltkreditgelds und seiner Schöpfer. Haushaltspolitik als Bilanzfälschung
Immerhin, das Eine kriegen die großen Weltgeld-Nationen mit ihrer Kreditmacht allemal noch hin: Die Zahlungsnöte, in die sie ihre Schuldner stürzen, treffen international bloß die und nicht sie selber. Denen wird ihre gesamte Zahlungsfähigkeit entzogen, die offizielle Annullierung ihres kompletten Geldvermögens zugemutet. Umgekehrt können die kapitalistischen Großmächte, so sehr sie davon und von der Stockung der Weltgeschäfte überhaupt betroffen sind, trotz Krise also, für sich selbst und untereinander bis auf Weiteres keinerlei Abrechnungsbedarf entdecken. In ihrem exklusiven Club mutet keiner dem andern einen Rechnungsabschluss zu, auch wenn grenzüberschreitend noch so viel Kredit und Vermögen kaputt geht und sogar ehrenwerte Multis in Schwierigkeiten geraten; keine der großen Weltwirtschaftsmächte stürzt die anderen in „Liquiditätsschwierigkeiten“.
Die Gründe dafür sind jeweils etwas anders beschaffen und dabei ziemlich komplementär zueinander:[7]
– Die USA befinden sich ohnehin nicht in der Situation, ihren großen Kontrahenten eine Abrechnung zu präsentieren, die deren Zahlungsfähigkeit antasten würde. Von denen, speziell von den Japanern, lassen sie sich umgekehrt ihr eigenes notorisches „Doppel-Defizit“ im Haushalt und in der Zahlungsbilanz der Nation finanzieren. Sie „leben über ihre Verhältnisse“ und verbrauchen die volkswirtschaftliche „Sparquote“ ihrer Partner, die sie selber nicht zu Stande bringen: Diese zu gleichen Teilen aus Häme und Vorwurf zusammengesetzte kritische Anmerkung hat wieder Konjunktur, seit Präsident Bush den Konkurrenzerfolg seiner Kapitalisten mit massiven Steuererleichterungen fördert und für seinen Krieg gegen den Terror keine Kosten scheut. Sie enthält bereits den Hinweis auf die beiden Gründe, weshalb die Amerikaner ihrerseits auch in der Krise nicht in die Zwangslage geraten, an irgendwen Zahlung in etwas anderem als in vermehrten neuen Dollar-Schulden leisten zu müssen. Sie verlassen sich darauf, dass ihre Schulden allein schon deshalb in jeder Menge als gute Vermögenswerte akzeptiert werden, weil die ganze Welt sie längst in jeder Menge als Vermögenstitel und Geschäftsmittel benutzt und an die Auflösung von Dollar-Guthaben gar nicht denkt, geschweige denn damit kalkuliert. Zumal noch ein ganz anderes „Argument“ als seine erfolgreiche kapitalistische Verwendung die fraglose Gültigkeit des US-Kredits verbürgt: Seine einzigartige „Glaubwürdigkeit“ gewinnt mit jeder Summe, die in das höchst kostspielige Unternehmen fließt, die Staatenwelt mit unendlich überlegener Rüstung zu beeindrucken und mit der Ankündigung und fallweisen Durchführung von Kriegen auf in Washington entworfene strategische Richtlinien festzulegen.
– Japan als größter Eigentümer amerikanischer Dollarschulden hat seinerseits weder bessere Alternativen zur Verfügung noch entscheidende Gründe, sich von diesem Bestandteil seines nationalen Vermögens zu trennen und dadurch dessen Entwertung herbeizuführen. Der Staat hat im Gegenteil allen Grund, die nationalen Dollarbestände festzuhalten und zu vermehren. Denn darin verfügt er über eine Garantie seiner uneingeschränkten Zahlungsfähigkeit, die die höchst mangelhaften Leistungen seines eigenen Kreditgelds – es versagt als Wachstumsmittel und bewährt sich stattdessen nur in der Fortschreibung eines längst fiktiven nationalen Bank-Vermögens – nach außen hin kompensiert und das Land zur Aufrechterhaltung und zum Ausbau seiner Gläubigerposition gegen den Rest der Welt, nicht zuletzt eben gegen Amerika, befähigt.
– Die Euro-Länder haben mit der Einführung ihrer Gemeinschaftswährung erst einmal untereinander den Standpunkt des kritischen Abrechnens überwunden. Mit der Kreditmacht, über die sie im Kollektiv in Gestalt des gemeinsamen Kreditgeldes verfügen, verfolgen sie darüber hinaus auf lange Sicht natürlich durchaus das Ziel, sich als vollkommen eigenständige Kapital- und Kreditquelle neben den USA zu etablieren und „dem Dollar“ das Weltgeschäft mit Schulden und Forderungen streitig zu machen. Zur Eröffnung einer kritischen Abrechnung über die Frage, was Euro und Dollar im Verhältnis zueinander taugen, reicht es aber noch lange nicht. Die neue Währung hat noch kaum ihre erste große Niederlage, die Abwertung im Dollar-Vergleich nach ihrer Einführung, halbwegs kompensiert; als alternatives Weltgeld, als Devisenschatz für Staaten und Geschäftsmittel fürs Finanz- und Handelskapital, ist sie noch immer nicht so durchgesetzt, wie ihre Schöpfer sich das für den Einstieg ins neue Jahrtausend gedacht hatten. Die Krise im Weltgeschäft stellt im Gegenteil klar, dass die kapitalistischen Kräfteverhältnisse sich noch keineswegs von Amerika weg nach Europa verschoben haben. Stattdessen verschieben die USA die strategischen Kräfteverhältnisse heftig in ihrem Sinn und zum Nachteil Europas und machen damit ganz nebenher deutlich, unter welchem Vorbehalt die Bemühungen der EU-Partner stehen, sich im Kollektiv als gleichrangiger Konkurrent, und sei es auch fürs Erste „nur“ in der Frage der Kreditmacht und des Geldverdienens, neben und gegen Amerika aufzubauen.
Untereinander, so sieht es aus, haben die großen Weltwirtschaftsmächte also auch in der gegenwärtigen Krise unbegrenzt Kredit. Der Haken ist nur: Es hilft nicht viel, ihre unangefochtene Zahlungsfähigkeit hilft ihnen nicht aus der Krise heraus. Japan hat die Erfahrung schon hinter sich, dass selbst die größten kreditfinanzierten Konjunkturprogramme die nationale Kapitalakkumulation nicht wieder in Gang bringen. Die USA machen die Erfahrung, dass Steuererlass für Reiche, Aufblähung der Staatsausgaben – noch dazu für einen so guten Zweck wie die Sicherheit der Nation – und eine entsprechende Aufstockung der Staatsschulden den nationalen Einbruch der Geschäfte und die Entwertung des Kapitals der Nation auch nicht ungeschehen machen. Die EU-Staaten versagen sich eine „expansive Fiskalpolitik“ von vornherein – um intern zahlungsfähig zu bleiben, müssen sie ihre Neuverschuldung ohnehin schon über die „Maastricht“-Grenzen hinaus steigern. Und alle Fachleute, die regierenden wie die ideell mitregierenden, geben sich belehrt und stellen sich auf den Standpunkt, der Staat könne mit seinem Kredit ohnehin höchstens „Strohfeuer“ entfachen; einen zukunftsträchtigen „Wachstumspfad“ müsse „die Wirtschaft“ schon selber finden und einschlagen. Nicht als ob die Politik dafür nicht einiges tun könnte. Aber alles, was die herrschende Meinung dafür vorschlägt, läuft auf das Eine und immer dasselbe hinaus: Der Staat soll erstens sich selbst und zweitens das lohnabhängige Volk billiger machen, damit die Unternehmen eine bessere Rendite erzielen können. Das Stichwort dafür lautet „Reformen“, und zwar „durchgreifende“ – eine kleine Ironie der Geschichte, dass genau der Schlachtruf, mit dem Sozialdemokraten einige Jahrzehnte lang die revolutionär gesinnte Arbeiterbewegung zur Ordnung gerufen und die Befriedigung aller „sozialen Anliegen“ im Rahmen des bürgerlichen Staates und seiner Marktwirtschaft propagiert haben, mittlerweile für das exakte Gegenteil steht, nämlich für die Forderung nach kompletter Rücknahme aller „sozial“ gemeinten Interventionen der Staatsgewalt ins freie kapitalistische Unternehmerleben. Dabei steht bei allen einschlägigen Maßnahmen, die von den Regierungen ergriffen werden, immer schon fest, dass sie längst nicht „kühn“, „einschneidend“ und vor allem nie „marktwirtschaftlich“ genug sind, um „den Karren aus dem Dreck zu ziehen“: Das prokapitalistische Reformgeschrei steht weniger für ein politisches Programm als für ein grundsätzliches Misstrauen gegen die Wirksamkeit politischer Programme überhaupt und insbesondere gegen jeden Aufwand, den der Staat sich leistet, um seinen Laden durch die Krise hindurch und aus ihr heraus zu steuern.
Dieser Standpunkt ist deswegen besonders bemerkenswert, weil daneben immer häufiger und nachdrücklicher eine Krisendiagnose gestellt wird, die eigentlich und herkömmlicherweise auf staatliches „Gegensteuern“ abzielt, und zwar mit den Mitteln des Kredits, im Wege einer umfassenden staatlich finanzierten „Nachfragebelebung“: Man befürchtet für die USA und Europa, was für Japan schon eingetreten sei, nämlich eine Deflation. Das Wort steht für das ein wenig begriffslose Bild einer „Abwärtsspirale“, in der verringerter Konsum sinkende Preise, sinkende Preise einerseits noch mehr Konsum-Aufschub, andererseits eine schwerere Schuldenlast für die Unternehmen und zurückgenommene Investitionen, diese wiederum Zukunftssorgen unter den Massen und noch weiter reduzierten Konsum nach sich ziehen; die Preise sinken weiter, und das bedeutet, am Geld ausgedrückt, das Gegenteil von Inflation; daher der Name. Die Schuldfrage wird in diesem tief schürfenden Befund ganz nebenher mit geklärt, zu Lasten der Konsumenten und ihrer schlechten Laune, für die sich wiederum alles Mögliche haftbar machen lässt, vor allem die Politik – je nach Standort die der Regierung, die nichts richtig, oder die der Opposition, die alles bloß schlecht macht. Plausibel wäre demzufolge ein Staatsprogramm, das die Laune der Konsumenten hebt; in ihrer etwas weniger albernen Fassung nimmt die Diagnose zur Kenntnis, dass der Masse der „Verbraucher“ Geld fehlt, weil sie immer weniger Lohn kriegen, und empfiehlt ohne käuferpsychologischen Umweg, mehr Geld in den Wirtschaftskreislauf zu tun. Doch genau das hält in der gegenwärtigen Lage kein verantwortungsbewusster Wirtschaftspolitiker und schon gar kein sachkundiger Wirtschaftssprecher, kaum der eine oder andere Gewerkschafter, für ein zielführendes Rezept. Die politökonomische Elite der großen Weltwirtschaftsnationen lehnt, Deflation hin oder her, staatliche Ausgabenprogramme als Mittel der Krisenüberwindung ab. Niemand zweifelt an der Fähigkeit der großen Weltgeld-Mächte zu quasi beliebiger Vermehrung ihrer Zahlungsfähigkeit; man misstraut der Wirksamkeit zusätzlicher Kreditschöpfung durch die Staatsgewalt. Derselbe Standpunkt, der die führenden Nationen des Weltkapitalismus zur Absage an eine Weiterfinanzierung bankrotter Schuldnerstaaten nach herkömmlichem IWF-Muster bewegt, gilt in Bezug auf die „Binnenkonjunktur“ der großen Kapitalstandorte.
Damit bekommt die Sorge vor einer weltweiten Deflation doch noch eine politökonomische Bedeutung jenseits dessen, was die besorgte Fachwelt damit meint. Sie enthält das Eingeständnis, dass sich inmitten der schönsten kapitalistischen Weltordnung der größte anzunehmende Betriebsunfall anbahnt: Geld und Kredit, obwohl in Massen vorhanden, finden einfach keine kapitalistische Verwendung mehr. Dass sich mit dem Geld der Weltgeld-Nationen immer mehr kaufen ließe, ist kein Glück, sondern ein Unglück, weil daran nur offenbar wird, dass es sich für den Konsum zwar ganz gut, kapitalistisch aber nicht verwenden lässt. Dass das Kapital sich in seiner Geldform nicht entwertet, ist die banale Folge des Übels, dass es gegen die Zirkulation festgehalten wird; es fungiert nicht als Kapital, ist als Kapital also gar nichts wert; die Entwertung findet an den produzierten Waren und den Produktionsmitteln statt – Lohnarbeiter inklusive. „Deflation“ steht insofern für den Befund, dass die Profis der unendlichen Geldvermehrung selbst mit ihren reichlich vorhandenen Geschäftsmitteln nichts Produktives anzustellen wissen; schlicht deswegen, weil sich für die Kapitalisten selbst ihr ganzer Kapitalismus momentan nicht mehr lohnt. Und die allmählich um sich greifende Angst vor einer womöglich bevorstehenden Deflation steht für die bange Ahnung, dass dieser GAU der kapitalistischen Produktionsweise noch lange nicht vorbei ist, sondern womöglich gerade erst richtig losgeht. Die Meldungen aus der Welt der Kreditinstitute bestätigen hier die schlimmsten Befürchtungen: Die Entwertung des finanzkapitalistischen Vermögens der großen Nationen ist noch in vollem Gang; ein Tiefpunkt, von dem es nurmehr wieder aufwärts gehen könnte, ist noch gar nicht erreicht.
Eine staatliche Krisenpolitik, die sich von „expansiven Maßnahmen“ wegen erwiesener oder antizipierter Unbrauchbarkeit nichts erhofft und deswegen zurückhält, ergänzt dieses Eingeständnis durch das andere: Wenn die Marktwirtschaft sich insgesamt nicht rentiert, dann kann auch der Staat mit all seiner ungebrochenen Macht übers Geld der Nation das fehlende Wachstum nicht erzwingen. Dann gerät umgekehrt jeder Staatshaushalt zu einem großen Schwindelunternehmen: Seine Einnahmeseite besteht zu erheblichen Teilen nurmehr aus Schönfärbereien, die unweigerlich auffliegen und Anlass zu neuen Rechnungen geben, die sich dann auch wieder als „zu optimistisch“ erweisen. Was da ausfällt, wird auf der Ausgabenseite eingespart – mit demselben negativen Ergebnis: Bei keinem erreichten Einspar-Niveau ist Schluss und kann die Bilanz für konsolidiert gelten; umso weniger, weil jede erfolgreiche Sparmaßnahme irgendwo auch wieder negativ auf die Staatseinnahmen durchschlägt. In soliden Demokratien macht sich, ihrem politischen Beruf gemäß, die jeweilige Opposition um die öffentliche Skandalisierung dieses Tatbestands verdient; dass die deutsche dieses Geschäft derzeit in der interessanten Form betreibt, dass sie nichts weiter als einen Wahlbetrug, den aber allen Ernstes dingfest machen will, nimmt von dem Befund nichts weg, dass von den Haushaltszahlen der Nation nichts stimmt. Den Ausgleich schaffen Schulden, die nicht bloß in ihrer Höhe an den Boom der New Economy gemahnen, sondern in ihrer Qualität, nämlich ihrem (Miss-)Verhältnis zum (ausbleibenden) Wachstum, an deren Zusammenbruch. Die staatliche Garantie, die dahinter steht, hat längst jede ökonomische Grundlage und Rechtfertigung verloren; sie enthält kein seriöses Versprechen auf demnächst anbrechende Boom-Jahre mehr, die den aufgehäuften Schuldenberg wenigstens halbwegs als einen hoheitlichen Vorschuss auf ein nationales Wachstum bestätigen würden, sondern überdeckt ein Minus, dessen Offenbarung für etliche Währungsreformen gut wäre, durch das schlichte Verbot, das fiktive Nationalvermögen auf Dimensionen zusammenzukürzen, in denen es sich allenfalls wirklich kapitalistisch verwerten könnte. Mit ihrer Absage an „Konjunkturprogramme“ gestehen die Experten der öffentlichen Haushaltsführung somit nicht bloß die Ohnmacht ihrer mächtigen Staatsgewalten in der gegenwärtigen Krise ein; den Krisenhaushalten, die gleichwohl formvollendet aufgestellt, wieder umgestoßen und neu verabschiedet werden, attestieren sie im Grunde den Charakter einer ziemlich gewaltigen nationalen Bilanzfälschung. Doch wie es aussieht, lässt es sich, jedenfalls was Staatsgewalt und Kapitalistenklasse in den Metropolen des Weltgeldes betrifft, bis auf Weiteres sogar damit leben.
Die schlechte Laune der Gesellschaft, aus der die Deflations-Theoretiker das Objekt ihrer Sorge ableiten – erklärtermaßen in praktischer Absicht: Entweder eine neue Regierung muss her, die ihnen gefällt, oder die, die ihnen gefällt, soll mehr Beifall kriegen! –, folgt im Übrigen unter den Bedingungen einer anständigen marktwirtschaftlichen Demokratie ganz von selbst aus dieser Krisenlage. Wenn die höchsten Gewalten sich zur puren Mängelverwaltung als aktueller Staatsräson bekennen und für sich auf Ohnmacht plädieren, dann ist das zwar verlogen, aber trotzdem nicht toll und keine gute Prämisse für eine – wenigstens schon mal – „geistig-moralische Wende“ zum Besseren. Regierungschefs, die ihrem Volk kein schöneres Angebot zu machen haben, als dass alle mit weniger Geld auskommen müssen und dass die Arbeitslosen ganz angestrengt und topfit darauf warten sollen, dass ein Arbeitgeber sie wieder ausnutzt, die also weder einen patriotischen Arbeitsdienst für die Schaffung „blühender Landschaften“ organisieren – sondern schon eine wirkliche Überschwemmung brauchen, um ihr Volk in Stimmung zu bringen – noch einen Feldzug fürs vaterländisch Gute riskieren: solche gemäßigten Herrscherfiguren blamieren sich nur, wenn sie mit dem für Kriegs- und Aufbruchszeiten erfundenen Spruch daherkommen, man solle nicht fragen, was der Staat für den einzelnen Bourgeois, sondern was der Citoyen für seinen Staat tun könne. Die jeweilige Opposition, sogar wenn sie konservativsten Zuschnitts ist, tut sich da leicht, eine „Vision“ zu vermissen und „Aufbruchsstimmung“ anzumahnen. Viel Begeisterung weckt sie damit aber auch nicht, solange sie demokratisch anständig bleibt, also keinen gescheiten „inneren Feind“ – jedenfalls keinen schlimmeren als einen sozialdemokratischen „Wahlbetrüger“ – dingfest macht, „die Ausländer“ nicht nur wegräumen, sondern außerdem „integrieren“ will und am internationalen Kräfteverhältnis überhaupt nicht rüttelt.
Eine Bombenstimmung herrscht bloß in Amerika, aus gegebenem Anlass – und widerlegt dort ein bisschen die deflationspsychologische Krisenerklärung…
c) Krise ohne entgegenwirkende Wachstums-Ursachen
Die so gar nicht aufbruchsträchtige Krisenreaktionspolitik der „politischen Klasse“ in den arrivierten kapitalistischen Demokratien reflektiert eine Krisenlage, in der den zuständigen Regierungen nach Jahrzehnten der kreditfinanzierten Krisenintervention die öffentlichen Schulden – sei es nach ihrem eigenen Urteil, sei es in der Einschätzung skeptischer Finanzexperten – dann doch ein wenig zu viel werden, weil sie viel stärker wachsen als die damit gefütterte Nationalökonomie. Auf der anderen Seite gehen ihnen nach eben diesen Jahrzehnten erfolgreicher Wachstumspolitik sowie mit vollendeter weltweiter Durchsetzung von Demokratie und Marktwirtschaft die Betätigungsfelder aus, auf denen sie dem Kapital neue Wachstumschancen eröffnen und so dem Zusammenbruch ihrer nationalen Akkumulationsraten effektiv entgegenwirken könnten:
- In den entscheidenden Sphären, wo das freie Unternehmertum beweist, was an Dynamik und Schöpfertum in ihm steckt, sind nach der Blitzkarriere und dem schmachvollen Platzen der mit so schönen Hoffnungen befrachteten „New Economy“ weit und breit keine „Innovationen“ in Sicht, die dem Geschäftemachen entscheidende, womöglich sogar längerfristig wirksame „Impulse“ verleihen könnten, deren Förderung sich also politökonomisch auszahlen müsste. Das gilt insbesondere für das Kreditgewerbe, das sich neulich noch anheischig gemacht hat, den Kapitalismus in das goldene „postindustrielle“ Zeitalter eines sich aus Vermögenstiteln selbst ernährenden immerwährenden Aufschwungs zu führen: Bei der Entwicklung neuer „Finanzprodukte“ hat es alles ausgereizt, wozu es per „Deregulierung“ politisch ermächtigt wurde, und am Ende bloß für die Annullierung der zuvor aufgebauten Vermögens-Fiktionen und die Vernichtung einer Menge gesparten Geldes gesorgt.
- In den niedrigeren Abteilungen der modernen Volkswirtschaften, bei den Arbeitnehmern, sind schon längst keine brachliegenden Potenzen mehr zu entdecken, deren gewaltsame Mobilisierung noch unerschlossene „Wachstumsreserven“ freimachen könnte. Die letzten Refugien einer eventuell doch noch nicht hundertprozentig kapitalistisch funktionalisierten Subsistenz, im „übersubventionierten“ Bauernstand z.B. oder einem „überregulierten“, mit Beamten „überbesetzten“ öffentlichen Dienst, sind schon oder werden aufgelöst und „angepasst“, ohne dass dadurch die Profitrate merklich wachsen würde. Wegweisende Neuerungen wie die gesetzliche Erlaubnis, Haushaltshilfen nun auch offiziell hemmungslos ausbeuten zu dürfen, sind weniger ein Beitrag als ein Hohn auf das tief empfundene wirtschaftspolitische Bedürfnis nach einem durchgreifenden „Rentabilitäts-Schub“. Das große Reform-Unternehmen, durch „Umbau des Sozialstaats“ die Arbeit entscheidend billiger zu machen und so dem Kapital „nachhaltig“ auf die Sprünge zu helfen, stößt an ziemlich enge Grenzen, weil die zur Marktwirtschaft gehörige Armut durch das gesetzliche Kassenwesen bereits perfekt funktionalisiert ist. Mehr Verelendung lässt sich natürlich trotzdem allemal herbei organisieren; doch damit setzt die Sozialpolitik eigentlich nur durch, was das Kapital mit seinem Wachstum an Existenzbedingungen für den Rest der Gesellschaft vorgibt, und schafft umgekehrt keine entscheidend verbesserten neuen Wachstumsbedingungen. Viel Zustimmung ernten Politiker regelmäßig für ihr regelmäßiges Versprechen, „Bürokratie abzubauen“ und dadurch vor allem dem „Mittelstand“ zu einem Aufschwung zu verhelfen, den ein kostspieliger staatlicher Aufsichtswahn bisher verhindert hätte; doch abgesehen davon, dass die private Kommandomacht des kapitalistischen Eigentums, auch des „mittelständischen“, auf einem bis in den letzten gesellschaftlichen Winkel hinein wirkenden Herrschaftsapparat beruht, gibt es da schon gar nichts Wesentliches mehr einzusparen und auch nicht per „Privatisierung“ zu einem neuen Geschäftsfeld zu machen. Nicht einmal mit der Garantie eines unverbrüchlichen „sozialen Friedens“ können die politischen Chefs der maßgeblichen Kapitalstandorte heute noch Eindruck machen, geschweige denn das nationale Wachstum fördern – weil es wachstumshemmende Widerstände von „unten“, Klassenkämpfe womöglich, gar nicht mehr gibt.
- Was im inneren Zuständigkeitsbereich der kapitalistischen Großmächte gilt, das gilt ebenso in Bezug auf den Rest der Welt. Die Erschließung fremder Märkte, die Herrichtung der Länder des Globus zur Anlagesphäre, die Subsumtion noch des letzten Naturprodukts unter den Zugriff irgendwelcher Geschäftemacher, die universelle Durchsetzung des Regimes des Geldes im Allgemeinen und einer sehr überschaubaren Anzahl von Weltwährungen im Besonderen, die Sicherstellung dieser perfekten Weltordnung mit den Mitteln ziviler und einem unendlich schlagkräftigen Inventar militärischer Gewalt: das alles ist fix und fertig, und nicht nur das. Der Rest der Welt ist längst in den Prozess der Überakkumulation von Kapital einbezogen und dadurch fachgerecht so ruiniert, dass man in den imperialistischen Zentren des Weltgeschäfts, siehe oben, bereits ein Abwicklungsverfahren für ganze Volkswirtschaften plant; in etlichen Regionen gibt es schon gar nichts mehr abzuwickeln. Einschließlich ihrer ehemals „realsozialistischen“ Teile ist die Staatenwelt kapitalistisch okkupiert, durchsortiert und in der gegenwärtigen Krise für weitgehend nutzlos befunden worden; als „Öffnungsklausel“ für überakkumuliertes Kapital, als Ausweg aus dem großen „Konjunkturtief“ hat sie damit fürs Erste ausgedient.
Was bleibt, ist daher: die kapitalistische Krise in ihrer ganzen Banalität und Radikalität. Also: ein stockender Geschäftsgang, der das involvierte Kapital mehr ent- als verwertet; der viel gegenständlichen Reichtum samt Reichtumsquellen vor die Hunde gehen lässt und ganz nebenher unter den Dienst tuenden wie vor allem den ausgemusterten Hilfskräften der Kapitalakkumulation für einige zusätzliche Verelendung sorgt; dies flächendeckend rund um die Welt, dabei je nach nationalen Standortbedingungen abgestuft; insgesamt in einer Größenordnung, die noch gar nicht feststeht, weil ein Ende nicht abzusehen ist. Dazu eine Regierungstätigkeit, der ihre gewohnten und beanspruchten Mittel abgehen; die mit viel „Bilanzkosmetik“ ihre Krisenhaushalte über die Runden bringt und immer weiter Schulden aufhäuft, die allen Gesichtspunkten staatskapitalistischer Solidität Hohn sprechen; die nach außen die Abrechnungen vollstreckt und Offenbarungseide erzwingt, die sie sich selbst verbittet; und die sich im Übrigen, der jeweiligen nationalen Verelendungslage entsprechend, um die ordentliche Verwaltung der kapitalistisch erzeugten Überbevölkerung, also darum kümmert, ihre nur noch sehr teilweise benötigte Bevölkerung insgesamt für ihre teilweise Überflüssigkeit mit einem deutlich nach unten korrigierten „Lebensstandard“ zahlen zu lassen. Dazu eine politische Kultur der allgemeinen Unzufriedenheit, die eine strapazierfähige „Einsicht ins Unvermeidliche“ mit tiefem, gerechtem, folgenlosem Verdruss über dessen Vollstrecker kombiniert.
Und schließlich: ein Krieg, mit dem die Führung der Weltmacht klarstellt, dass es wenigstens für sie etwas Wichtigeres gibt als das Krisenelend des globalen Kapitalismus. Nämlich ihre Herrschaft über dessen Geschäftsbedingungen.
[1] So wird z.B. die bundesdeutsche Sozialministerin nach eigener Auskunft kurz nach ihrem Amtsantritt beim Nachzählen der Sozialbeiträge von dem Befund unangenehm überrascht, dass viele Unternehmen tarifliche Lohnerhöhungen in diesem Jahr mit überkommenen übertariflichen Zahlungen verrechnen, die nominelle Lohnsumme, aus der die Sozialversicherungen sich bedienen, also kaum steigt. Immerhin weiß sie sich noch zu helfen – wenigstens bei den Krankenkassenbeiträgen: Die müssen prozentual steigen.
[2] Hierzu u.a. die Artikel Marktkonforme Arbeitsmarktpolitik: Vermitteln statt Verwalten!
in der Nummer 2-02 sowie Das neue Arbeitsamt: Vermarkten statt Vermitteln!
in GegenStandpunkt 3-02, S.75. Notierenswert auch die Klarstellung des bundesdeutschen Finanzministers – an passender Stelle: in einem Interview durchs Handelsblatt –, der die Härte seiner Regierung gegen die Armen der Gesellschaft von den Besserverdienenden ungerechterweise zu wenig gewürdigt findet: „Eichel: Allein 2003 kürzen wir die Ausgaben für die Arbeitsmarktpolitik, die Bundesanstalt für Arbeit, die Arbeitslosenhilfe und die Rente um insgesamt 9,5 Mrd. Euro. Das ist eine riesige Kraftanstrengung. Vor allem bei der Arbeitslosenhilfe nehmen wir den Leuten richtig Geld weg. (Steht genau so da.) Das bemerken Öffentlichkeit und Medien ebenso wenig wie die Wirtschaftsverbände oder die Dienstwagenbesitzer, die ihre Privilegien mit Zähnen und Klauen verteidigen.“ (HB, 21.11.02)
[3] So kommt es zu den Glanzleistungen der öffentlichen Meinung, wie sie derzeit an der Polemik gegen die Regierungspolitik täglich zu bewundern sind. Da einigt sich z.B. alle Welt darauf, dass die Rentner mittlerweile so alt werden, dass es einfach nicht mehr zu bezahlen ist. Keine öffentliche Stimme sieht sich noch zu der heuchlerischen Zusatzbemerkung bemüßigt, natürlich sei Langlebigkeit eine schöne Errungenschaft; auch die Erinnerung, dass allemal noch viel länger eingezahlt worden und das durchschnittliche Ergebnis mehr als spärlich ist – knapp 1000 Euro Rente pro Monat für Männer, für Frauen die Hälfte! –, ist aus der Mode gekommen. Statt dessen bauen sich „Jugendvertreter“ unterschiedlichsten Alters als Anwälte der „jungen Generation“ auf, die nicht länger bereit sei, die Alten ad infinitum auf eigene Kosten durchzufüttern – und niemandem unter den wirklich Jungen will auffallen, dass da von ihrem eigenen Alter die Rede ist, dass außerdem ganz andere Figuren und Instanzen auf Kosten der jeweils Arbeitenden reich werden als ausgerechnet die Rentner, weil es nämlich überhaupt nicht um Lebensjahre, sondern um ein Stück vom Elend der Lohnarbeit geht. Ein und dieselbe Wirtschaftsredaktion erklärt ihren Lesern oder Zusehern, dass das Rentensystem nur noch zu retten ist, wenn die Leute ihm weniger lang zur Last fallen, also erst deutlich später in Rente gehen, und dass die Älteren in Zeiten der Arbeitslosigkeit den Jüngeren den Einstieg ins Berufsleben versauen, weil sie ihre kündigungsgeschützten Arbeitsplätze nicht hergeben – und keiner im Publikum, ob jung oder alt, stört sich an der Absurdität und Gemeinheit aller engagierten Vorschläge, die zum System der Lohnarbeit dazugehörige Armut gerechter und passender zu verteilen. Sachgerecht abgerundet wird das Ganze durch die helle Empörung, mit der die Einschränkung des steuermindernden Verlustvortrags für Kapitalgesellschaften als Fall von räuberischer Erpressung der Allgemeinheit durch öffentliche Wegelagerer beschimpft wird, als Anschlag auf die Konjunktur und Vertreibungsaktion gegen die Reichen, von deren Vermögen – nach Auskunft der Experten, die das von sich selber wissen werden – „wir alle“ leben.
[4] Noch Jahrzehnte nach Hitler finden empörte Nationalisten die Tatsache bemerkenswert, dass doch tatsächlich Juden in diesem Gewerbe tätig sind.
[5] So macht sich auch noch in diesem Extremfall geltend, dass in der Krise die Zahlungsbilanz gegen alle beteiligten Staaten ausfällt.
[6] Als einzige und gleich sehr gewaltige neue Geschäftssphäre wird von denen, die sie nutzen wollen, die Volksrepublik China auf ihrem nationalen Sonderweg zum Kapitalismus eingeschätzt; dem entsprechend wird das Land gewürdigt und zurechtgewiesen. Dabei stellt sich freilich schon mit der „Integration“ des großen Landes in den kapitalistischen Weltmarkt praktisch heraus, dass nach dessen Maßstäben auch dort – gar nicht so viel anders als in den Ländern des ehemaligen sowjetischen Ostblocks – alles, womit und wovon die Massen ihr realsozialistisches Dasein gefristet haben, in der Landwirtschaft und in der Schwerindustrie vor allem, zu viel ist, um überhaupt kapitalistisch lohnend angewandt werden zu können, und das Volk insgesamt sowieso viel zu zahlreich, als dass der globale Kapitalismus damit etwas anfangen, geschweige denn es ernähren könnte. – Das Nötige dazu steht in GegenStandpunkt 2-02, S.181: „China in der WTO“.
[7] Ausführlicheres zu Amerika in dem Artikel Wirtschaftskrise und Kriegswirtschaft in den USA
in GegenStandpunkt 3-02, S.89, zu Japan in dem Artikel über Japans politische Krisenökonomie: Die Weltfinanzmacht rettet ihr Geld
in GegenStandpunkt 3-02, S.123, zu Europa in GegenStandpunkt 4-02, S.103.