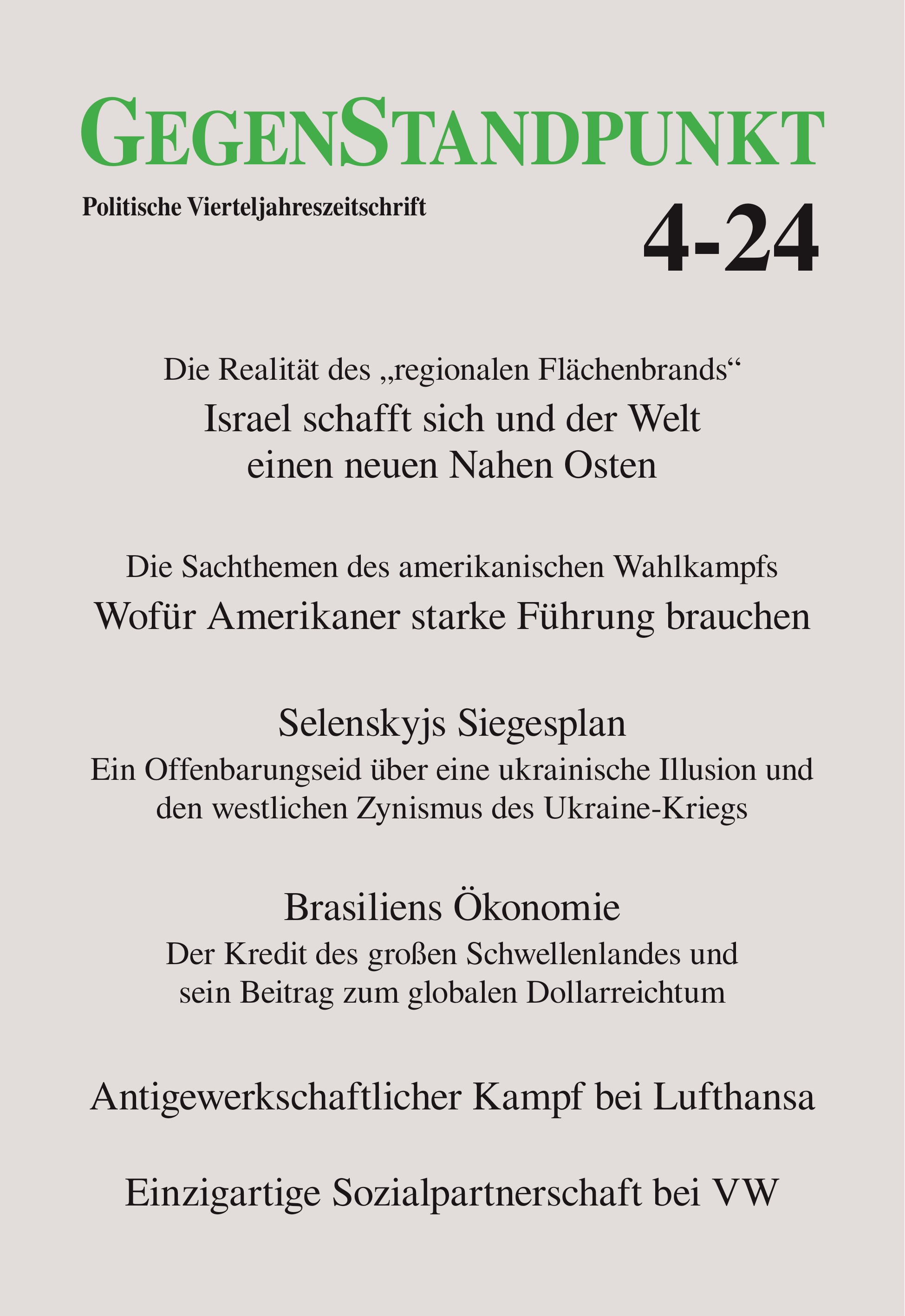Die Sachthemen des amerikanischen Wahlkampfs
Wofür Amerikaner starke Führung brauchen
Die Welt hat bei der US-Wahl nichts zu melden, obwohl alle von ihrem Ausgang betroffen sind. Diese Weltmacht ist nämlich eine vorbildliche Demokratie, also nur gegenüber ihren eigenen Bürgern rechenschaftspflichtig. Letztere werden daher im Wahlkampf mit Auskünften überschüttet, dass und wie es den Kandidaten ganz um sie geht. Der chauvinistische Wahlspruch „America first!“ ist in diesem allgemeinen Sinne nicht nur der Slogan von Donald Trump, sondern der Leitfaden der ganzen Veranstaltung. Die hat der oberste Vertreter dieses Mottos nun gewonnen. So deutlich, dass er die Pläne zur Umsetzung seiner Drohungen gegen diejenigen, die ihn um seinen vorher feststehenden Sieg betrügen wollen, in der Schublade lassen kann. Er hat diesmal sogar die „popular vote“ gewonnen, sodass man seinen Sieg nicht wie geplant auf das archaische „electoral college“ schieben kann. Der Rechtsruck der Wähler zu Trump hin durchzieht die ganze Nation, auf dem Land wie in den Städten und über alle ethnischen, Alters- und Geschlechtergrenzen hinweg. Trumps republikanische Partei hat außerdem in beiden Kammern des Kongresses eine Mehrheit erobert; der Oberste Gerichtshof liegt ohnehin schon fest in der Hand der Konservativen. Wie hat er das geschafft?
Aus der Zeitschrift
Artikel anhören
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Die Sachthemen des amerikanischen Wahlkampfs
Wofür Amerikaner starke Führung brauchen
Das Befürchtete ist eingetreten – so sieht man es in Deutschland und nicht nur dort. Die Hoffnung ist aufgegangen – so sieht man es in Ungarn und nicht nur dort. So oder so: Alle haben mitgefiebert, weltweit. Der amerikanische Wahlkampf und erst recht sein Ergebnis beschäftigen nicht nur die Amerikaner, sondern alle Staaten und alle Völker, nicht nur irgendwie, sondern ziemlich intensiv. Man kann es ihnen nicht verdenken. Wie es mit laufenden und drohenden Kriegen in gleich drei Weltregionen weitergeht; unter welchen Bedingungen es den Weltmarkt von heute und morgen überhaupt gibt; wer im Ringen zwischen etablierten und „populistischen“ Parteien den mächtigsten Machthaber der Welt auf seiner Seite hat und was das überhaupt heißt ... – das alles hängt am Ausgang der Konkurrenz zwischen zwei Anwärtern auf die Führungsposition der Weltsupermacht, deren Aufgabenkatalog sie sehr unterschiedlich ausbuchstabieren. Die Staaten der Welt sondieren schon sehr früh die Chancen und Zumutungen, die der Sieg des jeweiligen Kandidaten für die eigenen nationalen Kalkulationen und Ansprüche bedeuten könnte; ihre Völker, die sie dafür praktisch in Anspruch nehmen, werden darin auch geistig verwickelt. Am Ende hat sich alle Welt eine mehr oder weniger feste Meinung dazu gebildet, wie es um die demokratischen und überhaupt um die Sitten der Weltmacht USA steht.
Bloß hat die Welt da nichts zu melden. Diese Weltmacht ist nämlich eine vorbildliche Demokratie, also nur gegenüber ihren eigenen Bürgern rechenschaftspflichtig. Letztere werden daher im Wahlkampf mit Auskünften überschüttet, dass und wie es den Kandidaten ganz um sie geht. [1] Der chauvinistische Wahlspruch „America first!“ ist in diesem allgemeinen Sinne nicht nur der Slogan von Donald Trump, sondern der Leitfaden der ganzen Veranstaltung. Die hat der oberste Vertreter dieses Mottos nun gewonnen. So deutlich, dass er die Pläne zur Umsetzung seiner Drohungen gegen diejenigen, die ihn um seinen vorher feststehenden Sieg betrügen wollen, in der Schublade lassen kann. Er hat diesmal sogar die „popular vote“ gewonnen, sodass man seinen Sieg nicht wie geplant auf das archaische „electoral college“ schieben kann. Der Rechtsruck der Wähler zu Trump hin durchzieht die ganze Nation, auf dem Land wie in den Städten und über alle ethnischen, Alters- und Geschlechtergrenzen hinweg. Trumps republikanische Partei hat außerdem in beiden Kammern des Kongresses eine Mehrheit erobert; der Oberste Gerichtshof liegt ohnehin schon fest in der Hand der Konservativen. Wie hat er das geschafft?
Dafür hat die Öffentlichkeit dort wie hierzulande gleich nach der Verkündung des Ergebnisses ein halbes Dutzend Erklärungen parat. In der Summe rücken sie die amerikanischen Wähler in ein ziemlich schlechtes Licht – ebenso Harris’ Demokraten, die es vergeigt haben, den falschen Kandidaten am eigentlich Undenkbaren zu hindern. Ein Befund spielt dabei eine ganz prominente Rolle, wohl nicht zu Unrecht: Nach einem ereignisreichen Wahlkampfsommer, in dem den Bürgern mehrfach die Lektion erteilt worden ist, dass sie an der Führungsspitze vor allem energische Führungsstärke brauchen, [2] sind es am Ende die Sachthemen, die den Ausschlag gegeben haben sollen. Ob das wirklich der Fall gewesen ist, wird man nie ermitteln können; was die Bürger dabei im Einzelnen bewegt hat, dürfen sie in der Demokratie für sich behalten. Was aber auf jeden Fall feststeht, ist, mit welchen Alternativen die Kandidaten sie zu einer Wahlentscheidung bewegen wollten. Und das ist schon beredt genug.
I. Die Wirtschaft
„‚Es ist die Wirtschaft, Dummkopf!‘ Diesen berühmten Satz hat der Wahlkampfstratege der Demokraten James Carville schon bei der Präsidentschaftswahl 1992 geprägt. Und seitdem hat er sich in die Köpfe vieler Beobachter eingebrannt. Die Brot- und Butterthemen sind es, die die Wahlentscheidung der Amerikaner maßgeblich beeinflussen, heißt es. Eine neue Gallup-Umfrage aus dieser Woche bestätigt genau das für die Präsidentschaftswahl auch in diesem Jahr, und zwar in besonderem Ausmaß.“ (FAZ, 12.10.24)
Ob es der Wirtschaft gut geht oder nicht, dafür haben sich in kapitalistischen Demokratien bekanntlich drei bis vier feste Kriterien eingebürgert: Wachstum, Beschäftigung, Börse, Inflation. An den einschlägigen Zahlen soll jeder – ob Tellerwäscher oder Millionär – ablesen, ob die Wirtschaft so ist, wie sie sein soll, also Zufriedenheit angesagt ist. In Zeiten des Wahlkampfs ticken die Uhren freilich anders. Da bekommt der Wähler das Angebot, bei „der Wirtschaft“ allein an sich selbst zu denken. Gesamtwirtschaftliche Erfolgsindikatoren bleiben zweifellos relevant, aber gemäß dem ewigen Diktum, dass man „den eigenen Tank nicht mit BIP füllen kann“, soll sich der Wähler ruhig selbst als Maß aller ökonomischen Dinge aufführen und die Prätendenten auf die Macht am eigenen Wohlergehen messen. Die einschlägige Frage lautet da traditionell: „Geht es mir besser als vor vier Jahren?“ Von „gut“ oder „schlecht“ ist wohlgemerkt nicht die Rede. Es geht um eine Frage, die der Bürger in der Wahlkabine zu beantworten hat – einen dafür geeigneten Vergleich soll er anstellen, sein eigenes ökonomisches Abschneiden hat er in die Wahl eines politischen Hauptmanns zu überführen.
Das ist sehr eigenartig. Wo doch in einer freien Marktwirtschaft bekanntlich „die Wirtschaft in der Wirtschaft“ stattfindet. Wo die dafür gefeiert wird, dass es für das Wohlergehen des freien Individuums vor allem auf seine persönliche Tüchtigkeit ankommt. Nun soll sich aber der selbstverantwortliche Amerikaner, notorisch allergisch gegen obrigkeitliche Bevormundung, seine wirtschaftliche Lage so vorstellen, dass sie an der personellen Besetzung der Staatsspitze hängt? Die Kandidaten helfen ihm dabei auf die Sprünge: Das republikanische Lager gibt ihm den Rat, an die heftig gestiegenen Preise zu denken, die er seit einigen Jahren für Benzin, Lebensmittel und ein Eigenheim zahlen muss. Nähere Auskünfte dazu, was die mit der Demokraten-Regierung im Weißen Haus zu tun haben, sind freilich nicht zu erwarten; ein gewisser Aberglaube, das Verhältnis zwischen Preisen und Präsidenten betreffend, reicht allemal für die Entscheidung, die ein Wähler zu treffen hat. Mit dem Gegenargument „Biden hat mehr Jobs geschaffen als Trump!“ greift das demokratische Lager zur blanken Lüge gegenüber Wählern, die doch ganz genau wissen, wer sie heuert und feuert. Harris legt mit einer gewissen Unverschämtheit nach: Ihre eigenen biografischen Wurzeln sind so was von „middle class“; so viel menschliches Verständnis dafür, wie schwer es die Durchschnittsbürger haben, hat kaum ein anderes Mitglied der politischen Elite; die wird’s also schon richten. Trump, stets der Ehrlichere, pflegt wie gewohnt die umgekehrte Tour: So reich wie er zu sein, davon können die Wähler nur träumen; seine Regie kann für ihre Lage nur gut sein. Und so reich, wie der eh schon ist, kann es keine bessere Garantie dafür geben, dass ein Politiker es ernst meint, wenn er verspricht, sich ganz den Schwierigkeiten seiner Bürger zu widmen.
Inwieweit die Wähler solche zweifelhaften Argumente ernst nehmen, ist letztlich nicht zu ermitteln; Einspruch steht ihnen als Wählern nicht zu Gebote, nur ein Ja zu einer der gebotenen Alternativen. Der Unsinn verrät jedenfalls einiges – nicht nur darüber, wie unsachlich es zugehen kann, wenn mündige Bürger aus ihrer ökonomischen Lage eine Frage des guten Regierens zu machen haben, sondern auch über die freiheitliche Selbstverantwortung des marktwirtschaftlichen Individuums selbst. Die Kandidaten wissen offenbar durchaus, worin die letztlich besteht: in der selbstverantwortlichen Bewährung an Zwängen und in Abhängigkeit von Bedingungen, die die Bürger nicht bestimmen, nicht einmal begreifen müssen. Das gilt offenbar für alle: für gut betuchte Erfolgstypen wie für diejenigen, die täglich die Benzinpreise bis auf die dritte Stelle hinter dem Komma überprüfen müssen. Gleichgültig, ob man um die eigene Bereicherung konkurriert oder einen Kampf ums Zurechtkommen im Dienst der Bereicherung anderer führt: Freiheit braucht Obrigkeit, eine sehr umfassend tätige. Mit der größten Selbstverständlichkeit wird den Bürgern also bei allem Stolz auf ihre Selbstverantwortung in der Konkurrenz ein extrem affirmatives Bewusstsein ihrer Abhängigkeit von höheren Instanzen unterstellt. Auf der Basis bekommen sie ein Angebot, einen Anspruch zu stellen, der aber bloß davon zeugt, dass ihre freie Selbstbestimmung sich in einem Votum für einen obersten Chef verwirklicht: Sie sollen ruhig darauf bestehen, dass die politische Führung ihre Sache richtig, auf jeden Fall auftragsgemäß macht, damit ihre abhängige Glückssuche – jeder an seinem Platz – gelingt.
„Auftragsgemäß“ definieren amerikanische Präsidentschaftskandidaten traditionell so, dass sie die tüchtig konkurrierenden Amerikaner vor der Last zu verschonen haben, die die Staatsmacht für sie immer bedeutet. Bei Donald Trump ist das eine einfache Geschichte: Er verkündet die Verstetigung und Vertiefung seiner damaligen Steuersenkungen für die Unternehmen und die Reichen des Landes sowie eine Reihe von neuen. Wer viel Geld hat, soll es behalten und als Kapital einsetzen. Gemäß den wirksamen Abhängigkeitsverhältnissen der freiheitlichen Marktwirtschaft ist dadurch nicht nur den Wohlhabenden, sondern auch und gerade den anderen gedient: Zu Mitgliedern der Arbeiterklasse sickern, wenn alles gut geht, allemal Arbeitsplätze durch; erst recht nach der Abschaffung von weiteren regulatorischen Beschränkungen beim unternehmerischen Umgang mit der Natur wie mit ihnen selbst. Was sie von den Arbeitsplätzen haben, die es dann gibt, können sie als Herausforderung an ihre eigene Selbstverantwortung nehmen. Harris verspricht ihrerseits eine ganze Reihe von Entlastungen für die notorisch „struggling middle class“, die sich nun auch mit steigenden Preisen dort herumschlägt, wo es wirklich weh tut. Angekündigt sind eine Senkung der Einkommenssteuer für Normal- und Geringverdiener, Maßnahmen gegen kartellartige Preistreiberei bei Lebensmitteln, niedrigere Kosten für medizinische Versorgung durch Steuergutschriften und mehr Verhandlungsbefugnisse des Staates gegenüber „Big Pharma“, billigere Energie durch vermehrte – grüne wie fossile – Energieproduktion, Steuerhilfen für Häuslebauer und kleine Unternehmen, Steuergutschriften für Eltern, damit die sich z.B. Kindersitze leisten können – eine beeindruckende und superkonkrete Großzügigkeit, die in Harris’ Wahlkampf eine besonders prominente Rolle spielt. Und noch einiges mehr. Harris kann nicht oft genug sagen, wie viel Hilfe eine stolze „middle class“ braucht, um als selbstverantwortliche Menschen in einer „opportunity economy“ zurechtzukommen, die sie in Amerika neu beleben will. Mit besserer Betreuung halten sie allemal besser aus, was sie aushalten müssen, wenn der Reichtum der Nation weiterhin zuverlässig wachsen soll.
Zugleich machen beide Kandidaten auch lange vor dem aktuellen Wahlkampf klar, dass der Staat auf keinen Fall die Wirtschaft sich selbst überlassen darf. Das ist zwar auch in Amerika noch nie der Fall gewesen, aber jetzt steht für beide Parteien fest: Das kapitalistische Wohlergehen der Nation steht und fällt mit dem entschlossenen Einsatz der amerikanischen Staatsmacht – und zwar nach außen. Dazu lassen sich die Kandidaten entsprechend gebieterisch beauftragen. Trump bleibt damit seinem politischen Weltbild treu: Das heilige Recht der USA auf wirtschaftliche Ergebnisse, die ihre absolute Überlegenheit widerspiegeln, wird missachtet – vor allem durch amerikanische Politiker, die ihr Rechtsbewusstsein offenbar verloren haben und das ihrer Bürger auf jeden Fall verraten. Wo die Kapitalisten vom Ausland aus Jahr für Jahr am Größten Markt aller Zeiten mehr verdienen als umgekehrt, da verschenken Amerikas Politiker den Reichtum der Nation an Fremde. Dass Amerikas internationale Zahlungsfähigkeit dabei überhaupt nicht leidet, die notorisch negative Handelsbilanz vielmehr die Kehrseite davon ist, dass eine ganze Weltwirtschaft nicht genug Dollar und Dollarschulden kriegen kann, also für den singulären Status des amerikanischen Geldes in Anspruch genommen wird – das zeigt Trump nur, dass Amerika diese Kehrseite gar nicht dulden muss, es aber trotzdem laufend tut. Ein unansehnlicher „Rust Belt“ mit seinen Abstiegsbiografien belegt das Gleiche: Der gilt Trump im Gegensatz zur etablierten ökonomischen Vernunft nicht als die bedauerliche Schattenseite davon, dass die ganze Welt für eine Benutzung durch US-Kapital erschlossen worden ist. Letzteres belegt umgekehrt, dass die mächtigste Ökonomie der Welt sehenden Auges und ausgerechnet an der Heimatfront eine Relativierung ihrer Überlegenheit zulässt. Und dass eine fremde Nation im Besonderen es über die glorreiche Ära globalisierten Dollarkapitals zu einer ernsthaften Infragestellung amerikanischer Suprematie gebracht hat, ist für ihn der endgültige Beweis, dass die amerikanischen „Leaders“ der Globalisierung den größten Markt und den besten Standort der Welt nicht nur vernachlässigen, sondern verramschen. „America first!“ – das ist eben nicht bloß der Ausdruck für ein ehrgeiziges amerikanisches Aufbruchsprogramm, sondern ein Rechtszustand, den es wiederherzustellen gilt – „MAGA“ eben. In der Durchsetzung dieses Anrechts geht die angekündigte Wirtschaftspolitik von Trump II allem Anschein nach komplett auf. Konsequenterweise entdeckt er seine bevorzugte Waffe in einer Sparte der Wirtschaftspolitik, die in nichts als staatlichen Machtworten besteht:
„Zölle sind die schönste Entdeckung der Menschheitsgeschichte.“ (Trump) „Trump kündigte Zölle von 60 Prozent oder mehr auf chinesische Produkte und zehn oder zwanzig Prozent auf andere Importe an. Im März sprach er sich für einen hundertprozentigen Zoll auf Autos aus, die von chinesischen Unternehmen in Mexiko hergestellt werden, und im Mai erhöhte er diese Zahl auf zweihundert Prozent.“ (New York Times, 9.9.24)
Auf die genaue Höhe kommt es Trump nicht sonderlich an, entscheidend ist das Prinzip: Auswärtige Konkurrenten, die den amerikanischen Markt für ihre Bereicherung unbedingt brauchen, haben Amerika einen Tribut dafür zu zahlen, dass sie überhaupt an ihm verdienen dürfen. Die Höhe dieses Eintrittspreises wird so – und so freihändig – angesetzt, dass Amerikas Nutzen garantiert wird. Das gilt auch und erst recht für amerikanische Unternehmen, die ihren Heimatmarkt lieber von auswärtigen Standorten aus beliefern:
„Ich werde Zölle [auf Autoimporte] von 100, 200, 2000 % erheben – die höchsten Zölle der Menschheitsgeschichte! ... Die Zölle werden so hoch, so schrecklich, so widerwärtig sein, dass sie [die Unternehmen] sofort kommen werden.“ (Trump in Chicago, 15.10.24)
Mit den einschlägigen Eintrittsgebühren und Strafzahlungen – sowie mit einer neuen Runde Steuersenkung und Deregulierung für die vaterlandstreuen Kapitalisten, die echt amerikanische Arbeit für ihre Bereicherung ausnutzen – werden laut Trump alle ökonomischen Fragen der Nation zur allgemeinen Zufriedenheit, jedenfalls abschließend beantwortet: Darüber lassen sich besagte Steuersenkungen und einiges mehr finanzieren; überhaupt gehen alle anderen Rechnungen – vom Silicon Valley bis zum „Rust Belt“ – auf. Die ökonomische Bewährungsprobe, vor der Amerika steht, ist also eine rein politische: Der amerikanische Staat muss die Stärke, über die er kraft seines Marktes doch längst verfügt, mit aller Konsequenz einsetzen. Es ist rührend, wenn VWLer ungefragt ihre Bedenken bezüglich der Wirkungen solcher Zölle auf die Preise, den Standort, die Staatsschuld etc. anmelden und dabei so tun, als hätten sie es bei Trump mit einem schlechten Ökonomen zu tun, der seine Rechnungen nicht zu Ende gedacht hat. Wenn, dann denkt Trump genau umgekehrt – ganz gemäß dem MAGA-Prinzip, dass Amerika wieder großartig gemacht werden muss – an den Anfang der amerikanischen Weltwirtschaftsordnung zurück. Er besinnt sich auf eine ökonomische Gewissheit, die bei der Gründung dieser Ordnung Pate gestanden ist: die absolute Unverzichtbarkeit des amerikanischen Markts als Quelle des Dollarreichtums, der fortan den Reichtum der Welt ausmachen würde. Die Prämisse, dass den USA wegen ihres Markts der Nutzen des Weltmarkts zufällt, haben ihre Konkurrenten mit jedem Export nach Amerika nun praktisch mitzurestaurieren.
Trumps Zollfanatismus findet Harris extrem unseriös. Aus ihrer Sicht denkt Trump die Restauration der amerikanischen ökonomischen Suprematie nämlich viel zu einseitig und primitiv, wenn er sich dermaßen borniert als Türsteher vor dem US-Markt aufbaut. Sie warnt eindringlich vor den kontraproduktiven Wirkungen, mit denen bei einer dermaßen rücksichtslosen Zollpolitik zu rechnen ist: flächendeckend höhere Preise, die wie eine Verkaufssteuer – Harris sagt dazu: „Trump tax“ – wirken. Die haben nicht die fremden Konkurrenten, sondern hauptsächlich amerikanische Unternehmen und Endverbraucher zu entrichten. Die Dominanz amerikanischer Kapitalisten wird so nicht wiederhergestellt, eher zusätzlich belastet. Für die (Neu-)Eroberung fremder Märkte – insbesondere gegen den chinesischen Rivalen – ist das erst recht keine Hilfe, perspektivisch eher ein Schaden, wenn auswärtige Konkurrenten sich zu entsprechenden Retourkutschen genötigt sehen. Gegenüber Trump bestehen die – schon immer weltoffeneren – Demokraten also darauf, dass man doch nicht bloß den amerikanischen, sondern den gesamten Weltmarkt als amerikanischen Besitzstand neu in den Griff bekommen muss. Zölle haben darin zwar durchaus ihren Platz; gerade diejenigen, die Trump einmal gegen China verhängt hat, hat die Biden-Harris-Regierung beibehalten und ausgeweitet. [3] Damit lässt sich nämlich z.B. das Verbrechen Chinas gebührend bestrafen, seine Kapitalisten mittels ausgiebiger Staatshilfen zur Bestreitung des amerikanischen Rechts auf Überlegenheit zu befähigen. Auch Handels- und Investitionsverbote, z.B. im Falle von Huawei, sind bisweilen erforderlich; auch hier haben die Demokraten Trumps erste Vorstöße fortgesetzt und ausgebaut. Doch die imperialistische Überlegenheit, die Amerika wirklich braucht, die weltweite und nachhaltige nämlich, lässt sich nicht einfach mit höheren Eintrittspreisen zum US-Markt politisch herbeierpressen. Es bedarf vielmehr einer industriellen und zukunftstechnologischen Konkurrenzoffensive. Für einen überlegenen amerikanischen Kapitalismus gibt es also keine Ersatzlösung; dieser ist nur mit überlegener Kapitalproduktivität zu haben – im Allgemeinen und insbesondere in den Bereichen, an denen Amerikas ökonomische und militärische Suprematie entscheidend hängt, z.B. bei den berühmten Chips, der digitalen Infrastruktur, der grünen Energieproduktion, den Mitteln und Produkten der E-Mobilität etc. [4] Dafür ist der umfassende Einsatz des Staates wiederum absolut unerlässlich, wie die Biden-Harris-Regierung schon längst beweist: mit einem klaren und praktischen Bekenntnis zu einer Industriepolitik, die mit großen staatlichen Investitionshilfen amerikanischen Geschäftemachern zu der Überlegenheit verhilft, mit der der Staat sie beauftragt. Der dafür nötige Brain Drain, der vielversprechend Qualifizierte in die Innovationszentren der Nation spült, wird ebenfalls staatlich organisiert. Der technologische Vorsprung der USA in den entscheidenden Bereichen für die Suprematie auf dem Weltmarkt und als Weltmacht soll mit neuen, anspruchsvolleren Regelungen als geistiges Eigentum über Generationen hinweg gesichert werden. Schließlich braucht es eine neue Generation von Handelsabkommen, die andere Nationen auf die technologischen Potenzen und Standards verpflichten, die Amerika setzt – als „Rahmen“ für ihre eigenständige, weil vor allem antichinesische Entwicklung. [5] In Sachen saubere Energie kann sich ein Chefberater aus dem Biden-Harris-Lager sogar einen neuen Marshallplan vorstellen; der Name hilft schon sehr beim Verständnis dessen, worauf es da vor allem ankommt: Hilfen für die Länder der Welt, damit sie den USA zur Suprematie verhelfen. Auch Harris und Co kommen also offenbar auf ein Gründungsmoment der amerikanischen Weltmarktordnung zurück: auf die fraglose Überlegenheit amerikanischer Kapitale als Prämisse für einen freien, offenen Weltmarkt. Diese Prämisse gilt es wieder in Kraft zu setzen – als Produkt der angekündigten Konkurrenzoffensive. Dafür, so die Klarstellung gegenüber Trump, hat Amerika sehr viel zu tun, an sich und an den weltweiten Handelspartnern, damit auch die ihren Beitrag zum amerikanischen Vorsprung leisten. Kurz: Es kommt doch auf den Weltmarkt an, Dummkopf!
Ausgerechnet bei dieser Offensive springen Trump nur haarsträubende Beschränkungen ins Auge. Die sieht er vor allem beim angepeilten Übergang zu grünen Technologien in der Automobilindustrie und in der Energieproduktion. Er plädiert für den Abschied von einer staatlich forcierten Hinwendung zu E-Autos, die sich bloß für unamerikanische Kurzstrecken eignen, sowie für „drill, baby, drill!“. Wenn schon amerikanische Suprematie, dann mit allen Stärken, die Amerika hat. Zumindest in Energiefragen scheint sogar eine ziemlich weitgehende Annäherung der beiden Seiten zustande gekommen zu sein. Für beide sind alle amerikanischen Energieformen gut und förderungswürdig, sofern sie billig, lukrativ und einheimisch sind. Trump hat sich für Solarenergie längst erwärmen können, Harris hat ihre dokumentierte Abneigung gegen Fracking fallen gelassen – ein Standpunktwechsel, den sie mit dem Verweis verteidigt, ihre Werte seien doch stets die gleichen geblieben. Etwas anderes als den Erfolg des amerikanischen Kapitalismus gegen seine Konkurrenten hat sie nie im Sinn gehabt. Unter dem Strich kommt die wechselseitige Versicherung heraus, man wolle wirklich alles tun, damit Amerika zu seinem angestammten Platz an der Spitze zurückkehrt, wenn es um die ökonomische Dominanz über die Welt geht.
Was das alles mit der Inflation zu tun hat? Mit den steigenden Preisen, an die der Wähler den Umfragen zufolge bei „the economy, stupid“ vor allem denkt? Offensichtlich haben beide Kandidaten jedenfalls nicht vor, den staatlichen Geldaufwand aus Sorge vor weiterer Inflation zu beschränken. Dafür steht zu viel auf dem Spiel. Es geht um nicht weniger als die Sicherheit der Nation, weil Amerika sich als Weltsupermacht mit weniger als Überlegenheit auf allen Feldern nicht sicher fühlt. Steigende Preise bedeuten für die Kandidaten also, dass sie ihr ganz besonderes Weltgeld umso entschlossener zum Einsatz bringen müssen. Beide sind sich dabei absolut sicher, sich die nötigen Ausgaben leisten zu können. Dieses Gründungsmoment der amerikanischen Weltwirtschaftsordnung müssen sie nicht erst wiederherstellen, sondern nur konsequent genug zur Anwendung bringen: die unanfechtbare Singularität ihres Dollars.
II. Die Einwanderung
Das ist das zweite entscheidende Sachthema, das sagen die Umfragen. Worin es eigentlich besteht, inwiefern es alle Amerikaner unbedingt beschäftigen soll, das sagen die Kandidaten.
Trump hat keine Scheu, die Einwanderungsfrage bilderbuchmäßig rassistisch zu stellen – als Frage der richtigen Gene und des richtigen Bluts:
„Die illegale Einwanderung vergiftet das Blut der Nation... [Die Einwanderer kommen] nicht nur aus Südamerika, sondern von überall auf der Welt kommen sie in unser Land, aus Afrika, aus Asien, aus der ganzen Welt.“ (Trump, 16.12.23) „Bei der Besichtigung eines Ford-Werks in Michigan im Jahr 2020 lobte er den ‚guten Stammbaum‘ [bloodlines] des Firmengründers Henry Ford, eines stolzen Antisemiten... Und bei einem Wahlkampfauftritt in Minnesota, wo sich im 19. Jahrhundert Wellen nordeuropäischer Einwanderer niederließen, sagte Trump zu der fast ausschließlich weißen Menge: ‚Sie haben gute Gene. Vieles hängt von den Genen ab, glaubt ihr nicht auch? Die Rennpferd-Theorie – glaubt ihr, wir sind so anders? Ihr habt gute Gene in Minnesota.‘“ (Los Angeles Times, 10.10.24)
Bei allen Kurzausflügen in die Biologie führt Trump den Rassismus erkennbar auf seinen staatlichen Kern zurück: auf die Tauglichkeit der Individuen für das, was sie als sein amerikanisches Volk zu sein haben, nämlich erfolgreiche Konkurrenten. Daran entscheidet sich für Trump ganz vorurteilsfrei, was ein staatlich zusammengeschusterter Menschenschlag taugt. Auf jeden Fall untauglich sind die Migranten, die ungebeten an der Südgrenze erscheinen; sie kommen in aller Regel aus „shithole countries“, was schon alles über die Fliehenden selbst sagt. Warum sollten sie in Amerika zu mehr taugen als daheim – zumal Trump erfahren haben will, dass es nicht einmal die Besten der Schlechten sind, die nach Amerika kommen? Sie sind Gift für die Erfolgstüchtigkeit, die durch die Adern echter Amerikaner fließt. Umso schlimmer, wenn die Ungebetenen den echten Amerikanern ihr Vorrecht auf die Jobs bestreiten, mit denen die unter besonders harten Bedingungen ihre amerikanische Tüchtigkeit hätten beweisen können. Dabei nehmen es sich die Illegalen glatt heraus, öffentliche Dienstleistungen und Infrastruktur – bezahlt von anständigen Amerikanern – zu nutzen, gehen in die Krankenhäuser, besuchen Schulen, fahren – angeblich ohne Versicherung – auf Straßen, die fürs Durchkommen der Einheimischen da sind, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, die es mancherorts auch noch gibt, etc. Kurzum: Sie sind da und machen den rechtmäßigen Einwohnern der Vereinigten Staaten alleine damit das Leben schwer, dass sie sich genauso aufführen wie echte Amerikaner, wenn die sich selbstverantwortlich für den nationalen Erfolg nützlich machen. Vor allem aber legen Trump und Vance Wert darauf, dass die Einwanderung aus dem Süden zu einer ernsthaften persönlichen Bedrohung geworden ist: für die Sicherheit der Bürger und für deren Existenzrecht als Volk. Die Migranten sind „Invasoren“, deren Straftaten eine eigene Kategorie verdienen und die bisweilen guten Amerikanern sogar die Haustiere wegfressen – kurz: Immigranten als personifizierte kriminelle Energie. [6] Alles in allem ein Schrei nach einer Staatsgewalt, die zuverlässig für Recht und Ordnung sorgt, also nach einem Kandidaten, der die dafür nötige Härte an den Tag legt: Dieser Rechtsanspruch – vor allem der Verrat der regierenden Demokraten an ihm – ist es, was Trump und Vance mit ihren notorischen Feindbildern ausmalen. Die sind schon deswegen gegen alle sinnlosen Faktenchecks immun, weil Amerikaner doch immer Recht haben: Gegen das – womöglich konspirative – Versagen der regierenden Demokraten setzt Trump das Versprechen, an der Grenze wie in dem „Heartland“ auf eine Weise aufzuräumen, bei der er relativierende Gesichtspunkte des Rechts, der öffentlichen Moral und sogar der Logistik nur insofern kennt, als er sie demonstrativ verletzen will. [7] Und das geht auch mal ganz ohne Rassismus. Mit seinem demonstrativen Willen, die Ungebetenen aus dem Süden rauszuschmeißen und fernzuhalten, umwirbt Trump auch und gerade die legalen Latinos; die spricht er – offenbar nicht ohne Erfolg – auf ihr Selbstbewusstsein an, nicht mehr bloße Einwanderer, sondern echte Amerikaner geworden zu sein; als solche haben sie einen Anspruch auf Recht und Ordnung, also auf den Ausschluss der Falschen. Ein Sieg der rabiaten Ausländerfeindlichkeit über den Rassismus. Mit der großen Bereinigung wären dann alle drei Probleme erledigt, die die illegalen Migranten für Trumps Amerikaner darstellen: für ihre nationale Identität, ihre ökonomischen Rechnungen und ihre staatliche Ordnung.
Die rassistische Bösartigkeit von Trump und Vance kontern Harris und Walz mit einem menschenfreundlichen Beharren auf dem ökonomischen, militärischen und moralischen Zugewinn, den das amerikanische Einwanderungsland dank seiner Migranten verbuchen kann. Sie sehen im Migranten den Menschen, was stets heißt, in ihm das amerikanische Ebenbild der konkurrenztüchtigen Patrioten zu sehen, das er zu sein hat. Mit ihrer Hand- und Kopfarbeit, ihrem Unternehmergeist und ihrem Kapital leisten die Migranten einen extrem kostbaren Beitrag zu der Sorte Volksgemeinschaft, die Amerika so besonders und so besonders erfolgreich macht. Die hält nicht bloß irgendwie zusammen, sondern ist dem Ausland in den Konkurrenzveranstaltungen haushoch überlegen, auf die es für die Macht und den Reichtum der Nation wirklich ankommt, nämlich auf dem Weltmarkt und als Weltmacht. Die Ausländerfeindlichkeit der Staatenkonkurrenz gebietet Offenheit für fremde Staatsbürger; Erfolge dabei machen ein Volk erst so richtig stark und einig. Dennoch: In diesem Wahlkampf will Harris nichts beschönigen. Amerika leidet nun einmal unter einer „border crisis“. Es hat die Kontrolle über seine Südgrenze verloren, weil viel zu viele Ausländer unbestellt und auf eigene Faust kommen. Die Einwanderungsfrage, die Trump stellt, beantwortet sie also nicht mit schönen Bildern eines einzigartig überlegenen Einwanderungslandes, sondern mit einer lupenreinen Retourkutsche, was die Sünde der staatsgewaltigen Untätigkeit gegen ungebetene Fremde betrifft: Die Republikaner sind es doch, die den im Frühjahr im Kongress ausgehandelten „bipartisan border bill“ [8] trotz überdeutlicher republikanischer Handschrift dann doch aus wahltaktischen Gründen storniert haben. Sie würden offenbar lieber eine schwache Grenze politisch ausnutzen als die Bürger schützen. So macht das einschlägige Gesetzesvorhaben bei den Demokraten eine Blitzkarriere vom zähneknirschenden Zugeständnis an rechte Hardliner, an denen man leider nicht vorbeikommt, zur stolzen Errungenschaft, deren Realisierung nur die Republikaner verhindern. Die Beteuerung ihrer Härte in der Sache kombinieren die Demokraten mit der Beteuerung ihrer Sachlichkeit bei der Durchführung: Sie geben die trostreiche Versicherung ab, nichts gegen die Migranten selbst zu haben. Das aber soll der Wähler keinesfalls mit dem Unwillen verwechseln, das Problem zu bekämpfen, das die Migranten nun einmal sind. Was Amerika braucht, ist also weder rassische Reinheit noch rassistische Hetze, sondern eine Grenze so unpassierbar, wie Trump sich seine berüchtigte Mauer immer vorgestellt hat – aber eben nicht als unsachliches Symbol für Migrantenhass, sondern als pragmatische Notwendigkeit eines Einwanderungslandes, dem seine souveräne Kontrolle über die Einwanderung eben vorgeht. [9]
So bringen die Kandidaten die Einwanderungsfrage auf das Fundament aller bürgerlichen Existenz zurück – auf die Frage, wie weit die Macht des Staates reicht, Recht zu setzen und über sein Territorium und seine Bevölkerung zu verfügen. Was den einen das heilige Recht der einzig richtigen Amerikaner ist, das ist den anderen die sachlich-pragmatische Grundlage weltoffener Liberalität geworden. Für beide Seiten darf das hypertrophe Ideal eines Sicherheitsstaates nicht länger bloß auf dem Papier existieren.
III. Die Abtreibung
Dieses Thema – das drittwichtigste, heißt es – geht auf keinen Fall bloß die Frauen an, um deren Körper es geht. Amerika versteht sich nämlich als Wertegemeinschaft. Das sagt die politische Führung ihrem Volk jahrein jahraus, das ruft es ihr ebenso regelmäßig zurück. Und wie immer, wenn eine Nation ihre wertebasierte Einheit beteuert, streitet sie sich oben wie unten darüber, worin die besteht – und vor allem: wer sich nicht daran hält. Das heißt dann Kulturkampf. Zu einer definitiven Entscheidung in der Sache hat er noch nie geführt, dafür wird in jeder Kampfrunde die Hauptsache reproduziert: die allseitige Gewissheit, dass die amerikanische Gemeinschaft letztlich eine Sache von gemeinsamen Werten ist, jedenfalls sein müsste. Für die gelegentliche Zuspitzung dieses Kampfs ist der Wahlkampf erfahrungsgemäß besonders produktiv – vor allem deswegen, weil die Umkehrung gilt: Der Streit um Werte ist sehr produktiv für die Entscheidung, zu der der Wahlkampf unbedingt führen muss und immer führt. Und wenn Amerikaner an ihre nationalen Werte denken, dann denken sie in aller Regel an die Werte der Familie; die bildet immerhin den Zusammenhang, in dem die amerikanische Gemeinschaft sich nicht nur moralisch, sondern auch physisch reproduziert. Im diesjährigen Wahlkampf steht bei der Wertedebatte die Reproduktion explizit im Vordergrund.
Im Hintergrund steht der epochale Sieg, den die konservative Richtermehrheit am Supreme Court vor zwei Jahren für die Konservativen der Nation eingefahren hat. Nach ihrem Urteil im Fall „Dobbs“ ist die Abtreibung kein verfassungsrechtlich garantiertes Recht mehr; ob und inwieweit sie erlaubt wird, hängt nun vom jeweiligen Beschluss der Parlamente in den unterschiedlichen Bundesstaaten ab. [10] Dass das Recht auf Abtreibung von den Fährnissen der demokratischen Parteienkonkurrenz abhängig gemacht worden ist, übersetzt Trump in allgemeines Wohlgefallen. Schließlich können nun gewählte Politiker in den Bundesstaaten – also letztlich irgendwie die amerikanischen Wähler vor Ort selbst – darüber entscheiden, inwieweit amerikanische Frauen über ihren Körper frei verfügen dürfen. Mehr „freedom to choose“ geht kaum. Die Konsequenzen dieses Stücks gelebter Demokratie sorgen freilich dafür, dass die höchstinstanzlich geklärte Frage ein sehr heißes Eisen bleibt. [11] Angesichts dessen warten Harris und Walz zunächst mit einer zunehmend dringlichen Warnung an die Wähler auf: Wenn Trump wieder gewinnt, wird das Dobbs-Urteil nicht der letzte Sieg der Konservativen in der Abtreibungsfrage sein – auch nicht bei anderen kontroversen Fragen der rechtlich geregelten privaten Lebensführung, etwa bei der Homo-Ehe, die nicht wenigen führenden Republikanern ein Dorn im Auge ist.
Trump selbst lässt es bei der Abtreibungsfrage nicht zu einer Entscheidungsschlacht im Kulturkampf kommen. So sehr er das Dobbs-Urteil als seine eigene stolze Errungenschaft präsentiert, für die seine christlich-konservativen Anhänger ihn zu Recht feiern, so wenig tritt er als Feind des „pro-choice“-Lagers auf. Melania durfte sogar für ihre eigene „pro-choice“-Neigung öffentlich werben. Nach einigen Windungen verspricht er, sein Veto einzulegen, falls ein republikanischer Kongress ihm ein bundesweites Verbot zur Verabschiedung vorlegen sollte. Gefragt nach dem Grund für die auffällige Unentschiedenheit seiner Selbstdarstellung zwischen Racheengel aller konservativen Hardliner und zurückhaltendem Moderaten, der keiner Frau etwas wegnehmen will, gibt Trump die Antwort: Eine entschiedenere Linie in der Abtreibungsfrage wäre für die Hauptsache, an der jeder Fortschritt der konservativen Sache hängt, schlicht kontraproduktiv: „Das Problem ist, dass man Wahlen gewinnen muss. Sonst wäre man wieder da, wo man angefangen hat.“ (Trump im WABC-Interview, 20.3.24) Das Problem ist auch die Lösung: Trumps Wahlsieg ist schon der entscheidende Sieg im Kulturkampf; mit seiner Regentschaft sind alle wesentlichen Fragen geklärt.
Umso mehr warnen Harris und Walz vor den konservativen Aktivisten, die an Trumps Seite bzw. in seinem Windschatten stehen und seinen erneuten Sieg als ihre zweite große Chance nutzen wollen: Protagonisten einer konservativen Bewegung, die Trump I wortwörtlich als Geschenk des Himmels feiert, sich für einen zweiten Durchgang noch einiges mehr vom selben erhofft und sich für die einschlägigen administrativen, Richter- und Beraterposten in Stellung bringt. Dazu gehört auch und gerade der Vizepräsidentschaftskandidat und designierte „America first!“-Nachfolger J.D. Vance. Vor einigen Jahren zum rechten Flügel der Katholiken konvertiert, wird er sehr deutlich in der Frage, was sich fürs Privatleben seiner Bürger gehört. [12] Genau das ist es im Grunde, woran Amerika aus dieser Perspektive krankt: Die Politik nimmt die Bürger als Volk zu wenig in die Pflicht. Sie behandelt sie als bloße Konkurrenzindividuen, die die Freiheit der ökonomischen Konkurrenz mit der Lizenz zur Selbstverwirklichung verwechseln und die zum Zweck der Gemeinschaft erklären. Das ist asozial bis gemeingefährlich, vor allem ist es ein Verrat an der pflichtbewussten moralischen Mehrheit, der so ihre Freiheit genommen wird: Es ist nicht mehr ihr Land, wenn die Politik nicht mehr für die Gewissheit sorgt, dass sie die tonangebenden Normalos sind. Sich frei fühlen können sie nur, wenn ihre Sittlichkeit die herrschende ist. So fällt das Verlangen nach mehr staatlichen Verboten – z.B. gegen Abtreibung, gegen Gleichberechtigung für und schulische Aufklärung über Homos und Transmenschen – und nach der rücksichtsloseren Unterdrückung von wokem Protest, falls der sich wieder irgendwo regen sollte, mit dem Beharren auf „limited government“ bestens zusammen. Insgesamt eine Lehre über den Zusammenhang von freiheitlicher Sittlichkeit und Gewalt; wieder ein großes Aufräumen im Dienste der Freiheit.
Dagegen präsentieren Harris und Walz ein entschieden liberales Gegenangebot. Das ist erstens gesetzgeberischer Natur: ein bundesweites Recht auf Abtreibung, die Homo-Ehe sowie den gesetzlichen Schutz vor Diskriminierung für Transsexuelle. Angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Kongress macht sich freilich niemand etwas vor über die Chancen auf Realisierung solcher Versprechen. Umso vehementer bekennen sich Harris und Walz zu ihrer persönlichen Liberalität in solchen Privatangelegenheiten, zu ihrer weltanschaulichen und wertemäßigen Nähe zu den amerikanischen Normalbürgern, von denen Trump und Vance die seltsame Abweichung sind, wenn sie den Leuten ausgerechnet in ihren privaten Affären Vorschriften machen wollen und sie verachten, sofern sie ihr Glück nicht gemäß der traditionellen Familienform machen wollen. Damit geben Harris und Walz sich natürlich nicht bloß als Sympathisanten einer freiheitlichen Lebensführung zu erkennen. Sie wollen vielmehr genau damit das stärkste Argument für ihre eigene Vertrauenswürdigkeit als Machtinhaber geliefert haben, deren ganzer Beruf darin besteht, den Leuten Vorschriften zu machen. Auch und gerade, was den Umgang der Frau mit ihrem Körper betrifft: Die Abtreibung soll nicht etwa einfach freigegeben, sondern mit neuen – in Anlehnung an das Urteil in „Roe v. Wade“ – staatlich gezogenen und durchgesetzten Bedingungen versehen werden. Ein schöner Hinweis darauf, was es wirklich heißt, wenn das Private politisch wird: Es wird eben zu einem weiteren Argument, in der Wahlkabine die Zustimmung für den richtigen Machtinhaber abzugeben.
Einen noch schöneren liefert ein konservativer Journalist mit einer Frage, die allen auf den Nägeln brennt: ob Kamala Harris bereit wäre, Geschlechtsumwandlungen für Gefängnisinsassen mit Steuergeldern zu finanzieren. [13] Da ist die Sittlichkeit endgültig dort angekommen, wo sie hingehört. Ob der Journalist es weiß oder nicht, er liefert jedenfalls den fundamentalen Grund dafür, warum „es geht dich nichts an!“ noch nie der Leitfaden einer nationalen Sittlichkeit gewesen ist. Er verweist nämlich darauf, was die amerikanische Wertegemeinschaft jenseits aller Wertehuberei und ideologischen Ausmalungen ihrer Einheit wirklich materiell ist, was deren Mitglieder als Staatsbürger reell aneinander bindet: Sie sind die gemeinsam geschröpfte finanzielle Basis eines Staates. Auch und gerade in ihrem Privatleben sind sie sein Volk. Ihr Wille zur Bewährung als solches – im Beruf, im Privaten, in ihrer politischen Betätigung und natürlich bei der Reproduktion genau der Volksmasse, als die sie sich zu bewähren haben – gehört zu seinen zentralen, gar nicht bloß kulturellen, sondern materiellen Sorgeobjekten, also ganz in seinen herrschaftlichen Kompetenzbereich. Was die gebieterische Frage des journalistischen Fürsprechers der Steuerzahler auch noch zeigt: In einer Demokratie berechtigt die materielle Inanspruchnahme der Bürger durch den Staat sie offenbar zu Ansprüchen, die weit über das Materielle hinausgehen. Vor allem berechtigt sie sie dazu, einen Präsidenten zu wählen, der ihnen sittlich nahe steht, wenn er über sie regiert.
IV. Die Kriege der Nation
Zwei laufende Kriege, die die USA zwar nicht mit eigenen „boots on the ground“ führen, die aber ohne sie nicht zu denken sind. Dazu eine immer heißer werdende Kriegslage um Taiwan, für die dasselbe gilt. Die zweckmäßige Zerstörung von Land und Leuten, deren aktuelle und potenzielle Dimensionen bestens dokumentiert werden, sind nicht zu haben ohne amerikanische Waffen und alle einschlägigen Beihilfen zu ihrer sachgerechten Bedienung; ohne die abschreckende Rückendeckung durch die konventionellen und atomaren Vernichtungspotenzen Amerikas; ohne das Geld, das es mit seinem Weltgeld Dollar und seinen zahlungskräftigen Verbündeten mobilisiert; ohne die wirtschaftspolitischen und diplomatischen Erpressungsmanöver, die es z.B. in Gestalt eines internationalen Sanktionsregimes gegen Russland oder zwecks Abwehr der diplomatischen Schläge vollführt, die in der UNO und an ihren Gerichtshöfen gegen Israel versucht werden. Deswegen lebt das alles von den Freund- und Feindschaftsdefinitionen, über die in der amerikanischen Hauptstadt entschieden wird. Was die Kandidaten ihren Wählern dazu zu sagen haben, interessiert die Welt außerhalb Amerikas naturgemäß am meisten; das gilt auch und erst recht für die europäischen Staaten, die an die Kriegsvorhaben und -potenzen der USA ihre eigenen kriegerischen Berechnungen knüpfen.
Umso auffälliger ist der Kontrast zu der Statistenrolle, die die einschlägigen Auskünfte im amerikanischen Wahlkampf selbst spielen. Dass Trump und Harris die weltweiten Kriege und Kriegslagen, die so entscheidend durch Amerika bestimmt werden, nicht ins Zentrum ihrer Auseinandersetzung stellen, ist freilich nicht damit zu verwechseln, dass sie den Stellenwert dieser Kriege oder ihre diesbezüglichen Differenzen herunterspielen würden. Auch hier geht es ihnen letztlich ums Ganze – um Sein oder Nicht-Sein der amerikanischen Macht in der Welt. Und auch aus der existenziellen Bedeutung der amerikanischen Übermacht für die Kriege der Welt lässt sich eine geeignete Wähleransprache machen, die in beiden Fällen lautet: Den amerikanischen Wählern steht die Rettung bzw. die Katastrophe für die Macht der USA wie für das Leben der Weltbevölkerung zur Wahl.
1.
Das Angebot, das der ehemalige Präsident Trump zu machen hat, wird sehr gerne und sehr zu Unrecht „Isolationismus“ genannt. So reden vor allem die großen europäischen Verbündeten, deren Regierungen sich viel vom außenpolitischen „Engagement“ der US-Macht versprechen, nicht zuletzt die atomare Rückendeckung für ihr eigenes imperialistisches Engagement, für das sie sie offenbar bitter nötig haben. Das befürchtete Ausbleiben bzw. die Unberechenbarkeit der erwünschten Leistungen der amerikanischen Bündnisvormacht werden – denkbar interessiert – mit einem Ausbleiben der amerikanischen Außenpolitik überhaupt gleichgesetzt. Von der Welt isolieren will Trump sein Land natürlich überhaupt nicht; die flächendeckende Benutzung aller Länder für Reichtum und Macht der USA ist der Haupt- und Generalzweck seiner Außenpolitik; davon darf die Welt nicht verschont bleiben. Umgekehrt ist es: Amerika soll von allen Störungen verschont bleiben, die sich bei der lohnenden Inanspruchnahme der Welt bemerkbar machen. Diesen Anspruch richtet Trump ausnahmslos an alle Länder und alle Regierungen der Welt; wie sie sich dazu stellen, scheidet sie in Freund und Feind. Vor allem aber richtet er ihn an die amerikanische Politik selbst: Wenn das Ausland für Amerika und seine weltumspannenden Ansprüche zu einer solchen Störung wird, wenn ein Stück Ausland es überhaupt schafft, Amerika Probleme zu bereiten, dann ist Amerika definitiv selbst schuld daran. Dann hat die US-Führung offenbar den Kardinalfehler begangen, zu schwach zu sein. Anlässe zu diesem Vorwurf findet Trump viele; es ist offenbar nicht wenig, was da von den Staaten und Völkern der Welt gefordert wird. Die eine Variante des Vorwurfs lautet: Amerikas Führer haben sich in Konflikte und Kriegsallianzen hineinziehen lassen, in denen amerikanische Interessen gar nicht auf dem Spiel stehen. Sie haben sich also von Bündnispartnern ausnutzen lassen, die Amerikas Partner offensichtlich nicht sind, wenn sie ihm Kosten und Probleme bereiten. Die Mindestanforderung lautet dann: Wiedergutmachung muss her. Die Partner müssen aus dem Problem eine lohnende Angelegenheit für Amerika machen oder sie werden fallen gelassen.
Im aktuellen Wahlkampf bietet Trump hauptsächlich eine andere Variante dieses Vorwurfs an die US-Politik. In der Ukraine, im Nahen Osten, demnächst womöglich in Taiwan und überhaupt in allen Kriegen, die Amerika stören, sieht Trump immer denselben Missstand: Widerstand gegen amerikanische Ansagen gilt offenbar nicht als zwecklos. Darin sieht er deshalb immer dasselbe Vergehen: Amerikanische Politiker haben Störfälle überhaupt erst entstehen und groß werden lassen, weil sie als zu schwach wahrgenommen werden. „Unsere Feinde respektieren unser Land nicht mehr.“ Das macht Biden und Harris offensichtlich „völlig inkompetent“ (Trump in jedem Interview und bei jeder Kundgebung). Und sollten die Demokraten an der Macht bleiben, wird die Erde bald gar nicht mehr bewohnbar sein; dann gibt es nämlich kein Halten mehr für die Staaten, die Amerikas Schwäche ausnutzen wollen, also für niemanden mehr. Insofern führen die Demokraten das Land und die Welt gerade durch ihre Schwäche „bis an den Rand des 3. Weltkriegs“ (Trump, 2.10.23). Bei dermaßen grassierender Respektlosigkeit bliebe Amerika schließlich keine andere Wahl, als seinerseits die fällige Konsequenz zu ziehen. Das wäre gewiss „sad, so sad“, aber was ist schon eine Welt ohne amerikanisches Gewaltmonopol wert? Zumindest bezüglich der Anforderungen an eine Politik der Abschreckung, die der Supermacht würdig ist, landet Trump somit mitten im Mainstream der amerikanischen Außenpolitik. Auch bei ihm schließt eine erfolgreiche Politik der Abschreckung allemal die Bereitschaft zu Vernichtungsaktionen ein, die jede Frage nach einer lohnenden Benutzung einer erfolgreich befriedeten Staatenwelt ad absurdum führen. Den weltkriegerischen Sachverhalt kann Trump – wie so oft – am besten selbst ausdrücken. Auf die Frage, ob er in der Taiwan-Frage den Einsatz militärischer Gewalt gegen China für notwendig hält, antwortet er: „I won’t need to because Xi respects me and he knows I’m fucking crazy.“ (Wall Street Journal, 18.10.24) Überhaupt hat Trump zu allen Kriegen und Kriegsszenarien, die für Amerika derzeit die Tagesordnung beherrschen, konsequenterweise dieselbe Antwort: Mit ihm hätte es sie nie gegeben. Worauf seine Amerikaner sich also verlassen können: auf jede erforderliche friedensstiftende Vernichtungslust.
Und darüber kann sich auch die ganze Welt freuen. Denn niemand bedauert die Opfer, die in den amerikanisch unterstützten Kriegen anfallen, so sehr wie Trump:
„Es ist so traurig, wenn ich daran denke, dass diese Kriege nie begonnen hätten, wenn ich Präsident wäre. Es gäbe nicht all diese toten Menschen, zerstörten Städte und Gebiete. Es hätte nicht den 7. Oktober gegeben und all die Zerstörung und den Hass, die darauf folgten. Man hätte nie erleben müssen, dass Russland die Ukraine angreift... Das Ausmaß an Tod und Zerstörung in der Ukraine ist unglaublich – schlimmer als die meisten wissen.“ (Trump-Interview bei Al-Arabiya, 20.10.24)
Das Mitleid kann man ihm ruhig abnehmen. In den Opfern sieht er ja vor allem die Schwäche Amerikas, den viel zu geringen Respekt, den die Kriegsparteien vor der vernichtenden Gefahr zeigen, die von Washington ausgeht. Das tut weh.
So lauten die typisch trumpistischen Formulierungen für ein gar nicht bloß trumpistisches imperialistisches Prinzip: das unbedingte Bestehen auf einem alternativlosen, unanfechtbaren amerikanischen Gewaltmonopol als Bedingung für gedeihliche zwischenstaatliche Beziehungen, die Amerikas Nutzen garantieren. Das ist definitiv parteiübergreifender Konsens. Trumps Besonderheit besteht einzig darin, wie sehr er diesen traditionsreichen imperialistischen Anspruch und den Respekt davor auf eine für US-Präsidenten ungewöhnliche Weise personalisiert: Respektbezeugungen ihm gegenüber sind Gradmesser des Respekts, der Amerikas Übermacht gezollt wird. Den Stand der diplomatischen Beziehungen – auch und gerade mit den offiziellen Rivalen – formuliert Trump für gewöhnlich in unterschiedlichen Mischungsverhältnissen als Lob dafür, dass und wie sehr die Herrscher der Welt mit ihm per du verkehren, und als Klarstellung, dass und wie sehr sie von seiner Gefährlichkeit eingeschüchtert sind.
Im Einzelfall kann dieser Standpunkt alles Mögliche bedeuten; lässige Unbestimmtheit gehört programmatisch dazu. Was Trump seinen Wählern auf jeden Fall verspricht, sind sofortige, erfolgreiche Ergebnisse an zwei entscheidenden Fronten:
- Den Ukraine-Krieg will er am Tag nach der Amtseinführung beenden. Das kann bedeuten, den ukrainischen Stellvertreter sofort auf einen amerikadienlichen Frieden zu verpflichten. Das befürchten jedenfalls diejenigen, die darin zu Recht jedes Bekenntnis zur territorialen Integrität der Ukraine vermissen wie überhaupt zu jedem hohen Wert, mit dem die Biden-Regierung der Ukraine ihre „unerschütterliche Unterstützung“ zusichert und diese bislang materiell beglaubigt. Eine Parteinahme für Russland, die in Trumps Freundschaftsbekenntnissen zu Putin und in seiner gut dokumentierten Bewunderung für dessen „Scharfsinn“ gerne entdeckt wird, steckt definitiv nicht darin. Der Frieden, den Trump blitzschnell haben will, besteht eher in der einvernehmlichen Kapitulation beider Seiten. Das bekräftigt Trump mit der Versicherung, er habe vor einigen Jahren Putin gedroht, Moskau selbst zu bombardieren, falls der in die Ukraine einmarschiert, [14] sowie mit der Warnung, weitaus mehr und tödlichere Unterstützung an die Ukraine zu liefern, falls Putin sich nicht Amerikas Willen fügt. Auf der Basis des wiederhergestellten Respekts beider Seiten vor Amerika lässt sich effizient verhandeln und ein schnelles Ergebnis erzielen. Diese Gewissheit amerikanischer Überlegenheit drückt Trump stilgerecht als den persönlichen Respekt aus, den er bei beiden Präsidenten genießt: „Ich habe eine sehr gute Beziehung zu Putin.“ (8.10.24) „Ich habe eine sehr gute Beziehung zu Selenskyj.“ (27.9.24) Die Hauptsorge der hiesigen Politiker und Journalisten in Bezug auf Trumps Pläne für die Ukraine betrifft seine Pläne bzw. demonstrative Verachtung für die NATO. Wenn er das berühmte 2%-Versprechen als eine Zahlungspflicht behandelt, die die europäischen Bündnispartner gegenüber Amerika haben, dann beschweren die sich über das „Schutzgeld“, das ihnen auf die Art abgepresst werden soll. Das gilt als Schimpfwort, weil man souveräne Partnermächte doch nicht so behandeln darf; weil es der edlen Angelegenheit unwürdig ist, wenn man sich bei den Ausgaben für die Vernichtungspotenzen des größten Militärbündnisses der Menschheitsgeschichte wie ein Mafioso aufführt. Der solide Vorbehalt, den Trump gegenüber der NATO pflegt; die wiederholten Beteuerungen, Amerika sei eigentlich schon dabei, sich zum Ausgang zu bewegen – das passt zwar nicht zum Selbstverständnis dieser Allianz, auch nicht von Amerika her. Doch damit liefert Trump im Wahlkampf immerhin eine Klarstellung darüber, was immer Grundlage und Kern amerikanischer Allianzen sein wird, wie leidenschaftlich auch immer die amerikanische Verbundenheit zu den Partnern zelebriert wird: die Benutzung der Verbündeten für das, was Amerika auf die Tagesordnung setzt. Bei Trump gilt eben: Honesty is the best policy. Noch ist der Austritt aus der NATO nicht verkündet worden. Und laut Trump ist es sogar gerade seine jederzeitige Bereitschaft, diese Allianz im Falle fortgesetzter Säumigkeit zu kündigen, was die Mitglieder enger denn je zusammenschweißen könnte. Auch hier kommt Trump auf ein Gründungsmoment der amerikanischen Weltordnung zurück: auf die unanfechtbare, einzigartige militärische Überlegenheit der USA – dies freilich gegen die Weise, wie Amerika sie bislang immer bewerkstelligt hat.
Im Nahen Osten will Trump ebenfalls einen richtig friedlichen Frieden, nämlich einen dauerhaften:
„Ich möchte, dass das alles aufhört. Ich möchte, dass im Nahen Osten wieder Frieden herrscht, aber ein echter Frieden, ein Frieden, der von Dauer ist. Man will doch nicht, dass der Krieg alle zwei, fünf, zehn Jahre so weitergeht.“ (Interview bei Al-Arabiya, 20.10.24)
Trumps Verlautbarungen bzw. Andeutungen zufolge bedeutet das zunächst, dass Israel uneingeschränkte Freiheit und amerikanische Unterstützung für alle angedrohten und angekündigten kriegerischen Eskalationen gegen seine Feinde braucht, die schließlich auch Feinde Amerikas sind. Die Forderungen nach einem baldigen Frieden, wie Biden und Harris ihn sich vorstellen und zugutehalten, definiert Trump derzeit als unerträgliche, existenzielle Gefährdung für Israel. Auf die Frage, was er sich zur Eventualität israelischer Bombenangriffe auf den Hauptfeind Iran denkt, antwortet er mit dem freundlichen Tipp: „Zuerst das iranische Atomprogramm angreifen und sich später um den Rest kümmern“. Wenn jeder militante Widerstand gegen Israels Übermacht in der Region endgültig zwecklos gemacht wird, steht dem Frieden mit seinen gedeihlichen Geschäftsmöglichkeiten nichts mehr im Weg. Ein totaler Erfolg des israelischen Kriegsprogramms, das wegen amerikanischer Schwäche leider Gottes nötig geworden ist, wäre auch das Beste, was man für die Palästinenser und alle anderen Nachbarn tun könnte. Diese Versicherung amerikanischer Solidarität mit dem Vernichtungsfeldzug Israels ist zugleich eine gebieterische Anforderung: Israel muss sein Kriegsprogramm schnell und erfolgreich zu Ende führen; auch für diesen „special friend“ gilt das Dogma, dass es Störungen für Amerika zu beseitigen hat, also keine verursachen darf. Trump ist da vorläufig sehr optimistisch: Netanjahus Anbiederung an ihn gibt ihm guten Grund dazu; dem entspricht umgekehrt Trumps Respekt für die notorische Intransigenz des Chefs dieses für Amerika äußerst nützlichen Juniorpartners.
Was Trumps außenpolitischer Leitfaden für diese Kriege und diese Nationen aber tatsächlich heißt, ist eine ganz andere Frage. Die regionalen Akteure und alle anderen werden es erfahren, wenn Trump so weit ist, auf keinen Fall davor – deren tiefste Verunsicherung ist eine der wenigen festen Konstanten seines Programms.
2.
Genau das ist es im Kern, was Harris an Trumps außenpolitischen Versprechungen so verwerflich findet. Sein „America first!“ droht zu einem „America alone!“ zu führen. Und das macht Amerika, so einzigartig mächtig es auch sein mag, zu klein und zu schwach. Mit seiner großkotzigen außenpolitischen Angeberei ist Trump selbst der erste und größte Schwachpunkt:
„Die Staats- und Regierungschefs der Welt halten Donald Trump für ein leichtes Ziel – leicht zu manipulieren durch Schmeicheleien oder Gefälligkeiten. Autokraten wie Putin und Kim Jong Un drücken ihm bei dieser Wahl die Daumen.“ (Harris auf X, 30.10.24)
Ein Ende des Kriegs in der Ukraine kommt so lange nicht infrage, wie es mit einer ukrainischen Niederlage gegen Russland einhergeht. Die dazugehörige Zerstörung an Land und Leuten sind dagegen kein Einwand, sondern die Schuld Russlands. Der Krieg und seine Opfer sind auch kein Ausdruck amerikanischer Schwäche, sondern eine bleibende Herausforderung an Amerikas einzigartige Stärke; die Wiederherstellung seiner Suprematie gegen „revisionistische Mächte“ wie Russland und China macht ukrainische Opfer nötig und sogar lohnend, weil sie ein Beitrag zur Ruinierung der russischen Fähigkeit sind, Amerikas Monopol aufs Weltordnen anzufechten. Der 3. Weltkrieg, vor dem Trump die Wähler warnt, wenn die Demokraten am Ruder bleiben, droht insofern so lange, wie Russland in der Lage bleibt, ihn zu führen. Darin, dass Amerika seine einzigartige Stärke zunächst seinen einzigartigen – konventionellen wie atomaren – Zerstörungspotenzen verdankt, ist Harris sich mit Trump einig; in dem Sinne verspricht sie, dass Amerika unter ihrer Führung weiterhin „die stärksten, tödlichsten Streitkräfte der Welt“ haben wird. Worin ihre Alternative sich von Trump entschieden abgrenzt, ist der Beitrag, den Amerikas Allianzen – die NATO an erster Stelle – zur amerikanischen Übermacht leisten, gerade weil Amerika sich so fest an sie bindet: als Schutz- und Führungsmacht von Partnern, die die Reichweite, Durchschlagskraft und stabile Geltung der amerikanischen Ordnungsmacht potenzieren. Den Kosten, die solche Bindungen zweifellos bedeuten, steht insofern ein Nutzen gegenüber, der unverzichtbar bleibt, solange Amerika die Weltordnung mit seinem Namen versehen will. Wenn Amerika die einzigartige Supermacht bleiben will – und das will es doch, es wäre doch sonst überhaupt nicht mehr Amerika –, dann ist die punktuelle Erzwingung von Respekt und Gehorsam, sind wüste persönliche Drohungen innerhalb von Männerfreundschaften zwischen starken Führern eine viel zu wacklige Grundlage.
Trump ist demnach der Inbegriff eines Politikers, der sich von Freunden wie Feinden übers Ohr hauen lässt; das Gegenteil der unerschütterlichen Stärke also, die die wichtigste persönliche Eigenschaft, weil höchste Pflicht eines amerikanischen Präsidenten ist: Die Personalisierung der Außenpolitik, Abteilung kriegerische Abschreckung, findet Harris offenbar überhaupt nicht absurd, im Gegenteil. Als das entsprechende Gegenbild bietet sie sich selbst an: eine taffe Staatsanwältin, die sich mit der Bestrafung von Verbrechern von Berufs wegen auskennt. Genau das Richtige angesichts dessen, dass die aktuelle Aufgabe der amerikanischen Außenpolitik darin besteht, sich als eine Macht durchzusetzen, gegen die Widerstand zwecklos ist.
- Dass Amerika zu seinen Bündnispartnern steht, sich aber nicht vor deren Karren spannen lässt, ist die salomonische Botschaft, mit der Harris in Bezug auf den Krieg Israels im Gazastreifen, im Libanon etc. pp. Wahlkampf macht. Israel hat das Recht, sich zu verteidigen, Amerika hat also die Pflicht, ihm die Mittel zu liefern, mit denen es sich mit der Vernichtung von ganzen Küstenstreifen und Landesteilen sowie mit entwaffnenden Schlägen gegen Feinde in der näheren und ferneren Nachbarschaft, insgesamt also sehr offensiv und ausgreifend, verteidigt. Mit jedem Stück Zerstörung kann und soll der amerikanische Bürger sehen, wie nötig Israel die einzigartigen Zerstörungspotenzen der USA hat. Was freilich überhaupt nicht heißt, dass Amerika sich für den Schutz der produzierten Opfer nicht verantwortlich fühlt – genau das verspricht Harris den arabisch-amerikanischen Wählern im Swing State Michigan, für die ausnahmsweise die Kriegspolitik der USA das entscheidende Thema des Wahlkampfs ist: Deren Proteste gegen Verwüstung und Völkermord im Nahen Osten und gegen eine amerikanische Regierung, die dazu Beihilfe leistet, ohne die das alles nicht zu denken wäre, greift Harris als eine Forderung nach noch mehr amerikanischer Führungsstärke auf. Die verspricht sie ehrlich und aus vollem Herzen.
V. Worauf alle Sachthemen hinauslaufen: Kampf um die Demokratie
Ausweislich der Sachthemen und ihrer weltweiten Bedeutung haben die amerikanischen Wähler bei der Wahrnehmung ihres demokratischen Hauptrechts dieses Jahr eine besonders gewichtige Entscheidung zu treffen. Dabei legen beide Kandidaten gleichermaßen Wert darauf, dass es sogar um noch viel mehr geht: Gewinnt der Falsche, stirbt die Demokratie.
1.
Die Kandidaten sind da zueinander sehr ungerecht. Gerade bei den Sachthemen, mit denen sie sich um die Wähler bemüht haben, sind beide vorbildlich demokratisch vorgegangen. Sie haben sie nämlich so thematisiert, dass alles auf dasselbe hinausläuft: auf überhaupt keine Entscheidung in irgendeiner Sache, sondern auf eine über die Person, die federführend zu bestimmen hat, was bei allen Haupt- und Nebenthemen Sache ist – offiziell gültig, herrschaftlich verbürgt. Jede individuelle Lebenslage, jede ökonomische Machtposition und Abhängigkeit und jeder Gegensatz dabei; jeder private Katalog an Meinungen zur nationalen Identität des amerikanischen Einwanderungslands, dazu, was Amerikaner in ihrem Privatleben und mit ihren Geschlechtsorganen dürfen, sowie dazu, was Amerikas Interessen und Verantwortung in der Welt sind – das alles haben die Kandidaten gemäß dem nationalen Wappenspruch „e pluribus unum“ zum immer selben Ergebnis geführt: Ein Volk braucht nationale Führung, der es Gefolgschaft leistet.
Aber nicht nur das. Diesen Bedarf des Volkes nach guter herrschaftlicher Macht, diese Quintessenz aller Sachthemen in der Demokratie, haben beide Kandidaten ihren Wählern noch einmal extra dringend ans Herz gelegt – eben in Gestalt der Beteuerung, dass die Herrschaft nur dann eine des Volkes bleiben kann, wenn man selbst an die Macht kommt. Dass die Potenz und Intaktheit des Machtapparats auf dem Spiel stehen und das Votum der Wähler sich darum zu drehen hat: das ist eine sehr selbstbewusste Ansprache an das amerikanische Wahlvolk. Offensichtlich gehen die Kandidaten schlicht davon aus, dass sie die Aufgabe aller demokratischen Parteien in der Demokratie – das, was man im deutschen Grundgesetz die „politische Willensbildung des Volkes“ nennt – meisterhaft erledigt haben. Gemeint ist damit der erfolgreiche Abschluss eines Ausbildungsgangs, der im Wahlkampf gerne mit der Frage beginnt: „Wie würdest du es machen, wenn du Präsident wärest?“ Die Frage ist eine Einladung zu einer gewussten Einbildung. Der Wähler soll sich bei seiner Wahlentscheidung das exakte Gegenteil von dem vorstellen, was der Wahlakt für ihn wirklich bedeutet: die Abgabe von Entscheidungskompetenz, und zwar von einer, die er sowieso nie hatte. In einer ordentlichen Demokratie stellt sich nicht die Herrschaft auf den Standpunkt des Volkes, sondern umgekehrt: Die Wähler stellen sich auf den Standpunkt der Machthaber, die über sie regieren. Sie sollen auf die kapitalistischen, innen- und außenpolitischen Zwecke, auf die sie von der Staatsmacht verpflichtet werden und für die sie sich in der Wirtschaft, als Steuerzahler, als Familienoberhäupter, als Soldaten usw. nützlich machen sollen, einmal so schauen, als wären sie etwas ganz anderes: eine Ansammlung von – finanziellen, rechtlichen, politischen, militärischen – Möglichkeiten und Grenzen für das, was sie sich von der Staatsmacht versprechen. Und bei allem, was sie sich von ihr versprechen, sollen und brauchen sie nur an das Eine denken, auf das es für alles ankommt: Die Macht selbst muss funktionieren. Und die braucht vor allem einen Machtmenschen, der dieses Essential aller Bürgerwünsche am besten verkörpert.
2.
Dass die amerikanischen Bürger eine in diesem Sinne perfekt politisierte Wählerschaft sind: davon gehen Harris und Trump jedenfalls aus, wenn sie ihnen die Macht selbst – deren Potenzen, deren Funktionstüchtigkeit – als Hauptsorge nahelegen.
Das Harris-Lager geht dabei mit dem erkennbaren Selbstbewusstsein zu Werk, die demokratischen Institutionen und Verfahrensweisen gegen die autoritäre Gefahr eines regierenden Egomanen zu verteidigen. Von Bidens eindringlichen Warnungen vor einem Mann, der bei einem erneuten Wahlsieg die Demokratie – und damit alles Schöne und Wahre, das daran hängt – zugrunde richten würde, schwenkt die Harris-Walz-Kampagne zwischenzeitlich auf die lockere Verachtung eines Irrläufers um, den jeder, der einigermaßen bei Trost geblieben ist, zu „weird“ fürs Präsidentenamt finden müsste. Je näher der Wahltag rückt und je klarer wird, dass der coole Umgang mit dem bedauerlichen Wahnsinnigen bei den Wählern nicht so richtig zieht, desto mehr kehrt man zu den drastischen Warnungen zurück; auf der Zielgeraden wird dann das Schlüsselwort „Faschist!“ mehrmals zum Einsatz gebracht. Die angesprochenen Bürger sollen dabei natürlich an die eigene potenzielle Betroffenheit an welcher Stelle auch immer denken, wenn Trump die werten Institutionen der demokratischen Staatsgewalt künftig ins Wanken bringen wird. Harris hilft ihnen darin gerne mit Verweisen auf Trumps Positionen nach, die er zu allen Sachthemen einnimmt und bei deren Durchsetzung er gewiss keine Grenzen kennen wird – um dann stets beim Wesentlichen zu landen: Es geht ihm mit seinem autoritären Gehabe nie um das Volk, nur um sich! Den Bürgern fügt er damit einen doppelten Schaden zu: Im Interesse seines eigenen Machterhalts spaltet er das Volk, macht es schwächer; und er ruiniert die Macht selbst, zerstört also genau das, was die Bürger als ihr oberstes wohlverstandenes Eigeninteresse anzusehen haben. Dagegen präsentiert Harris sich als die korrekte Antwort auf die Frage: „Wie würdest du es als Präsident machen?“ – nämlich die Macht so ausüben, dass das Volk zusammengeführt wird; mit Respekt vor der Würde aller Amerikaner und vor allem vor der demokratischen Korrektheit, die deren Herrschaftsinstitutionen brauchen, um ordentlich zu funktionieren. Dadurch wird das Volk mehr denn je zu einer unerschütterlichen Basis für eine Staatsmacht, die darüber erst recht stark wird. So funktioniert die Obrigkeit, derer die wahrhafte Freiheit bedarf, mit amerikanischer, nämlich gewohnt vorbildlicher Perfektion.
Dass Trump wiederum eine Gefahr für die Demokratie ist, weiß jeder. Von den politischen und journalistischen Wächtern der Demokratie dort wie hier darf man das mindestens zweimal am Tag erfahren. Beweismittel gibt es genug: Der investigative Journalismus muss da nicht tief, eigentlich überhaupt nicht graben. Trump selbst ist bekanntlich nicht schüchtern – weder in der Frage, wozu er alles bereit gewesen wäre, um den einzigen Wahlausgang zu sichern, den er als legitim akzeptieren würde, noch in der Frage, was er mit der wiedererrungenen Macht in einer neuen Amtszeit anfangen will. Gefragt, ob er seine einschlägigen Sprüche im Wahlkampf – „Ich werde kein Diktator sein – außer am ersten Tag“, „Der wahre Feind der Nation ist der Feind im Innern“, „Der 6. Januar war ein Fest der Liebe“ etc. – wirklich ernst meint, hat er immer nachgelegt. Er besteht nämlich darauf, dass man sich da nicht täuscht: Seine Feindschaft gegen seine Widersacher und alle – Bürger wie Politiker –, die sich seinem Willen nicht fügen, ist genuin. Seine Entschlossenheit, bei der praktischen Erledigung solcher Feinde der Nation keine Tabus zu kennen, sie vielmehr extra finden und brechen zu wollen, ist seine liebste Angeberei. Seine Skrupellosigkeit beweist seinen unerschütterlichen Willen, den Umsturz wirklich durchzuführen, den er zur Rettung seines Volkes verspricht, und sich dabei von nichts und niemandem irritieren zu lassen. Auch über das praktische Drehbuch für die Vollendung der amerikanischen Demokratie zu einem ausführenden Organ seines Führerwillens hat er nie Zweifel aufkommen lassen. Geplant ist die „Institutionalisierung des Trumpismus“ durch den Umbau staatlicher Institutionen zu seinen willfährigen Vollstreckern. Schon fertig ist die Verwandlung der republikanischen Partei in eine loyale Trump-Gefolgschaft. Die soll ihre Mehrheit in den gesetzgebenden Körperschaften nutzen, um den Willen des Volkspräsidenten in gültiges Recht zu übersetzen. Wer in der Partei Positionen vertritt, die Trumps Vorgaben widersprechen, begeht politischen Selbstmord. Fertig vorbereitet ist der Austausch des leitenden Personals der Exekutive durch Loyalisten, die den Verwaltungsapparat zum verlässlichen Transmissionsriemen von Trumps Anweisungen machen. [15]
Zum Programm gehört die Unterordnung des Justizministeriums unter Trumps Direktive: In Verbindung mit der weiteren Besetzung von Richterstellen durch verlässliche Gesinnungsgenossen auf allen Stufen der juristischen Hierarchie wird die dritte Gewalt im Staat zu einem verlässlichen Partner der zweiten. Die erste Aufgabe der Justiz besteht darin, Trumps giftige Anklage praktisch gültig zu machen, dass alle Verfahren gegen ihn – gerade wegen seines Versuchs, das Wahlergebnis von 2020 ungültig zu machen – nichts als eine politische „Hexenjagd“ sind. Rache erwartet die Staatsanwälte, die ihn angeklagt haben, und alle, die diese Anklage in Politik und Medien gestützt haben. Gerade letztere haben sich als Feinde des Volkes erwiesen, weil sie es um die Wahrheit betrogen haben, dass Trump stets Recht hat. Trumps Volksherrschaft ist erst vollendet, wenn jeder wirksame Einspruch gegen seine Macht und deren Gebrauch auf Dauer ausgeschaltet ist. Das hat er seinem Volk als „Endkampf“ um dessen Befreiung von der liberalen Elite fest versprochen. Die passenden Hardliner für die Durchführung seines Kampfprogramms sind schnell gefunden, die Richtigkeit seiner Postenvergabe wird durch das Entsetzen der liberalen Öffentlichkeit und Teile seiner eigenen Partei abermals bestätigt; ob er sich dabei die Kompetenz des Senats, seine Personalentscheidungen offiziell zu bestätigen, überhaupt gefallen lassen will, steht noch aus.
Da staunt die US-Öffentlichkeit nicht schlecht. Zwar auch über die Offenheit, mit der Trump seinen Autoritarismus nicht bloß als den Stil, sondern als den ganzen Gehalt seiner Präsidentschaft anpreist. Aber vor allem – erst recht nach seinem Wahlsieg – über den Erfolg, mit dem Trump seine Werbekampagne betrieben hat. Nehmen die amerikanischen Wähler ihn etwa nicht ernst? Oder ist es ihnen egal? Oder wollen sie das auch so? Auch auf diese Fragen sieht die demokratische Wahl eine klare Antwort nicht vor. Aber inzwischen hat sich die Öffentlichkeit zu dem durch Umfragen gestützten Befund vorgearbeitet, dass die Wähler es so sehen, wie Trump es gesehen haben will: Eine kritische Masse an Wählern sieht in Trump nicht nur keine Gefahr für die Demokratie, sondern deren Retter. Und zwar vor genau den Politikern, die die Verteidigung der Demokratie auf den Schild gehoben haben – als einziges Thema, bei dem sie bis zuletzt dachten, sich einer Mehrheit sicher sein zu können. Und nun das: ein Proto-Faschist als Retter der Demokratie – wie kann das sein?
Auch das darf man zweimal am Tag erfahren: Trump habe den weitverbreiteten, von den Demokraten sträflich unterschätzten Groll der amerikanischen Bevölkerung gegen die politischen Eliten und Institutionen des Landes verstanden. Das gilt Demoskopen zufolge erst recht für die Mitglieder der stolzen Arbeiterklasse, die die Demokraten immer noch als ihr gesichertes Stimmvieh verplanen, während sie sie in ihrer fortschreitenden Verelendung seit Jahren vernachlässigen. Für ihre seit Jahrzehnten beklagte Verelendung habe Trump eine Deutung angeboten, die enttäuschten Bürgern eben zusage: Das politische Establishment hat sie verraten, also brauchen sie einen starken Mann, der gründlich aufräumt – sowohl mit rechtsstaatlich eingebauten Hindernissen fürs Durchregieren als auch mit Partikularinteressen, die einer korrupten politischen Elite wichtiger sind als das Verlangen einer patriotischen Bevölkerung nach ihrem Vorrecht gegen alle Fremden und alles Abweichende. Ein Politiker, der sich mit seiner Feindschaft gegen die Eliten als Rächer der Entrechteten präsentiert, komme da gut an – da kennt sich der politische Sachverstand aus.
Da sollte man doch lieber selbst einmal staunen: darüber, wie leicht und – bei aller verächtlichen Distanzierung – wie verständnisvoll Berufsdemokraten diese denkbar affirmative, erznationalistische Umdeutung kapitalistischer Schadensfälle nachzeichnen; darüber, wie vertraut ihnen der Faschismus als Radikalisierung einer in der Demokratie stets präsenten, offenbar kinderleicht zu mobilisierenden Unzufriedenheit mit der Demokratie ist; und wie wenig sie die Verwandtschaft zwischen dem System der Freiheit und dem der Anti-Freiheit gelten lassen wollen, die sie ihrem Publikum vorbuchstabieren.
Denn tatsächlich ist der Standpunkt von Trump genauso wie die Zustimmung seiner Wähler zu ihm die Vollendung einer beeindruckenden demokratischen Politisierung. Trump bietet nämlich die denkbar grundsätzlichste Antwort auf die Grundfrage, mit der die Wähler zur Wahrnehmung höherer, nationaler Verantwortung gerufen werden: „Was würdest du als Präsident machen?“ Seine Antwort heißt schlicht: dafür sorgen, dass die Macht, die dem treuen Volk zu dienen hat, wirklich eine fraglos durchsetzungsfähige Macht ist. Ein Volk, das wirklich herrscht, braucht also das uneingeschränkte Recht eines Präsidenten, der sich mit ihm uneingeschränkt einig erklärt. Dass Trump selbst dieser wahrhafte Mann des Volkes, also der zu diesem Herrschaftsprogramm passende Machtmensch ist, beweist nichts so schlagend wie seine Lust, sich Feindschaften nicht bloß einzufangen, sondern sie offensiv anzusagen: gegen innere und äußere Feinde, auch und gerade gegen die etablierten Institutionen, die ihm zufolge den einheitlichen Willen des Volkes verwässern bis verhindern. Trump verkörpert so das Recht des Volkes auf einen politischen Umsturz, der die Macht des guten Volkes endlich ganz in die Hände ihrer regierenden Personifizierung legt. Oder kurz und bündig: „Trump will fix it“ – kein Problem, für das resolutes Herrschen nicht die Lösung wäre. Nicht so, dass der Präsident den Bürgern hemmungslos zu Dienste steht, sondern umgekehrt so, dass er mit der herrschaftlichen Perspektive ernst macht, zu der er alle Einzelinteressen hinpolitisiert. Der Wille des Volkes ist die Durchsetzung des Staates gegen alle Feinde und Abweichungen, ist die Entmachtung der Institutionen, die genau das verhindern. So ruft die Lehre, die Trump aus seiner ersten Amtszeit gezogen hat, nach einem Echo von unten: Er hatte zu wenig Macht, seine Feinde zu erledigen.
Ob das schon faschistisch oder gerade noch demokratisch ist, ist die falsche Frage – dafür sind die Verfassungsschutzbehörden demokratischer Heimatländer die Zuständigen. Man sollte lieber einmal die Leistungen würdigen, zu denen die mächtigste Demokratie auf dem Globus offenbar fähig ist – zumal die Warnung überall zu haben ist, dass Amerika in puncto politischer Sitten eher Vorbote als Ausnahme ist. Die eine Leistung betrifft die Durchsetzung der Herrschaft: Dort bringt die Demokratie einen Führer an die Macht, der unerbittlich darauf besteht, allein seine Macht könne die Nation vor „Feinden im Innern“ retten, die er ausschalten wird – falls nötig auch unter Einsatz des Militärs. Die andere Leistung betrifft die Bildung der Bürger zu Volksgenossen, die im stolzen Selbstbewusstsein, die freiesten Menschen der Welt zu sein, auf ihrem Recht auf die uneingeschränkte Macht für den Führer ihrer Wahl bestehen.
[1] Diese Abhängigkeit kriegführender wie von Krieg betroffener, also aller Souveräne weltweit, von der Weltsupermacht USA nehmen die interessierten Öffentlichkeiten gerade der großen europäischen Mächte zum Anlass für eine seltsame Beschwerde. Sie stöhnen über die Ungerechtigkeit, dass so vieles von so wenigen abhängt: Nicht weniger als der Weltfrieden – so wird der Kriegserfolg der eigenen Seite getauft – hängt von einigen tausend Wählern in amerikanischen Swing States ab? Zu einem ernst gemeinten Einspruch kommt es dabei natürlich nicht – wo sollte der auch eingereicht werden. Keine Bremse, offenbar eher ein Stachel ist das für den demokratischen Idealismus, sich ausgerechnet die Abhängigkeit von einer überlegenen Weltmacht als Anspruchstitel auf Mitbestimmung zu imaginieren – je näher der Wahltag, desto intensiver, erst recht nach dem Sieg des Falschen.
[2] Vgl. „Ein heißer Wahlkampfsommer in den USA: Was muss ein amerikanischer Präsident können und sein?“ in GegenStandpunkt 3-24, S. 117 ff.
[3] „Trump hat während seiner Amtszeit umfassende Zölle auf chinesische Produkte im Wert von etwa 300 Milliarden Dollar eingeführt. Joe Biden hat diese Zölle beibehalten und Anfang des Jahres beschlossen, einige der Zölle auf chinesische Importe im Wert von etwa 15 Milliarden Dollar zu erhöhen. Die Art der Produkte, für die die Zölle nun erhöht werden, steht im Einklang mit Bidens anderen wirtschaftspolitischen Maßnahmen, die darauf abzielen, die heimische Produktion in Branchen wie saubere Energie und Halbleiterchips zu fördern. Ab dem 27. September werden die Zölle auf 100 % für Elektrofahrzeuge, 50 % für Solarzellen und 25 % für Batterien für Elektrofahrzeuge, kritische Mineralien, Stahl, Aluminium, Gesichtsmasken und Containerbrücken angehoben. Zollerhöhungen auf andere Produkte, einschließlich Halbleiterchips, sollen in den nächsten zwei Jahren in Kraft treten.“ (CNN, 13.9.24)
[4] An der Stelle reden die Demokraten gerne von einem „kleinen Hof mit einem hohen Zaun“, um – gerade im Gegensatz zu Trumps Drohungen – den chirurgischen Charakter ihres antichinesischen, also freiheitlichen Protektionismus auszudrücken. Im kleinen Hof liegen dann genau die Industrien, mit denen Amerika die Kommandohöhen der gesamten ökonomischen und der militärischen Konkurrenz von morgen beherrschen will.
[5] Zu dieser Liste an projektierten Maßnahmen vgl. den Artikel Sachdienliche Auskünfte zur Modernisierung des amerikanischen Imperialismus in GegenStandpunkt 1-23, S. 45 ff.
[6] „Auf die Frage der CNN-Moderatorin Dana Bash, ob die falschen Gerüchte über Springfield, Ohio, ‚eine Geschichte waren, die Sie erfunden haben‘, antwortete Vance: ‚Ja!‘ Er sagte, er habe das Bedürfnis, ‚Geschichten zu erfinden, damit die ... Medien dem Leiden des amerikanischen Volkes tatsächlich Aufmerksamkeit schenken‘.“ (The Guardian, 15.9.24)
[7] „Trump und seine Stellvertreter haben nur spärliche Angaben dazu gemacht, wie er die ‚größte Abschiebeaktion in der amerikanischen Geschichte‘ durchführen würde, haben das Ziel aber als oberste Priorität bezeichnet. Was bekannt ist: Die Strategie würde sich auf militärische Truppen, befreundete staatliche und lokale Strafverfolgungsbehörden und Kriegsbefugnisse stützen. ‚Niemand darf sich sicher fühlen‘, sagte Tom Homan, Trumps ehemaliger Leiter der Einwanderungs- und Zollbehörde [nun als Grenzschutzbeauftragter nominiert],im Juli. ‚Wenn Sie sich illegal im Land aufhalten, sollten Sie besser über Ihre Schulter schauen.‘ Auf einer Wahlkampfveranstaltung Anfang des Monats sagte Trump, er werde sich auf das Gesetz gegen ausländische Feinde von 1798 berufen, um jedes kriminelle Netzwerk von Migranten, das auf amerikanischem Boden operiert, ins Visier zu nehmen und zu zerschlagen. Er sagte weiter, er werde ‚Elitetruppen‘ von Bundespolizisten entsenden, um jedes Mitglied einer Migrantenbande ‚zu jagen, zu verhaften und abzuschieben‘. Diejenigen, die versuchen, in die USA zurückzukehren, würden zu 10 Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt, sagte er und fügte hinzu, dass jeder Migrant, der einen US-Bürger oder einen Vollzugsbeamten tötet, mit der Todesstrafe rechnen müsse. Im Mai erklärte Trump gegenüber dem Time Magazine, er werde 15 bis 20 Millionen Menschen ins Visier nehmen, die sich illegal in den USA aufhalten. Das überparteiliche Pew Research Center schätzt die tatsächliche Zahl auf etwa 11 Millionen im Jahr 2022. Seitdem sind mehr als 2 Millionen Menschen illegal ins Land gekommen. ‚Fangen wir mit 1 Million an‘, sagte Vance im August gegenüber ABC News.“ (Los Angeles Times, 24.10.24)
[8] Das Gesetzesvorhaben besteht vor allem in der massiven Verstärkung des Grenzschutzes, dem Ausbau der Asylhaftkapazitäten und der schnellen Bearbeitung von Asylanträgen mitsamt Abschiebungen.
[9] „Präsident Biden erließ am Dienstag eine Executive Order, die Migranten daran hindert, an der Grenze Asyl zu beantragen, wenn die Zahl der Grenzübertritte stark ansteigt... Die Maßnahme ist die restriktivste, die von Biden oder einem anderen modernen Demokraten eingeführt wurde, und erinnert an einen Versuch von Präsident Donald J. Trump im Jahr 2018, die Migration zu unterbinden. ‚Wir müssen uns einer einfachen Wahrheit stellen‘, sagte der Präsident. ‚Um Amerika als ein Land zu schützen, das Einwanderer willkommen heißt, müssen wir zuerst die Grenze sichern, und zwar jetzt.‘ Die Maßnahme tritt in Kraft, sobald der Sieben-Tage-Durchschnitt der täglichen illegalen Grenzübertritte 2500 erreicht – was jetzt regelmäßig der Fall ist. Die Grenze wird erst dann wieder geöffnet, wenn die Zahl sieben Tage hintereinander auf 1500 sinkt und zwei Wochen lang auf diesem Niveau bleibt. Dies ist eine erhebliche Veränderung der bisherigen Asylpraxis. Normalerweise werden Migranten, die die Grenze illegal überqueren und Asyl beantragen, in die Vereinigten Staaten gelassen, wo sie auf einen Gerichtstermin warten, bei dem sie ihren Fall vortragen können. Das neue System soll von solchen illegalen Übertritten abhalten. Mit der Anordnung werden die langjährigen Garantien, die jedem, der US-Boden betritt, das Recht auf einen sicheren Zufluchtsort geben, größtenteils außer Kraft gesetzt. Die Exekutivmaßnahme spiegelt die Gesetzgebung wider, die von den Republikanern im Februar mit der Begründung blockiert wurde, sie sei nicht stark genug.“ (New York Times, 4.6.24)
[10] Vgl. den Artikel Heimatschutz mal anders: Amerika streitet über seine Familienwerte in GegenStandpunkt 4-22, S. 65 ff.
[11] „Seit 2022 haben viele Bundesstaaten den Zugang zu Abtreibungsbehandlungen innerhalb ihrer Grenzen nahezu unmöglich gemacht und ihr Bestes getan, um Menschen, die mit einer ungewollten oder komplizierten Schwangerschaft konfrontiert sind, zu isolieren und sie so einzuschüchtern, dass sie sich nicht an medizinische Dienstleister oder sogar an Freunde und Angehörige wenden, die ihnen helfen könnten. Die neuen Gesetze haben die Ärzte gezwungen, die Behandlung in lebensbedrohlichen Situationen zu verzögern, und den Frauen Angst davor gemacht, sie aufzusuchen, was zu vermeidbaren Todesfällen führt. Selbst dort, wo die Folgen nicht so gravierend gewesen sind, bedeutet die tägliche Realität der Abtreibung in vielen Bundesstaaten, dass man sich durch ständige Unterströmungen von Verwirrung und Angst bewegen muss: Ist diese Pille, die ich im Internet gefunden habe, sicher? Wenn ich eine Fehlgeburt habe, wird mir dann jemand helfen? Oder, im Fall mancher Ärzte: Wie kann ich dieser Patientin helfen, ohne verhaftet zu werden?“ (New York Times, 17.10.24)
[12] „Im August 2021, einen Monat nach dem Start seiner Kandidatur für den Senat, verschickte Vance Spendenaufrufe, in denen er sich auf die ‚radikalen kinderlosen Führer in diesem Land‘ bezog, nachdem er sich in der Sendung ‚Tucker Carlson Tonight‘ über ‚childless cat ladies‘ lustig gemacht hatte... ‚Wir haben zugelassen, dass wir von kinderlosen Soziopathen beherrscht werden – sie investieren in NICHTS, weil sie nicht in die Kinder dieses Landes investieren. Es wird nicht leicht sein, sich zu wehren – unsere kinderlosen Gegner haben eine Menge Freizeit. Deshalb brauche ich DICH an meiner Seite.‘“ (cnn.com, 30.7.24) Vance kokettiert auch mit dem Vorschlag, Eltern eine zusätzliche Wahlstimme pro Kind zuzusprechen.
[13] „Etwa eine Woche nach der Debatte im September begann Trump, viel Geld für eine Fernsehwerbung auszugeben, in der er Frau Harris für ihre Haltung zu einem scheinbar obskuren Thema angriff: die Verwendung von Steuergeldern zur Finanzierung von Operationen für transsexuelle Häftlinge. ‚Jeder Transgender-Insasse im Gefängnissystem hat darauf ein Recht‘, sagte Frau Harris in einem Clip aus dem Jahr 2019, der in der Anzeige verwendet wurde. Die Anzeige mit dem anschaulichen Slogan „Kamala is for they/them. President Trump is for you“ kam bei den Testläufen dermaßen gut an, dass einige seiner Berater verblüfft waren. Also steckten sie noch mehr Geld in die Anzeigen und schalteten sie während Footballspielen... Die Anti-Trans-Anzeigen trafen den Kern des Trump-Arguments: Frau Harris sei ‚gefährlich liberal‘. Die Anzeigen waren nach Angaben des Trump-Teams bei Schwarzen und Latino-Männern wirksam, aber auch bei gemäßigten weißen Vorstadtfrauen, die über Transgender-Sportler im Mädchensport besorgt sein könnten.“ (NYT, 7.11.24)
[14] „‚Ich sagte: Wladimir, wenn du gegen die Ukraine vorgehst, werde ich dich so hart treffen, dass du es nicht einmal glauben wirst. Ich werde dich mitten im verdammten Moskau treffen‘, soll Trump gesagt haben. ‚Ich sagte: Wir sind Freunde. Ich will es nicht tun, aber ich habe keine Wahl. Er sagte: Tust du nicht! Ich sagte: Tue ich doch!‘“ (Wall Street Journal, 18.10.24)
[15] In dem Zusammenhang ist das berüchtigte sogenannte „Project 2025“ zu einiger Prominenz gelangt. Das gilt als Blaupause für eine kommende Trump-Diktatur:
„Der Plan würde eine schnelle Übernahme der gesamten US-Exekutive im Rahmen einer Maximal-Version der Theorie einer ‚einheitlichen Exekutive‘ vorsehen, die besagt, dass der Präsident der Vereinigten Staaten die absolute Macht über die Exekutive habe. Er sieht weitreichende Veränderungen in der gesamten US-Regierung vor, insbesondere bei der Wirtschafts- und Sozialpolitik sowie den Rollen der Bundesregierung und der Bundesbehörden. Die Mittel des US-Justizministeriums sollen gekürzt, das FBI und das Ministerium für Homeland Security aufgelöst und die Kabinettsabteilungen für Bildung und Handel abgeschafft werden. Der Plan zielt unter anderem darauf ab, gezielt nach politischen Erwägungen ausgewählte Personen nach der Wahl zu rekrutieren, um von den landesweit ca. 2,9 Millionen Bundesbeamten im öffentlichen Dienst ca. 50 000 zu ersetzen, die als Angehörige eines Deep State („Staat im Staate“) bezeichnet werden, weil sie sich während Trumps erster Amtszeit nicht als folgsam erwiesen. Wenn die Macht von einer Partei zur anderen wechselte, war bislang üblich, dass ‚lediglich‘ ca. 4 000 politische Beamte ausgetauscht wurden. Projektleiter Paul Dans, ein ehemaliger Beamter der Trump-Regierung, sagte im September 2023, dass das Projekt ‚systematisch darauf vorbereite, ins Amt zu marschieren und eine neue Armee [ideologisch] ausgerichteter, geschulter und im Wesentlichen einer Waffe gleicher Konservativer mitzubringen, welche bereit sind, gegen den Deep State zu kämpfen‘. Kevin Roberts, Chef der Heritage Foundation, erklärte: ‚Wir sind dabei, die zweite amerikanische Revolution zu erleben, die unblutig bleiben wird, wenn die Linke es zulässt.‘“ (Wikipedia, s.v. Project 2025)
Obwohl die Autoren des Plans zum erheblichen Teil aus Trumps innerem Beraterkreis stammen, bestreitet er während des Wahlkampfs jede Kenntnis des Plans. Was weithin als lächerlicher, bloß wahlkampftaktischer Versuch gewertet wird, sich von seinen eigenen Herzensanliegen zu distanzieren, hat seinen Grund ironischerweise eher darin, dass der Volkspräsident Trump um einiges diktatorischer ist, als die Autoren des Plans gedacht haben: Trump lässt sich von einer Denkfabrik, mag sie noch so sehr mit seinen Gefolgsleuten ausgestattet sein, doch kein Projekt vorsetzen. Er ist nicht der exekutive Ausschuss irgendeines konservativen Programms, sondern die Verkörperung des Volkswillens, also dessen alleinige Definitionsmacht. Was das wahre, konservative Amerika von Trump braucht, ist kein fertiger Plan, sondern sind Handlanger, die den Umsturz umsetzen, den Trump selbst verkörpert, und zwar gerade durch seine Rücksichtslosigkeit gegen jede Vorgabe von irgendwem, also absolut glaubwürdig.