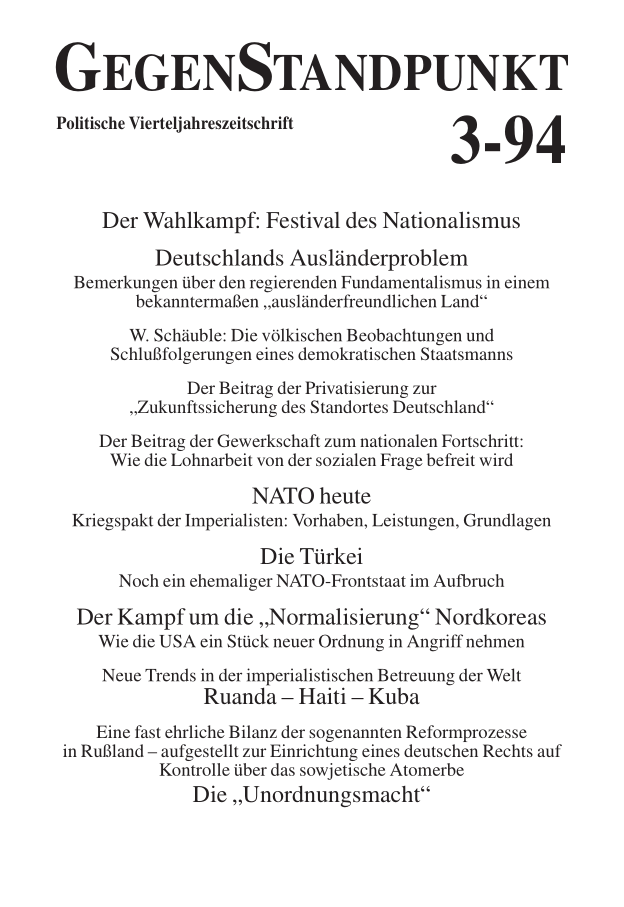Neue Trends in der imperialistischen Betreuung der 3. Welt
Ruanda: Ein Bürgerkriegsland, an dem kein imperialistisches Interesse mehr durchgesetzt werden muss, wird bestenfalls zum Betätigungsfeld für den „Humanismus der Weltgemeinschaft“. Haiti: Geschäft und Gewalt geben keinen überzeugenden Gesichtspunkt für ein Engagement her. Ein militärisches Engagement der USA steht (noch) nicht an. Weil sich Kuba dem Zerfall der SU nicht angeschlossen hat, wird die imperialistische Feindschaft mit Wirtschaftsboykott und Exil-Kubanern vorangetrieben.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Neue Trends in der imperialistischen Betreuung der 3. Welt
Was tun mit Ruanda?
In Ruanda[1] eskaliert ein Bürgerkrieg zu Massenmord, Massenflucht und Massensterben – und die zivilisierte Erste Welt stellt sich zu diesem Dritt-Welt-Ereignis wie zu einer Naturkatastrophe, deren Ursachen man mehr oder weniger hilflos gegenübersteht. Nach monatelangen Schlächtereien und Massensterben in überfüllten Flüchtlingslagern steht für den maßgeblichen politischen Sachverstand die Definition der Lage in diesem Teil Afrikas fest: Ein „Feld für humanitäre Einsätze“ wurde ausgemacht. Einsätze, über deren mehr als fragwürdigen Erfolg sich keiner etwas vormacht.
Das ist aufschlußreich.
1. Der „Bürgerkrieg“ in Ruanda kommt ganz gewiß nicht von Natur. Er ist aber auch keine politische Aktion, in der rivalisierende Parteien ihren Konkurrenzkampf um Besitz und Gebrauch einer souveränen Staatsmacht ausfechten, die aus sich heraus lebensfähig wäre. Soviel ist vielmehr noch jedem der unvermeidlichen „Hintergrundberichte“ zu entnehmen, mit denen Fernsehen und Presse die Öffentlichkeit über das „Chaos“ in Ruanda informieren: Dort wird ein – im wesentlichen an wiederbelebten alten Stammesgrenzen entlang geführter – Kampf der Häuptlinge von bewaffneten Cliquen ausgefochten um das, was sogar in einem Staat wie Ruanda an politischer Pfründe existiert: Ein bißchen Export – von Kaffee und Tee – findet statt, mit dem dieser Staat am EU-Markt hängt, und ein der Summe nach mehr als dreimal so hoher Import – ebenfalls aus den Ländern der EU – von allem, was nötig ist, um die Produktion und den Transport der Exportgüter zu gewährleisten; und – das Wichtigste – für die Organisatoren und Verwalter dieser Handelsbeziehungen an der Spitze des Staatsapparats gibt es eine Gage. Ein Kenner der Materie – der Koordinator der Partnerschaft Rheinland-Pfalz/Ruanda – analysiert die Lage folgendermaßen:
„Im Verlauf von drei Jahrzehnten Unabhängigkeit bildete sich eine neue Oberschicht, für die nicht primär die Zugehörigkeit zu den Bevölkerungsgruppen Tutsi und Hutu identitätsstiftend war, sondern ihre Stellung im neuen Staat. Ihre Einkünfte beschaffte sich die neue Oberschicht durch Nutzung der staatlichen Strukturen und der ausländischen Entwicklungshilfe: Im entsprechenden staatlichen Amt ließ sich fast jedes ausländische Entwicklungshilfeprojekt auch zur persönlichen Bereicherung oder zumindest zur Beschäftigung von Verwandten und Anhängern nutzen.“ (Peter Molt, Frankfurter Rundschau, 20.6.94)
Ob der Mann diese Resultate von drei Jahrzehnten Entwicklungshilfe immer noch für betrübliche, dem eigentlichen Zweck seiner koordinierten Partnerschaft widersprechende Auswüchse hält, soll er mit sich selber ausmachen. Andere Ergebnisse hat die Ära der Entwicklungshilfe jedenfalls nicht erbracht, und mehr war auch nicht im Programm. Es ging nie um Hilfe zum Aufbau von lebensfähigen, sprich: auf dem Weltmarkt konkurrenzfähigen Nationalökonomien, erst recht nicht ging es um Hilfe für die dort ansässige notleidende Bevölkerung. Ruanda war von den sogenannten „Geberländern“ vorgesehen als Kaffeelieferant mit einer garantiert antikommunistischen Verwalterclique an der Spitze und einem großen Rest unbrauchbarer Massen.
2. Gewalttätige Auseinandersetzungen bis zu Massenschlächtereien um die von den führenden imperialistischen Mächten gestifteten Pfründen hat es in Ruanda und Umgebung auch in der Vergangenheit reichlich gegeben. Sie wurden aber nie als Anlaß zu einer weltweiten „humanitären UNO-Aktion“ genommen. In der Regel wurden die Auseinandersetzungen, ohne erst groß die UNO zu bemühen, durch belgische und französische Waffenlieferungen, Militärberater und – wenn es sein mußte – französische Fallschirmjäger entschieden.
Geändert hat sich jetzt weniger das Leben in Ruanda als vielmehr der Standpunkt der imperialistischen Hauptmächte zu Ruanda. Die maßgebliche imperialistische Definition einer kriegerischen Auseinandersetzung in Afrika stand nämlich zu Zeiten des Ost-West-Gegensatzes fest, und zwar ganz jenseits dessen, was sich in einem Lande wie Ruanda tatsächlich abspielte. Jeder Konflikt war ganz selbstverständlich unter die weltweite Systemkonkurrenz subsumiert. Selbst wenn in Ruanda weit und breit kein russischer Militärberater gesichtet wurde, geschweige denn ein Kommunist, galt es immer und überall einen möglichen sowjetischen Einfluß zurückzudrängen; und für eine Abteilung der rivalisierenden Herrschercliquen wurde Partei ergriffen im Sinne einer stabilen, eindeutig prowestlichen Staatsgewalt. Diesen Kampf der Freiheit gegen den Sozialismus und die Sowjetunion haben in Zentralafrika im wesentlichen die Franzosen durchgefochten. Da der ganze afrikanische Kontinent während der übersichtlichen Zeiten der Ost-West-Konfrontation als Schauplatz eines welthistorischen Ringens definiert war, war jeder französische Militäreinsatz in Afrika ein Beitrag Frankreichs zur Sache des westlichen Lagers. Als verantwortliche Aufsichtsmacht und Ordnungsstifter in Afrika erfüllte Frankreich einen unverzichtbaren Dienst im Kampf gegen den östlichen Hauptfeind.
Von dieser imperialistischen Einordnung des Kontinents bleibt nach dem Ende des Ost-West-Gegensatzes nichts mehr übrig. Und die ruandischen Kaffeebohnen geben keinen neuen Gesichtspunkt ab für ein schlagkräftiges imperialistisches Engagement, das die politische Lage definiert.
3. Geblieben ist im Falle Ruandas die pure Abstraktion der politischen Zuständigkeit Frankreichs für das frankophone Afrika. In diesem Sinn hat die französische Regierung sich nach begonnenem Gemetzel einen UNO-Auftrag verschafft, französische Truppen nach Ruanda marschieren lassen, um sich dann die Frage vorzulegen, was die dort eigentlich regeln sollen. Entschiedene und entscheidende Parteinahme für eine der kämpfenden Parteien vor Ort stand nicht auf dem Programm. Was blieb, das waren, quasi ersatzweise, die berühmten „humanitären Aktionen“. Mehr als die Demonstration: Hier ist Frankreich statt einer anderen Macht aktiv geworden! ist unter dem Strich nicht übriggeblieben.
Das mag herzlich wenig sein, hat aber immerhin dazu gereicht, daß die Adressaten dieser Demonstration aktiv wurden.[2] Die USA haben auch ein paar Soldaten als Nothelfer losgeschickt; und der amerikanische Generalstabschef höchstpersönlich ist im benachbarten Zaire gelandet, um dort zu verkünden, daß für die USA keinesfalls eine „militärische Aktion, sondern nur streng humanitäre Hilfe in Frage kommt“. Klargestellt hat der oberste US-Militär damit zweierlei: Erstens sehen sich die USA bei der Beaufsichtigung Afrikas durchaus in Konkurrenz zu Frankreich. Zweitens ist der Gegenstand, um den diese Konkurrenz geht, kein imperialistisches Engagement wert. Wenn Imperialisten verkünden, daß sie ihre Elitetruppen für ein paar Wochen zu rein humanitärer Wasseraufbereitung und sonst nichts abstellen, dann drücken sie damit aus, daß sie die Sache zwar fest im Blick behalten, aber kein nationales Interesse an dem Land und seinem Krieg ausmachen können.
So sehen es dann auch die Franzosen. Sie haben militärisch in diesem Land nichts zu erledigen, was der Sache Frankreichs nutzen könnte. Die Erprobung, was aus einem afrikanischen Land wie Ruanda zu machen geht, ist in kolonialer und postkolonialer Weise gelaufen und zu Ende gebracht. Ruanda ist von den zuständigen Imperialisten fertig entwickelt worden – in einem weiteren massiven Engagement können sie derzeit einfach keinen Vorteil entdecken. Und weil auch kein konkurrierendes imperialistisches Interesse an dem Land zu entdecken und in Schach zu halten ist, zieht die zuständige europäische Republik ihre Soldaten ab und kümmert sich herzlich wenig um die jetzt laut werdenden Bedenken, damit gäbe sie gewissermaßen das Signal für die Entvölkerung der eingerichteten Schutzzonen durch neue Massenmorde und Massenflucht. Der „Auftrag“, den Frankreich sich beschafft hat, wird an die UNO zurückgegeben; die ist ab sofort für Humanismus in der Region zuständig.
4. Am Fall Ruanda zeichnet sich nach mehreren Jahrzehnten Entwicklungshilfe, Aufrüstung und Kommunismus-Bekämpfung ein interessantes Zwischenergebnis ab: Staaten wie Ruanda sind fix und fertig entwickelt, ökonomisch wie gewaltmäßig. Waffen wurden in der Vergangenheit ausreichend geliefert; den Umgang damit haben die Leute dort auch gelernt, und auf Befehl gehen sie ans Werk. Die imperialistischen Aufsichtsmächte sehen sich dadurch herausgefordert in ihrem Zuständigkeits- und Ordnungsanspruch auf die Staaten Schwarzafrikas. Doch statt einzugreifen, stellen sie in bezug auf diesen – abstrakt nach wie vor aufrechterhaltenen – Anspruch eine Kosten-Nutzen-Kalkulation an. Schon die Tatsache, daß sie überhaupt solche Berechnungen anstellen, zeigt, daß sie im Grunde kein nationales Interesse wissen, das sie dort militärisch verteidigen müßten: Wenn sie es wüßten, würden sie zuschlagen und nicht rechnen. Daher kommen sie bei ihrer Kalkulation zu dem Ergebnis: Es gibt weit und breit keinen nationalen Nutzen, der einen militärischen Aufwand lohnt. Nicht einmal den, die imperialistische Konkurrenz aus dem Feld zu schlagen: Die kommt, nachdem man sich wechselseitig ein bißchen herausgefordert und belauert hat, zu demselben Ergebnis. Also wird das Ganze zum Betätigungsfeld für den „Humanismus der Weltgemeinschaft“ erklärt[3] – im Klartext: Die Imperialisten selber wissen mit ihren eigenen Machwerken in Afrika zur Zeit nichts mehr anzufangen.
Was tun mit Haiti?
Die US-Regierung versucht der Lage auf Haiti[4] eine eminent wichtige Bedeutung beizulegen. Sie ist bei der UNO mit der Sprachregelung vorstellig geworden, auf dieser Karibik-Insel ginge es um die alles entscheidende Frage: Demokratie oder Diktatur. Und nicht nur das: Wenn ungestraft demokratisch gewählte Präsidenten abgesetzt werden können, dann soll es sich mindestens um eine Bedrohung des Weltfriedens handeln. Was ihren Wahrheitsgehalt betrifft, sind diese Sprachregelungen einerseits lächerlich. Was allerdings nichts Neues wäre: Wenn die Weltmacht Nr. 1 sich Titel für militärische Ordnungsaktionen gesucht hat, ist es nie um Wahrheitsfindung gegangen. Andererseits stehen diese wuchtigen Titel in einer gewissen Diskrepanz zu der mittlerweile von aller Welt registrierten ungewohnten „Zögerlichkeit“ der USA, eine militärische Strafaktion gegen Haiti in die Wege zu leiten.
Auch das ist aufschlußreich:
1. Ob in Haiti demokratische Verhältnisse herrschen oder nicht, war den USA in den letzten 190 Jahren erstens scheißegal; und zweitens war es ihnen gar nicht recht, wenn der Wunsch danach von unten laut wurde.[5] Die Forderung nach stabilen demokratischen Verhältnissen in diesem Staat ist darüber hinaus lächerlich angesichts der Verhältnisse, die unter der Oberaufsicht der USA in diesem Lande hergestellt wurden. Was man in Haiti „ziviles Leben“ nennen kann, ist nämlich keineswegs durch eine geregelte kapitalistische Benutzung der Massen und schon gar nicht durch deren demokratische Beteiligung an ihrer eigenen Verwaltung bestimmt. Es ist auch nicht gekennzeichnet durch die Unterdrückung einer eigentlich fälligen Kultur demokratischer Massen-Beteiligung durch eine durchgedrehte Militärdiktatur. Das „zivile Leben“ Haitis ist zusammengesetzt aus Massenelend, einer reichen, von den USA ausgehaltenen Elite und einer – von den USA verbotenen und nach Kräften verhinderten – Massenauswanderung hoffnungsloser Elendsgestalten Richtung USA.
2. Für diese idyllischen karibischen Zustände hat immer eine imperialistische Bestimmung gegolten: Hinterhof der USA. In sämtlichen Ländern der Region (mit Ausnahme der ärgerlichen Ausnahme Kuba – doch dazu später) war immer eines klar: In letzter Instanz ist die Regierung in Washington zuständig für das Ein- und Absetzen von Regierungen, für die Ausstattung und die Freiheiten des Militärs, kurz: für die Definition all dessen, was man so „Lebensbedingungen“ nennt. Im Rahmen dieser feststehenden Hinterhof-Ordnung wurde auch mal eine Regierung in Panama, die vorher von den USA installiert worden war, unter dem Gesichtspunkt „Drogendealer“ verhaftet. Eine Verhaftungsaktion, die bekanntlich nebenbei noch einige Tausend Bewohner von Panama das Leben kostete. Oder es wurde in Grenada einmarschiert – unter dem Gesichtspunkt: „Linksradikale Regierung baut kommunistischen Flughafen und gefährdet damit das Leben von US-Auslands-Studenten“. Und die Existenz von Kuba war letztlich immer der Beweis, daß auch in der karibischen Region der Kampf gegen das östliche „Reich des Bösen“ mit aller Entschlossenheit geführt werden mußte. Wann immer die USA sich daran machten, in ihrem Hinterhof aufzuräumen, geschah das im Namen der „zu rettenden Demokratie“ oder sonstiger hoher abendländischer Werte. Oder anders ausgedrückt: Immer wenn eine US-Regierung „verletzte demokratische Werte“ in dieser Region geortet hatte, war klar, daß das „Demokratie“-Geschrei die Chiffre für ein verletztes US-amerikanisches Interesse war. Die Eingreiftruppen waren dann auf dem Weg – und nach der UNO hat kein Hahn gekräht.
3. An diesen Szenarien gemessen sieht der derzeitige US-amerikanische Umgang mit Haiti in der Tat unentschlossen und zögerlich aus. Erst wird gedroht, es werden Ultimaten für die Rückkehr des „demokratisch gewählten Präsidenten Aristide“ gestellt, US-Kriegsschiffe laufen aus und machen dann im Hafen von Port-au-Prince wieder kehrt. Gemessen an den wuchtigen Titeln – Demokratie und Weltfrieden – blamiert sich das ganze Hin-und-Her um den „rechtmäßig gewählten Aristide“ schon an seiner mittlerweile 3jährigen Dauer.[6] Und auf alle Fälle entspricht es so gar nicht der altvertrauten Hinterhof-Logik; entsprechende Mäkeleien werden denn auch nicht nur in der US-Öffentlichkeit laut, auch die europäische Presse stellt – mit leichter Häme – fest, daß die Amis hinterhofmäßig auch nicht mehr das sind, was sie einmal waren.
Tatsächlich unterscheidet sich der Ruf nach „Demokratie für Haiti“ heute in einer entscheidenden Hinsicht von früheren US-amerikanischen Schlachtrufen. Er steht in diesem Fall nicht für ein unabweisbares nationales Interesse der USA. Und schon gar nicht dafür, daß der „gewählte Mann“, Aristide, der Typ wäre, auf den die USA an der Spitze Haitis gerade gewartet hätten – der fällt eher unter die Kategorie „suspekter Sozialreformer“, wenn nicht gar „verrückter Kommunist“; zumindest steht das in einer Akte, die die CIA in früheren Jahren schon mal vorsorglich über ihn angelegt hatte. Entsprechend sieht die diplomatische Behandlung der Haiti-Affäre durch die USA aus. Statt Fakten zu schaffen, zu denen die Welt sich dann stellen soll, tragen sie die Angelegenheit zuerst der UNO vor. Wenn sie sich dann ihr UNO-Mandat zum Zuschlagen geholt haben, schreiten sie nicht zur Tat, sondern versichern, daß sie sich vorbehalten, zur Tat schreiten zu können, falls im Rahmen der UNO keine befriedigende Lösung gefunden wird. Schon vorab erklären sie glatt, daß nach einer allenfalls doch stattfindenden Intervention die UNO nach dem Rechten sehen soll. Es ist fast so, als wollten sie die Zuständigkeit für die Wiedereinsetzung des gewählten Präsidenten wieder an die UNO zurückdelegieren.
Was soll der Zirkus? Offenbar stellen die USA auch in Bezug auf ihr Eingreifen in Haiti eine Aufwands- und Ertragsrechnung an und kommen dabei für sich zu keinem positiven Ergebnis. Sie finden partout keinen Gesichtspunkt, unter dem sich ein entschlossenes Eingreifen dort für ihre nationale Sache lohnt. In Haiti selber gibt es keine Partei, von deren Unterstützung sich Washington einen gesteigerten Nutzen versprechen könnte. Das Land ist ökonomisch so zugerichtet, daß von einer Nationalökonmie nicht die Rede sein kann; sie zu schaffen, würde eine neokoloniale Betreuung des Landes erfordern, die von Washington nicht für lohnend erachtet wird. Das bißchen Geschäft, das läuft, ist alternativlos von den USA abhängig. Es ist weit und breit keine andere Konkurrenzmacht zu sehen, die Haiti politisch für sich benutzen und gegen die USA einsetzen könnte oder wollte. Eine politische Lektion, die am Fall Haitis anderen Staaten zu erteilen wäre, ist ebenfalls nicht zu entdecken. Und das Hauptproblem, das die USA mit Haiti haben, die lästigen „boat-people“ vor der Küste Floridas, bekämpfen sie immer noch am effektivsten selber, mit US-Marine und Küstenwache.
4. Vielleicht entschließen die USA sich ja doch noch im Interesse der Demonstration ihrer ganz prinzipiellen Zuständigkeit für ihre karibische Hinterhofregion, in Haiti militärisch zu intervenieren. Die Frage, wozu das gut sein soll, werden sie dennoch so schnell nicht los werden. Haiti ist nämlich noch so ein Endprodukt imperialistischer Aufsicht und Zurichtung, mit dem die zuständigen Imperialisten derzeit nichts mehr anfangen wollen und können – weder Geschäft noch Gewalt geben einen überzeugenden Gesichtspunkt her, unter dem sich eine Weltmacht dort engagieren will.
Was tun mit Kuba?
Wenigstens in Kuba[7] wissen die Imperialisten in Washington haargenau, was zu tun ist. Da sind sie um eine politische Definition ihrer auswärtigen Interessen nicht verlegen: Das Castro-Regime muß weg!
Denn dieser Staat unterscheidet sich ganz prinzipiell von imperialistischen Geschöpfen wie Ruanda und Haiti. Die kubanische Revolution hat die Emanzipation von der Herrschaft des Eigentums geschafft, sie hat das Land von der Rolle einer Zucker- und Tabakplantage im Dienste von US-Konzernen befreit. Daß Kuba mit einem „künstlich überhöhten Zuckerpreis“ „am sowjetischen Tropf gehangen“ und sich damit ein Sozial- und Bildungssystem „über seine Verhältnisse geleistet“ haben soll, verrät einiges über „natürliche Preise“ und die den Ländern der 3. Welt angemessenen sozialen Verhältnisse. Jahrelang haben Weltwirtschaftsexperten darüber gerätselt, warum sich die terms of trade zwischen 1. und 3. Welt permanent verschlechtert haben, so daß die Dritt-Welt-Länder für dasselbe Quantum Industriewaren aus den kapitalistischen Ländern immer mehr Rohstoffe exportieren müssen. Die sowjetischen Realsozialisten haben beim Ankauf von Kubas Zucker den fallenden Weltmarktpreis für Zucker ignoriert und damit praktisch gezeigt, wie man dieses „Gesetz“ außer Kraft setzt. Heute nach dem Abtreten des realen Sozialismus wollen alle Experten wissen, daß sich die RGW-Länder bei ihren Austauschrelationen gegen das angebliche Naturgesetz des Weltmarkts versündigt haben sollen, demzufolge die Länder der 3. Welt dazu da sind, ihre Reichtümer zu Preisen abzuliefern, die von den Warenterminbörsen der kapitalistischen Welt bestimmt werden und nicht davon, was diese Länder, die man einstmals Entwicklungsländer nannte, brauchen, um sich zu entwickeln, geschweige denn, um damit ihre Bevölkerung zu ernähren. Denn das ist der zweite Verstoß des „roten Caudillo“ gegen die Gesetze der kapitalistischen Welt: Er hat die Entwicklungshilfe der Sowjets nicht wie normale Dritt-Welt-Herrscher dazu benutzt, selbst im Luxus zu schwelgen und Polizei und Armee zu entwickeln, um ihre Massen niederzuhalten und, wenn sie dagegen aufmucken, niederzumachen, sondern er hat mit den Einkünften aus dem RGW-Austausch und mit den Subsidien der SU Kuba tatsächlich ein Stück weit entwickelt: Nahrungsmittel, die in Kuba nicht gedeihen, wurden importiert, damit das Volk satt wird; ein Bildungs- und Gesundheitswesen wurde für die Massen aufgebaut (und nicht – wie in der 3. Welt normal – für die Oberschicht), so daß die kubanische Bevölkerung selbst jetzt noch – nach dem Ausfall der sowjetischen Unterstützung und unter den Bedingungen eines verschärften Embargos durch die USA – über soziale Sicherheiten und einen durchschnittlichen Lebensstandard verfügt, der in Südamerika einmalig ist und der sich neben dem, was in US-amerikanischen Ghettos üblich ist, durchaus sehen lassen kann. Trotzdem gilt die Tatsache, daß seit dem Ende des Ostblocks die terms of trade wieder gegen Kuba wirken, so daß ihm die Devisen für Öl–, Nahrungsmittel- u.a. lebensnotwendige Importe fehlen, als Beweis, daß der „tropische Sozialismus“ ebenso abgewirtschaftet hat wie der sowjetische, der ihn ausgehalten haben soll.[8] Daß zur gleichen Zeit in Lateinamerika mitten im schönsten Kapitalismus die Slums Rekordgröße erreicht haben, daß in Afrika reihenweise ganze Staaten nach 30 Jahren Integration in den kapitalistischen Weltmarkt samt Entwicklungshilfe in blutrünstige Banden zerfallen – vom Elend ihrer Massen ganz zu schweigen, wirft dagegen keine Systemfrage auf, sondern wird höchstens der persönlichen Machtgier und Korruptheit der einheimischen Eliten angelastet.
Diese Abweichung Kubas vom Normalfall eines karibischen Hinterhof-Staates war und ist für die USA Grund genug für ihre Feindschaftserklärung. Sie ist Grund genug, um auch heute noch, nach dem Ende des Ost-West-Gegensatzes, an ihrer politischen Definition der Lage wie in den kältesten Kalten-Kriegs-Zeiten festzuhalten und das Land entsprechend zu bekämpfen. Der Wirtschaftsboykott, der die kubanische Ökonomie ruiniert, wird ergänzt durch sorgfältige Päppelung jeder Sorte von Exil-Kubaner-Revanchismus in Florida, Subversion in Kuba selbst, einschließlich einer Fluchtperspektive für unzufriedene Kubaner, die sonst keinem Dritt-Welt-Insassen offensteht.[9] Wenn sie den Fluchtdrang dann auch wieder bremsen, dann wird der Zweck offen ausgesprochen: Die USA wollen keine kubanischen „Wirtschaftsflüchtlinge“ im eigenen Land, sie wollen Unruhe und Zersetzung in Kuba. Darüber regt sich kein besonnener Beobachter auf, wohl aber über Castro, wenn der Mann seinerseits auf die politische Subversion der USA als Ursache der Fluchtbewegung hinweist. Solange Fidel Castro die illegale Ausreise auswanderungswilliger Kubaner nach den USA verhindern ließ – übrigens auf Wunsch der USA, die zum Beweis der „kommunistischen Castro-Diktatur“ nur Flüchtlinge aufnahmen, die der kubanischen Küstenwache entkommen waren, nicht jedoch die vertraglich vereinbarten 20000 legalen Auswanderer pro Jahr, soll er den „Insassen seines roten Insel-Gefängnisses das unveräußerliche Menschenrecht auf Ausreise vorenthalten“ haben. Seit er diejenigen seiner Bürger, die auf eigene Faust ihr Glück in den USA versuchen wollen, ziehen läßt, „läßt er zynisch den Überdruck aus dem Dampfkessel der roten Diktatur ab“. Nach der Öffnung der Grenzen für alle Ausreisewilligen verloren die westlichen Beobachter endgültig alle Maßstäbe: Nicht die Weltmacht USA setzt mit Embargo und der Androhung einer Seeblockade den isolierten Inselstaat unter Druck, sondern Castro soll es sein, der mit der Öffnung der Grenzen auf den amerikanischen Präsidenten einen so unerträglichen Druck ausübt, daß der „konzeptlos“ eine „überstürzte“ Änderung der bisherigen Aufnahmegarantie für Kubaflüchtlinge einleiten „mußte“. Damit zog sich Clinton nicht nur die Kritik der Hardliner zu, die jede amerikanische Kuba-Politik unterhalb einer Invasion als Zurückweichen vor Castro brandmarken, er eckte damit auch bei den Freunden eines „Dialogs“ an: Sie werfen Clinton vor, daß er die Chance vergeben habe, „flexibel“ Castro in Verhandlungen eine friedliche Kapitulation anzubieten, daß er mit seiner abermaligen Verschärfung des Embargos die Kubaner, die drauf und dran gewesen sein sollen, ihrem „Diktator“ davonzulaufen, wieder „mit ihrem roten Caudillo zusammenschweiße“. Wenn Castro und seine Genossen ihrem Volk übers Fernsehen und in Meetings den Grund der Misere mit dem verschärften US-Embargo erklären und die Ausreisewilligen darauf aufmerksam machen, daß sie – seit es den USA von ihnen zu viele gibt – als nützliche Idioten des US-Imperialismus ausgedient haben und als unerwünschte Ausländer in Lagern auf Guantánamo eingepfercht werden, dann mag er noch so recht haben, es nützt ihm nichts. Dann ist das nämlich nur wieder ein neuer Beweis für seine unerträgliche kommunistische Halsstarrigkeit.
Castros Halsstarrigkeit besteht in nichts anderem als in der Unnachgiebigkeit der Imperialisten gegen einen von ihrer sauberen Weltordnung abweichenden Staat. Sie sind nicht zufrieden, bevor sie nicht auch aus Kuba ein weiteres Haiti gemacht haben.
[1] „Ruanda Ost-Afrika … Fläche: 26.338 km², Einwohner (88): 7.148.496 … Lebenserwartung: 46 Jahre… Säuglingssterblichkeit (83): 11,1%, Kindersterblichkeit: 22,2%, Analphabeten: 50%..“ (Fischer Welt-Almanach 1994)
[2] Aktiv wurden auch die wachsamen Beobachter der internationalen Konkurrenzlage in deutschen Zeitungsredaktionen. Sobald ausländische Mächte etwas von „humanitärem Engagement“ daherreden, wissen die nämlich sofort, was dahinter steckt: „Unmenschliches Intrigenspiel… Frankreich will die Welt zwingen, seiner militärischen Intervention in Ruanda zuzustimmen… Paris spricht von humanitärer Hilfe, aber es geht ihm um seine Anerkennung als Weltmacht und Ordnungsmacht in Afrika. Wie die Amerikaner als Vorboten der UNO nach Somalia einflogen, so wollen diesmal die Franzosen auf der Weltbühne auftreten… Damit wird der schwarze Kontinent wieder zum Spielball fremder Interessen herabgewürdigt. Mit 2000 Soldaten glaubt Frankreich, seinen Anspruch als Weltmacht geltend machen zu können… Diese Art von Hilfe hat Ruanda nicht verdient. Es ist ein unmenschliches Intrigenspiel, das böse enden kann.“ (Michael Birnbaum, Süddeutsche Zeitung, 23.6.94) Mittlerweile hat man sich auch bei der Süddeutschen Zeitung wieder abgeregt. Seitdem klar ist, daß die Franzosen ihre Truppen aus Ruanda wieder abziehen, vertritt man dort eher die Linie, daß das irgendwie ziemlich inhuman ist angesichts des dann zu erwartenden neuen Flüchtlingsstroms. So sensibel reagieren eben verantwortungsvolle Deutsche, wenn sie mit sicherem Instinkt die weltpolitischen Aktionen einer Konkurrenzmacht verfolgen.
[3] Selbst auf diesem Feld angeblich reinster Mitmenschlichkeit können die Hilfsvereine nicht vergessen, daß sie Abgesandte von imperialistischen Mächten sind: Sie lassen sich von ihren Staaten – keineswegs von ihrem Mitleid – definieren, wo und wann humanitäre Einsätze fällig sind: z.B. eben nicht im Sudan, wo mindestens genauso massenhaft gestorben wird wie in Ruanda, und in Ruanda dann, wenn ihre Regierungen beschlossen haben, daß das Gemetzel dort kein Anlaß für eine Militärintervention ist, sondern daß den Negern in diesem Fall gezeigt wird, daß nicht nur die Waffen, mit denen sie gemeuchelt werden, aus imperialistischen Arsenalen stammen, sondern auch das medizinische Gerät, mit dem die halbtoten Überlebenden versorgt werden. Dabei vergessen die barmherzigen Samariter-Organisationen aus Europa auch keineswegs den Standpunkt ihrer Nationen: Es kommt ihnen schwer darauf an, deutsche, französische, belgische usw. Zuständigkeit fürs Humanitäre zu demonstrieren, so daß es auch ganz unwichtig wird, was den Elenden in Goma wirklich hilft, wenn es nur die „Helfer“ aus der richtigen Nation waren. Und da „Hilfe“ in kapitalistischen Staaten – wie alles andere auch – als Geschäft organisiert ist, bleiben auch die ekelhaftesten Formen der Konkurrenz darum nicht aus, welche „Hilfsorganisation“ als erste vor Ort auftaucht und mit „aufrüttelnden“ Berichten von ihrem Einsatz als erste ins Fernsehen kommt, um am meisten vom Spendenkuchen abzukriegen. Bei soviel care kann es nicht ausbleiben, daß gelegentlich bekannt wird, daß sie mehr der eigenen Kasse als den Hilfsbedürftigen gilt, weshalb die humanitäre Konkurrenz alle Hände voll zu tun hat, dem Spendervolk zu erklären, daß es sich dabei nur um schwarze Schafe handle, mit denen seriöse Spendensammler nichts zu tun hätten…
[4] „Haiti, Mittel-Amerika; Karibik… Fläche 27.750 km², Einwohner(90): 6.603.000… Lebenserwartung: 55 Jahre… Säuglingssterblichkeit (87): 9,4%… Kindersterblichkeit: 15,5%, Analphabeten: 47%…“ (Fischer Welt-Almanach 1994)
[5] Vgl. den Artikel: „Haiti und Kuba – Zwei Embargos für die Demokratie“, GegenStandpunkt 4-93, S.16
[6] Für alle, die es vergessen haben: „Haiti – Staatsoberhaupt: Jean-Bertrand Aristide (gewählt am 16.12. 1990), seit Militärputsch vom 29.9.1991 im Exil; Rückkehr für für 30.10.1993 geplant.“ (Fischer Welt-Almanach 1994)
[7] „Kuba, Mittel-Amerika; Karibik… Fläche: 11.086 km², Einwohner: 10.736.000… Lebenserwartung: 76 Jahre, Säuglingssterblichkeit: 1,25%, Kindersterblichkeit: 1,4%, Analphabeten: 6%…“ (Fischer Welt-Almanach 1994)
[8] Dabei ist in der hiesige Öffentlichkeit durchaus bekannt, woher die Versorgungsmängel in Kuba rühren. Kein Fernsehbericht oder Kommentar über Kuba, in dem nicht auf die verschärften Wirtschaftssanktionen und die dadurch bedingten Produktionsausfälle hingewiesen wird. Und was lernen antikommunistisch gebildete Journalisten daraus? Klar das Eine: Auch in Kuba zeigt sich eklatant die Unfähigkeit des Sozialismus, die Massen zufriedenzustellen. Die ganze Welt hat diese Grundkonstante des menschlichen Daseins eingesehen, bis auf den „starrsinnigen Revolutionär Castro“, dessen weiteren Verbleib an der Macht sich ein bürgerliches Hirn deshalb auch nur mit der Verfügung über fast schon magische Kräfte erklären kann: Castro ist „Monument und Mythos“, „eine Ikone“, „Populist“, ein Bündel aus „Eloquenz, Überzeugungskraft, Starrsinn und Charisma“ (alle Attribute stammen aus einem einspaltigen Artikel der Frankfurter Rundschau vom 12.8.94). Daß der Mann mit seiner Eloquenz vielleicht ein paar überzeugende Argumente von sich geben könnte, liegt jenseits des Horizonts einer FR-Korrespondentin; aber Führerkult leuchtet jedem Demokraten ein.
[9] Wieviel Mexikaner gäbe es denn noch in Mexiko, dem NAFTA-Partner der USA, wenn die dort als „Chicanos“ Diskriminierten nicht von einem mehrere Meter hohen Metallzaun an der Flucht über den Rio Grande gehindert würden, sondern – wie bis vor kurzem die kubanischen Flüchtlinge – nach einem Jahr automatisch die US-Staatsbürgerschaft bekämen?