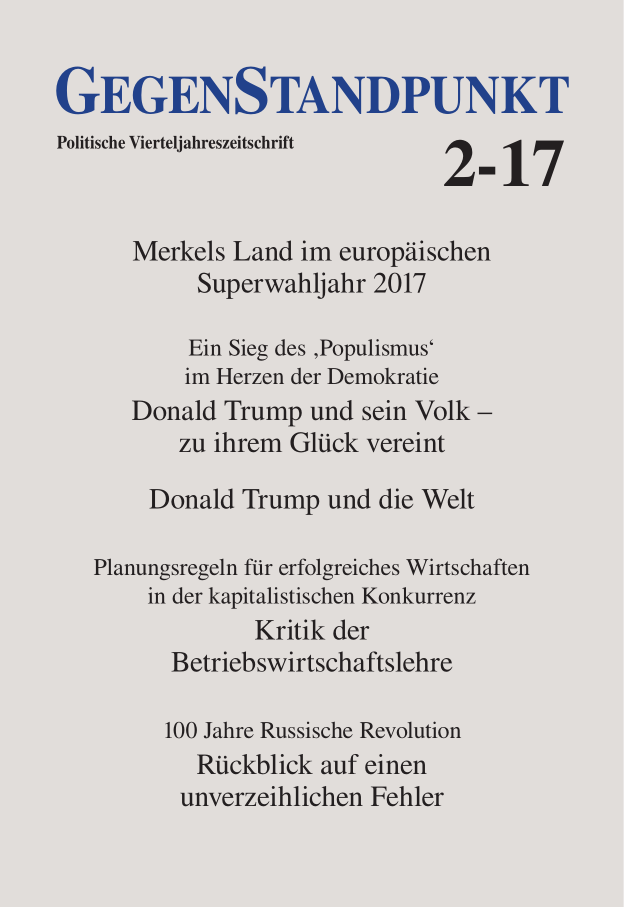Donald Trump und die Welt
Das steht für Trump also fest: Die stolzen USA und das amerikanische Volk sind ausgezehrt durch ein grenzüberschreitendes Wirtschaften, das für den Abbau von Arbeitsplätzen im Lande, das Verrotten ganzer, einst blühender Industrielandschaften, den Verfall der amerikanischen Infrastruktur, für die Verarmung der dort ansässigen Bevölkerung, für negative Handelsbilanzen und gigantische Staatsschulden gesorgt hat. Das verbindet sich für ihn nahtlos mit einem erschreckenden Niedergang amerikanischer Gewaltpotenzen, den er nicht nur an den gebremsten Ausweitungsrunden der US-Rüstungsetats der letzten Jahrzehnte festmacht, sondern ebenso an den bedingt bis gar nicht gelungenen kriegerischen Auftritten der USA im letzten Vierteljahrhundert.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Siehe auch
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
- I. Trumps Anspruch an die kapitalistische Weltwirtschaft: Jobs for the American People
- II. Trumps Absage an die Weltordnung: I’m going to rip up these bad trade deals and we’re going to make really good ones.
- III. Trumps Auftrag an die Super-Gewalt Amerikas: Wir müssen endlich wieder Kriege gewinnen!
- 1. Trump geißelt Vernachlässigung und Missbrauch der amerikanischen Gewaltmittel und beginnt die Restauration der US-Kriegsmacht für und durch ihren entschlossenen Einsatz
- 2. Trump kündigt die transatlantische Kumpanei und damit die Garantie für den Zustand namens ‚Weltfrieden‘, der Amerikas Bedürfnissen nicht mehr genügt
- PS: Zum widersprüchlichen Zusammenhang von Trumps Populismus und Amerikas neuem Imperialismus
Donald Trump und die Welt
I. Trumps Anspruch an die kapitalistische Weltwirtschaft: Jobs for the American People
1. Trump verurteilt die ökonomische Lage der USA als unvereinbar mit dem Status der USA als Supermacht der Weltwirtschaft
a)
Das steht für Trump also fest: Die stolzen USA und das amerikanische Volk sind ausgezehrt durch ein grenzüberschreitendes Wirtschaften, das für den Abbau von Arbeitsplätzen im Lande, das Verrotten ganzer, einst blühender Industrielandschaften, den Verfall der amerikanischen Infrastruktur, für die Verarmung der dort ansässigen Bevölkerung, für negative Handelsbilanzen und gigantische Staatsschulden gesorgt hat. Das verbindet sich für ihn nahtlos mit einem erschreckenden Niedergang amerikanischer Gewaltpotenzen, den er nicht nur an den gebremsten Ausweitungsrunden der US-Rüstungsetats der letzten Jahrzehnte festmacht, sondern ebenso an den bedingt bis gar nicht gelungenen kriegerischen Auftritten der USA im letzten Vierteljahrhundert.
Dabei steht ihm klar vor Augen, dass das alles ein Resultat eines so gigantischen wie verbrecherischen Ausverkaufs amerikanischer Interessen ist. Ein ganz und gar verdorbenes establishment hat seiner Überzeugung nach auf dem Feld der Ökonomie den Diebstahl amerikanischer Jobs zugelassen, durch den seine hard-working Amerikanerinnen und beautiful Amerikaner um das ihnen rechtmäßig zustehende Glück gebracht worden sind, per überlegener Tüchtigkeit sich selbst und ihren Familien und also Amerika als Ganzem den Wohlstand zu erarbeiten, der ihnen und ihrer Nation angemessen ist. Diesem Bild von der tiefen Krise Amerikas und ihren Gründen lässt sich entnehmen, wie Trumps Bild von der Welt überhaupt beschaffen ist.
Der erste Hauptsatz seiner allgemeinen und sehr übersichtlichen Weltsicht besagt, dass – so man sie lässt – seine geliebten Amerikaner dem pursuit of happiness folgen, der darin besteht, mit welchen Mitteln und unter welchen Umständen auch immer, Geld für ihre private Existenz zu verdienen, also im Wettbewerb gegen andere ihre individuelle Tüchtigkeit im Gelderwerb auszuleben. Der job ist Mittel, Inbegriff und Ausweis gelungenen individuellen Glücksstrebens sowie des Erfolgs auch auf der Ebene des großen nationalen Ganzen. Daran schließt sich nahtlos der zweite Hauptsatz an, demzufolge auch das Zusammenleben der Völker, an dem das amerikanische in jeder Hinsicht beteiligt ist, eine einzige große Konkurrenzveranstaltung ist, in der es Reichtum der Nationen und Wohlstand der Völker – jobs eben – nur als Objekt und Resultat eines immerwährenden Ringens darum, eines wechselseitigen Wegnehmens und Vorenthaltens gibt. Beides zusammen ergibt den dritten bzw. eigentlich allerersten Hauptsatz: Darin ist Amerika überlegen. Nicht speziell durch die eine oder andere von tüchtigen Amerikanern hergestellte Ware, das eine oder andere überlegene Kapital mit überlegenen Geschäftsideen und -mitteln, die eine oder andere staatliche Maßnahme zur Stärkung des nationalen Standorts, das eine oder andere gelungene diplomatische Manöver zum Ausbooten der Konkurrenten, sondern ganz prinzipiell, also immer schon, also auf jedem Feld, also gemessen an allen Maßstäben kapitalistischen Handels und Wandels, von denen Trump darum auch nichts weiter wissen will und nichts weiter zu wissen braucht als eben dies. Wenn Trump vom hard-working American spricht, dann meint er die Gleichung von überlegener Tüchtigkeit des Amerikaners und konkurrenzloser Überlegenheit Amerikas gegenüber allen anderen Nationen – dafür stehen für ihn die jobs, jobs, jobs
, die er Amerika zurückzuholen gedenkt.
Zwar sind ‚Jobs‘ bzw. ‚Arbeitsplätze‘ die übliche Münze, in der verantwortliche Politiker jeder Herkunft und nationalen Zugehörigkeit und überhaupt alle, die sich praktisch oder ideell um den Erfolg ihrer Nation in der internationalen Konkurrenz kümmern, diesen Erfolg auszudrücken belieben und messen – denn darin fassen sie die Einheit von gelungener, kapitalistisch rentabler Indienstnahme des Volkes und dessen materiellem Unterhalt ins Auge, die es nach Kräften zu fördern gilt, weil darin das Wohl einer modernen Nation liegt. Aber Amerika hat sich dieses Prinzip: Nationen erringen ihre Konkurrenzerfolge um Bereicherung an- und gegeneinander mittels der kapitalistisch rentablen Erwerbsarbeit ihrer Völker, die darin ihr Lebensmittel haben, seit jeher schon und unter Trump in denkbar radikaler Zuspitzung als den Standpunkt zu eigen gemacht, dass der im job praktizierte und verwirklichte Privatmaterialismus der überlegen tüchtigen Konkurrenzbürger mit Reichtum und Größe der überlegenen amerikanischen Nation identisch ist. Darin besteht für Trump die Ordnung der Dinge, d.h. die Weltwirtschaft geht ihren guten natürlichen Gang, weil und wenn sie diese Überlegenheit Amerikas und der jobbenden Amerikaner in jeder Hinsicht, auf jedem Feld zur Geltung bringt und beständig reproduziert.
Darum ist für Trump eines komplett ausgeschlossen: jegliches Verrechnen von nationalen Verlusten, die er dingfest macht, mit ökonomischen Erfolgszahlen anderer Art und aus anderen Bereichen, die er darum auch nicht glaubt. So ist konsequenterweise von seinem Standpunkt aus schon das Ausrechnen einer nationalen Arbeitslosenrate, zumindest bevor er ins Weiße Haus eingezogen ist, eine eigentlich für Amerika ungehörige Angelegenheit. In seinen Augen wird da mit dem skandalösen Resultat eines skandalösen Raubbaus am amerikanischen Lebensmittel, Lebensstil und Lebensinhalt auf eine Weise kalkuliert, als ob es diesbezüglich überhaupt irgendeine Rate geben könnte, die in Ordnung wäre – weswegen er ohne Probleme in der Lage ist, die offizielle Arbeitslosenrate ad libitum mit einem ein- bis zweistelligen Faktor zu multiplizieren, um damit jedes Mal klarzustellen, dass sich für seine USA erstens keine Arbeitslosenrate und zweitens schon gar keine gehört, die daher rührt, dass jobs nicht einfach nur schändlicherweise ab-, sondern verbrecherischerweise ins Ausland geschafft worden sind.
Er lässt sich von niemandem und in keiner Hinsicht den fundamentalen Widerspruch weg- oder auch nur kleinreden, auf den er mittels seiner beeindruckend selbstbezüglichen Dialektik an jedem verlorengegangenen Job im ‚Rust Belt‘, an geschlossenen Fabriken und verarmten Innenstädten dort und anderswo in seiner Heimat stößt: Amerika ist nicht das, was es eigentlich ist. Es ist die größte, mächtigste, reichste Nation der Welt mit dem tüchtigsten, ohne Abstriche auf Erfolg abonnierten Volk der Welt und den schlagkräftigsten Kapitalen und dem besten Geld der Welt – und muss doch hinnehmen, dass im Zuge und aufgrund des false globalism seiner bisherigen Administrationen jobs millionenfach verlorengegangen sind.
Die heftige Kritik Trumps lebt von der historisch einzigartigen Errungenschaft der Zurichtung des Globus für den Materialismus seiner Nation, und sie zielt auf eine entsprechende Vollendung dieses Werks.
b)
Wenn Trump fest davon ausgeht, die USA bzw. ihre tüchtigen Einwohner seien dazu berechtigt und vorbestimmt, jede Konkurrenz und insbesondere die internationale um den Reichtum der Welt zu gewinnen, und von daher sei kein Resultat dieser Konkurrenz zu dulden, das dieses Naturrecht verletze, so ist das seine patriotische Art, sich auf einen tatsächlichen welthistorischen Erfolg der USA so selbstverständlich wie affirmativ zu beziehen: Die Welt ist Mittel für den Reichtum der USA.
Heutzutage wirtschaften alle Nationen kapitalistisch. Wie gut oder schlecht sie damit jeweils fahren mögen, für alle schließt das ein, dass sie dem Handel über alle Grenzen hinweg offenstehen und offenzustehen haben. Mit dieser, seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges systematisch betriebenen kapitalistischen Öffnung erst der halben und nun der ganzen Welt vermögen die amerikanischen Kapitale viel Sinnvolles anzustellen: Sie verkaufen iPads, Boeings, Fords und Genmais samt Software und Infrastruktur zur Vernetzung von allem mit jedem in die ganze Welt und decken sich in der ganzen Welt mit allem ein, was für ihre Geschäfte nötig und nützlich ist, von afrikanischen Rohstoffen bis hin zu deutschen Edelwerkzeugen für ihre Fabriken.
Die stehen längst nicht mehr nur in Amerika, sondern werden auf der ganzen Welt errichtet und betrieben, die für amerikanische Kapitale nicht nur globaler Markt, sondern auch globaler Standort ist. Der Internationalismus der großen US-Unternehmen ist auch dabei grenzenlos und frei von jedem diskriminierenden Vorurteil. Denn ihre Kapitalmacht ermöglicht es ihnen, sowohl die Vorteile auszunutzen, die hochentwickelte kapitalistische Standorte für ihre Investitionen bieten, als auch die Sonderbedingungen in solchen Ländern, die zum Ausgleich für die nicht vorhandenen Schönheiten eines erfolgreich durchkapitalisierten Standorts mit dem speziellen Charme konkurrenzlos rücksichtsloser Ausbeutbarkeit der ortsansässigen Arbeitskräfte und aller anderen landeseigenen Naturbedingungen aufwarten. Überdies und nicht zu knapp machen die Global Players der USA von der ihre eigene Mobilität begleitenden Reiselust des Humankapitals dieser Welt Gebrauch. Auch hier zeichnen sie sich durch absolute Unvoreingenommenheit aus, wenn sie sich der Vertreter aller Rassen und Stände bedienen: Mit der Expertise britischer Finanzjongleure und Management-School-Absolventen bringen sie die Leitungsebenen ihrer Konzerne auf Vordermann; Abgeordnete der weltweiten Jugend lassen sie ihre Affinität zu allem, was ein Display hat, profitdienlich im Silicon Valley ausleben; was schließlich die Freude von Latinos und anderen Südländern an billig bezahlter körperlicher Arbeit angeht, so geben sie der daheim wie auswärts gleichfalls millionenfache Chancen zu mehr oder weniger legaler Betätigung.
Auf der ganzen Welt zu Hause fühlen können sich die unternehmerischen Exponenten amerikanischer Konkurrenztüchtigkeit überdies und insbesondere, weil sie überall mit ihrem heimatlichen Geld wirtschaften können, das an allen Standorten heimisch ist. Über alle Grenzen hinweg haben und messen private Geschäftsleute und Staaten ihre erreichten Erfolge und ihre Potenzen zu weiteren Konkurrenzunternehmungen in jedem Fall im Verhältnis zum, in vielen Fällen unmittelbar im Dollar. Dass angehäufte Dollars weltweit gültiger Reichtum und Vorschüsse in Dollar auf der ganzen Welt Mittel sind, daraus mehr Reichtum zu erwirtschaften, gilt darum erst recht für den auf Dollar lautenden Kredit, den die global führenden Finanzkapitale stiften, die passenderweise auf einen New Yorker Straßennamen getauft sind: Die von ihnen geschöpften Zahlungsversprechen wirken auf der ganzen Welt als Hebel kapitalistischer Geldvermehrung, umgekehrt also bewährt sich die ganze Welt als Mittel, aus Dollarwertpapieren akkumulierendes Kapital zu machen. Und auch die Finanzkapitale der USA sind für ihre Art einträglicher Dollargeschäfte nicht auf eine bestimmte Sorte von Marktteilnehmern fixiert, sondern bedienen diskriminierungsfrei jeglichen Bedarf, den die unterschiedlichen bis gegensätzlichen Weltmarktakteure nach ihrem Angebot hegen, deren Tauglichkeit für ihre Spekulation mit einem Rating zu versehen der Vollständigkeit und Gerechtigkeit halber ebenfalls ein einträgliches Geschäft von ein paar Wall-Street-Instituten ist: Auf dem einen Ende der Skala kommen sie mit den international erfolgreichsten privaten Konkurrenten ins Geschäft und bedienen deren Bedarf nach Kredit zwecks Wachstum, das sich heute nennenswert nur noch auf dem Niveau gigantischer Monopole erzielen lässt, die miteinander um nicht weniger als die Verdrängung aus bestehenden und die Stiftung komplett neuer Märkte konkurrieren und dafür die entsprechend groß dimensionierte finanzkapitalistische Spekulation auf diesbezügliche Zukunftserfolge brauchen. Im unteren Segment der Skala nehmen sie sich der Zahlungsnöte nationaler Standorthüter an, die sich bei ihnen in Dollar verschulden, weil ihre Standorte es ihnen schuldig bleiben, ihre staatlichen Schulden in kapitalistisches Geschäftsmittel, in dem Zuge die Druckerzeugnisse ihrer Notenbanken in ein brauchbares Geld und damit insgesamt die Hoheit über den Standort in wirkliche staatliche Finanzmacht zu verwandeln.
Letzteres gelingt den USA dafür umso besser. Die Internationale der privaten Geschäftsleute und die konkurrierenden Staaten zusammen sorgen mit ihrem betätigten Bedarf nach Dollar und Dollarkredit für die Verwandlung dieses Kredits in Kapital, umgekehrt mit ihrem Bedarf an sicheren Geldanlagen dafür, dass die Produkte der Wall Street und erst recht die kapitalistisch unproduktiven Schulden des amerikanischen Staates weltweit als unbedingt solides Finanzinvestment gelten. Den US-Dollar machen sie durch seinen entsprechenden Gebrauch zur Weltwährung Nummer Eins: der denkbar verlässlichsten Verkörperung kapitalistischen Reichtums.
2. Trump kommt angesichts der krisenhaften Resultate des US-Erfolgs auf die Grundlage und das ultimative Mittel aller Weltmarktkonkurrenz zurück: die überlegene Gewalt der USA
a)
Hinter diesen schönen Erfolg für Amerika und seine tüchtigen Kapitale will Trump ganz gewiss nicht zurück. Das wird leicht übersehen, weil sein America first!
gern als Protektionismus in einem längst überwunden geglaubten Sinn verstanden wird; weswegen auch immer wieder eine halbe, aber ganz unberechtigte Erleichterung um sich greift, wenn er sich dann doch ein Bekenntnis zum weltweiten Freihandel abringen lässt. Dabei fügt er auch da konsequent die nähere Bestimmung „fair“ hinzu, womit die Resultate des bisherigen Geschäftsgangs unmissverständlich als unfair definiert sind und ihre Korrektur angesagt ist.
Worauf der Präsident sich so kritisch bezieht, ist eine notwendige Konsequenz genau des Welterfolgs des US-Kapitalismus, dem er die hohen Maßstäbe seiner Kritik entnimmt. Die Herrichtung der Welt zur Sphäre der Akkumulation amerikanischen – und sonstigen konkurrenzfähigen – Kapitals in allen seinen Formen ist gleichbedeutend mit einer Überakkumulation, die in Geschäftszusammenbrüchen, der Streichung kapitalistischen Reichtums einschließlich der davon abhängigen Arbeitsplätze, der Eliminierung ganzer Gewerbezweige und Produktionsstandorte mündet. Kredit, den die amerikanischen Finanzmärkte generieren und die US-Notenbank mit ihrer Geldschöpfung beglaubigt, finanziert Wachstum weltweit, bis mehr investiert ist als sich lohnen kann; der „platzt“ dann, geht kaputt oder wird nicht mehr gegeben, ist gleichzeitig zu viel und zu wenig; nicht nur kapitalistische Unternehmen, sondern ganze Nationen geraten so sehr in Verlegenheit, wie sie vorher damit bewirtschaftet worden sind. Das trifft natürlich auch die USA; im Fall der vor nunmehr einem Jahrzehnt losgebrochenen Finanzkrise sogar zuerst und am härtesten, bevor dann die gewichtigen Konkurrenten mit hereingerissen worden sind – dank der Universalität des auf dem US-Finanzmarkt basierenden Kreditgeschäfts. Allerdings werden die USA auch am erfolgreichsten mit solchen Krisen fertig – auch das haben die vergangenen zehn Jahre nachdrücklich demonstriert –: Staatshaushalt und Notenbank refinanzieren mit Schulden und frisch geschöpftem Kreditgeld das in die Krise geratene Geldkapital, ersetzen so den schon annullierten Kredit durch Liquidität, die zwar keine Kapitalverwertung repräsentiert, insofern kapitalistisch so wertlos ist wie der „geplatzte“ Kredit, den sie ersetzt, dank der unanfechtbaren Garantie des amerikanischen Staates aber weltweit als Repräsentant kapitalistischen Reichtums genommen wird. Mit ihrem Machtwort „kauft“ sich die Weltwirtschaftsmacht Nummer Eins gewissermaßen aus der Krise ihres Kredits heraus und „rettet“ sogar in Kooperation mit den Notenbanken der anderen betroffenen Großmächte des Kapitals deren Kredit und garantiert die weltweite Gültigkeit deren Kreditgelds.
Diese Rettungstat verhindert allerdings nicht die Streichung von ziemlich viel über seine Verwertungsbedingungen hinausgewachsenem produktivem Kapital, und zwar weltweit in einem Umfang jenseits der üblichen unschönen Wirkungen des internationalen Wettbewerbs. Und dass die Ersetzung wertlosen Kredits durch Staatsgeld der Anerkennung dieses Geldes nicht schadet, die globalisierte Geschäftswelt sich also ebenso wie die konkurrierenden Nationen darauf verlassen, dass das Machtwort der Weltmacht so gut wie das Geldkapital ist, das es ersetzt, sorgt auch nicht automatisch dafür, dass die USA in der Krisenkonkurrenz um die Rettung oder Vernichtung produktiven Kapitals als Standort gewinnen. Das gehört ja gerade zu den Errungenschaften, die Amerikas Imperialismus der Unternehmenswelt beschert hat, dass gerade das in den USA beheimatete Kapital die Freiheit genießt und ausgenutzt hat, die ganze Welt nach optimalen Standorten durchzumustern und zu benutzen. Dabei bleibt es auch in der Krise: Amerikanische wie andere Unternehmen verteilen die fälligen Streichungen von Produktionsstandorten im Sinne ihres Gewinninteresses nach ihrem Ermessen und eben auch so, dass die USA Schäden zu registrieren haben.
Für die Regierungen in Washington sind solche Effekte natürlich eine Herausforderung, sie abzuwenden oder zu kompensieren. Und dafür haben sie mit ihrem unverwüstlichen Dollar nicht das schlechteste Mittel in der Hand. Mit ihrer hoheitlichen Gewalt setzen sie zwar nur Geldzeichen als Wertträger in Kraft, keine Kapitalverwertung, die den Wert eines Kreditgeldes ökonomisch verbürgt. Mit den durch ihre Geldhoheit garantierten Staatsschulden können sie aber durchaus Standorte und ganze Industrien retten, wenn sie es für angezeigt halten – Obama hat immerhin mit beträchtlichen Finanzmitteln das Kernstück der US-Autoindustrie reanimiert. Die hoheitliche Macht, mit der die Regierung Kapital rettet und den Kapitalstandort in Schuss hält: die hat es dem neuen Präsidenten angetan; an die Lehre, dass sich mit einem Machtwort Geschäfte finanzieren lassen, wenn es von der richtigen Instanz kommt, knüpft er an – auf seine Weise. Nämlich nicht in der finanzkapitalistisch sachgemäßen Form, Geld zu drucken und es im Maße seiner Anerkennung durch die Finanzwelt als brauchbares Geschäftsmittel für Investitionen zu verwenden, zu denen kein privater Unternehmer bereit ist: Trump saniert das ‚disaster‘, das er seiner Nation im Außenhandel attestiert, per Verbot. Vom Standpunkt des nationalen Segens kapitalistischer Produktion, verdolmetscht mit der stets dreifach wiederholten Beschwörungsformel „jobs“, legt er Einspruch ein: der Absicht nach gegen eine ökonomisch ungerechtfertigte Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Ausland, und zwar von guten und nötigen Jobs, wie ihre Verlagerung, ihr Neuaufbau an anderen Orten beweist; der Sache nach gegen eine Konsequenz der Krise, die eben aufgrund der von Amerika eingeführten, stets verteidigten und per Saldo auch allemal nützlichen Ermessensfreiheit der konkurrierenden, mit Krisenfolgen und -chancen kalkulierenden Kapitalisten an manchen Stellen auch die USA trifft.
Trumps Kritiker sehen an diesen Stellen – wie Trump selbst – nichts weiter als die freie – „unfaire“ – Konkurrenz am Werk; sie rechnen vor – was oft genug auch stimmen mag –, dass in dieser Konkurrenz Amerika als Nation im Ganzen gut abschneidet, besser als die meisten Konkurrenten, vor allem auf dem mit enorm viel Kredit versorgten Sektor der weltweit vermarkteten ‚Dienstleistungen‘; sie beharren auf der Universalerklärung „Strukturwandel“. Sie negieren damit den Zusammenhang, in den Trump die für Amerika negativen Ergebnisse der weltweiten Krisenkonkurrenz stellt, nämlich den der Schädigung Amerikas, und damit den Kontext, in dem sie tatsächlich zustande kommen: die Krisenkonkurrenz, die mit der Abwicklung einer globalen Überakkumulation nicht über Anteile an einem kapitalistischen Wachstum entscheidet, sondern eben Schäden verteilt.[1] Dagegen interveniert der neue Präsident ganz direkt mit dem Mittel, über das Amerika wie keine andere Nation verfügt.
b)
Für den Übergang: den Entschluss, mit Strafen für Fairness im Welthandel in seinem Sinn zu sorgen, reicht Trump die Gewissheit, dass er das kann. Was er damit tatsächlich aktiviert, ist eine imperialistische Wahrheit über „die Globalisierung“ und ihr weltweit „freigesetztes“ Geschäftsleben: Schlicht „freigesetzt“ ist da gar nichts. Sämtliche grenzüberschreitenden Eigentumsgarantien, alle Mittel, Bedingungen, Regeln der freien, kapitalistisch sachgerechten Verwendung des Geldes und seiner Kommandogewalt über die gesellschaftliche Arbeit auch in fremden Nationen sind von Staats wegen hergestellt. Sicher, moderne Staaten setzen in ihren Wirtschaftsbeziehungen nicht irgendwas, sondern sachliche Erfordernisse der Kapitalverwertung und des Kreditgeschäfts in Kraft. Und so, wie sie nach 70 Jahren eines amerikanischen Regimes über die Weltmärkte gelten, ist Trumps Bestrafungsinitiative ein Verstoß dagegen. Mit der kommt der Präsident andererseits zielsicher auf die Grundlage der internationalen Gültigkeit aller Sachgesetze des Kapitals „zurück“: Die gelten, weil sie von den beteiligten Souveränen mit ihrer hoheitlichen Gewalt in Kraft gesetzt sind, daher auch gemäß den Maßregeln, die die Herrschaften miteinander ausgemacht resp. die einen den anderen erfolgreich zugemutet haben. Die Freiheit sachgerechten kapitalistischen Wirtschaftens im Weltmaßstab, des grenzüberschreitenden Kaufens und Verkaufens, des Investierens und Ausbeutens von Menschen und Natur, des Finanzierens von und Spekulierens auf Investments von Privatunternehmen und Staaten beruht auf der wechselseitigen Inanspruchnahme der nationalen Staatsgewalten für ihr kapitalistisches Wirtschaftsleben.
Freilich haben diese Setzungen nicht bloß eine siebzigjährige Entwicklungsgeschichte hinter sich. Sie haben ihre eigene Logik und Verbindlichkeit. Schon mit der Ankündigung einer Politik des „fairen“ Bestrafens kündigt Trump eine internationale Rechtsordnung.
II. Trumps Absage an die Weltordnung: I’m going to rip up these bad trade deals and we’re going to make really good ones.
1. Trump verurteilt die Sphäre multinationaler Satzungen, Institutionen und Organisationen als Unrechtsordnung gegen Amerika und setzt seine Politik des good deal dagegen
a)
Der neue Präsident ordnet die Schäden an Amerikas Nationalökonomie infolge krisenhaft verschärfter Standort-Konkurrenz der international agierenden Konzerne und der staatlichen Standort-Hüter als Rechtsbruch ein; im Superlativ, wie es seine Art ist: greatest jobs theft in the history of the world
. Eine ökonomische Kategorie ist das nicht: „Diebstahl“ ist der Rechtstitel für eine Beschwerde, die der US-Präsident freilich nicht bei irgendeiner übergeordneten Schieds- und Schlichtungsstelle einlegt – von denen es in der ordentlichen Welt des globalisierten Kapitalismus ja jede Menge gibt –, sondern bei sich selbst als dem Hüter der Rechte des amerikanischen Volkes und seiner Konkurrenzerfolge. Er spricht sich damit das Recht auf Gegenwehr zu. Und er drückt auch deutlich aus, wie er diese Gegenwehr verstanden haben will: als Bestrafung derer, die Amerika um sein Recht auf ungeschmälerten Konkurrenzerfolg betrogen haben. Dabei nimmt er nicht die Position des Richters ein, der beide Streitparteien anhört, den Streitfall mit dafür geltenden Regeln abgleicht und zu einem Verdammungsurteil gelangt; noch nicht einmal zum Schein, wie es im zwischenstaatlichen Verkehr üblich ist, wenn die Parteien ihre entgegengesetzten Interessen als Rechtspositionen der Weltgemeinschaft und ihren ideellen oder auch völkerrechtlich befugten Schiedsrichtern vortragen. Trump reklamiert das Recht auf Bestrafung als betroffene Partei; er schließt das reklamierte Recht auf einen Gegenschlag mit dem Standpunkt einer dadurch wiederherzustellenden Rechtsordnung der Fairness zusammen, und das eben nicht im Sinne einer selbstermächtigenden Unterordnung unter ein überstaatliches Prinzip, wie es die übliche diplomatische Heuchelei verlangt, sondern im Sinne einer umstandslosen Verabsolutierung des eigenen Rechtsstandpunkts. Als Partei setzt er sich über alle Parteien: eine ideelle Absolutsetzung des eigenen Interesses, die ganz offenkundig in der durch keinerlei Zweifel angekränkelten Sicherheit geschieht, die Reparatur des Schadens der Nation per Bestrafung, also die Wiederherstellung des Rechts Amerikas auf Erfolg auch praktisch ohne relativierende Rücksichten, schon gar nicht auf eine nennenswerte Gegenwehr der Gegenseite, durchsetzen zu können. Es ist, als wollte Trump den Begriff des Faustrechts sauber herausarbeiten – tatsächlich führt er es als gültigen amerikanischen Rechtsstandpunkt in die Weltpolitik ein.
Ganz in diesem Sinn übt er Kritik an den Abkommen, die seine Vorgänger abgeschlossen oder über die sie ernsthaft verhandelt haben. Dass in diesen Abmachungen Amerikas Interessen preisgegeben worden sind oder werden sollten, entnimmt er nicht dem Inhalt der Vereinbarungen, sondern mit Blick auf geschlossene Verträge der Tatsache des von ihm erkannten Schadens, der sich mit der überlegenen Konkurrenzfähigkeit des amerikanischen Arbeiters überhaupt nicht vereinbaren lässt, also durch Verstöße gegen das Recht des Überlegenen auf Erfolg verursacht sein muss; ganz gleich, ob sich den Bestimmungen in den dafür haftbar gemachten Verträgen ein solcher Verstoß oder auch nur ein Indiz dafür entnehmen lässt. Verträge wie TTIP, die noch nicht ausverhandelt und abgeschlossen worden sind, nachteilige Wirkungen also noch gar nicht entfaltet haben können, belegt er nicht mit dem Verdacht, sondern dem fertigen Verdikt, damit würden Amerikas überlegener Konkurrenzmacht Fesseln angelegt: den Kontrahenten Lizenzen zu ungerechtfertigter Bereicherung erteilt, den USA Mittel und Möglichkeiten der Gegenwehr aus der Hand geschlagen. Einen schlagenden Beweis liefert ihm wiederum eine Tatsache, nämlich die des enormen deutschen Überschusses im Handel mit Amerika; und da wird seine Kritik zwar auch nicht sachlich, aber durchaus hellsichtig: Hinter dem Interesse der EU an einem umfassenden Partnerschaftsvertrag mit den USA und hinter der Konstruktion eines vereinten Europas als Vertragssubjekt erblickt er eine raffinierte Strategie der Deutschen, mit einer Art internationaler Bandenbildung, noch dazu zum Schaden der von ihnen rekrutierten Spießgesellen, Amerikas Überlegenheit auszuhebeln. Das hätten seine Vorgänger mit ihrem viel zu positiven Verhältnis zur EU nicht bloß nicht gemerkt; sondern sogar als legitim anerkannt. Tatsächlich ist denen der immanente Antiamerikanismus des europäischen Einigungsunternehmens überhaupt nicht verborgen geblieben; doch deren Überlegungen, wie sich Europas und speziell Deutschlands Wille zur Emanzipation von Amerika und zur Gleichrangigkeit mit der Weltmacht einhegen, neutralisieren und eventuell sogar zum Vorteil der USA funktionalisieren ließe, sind dem neuen Präsidenten völlig fremd; und für die entsprechenden Versuche seiner Vorgänger zur Beschränkung und Vereinnahmung des Projekts EU fehlt ihm jedes Verständnis. Er ist jedenfalls dagegen und deswegen von Haus aus für alle europäischen EU-Kritiker und -Feinde, ganz gleich, was die selber wollen und ob sich deren Nationalismus mit dem seinen verträgt; dass sie gegen die EU und den Machtzuwachs sind, den Deutschland nicht bloß in der Vorstellungswelt des US-Präsidenten damit betreibt, genügt ihm schon – je radikaler, das ist sein einziger Maßstab, desto besser.
Ganz grundsätzlich braucht der US-Präsident nicht den Nachweis irgendwelcher Amerikas Interessen diskriminierenden Bestimmungen, um sich insgesamt entschieden ablehnend vor allem zu allen multilateralen zwischenstaatlichen Vereinbarungen zu stellen, in denen die USA als eine Vertragspartei unter anderen vorkommen und zu irgendetwas verpflichtet werden. Die Konvention zum „Klimaschutz“ ist dafür der aktuelle und zugleich ein exemplarischer Fall: Entscheidend für das Nein dazu sind die weltweiten Folgen eines globalen Temperaturanstiegs jedenfalls überhaupt nicht, auch nicht wirklich die widerstreitenden Argumente zum kapitalistischen Gewinn für den Standort Amerika aus konventioneller oder „regenerativer“ Energiegewinnung, sondern die Ge- und Verbote in Sachen Energiepolitik, die Amerikas Handlungsfreiheit und damit, das ist für Trump identisch, das Ausspielen amerikanischer Überlegenheit im Weltgeschäft behindern würden. Das, in all seiner Abstraktheit und Radikalität, ist es, was der Präsident seinen Vorgängern und dem Establishment überhaupt zum Vorwurf macht und unbedingt beenden will: eine Politik der Preisgabe möglicher nationaler Konkurrenzerfolge, die Amerika zustehen, weil es zu ihnen fraglos fähig ist. Überlegenheit und das nicht zu relativierende Recht des Überlegenen, seine Überlegenheit voll und uneingeschränkt auszuspielen, fallen in dieser Absage an internationale Abmachungen als Fußfesseln für die USA zusammen. Was als „unfair“ zurückgewiesen wird, ist jede Einschränkung des Rechts des Stärkeren.
b)
Mit Trumps Kritik an den Ergebnissen des Außenhandels als strafwürdige Rechtsverletzung und an den Vertragsbeziehungen der USA als unfaire Fesselung des amerikanischen Riesen ist auch schon der Standpunkt der Korrektur angesagt. Bei den Abkommen zum Nachteil der USA handelt es sich für Trump um „bad deals“; an deren Stelle treten ab sofort „good deals“, wobei das „good“ gewöhnlich in höchsten Steigerungsstufen umschrieben wird. Seinen ganzen Stolz legt er in die Selbstdarstellung als der fähigste Dealmaker, den die Welt je gesehen hat; und das trifft seine Politik, die das Recht des Stärkeren zu ihrer Leitlinie macht, ganz gut. Amerika hat ja Interessen, ganz viele und ganz substanzielle, die sich auf Gegenparteien in aller Welt richten. Diese Interessen sind nicht nur der Ausgangspunkt, sondern der alleinige Inhalt aller Deals, die mit anderen auszumachen sind. Sie sind Ausgangspunkt nicht für die Ermittlung eines komplementären Interesses der Gegenseite, das sich für den eigenen Bedarf funktionalisieren ließe, geschweige denn für die Festschreibung irgendwelcher übereinstimmenden Anliegen oder Bedürfnisse, sondern für ein Kräftemessen zwecks Ausnutzung des Kontrahenten, für das Ausspielen amerikanischer Überlegenheit mit dem Ziel, die Gegenseite zu was auch immer, jedenfalls zu Gunsten der USA zu nötigen. Man liegt sicher nicht falsch mit der Diagnose, dass Erpressungsgeschäfte dieser Art schon immer zum Programm der amerikanischen Weltpolitik gehören. Umso auffälliger ist der Standpunkt des neuen Präsidenten, Amerika müsste unter seiner Führung diese Art des Zugriffs auf die externe Staatenwelt überhaupt erst wieder, und zwar kämpferisch, zur Geltung bringen. Was er der Welt damit ansagt, ist eine von allen überkommenen Vorentscheidungen und Vorfestlegungen freie Prüfung des Weltgeschehens und der Interessen, Standpunkte und Taten der daran Beteiligten ausschließlich unter dem Gesichtspunkt, ob mit einem erpresserischen Eingreifen an dieser oder jener Stelle ein Nutzen für Amerikas Macht und Reichtum herauszuholen ist – wenn ja, wird das und sonst nichts mit dem jeweiligen Adressaten ausgemacht; wo solche Deals nicht zu machen sind, werden sie auch nicht gemacht.
Wie Trump an die entsprechende Umgestaltung der Rechtsbeziehungen seines Landes zu anderen Staaten herangeht, wird exemplarisch an einem Interview mit dem Londoner Economist (erschienen am 12. Mai 2017) [2] deutlich. Die Zeitung möchte vom neuen Präsidenten wissen, worin sich „Trumponomics“ von der üblichen republikanischen Wirtschaftspolitik unterscheidet. Der Gefragte lobt erst einmal die ihm schmeichelnde Frage und nennt die patriotische Einstellung als entscheidenden Unterschied:
„Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, sie wurde in der Form noch nie gestellt. Tatsächlich hat es mit dem Selbstrespekt als Nation zu tun. Es hat zu tun mit Handelsverträgen, die fair sein müssen und irgendwie reziprok, wenn nicht völlig reziprok. Und ich denke, das ist ein Wort, das sie noch oft hören werden, denn wir brauchen Reziprozität in Bezug auf unsere Handelsverträge.“
Nachdem er wissen lässt, dass er für ‚fair‘ noch ein zweites, nicht so übliches Wort kennt und offenbar mag, verfällt er ins Erzählen, wie unfair ihn die Freihandelsfraktion attackiert, dass die USA überhaupt keine guten „trade deals“ haben, dass damit nun Schluss ist, weil er schlechte Deals – es geht um NAFTA – einfach kündigt, und wie raffiniert er den mexikanischen und den kanadischen Staatschef dadurch in die Position von Bittstellern manövriert hat:
„Und ich war letzte Woche schon dabei, NAFTA zu beenden, ich war voll entschlossen; das heißt sechs Monate Kündigungsfrist. Ich wollte ihnen einen Brief schreiben, dann nach sechs Monaten ist es tot. Aber sie haben davon erfahren, sie riefen an und sagten, sie würden sehr gerne ... sie riefen getrennt an, aber es war erstaunlich. Sie riefen getrennt an im Abstand von zehn Minuten. Ich habe gerade das Telefon mit dem Präsidenten von Mexiko weggelegt, als der Premierminister von Kanada anrief. Und beide stellten fast identische Fragen. ‚Wir wüssten gerne, ob es möglich wäre zu verhandeln anstatt einer Kündigung.‘ Und ich sagte: ‚Ja, durchaus‘ ...“
Economist: „Das klingt, als hätten Sie eine ziemlich große Neuverhandlung von NAFTA im Auge. Wie würde ein faires NAFTA-Abkommen aussehen?“
„Groß ist als Wort nicht gut genug: Massiv.“
„Riesig?“
„Das muss es sein. Das muss es sein.“
Jetzt fängt auch der Interviewer an, alles zweimal zu sagen; außer „riesig“ hat er ja noch nichts über die angestrebten Korrekturen erfahren:
„Wie würde es aussehen? Wie würde ein faires NAFTA aussehen?“
„Nein. So muss es sein. Sonst kündigen wir NAFTA.“
Trump weist die Frage zurück: riesige Korrekturen oder Kündigung; mehr gibt es zu den geplanten Neuverhandlungen nicht zu sagen. Der Economist hakt nach und provoziert nur die nächste Runde Wiederholung.
„Wie würde ein faires NAFTA aussehen?“
„Ich war voll entschlossen, wissen Sie. Und das war nicht wie ... das war kein Spiel, das ich spielte.“ – Und dann fallen ihm die Spiele ein, die es so gibt: „Ich habe nicht herumgespielt, wissen sie, ich habe nicht Schach oder Poker oder sonst ein Spiel gespielt. Das war, ich war, ich hab’ nicht einmal daran gedacht ... es ist immer am besten, wenn man es auch wirklich so fühlt. Aber ich war ... ich hab’ an nichts anderes gedacht und diese zwei da [sein Finanzminister und der Handelsbeauftragte, die anwesend sind] werden es Ihnen sagen, dass ich an nichts als Kündigung gedacht habe. Aber wegen meiner Beziehung zu beiden [Präsidenten] sagte ich, auch ich würde dem [einer Neuverhandlung] gerne eine Chance geben, das geht in Ordnung. Ich meine, wegen des Respekts vor ihnen. Es wäre sehr respektlos gegenüber Mexiko und Kanada, hätte ich gesagt, ich würde nicht.“
Trump definiert auf seine Weise, wie der „fair deal“ beschaffen ist, den Amerika beansprucht: Er steht auf dem Standpunkt, dass die USA einen Handelsvertrag, schon gleich ein mehrseitiges Freihandelsabkommen mit Nachbarn nicht nötig haben. Seine angedrohte Kündigung nötigt die Partner zum Geständnis, dass sie einen Vertrag brauchen, dass also allein schon ein Vertragszustand überhaupt eine Konzession ist, die sie sich verdienen müssen. In den einseitigen Verhandlungen, die anstehen, haben sie nichts zu verlangen. Wie zum Hohn setzt Trump hinzu, nur aus Respekt vor beiden Staatschefs gewähre er ihnen die Gunst, den USA so lange Konzessionen anbieten zu dürfen, bis die zufriedengestellt sind und ihr Vorteil aus dem Handel garantiert ist. Der Economist merkt nicht, dass er die Auskunft, die er sucht, schon bekommen hat, und fragt noch einmal:
„Aber Herr Präsident, was muss sich ändern, damit sie sich nicht [vom Vertrag] zurückziehen?“
Trump wiederholt seinen Wahlspruch vom „fair deal“ und kommt auf das Handelsbilanzdefizit mit den NAFTA Partnern zurück, das er jetzt ganz furchtbar nennt.
„Muss das 70-Milliarden-Dollar-Defizit auf Null kommen, um fair zu sein?“
„Nicht unbedingt. Und sicher kann es, wissen Sie, über eine ziemlich ausgedehnte Zeitspanne dahin kommen, ich hab’ ja nicht vor, das System zu schockieren. Aber es muss wenigstens fair werden. Und nein, es muss nicht sofort auf Null gehen. Aber irgendwann würde ich es schon gerne auf Null bringen, wo manchmal wir und manchmal sie im Plus sind.“
Trump, der das Handelsbilanzdefizit zum zentralen gegen die USA verübten Unrecht der Handelspartner erklärt, lässt sich auf Null-Defizit als Ziel nicht festlegen. Er hält das offen; festgelegt ist er nur in einer Hinsicht: Er besteht darauf, dass Amerika anders als unter seinen Vorgängern Vertragsbeziehungen ohne jede Rücksicht auf weltwirtschaftliche Erfordernisse und Wachstum anderswo eingeht, an dem es als Nation dann partizipiert. Verträge hat es allein zum nationalen Konkurrenzvorteil aus einer Position der Überlegenheit und Freiheit zu schließen; gut sind Deals, die diesen Vorteil aus dem zwischenstaatlichen Verkehr festschreiben und die Partner binden – mehr Reziprozität ist unverträglich mit seiner großen Nation. Worin der nationale Vorteil im einzelnen besteht, das muss Trump jetzt nicht wissen. Sein Land muss durch Vertragsbeziehungen zufriedengestellt werden; wann es das ist, wird er dann schon sehen und den Vertragspartnern rechtzeitig mitteilen. Da hält sich der Präsident an seinen anderen Wahlspruch:
„Ich gebrauche immer das Wort Flexibilität. Ich habe Flexibilität.“
Diesem Prinzip des Händlers folgt Trump, wenn er abwägt, was für Leistungen er von anderen Staaten verlangt und welchen Preis ihm das wert ist. Dabei wird alles mit allem kommensurabel und aufrechenbar. Stolz erzählt er in diesem Sinn, wie er China, das er im Wahlkampf der Währungsmanipulation bezichtigt hatte, für seine Kampfansage an Nordkorea einkauft:
„Also ich habe ihnen [den chinesischen Verhandlungspartnern] gesagt, ich sagte: ‚Wir haben ein Problem und wir werden das Problem lösen.‘ Aber er [der chinesische Staatschef Jinping] will uns bei der Lösung dieses Problems helfen. Man weiß eben nie, was passiert. Aber sie [die Trump-kritischen Medien] kommen mir mit der Währungsmanipulation. ‚Donald Trump hat es unterlassen, China einen Währungsmanipulator zu nennen.‘ Eines muss ich doch verstehen. Ich verhandle mit einem Mann, ich denke, ich mag ihn sehr. Ich denke, er mag mich sehr. ... Ich meine, er ist ein großartiger Typ. ... Er repräsentiert China und will das Beste für China. ... Jetzt stellen Sie sich vor. Ich sage: ‚Jinping hilf uns, lass uns einen Deal machen. Hilf uns mit Nordkorea und übrigens morgen geben wir bekannt, dass ihr Währungsmanipulatoren seid. OK?‘ Die sagen das nicht so, Sie kennen die fake media, sie bringen beides nicht zusammen, sagen immer nur, er hat ihn nicht Währungsschwindler genannt. Das ist das eine. Zum anderen manipulieren sie [die Chinesen] gegenwärtig gar nicht an ihrer Währung. Wissen Sie, seit ich in Bezug auf sie und andere Länder von Währungsmanipulation rede, haben sie damit aufgehört.“
Für sein wunderbares Geschäft mit dem großartigen chinesischen Typen tut Trump gar nicht erst so, als hätten die USA und China mit Nordkorea ein gemeinsames Problem und ein gemeinsames Interesse, das andere Konfliktthemen relativiert. Er macht ihm einfach die Ansage, dass die USA ein Problem haben, das sie lösen werden, dass sie also an der chinesischen Grenze einen militärischen Konflikt eskalieren und mit dem störrischen Verbündeten Chinas das ganze Vorfeld seiner Macht abzuräumen gedenken. Wenn China dabei „helfen“ will, ist es herzlich eingeladen. Das ist schon der ganze „Deal“. Als Konzession von seiner Seite reitet er vorerst nicht auf seinen währungspolitischen Vorwürfen herum, aber richtig aus dem Verkehr zieht er sie auch nicht – jedenfalls will er China nicht gleich „morgen“ wieder mit dieser Leier kommen; außerdem ist er so frei zu befinden, dass es vor lauter Trump schon von selbst mit dem Manipulieren aufgehört habe. Was mit dem Währungsstreit passiert, wenn China die erwartete Hilfe gegen Nordkorea schuldig bleibt oder wenn das ‚Problem‘ nach Trumps Geschmack ‚gelöst‘ ist, wird er den „great guy“ dann schon wissen lassen.
Nicht nur „Flexibilität“, auch eine gewisse Großzügigkeit gehört für den Präsidenten also dazu, zu den Deals, die er der Welt anzubieten hat. Wenn Amerikas Nutzen, die Bedienung eines gewichtigen Interesses gesichert ist, dann kann die Gegenseite zwar nicht erwarten, dass Amerika dafür einen Preis zahlt und sich „fesseln“ lässt. Sie darf aber ruhig auch einen Gewinn verbuchen, sofern der die USA nichts kostet. Entscheidend ist in jedem Fall das Ergebnis, nicht eine zwischen Amerika und dem Kontrahenten ausgemachte Regel, nach der miteinander verfahren, der eigene Vorteil am anderen gesucht und das Ergebnis akzeptiert wird. Als überlegene Vertragspartei schließt Amerika Verträge allein über seinen Nutzen: Mit diesem schlichten Prinzip – das seine Vorgänger missachtet haben – bringt Trump die Welt wieder ins Lot.
2. „America first!“ statt „Leadership“: Trump revidiert die Logik der „Globalisierung“
a)
Ein rundes Dutzend US-Präsidenten vor Trump haben mit ihrer Weltpolitik sehr explizit das Ziel amerikanischer „Leadership“ verfolgt: Die Weltmacht bezieht sich auf die anderen Nationen als ihre Gefolgschaft, indem sie deren Souveränität förmlich anerkennt, für die Betätigung staatlicher Macht Forderungen aufstellt, Bedingungen vorgibt, materielle Mittel verfügbar macht und den Souveränen zumutet, diese Vorgaben als in ihrem wohlverstandenen Eigeninteresse liegend zu akzeptieren und auf der Basis mit den USA zu kooperieren. Den gewünschten Erfolg hatte sie damit zunächst nur in der dem „Westen“ zuzurechnenden Hälfte der Welt; in das daraus entstandene Netzwerk supranationaler Institutionen, das rechtliche Regelwerk und die dadurch regulierte und betreute weltpolitische Praxis der Staaten haben sich schon vor und definitiv nach dem Ende der sowjetischen Gegenmacht und dem Schwenk der VR China auch die Mitglieder der anderen Welthälfte eingeordnet.
Ausgangspunkt und Grundlage dieser amerikanischen ‚Führerschaft‘ war eine Überlegenheit der USA im Verhältnis zu den anderen kapitalistisch wirtschaftenden und imperialistisch ambitionierten Mächten auf der Welt, die tatsächlich an eine Art Gewaltmonopol mit einiger Kompetenz zu zwischenstaatlicher Rechtsetzung und -durchsetzung heranreichte. Am Ende des – in Allianz mit der und beginnender Feindschaft zur Sowjetunion gewonnenen – Weltkriegs waren die Gegner zerstört und auf Basis ihrer bedingungslosen Kapitulation erst Objekte, dann zunehmend souveräne Mitakteure ihres Neuaufbaus, eines Musterfalls von imperialistischem „Nation-Building“; die ruinierten Verbündeten wurden in diesen Prozess mit einbezogen – mit Ausnahme eben der Sowjetunion, die sich der amerikanischen ‚Führerschaft‘ entzog, dadurch den Zusammenhalt der kapitalistischen Staaten unter US-Regie erst richtig stabilisierte und im Übrigen für ein Regelwerk ziviler Beziehungen zwischen souveränen Staaten durchaus zu haben war und sich auch als mit Veto-Recht ausgestattete Führungsmacht in der Organisation der Vereinten Nationen, der zivilen Fortsetzung und Erweiterung der großen Weltkriegs-Allianz, betätigte. Die bis dahin aus den imperialistischen Zentren regierten Völker wurden unter den gleichen materiellen Vorgaben und rechtlichen Bedingungen zu souveräner Staatlichkeit „befreit“.
Instrument amerikanischer „Leadership“ war diese institutionalisierte Staaten-Ordnung hauptsächlich insofern – und ist in dem Sinn auch wirksam geblieben –, als sie explizit und implizit die Internationalisierung des Kapitalismus und seines beherrschenden nationalen Standorts Amerika zum Inhalt hat: implizit, indem sie die Staaten mit der Anerkennung ihrer Souveränität bei gleichzeitiger Verpflichtung zu zivilen Umgangsformen im Verkehr miteinander, formell abgesichert durch einen förmlichen Gewaltvorbehalt der UNO und ihres Leitungsgremiums, als Konkurrenten um Macht und um staatlich verfügbaren Reichtum als Basis ihrer Macht definiert und aufs Konkurrieren als ihre Staatsräson festlegt; explizit machen verbriefte Freiheiten für den internationalen Warenhandel, Schutzgarantien fürs kapitalistische Eigentum und seine internationale Verwendung, IWF und Weltbank als supranationale Kontroll- und Hilfsorgane für die Finanzierung der Außengeschäfte der Nationen und anderes von der Art die Welt zum Betätigungsfeld jeglichen dazu fähigen Kapitals, des US-amerikanischen also allemal, und zum Kampfplatz einer Konkurrenz der nationalen Kapitalstandorte, für die die USA ihren Kredit als die Finanzquelle, ihr Kreditgeld als das Geschäftsmittel weltweiter Kapitalakkumulation bereitgestellt haben und nach wie vor reichlich verfügbar machen. So ist es den USA tatsächlich gelungen, die eigenen Ansprüche an die Staatenwelt als die geltende Rechtslage und das Recht der Staaten zu verankern. Im Rahmen dieses – mittlerweile nun also die ganze Welt umspannenden – Systems schließen lauter kapitalistisch wirtschaftende Staaten untereinander nicht bloß Tauschgeschäfte und andere Deals ab, für deren Einhaltung durch ihren Kontrahenten sie mit ihren Mitteln, mit Angeboten, Erpressungen und Gewalt, selber sorgen müssen. Vielmehr richten sie sich in ihrem Verkehr untereinander nach quasi rechtlichen Regeln, die sie zwar weder erfunden noch wirklich in Kraft gesetzt, aber auf freundliche Einladung der USA als anerkannte freie Hoheiten unterschrieben und so für sich und allgemein verbindlich gemacht haben. Ihre zivilen Konkurrenzbemühungen richten sie zwar in aller Entschlossenheit gegeneinander, aber auf das Interesse und den Zuspruch eines finanzkapitalistischen Reichtums, dessen universelle Zugriffsmacht Amerika und die allgemein genutzte kapitalistische Geschäftsordnung gewährleisten.
Die USA als Schöpfer dieses Ordnungsrahmens für konkurrierende Kapitalstandorte treten hinter dem Eigenleben, das ihr Geschöpf entfaltet, und als Garant seiner Wirksamkeit – unter Vorbehalt! – hinter den im System eingebauten Garantien zurück; in der Sicherheit, dass überall da, wo kapitalistisch konkurriert wird, ihre Unternehmen, ihre Kreditschöpfer, ihr ökonomisches Nationalheiligtum US-Dollar, also ihr nationaler Reichtum mit dabei sind, direkt oder indirekt, und mit profitieren. Als Führungsmacht des globalisierten Kapitalismus und der darauf eingeschworenen Staatenwelt finden sie zwar dauernd Anlässe – von ihrem Standpunkt aus: sind sie immer wieder mit der Notwendigkeit konfrontiert –, ihre Entscheidungskompetenz mit Erpressungen oder Gewaltanwendung direkt geltend zu machen; insbesondere weil immer irgendwer gegen die geltenden Regeln – bzw. gegen deren verbindliche Auslegung im amerikanischen Interesse – verstößt. Grundsätzlich nehmen sie aber die anderen Staaten als eigenverantwortliche Akteure für den Fortgang des Weltgeschäfts in Anspruch und gehen davon aus, dass denen ihr Eigennutz ganz von selbst Gefolgschaft gegenüber den Regeln gebietet, denen in letzter Instanz das amerikanische Finanzkapital ihren lebendigen Sinn verleiht. Diesen Standpunkt haben die zuständigen US-Administrationen auch über die unausbleiblichen Enttäuschungen hinweg durchgehalten. Der Widerspruch, an dem praktisch alle anderen Regierungen laborieren, nämlich zwischen nationaler Souveränität und verbindlichem supranationalem Regelwerk gilt in der Allgemeinheit zwar auch für die USA, hat für sie aber seine eigene grundsätzlich positive Bedeutung: Gerade als verselbständigtes, von allen Betroffenen mitgetragenes Regime und mit dem Eigenleben ihrer supranationalen Organe bewirkt die Geschäftsordnung des globalen Kapitalismus und der Konkurrenz der Staaten die Verallgemeinerung, die allgemeine Anerkennung des amerikanischen Nationalinteresses an einer Welt, die ohne Abstriche als Ressource und Markt für die Akkumulation von Kapital, also nicht zuletzt für die Verwandlung amerikanischen Kredits in kapitalistischen Reichtum funktioniert. Mit der Anerkennung einer auch für sie verbindlichen Konkurrenzordnung setzen sich die USA als die Macht mit den überlegenen Konkurrenzmitteln an die Spitze der so „geordneten“ Welt. Für die anderen Staaten gilt die Scheidung zwischen Souveränität und vorgegebenen quasi rechtlichen Schranken ihrer Betätigung; das Recht, das sie als Höchste Gewalten unbedingt beanspruchen, ist überführt in ein Recht, das ihnen im Rahmen des von ihnen souverän akzeptierten Regelwerks zukommt, was Anerkennung und Bedingtheit zugleich bedeutet. Für die USA gilt das der Form nach auch; nur hat die Form da einen etwas anderen Inhalt: Anerkannt ist eben ihre „Leadership“; die Bedingung ist, dass sie sich dementsprechend um die Gefolgschaft kümmern.
Dass die Welt nie einfach so funktioniert hat, liegt auf der Hand. Nach diesem Prinzip hat Amerika aber über Jahrzehnte seinen Imperialismus praktiziert; mit beträchtlichem Erfolg – und einem Ergebnis, das für den neuen Präsidenten den Tatbestand eines „total disaster“ erfüllt.
b)
Nicht irgendeinem Vertrag, nicht einem ihn störenden Bestandteil des US-amerikanischen Gesamtkunstwerks der „Globalisierung“ der Konkurrenz unter der Prämisse US-amerikanischer Überlegenheit, sondern der diesen Regeln und Einrichtungen innewohnenden Verbindlichkeit auch für Amerika – und seinen Präsidenten! – erteilt der Neue eine Absage. Erklärtermaßen will er die Gleichung auflösen, um deren Herstellung und Aufrechterhaltung sich seine Vorgänger seit Wilson und Roosevelt bemüht haben: Trump will Präsident der USA und nicht „Präsident der Welt“ sein:
„I’m not, and I don’t want to be the president of the world. I’m the president of the United States, and from now on it’s going to be America first.“ (Trumps Rede auf einer Versammlung der US-amerikanischen Bauarbeiter-Gewerkschaft NABTU, 4.4.17)
Die Floskel ist nicht bloß ein Gruß an seine Wähler im Kohlerevier der Appalachen oder im ‚Rust Belt‘, denen die Welt außerhalb ihres County schnurz ist. Er kündigt damit die ganze Art und Weise auf, wie die USA die Staatenwelt auf sich ausgerichtet und für ihre Interessen funktionalisiert haben – per „Leadership“, durch Angebote an den nationalen Eigennutz der Gefolgschaft, so eben als wäre der US-Präsident irgendwie auch für deren Zurechtkommen verantwortlich. Trump setzt nicht – mehr – auf einen Erfolgsmechanismus, nach dem aus Führerschaft nationaler Nutzen folgt; statt auf dieser Methode der Verallgemeinerung des nationalen Eigennutzes Amerikas besteht er auf dessen direkter Verabsolutierung. Mit ihm als dem großen Dealmaker zieht die Weltmacht einen Schlussstrich unter eine Weltordnung, deren Ergebnisse ihr nicht mehr genügen.
Dabei geht aus Trumps Polemik gegen räuberische Konkurrenten in Fernost und in Europa deutlich genug hervor, inwiefern Amerika mit dieser ‚Ordnung der Dinge‘ an ein Ende gekommen ist: In ihrem Rahmen sind der Weltmacht Rivalen erwachsen, die es sich herausnehmen und, wenn der Rahmen des ‚false globalism‘ bestehen bleibt, auch in der Lage sind, Amerika zu schädigen und seine Weltmacht in Frage zu stellen. Mit ihrem Erfolg auf Kosten Amerikas, der in der Krise und in der Konkurrenz um die Folgen der Überakkumulation so peinlich offenbar geworden ist und Trump als Anwalt seines Volkes nicht ruhen lässt, führen diese Rivalen die Methode des US-Imperialismus und das ganze System rechtsförmiger ‚Führerschaft‘ der USA ad absurdum: Es bewährt sich nicht mehr so, wie es gemeint war und gewirkt hat, im Sinne von America first!
. Wenn Trump exemplarisch Deutschlands Exportüberschüsse zu Lasten der USA für bad, very bad
befindet, dann zieht die Weltmacht eine Bilanz und gelangt zu einem klaren Befund: Der Widerspruch, den Amerika sich als Führungsmacht der kapitalistischen Staatenwelt geleistet hat, indem es ganz generell den Konkurrenten in Sachen Kapitalwachstum und Staatsreichtum alles gestattet, ja sogar materiell ermöglicht, was sich Amerika selbst erlaubt, ist umgeschlagen in die akute Gefahr, dass Amerika seinen Vorrang in der Welt einbüßt; mit seiner Art der Weltherrschaft hat es praktisch seinen Gegenspielern seine Entmachtung als Nummer Eins gestattet. Sinn und Zweck der Einladung an die Welt, in aller rechtlichen Form beim Weltkapitalismus mitzumachen und nach Kräften zu konkurrieren, sind durch erfolgreiche Rivalen in ihr Gegenteil verkehrt worden; also wird – natürlich nicht der Weltkapitalismus, sondern – die Einladung widerrufen.
Mit dieser Entscheidung vergreift sich die US-Regierung nicht bloß an den Durchführungsbestimmungen des globalen Kapitalismus. Sie kommt auf den Ausgangspunkt des amerikanischen Imperialismus der „Leadership“ zurück: auf das die ‚Weltordnung‘ begründende strategische Kräfteverhältnis zwischen den imperialistischen Mächten. Amerika eröffnet die ‚Frage‘ des zivilen Umgangs der Staaten miteinander neu auf dem Niveau, auf dem es um Krieg und Frieden geht.
III. Trumps Auftrag an die Super-Gewalt Amerikas: Wir müssen endlich wieder Kriege gewinnen!
1. Trump geißelt Vernachlässigung und Missbrauch der amerikanischen Gewaltmittel und beginnt die Restauration der US-Kriegsmacht für und durch ihren entschlossenen Einsatz
a)
Sie haben keinen Respekt vor uns!
– dies ist Trumps Generalbefund über die Verhältnisse, in die sich die USA unter den vorherigen Präsidenten haben verstricken lassen. Was er damit meint, wird an seinem Bild vom bisherigen Gebrauch und jetzigen Zustand des US-amerikanischen Gewaltpotenzials deutlich. Dieses Bild ist geprägt von der Gewissheit, dass auch die amerikanischen Gewaltmittel nicht das sind, was sie eigentlich sind, und dass sie nicht dafür gebraucht werden, wozu sie eigentlich bestimmt sind.
- Erstens haben die politischen Oberbefehlshaber vor ihm – insbesondere Obama – das einzige Prinzip verletzt, das für den US-Gewaltgebrauch heilig ist: Der hat für Amerika da und nützlich zu sein. Seine Vorgänger haben es sich zuschulden kommen lassen, stattdessen den Weltpolizisten zu spielen, sich von allem betroffen und für alles zuständig zu erklären und in einer Mischung aus Altruismus und Größenwahn mit dem amerikanischen Militär alle Völker dieser Welt glücklich machen zu wollen. Sie haben sich das absurde Ziel des Nation-Building gesetzt, das nirgendwo funktioniert –
Es funktioniert nicht, OK? Es funktioniert nicht!
–, vielmehr in der Region, in der dieses Projekt vor allem verfolgt worden ist, nur Chaos hinterlassen –Wir haben den Mittleren Osten destabilisiert und er ist jetzt ein einziger Verhau.
[3] – und seinen Rechnungen zufolge den geliebten amerikanischen tax payer sechs Billionen schöner amerikanischer Dollars gekostet hat. Darum ist klar:Die Ära des Nation-Building wird rasch und entschieden beendet.
[4] Zweitens haben sich die Amerikaner in diesem Zuge auf falsche Feindschaften festlegen und – im Zusammenhang damit – durch falsche Freunde ausnehmen lassen. Vor allem die jeder Reflexion auf den Nutzen Amerikas enthobene Pflicht des Westens zur Feindschaft gegen Russland hält Trump für absurd, für ein Herumschubsen – „push around“ – der USA durch ihre Alliierten für deren antirussische Obsession:
„Frage: Sie scheinen kein Fan der NATO zu sein? Trump: Ich bin ein Fan von Fairness. Ich bin ein Fan von common sense. Ich bin ganz bestimmt kein Fan davon, dass wir gegen Russland sind. Warum müssen wir bei allem die Anführer sein?“ [5]
Und nicht genug damit, dass die US-Führer sich von ihren Alliierten auf eine ideologische Feindschaft zu Russland haben verpflichten lassen, sie lassen Amerika auch noch dafür bezahlen, dass es den Schutzdienst an deren Existenz leistet, zu dem sie nicht fähig sind und der ihnen zu teuer ist – genauso wie sie es sich von ihren anderen strategischen Alliierten rund um die Welt gefallen lassen:
„Wir sind das Gespött der Welt, weil wir jahraus, jahrein 150 Milliarden Dollar zum Fenster hinausschmeißen, indem wir kostenlos reiche Nationen verteidigen. Nationen, die ohne uns innerhalb von 15 Minuten von der Erdoberfläche hinweggefegt würden. Unsere ‚Alliierten‘ verdienen Milliarden, indem sie uns bescheißen.“ [6]
- Kein Wunder also, dass – drittens – dann auch keine Mittel vorhanden sind, das Militär so auszustatten, wie es sein Einsatz für amerikanische Interessen erfordert – der Verdeutlichung halber, und weil er bei einem Abstecher zwecks Flugzeugträger-Taufe passende Gelegenheit dazu hat, sagt er der Marine nach, sie sei
fast auf den Stand des Ersten Weltkriegs zurückgefallen
. Viertens und vor allem aber muss Trump, nunmehr als Commander-in-Chief, konstatieren:
„...als ich jung war, haben alle in der High School und in der Uni gesagt: ‚Wir haben noch keinen Krieg verloren.‘ – und wir haben ja auch nie einen Krieg verloren. Ihr erinnert euch? Manche von euch waren damals mit mir dabei und ihr wisst noch: Wir haben nie einen Krieg verloren. Amerika hat nie verloren. Und nun gewinnen wir gar keinen Krieg mehr. Wir siegen nie. Und wir kämpfen nicht mehr, um zu siegen.“ [7]
Auf wen bzw. was Trump mit seiner Beschwörung Sie haben keinen Respekt vor uns!
abzielt, das ist also nicht ein bestimmter Gegner, eine bestimmte Kriegsallianz, ein bestimmter Kriegseinsatz oder die Summe von allem, sondern: auf die USA selbst. Die haben sich so viele Probleme
eingehandelt, weil sich ihre Führungen bisher an etwas anderem orientiert haben als ausschließlich am Wohl Amerikas, weil sie an etwas anderem Maß genommen haben als an dessen Größe, weil sich unter ihrem Kommando Amerika bei der Entfaltung seiner Gewalt überhaupt auf irgendetwas anderes bezogen hat als auf sich selbst.
b)
Das wird sich unter seiner Führung ändern. Die USA werden sich nur noch auf sich selbst und ihre Interessen orientieren, sich nur noch an sich selbst und ihrem Anspruch auf gewaltmäßige Unvergleichlichkeit messen. Ihre Ausnahmestellung zeichnet sich per se dadurch aus, dass sie auf nichts und durch nichts verpflichtet sind – das (wieder) zur jederzeit und überall verfolgten Praxis amerikanischer ‚Machtprojektion‘ zu machen, ist der Inhalt von Trumps weltpolitischem Programm. Alles Nähere in Fragen der Außenpolitik, der Geostrategie, der militärischen Mittelbeschaffung und der kriegerischen Gewaltanwendung hat sich davon abzuleiten – situationsbezogen, unvoreingenommen, unideologisch; das ist Trumps fix und fertige, auf alles anwendbare und unbedingt anzuwendende Doktrin des Principled Realism
. Er steht jedenfalls nicht an, sie umzusetzen.
Die Runderneuerung der Mittel
geht Trump als einen seiner ersten Programmpunkte an. Also verspricht er den im Weißen Haus versammelten Gouverneuren:
„Wir müssen sicherstellen, dass unsere mutigen Soldaten und Soldatinnen die nötigen Werkzeuge haben, um einen Krieg abzuwenden und nur eines zu tun, wenn sie aufgerufen werden, in unserem Namen zu kämpfen: siegen.“
Es passt zu der programmatischen Selbstbezüglichkeit, die er seiner Nation und ihrem Gewaltapparat verordnet, dass er die Werkzeuge
, die er zu beschaffen verspricht, nicht ins Verhältnis zu irgendeinem bestimmten Kriegsszenario, womöglich gegen einen konkret von ihm ins Visier genommenen Gegner setzt, sondern zu den mutigen Soldaten und Soldatinnen
: Ihrer Kühnheit – sich eben – schuldet die Weltmacht viele schöne neue Flugzeuge und schöne neue Ausrüstung
. Die detaillierte Beschaffungsstrategie erläutert er später an Bord eines funkelnagelneuen Flugzeugträgers: Wir werden die feinste Ausrüstung der Welt haben: Flugzeuge, Schiffe, alles.
– und auch zu dieser Gelegenheit betont er, dass die feinste Ausrüstung der Welt
das genau Passende für die besten Kriegsmarine-Mannschaften der Welt
ist. Person und Programm fallen da aus gegebenem Anlass ohne Rest in eins: Wenn Trump davon schwärmt, dass er sich zwar an Deck eines Schiffes befinde, das aber so groß sei, dass er sich vorkomme wie auf einem großen Stück Land
, dann drückt er an seiner Person aus, dass die Wucht der Zerstörungsmittel, die sich die USA unter seinem Oberkommando zuzulegen haben, sich nicht daran zu bemessen hat, ob das irgendeinem Gegner einen abschreckenden Eindruck macht, sondern ausschließlich an den Ansprüchen, die die Weltmacht in Sachen militärischer Einzigartigkeit an sich selbst stellt. Diese Logik ist nicht nur jeden Dollar wert, den sie kostet, sondern wird durch den schieren Umfang des dafür zur Verfügung gestellten Etats noch einmal bekräftigt: durch die demonstrierte Rücksichtslosigkeit gegenüber allen Spargesichtspunkten, die Trump ansonsten gegen die von ihm heftig bedauerten Staatsschulden ins Feld führt: Für seinen Rüstungshaushalt wirbt er damit, dass der mit 54 Milliarden Dollar die größte Erhöhung aller Zeiten erfahren habe.
Den Mitteln der anderen Mächte spricht Trump von diesem Selbstanspruch her jede Potenz ab, die US-Macht von irgendetwas abzuschrecken, sie in irgendeiner Weise bestimmen oder beeinflussen zu können – außer in dem Sinn, dass man sie dann eben fertigmacht, wenn man beschließt, dass es ansteht. Das gilt nicht zuletzt für die letzten Mittel kriegerischer Durchsetzung, die Nuklearwaffen. Von Trumps Standpunkt aus ist irgendeine dogmatische Zurückhaltung bezüglich der Anwendung von Atomwaffen – Warum können wir sie nicht benutzen, wenn wir sie schon haben?
[8] – ebenso unangebracht wie die Furcht vor einem neuen nuklearen Wettrüsten für den Fall der von ihm angekündigten Erneuerung und Verstärkung des amerikanischen Nuklearwaffenpotenzials; nicht weil er glaubt, dass damit kein Wettrüsten losgetreten werde, sondern weil er nicht weiß, was daran für Amerika schlimm sein soll: Dann gibt es eben ein Wettrüsten, wir werden sie überall übertreffen und überdauern.
[9] Auf die Idee eines Obama, mit einer neuen Runde atomarer Abrüstungsdiplomatie den Russen ihr strategisches Atompotenzial abzuknöpfen oder entscheidend zu verringern, indem man im Gegenzug eine gleichgewichtige Reduktion der amerikanischen Kernwaffen anbietet, käme Trump nie und nimmer: Darin äußert sich für ihn lediglich der unangebrachte Respekt vor fremden Gewaltmitteln, die doch einzig die Bestimmung haben, Amerika entweder nicht zu interessieren oder von Amerika besiegt zu werden. Rüstungsdiplomatie, um den Gegner berechenbar zu machen, ist für Trump eine Absurdität, die den falschen Ausgangspunkt hat, dass man mit dem Gegner umgehen müsse, statt ihn einfach fertigzumachen, und die das fatale Resultat hat, dass Amerika im Gegenzug nur sich selbst berechenbar macht. Und das geht schon deshalb nicht, weil von Trumps selbstbezüglichem Standpunkt aus Berechenbarkeit identisch ist mit Verwundbarkeit. Umgekehrt also darf Unberechenbarkeit der einzige Bezug sein, den Amerika zu den Gewaltpotenzen und -anliegen der anderen zu- und gelten lässt.
Die ersten Einsätze,
die – an den üblichen Schauplätzen – nicht lange auf sich warten lassen, bieten diesbezüglich Gelegenheiten für deutliche Aufklärung. Neben einer drastischen Verstärkung der Militäroperationen in Afghanistan und im Irak, mit denen die Weltmacht – unter anderem mit dem erstmaligen Einsatz der wuchtigsten nicht-nuklearen Fliegerbombe im Bestand der USA – ihre überragende Schlagkraft und neue Entschlossenheit zum Kampf gegen die zu den Hauptfeinden Amerikas erklärten IS-Terroristen vorführt, ergibt sich in Syrien durch einen Giftgasangriff im Osten des Landes ein schöner Anlass für weitergehende Verdeutlichungen: Trump befiehlt die Bombardierung eines syrischen Militärflughafens. Die staatsoffizielle Begründung dafür sind beautiful babies
, die sich Trump von seiner Tochter im TV hat zeigen lassen. Der Verweis auf seine persönliche Ergriffenheit passt zur damit transportierten Botschaft: Der moralische Geschmack des Präsidenten hat für den Rest der Welt die hinreichende Begründung für einen Militärschlag zu sein, der immerhin ein neues Niveau der direkten Einmischung des amerikanischen Militärs in den Syrien-Krieg markiert. Nicht die Überschreitung einer von der amerikanischen Schiedsrichter-Macht über den Krieg gezogenen ‚roten Linie‘, moralisch aufbereitet zu einem Vergehen gegen das Menschenrecht auf humane Kriegsführung, wird mit den 59 Tomahawks abgestraft. Vielmehr wird demonstriert, dass diese Macht keine roten Linien braucht – also auch nicht von deren Überschreitung abhängig ist –, damit sie auf neuer Eskalationsstufe zuschlägt. Die Demonstration der Unberechenbarkeit gerät umso drastischer, als sie mit den Assad-Truppen eine Kriegspartei trifft, auf deren Verurteilung sich Trump vorher nicht hat festlegen lassen. Und auch hinterher macht der US-Präsident klar, dass dieser Luftschlag nicht der Auftakt zu einem Strategiewechsel gewesen sei, auf den sich nun alle anderen berechnend beziehen und ihre Pläne entsprechend ausrichten können. Noch nicht einmal der einzige in der Sache fixe Tagesordnungspunkt auf Trumps weltweiter Kriegsagenda – Wir werden den IS zur Hölle bomben.
– bietet den übrigen jeweils vor Ort agierenden und sonstigen mittelprächtigen Mächten Hebel der beeinflussenden Bezugnahme auf die USA – einfach weil die unter Trump ihren Krieg gegen den IS nicht mehr als großen Bezugsrahmen auf alle anderen inszenieren, als Mittel, deren Gewaltbedürfnisse und Kriegsziele anzuerkennen, zu beschränken, einzubinden, damit dann ein großes Ganzes daraus werde, das der Oberaufsichtsmacht USA passt.
Die erste diplomatische Großaktion
macht klar, wie Trump sich stattdessen nicht nur zu den Kriegen, sondern auch den Friedensprozessen und Allianzen im Mittleren Osten und generell stellt: Auch auf dem Feld der strategischen Kräfteverhältnisse soll seine Logik des Deals: der praktischen Verabsolutierung des amerikanischen Interesses durch den an nichts relativierten Einsatz amerikanischer Überlegenheit ohne Abstriche zum Tragen kommen.
Dafür reist Trump zunächst nach Saudi-Arabien, wo er die Führer von 50 islamischen Staaten trifft. Dort führt er vor, wie Amerika unter seiner Führung die Staaten der Welt komplett danach einteilt, welche Deals es mit ihnen vorhat. Da ist zunächst einmal der Gastgeber selbst, das saudische Königreich. Das wird von ihm in den höchsten Tönen gepriesen – unter Verweis auf die netten Menschen, die große Kultur und vor allem die lange, schöne amerikanisch-saudische Geschichte, die einst unter Roosevelt und dem Vater des jetzigen Königs begann. Will sagen: Saudi-Arabien ist gut, weil der Deal gut ist, den Trump mit dessen Herrscherhaus schließt – er verschafft der amerikanischen Rüstungsindustrie ein Auftragspaket von 110 Milliarden Dollar, damit sie den Saudis die Waffen liefern kann, die die brauchen, um vor allem den Iran zu bekämpfen. Dieses Land fällt komplett unter die entgegengesetzte Kategorie: Den einzigen Deal, den die USA mit dem Mullah-Staat überhaupt laufen haben: den Vertrag über die Beschränkung der iranischen Atomindustrie, bezeichnet Trump während des Wahlkampfes und auch danach immer wieder als den schlechtesten Deal aller Zeiten
; für ihn ist das Land ein Feind, der besiegt gehört, nichts sonst. Die Begründung, die er dafür anführt – der Iran stecke hinter letztlich allen Terroristen, die gegen Amerika kämpfen –, braucht darum auch keinerlei weitergehenden Beweis. Und auch die übrigen 49 anwesenden Staatschefs dürfen sich von Trump sagen lassen, dass er die von ihnen geführten Nationen komplett dem Deal subsumiert, den er ihnen anzubieten hat – und der, ausweislich seiner Ansprache in Riad, entsprechend aussieht: Wir sind nicht hier, um Sie zu belehren. Wir sind nicht hier, um anderen zu sagen, wie sie zu leben, was sie zu tun, wer sie zu sein oder wie sie zu beten haben. Stattdessen bieten wir Partnerschaft, die auf gemeinsamen Interessen und Werten beruht, um eine bessere Zukunft für uns alle anzustreben.
Eine herrlich unkomplizierte Botschaft: Amerikas Führer interessiert sich nicht für die politischen, religiösen und sonstigen Sitten in diesen Ländern, was ihr ökonomisches und soziales Innenleben ausmacht und wie ihre zwischenstaatlichen Verhältnisse beschaffen sind. Unter brutaler Abstraktion von all dem sind sie für ihn nur das Kollektiv, zu dem er sie macht, indem er sie in Riad antanzen lässt und ihnen erklärt, worin ihre gemeinsamen Werte
bestehen: in der Bereitschaft, mit Amerika eine Partnerschaft
einzugehen, deren einziger Inhalt das amerikanische Interesse an einem totalen Krieg gegen den islamistischen Terror ist. Dazu kann und will er niemanden zwingen – Ihr habt die Wahl zwischen zweierlei Zukunft – und diese Wahl KANN NICHT Amerika für euch treffen.
Er hat aber – was einen guten Dealmaker eben so ausmacht – gewisse Entscheidungshilfen parat: Zum einen sind erwiesenermaßen die meisten der Terror-Opfer Muslime – ein Anti-Terror-Deal mit Amerika sollte von daher auch ein guter Deal für deren Staatsführer sein. Zum anderen will er niemanden im Unklaren darüber lassen, dass jeder definitiv verloren hat, der sich auf die falsche Seite schlägt: Wenn ihr den Weg des Terrors wählt, wird euer Leben leer sein, euer Leben wird kurz und EURE SEELE WIRD VERDAMMT SEIN.
[10] Wenn Trump also auf dem Höhepunkt seiner Rede einigermaßen harsch im Ton deklamiert: Schmeißt. Sie. Raus. SCHMEISST SIE RAUS aus euren Gebetsstätten. SCHMEISST SIE RAUS aus euren Gemeinschaften. SCHMEISST SIE RAUS aus eurem heiligen Land. Und SCHMEISST SIE RAUS AUS DIESER WELT!
, dann meint er das wirklich als Angebot, weil er an den so Angeredeten ja wirklich nichts anderes gelten lässt als das, was er mit ihnen vorhat. Von daher braucht Trump dann auch keine weiteren Zusagen, Unterschriften oder sonstigen positiven Reaktionen, damit für ihn der Deal mit diesen Figuren perfekt ist.
Von Riad aus begibt er sich nach Israel. Schon die Flugroute ist ein diplomatisches Statement an Saudis, Israelis und überhaupt an alle. Zum ersten Mal fliegt nämlich eine Maschine ohne Zwischenstopp, ohne Umweg von Saudi-Arabien nach Israel: Jahrzehntelang gepflegte Erzfeindschaften gehen Trump nichts an. Das zelebriert er an der Klagemauer in Jerusalem dann gleich noch einmal, die ein jüdisches Heiligtum ist, das sich auf besetztem arabischem Boden befindet: Wenn er an dieser Wand einen Zettel zu versenken gedenkt, wird ihn kein grenztopografisches Detail, keine politische Empfindlichkeit und keine diplomatische Gewohnheit daran hindern. Diese beiden kleinen Episoden markieren auf ihre Weise, was die allgemeine und imperialistisch entscheidende diplomatische Botschaft dieser zweiten Station des Präsidententrips ist; die betrifft den Israel-Palästinenser-Konflikt speziell und darüber hinausgehend Trumps Ansatz, mit solchen Konflikten generell umzugehen: Israel ist und bleibt ein enger und privilegierter Verbündeter der USA; aber es soll sich abschminken, den mächtigen Partner auf seine Gegnerschaft zu den Palästinensern im Besonderen und den Arabern im Allgemeinen festlegen zu wollen. Allianzen werden unter Trump einseitig definiert und einseitig praktiziert, und wenn die Alliierten das einsehen, dann steht ihnen eine wundervolle gemeinsame Zukunft an der Seite Amerikas bevor. Was Israel näherhin einzusehen hat: Der Konflikt, den es sich mit den Palästinensern leistet, entbehrt für Trump jedes vernünftigen Grundes, nämlich jeglichen Nutzens für Amerika; er behindert sogar das, was Amerika will: eine wirksame Bekämpfung vom IS und insbesondere vom Iran. Anders als seine Vorgänger verfertigt Trump aus diesem Befund aber nicht den Auftrag an die US-Diplomatie, aus überlegener Warte und unter Berücksichtigung der feindseligen Interessen einen Frieden mit Angeboten und Drohungen politisch zu arrangieren, die Streitparteien auf dieses Anliegen festzulegen und diesen Anspruch dann in einen Sumpf namens ‚Friedensprozess‘ zu überführen, der zwar zu nichts weiter führen mag, aus dem aber auch keine beteiligte Seite entlassen wird. Er hat den verfeindeten Lagern nur mitzuteilen, dass sie mit ihrem Konflikt Amerika gefälligst nicht stören, sich also untereinander irgendwie auf einen peace deal einigen sollen, der doch zu haben sein muss, wenn alle Seiten – Principled Realism
hat auch hier zu gelten – nichts Unrealistisches verlangen, darauf achten, wie stark ihre Verhandlungsposition ist und immer daran denken, dass es für jede zu Frieden führende Einigung den amerikanischen Segen gibt, weil für Amerika nichts anderes an ihnen überhaupt interessant ist.
Über die letzten Fragen den Frieden betreffend einigt sich Trump hernach im Zuge eines moralischen Geschäfts eigener Art mit dem katholischen Papst. Von dem lässt er sich über die christliche Botschaft vom Frieden belehren – und teilt im Gegenzug mit, dass der von ihm zu vertretende Nutzenaspekt dieses höchsten Guts dann doch dessen allerhöchster Sinn sei: Wir können Frieden gut gebrauchen.
Ein guter Handel für beide Seiten: Der Papst hat sich damit von Trump als der Welt höchste moralische Instanz in Szene setzen lassen, von der sich auch der höchste Vertreter der wuchtigsten Macht hienieden moralische Lektionen anhört; Trump seinerseits hat mit dem Vatikanbesuch, was die höheren Weihen seiner Weltpolitik anbelangt, das abrahamitische Tripel komplett gemacht. Und kann moralisch gut gerüstet nach Brüssel aufbrechen, wo er seinen NATO-Partnern zu erklären gedenkt, was er von ihrer Partnerschaft hält.
Zwischen Ankunft und offiziellem Beginn des NATO-Treffens findet er sich zu einem ganz kurzen Treffen mit den beiden höchsten Repräsentanten der EU – dem Kommissionschef und dem Ratspräsidenten – zusammen, das aber lang genug dauert, um denen alles mitzuteilen, was er hinsichtlich der EU für allenfalls mitteilenswert befindet: Die EU ist für ihn die Vorherrschaft der Deutschen; die Deutschen sind für ihn die mit den schlimmen, sehr schlimmen
Handelsbilanzüberschüssen gegenüber den USA; die wird er abstellen – Ende der Durchsage.
Dann ist die NATO an der Reihe. Der großartige Erfolg
seiner Europareise, für den Trump sich später per Twitter lobt, besteht auch beim NATO-Treffen darin, dass er seine Ansagen macht und den anderen gar nicht erst die Gelegenheit gibt, ihm mit irgendwelchen Anträgen oder Verhandlungen oder irgendwelchen Reaktionen zu kommen, die er zur Kenntnis nähme. Haargenau so, wie er es zuvor mit den kleinen und großen Despoten des Morgenlandes getan hat, lässt er auch die Chefs der alliierten NATO-Mächte antreten, unterbreitet ihnen die nicht zur Disposition stehenden Ansprüche der USA an sie und stellt klar, dass sie für ihn nichts anderes sind, als die Adressaten dieser Ansprüche. Das sind für die NATO im Wesentlichen zwei:
Erstens sollen die Verbündeten endlich zahlen, was sie schulden. Allen im Vorfeld der Zusammenkunft geäußerten Hoffnungen auf ein offizielles „erneuertes Bekenntnis zur NATO“ erteilt er damit eine Absage. Nicht in der Form der Aussage, die NATO sei nicht mehr von Interesse; er erklärt vielmehr, was die NATO – für die USA, also überhaupt – ist: Der Schutzschirm der USA über Europa, unter dem es sich die Alliierten bequem eingerichtet haben. Mit seiner Pose des Inkasso-Beauftragten des amerikanischen Steuerzahlers stellt er klar, dass er die NATO vor allem als eine Dienstleistung der USA am Rest der Mitglieder definiert, die – wie jede Dienstleistung – bezahlt zu werden hat. Zwar erwähnt Trump irgendwo im hinteren Drittel seiner Rede, zwischen Terrorismus und nicht näher genannten Gefahren an der NATO-Südflanke, auch die Bedrohungen von Russland
und erweist so der Lebenslüge der heutigen Allianz, sie sei immer noch der Schutz- und Trutzbund westlicher Freiheit gegen den postsowjetischen Unfreiheits-Imperialismus, pflichtschuldigst mit exakt drei Wörtern seine Reverenz. Aber er erläutert gleich im nächsten Satz, worauf er mit den beschworenen gemeinsamen Sicherheitsanliegen
hinauswill: Sie sind für ihn keine Herausforderungen an die transatlantische Schicksals- und Wertegemeinschaft, sondern Belege dafür, dass die Europäer Amerika mit ihrem Sicherheitsbedürfnis auf der Tasche liegen.
Den allergrößten Teil seiner kurzen Ansprache widmet er – zweitens – dem islamistischen Terror, in dessen Bekämpfung er die NATO einordnet, womit für ihn feststeht, was – momentan zumindest – allenfalls ihr praktischer Nutzen ist. Das macht er den europäischen NATO-Staatenlenkern auch ad personam klar: Indem er während seiner knapp gehaltenen Rede reichlich Gelegenheit findet, den saudischen Führer als nachahmenswertes Vorbild anzupreisen, ordnet er alle diese Mitglieder der mächtigsten Militärallianz der Welt neben oder eigentlich hinter der Wüstenmonarchie mit ihrem König ein, der in seiner Weisheit
bereits erkannt habe, was Sache ist: was nämlich Trump zur verbindlichen Sache aller Staatenlenker erklärt hat, die ihren geliebten Gemeinwesen irgendeine Aussicht auf Sicherheit, Wohlstand und Frieden
verschaffen bzw. erhalten wollen. So einen Deal drückt Trump jetzt auch der NATO aufs Auge, so ist er mit ihr zufrieden, nichts anderes interessiert ihn an diesem Verein: Die NATO ist der von den USA geschmiedeten Anti-Terror-Allianz beigetreten; für Trump der Erfolg, auf den es ihm ankommt. ‚Gemeinsamkeiten‘ sind das, was Amerika setzt, dem dürfen sich die anderen gerne zu- und unterordnen – Deal perfekt. Das ist jetzt für die NATO der neue Status: einerseits Dienstleistung der USA am Rest der Alliierten, für die sie den nach Inhalt und Höhe von Amerika festgesetzten Preis zu zahlen haben, andererseits Instrument der USA für ihre – im Moment vor allem antiterroristischen – Anliegen, das sich seine Wertschätzung seitens des amerikanischen Anwenders einzig und allein durch seine Brauchbarkeit verdient.
Und dann ist da noch der G7-Gipfel, mit dem Trump vor allem eines anfangen kann: überhaupt nichts. Er lässt demonstrativ sein Desinteresse an diesem Club heraushängen, der seiner Meinung nach aus einem Haufen nachgeordneter Wichtigtuer besteht, die Gleichrangigkeit ihrer Nationen mit Amerika beanspruchen – was lächerlich ist – und dies dadurch demonstrieren, dass sie ihm lauter ‚Themen‘ unterbreiten, die von gemeinsamem Interesse und überhaupt von einem allgemeinen Standpunkt her unbedingt zu lösende Menschheitsprobleme seien – was ihn schlicht nicht interessiert. Dass sie sich zum Kampf gegen den Terrorismus bekennen, nimmt er zur Kenntnis; falls sie damit noch irgendetwas anderes gemeint oder beansprucht haben wollten, dann geht ihn das nichts an. Von den 39 Punkten des offiziellen Abschluss-Communiqués erklärt Trump auf der Rückreise per Twitter den Punkt 20 zu seinem Erfolg, also zum einzig erwähnenswerten Ergebnis: Wir dringen auf die Beseitigung aller handelsverzerrenden Praktiken, um wirklich gleiche Wettbewerbsbedingungen zu fördern.
Er ist in seiner guten Laune so freundlich, diesen G6 zu konzedieren, dass sie kapiert haben, dass es Gemeinsamkeit nur noch in Form von seinen Deals gibt.
2. Trump kündigt die transatlantische Kumpanei und damit die Garantie für den Zustand namens ‚Weltfrieden‘, der Amerikas Bedürfnissen nicht mehr genügt
a)
Präsident Trump weiß – gibt jedenfalls bei Gelegenheit zu Protokoll,[11] geht also wie seine Vorgänger seit dem Zweiten Weltkrieg davon aus –, dass die Staaten, die sich als Verbündete Amerikas verstehen, vor allem auch die, die in der NATO mit den USA als Führungsmacht verbunden sind, ohne Amerikas Schutz vielleicht nicht wirklich in einer Viertelstunde militärisch auszuradieren wären, ihre eigene Existenz aber nicht garantieren könnten. Er kennt allerdings keinen Feind, der willens und fähig wäre, einen solchen Überfall zu unternehmen; er weiß keinen Grund, weshalb Amerikas Verbündete um nichts Geringeres als ihre Existenz fürchten müssten. Was er weiß und kennt, ist eine allgemeine Bedrohung der Guten auf der Welt durch böse Terroristen, gegen die alle Guten fest zusammenstehen müssen. Aber ein Grund, dass die USA mit ihrer gesamten Militärmacht ihren Alliierten in Europa beistehen müssten, in letzter Konsequenz sogar ihre eigene Sicherheit mit dem Schicksal der Partner verknüpfen, ist das nicht. Eine Notwendigkeit für ein solches unverhandelbares Bündnis, das die Europäer fest an die USA als Führungsmacht und umgekehrt auch die USA an ihre abhängigen Partner binden würde, kennt Trump auch nicht; wenn es da nach seiner halb zurückgenommenen Einordnung der NATO als „obsolet“ noch Zweifel hätte geben können, wären die mit seinem Besuch in Brüssel und der Ansage, die Trittbrettfahrer der amerikanischen Weltmacht zur Kasse zu bitten, erledigt.
Das unterscheidet ihn vom bündnispolitischen Standpunkt seiner Vorgänger.
Denen hat, bis Reagan einschließlich, das Projekt einer ultimativen kriegerischen Auseinandersetzung mit dem sowjetischen „Reich des Bösen“ so klar vor Augen gestanden, dass sie einen Atomkrieg an verschiedenen Schauplätzen, von Deutschland und von U-Booten aus, mit Erst- und Zweitschlagskapazitäten minutiös geplant, materiell vorbereitet, Szenarios der schrittweisen Vernichtung sogar mit dem Feind durchgesprochen haben, um Fehlkalkulationen zu vermeiden. Dass dieses Weltkriegsprojekt für die Partner der USA eine unmittelbare Existenzgefahr beinhaltet, war ebenso klar wie deren Entscheidung, die Beteiligung daran als Versicherung gegen die Folgen zu veranschlagen und als feste Prämisse in die eigene Staatsräson einzubauen; gegen entsprechende Zusicherungen der Führungsmacht, im Ernstfall auch ihr Überleben aufs Spiel zu setzen. Diese in der NATO und ihren Arsenalen materialisierte Partnerschaft hat den Westen ausgemacht; einschließlich der Idee der „Wertegemeinschaft“, die tatsächlich nichts weiter ausdrückt als den Vorrang der Bündnisdisziplin im Hinblick auf den Weltkriegsfall vor allen besonderen nationalen Interessen und Berechnungen.
Damit ist es im Prinzip vorbei, seit die Sowjetunion diese mit immer raffinierteren Mitteln verschärfte Bedrohungslage mit ihrer Selbstauflösung als Gegenmacht gegen den Westen quittiert hat. Zur Auflösung der NATO hat das nicht geführt. Die war eben – entgegen der offiziellen Begründung ihrer permanenten Kriegsbereitschaft – mehr als ein Verteidigungsclub. Und deswegen hat sie sich auch erhalten, sogar ausgeweitet: als von den USA, der nach wie vor mit Abstand stärksten Militärmacht, dominiertes und geführtes Kollektiv rivalisierender und kooperierender kapitalistischer Nationen, die untereinander Krieg als ultimatives Konkurrenzmittel ausschließen und als einheitlicher Block den handgezählten zwei anderen militärischen Weltmächten gegenübertreten. In Konfrontation und Abstimmung mit denen verbürgt dieses Super-Bündnis den herrschenden Zustand namens ‚Weltfrieden‘: einen Gewaltverzicht auf der obersten strategischen Ebene, nicht was die ständig weiter perfektionierten Gewaltmittel, sondern was deren kriegerischen Einsatz gegeneinander betrifft, und ein generelles Gewaltverbot, das auch bei noch so vielen „regionalen Konflikten“ der blutigsten Art den ‚Weltfrieden‘ bestehen lässt. Als der maßgebliche Garant dieses Irrsinns ist dieses Kollektiv, die Kumpanei der führenden kapitalistischen Mächte, auch die letzte Sicherheitsinstanz der zivilen Weltordnung, in der sich der Kapitalismus mit seinem Zentrum im amerikanischen Finanzmarkt, mit seinem amerikanischen Kreditgeld, unter US-amerikanischer „Leadership“, durch Aufschwünge und Krisen hindurch so prächtig „globalisiert“ hat. Diese Kumpanei hat den sachzwanghaften Grund für unverbrüchliches Zusammenhalten, das einigende Weltkriegsprojekt, zwar verloren; und das macht sich auch praktisch geltend, nämlich in den zersetzenden Bemühungen der verschiedenen Mitglieder, die organisierte Partnerschaft mit ihren Absprachen und Einrichtungen und Beistandspflichten für je eigene Ordnungsinteressen, denen ein Kriegspotenzial innewohnt, zu funktionalisieren. Eben dafür, als Basis für die Entfaltung je eigener gewaltträchtiger Interessen und als Objekt eigennütziger Berechnungen, wird die Allianz von ihren Mitgliedern aber aufrechterhalten; von der Führungsmacht, die mit ihren postsowjetischen Kriegen für eine ‚neue Weltordnung‘ dann doch recht zwiespältige Ergebnisse erzielt hat, wie von den europäischen Bündnisgenossen, die es sich dank des Rückhalts in Amerikas überlegener Militärmacht herausnehmen und leisten können, ordnungspolitisch „über ihre Verhältnisse“ zu agieren.[12]
b)
Jetzt orientiert Amerika sich neu. Und es ist eben nicht bloß ein „gewachsenes Vertrauensverhältnis“, das der neue Präsident mit seiner Politik der America first!
-Deals „ein Stück weit“ stört. Mit seiner Umdefinition der bisherigen Bündniseinheit in ein Sicherheitsdienstleistungsgeschäft kündigt er die immer noch wirksam gebliebene widersprüchliche Kumpanei imperialistisch ambitionierter, konkurrierender, im Prinzip aber gleichermaßen an einer brauchbaren internationalen Rechtsordnung interessierter Staaten und nicht nur deren Schein, die schönen Werte und die Solidarität.
Dem Imperialismus der Europäer und speziell der deutschen EU-Führungsmacht entzieht Amerika damit die Geschäftsgrundlage – was dort auch sehr verkehrt wahrgenommen wird als womöglich wohltuender Sachzwang zu mehr europäischer Eigeninitiative und sicherheitspolitischem „Erwachsen-Werden“. Das betrifft unmittelbar die traditionsreiche deutsche Manier, auf Basis amerikanischer Abschreckungsgewalt ordnungspolitische Erpressungsgeschäfte im eigenen Interesse zu betreiben und den eigenen Club zur weltpolitischen Alternative zu den USA fortzuentwickeln – ein Schmarotzertum, das mit Trumps Polemik gegen die Deutschen mit ihren Schulden bei der NATO bzw. deren Hauptfinanzier, dem amerikanischen Steuerzahler, bei gleichzeitigem Handelsbilanzüberschuss sachlich und in seiner Tragweite gar nicht erfasst, aber moralisch gut getroffen ist. Der in Europas großen Hauptstädten laut gewordene Imperativ, endlich die gemeinsame Sicherheitspolitik entscheidend voranzubringen, enthält darüber hinaus einen Verweis auf die implizite, aber geradezu konstitutive Leistung, die das NATO-Bündnis für die EU erbracht hat: Die große transatlantische Gemeinschaft hat den absoluten inner-westlichen Gewaltverzicht fraglos sichergestellt, also alle Übergänge in die Sphäre der „bewaffneten Konflikte“ im Raum der europäischen Union unmöglich gemacht. Damit hat sie die – vor allem von Deutschland – stillschweigend in Anspruch genommene Geschäftsgrundlage für einen Staatenverbund geschaffen, der manche Mitglieder ökonomisch heftig strapaziert und in ihrer Souveränität nicht bloß herausfordert, sondern wirklich beschränkt. Natürlich ist das mit 100 Tagen Trump nicht weg. Dessen Auftritt erinnert die Europa-Macher aber nicht zufällig an die Notwendigkeit, das Stück nationaler Autonomie, das bislang im NATO-Bündnis gut aufgehoben war, nämlich in Sachen Militär, europäisch zu vergemeinschaften.
Was ansatzweise und sehr implizit für den festen inneren Zusammenhalt der EU gilt, das gilt erst recht für die analoge Leistung, die das westliche Bündnis, dieser „harte Kern“ der weltweiten amerikanischen „Leadership“, für die großartige Errungenschaft namens ‚Weltfrieden‘ erbracht hat. An der Rolle der Führungsmacht, die die Sicherheitsinteressen ihrer Verbündeten als Teil ihres eigenen Sicherheitsbedarfs anerkennt und schützt, ist Amerika nicht mehr interessiert; der neue Präsident findet sein Land auch und gerade in der Hinsicht nur ausgenutzt und verlacht. Damit kündigt er die Kumpanei der Großen auf, die in ihrem Bündnis und in ihrem kollektiven Kräfteverhältnis zu Russland und China den allgemeinen Gewaltvorbehalt auf Weltniveau praktisch wirksam gemacht haben. An die Stelle setzt Trump America first!
, i.e. den unmittelbaren Bezug der nurmehr an sich selbst interessierten eingriffsbereiten amerikanischen Militärmacht, der kriegerischen Überlegenheit Amerikas, zum Weltgeschehen und dessen politischen Subjekten. Er eröffnet die „Frage“ der „Weltfriedensordnung“ neu, indem er sie gleich neu beantwortet: Er konfrontiert die Staatenwelt mit dem fertigen Standpunkt, dass sie es in Zukunft immer, wenn man in Washington das für fällig hält, unilateral
mit der Weltmacht zu tun bekommt. Die kritische Frage seiner Bündnispartner, ob sich Amerika damit nicht überhebt oder isoliert, ist für die Nation unter Trump damit beantwortet, dass der alte ‚Weltfrieden‘ unter dem wackligen und von allen anderen missbrauchten Regime des NATO-Bündnisses ihrem Anspruch auf Weltkontrolle jedenfalls schon lange nicht mehr genügt.
PS: Zum widersprüchlichen Zusammenhang von Trumps Populismus und Amerikas neuem Imperialismus
Bis dato ist Donald J. Trump ausschließlich von einem beeindruckt: von Donald J. Trump. Das ist gerecht und sachdienlich. Gerecht ist das, weil sein eitles Selbstbewusstsein als größter Dealmaker aller Zeiten, der nun seine wunderbaren Fähigkeiten als Dealmaker-in-Chief in die Dienste seiner Nation stellt, nur die psychologische Seite der politischen Mission ist, der er sich verschrieben hat. Inspiriert vom normalen Chauvinismus eines amerikanischen Patrioten, befeuert durch alle Konkurrenzerfolge als Geschäftsmann und dann als wahlkämpfender Politiker, beglaubigt schließlich durch die Wahl ins Amt des Führers seiner Nation, hält er sich für die Verkörperung der Überlegenheit des amerikanischen Volkes und seines Willens nach einer staatlichen Macht, die diese Überlegenheit weltweit zur Geltung bringt. Sachdienlich ist das, weil er es nur mit diesem mit seiner Persönlichkeit zusammenfallenden politischen Willen und allen dazu gehörigen Formen der Angeberei und Rücksichtslosigkeit dahin gebracht hat, per Wahlkampf daraus den herrschenden politischen Standpunkt der USA zu machen. Es hat schon den Berserker mit seinem selbstgerechten patriotischen Furor gebraucht, um das Amt im Sinne seines Aufbruchsprogramms zu handhaben, also ein Stück weit umzuwidmen – gegen alle Widerstände einer, im Wortsinne, etablierten Politik, die vom Gebrauch der in Ämtern und Institutionen versachlichten politischen Macht des amerikanischen Souveräns andere Vorstellungen hat.
Der Präsident, der seine Mission so perfekt verkörpert, ist zugleich eine schwere Herausforderung nicht nur für die Vertreter des verhassten Establishments, sondern auch für die von ihm selbst zusammengestellte Mannschaft des Weißen Hauses und an der Spitze der Ministerien. Er lässt die Neusortierung von Freund und Feind und auch militärische Interventionen unmittelbar aus dem gesunden Empfinden seiner hervorragenden Persönlichkeit folgen. Dass er mit derart willkürlichen und unsteten Ratschlüssen die USA und die Anwendung ihrer Gewalt für Rivalen, Feinde und überhaupt für ein widerborstiges Ausland unberechenbar macht, dass er der Staatenwelt Drohungen übermittelt, mit denen sie nicht kalkulieren kann, ihr also eine letztlich berechnungslose Unterwerfung abverlangt, das ist gut und findet den Beifall vieler Außenpolitiker in Washington, die seiner Parole America first!
etwas abgewinnen.
Nicht so gut ist, dass er sich mit diesen spontanen Einfällen und überraschenden isolierten Kriegsakten für das politische Washington selbst unberechenbar macht. Auch seine Leute können, abgesehen vom immer wieder klar präsentierten Standpunkt, in seinen erratischen Aktionen und Auftritten keine durchgehaltene Linie erkennen, mit der die Suprematie der USA über den Rest der Welt praktisch erneuert und vollendet werden soll. Sie fürchten, dass gerade der Protagonist des imperialistischen Aufbruchs ihn gefährden könnte, weil er damit zufrieden ist, ihn zu verkörpern und zu proklamieren. Sie verlangen von ihrem Volkstribun, dass er sein nationalistisches Ethos mit dem Zynismus des Technikers der Macht, nämlich mit dem berechnenden und zweckmäßigen Einsatz der vorhandenen Instrumente und politischen Beziehungen verbindet. Weil er das allen Erwartungen zum Trotz – man erinnere sich der abgeklärt-hoffnungsfrohen Stellungnahmen zum Verhältnis von Wahlkampf, in dem dem Volk so manches versprochen wird, und politischem Alltag, in dem selbstverständlich anderes zählt – bislang so gut wie nicht tut, bemühen sich die Besonneneren unter den Fundamentalisten amerikanischer Größe, ihren Häuptling, der Geheimdienst-Briefings schwänzt und keine Akten studiert, mit Beratern, Sprechern, Gremien zu umstellen und produktiv zu machen. Sie erklären ihm die Funktionsweise der nationalen und internationalen Politik jenseits von Trump-Tower und Mar-a-Lago. Sie rücken seine Lügen und Ausfälle für die Öffentlichkeit zurecht, suchen ihnen eine durchhaltbare Linie abzugewinnen und müssen ihre Interpretationen und Korrekturen immer wieder vom Chef desavouieren lassen. Die White-House-Staff unternimmt das interessante Experiment, den Widerspruch zwischen Notwendigkeit und Dysfunktionalität von Trumps entfesseltem Rechtsbewusstsein für den imperialistischen Aufbruch zu heilen.
Andere, Senatoren vor allem, auch unter den Republikanern, sehen dagegen eine Linie, die sie für schädlich und gefährlich für die amerikanische Macht halten: Dass Trump sich nicht mehr auf die gut etablierte Feindschaft zu Russland und damit auf das verbliebene einigende Band mit den westlichen Verbündeten festlegen lässt, erscheint gerade den alten Falken im Kongress als so weitgehender Bruch mit der außenpolitischen Staatsräson und mit den vorhandenen Mitteln globaler amerikanischer Durchsetzung, dass sie den Schwenk nicht nur politisch bekämpfen, sondern nach Kräften juristisch inkriminieren: Sie legen Trump die Verständigung seines Emissärs mit der russischen Botschaft noch vor seinem Amtsantritt als illegale Nebenaußenpolitik zur Last, setzen einen Sonderstaatsanwalt ein, der dem Verdacht auf Wahlmanipulation unter Mithilfe einer ausländischen Macht nachgehen soll, und bezichtigen ihn des Geheimnisverrats.
Der Versuch der konstruktiven Einhegung des an sich und seinem Patriotismus berauschten Oberkommandierenden geht so in einen öffentlichen Machtkampf über, in dem es um die Disziplinierung, Isolierung oder sogar um die Amtsenthebung des Präsidenten geht – alles im Interesse der Effektivität und Praktikabilität des America first!
, das Trump der Nation auf die Tagesordnung gesetzt hat.
[1] Den hier kurz skizzierten Zusammenhängen von weltweiter, finanzkapitalistisch vorangetriebener Akkumulation und Überakkumulation, Finanzkrise sowie Krisenpolitik und Krisenkonkurrenz der Zentren des Weltkapitalismus – insbesondere der USA und der EU bzw. der Eurozone – hat diese Zeitschrift seit ‚Ausbruch‘ der Finanzkrise 2007 eine Reihe von Artikeln gewidmet. Besonders sei hier auf den Artikel Im Jahr 9 nach Amerikas ‚Hypothekenkrise‘: Weltkapitalismus im Krisenmodus in Heft 3-16 verwiesen; der beschäftigt sich ausführlich mit dem – keinesfalls den USA vorbehaltenen – neuen Standpunkt und den dazugehörigen Methoden einer speziellen Standortkonkurrenz angesichts von fehlendem Wachstum weltweit und unter den Bedingungen der – ebenfalls nicht nur durch die USA praktizierten – Ersetzung von kapitalistischer Kreditverwertung durch das geldschöpferische Machtwort des Staates.
[2] Für Freunde des Englischen in einfacher Sprache und von Taubstummendialogen, in denen der Interviewte ganz anderes beantwortet als das, wonach er gefragt wird, dokumentieren wir größere Teile des Interviews im Original.
„What is Trumponomics and how does it differ from standard Republican economics?
Well it’s an interesting question. I don’t think it’s ever been asked quite that way. But it really has to do with self-respect as a nation. It has to do with trade deals that have to be fair, and somewhat reciprocal, if not fully reciprocal. And I think that’s a word that you’re going to see a lot of, because we need reciprocality in terms of our trade deals. We have nations where ... they’ll get as much as 100 % of a tax or a tariff for a certain product and for the same product we get nothing, OK? It’s very unfair. And the very interesting thing about that is that, if I said I’m going to put a tax on of 10 %, the free-traders, somewhat foolishly, they’ll say ‚Oh, he’s not a free-trader‘, which I am, I’m absolutely a free-trader. I’m for open trade, free trade, but I also want smart trade and fair trade. But they’ll say, ‚He’s not a free-trader‘, at 10 %. But if I say we’re putting a reciprocal tax on, it may be 62 % or it may be 47 %, I mean massive numbers, and nobody can complain about it. It’s really sort of an amazing thing.
So that’s the story. It very much has to do with trade. We have so many bad trade deals. To a point where I’m not sure that we have any good trade deals. I don’t know who the people are that would put us into a NAFTA, which was so one-sided. Both from the Canada standpoint and from the Mexico standpoint. So one-sided. (...)
Now at the same time I have a very good relationship with Justin [Trudeau, the Canadian prime minister] and a very good relationship with the president of Mexico. And I was going to terminate NAFTA last week, I was all set, meaning the six-month termination. I was going to send them a letter, then after six months, it’s gone. But the word got out, they called and they said, we would really love to ... they called separately but it was an amazing thing. They called separately ten minutes apart. I just put down the phone with the president of Mexico when the prime minister of Canada called. And they both asked almost identical questions. ‚We would like to know if it would be possible to negotiate as opposed to a termination.‘ And I said, ‚Yes, it is. Absolutely.‘ So, so we did that and we’ll start. (...)
It sounds like you’re imagining a pretty big renegotiation of NAFTA. What would a fair NAFTA look like?
Big isn’t a good enough word. Massive.
Huge?
It’s got to be. It’s got to be.
What would it look like? What would a fair NAFTA look like?
No, it’s gotta be. Otherwise we’re terminating NAFTA.
What would a fair NAFTA look like?
I was all set to terminate, you know? And this wasn’t like ... this wasn’t a game I was playing. I’m not playing ... you know, I wasn’t playing chess or poker or anything else. This was, I was, I’d never even thought about ... it’s always the best when you really feel this way. But I was ... I had no thought of anything else, and these two guys will tell you, I had no thought of anything else but termination. But because of my relationship with both of them, I said, I would like to give that a try too, that’s fine. I mean, out of respect for them. It would’ve been very disrespectful to Mexico and Canada had I said, ‚I will not.‘
But Mr President, what has to change for you not to withdraw?
We have to be able to make fair deals. Right now the United States has a 70 – almost a $70bn trade deficit with Mexico. And it has about a $15bn dollar trade deficit with Canada. The timber coming in from Canada, they’ve been negotiating for 35 years. And it’s been ... it’s been terrible for the United States. You know, it’s just, it’s just been terrible. They’ve never been able to make it.
Does that $70bn deficit have to come to zero to be fair?
Not necessarily. And certainly it can come over a, you know, fairly extended period of time, because I’m not looking to shock the system. But it has to become at least fair. And no, it doesn’t have to immediately go to zero. But at some point would like to get it at zero, where sometimes we can be up and sometimes they can be up.“ (...)
„So I told them, I said, ‚We have a problem and we’re going to solve that problem.‘ But he wants to help us solve that problem.
Now then you never know what’s going to happen. But they said to me that on the currency manipulation, ‚Donald Trump has failed to call China a currency manipulator.‘ Now I have to understand something. I’m dealing with a man, I think I like him a lot. I think he likes me a lot. (...) I mean, he’s a great guy.
Now, with that in mind, he’s representing China and he wants what’s best for China. But so far, you know, he’s been, he’s been very good. But, so they talk about why haven’t you called him a currency manipulator? Now think of this. I say, ‚Jinping. Please help us, let’s make a deal. Help us with North Korea, and by the way we’re announcing tomorrow that you’re a currency manipulator, OK?‘ They never say that, you know the fake media, they never put them together, they always say, he didn’t call him a currency [manipulator], number one. Number two, they’re actually not a currency [manipulator]. You know, since I’ve been talking about currency manipulation with respect to them and other countries, they stopped.“
[3] So Trump als designierter Präsidentschaftskandidat der Republikaner.
[4] Ebenfalls aus einer Wahlkampfrede
[5] Aus einer Pressekonferenz während des Wahlkampfs
[6] Das hat Trump schon vor über zwanzig Jahren dem „Playboy“ erzählt.
[7] Präsident Trump bei einem Treffen mit der National Governors Association
[8] Das war zum Thema Nuklearwaffen dem Vernehmen nach die wichtigste und gleich mehrfach gestellte Frage des Präsidentschaftskandidaten Trump an den ihm für solche Themen zur Seite gestellten Experten.
[9] So Trump als President-Elect zu einem Reporter von MSNBC.
[10] Die etwas amerikanischere Fassung wird er später beim NATO-Gipfel äußern: Da fällt er über die Terroristen das schlimmste für einen Amerikaner denkbare Urteil: They are losers.
[11] Siehe das Zitat aus dem Punkt 1 a): Wir sind das Gespött der Welt, weil wir jahraus, jahrein 150 Milliarden Dollar zum Fenster hinausschmeißen, indem wir kostenlos reiche Nationen verteidigen. Nationen, die ohne uns innerhalb von 15 Minuten von der Erdoberfläche hinweggefegt würden. Unsere ‚Alliierten‘ verdienen Milliarden, indem sie uns bescheißen.
[12] Mehr dazu in den Anmerkungen zum ‚Weißbuch 2016 zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr‘: Anspruch und Drangsale des deutschen Imperialismus, erschienen in GegenStandpunkt 1-17