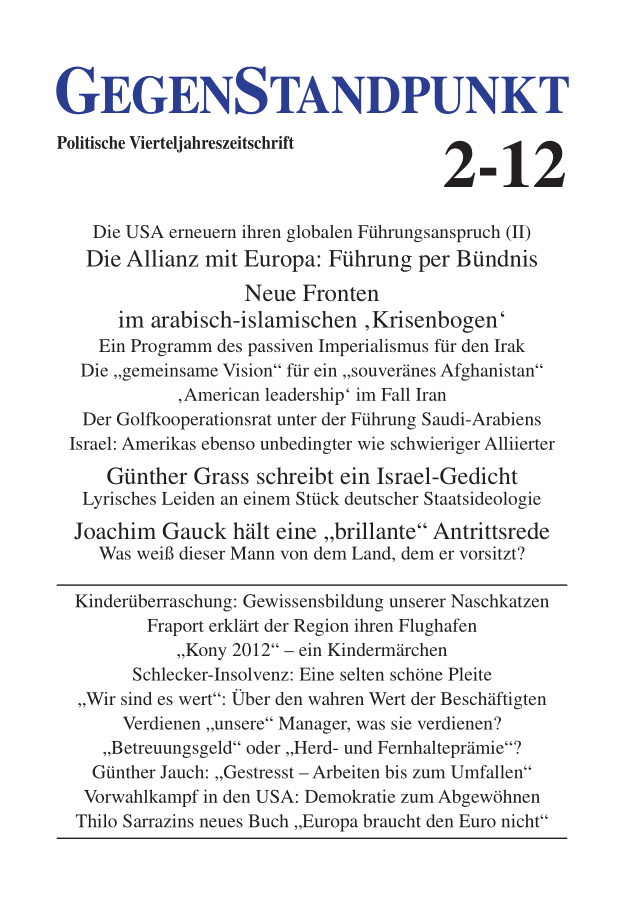Die USA erneuern ihre Allianz mit Europa
Führung per Bündnis
Präsident Obamas Ankündigung, dass das zweite Jahrhundert amerikanischer Führung in der Welt ein pazifisches werden soll und dass er dafür den Fokus des weltpolitischen Interesses und eine Menge Soldaten und Kriegsgerät nach Ostasien verlagern wird, vernimmt Europa mit Sorge. Seine Regierungen sehen sich überhaupt nicht von einer 60-jährigen Bevormundung und zu größerer eigener imperialistischer Entfaltung befreit, sondern nach den Bush-Jahren schon wieder, wenn auch in anderer Weise von Irrelevanz bedroht: Verlieren die USA ihr Interesse an den atlantischen Partnern, und verlieren die dadurch an weltpolitischem Gewicht, das sie offenbar nur durch das amerikanische Machtkalkül mit ihnen gewinnen? Auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2012 beruhigen höchste US-Repräsentanten diese Sorgen.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Die USA erneuern ihre Allianz mit Europa
Führung per Bündnis
Präsident Obamas Ankündigung, dass das zweite Jahrhundert amerikanischer Führung in der Welt ein pazifisches werden soll und dass er dafür den Fokus des weltpolitischen Interesses und eine Menge Soldaten und Kriegsgerät nach Ostasien verlagern wird, vernimmt Europa mit Sorge. Seine Regierungen sehen sich überhaupt nicht von einer 60-jährigen Bevormundung und zu größerer eigener imperialistischer Entfaltung befreit, sondern nach den Bush-Jahren schon wieder, wenn auch in anderer Weise von Irrelevanz bedroht: Verlieren die USA ihr Interesse an den atlantischen Partnern, und verlieren die dadurch an weltpolitischem Gewicht, das sie offenbar nur durch das amerikanische Machtkalkül mit ihnen gewinnen? Auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2012 beruhigen höchste US-Repräsentanten diese Sorgen.
„Ich habe alles darüber gehört, wo Europa in der globalen Ausrichtung der Vereinigten Staaten angesiedelt ist. Ich habe auch einige der Bedenken vernommen, die geäußert wurden. Die Realität aber könnte nicht deutlicher sein. Europa ist und bleibt die erste Wahl als Partner der Vereinigten Staaten. Wo auch immer Amerika daran arbeitet, die Verbreitung von Kernwaffen zu verhindern, Krankheiten zu bekämpfen oder Länder auf dem schwierigen Weg von Diktatur zu Demokratie zu begleiten, stehen wir Seite an Seite mit unseren europäischen Freunden. Ich würde in der Tat so weit gehen zu sagen, dass die transatlantische Gemeinschaft niemals zuvor enger zusammengearbeitet hat, um die Herausforderungen einer vielschichtigen, gefährlichen und sich schnell verändernden Welt zu bewältigen. Ausmaß und Tiefe unserer Zusammenarbeit sind bemerkenswert. ... Wenn Präsident Obama also sagt, dass ‚Europa der Eckpfeiler unseres weltweiten Engagements bleibt‘, dann sind das nicht nur beschwichtigende Worte. Es ist die Wahrheit. Die heutige transatlantische Gemeinschaft ist nicht nur eine wichtige Errungenschaft eines vergangenen Jahrhunderts. Sie ist für die Welt, die wir im kommenden Jahrhundert gemeinsam aufzubauen hoffen, unerlässlich.“ (Hillary Clinton, München 4.2.12)
Über Grund, Zweck und Glaubwürdigkeit derart ausdrücklicher Dementis muss man sich nichts vormachen. Aber dass die USA nichts Geringeres vorhaben, als die Welt ... im kommenden Jahrhundert ... aufzubauen
, das darf man der Außenministerin abnehmen. Nichts ist für die USA selbstverständlicher, als dass sie – oder niemand! – der Schöpfer der herrschenden Weltordnung sind, den ca. 190 restlichen Souveränen also der Stellenwert von Objekten dieser Ordnung zukommt. Unter denen macht die Außenministerin immerhin Unterschiede. Den Europäern – in Wahrheit heißt das: den wenigen maßgeblichen Nationen auf dem alten Kontinent – tut sie die Ehre an, sie als Mit-Aufseher über den ganzen vielschichtigen, gefährlichen und sich schnell verändernden
Laden anzusprechen und zur Bewältigung von Aufgaben einzuladen, die zumindest andeuten, um was für ein Vorhaben es den Amerikanern geht:
- Die
Verbreitung von Kernwaffen
gilt es zu verhindern. Bei den Staaten, aus denen die USAim kommenden Jahrhundert die Welt aufzubauen
gedenken, handelt es sich also um Machtgebilde, von denen nicht wenige darauf aus und von denen viele absehbarerweise auch dazu in der Lage sind, sich die allerwuchtigsten militärischen Gewaltmittel, solche von völlig unakzeptabler Zerstörungskraft zuzulegen. Gegen diese Absicht und die entsprechende Fähigkeit, sagt die Ministerin, schreiten die USA ein, hindern die Staatenwelt – soweit sie nicht schon Atomwaffen besitzt – daran, sich zu ultimativer Kriegsführung zu befähigen, diktieren ihr also einen Status, der sie darauf festlegt, sich im Bedarfsfall militärisch fertigmachen zu lassen; von wem und nach wessen Bedarf, die Fragen sind mit der Aufgabenstellung schon beantwortet. - Den
Weg von Diktatur zu Demokratie
begleitet
Amerika, macht sich also praktisch zuständig für die Art von Herrschaft, die in der restlichen Staatenwelt ausgeübt wird. Es nimmt so mit größter Selbstverständlichkeit die Oberhoheit über alle Staatsgewalt auf dem Globus wahr. - Und dass die USA auch Inhalt und Ziele staatlicher Herrschaft in anderen Ländern, deren Staatsräson, ihrer Kontrolle unterwerfen, macht, pars pro toto, der knappe Hinweis aufs
Krankheiten bekämpfen
als amerikanische Weltbaustelle klar: In letzter Instanz sind die Vereinigten Staaten jenes ‚Höhere Wesen‘, bei dem die Völker dieser Welt ihre Bedürfnisse nach guter Regierung anzumelden, dem sie ihr Schicksal anzuvertrauen haben.
Zur Wahrnehmung dieser wahrhaft umfassenden Kontrollmacht über die Staatenwelt erklärt die Ministerin die transatlantische Gemeinschaft
für unerlässlich
; und es kann keinen Moment lang Unsicherheit darüber bleiben, wer hier anschafft und wer in seine Rolle eingewiesen wird. Die USA lassen sich zu nichts auffordern; sie laden die Europäer zum Mitmachen ein – bei einer Weltherrschaft, deren Vorhaben und Aufgaben sie definieren. Und deren Inhalt und Endzweck Frau Clinton in der schönen Trias zusammenfasst: unsere gemeinsamen Werte, unsere gemeinsame Sicherheit, unser gemeinsamer Wohlstand.
Die „indispensable nation“...
Präsident Obama hält sich zugute, diese Kontrollmacht der USA wieder in Ordnung gebracht und der Staatenwelt klar gemacht zu haben, dass die USA auch künftig ihre globale Führungsmacht bleiben werden.
„Ich habe versprochen, den Kurs der amerikanischen Außenpolitik so zu ändern, dass wir den Krieg im Irak beenden, und uns wieder darauf konzentrieren, unseren eigentlichen Feind, Al Kaida, zu schlagen, dass wir unsere Bündnisse und unsere Führung in multilateralen Foren stärken und die amerikanische Führerschaft in der Welt wiederherstellen. Und ich denke, wir haben diese grundsätzlichen Ziele erreicht.
Diese US-Führerschaft ist eine, die unsere Grenzen in Bezug auf Mittel und Fähigkeiten anerkennt. Und doch, glaube ich, haben wir es geschafft, bei anderen Nationen die klare Auffassung zu etablieren, dass die Vereinigten Staaten fortfahren werden, die eine für die Bewältigung größerer internationaler Probleme unverzichtbare Nation zu sein. Und ich denke, dass es einen starken Glauben gibt, dass wir eine Supermacht sind, die, vielleicht einzigartig in der Geschichte, nicht nur selbstsüchtig handelt, sondern darüber nachdenkt, einen Korpus internationaler Regeln und Normen zu schaffen, denen alle folgen und aus denen alle Nutzen ziehen können. All diese Veränderungen zusammengenommen sind die USA heute in einer viel stärkeren Position, um ihre Führerschaft über das nächste Jahrhundert zu bekräftigen, als vor kaum drei Jahren.“ (Interview Time, 19.1.12)
Seine Neuausrichtung der Außenpolitik – er konzentriert sich auf die nötigen Kriege und beendet die unnötigen und misslungenen in einer Weise, die mit Rückzug aus der Weltpolitik nicht zu verwechseln ist – will der Präsident als einen Akt der Belehrung anderer Staaten verstanden wissen; und zwar über deren ureigenes Bedürfnis: Er will ihnen klargemacht haben, dass sie auch künftig auf die unverzichtbare Nation nicht verzichten müssen, die den Streit zwischen ihnen entscheiden, ihnen ihre Rechte sichern, unberechtigte Ansprüche in die Schranken weisen und dadurch allen Staaten den Weltfrieden spendieren kann, aus dem sie Nutzen ziehen. Die USA bestehen darauf, als ein wohlwollender Hegemon anerkannt zu werden, der nicht – jedenfalls nicht nur – selbstsüchtig herrscht, sondern den Objekten seiner Vorherrschaft einen Dienst erweist: Er gibt und sichert Regeln, die die für ihren friedlichen Verkehr brauchen und die ohne eine Macht, die für ihre Geltung sorgt, nichts wert wären. So sieht der Chef der Weltmacht die Welt. Und soweit etwas dran ist an seiner Weltsicht, wirft das kein gutes Licht – weder auf die Staaten, die für ihren Nutzen einen Haufen Maßregeln samt kriegsbereitem Aufpasser brauchen, noch auf den zwischenstaatlichen Verkehr, die dafür offenbar nötigen Verkehrsregeln und die Funktion einer für deren Einhaltung zuständigen Supermacht
, für die Obama sein Land lobt.
Unerlässlich ist ein Korpus
bindender internationaler Regeln und Normen
, weil der Umgang der Staaten miteinander von einem fundamentalen Antagonismus geprägt ist. Das ist bei Gewaltmonopolisten auch kein Wunder, und schon gar nicht bei dem Stoff, auf den die Masse besagter Regeln sich bezieht, nämlich unserem Wohlstand
, den die US-Außenministerin in einem Atemzug mit unserer
transatlantischen Sicherheit
nennt. Was die gegeneinander souveränen Staaten – und das tatsächlich nach Maßgabe amerikanischer Vorgaben – untereinander als Quelle ihres Wohlstands eingerichtet haben, ist ein weltumspannendes kapitalistisches Geschäftsleben: die komplette Indienstnahme des Globus und der Verbrauch seines lebenden und toten Inventars für das Wachstum der potentesten Kapitale und die Wohlfahrt der Höchsten Gewalten, die daran partizipieren; ein Geld- und Kapitalverkehr, der sich die Länder mit ihren Ressourcen, die Völker mit ihren Produktivkräften und ihrer Kaufkraft, sogar die Staaten mit ihrem Finanzbedarf als Mittel privatwirtschaftlicher Bereicherung einverleibt hat. Die Konkurrenz der Firmen, die weltweit tobt, ist die materielle Basis und der Stoff für die Bemühungen der Staatsmächte, sich in Konkurrenz gegeneinander als souveräne Herrschaften über Land und Leute zu behaupten. Als hoheitliche Sachwalter der Geschäftsinteressen, die unter ihrer Regie aktiv sind und deren Gesamterfolg – der mit den untereinander konkurrierenden Einzelinteressen ihrer nationalen Firmen keineswegs identisch ist – sie brauchen und betreiben, treten die Staaten gegeneinander an; als Schutzmächte ihrer selbstdefinierten nationalen Belange sind sie zu gewaltsamem Eingreifen jederzeit und immerzu bereit.
Darauf bezieht sich der Korpus internationaler Regeln
, für deren Durchsetzung Obama sein Amerika lobt. Diese Regeln schreiben den staatlichen Gewaltmonopolisten vor, was die selber den natürlichen und juristischen Personen unter ihrer Hoheit vorzuschreiben pflegen, nämlich an welche Richtlinien sie sich halten müssen, damit sie sich in ihrer Konkurrenz gegeneinander zugleich aufeinander verlassen können – lauter Ermächtigungen und Beschränkungen, denen die Höchsten Gewalten gehorchen sollen. Die gehorchen aber keinem Recht, sondern setzen Recht. Auch im Verkehr untereinander verfolgen sie nicht bloß irgendwelche Interessen, sondern machen ihr Recht geltend – also die höhere Gewalt, mit der sie über die Berechtigung von Interessen und Berechnungen entscheiden. Ein verbindliches internationales Regelwerk ist daher ein widersprüchliches Ding: Damit die Staaten ihre gegensätzlichen Interessen aneinander mit- und gegeneinander verwirklichen können, müssen sie sich Vorschriften unterwerfen, deren Geltung von ihrem eigenen souveränen Machtwort abhängt.
Obamas Stolz ist es, dass Amerika diesen Widerspruch gelöst hat – nämlich aufgelöst in den höheren Widerspruch einer auf Anerkennung nicht bloß bedachten, sondern auch gegründeten Führerschaft seiner Nation im Verhältnis zum Rest der Staatenwelt. Er macht wahrlich kein Geheimnis daraus, dass die USA ihre Führungsmacht daraus gewinnen, dass sie mit ihrem Militär jeder anderen Staatsgewalt tatsächlich effektiv Schranken setzen und Beschränkungen auferlegen können: Den Nicht-Atommächten drohen sie für den Ernstfall mit einer kriegerischen Zerstörung, der für sie selber ein überschaubares Risiko enthält – und sie arbeiten daran, wie Frau Clinton in Erinnerung bringt, die Staatenwelt mit den wenigen nicht mehr rückgängig zu machenden Ausnahmen in diesem Status festzuhalten, notfalls mit eben dem besagten Ernstfall –; den nicht verbündeten Atommächten können sie mit ihrem weit gefächerten Arsenal immerhin ein militärisches Kosten-Nutzen-Kalkül aufzwingen, das zwar keine letzte Sicherheit schafft, den Respekt vor amerikanischen Rechtsansprüchen aber mindestens ratsam, wenn nicht unausweichlich erscheinen lässt. Zugleich besteht der US-Präsident darauf, dass Amerikas Führerschaft kein bloßer Gewaltakt, sondern weltweit akzeptiert ist. Und darin hat er insoweit recht, als das Regelwerk des globalen Kapitalismus, das von den USA Stück um Stück durchgesetzt worden ist, tatsächlich in einer von ihrem Urheber abgetrennten, verselbständigten Gestalt existiert und effektiv funktioniert, ohne dass Amerika dauernd seine militärische Gewalt als schlagende Garantie für allgemeines regelkonformes Mitmachen aktivieren muss. Als Regelungsinstanzen fungieren die bekannten UNO-Organisationen und supranationalen Institutionen wie WTO, Weltbank und IWF; in denen kann sich jeder Souverän als Mit-Urheber und Mit-Garant der normgerechten Beschränkungen wiederfinden, denen er unterliegt. Die Geschäftsordnung, mit der die USA alle Staatsgewalten auf die Konkurrenz ums Geld – und zwar maßgeblich um ihren Dollar! – als ihr ökonomisches Lebensmittel festlegen, ist unter dem Dach der „Völkergemeinschaft“ fest institutionalisiert. Und diese Methode, die praktische Gleichsetzung der amerikanischen Staatsräson mit dem „wohlverstandenen Eigeninteresse“ und dem politischen Willen aller anderen Souveräne, hat sich dermaßen bewährt, dass schon längst gar nicht mehr bloß die Außenhandels- und sonstigen Außenbeziehungen der Staaten einem immer umfänglicheren Regelwerk und einer ziemlich eingreifenden supranationalen Schiedsgerichtsbarkeit unterliegen: Auch ganz viele interne Politikbereiche sind – mehr oder weniger – Gegenstand von Rechtsansprüchen geworden, die von fremden Souveränen geltend gemacht werden können. Auf der Grundlage hat sich das internationale Geldkapital über alle Interna nationalstaatlicher Politik hergemacht, kalkuliert damit bei seiner Bewirtschaftung der Nationen als seinen Anlagesphären; und mit den Geld- und Warenströmen, die es rund um den Globus dirigiert, trägt es zur Verselbständigung des Korpus internationaler Regeln und Normen
, nach denen die staatlichen Souveräne sich zu richten haben, von Amerikas Kontrollmacht ganz kräftig bei.
Allerdings hat dieser Welterfolg der kapitalistischen Geschäftsordnung made in USA seinen Preis. Für die Staaten, die in der Konkurrenz der Kapitalstandorte immer gegen nationale Niederlagen anzukämpfen haben, sowieso. Der Führungsmacht selbst erwachsen aber auch aus der vielschichtigen
und sich schnell verändernden Welt
, die sich unter ihrer Regie gebildet hat, eine Menge Herausforderungen
. Zum einen wird unter dem fortdauernden und laufend ausgedehnten Regime der gepriesenen globalen Geschäftsordnung der Gewaltbedarf der Staatenwelt keineswegs geringer, sondern immer größer: Auf immer mehr Feldern, immer intensiver und immer weiträumiger bekommen es die Staaten als Konkurrenten miteinander zu tun; und mit ihren entsprechend vervielfachten widerstreitenden Rechtsansprüchen auf fremdes Entgegenkommen und Zurückstecken nimmt für die politisch Verantwortlichen die Notwendigkeit zu, sich bei ihresgleichen Respekt zu verschaffen. Dieses Bedürfnis, die vielen Rechte, die eine moderne Staatsgewalt sich zuspricht, auch durchzusetzen, wird durch die Regeln und Institutionen, die vom Konsens der Souveräne getragen sind, keineswegs ausreichend befriedigt. Den Musterfall dafür liefert – ausgerechnet, aber auch ganz logischerweise – die Supermacht selber. Die ist nämlich – zum andern – von dem so effizienten und effektiven Widerspruch, den eigenen Kapitalismus in Gestalt einer verselbständigten Geschäftsordnung und eines Regimes supranationaler Organisationen weltweit durchzusetzen, ganz außerordentlich betroffen: Wenn konkurrierende Nationen nicht bloß für sich auch Nutzen daraus ziehen, sondern der Führungsmacht deren Nutzen streitig machen, dann verletzen sie damit nicht bloß irgendein amerikanisches Interesse, sondern verstoßen gegen die Regeln und fordern damit die Gewalt heraus, die das System regelkonformer Verteilung von Nutzen und Schaden zwischen den staatlichen Konkurrenten garantiert. Aus dem Mund der zuständigen Ministerin klingt ein solcher Befund so:
„Viel zu oft wirken sich unfaire Praktiken für amerikanische und europäische Unternehmen zum Nachteil aus: Bevorzugung staatlicher Unternehmen, Handelsbarrieren, Beschränkungen von Investitionen und der überhand nehmende Diebstahl geistigen Eigentums. Europa und die Vereinigten Staaten müssen darauf bestehen, dass alle Nationen die Regeln achten, die fairen Wettbewerb und Zugang zu den Märkten sicherstellen.“ (Clinton, München, 4.2.12)
Auch dafür lässt Amerika natürlich nicht seine Bomberflotte losfliegen. Um jedoch erfolgreich auf die Berechnungen von Staaten einzuwirken, die Amerikas Rechte und damit die herrschenden Fairnessregeln überhaupt – oder auch umgekehrt – verletzen, ist schon mehr vonnöten als der Appell an die Vorteils-Nachteils-Rechnungen, die die Nationen im Rahmen des etablierten Systems anstellen. Da müssen fremde Souveräne mit einer Macht konfrontiert werden, die ihrem souveränen Eigensinn als solchem, ihrer Freiheit, die sie sich bei der Definition ihrer nationalen Rechte herausnehmen, wirksam Einhalt gebietet. In der Praxis des zwischenstaatlichen Verkehrs stellt sich diese Notwendigkeit in den verschiedensten Varianten laufend ein; dauernd sieht sich Amerika durch die vielschichtigen, gefährlichen
Machenschaften anderer Staaten herausgefordert. Und damit kommt das System der internationalen Rechtsbeziehungen ganz praktisch auf seine wirkliche Grundlage zurück, die eben nicht bloß bei seiner Entstehung wirksam war, sondern dem gesamten Umgang heutiger Staaten miteinander immanent ist: Die Einbindung souveräner Mächte in ein verbindliches Regelwerk beruht, wenn sie verlässlich und als Weltordnung tragfähig sein soll, auf der Brechung der Souveränität der Staaten, und zwar durch eine bewaffnete Übermacht. Das Fundament der Geschäftsordnung, auf deren Wirksamkeit Obama so stolz ist, ist das Regime glaubhafter militärischer Abschreckung – in diesem prinzipiellen Sinn also allemal die Schlagkraft amerikanischer Bomberflotten, und was die Supermacht sonst noch zu bieten hat.
... und ihre unverzichtbaren Partner
Freilich das nicht allein; und damit kommt die „indispensable nation“ ihrerseits auf die Unverzichtbarkeit ihrer transatlantischen Allianz zurück: Amerika braucht Europa. Zuerst und vor allem deswegen, weil das der Teil der Welt ist, in dem die – zumindest in der Summe nach wie vor – potentesten Konkurrenten der USA mit weltherrschaftlichen Ambitionen von vergleichbarem Anspruchsniveau zu Hause sind. Hier zuallererst muss Amerikas „leadership“ Gefolgschaft finden; die müssen mitmachen, wenn die Geschäftsordnung des US-Kapitalismus überhaupt in nennenswertem Umfang wirksam werden soll. Und das heißt: Die europäischen Weltwirtschaftsmächte müssen nicht bloß berechnend und zu eigenen Bedingungen ein internationales Geschäftsleben organisieren helfen, sondern zu so grundsätzlichem Mitmachen bereit sein, dass sie ihre Souveränität an der Richtlinienkompetenz relativieren, die Amerika als Tutor der Weltrechtsordnung beansprucht; denen müssen die USA ihre Anerkennung als Garantie- und Schutzmacht nationaler Rechte und als letzte Entscheidungsmacht über deren Reichweite abringen. Daran entscheidet sich, ob Amerikas Korpus internationaler Regeln und Normen
wirklich globale Gültigkeit erlangt oder Stückwerk bleibt.
Hier hat sich für Amerika ausgezahlt, dass der 2. Weltkrieg nicht nur für die Verlierer, sondern auch für die westeuropäischen Alliierten ruinös geendet hat und die USA als einzige kapitalistisch schlagkräftige Nation übriggelassen hat: Um als bürgerliche Staaten zu überleben und als kapitalistische Mächte neu aufzuleben, hatten die Länder Westeuropas keine andere Wahl als die freiwillige Eingliederung in die von den USA beherrschte transatlantische Allianz. Entscheidend war dann freilich die jahrzehntelange weltkriegerische Konfrontation des kapitalistischen Westens mit der Sowjetmacht und deren ‚Ostblock‘: Die amerikanisch gesponserte Atomkriegsbereitschaft hat die autonomen militärischen Fähigkeiten der Westeuropäer, auch die der kleinen Atommächte Großbritannien und Frankreich, heillos überfordert und dauerhaft auf die USA als Schutzmacht festgelegt. Dabei hat die Zusicherung der USA, bei dem durchgeplanten strategischen Atomkrieg das Schicksal Europas mit dem Überleben der eigenen Nation zu verknüpfen, für den Schein einer letztlich äquivalenten Verteilung von Kompetenz und Risiko gesorgt und die gar nicht bloß scheinbare Anerkennung der USA als Führungsmacht durch die transatlantische Gefolgschaft gefestigt. Schon vor dem Ende der Sowjetunion hat diese zum „Westen“ verschmolzene Kriegsallianz auch in dem Sinn imperialistisch produktiv gewirkt, dass kaum ein Staat der westlichen Hemisphäre das Ordnungsregime der USA in Frage gestellt und deren Führungsanspruch herausgefordert hat; an den Ausnahmefällen wurde exemplarisch vorgeführt, wie der Westen ‚Frieden durch Abschreckung‘ versteht. Nach Jahrzehnten der „kalten“ Kriegsführung und des aktiven „Totrüstens“ hat die NATO dann den sozialistischen Gegner in den Selbstmord getrieben. Gleich anschließend hat sie sich als Instrument bewährt, die Hinterlassenschaft der zerstörten Sowjetherrschaft ins westliche Weltsystem einzugliedern. Seither erwächst den Amerikanern ihr größtes strategisches Problem daraus, dass sich die beiden nicht verbündeten Atommächte der von Amerika und seinen Verbündeten geschaffenen Weltordnung samt supranationalen Institutionen und rasendem kapitalistischem Geschäftsleben nicht länger entziehen, sondern das alles zu ihrer Sache machen – zu ihren Konditionen und unter Zurückweisung des amerikanischen Anspruchs auf Führerschaft: ein Anschlag auf die Unverzichtbarkeit der USA für ein funktionierendes internationales Regelwerk, quasi eine versuchte Enteignung des Urhebers der imperialistischen Rechtsordnung.
Umso wichtiger ist für die USA im kommenden Jahrhundert
ihre fortdauernde Anerkennung als absolut unentbehrliche Garantie- und Schutzmacht durch die Europäer: Nur dann bleibt die globale Geschäftsordnung noch unter „westlicher“ und damit letztlich unter ihrer Kontrolle. Der alte, unbedingt überzeugende Grund für eine solche Gefolgschaft ist mit der gemeinsamen Feindschaft gegen die Sowjetunion zwar entfallen; aber das betrifft ja nur eine wichtige Errungenschaft eines vergangenen Jahrhunderts
und nicht die imperialistische Weichenstellung für das neue. Um die zu sichern, macht die US-Regierung ihren Partnern ein Angebot, das Deutschland, Frankreich, Großbritannien und folglich auch der ganze Rest einfach nicht ausschlagen können – oder jedenfalls nicht ablehnen sollten: ein Angebot, das auf den weltherrschaftlichen Nutzen tatkräftiger amerikanischer Führerschaft und treuer europäischer Gefolgschaft für beide Seiten zielt. Das ist jedenfalls Sinn und Zweck der neuen Partnerschaftsinitiative Obamas. Er anerkennt ausdrücklich die Angewiesenheit seiner Weltordnungsmacht auf die transatlantische Allianz und setzt sich damit demonstrativ ab von der „unilateralen“ Politik seines Vorgängers: „Ja, unsere Macht hat Grenzen, wir können nicht alles auf der Welt kontrollieren und wir können bei der Kontrolle nicht alles alleine machen.“ Die beiden Bushs hatten nach dem Ende der Sowjetunion die USA als einzige überlebende Supermacht ausgerufen, die sich an Verbündete nicht mehr fesseln, auf sie keine Rücksicht mehr nehmen muss, weil sie der Welt ganz alleine ihr Gesetz aufzwingen kann. Bush Junior hat den alten Partnern daher die nahöstlichen Feinde Amerikas als die Front präsentiert, in die sie sich einsortieren, für die sie Kriegsdienste leisten sollten, ohne dass die Amerikas Feinde auch für die ihren hielten. Er stellte sie vor die Alternative, entweder für Amerikas Kriege Beiträge abzuliefern oder „irrelevant“ zu werden. Bei ihm sollte nicht mehr „die Allianz den Auftrag“ definieren, sondern „der Auftrag die Allianz schaffen“; die NATO wurde zum „Werkzeugkasten“ degradiert, aus dem Amerika sich nach Bedarf bedienen, auf den es sich aber nicht verpflichten lassen sollte, weil es für seine Kriege jederzeit genug Interessenten finden würde, die „Koalitionen der Willigen“ bilden. Statt des angestrebten klaren Machtbeweises der USA, der die Partner, die sich nicht zur Verfügung gestellt hatten, ins Unrecht setzen und isolieren sollte, haben die Regime Changes in Irak und Afghanistan nun aber zu Chaos, zerstörten Staaten und einem Sumpf von Besatzungsregime und Bürgerkrieg geführt, in dem für die USA nichts mehr zu gewinnen ist. Bush hat die Verweigerer im Westen nicht bestrafen können, seine Koalition der Willigen hat nicht triumphiert, sondern sich je länger, desto mehr aufgelöst. Einige NATO-Staaten – Deutschland und Frankreich vor allem – haben sich auf die Suche nach neuen strategischen Partnerschaften – mit Russland und China – begeben und den Aufbau einer „europäischen Verteidigungs-Identität“ vorangetrieben; vom bevorstehenden Ende der NATO war die Rede.
Das alles verbucht Obama als Schwächung der amerikanischen Stellung in der Welt. Außerdem beeindruckt ihn der unaufhaltsame Aufstieg Chinas als kapitalistische Großmacht, die bei aller Vorsicht und Kompromissbereitschaft darauf besteht, ein Souverän aus eigener Machtvollkommenheit zu sein, sich auf den von Amerika geschaffenen Weltmarkt nur zu eigenen Bedingungen einzulassen und seine Rechtsansprüche autonom geltend zu machen; allein dadurch qualifiziert sich China als gefährlicher Rivale.[1] Das Ignorieren des chinesischen Aufstiegs wie die Entfremdung der europäischen Verbündeten legt Obama seinem Vorgänger als schwere Fehler zur Last und belehrt ihn rückblickend darüber, dass Führung nicht nur einen braucht, der vorwegmarschiert, sondern auch andere, die sich führen lassen und folgen. Nicht zuletzt wegen des chinesischen Rivalen wertet er die NATO wieder auf und setzt die Verbündeten in alte Rechte ein. Den paar wichtigen Nationen des Bündnisses offeriert er nichts Geringeres als Teilhabe an der amerikanischen Beherrschung der Welt und sucht mit ihnen in diesbezüglichen Fragen den Konsens. Erst zusammen mit den nach ihnen reichsten und daher auch militärisch zu einigem fähigen europäischen Nationen bilden die USA den Machtblock, an dessen Machtworten keine Macht der Welt vorbeikommt.
Damit gerät der US-Präsident an die Richtigen: Die Regierungen in Berlin, Paris, London haben etwas übrig für Imperialismus – und zwar wie die USA gleich auf der Ebene des heutigen Weltordnens. Ein imperialistischer Auftritt ohne die Supermacht erscheint ihnen, jedenfalls außerhalb ihrer Europäischen Union, wenig aussichtsreich, schon deswegen, weil sie überall auf Amerikas Interessen und die Präsenz seiner Waffen treffen; eine strategische Rivalität gegen die USA kommt schon gar nicht in Frage. Das Angebot, Kontrollmacht über die Staatenwelt nicht gegen die USA erringen zu müssen, sondern an deren Kontrollmacht zu partizipieren, passt bis auf weiteres besser zur Verfassung der Welt wie zu ihrer eigenen. Als global agierende Großmächte, deren Wort überall Gewicht hat, sind sie durchs Bündnis mehr, als sie für sich sein könnten. Natürlich sind sie für diese ambitionierte Rolle auf die strategische Einheit mit der Supermacht dann auch in ganz anderer Weise angewiesen als umgekehrt. Was sie als Weltmächte sind, sind sie nur an der Seite Amerikas und nur mit der Rückendeckung seiner Waffen. Das wieder bindet mit seinem Angebot diese potenten, prinzipiell zur Rivalität fähigen Nationen in seine Vorherrschaft ein: Die Europäer unterschreiben, dass es sich dabei nicht um Unterdrückung, sondern Führung handelt und dass die Welt Führung braucht. Und sie gehen mit dem Widerspruch um, bei der Beherrschung der Welt nur Juniorpartner zu sein.
Das Ringen um Führung
Die kollektive Weltherrschaft des Westens hat anders als in den ersten 40 Jahren der NATO keinen feststehenden gemeinsamen Feind mehr, den jeder Bündnispartner von sich aus als Hindernis seiner Machtentfaltung und seines Einflusses auf andere Staaten ansieht, in Schach halten und auf längere Sicht entmachten will, dessen Bekämpfung jedoch die europäischen Alliierten an der ostatlantischen Gegenküste der USA hoffnungslos überfordert und damit fest an Amerika bindet, dessen Atomkriegsplanung einen „atomaren Schutzschirm“ über Westeuropa vorsieht. Das Bündnis hat seinen Feind überlebt und damit seinen eindeutigen strategischen Lebenszweck hinter sich gelassen, der die Rolle der USA als bestimmende Führungsmacht begründet hat. Doch auf diese Rolle will Amerika auf keinen Fall verzichten; es braucht Europas Gefolgschaft nach wie vor für seinen Auftritt als unverzichtbare Garantiemacht einer für Amerika und den Welt-Kapitalismus brauchbaren verbindlichen Geschäftsordnung. Die merkwürdige Beschlusslage der NATO heute lautet daher: Man beherrscht die Welt gemeinsam – und was das jeweils heißt, welcher Staat die westlichen Kreise stört und zum Feind wird, wo man sich mit abweichenden Mächten arrangiert, sie diplomatisch zur Kooperation erzieht, mit Wirtschaftskrieg fertigmacht oder zu den Waffen greift, darüber muss und will man sich in jedem Einzelfall erst noch einig werden. Das ist viel Stoff für Konkurrenz im Bündnis: Jede Partei lässt sich auf ein Zusammenwirken ein mit der Rechnung, die Partner für ihre Interessen und die Erweiterung ihrer Macht einzuspannen; jede Seite und am Ende jede Nation präsentiert dem Club den oder die Staaten, die sie stören, als den gemeinsam zu bekämpfenden Feind, den die anderen deshalb aber noch lange nicht für ihren Feind halten. In diesem Hin und Her macht sich selbstverständlich geltend, dass die Angewiesenheit aufeinander doch eine sehr asymmetrische Sache ist. Die USA führen, sie benutzen das Interesse der Partner am Bündnis, um sie für ihre Weltordnungsziele in Dienst zu nehmen; sie machen Angebote an deren Machtambitionen und treiben den Preis für die Aufwertung ein, die sie ihnen verschaffen.
- Der beständige Kampf um die Funktionalisierung der Partner kann so freundlich geführt werden wie bei Mrs. Clintons Münchener Einladung, die Europäer sollten sich doch im eigenen Interesse mehr Imperialismus in Richtung Osten und Süden genehmigen. Sie ignoriert die antiamerikanische Seite des europäischen Aufbaus, spricht ganz als Repräsentantin europäischer Ordnungsmacht und ermahnt ihre Zuhörer, dass „wir“ auf der globalen Bühne nicht bestimmend auftreten können, solange „wir“ nicht einmal „unser Zuhause“ im Griff haben.
„Erstens müssen wir das, was unsere Vorgänger begonnen haben, zu Ende führen, und ein sicheres, geeintes und demokratisches Europa aufbauen. … Solange große Konflikte in Osteuropa, auf dem Balkan, im Kaukasus und im Mittelmeerraum ungelöst bleiben, so lange bleibt auch Europa unvollständig und unsicher. Trotz der schwierigen globalen Agenda dürfen wir die Probleme zuhause nicht aus den Augen verlieren.“ (Clinton, München, 4.2.12.)
Das Zuhause, das Amerikas Außenministerin den Europäern zuweist, reicht übers Mittelmeer hinaus und bis in den Kaukasus. Clinton fordert von ihren Partnern, dass die ihren ureigenen Zuständigkeitsbereich zielstrebig ausfüllen und den Einfluss der einzigen anderen Macht, die dem euro-amerikanischen Kartell noch Paroli zu bieten vermag und auf ihrer Autonomie und einem eigenen Umfeld von abhängigen Schützlingen besteht, zurückdrängen, im Endeffekt eliminieren. In der Richtung lässt „unser“ Imperialismus schwer zu wünschen übrig – das „Wir“ vereinnahmt Europa für Amerikas Anspruch auf Beschränkung und Einhegung des nach wie vor nicht unter Kontrolle gebrachten Russland.
- Dieselbe Einladung ergeht in Richtung Süden, wo Machtrivalen der USA zwar nicht zu finden sind, wohl aber eine Menge unzuverlässige und von Umsturz bedrohte Staaten. Der Libyen-Krieg vom letzten Jahr wird auf der Sicherheitskonferenz zumindest von den NATO-Staaten, die sich beteiligt haben, als ein Fall gelungener Waffenbrüderschaft gewürdigt. Die USA haben europäischen Kriegstreibern die Initiative überlassen und sich auf ein „leading from behind“ beschränkt. Statt Konkurrenz nur zu unterbinden, probieren sie aus, ob und wie sich kriegerische Eigenmächtigkeiten von Partnern benutzen und zu einer Demonstration der amerikanischen Unverzichtbarkeit und Durchsetzungsfähigkeit umbiegen lassen. Sie lassen sich also für den französisch-britischen Machtbeweis in Anspruch nehmen und bewähren sich dann als Garantiemacht von deren Macht; um so lieber, als die ein altes Ärgernis der USA, den Colonel Gaddafi, wegräumen und in Libyen ein anti–antiimperialistisches Regime an die Macht bringen. Die Klarstellung, wer Koch und wer Kellner ist, kommt nicht zu kurz: Aus dem britisch-französischen Eingriffswillen wird im UN-Sicherheitsrat erst etwas, sobald sich die USA nach einigem Zögern dahinterstellen. Den Eingriff selbst ermöglichen die USA den Partnern dadurch, dass sie, was diese gar nicht könnten, in kaum einem Tag die libysche Luftverteidigung vernichten und britischen und französischen Bombern freie Bahn schaffen. Am Schluss gibt die Peinlichkeit, dass den Bombenmächten im Lauf der Kampagne die Munition ausgeht und sie schon wieder auf US-Hilfe zurückgreifen müssen, noch einmal Gelegenheit zur Demonstration der Kräfteverhältnisse im Bündnis: Die Europäer können die Kriege, die sie im eigenen Interesse und auf eigenen Beschluss hin anstreben, weder weltpolitisch durchsetzen noch alleine anfangen noch alleine zu Ende bringen. Die Führung aus dem Hintergrund sieht sich bestätigt; ihre Partner haben sich ihr aus eigenem Antrieb zur Verfügung gestellt. Briten und Franzosen sehen sich umgekehrt zu auch in Kriegsfragen wieder selbstständig handlungsfähigen Mächten aufgewertet. Über den Bruch der Bündnissolidarität durch Deutschland, das sowohl die Legitimation in der UNO wie das praktische Mitschießen verweigert, geht man pragmatisch hinweg. Wenigstens diesmal sieht man nicht schon wieder das ganze Bündnis in Frage gestellt. Erst recht nicht getrübt wird der Erfolg von der ungeklärten Bürgerkriegslage, die nun am Boden des „befreiten“ Landes herrscht. Um eine neue, gar bessere Ordnung für die Libyer ist es bei diesem vielseitig verschachtelten Machtbeweis eben nicht gegangen.
- Im Fall Iran funktioniert die Führerschaft der USA wieder anders herum: Ihre Entschlossenheit, ihren Kurs sowieso durchzuziehen, zwingt die Europäer, Vorbehalte aufzugeben und sich dem amerikanischen Kurs anzuschließen, den sie nicht von sich aus wollen. Das läuft unter anderem so, dass die US-Regierung im Zug der diplomatischen und militärischen Aufbereitung des Iran zum Feind einseitig Sanktionen verhängt, eben weil die Partner lange nicht mitmachen und ihre iranischen Geschäfte nicht der amerikanischen Feindschaft opfern wollten. Die Sanktionen kriminalisieren den gesamten Geschäfts- und Geldverkehr mit Iran und bedrohen Firmen, die ihn nicht abbrechen, mit Anklagen vor US-Gerichten und dem Ausschluss vom amerikanischen Markt. Mögen die Partnerstaaten zögern, ihre Konzerne und Banken werden auch ohne ihre Zustimmung als Helfer der amerikanischen Abschnürungspolitik rekrutiert. Die Drohung Israels, den Mullah-Staat auf eigene Faust zu entwaffnen, wenn die Weltgemeinschaft es nicht tut, liefert ein weiteres starkes Argument: Jetzt sind die Europäer eingeladen, sich an den Sanktionen und der übrigen Eskalation der Feindschaft zu beteiligen, um das Schlimmste abzuwenden. Sie dürfen mithelfen, den Iran zum Nachgeben zu bewegen, um Israel seinen Kriegsgrund zu nehmen. Alles Aufmischen der Lage, jeder Fortschritt der Abschnürung ist nun ein Beitrag zur Kriegsvermeidung.
- Bush’s Projekt einer Raketenabwehr für die USA und den gesamten Bündnisraum ist bei vielen europäischen Staaten auf Widerstand gestoßen. Das großzügige Angebot, mit der neuen „Defensiv-Rüstung“ fremden Atomwaffen die Abschreckungswirkung zu nehmen, Europa also mit dem Privileg auszustatten, atomar nicht erpressbar zu sein, wie es sonst nur die USA sind, fand kein ungeteiltes Echo unter den europäischen Staaten. Aufschlussreich ist die amerikanische Beteuerung, die geplante Raketenabwehr sei selbstverständlich nicht auf eine Entwertung russischer Waffen, sondern ausschließlich gegen zukünftig eventuell drohende iranische Atomwaffen gerichtet. Diese Beschwichtigung richtet sich keineswegs nur an die Adresse Russlands, das damit zur Hinnahme der Maßnahme bewegt werden soll. Das Pentagon will damit zugleich Vorbehalte des vormals so genannten „alten Europa“, insbesondere Deutschlands zerstreuen, die Beteiligung am neuen US-Raketenschild sei dazu geeignet, den Ausbau der guten Beziehungen zu Russland als einem herausragenden Energieversorger und Partner von strategischem Format zu stören. Eine Sorge, die exakt von der Zwecksetzung des Raketenschirms ausgeht, die die USA diplomatisch dementieren. Andere europäische Staaten wie Polen und Rumänien, in der Diktion der verblichenen Bush-Ära noch „neues Europa“ getauft, gewinnen dem US-Vorstoß viel Positives ab und sehen darin ein Angebot, das sie keinesfalls ausschlagen wollen. Auch sie durchschauen natürlich sofort, dass der Reiz der neuen Raketenabwehr genau in der Qualität und Leistung liegt, die die USA bei ihrer Werbung für die „Missile Defense“ so kategorisch ausschließen: Sie entwertet die militärische Schlagkraft Russlands. Und daran ist den Osteuropäern sehr gelegen, weil ihnen der große Nachbar Russland immer noch zu mächtig und in seiner dominanten Einflussnahme im Osten unerträglich und bedrohlich erscheint.
Dieses geteilte Echo in Europa hat nichts an der Entschlossenheit der Obama-Regierung geändert, das Raketensystem zu installieren:
„We will continue with our deployment of missile defenses... And this will, of course, include putting assets in Poland and Romania, a radar in Turkey, and the home porting of missile defense-capable Aegis destroyers in Spain. All of this is part of the European Phases Adaptive Approach to missile defense, but importantly, its another robust commitment to an American presence in Europe in cooperation with our European partners on the true challenges that we face in the 21st century.“ (Philip H. Gordon, Assistant Secretary, Bureau of European and Eurasian Affairs, 9.1.2012)
In Separatverträgen mit Polen und Rumänien treibt Amerika die Stationierung des Systems voran, und dem „alten Europa“ begegnet die Obama-Regierung mit dem Argument, es möge doch seine Beteiligung an einem solchen Schutzschild als eine Aufwertung seines militärpolitischen Gewichts würdigen. Denn Mitmachen heißt auch Mitbestimmen in Fragen von weltpolitischer Dimension, auch wenn dieses Angebot zur Kooperation die Hierarchie gar nicht verleugnet, die ihr zugrunde liegt. Die Einsicht, dass sich das Programm ohnehin nicht mehr stoppen lässt, hat die deutsche Regierung dazu bewogen, sich der US-Strategie als einem NATO-Projekt anzuschließen, in dem Deutschland seinen Beitrag mit einigen Patriot-Raketen abliefert und im Gegenzug mit der Installierung der Kommandozentrale in Ramstein auf eine privilegierte Mitsprache baut. Auch Frankreich setzt dem US-Projekt nichts entgegen, steht aber einstweilen abseits, weil es durch einen solchen Rüstungsfortschritt seine eigene autonome atomare Schlagkraft relativ entwertet sieht.
Auch so funktioniert also die amerikanische Führung: Die Partner, die als EU organisiert sind, den USA aber nicht als EU gegenüberstehen, sondern ihnen zusammen mit noch anderen Staaten in der NATO verbunden sind, lassen sich gegeneinander ausspielen. Sie bilden kein einheitliches imperialistisches Subjekt. Einige von ihnen stehen, schon aus Gründen der innereuropäischen Machtkonkurrenz, amerikanischen Angeboten offener gegenüber und sind für Kriegseinsätze leichter mobilisierbar als andere; in den meisten US-Kriegen des letzten Jahrzehnts war die EU gespalten und handlungsunfähig. Mit Hilfe innereuropäischer Konkurrenzen verunmöglichen die Amerikaner bisher jede europäische Außenpolitik, die ihnen nicht passt. Alles, was die Verwiesenheit der Europäer auf die USA relativieren würde, hintertreiben sie konsequent.
Unzufriedenheit mit berechnenden Verbündeten
Den Widerspruch, großen europäischen Führungsmächten eine Beteiligung an der Herrschaft über die Staatenwelt im Tausch gegen deren Unterordnung unter amerikanische Sicherheitsbedürfnisse anzubieten, bekommen die Vereinigten Staaten umgekehrt zu spüren. Die Partner lassen sich auf ihre Indienstnahme für das globale amerikanische Gewaltmonopol ein, aber immer auch zugleich nach Maßgabe ihrer eigenen Berechnungen. Sie geben sich her für Abschreckung und Interventionen, aber nur dann, wenn, und nur so, wie es ihren besonderen Interessen nützlich scheint. Eine förmliche Bestreitung ihrer Führungsrolle und die offene Verweigerung von Gefolgschaft, also eine strategische Rivalität muss Amerika von Europa bis auf weiteres nicht fürchten. Aber die europäischen Verbündeten bleiben sperrige Partner. Sobald Amerika sie für seine Kriege in Anspruch nehmen will, teilen die sich ihren Einsatz ein. Teils machen sie bei Kriegseinsätzen gar nicht mit, teils sind sie sparsam mit Beiträgen, wenn sie mitmachen. Das erfüllt für die politische Führung in den USA den Tatbestand der Unzuverlässigkeit. Den „unreliable allies“ liest Robert Gates, Vorgänger des amtierenden Verteidigungsministers Panetta, die Leviten. Und weil er seines Amtes ledig ist, muss er sich keinerlei diplomatische Zurückhaltung auferlegen:
„Er (Robert Gates) stellte klar, dass dieses Land es sich nicht länger leisten kann, einen überproportionalen Anteil der NATO-Kriegführung zu tragen und einen überproportionalen Teil ihrer Rechnungen zu bezahlen, während Europa seine Verteidigungshaushalte zusammenstreicht und am kollektiven Sicherheitsgewinn schmarotzt. Die erschreckend wackelige Performance der NATO über Libyen, nachdem das Pentagon die Führung aus der Hand gegeben hatte, sollte keine Zweifel an Europas Schwächen mehr erlauben... Das sollte jedem Verteidigungsminister in Europa Angst einjagen. Was, wenn sie einen Feind von anderer Statur zu bekämpfen hätten als Col. Ghaddafis bröckelnde Diktatur? … Das Problem der Trittbrettfahrer ist alt, aber es ist über die letzten beiden Jahrzehnte noch schlimmer geworden.“ (Talking Truth to NATO, 10. 6.2011)
Der ehemalige US-Verteidigungsminister stellt sein Land als Opfer von Verbündeten hin, die eine faire Lastenteilung bei der NATO-Kriegführung und ihrer Finanzierung verweigern, aber den „Sicherheitsgewinn“ einfahren. Die ausdrücklich so genannten „Trittbrettfahrer“ schmarotzen an einer von den USA militärisch abgestützten Weltordnung, sehen sich aber außer Stande, für deren Pflege nennenswerte finanzielle und militärische Beiträge abzuliefern. Der Imperativ ist unüberhörbar: Europa soll sich mehr engagieren, weil die Aufrechterhaltung der Weltordnung seine eigene globale Geschäftsgrundlage betrifft, also in seinem eigenen Interesse liegt. Eine Art und Weise, die Verbündeten in die Pflicht zu nehmen, die über die auch im Pentagon bekannten Eigenwilligkeiten und Sonderinteressen der Europäer bei Rüstung und Krieg hinweggeht und sie dadurch en passant für unangemessen, störend und letztlich irrelevant erklärt. Wie selbstverständlich subsumiert diese Wortmeldung eines hochrangigen US-Politikers die europäischen Sicherheitsinteressen unter die amerikanischen, als wäre nicht gerade diese eingeforderte Gleichung auch eine Ungleichung, bei der Europa immer aufs Neue den geforderten Einsatz für eine auch ihm dienliche Weltordnung davon abhängig macht, ob und wie sehr damit seinen Sonderinteressen Rechnung getragen wird oder ob sie am Ende gar durch das US-Vorgehen beschädigt werden. Und eines sollte den Europäern in Ansehung ihrer jüngsten militärischen Aktionen in Libyen laut Gates klar sein: Alle europäischen Zweifel am Nutzen einer Einfügung in eine US-geführte Allianz zur Weltordnung wiegen nichts angesichts der Schwäche, die Europa bei seinem militärischen Auftritt in Libyen durchaus auch zu Protokoll geben musste. Ohne die Vorarbeit einer überlegenen US-Luftwaffe und ohne den Munitionsnachschub aus amerikanischer Fertigung hätte der Feldzug womöglich in einem Desaster für die europäischen Führungsmächte geendet.[2]
Die aktuelle weltweite Finanzkrise mit ihren Folgen für das wirtschaftliche Wachstum auf den nationalen Standorten gibt diesem politischen Grundsatzstreit zusätzliche Brisanz. Außenministerin Clinton zufolge sind nämlich
„Wohlstand und Sicherheit letztlich untrennbar miteinander verbunden, da die Stärke unseres Bündnisses von der Stärke unserer Volkswirtschaften abhängt. Das bedeutet, dass wir eine gemeinsame Agenda für wirtschaftliche Erholung und Wachstum brauchen, die genauso zwingend ist wie unsere globale Zusammenarbeit im Bereich Sicherheit. Wir wissen, dass die derzeitige Finanzkrise die dringlichste wirtschaftliche Priorität Europas ist. Wie Sie vielleicht wissen, müssen wir in den Vereinigten Staaten selbst eine Krise bewältigen. … Wir sind aber voller Vertrauen, dass Europa den Willen und die Mittel hat, nicht nur die Schulden zu reduzieren und die notwendigen Schutzwälle zu errichten, sondern auch, um Wachstum zu erzeugen, Liquidität zu schaffen und das Vertrauen in die Märkte wiederherzustellen. ... Ich spreche häufig über wirtschaftspolitische Staatskunst, da wir meines Erachtens nicht über das sprechen können, was wir im 21. Jahrhundert tun müssen, ohne zu erkennen, dass unsere Wirtschaftsstärke allem zugrunde liegt, was wir tun können, um unsere Werte zu fördern, unsere Interessen zu schützen, und eine Sicherheitsarchitektur zu schaffen, die auch in Zukunft Stabilität bringen wird.“ (aus Hillary Clintons schon zitierter Rede vor der Münchener Sicherheitskonferenz, 4.2.12)
Im Klartext: Der Ertrag, den die nationalen Wirtschaftsstandorte aus dem Weltmarkt herausschlagen, vornehm „Wohlstand“ genannt, ist für die Staaten, die als Hüter dieser Standorte fungieren, nicht das einzige und letzte Ziel. Dieser ökonomische Gewinn muss nämlich ihre Gewalt finanzieren, mit der diese Staaten die Sicherheit und Ordnung aufrechterhalten, in und an der ihre Wirtschaften verdienen. Die Gewalt bahnt dem globalen Geschäft seinen Weg, das Geschäft finanziert die dafür nötige Gewalt: In Bezug auf diesen produktiven Zirkel macht sich Europa eines schwerwiegenden Vergehens schuldig, so die US-Außenministerin. Die europäische Krisenbewältigung, die mit kreditfinanzierten Rettungsschirmen überschuldete Haushalte und marode Banken zahlungsfähig halten will, schlägt den von Amerika immer wieder angemahnten Weg aus, mit der unbegrenzten Schaffung von Liquidität durch die Zentralbank die Krise zu entschärfen und das Wachstum zugleich zu fördern. Genau das vermeidet Europa bis heute, auch deshalb, um sich und seine Währung als besonders „stabil“ vorteilhaft vom Dollar abzusetzen und das Interesse der globalen Finanzwelt weg vom US-Weltgeld hin zum Euro zu dirigieren. Das ist inmitten der Krise eine Währungskonkurrenz auf höchster Ebene, die aus der Sicht der USA zudem dazu führt, dass die europäischen Märkte mangels zureichender Liquiditätsversorgung wesentliche Leistungen für die amerikanische Wirtschaft und ihren Außenhandel schuldig bleiben.
Diesen wirtschaftspolitischen Streit rückt Clinton in die Nähe einer politischen Sabotage, mit der Europa sich selbst schadet, weil es dadurch Amerika beschädigt. Jede Beeinträchtigung amerikanischer Wachstumserfolge und -ansprüche, schon gleich ein wirtschaftlicher Abstieg der Supermacht, würde die Grundlage der ganzen Weltordnung bedrohen, auf deren Boden doch auch die Partner ihre Konkurrenzinteressen verfolgen. Das ist eine Mahnung, die das im Euro vereinigte Europa an einen Widerspruch erinnert, der für Amerika in der aktuellen Wirtschaftslage ausweislich des europäischen Krisenmanagements zum Ärgernis wird: Die Euro-Staaten treten auf der Ebene der imperialistischen Gewalt als Juniorpartner der USA an und fordern sie nicht heraus; in der ökonomischen Konkurrenz aber machen sie der Vormacht immer größere Teile des Weltgeschäfts streitig, verfolgen auch in der Krise hartnäckig ihre Währungskonkurrenz und sind bestrebt, sich mit wachsenden Reichtums- und Machtquellen Elemente der amerikanischen Sonderstellung anzueignen. Deshalb erinnert Clinton ihre Kollegen daran, dass jeder ökonomische oder politische Machtzuwachs Europas, der die Supermacht und ihre Potenzen untergräbt, die ganze Weltordnung gefährdet, von der auch Europa lebt.
Das ist die wirtschaftspolitische Staatskunst
, auf die Amerika seine sperrigen Partner einschwören will: Wenn die Supermacht nicht mehr über eine überlegene Wirtschaftskraft und eine daraus finanzierte konkurrenzlose globale Militärmacht verfügt, mit der sie die ganze Welt nach Bedarf terrorisieren und in die Schranken weisen kann, dann geht gar nichts mehr, auch nicht Europas Bereicherung an einem solchermaßen geordneten Globus.
[1] Nicholas Burns, früher Diplomat bei der NATO, heute Politik-Professor in Harvard, spricht deutlicher als die Amtsträger diesen Grund der neuen Wertschätzung der Europäer aus: Nein, die Vereinigten Staaten müssen sich neu um Europa bemühen, wir müssen reinvestieren in diese Beziehungen – gerade weil die große strategische Herausforderung der Aufstieg Chinas ist. Aber während die USA sich aus gutem Grund Asien zuwenden, dürfen wir uns von Europa nicht abwenden.
(SZ, 18.5.12)
[2] Wie vom Verteidigungsminister im Abgang, so ist auch sonst aus der zweiten Reihe der US-Politik tiefe Unzufriedenheit mit den unbrauchbaren Partnern zu vernehmen: Nicholas Burns, früherer Diplomat bei der NATO, äußert in einer von ihm verfassten Studie geradezu Verzweiflung über Deutschland. Dessen Weg zur Dominanz über Europa erscheint ihm, der es für die Stärkung der NATO verplant hat, als eine einzige imperialistische Feigheit: Deutschland agiert international wie eine ‚verlorene Nation‘... Deutschland ist der Schlüsselstaat des Kontinents, es führt Europa. Aber während Berlin Europa wirtschaftlich lenkt, scheut es die politische und auch militärische Führung, die die NATO so dringend braucht. Ein schwaches Deutschland schwächt auch die Allianz.
(SZ, 18.5.12)