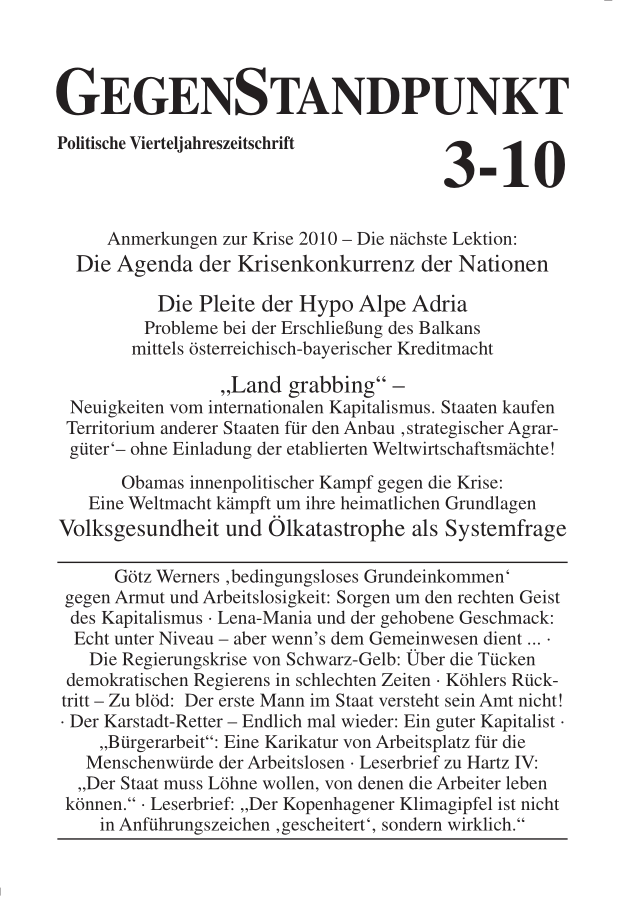Socialized Health – oder:
Volksgesundheit als Systemfrage
Der amerikanische Kongress beschließt eine weitreichende Reform des amerikanischen Gesundheitswesens und setzt damit eines der zentralen Projekte um, mit denen Präsident Obama angetreten ist. In den USA hat sich die politische Gewalt zu dem Standpunkt durchgerungen: Die amerikanische Methode, Gesundheit zu organisieren und zu finanzieren, funktioniert nicht mehr. Da ist es mit Teilsanierungen des als grundsätzlich defizitär beurteilten Systems nicht mehr getan; es muss ganz grundsätzlich auf neue Füße gestellt werden.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
- Die drei „Säulen“ des amerikanischen Gesundheitssystems: Der Privatmann, das Kapital und der Staat
- Der Staat zieht eine kritische Bilanz
Socialized Health – oder:
Volksgesundheit als Systemfrage
Der amerikanische Kongress beschließt eine weitreichende Reform des amerikanischen Gesundheitswesens und setzt damit eines der zentralen Projekte um, mit denen Präsident Obama angetreten ist. Der geißelt schon im Wahlkampf und vom Beginn seiner Amtszeit an die Verhältnisse, die im amerikanischen System des „health care“ herrschen, als untragbar und kündigt eine Wende an:
„Die Kosten der Gesundheitsversorgung steigen Tag für Tag... Die Ausgaben für Gesundheit gehören zu den größten Belastungen für Familien, für Unternehmen und für unsere Regierung. Diese Belastung zwingt Leute, ihre Krankenversicherung zurückzufahren oder ganz ohne Krankenversicherung auszukommen. Sie zwingt kleine Unternehmen, Neueinstellungen und Krankenversicherungsleistungen gegeneinander abzuwägen. Sie treibt die Zentralregierung immer mehr in die Verschuldung. Und die Versicherungsgesellschaften fahren fort, Gesundheitsleistungen danach zu rationieren, wer gesund ist und wer krank; wer zahlen kann und wer nicht. Das ist der status quo in Amerika; und es ist ein status quo, der für das Land untragbar ist. Wir können nicht ein System haben, das für die Versicherungsunternehmen besser funktioniert als für das amerikanische Volk. Wir müssen Familien und Unternehmen mehr Kontrolle über ihre eigene Krankenversicherung geben. Deshalb müssen wir die Reform des Gesundheitswesens beschließen – nicht nächstes Jahr, nicht in fünf Jahren, nicht in zehn Jahren, sondern jetzt. Um wie viel müssen die Versicherungsbeiträge noch steigen, bis wir etwas dagegen unternehmen? Wie viele Amerikaner müssen noch ihre Versicherung verlieren? Wie viele Unternehmen müssen noch ihre Versicherungsleistungen streichen? Wie viele Jahren kann der Haushalt der Zentralregierung noch die erdrückende Kostenlast von Medicare und Medicaid bewältigen?“ (Remarks by the President on Health Insurance Reform, Arcadia University Glenside, Pennsylvania, March 08, 2010).
Das amerikanische Gesundheitssystem, so Obama, versagt auf der ganzen Linie. Wenn die Kosten für Gesundheitsleistungen ständig steigen und darüber die nötige Versorgung des Volkes mit Gesundheit immer weniger zustande kommt, dann ist das, so der Präsident, nicht nur ein Schaden für diejenigen, die auf solche Leistungen angewiesen sind: Die Nation leidet darunter, wenn das Staatsvolk gesundheitlich immer mehr vor die Hunde geht und dem Staat immer mehr unproduktive Lasten aufgebürdet werden. Da ist die Staatsmacht gefordert, dafür zu sorgen, dass die Versorgung des Volkes mit Gesundheitsleistungen sichergestellt wird – und zwar so, dass dies für alle Beteiligten auch finanzierbar ist. Und auch das stellt der Präsident klar: Ohne einschneidende Eingriffe in die Rechte und Pflichten aller Instanzen und Personen, die am System des „health care“ beteiligt sind, ist diese Wende im System nicht zu haben.
Das Reformprojekt Obamas ist von Anfang an heftig umstritten. An der Frage, wie die Missstände im amerikanischen Gesundheitswesen abzustellen seien, spaltet sich die Nation: Nicht nur die politische Opposition, auch Teile der eigenen Partei leisten heftigen Widerstand; aufrechte Bürger versammeln sich zu einer politischen Bewegung, die Obamas Projekt als grundsätzlichen Angriff auf das Recht freier amerikanischer Bürger zur selbstverantwortlichen Lebensgestaltung geißelt. Gegner der Reform von oben und unten entdecken in ihr nichts Geringeres als einen Angriff auf den „American way of life“, d.h. auf die Grundprinzipien, nach denen das amerikanische Gemeinwesen funktioniert; Streitpunkte, die in anderen Staaten Material alltäglichen Parteiengezänks sind, werden hier mit allem Ernst als Grundsatzfragen in Sachen „Freiheit oder Sozialismus“ verhandelt und geben der Opposition Anlass für jede nur erdenkliche praktische Obstruktion in und außerhalb der politischen Institutionen.
Die hiesige Öffentlichkeit kann über diese Debatte nur verwundert den Kopf schütteln. Mit der Ausmalung erschreckender Details über die Gesundheitsversorgung in den USA bestätigt man sich gerne das längst feststehende Urteil, dass die Missstände im amerikanischen Gesundheitswesen sich vor allem der Abwesenheit der menschenfreundlichen Einrichtungen verdanken, die bei uns für die Pflege der Volksgesundheit zuständig sind. Deswegen sei, so wissen europäische Schlaumeier, die Reform Obamas nicht nur überfällig, sondern bestehe im Prinzip in nichts anderem als in der Übernahme bewährter Grundsätze europäischer Sozialstaatlichkeit.
Worin eigentlich genau die Nöte des amerikanischen Gesundheitswesens bestehen, kommt dabei weniger zur Sprache; eine nähere Befassung mit der Art und Weise, wie sich in den USA bislang um Volksgesundheit gekümmert wurde, wäre der selbstzufriedenen Sichtweise eher abträglich, derzufolge „wir“ die Betreuung des hohen Guts Gesundheit vergleichsweise allemal besser hin bekommen als die Amis. Schon gar nicht ist Thema, in welcher Hinsicht eigentlich die Zustände im amerikanischen Gesundheitswesen Ausdruck derselben Problemlage sind, der das hiesige Gesundheitswesen seinen Zustand der Dauerreform verdankt und die sich in endlosen Debatten darüber niederschlagen, wie sinkende Einnahmen und zunehmend unbezahlbar werdende Leistungen unter einen Hut zu bringen seien, ohne dass die Versorgung darunter allzu sehr leidet.
Diesseits wie jenseits des Atlantiks machen sich die staatlichen Instanzen an dem generellen Widerspruch zu schaffen, den sie sich mit dem Programm der Sorge um die Volksgesundheit eingehandelt haben: Wie es sich in einem freiheitlichen Wirtschaftssystem gehört, ist die Her- und Bereitstellung von Gesundheit als Geschäftssphäre organisiert, in der die einschlägigen Waren und Dienstleistungen gehandelt werden. Die dabei zustande kommenden Beiträge zum Wachstum der nationalen Wirtschaft sind durchaus gewichtig und liegen dem Staat – wie jedes Kapitalwachstum am Standort – am Herzen. Die profitablen Preise, die den Wachstumsansprüchen der Gesundheitsindustrie aller Sparten zu genügen haben, kann ein wesentlicher Teil des Volkes, dessen Gesundheit die geschäftstüchtigen Leistungserbringer sicherstellen sollen, allerdings nicht ohne weiteres aus seinen Einkünften bezahlen. Das stellt einer Obrigkeit, die am Wachstum des Geschäfts mit der Gesundheit ebenso interessiert ist wie an einem brauchbaren Gesundheitszustand ihrer Bevölkerung, die Aufgabe, die prekäre Zahlungsfähigkeit der Massen, die dem Geschäft mit Medikamenten, Medizintechnik und ärztlichen Leistungen als Wachstumsfonds dient, sachgerecht zu organisieren. Was immer aber dem sozialstaatlichen Erfindergeist bei der Organisation dieser Betreuungsaufgabe auch einfällt: Für den kapitalistischen Laden, um den es der politischen Gewalt geht, stellen die Aufwendungen für die Gesunderhaltung der Bürger Kosten dar. Genauer gesagt eine Unterabteilung der Kost, die die Ernährung und der Unterhalt der Volksmassen insgesamt für die Geldvermehrung als den eigentlichen Zweck allen Wirtschaftens darstellt. Dass die nationalen Ausgaben für Gesundheit, so nötig sie für die Sicherstellung der Funktionstüchtigkeit der Leute sein mögen, allemal eine Belastung für das nationale Geschäft sind, anerkennt der Staat ganz grundsätzlich als Ausgangspunkt und bleibende Grundlage seiner Sorge um die Volksgesundheit: Die dafür zu erbringenden Leistungen und ihre Finanzierung müssen prinzipiell vereinbar sein mit dem, was das nationale Geldwachstum erlaubt und aushält. Im dauernden, von Konjunkturen, Haushaltslagen und politischen Präferenzen der jeweiligen Regierung bestimmten Abgleich der politisch gewollten Versorgungsleistungen damit, was sie wen kosten dürfen, kommt dann – irgendwie – eine Versorgung der Leute zustande; mit dem jeweils hergestellten Verhältnis von Kosten und Versorgung ist die politische Gewalt denn auch hierzulande dauerhaft beschäftigt und immer unzufrieden.
In den USA ist diese Unzufriedenheit nun in eine grundsätzliche Kritik umgeschlagen. Da hat sich die politische Gewalt zu dem Standpunkt durchgerungen: Die amerikanische Methode, Gesundheit zu organisieren und zu finanzieren, funktioniert nicht mehr. Da ist es mit Teilsanierungen des als grundsätzlich defizitär beurteilten Systems nicht mehr getan; es muss ganz grundsätzlich auf neue Füße gestellt werden.
Die drei „Säulen“ des amerikanischen Gesundheitssystems: Der Privatmann, das Kapital und der Staat
Das Gesundheitssystem der USA zeichnet sich durch seine streng freiheitlich-marktwirtschaftliche Organisation aus: Es folgt in allen seinen Abteilungen dem Prinzip, dass die freie Kalkulation mit Kosten und Ertrag – sei es von Privatleuten, sei es von Unternehmen – schon im Prinzip für alles sorgen werde, was die Nation in Sachen Gesundheit benötigt. Aufgabe des Staates ist es, dieses freiheitliche System zu beaufsichtigen, zu fördern und zu unterstützen; wo nötig, auch ergänzend tätig zu werden, damit das gewünschte Versorgungsniveau zustande kommt.
I. Der freie Bürger als „Träger“ des Gesundheitssystems
In den USA ist zunächst einmal das private Individuum für die Bewältigung der Risiken zuständig, die das Leben im Kapitalismus mit sich bringt. Ihm obliegt es, sich gegen solche Risiken so abzusichern, dass er sie dauerhaft finanziell bewältigen kann; so auch das Risiko der Erkrankung. Den Bedarf nach einer solchen Absicherung bedient die Geschäftswelt, indem sie daraus einen Verkaufsartikel macht. Versicherungsgesellschaften kollektivieren Risiken dieser Art, indem sie mit ihrer Kundschaft gegen die regelmäßige Bezahlung einer Prämie die Versorgung bei eintretendem Schadensfall vereinbaren. Dabei sehen sie zu, das Verhältnis von eingenommenen Beiträgen und ausgezahlten Leistungen im Durchschnitt aller Verträge ertragreich zu gestalten und sich mit ihrem versicherungstechnischen Geschäft den Stoff für ihre finanzkapitalistischen Aktivitäten als große Kapitalsammelstellen zu beschaffen. Deshalb wendet das Versicherungsgewerbe bei der Gestaltung der Verträge viel Erfindungsreichtum auf, wenn es darum geht, Zahlungen möglichst abzuwenden und sich gegenüber der Kundschaft alle Freiheiten zu sichern, um Prämien und Leistungen auch innerhalb der Vertragslaufzeit an den jeweiligen Stand ihres Geschäftsrisikos anzupassen. Leistungsausschlüsse für Vorerkrankungen, Wartezeiten, Leistungsverweigerung für angeblich überhöhte Rechnungen oder unnötige Behandlungen, patient dumping
(die Kündigung des Vertrages inmitten in einer kostspieligen Behandlung) usw. gehören deshalb zu den Geschäftspraktiken der Branche. Den „Versicherungsnehmern“ bleibt offenbar nichts anderes übrig, als solche Verträge zu unterschreiben, wenn sie sich überhaupt krankenversichern wollen. Da periodische Erkrankungen zur Normalität des Lebens, und schon gleich im Kapitalismus, dazugehören, ist dem Versicherungsgewerbe in dieser Geschäftsabteilung ein verlässlicher Kundenstamm sicher – einerseits. Zugleich ist es kein Wunder, dass nur ein vergleichsweise geringer Prozentsatz von US-Bürgern – und in den letzten Jahren immer weniger – auf diese Weise privat versichert ist, und zugleich die Zahl derer wächst, deren Versicherung nur das Notdürftigste an Versorgung abdeckt. Wer sich in aller Freiheit gegen das Krankheitsrisiko versichern kann, kann sich eben auch in Absprache mit seiner Versicherung entscheiden, wie weit dieser Versicherungsschutz gehen soll; und er kann sogar ganz auf ihn verzichten und die Kosten selbst tragen, wenn sie anfallen. Eben das tut eine wachsende Anzahl von Leuten, zunehmend auch solche, die im Zweifelsfall gar nicht in der Lage sind, nötige medizinische Leistungen zu bezahlen. Für nicht wenige stellen die Prämien, die die Versicherungen verlangen, einen Abzug von ihrem Einkommen dar, den sie sich nicht leisten können; andere wiederum sparen sich die Versicherungskosten in der Berechnung darauf, dass ihr aktueller Gesundheitszustand große medizinische Leistungen überflüssig machen würde und sie sich ja immer noch später versichern könnten. Hinzu kommen eine wachsende Zahl von Leuten, die von Versicherungen als „schlechte Risiken“ gar nicht erst genommen oder denen deswegen laufende Verträge gekündigt werden, sowie Leute, denen mit dem Verlust ihres Arbeitsplatzes das Geld fehlt, ihre vom ehemaligen Arbeitgeber mitfinanzierte Versicherung selbst weiterzuzahlen.[1] Wer kann, schlüpft in dieser Lage bei der Police des Ehegatten unter oder gründet irgendeine kleine Firma, um eine günstigere Unternehmenspolice erwerben zu können. Grundsätzlich aber wird der private Versicherungsmarkt immer mehr zu einer exklusiven Domäne der Besserverdienenden.
II. Wie das Kapital die Betreuung der Gesundheit der arbeitenden Massen organisiert
Die betriebliche Krankenversicherung: Ein Werk des Kapitals, von der Gewerkschaft erkämpft, vom Staat gefördert
Klar ist, dass eine solche einzelvertragliche Absicherung des Krankheitsrisikos für die Masse der Normal- oder Niedrigverdiener nicht erschwinglich ist. Die Lohnabhängigen unter ihnen kommen in den USA zu einer Krankenversicherung nicht über beitragsfinanzierte, öffentlich-rechtliche Körperschaften wie die hiesigen gesetzlichen Krankenversicherungen, sondern über den Betrieb, in dem sie arbeiten. Die maßgeblichen Vertragspartner der Versicherungsgesellschaften sind nicht private Individuen, sondern Unternehmen: Die nutzen das Angebot der Versicherungsgesellschaften, um mit ihnen Kollektivverträge für ihre jeweilige Belegschaft abzuschließen. Die Versicherung stellt entweder als benefit
einen Zusatz zum Lohn dar oder die Unternehmen sammeln zur Senkung der Kosten, die ihnen zur Last fallen, Beiträge von ihren Belegschaften in unterschiedlichen Prozentsätzen vom Lohn ein.[2] Untereinander handeln Betriebe und Versicherungsunternehmen die Konditionen der jeweiligen Verträge aus; so entscheidet sich, zu welchem Preis und in welchem Umfang die jeweiligen Belegschaftsmitglieder in den Genuss medizinischer Leistungen kommen. So etwas wie ein allgemeines Versorgungsniveau existiert nicht. Es gibt Betriebe, die gar keine Krankenversicherung anbieten; wo sie es tun, existiert ein bunter Wirrwarr von Versicherungsbedingungen, die sich in jeder nur denkbaren Hinsicht in Preis und Leistung unterscheiden: Ob etwa und in welchem Umfang Familienmitglieder mitversichert sind; ob und wofür eigene Zuzahlungen zu leisten sind; wie es um Ergänzungszahlungen zu Medicare nach der Verrentung bestellt ist, u.a.m.; dann, wie viel von der Prämie der Betrieb zahlt und was er der Belegschaft dafür an Lohnabzügen abknöpft. Es gibt sogenannte Altverträge, die vergleichsweise viel abdecken und z.T. sämtliche Familienmitglieder mitversichern, wie die berühmten Cadillac Insurances ganz ohne jede Zuzahlung; oder auch Betriebskrankenkassen, die Zahnbehandlungen und Brillen bezuschussen; aber auch, wie vor allem in den letzten Jahren zunehmend üblich, Policen, die nur minimale Notfallbehandlungen mit großer Selbstbeteiligung vorsehen, wie z.B. bei Wal-Mart.[3]
Diese heterogene Versorgungslandschaft ist ein Gemeinschaftswerk von Unternehmen, Gewerkschaften und Versicherungsgewerbe. Allerdings lässt sich die amerikanische Unternehmerschaft nicht ganz freiwillig darauf ein, für ihre Belegschaft über den normalen Lohn hinaus noch Versicherungsbeiträge zu bezahlen. Es sind die amerikanischen Gewerkschaften, die es sich in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts angesichts der Notlage ihrer Klientel in Sachen Gesundheitsversorgung zum gewichtigen Anliegen machen, den Betrieben – d.h. zunächst einmal den kapitalstarken Multis der Automobilindustrie – diese Leistung abzutrotzen.[4] Während in Deutschland und anderen Ländern Europas die Gewerkschaften der politischen Gewalt die Krankenhilfe als sozialstaatliches Recht abringen, ist dieser proletarische Vorsorgebedarf in den USA Gegenstand des gewerkschaftlichen Lohnkampfes. In diesem Anliegen werden sie vom Staat unterstützt: Der hat viel dafür übrig, dass die Betreuung der Volksgesundheit auf amerikanisch-freiheitliche Weise, also ganz ohne „dirigistisches“ Dazwischentreten des Staates, als Vertrag zwischen den „Sozialpartnern“ zustande kommt. Selbstverständlich wirkt der Staat dann doch auf seine Weise auf den Entscheidungsprozess der Firmen ein: In Anerkennung der Belastung, die diese Leistung für die Bilanz der Unternehmen darstellt, macht er ihnen den Abschluss solcher Versicherungen und die Bildung eigener Betriebskrankenkassen mit erheblichen Steueranreizen finanziell schmackhaft. Zugleich geht der Staat als Arbeitgeber mit gutem Beispiel voran und richtet selbst eine entsprechende Absicherung seiner Beschäftigten ein. So überzeugen Staat und Gewerkschaften gemeinsam die Firmen davon, dass ein solches Versorgungsangebot auch in ihrem Sinne ist – oder jedenfalls sein könnte.
Für Teile der amerikanischen Arbeiterklasse sichert dieser gewerkschaftliche Kampf ein paar Jahrzehnte lang Gesundheitsversorgung als so etwas wie einen sozialen „Besitzstand“; in dessen Genuss kommt man vor allem dann, wenn man das Glück hat, bei Großunternehmen wie GM, Ford usw. beschäftigt zu sein. Insgesamt spiegelt die Versorgungslandschaft ziemlich getreu die Hierarchie von Löhnen und Arbeitsbedingungen wider, die die Welt des Kapitals so vielfältig gestaltet; alle Momente, die den Stand des Lohnarbeiters in der Konkurrenz um Löhne und Arbeitsplätze beeinflussen, bestimmen auch mit, wie es um seine Gesundheitsvorsorge bestellt ist. Für den Arbeitnehmer sind diese Unterschiede eine Abteilung der diversen, besseren oder schlechteren Beschäftigungsbedingungen, mit denen er sich von Seiten der Arbeitgeber konfrontiert sieht. An solchen „benefits“ entscheidet sich wesentlich der Status mit, zu dem es der „hardworking American“ in der Konkurrenz bringt. Für die Interessenvertretung der Arbeiter war und ist das Erstreiten von Zusatzleistungen zum Lohn und deren Verteidigung gegen Angriffe des Kapitals ein Punkt in ihrem unendlichen Kampf darum, von der jeweiligen Betriebsmannschaft als brauchbare Vertretung ihrer Interessen anerkannt zu werden und sich darüber im Betrieb zu etablieren bzw. zu halten. Für den Beweis an die Adresse der Lohnabhängigen, dass es sich vergleichsweise lohnt, Gewerkschaftsmitglied zu sein, kommt es auch und gerade den Gewerkschaften auf die Unterschiede in Lohn und Versorgung an, die sie in Konkurrenz zueinander von den Betrieben erstreiten; mit dem, was sie da jeweils für verschiedene Abteilungen der amerikanischen Arbeiterklasse herausholen, werben sie um Mitglieder und sichern ihre Existenz als anerkannte Arbeitervertretung.
„Managed Care“ und andere Erfindungen: Der Dauerkampf um kostengünstige Organisation der Gesundheitsbetreuung
Für die Versicherungen sind die Kollektivverträge mit den Betrieben ein gewichtiger Posten in ihrer Geschäftstätigkeit; gerade deshalb gilt es, diese Policen so zu gestalten, dass sie auf jeden Fall lohnend sind und bleiben. Also bringen sie in den Verträgen mit den Unternehmen alle Berechnungen mit Risiko und Ertrag zum Tragen, die ihr Geschäft ausmachen, und nutzen dazu nach Kräften ihre Marktmacht. Seit den Anfängen der betrieblichen Organisation der Gesundheitsvorsorge schlagen sich die Unternehmen und ihre versicherten Angestellten deshalb damit herum, wie viel Leistung sie eigentlich mit ihren gezahlten Prämien bei ihrem Versicherer herausschlagen können. Im Interesse eines für sie günstigen Preis-Leistungsverhältnisses schließen Betriebe mit Vorliebe Verträge mit Versicherungen, die ihrerseits den Gesundheitsservice bei Großunternehmen einkaufen und so die versicherten Leistungen günstiger anbieten. Andere übernehmen die Zahlung von Krankenkosten für ihre Belegschaft gleich unmittelbar selbst und sparen sich darüber die Zahlung der Prämie an eine Versicherungsgesellschaft: Self-Insurance bzw. Self-Funded Health Care. Zur Begrenzung des Risikos solcher reinen self-insured group health plans sichern sich Großbetriebe in aller Regel mit einer stop-loss insurance ab.
Als Reaktion auf ständig steigende Versicherungsprämien, die die Versicherungen ihrerseits mit steigenden Preisforderungen der Verkäufer von Gesundheitsdienstleistungen aller Art begründen, sind in den USA Quasi-Großbetriebe auf die Welt gekommen, die gegen die Zahlung einer Prämie in verschiedensten Ausprägungen die Organisation der gesundheitlichen Betreuung übernehmen. Nur auf deren Diagnose und Behandlung haben die Versicherten im vereinbarten Umfang ein Recht; wer als Patient eine andere medizinische Betreuung haben will, muss je nach Kontrakt die Kosten der Behandlung entweder selbst übernehmen oder erhält lediglich einen kleinen Zuschuss. Für diese Einrichtungen hat sich in den USA der Begriff Managed Care eingebürgert.[5] In diesen Organisationen sind die Versicherung, die zahlt, und die Firma, die die Leistungen erbringt, unmittelbar zusammengespannt; so spart man sich das ewige Feilschen um Preise und Leistungen und stellt zugleich sicher, dass von der Leistungsabteilung wirklich nur die Behandlungen durchgeführt werden, die die Geschäftskalkulation der Versicherungsabteilung nicht allzu sehr belasten. Alle Varianten, die Erbringung der Leistung billiger zu machen, dienen so dem doppelten Zweck, das Geschäft, das die Anbieter von Gesundheitsleistungen machen, weitergehen zu lassen und trotzdem noch so etwas wie für den „Kunden“ bezahlbaren und für das Versicherungsunternehmen lohnenden Versicherungsschutz zu gewährleisten.
Dies Geschäftsmodell ist deshalb auch kein Heilmittel gegen die zuvor erwähnten Praktiken, mit denen das Versicherungsgewerbe seine Risiken minimiert, indem es sie den Versicherten aufbürdet, sondern setzt diese erst so richtig flächendeckend in Kraft. So trägt das Prinzip des „managed care“ das Seine dazu bei, eine Hierarchie der Versorgung zu erzeugen. Welche Art und welcher Umfang von angebotenen Behandlungsmöglichkeiten sich für eine HMO überhaupt lohnen, entscheidet sich ganz sachgerecht nach dem Beitragsvolumen, mit dem insgesamt als Geschäftsmittel kalkuliert werden kann, also nach Größe und Geschäftslage der Unternehmen, mit denen sie Verträge abschließt, sowie nach Größe und Besiedlungsdichte des Gebiets, das der jeweilige Gesundheitsbetrieb – allein oder in Konkurrenz zu anderen „Anbietern“ – betreut. Im Ergebnis gibt es dann feine medizinische Wirtschaftszonen, in denen die Herzinfarktanfälligkeit betuchter Medicare-Patienten gut bedient wird; auch anderweitig schwer Erkrankte finden in den Metropolen die Premium-Versorgung entsprechend ihrem Geldbeutel oder ihrer Versicherung. Begüterte Amerikaner treffen sich in den Krankenhäusern ihrer Nachbarschaft; Bewohner weniger schöner städtischer Gegenden oder dünn besiedelter ländlicher Flächen müssen ihre Versorgungseinrichtung mitunter gesundheitsgefährdend weit entfernt suchen und häufig sehr bescheidenen Service ertragen.
Die Krise des Systems
Die unschönen Nebenwirkungen des Systems nehmen in dem Maße zu, wie sich der Gegensatz zwischen den steigenden Kosten für gesundheitliche Betreuung der Massen und der Kostenrechnung der Betriebe verschärft. Vorausschauend haben die Unternehmen ihr System der Gesundheitsvorsorge gleich so konstruiert, dass es ihnen alle Freiheiten lässt, sich der Kosten dafür Stück für Stück oder auch ganz zu entledigen, wenn sie in ihre Geschäftsrechnung nicht mehr passen. Für die Unternehmen ist es nur logisch, bei angespannter Geschäftslage neben anderen Lohnbestandteilen die Krankenversicherung als wesentliches Hindernis für Kostensenkung auszumachen und sich der entsprechenden vertraglichen Pflichten zu entledigen.[6] Das jeweilige Niveau der betrieblichen Gesundheitsleistungen ist deshalb nicht nur Gegenstand eines Dauerstreits zwischen Betriebsleitung und Arbeitnehmervertretung, sondern auch selbstverständlicher Bestandteil der zur Disposition stehenden Verhandlungsmasse, wenn es darum geht, Lohnsenkungen abzuwehren. Die Gewerkschaften, die die gute Geschäftslage der Betriebe ausgenutzt haben, um „benefits“ zu erstreiten, lassen es sich in der Krise einleuchten, dass das Ausmaß der Krankenversorgung nicht zu halten ist: Auch in den USA beherrscht man die Logik, dass ein Arbeitsplatz, den man sich durch Verzicht auf Absicherung im Krankheitsfall „sichert“, immer noch besser ist als gar keiner. Altverträge sind zwar ein wenig umständlicher zu verändern oder zu kündigen, weshalb umso heftiger bei Neuanstellungen gekürzt wird: Da bieten die Firmen, wenn überhaupt, betriebliche Krankenversorgung nur zu erheblich schlechteren Konditionen an als vor Jahren noch üblich. Diese Billigvarianten beinhalten größtenteils keine Mitversorgung der Familienmitglieder mehr, und die Leistungen sind stark reduziert bei gleichzeitig deutlich höheren Eigenbeteiligungen. Auch die heilen dann allerdings letztlich nichts: Insgesamt sinkt unterm Strich die Summe eingehender Beiträge, was die von HMOs und Ihresgleichen praktizierte Kunst des Einteilens immer neuen Härtetests unterwirft; die Absenkung von Leistungen macht dann manchen Gesundheitsgroßdienstleister unrentabel. Entsprechend nimmt die Zahl amerikanischer Bürger zu, die, entweder gar keine Gesundheitsversorgung mehr haben oder an ihren Krankenkosten pleite gehen. Die trotz aller Kostensenkungsprogramme weiter steigenden Prämien des Versicherungsgewerbes tun ein Übriges dazu, dass vor allem kleinere Betriebe zunehmend zu dem Ergebnis kommen, dass ihnen die Krankenversicherung ihrer Mitarbeiter einfach zu teuer ist.
III. Der Staat als Gesundheitsdienstleister in ergänzender Mission
Der Staat als Arbeitgeber
Was seine eigenen Beschäftigten betrifft, ist der Staat mit gutem Beispiel vorangegangen:
Noch lange, bevor es Versicherungen in nennenswerten Umfang gab, war die US-Army in Sachen Krankenversorgung von der medizinischen Forschung bis zum Betrieb von Krankenhäusern u.v.m. der größte Auftraggeber und Provider. Sein eigener Bedarf an Gesundheit und die besonderen Gefährdungen, die ein Engagement in solch einer Organisation mit sich bringt, hat das Militär zum wesentlichen Träger des medizinischen Fortschritts werden lassen, besonders seit dem II.Weltkrieg.
Auch in allen anderen Bereichen bietet der Staat als öffentlicher Arbeitergeber seinen Mitarbeitern benefits an, die denen in Industrie und Handel ähneln. Auch die staatlichen Absicherungen haben keinen einheitlichen Standard; ihr Umfang hängt vom Willen und der Finanzkraft regionaler Behörden und Einrichtungen ab. Es ist völlig normal, dass Lehrer in reichen Schulbezirken eine deutlich bessere medizinische Versorgung erwarten können als ihre Kollegen in ärmeren Gebieten. Dieses Prinzip zieht sich durch alle öffentlichen Dienststellen und durch alle staatlichen Organisationsformen; auch hier macht sich der gewerkschaftliche Einfluss auf den Umfang der Leistungen bemerkbar.
Alter und Armut ...
Den zuständigen Instanzen der Staatsgewalt war von Anfang an klar, dass nennenswerte Abteilungen des Volkes von vornherein nicht unter die Fürsorgepflicht des Kapitals fallen. Das Betreuungsverhältnis, das die Unternehmen mit dem System von Betriebskrankenkassen und medizinischen Versorgungseinrichtungen eingerichtet haben, gilt nur den Abteilungen der Lohnarbeiterklasse, die vom Kapital gerade benutzt werden; mit dem Ende des Lohnarbeitsverhältnisses – sei es durch Entlassung oder Verrentung – endet jede Pflicht des Arbeitgebers in dieser Hinsicht. Hier sieht sich der Staat in der Pflicht, ergänzend tätig zu werden, um auch für solche Leute wenigstens ein Minimum an gesundheitlicher Versorgung sicherzustellen, und das tut er mit Medicare und Medicaid:
- Medicare, die Krankenkasse für den amerikanischen Rentner, ist die erste allgemeine Pflichtversicherung (1965) in den USA überhaupt. Im Umlageverfahren zahlt jeder US-Bürger 2,9 % seines Einkommens als Medicare Tax, die, sofern man abhängig beschäftigt ist, hälftig vom Arbeitgeber getragen wird. Die Versicherung kommt für jeden über 65 auf, der 10 Jahre Beitragszahlungen geschafft hat, und finanziert zudem noch verschiedene medizinische Sonderleistungen.[7] Damit ist Medicare die größte Versicherung und, bei dieser ihres Alters wegen „risikoreichen“ Klientel kein Wunder, größter Zahler von Medizinleistungen auf dem US-Markt.
- Zeitgleich hat der Staat Medicaid eingeführt. Die Einzelstaaten sichern in unterschiedlichem Ausmaß und Standard – je nach Budgetlage und politmoralischer Ausrichtung in Sachen „Soziales“ – Alleinerziehenden, Schwerbehinderten und denjenigen Amerikanern eine medizinische Grundversorgung, die unter eine gewisse Armutsgrenze fallen und kein verwertbares Vermögen besitzen.
… zunehmend unbezahlbar
Der Umfang der Leistungen, die der Staat für Alte und Arme zu erbringen hat, bleibt von den Kostensenkungsmaßnahmen des Kapitals nicht unberührt. Entlassungen und Lohnsenkungen lassen die Zahl der zum Bezug von Medicaid Berechtigten steigen; die Zahl der Rentner steigt, die nicht in der Lage sind, für Behandlungen nötige Zuzahlungen zu Medicare zu erbringen; entsprechend steigt die Beanspruchung der Kassen auf der Ausgaben- wie auf der Einnahmenseite und bringt die beiden staatlichen Agenturen beständig an ihre finanziellen Grenzen.
An Medicare reformiert der Staat seit Anbeginn herum. Mit immer neuen Zusatzversicherungen – Medicare Part A, B, C, D... – bemüht er sich darum, mit sinkenden Leistungen des Kapitals auf der einen Seite und steigenden Kosten auf der anderen Seite irgendwie Schritt zu halten, wofür er die Beitragszahler – teils freiwillig, teils zwangsweise – abgestuft zur Kasse bittet. Als letzte Maßnahme in dieser Reihe wurde 2003 mit Medicare Part D eine umfangreiche Medikamenten-Zusatzversicherung angeboten, um auch den notorisch klammen US-Oldies den pharmazeutischen Fortschritt zu erschließen.[8] Gelegentlich sieht sich die Staatsgewalt auch bisher schon zu einschneidenden Maßnahmen gezwungen, um das Stattfinden von Versorgung überhaupt zu gewährleisten.[9]
Auch Medicaid befindet sich im Zustand der Dauerreform. Hier hat jeder Bundesstaat seine eigenen Regelungen; mit Leistungsanpassungen, auch zugunsten der Empfänger, und der Neudefinition von Leistungsberechtigungen versuchen die jeweiligen Regierungen, einerseits den für nötig befundenen medizinischen Standard zu sichern und zugleich steigender Kosten Herr zu werden.[10] Der Bund, besonders z. Zt. die Obama-Administration, greift seinerseits in die teils unübersichtlichen Einzelstaaten-Bestimmungen ein und definiert Gruppen, die er für besonders schützenwert hält und die besonders auf Medicaid angewiesen sind; so z.B Kinder, die nicht über ihre Eltern genügend abgesichert sind, sowie die Veteranen, die verschiedener Betreuungszusätze bedürfen, die kein Leistungskatalog bisher umfasst.[11]
Als letzte Reaktion auf die immer schwieriger werdende Lage der staatlichen Kassen haben verschiedene Bundesstaaten in den letzten Jahren allgemeine Zahlungspflichten für Gesundheitsleistungen eingeführt, die einer allgemeinen Krankenversicherung entsprechen oder zumindest ähneln. Andere haben entsprechende Pläne wegen der Health Care Reform vorerst storniert.[12]
So bekommt der Staat als sein Finanzproblem serviert, dass die amerikanische Geschäftswelt immer weniger willens ist, die gesundheitliche Betreuung maßgeblicher Teile der amerikanischen work force zu übernehmen. Damit kommen alle Rechnungen durcheinander, die der Staat mit seinem Gesundheitssystem angestellt hat. Die Versorgung des Volkes wird immer teurer und findet gleichzeitig immer weniger zuverlässig statt; und der Staat selbst sieht sich immer mehr in die Rolle gedrängt, mit eigenen Finanzmitteln für ausbleibende Leistungen seiner Kapitalistenklasse einspringen zu müssen.
Der Staat zieht eine kritische Bilanz
I. Die Diagnose: Versagen und Pflichtvergessenheit auf der ganzen Linie
Die staatliche Diagnose, die der Reform zugrunde liegt, lautet: Wenn das System des „health care“ immer unbezahlbarer wird und die Leute nicht versorgt, dann müssen die Akteure des Systems – sei es aus bösem Willen, sei es aus Unfähigkeit – es versäumen, die Leistungen zu erbringen, die für das Funktionieren des Systems erforderlich wären. In diesem Sinne macht sich die Regierung daran, die maßgeblichen Verursacher der Missstände ausfindig zu machen. Aus der Sicht der politischen Aufsichtsmacht haben sich alle maßgeblichen Akteure da einiges zu Schulden kommen lassen:
Da ist zum einen das Versicherungsgewerbe, das gleichgültig gegenüber den Nöten der Bedürftigen nur an sein Geschäft denkt: Ihm lastet der Staat vorrangig die Notlage an, in der sich amerikanische Bürger in Sachen Gesundheitsversorgung befinden. Das allen gültigen Regeln unternehmerischen Tuns folgende Geschäftsgebaren der Branche klagt Obama als rücksichtslosen Verstoß gegen die Aufgabe an, die dem Versicherungswesen staatlicherseits übertragen ist: dafür zu sorgen, dass die Versicherten an die nötige Gesundheitsversorgung kommen.[13] Von diesem Auftrag war zwar bislang in den staatlichen Vorschriften zum Versicherungswesen nie die Rede; da ist der amerikanische Staat ganz selbstverständlich davon ausgegangen, dass das Gewerbe mit seinen geschäftlichen Rechnungen schon eine bezahlbare Volksgesundheit herbeiorganisieren würde. Diese uramerikanische Gewissheit wird nun von höchster politischer Stelle ausdrücklich aus dem Verkehr gezogen.
In diesem Sinne legt Obama sich auch mit den US-Arbeitgebern an: Er wirft ihnen vor, nicht alles versucht zu haben, um ihren Mitarbeitern wenigstens eine betriebliche Minimalversorgung zu sichern. Wenn alle staatlichen Anreize, die dieses Anliegen befördern sollten, nichts geholfen haben – dann, so Obama, ist es offenbar mit Anreizen nicht mehr getan.
Und dann ist da noch der US-Verbraucher selbst, der sich trotz seiner knappen Mittel bisher überhaupt nicht vorsorgend um die Bezahlung seiner Rechnungen kümmert, sich und seine Familie leichtsinnig gefährdet und so viel zu häufig dem Staat zur Last fällt.
Unterm Strich, so Obama, liegt beim Gesundheitswesens ein Fall massiven Staatsversagens vor. Aufgabe der Staatsmacht wäre es längst gewesen, gegenüber ihren Konkurrenzsubjekten durchzusetzen, dass sie in Amerika für ein funktionierendes System der Betreuung der Volksgesundheit sorgen. Stattdessen hat die Politik viel zu lange die verschiedenen geschäftlichen und privaten Interessen ihre eigenen Wege gehen lassen – im Vertrauen darauf, dass alle Beteiligten in der Verfolgung ihres Eigennutzes gemeinsam schon die vom Staat erwünschte Dienstleistung erbringen würden.
Diese Gewissheit zieht Obama programmatisch aus dem Verkehr. Die Lage im Gesundheitswesen ist für ihn ein schlagendes Beispiel dafür, dass es so wie bisher mit Amerika nicht weitergeht und der Staat neue Saiten gegenüber seiner Zivilgesellschaft aufziehen muss. Das ist gemeint, wenn der Präsident davon spricht, dass ein „Systemwechsel“ her muss: Der betrifft die Art und Weise, wie die Staatsgewalt mit den etablierten Interessen in ihrer Konkurrenzgesellschaft umgeht, wie weit sie diese Interessen ins Recht setzt und wo sie ihren selbstsüchtigen Kalkulationen Schranken setzt. Bei aller wortgewaltigen Anklage gegen Pflichtvergessenheit und Profitsucht: Ein amerikanischer Präsident käme zu Recht nie auf die Idee, dagegen etwas zu sagen, dass die Absicherung gegen das Risiko Krankheit ebenso ein Geschäftsartikel ist wie die Leistungen der Gesundheitsbranche; ebenso wenig dagegen, dass Betriebe mit dieser Absicherung als Kostenfaktor kalkulieren, den das Geschäft des Kapitals aushalten können muss. Dass bei all diesen Geschäftskalkulationen der Ertrag in Sachen Volksgesundheit nicht herauskommt, auf den es dem Staat ankommt – das ist der kritische Befund, von dem aus sich die Regierung zur Neuorganisation des nationalen Gesundheitswesens aufmacht. Neue gesetzliche Vorschriften sollen dafür sorgen, dass die maßgeblichen Veranstalter des Gesundheitswesens ihre geschäftlichen Berechnungen in den Dienst des Volksgesundheit stellen; damit sie das auch können, soll zugleich die Finanzkraft des Systems gestärkt werden. Mit staatlicher Anordnung, mit Druck und neuer Motivation sollen Geschäft, Versorgung und Finanzierung zusammengebracht und so allen Seiten gedient sein.
II. Die Reform
Die Reform der privaten Anbieter
Im Zentrum der gesetzlichen Veränderungen steht das Versicherungsgeschäft. Dessen Geschäftsbedingungen und –inhalte werden neu definiert: Der Staat stellt klar, dass das hohe Gut der Vertragsfreiheit seine Schranke an dem Interesse hat, das er an den Leistungen des Versicherungswesens für die Volksgesundheit nimmt. Versicherungen werden gesetzlich verpflichtet, jeden Antragsteller zu versichern – damit wird die alte Freiheit zum Vertragsschluss durch einen politisch begründeten Kontrahierungszwang ersetzt. Und auch hinsichtlich der Vertragsgestaltung werden neue staatliche Vorgaben erlassen: Das vertragliche Widerrufsrecht der Versicherer wird eingeschränkt, und nicht nur das: Ihnen wird auferlegt, einen Mindestversorgungsanspruch (Qualified Health Benefit Plan) abzudecken, der besonders Leistungen für Kinder und Schwangere vorsieht und Krankenhausaufenthalt, Versorgung Pflegebedürftiger, Vorsorgemaßnahmen und die von den amerikanischen Konkurrenzsubjekten besonders häufig in Anspruch genommene psychiatrische Versorgung mit umfasst. Zudem können Kinder bis zum Alter von 26 Jahren bei den Eltern versichert bleiben.
Zugleich kümmert sich der Gesetzgeber um die Konkurrenzbedingungen in der Versicherungssphäre – dem Verdacht folgend, dass die Versicherungen bislang auch deshalb so rabiat mit ihrer Kundschaft umgehen konnten, weil sie eine monopolistische Stellung am Markt einnahmen. Zukünftig müssen die Versicherungsangebote für Privatkunden im insurance exchange
, einer Angebotsvergleichsliste, veröffentlicht werden. Außerdem wird den Versicherungsgesellschaften ihre ökonomische Ausnahmeregelung bezüglich des Anti-Trust-Gesetzes nicht mehr gewährt. Diese Regelung sah vor, dass die monopolistische Stellung einer Versicherung in einem Gebiet oder Bundesstaat nicht dem Verbot nach dem Anti-Trust-Gesetz unterlag; auf diesem Wege wollte der Staat es für das Versicherungsgeschäft attraktiv machen, sich in dünn besiedelten Gebieten überhaupt zu etablieren. Eben diese Praxis missfällt nun dem Staat, der jetzt in einer solchen Monopolstellung weniger die Voraussetzung für lohnendes Geschäft als vielmehr einen Grund für Preistreiberei und für schlechte Versicherungskonditionen entdeckt.
Auch in der Gesundheitsbranche sollen neue Zulassungs-, also Konkurrenzbedingungen dafür sorgen, dass die nötigen Leistungen für die gezahlten Dollars auch erbracht werden. Mit der gleichen Zielsetzung bringt der Staat seine Position als wuchtiger Nachfrager ins Spiel, um Einfluss auf die Kosten und die Erbringung von Leistungen geltend zu machen. Was aus den Töpfen von Medicare und Medicaid bezahlt wird, woran da also wer wie gut verdienen kann, definiert der Staat mit seinen gesetzlichen Vorgaben; neue Bedingungen für die Vergütung von Leistungen aus diesen Töpfen sollen dafür sorgen, dass sich das Versorgungsniveau hebt und die Versorgung zugleich billiger wird. Hausärzte und Allgemein-Chirurgen (ähnlich dem Unfall- oder Durchgangsarzt) profitieren nun von einer 10 %-Bonus-Zahlung, die mit der Verbesserung der Grund- und Erstbehandlungsqualität verknüpft wird und teure fachärztliche Weiterbehandlung reduzieren soll.
Zugleich fährt der Staat die vor einigen Jahren eingeführten Sonderzahlungen aus Medicare zurück, um Mittel für die Durchschnittsversorgung frei zu machen. Die von Medicare oder Medicaid abgedeckte Akutversorgung in den Krankenhäusern wird mit Zusatzmitteln ausgestattet, sofern diese sich einer staatlichen Kontrolle unterwerfen, bei der geprüft wird, ob es gelingt, die Wiedereinlieferungszahlen der entlassenen Patienten zu verringern. Ein schönes Dokument, wozu es die finanziellen Einteilungskünste von Gesundheitseinrichtungen in Sachen Versorgung gebracht haben: Der Staat sieht sich genötigt, Krankenhäuser dazu anzuhalten, Behandlungen medizinisch sinnvoll zu Ende zu bringen. Bei Medicaid macht der Staat Geld frei, um häusliche Pflege der ärmsten Patienten, deren Versorgung ansonsten nur durch eine Heimunterbringung zu gewährleisten wäre, zu unterstützen. Die genauen Bedingungen zu definieren, obliegt, wie immer bei Medicaid, den Einzelstaaten.
Die Reform der Finanzierung und die Erschließung weiterer Finanzquellen
Der Staat verlässt sich in Zukunft nicht mehr darauf, dass seine Unternehmer ihrer Belegschaft eine Krankenversicherung anbieten; von den Betrieben wird diese Leistung nun gesetzlich eingefordert. Unternehmen, die diese nicht erbringen, werden trotzdem für die Finanzierung des Systems zur Kasse gebeten: Sie werden, sofern ihr Betrieb 50 oder mehr Mitarbeiter hat, mit 2000 Dollar Sondersteuer für jeden nicht versicherten Mitarbeiter belegt, zu zahlen ab dem 31. Angestellten. Betriebe, die der staatlichen Anforderung nachkommen, erhalten dagegen Steuervergünstigungen.
Auch die Pharmaunternehmen werden finanziell neu in die Pflicht genommen: Diejenigen, die sich ordentlich am Gesundheitswesen bereichert haben und mehr als 5 Millionen Dollar Umsatz erzielen, müssen ihrem Marktanteil gemäß jährlich eine Sonderzahlung leisten, also mit einem Teil ihres Ertrags das System mitfinanzieren, an dem sie – Gerechtigkeit muss sein! – so gut verdienen.
Die Empfänger gesundheitlicher Leistungen werden von der staatlichen Verpflichtung zur Finanzierung des Systems nicht ausgenommen. Der Staat nimmt die Einkommen seiner Bürger neu als Finanzquelle ins Visier: Für die Bezieher höherer Einkommen werden die Beiträge zu Medicare von 1,45 % des Einkommens auf 2,35 % erhöht; der Anteil der Arbeitgeber bleibt unverändert. Die steuerliche Absetzbarkeit von Gesundheitskosten schränkt der Staat dagegen ein; nur noch Kosten oberhalb von $10 000 sind absetzbar.
Auch diejenigen, die überdurchschnittlich gut versichert sind, werden staatlicherseits neu zur Kasse gebeten: U.a. unterliegen die Leistungen aus den teuren betrieblichen Altverträgen, den so genannten Cadillac insurances, als geldwerte Zuwendungen ab sofort der Steuerpflicht. Diese Steuer soll die Policen finanziell unattraktiv machen und die Versicherungsnehmer zu einer einvernehmlichen Vertragsauflösung bewegen. Der Gesetzgeber lastet den hohen Alt-Versicherungen an, einer allgemeinen Basisversicherung aller Belegschaftsmitglieder durchs Kapital im Wege zu stehen; ein staatlich geförderter Abbau solcher „Altlasten“ soll der Motivation der Unternehmen zur Einrichtung bzw. Beibehaltung einer Grundversorgung auf die Sprünge helfen.
Damit die neuen Mittel auch verlässlich beim Staat eingehen, trifft der Gesetzgeber entsprechende Vorkehrungen: Firmen müssen nun für die Steuererklärungen ihren Mitarbeitern offenlegen, wie hoch der geldwerte Umfang von deren Krankenversicherung ist. Mit solchen und ähnlichen Vorschriften verschafft sich der Staat Auskunft über die Einkünfte seiner Bürger, die ihm als Grundlage für die Neufestlegung von Steuern und Medicare-Beiträgen dienen.
Als entscheidende neue Finanzquelle nimmt der Staat die Einkommen derjenigen Amerikaner in Haftung, die sich bisher – sei es aus Armut oder aus Berechnung – überhaupt nicht an den Kosten ihrer Versorgung beteiligt haben. Freiwillig, das hat man ja gesehen, tut sich da nichts; deshalb macht die Reform den Bürgern mit Strafandrohungen und Unterstützungsangeboten finanziell Beine. Schließlich sind sie, die bislang Unter- und Nichtversicherten, die prospektiven Nutznießer der Reform; also halten die Reformer es nur für recht und billig, wenn sie nach Maßgabe ihrer Fähigkeit zu dessen Funktionieren finanziell beitragen. Wer es zu keiner Krankenversicherung an seiner Arbeitsstätte bringt, muss sich nun privat darum kümmern. Wer sich trotz des großen Angebots, das der Staat im insurance exchange hat auflisten lassen, nicht versichern will, muss knapp 700 Dollar Strafe pro Jahr zahlen und wird so an den Kosten der Gesundheit beteiligt. Bei der Festlegung der Beitragshöhe nimmt der Staat selbstverständlich Rücksicht auf die finanzielle Lage der zukünftigen Beitragszahler; die Kosten, die den Privatkunden entstehen, sind eine Frage des Einkommens. Den Ärmsten wird ermöglicht, sich mit wenigen Dollars zu versichern, größtenteils vom Staat finanziert; stufenweise steigt der Pflichtbeitrag dann bis zum Höchstbeitragssatz von 10 % des Einkommens für alle, die das Vierfache und mehr dessen verdienen, was als Armutsgrenze staatlich definiert ist.
So zwingt die Reform die gegensätzlichen Interessen zusammen, deren konkurrierendes Wirken das Gesundheitswesen bestimmt. Diejenigen, die an der Gesundheit verdienen, verpflichtet die Staatsmacht, dann aber auch Gesundheit zu liefern. Diejenigen, die Gesundheit vernutzen, haben dafür zu sorgen, dass ihre Reparatur geht. Und diejenigen, die Gesundheit als Lebens- und Konkurrenzmittel brauchen, haben ihren Beitrag dazu zu leisten, dass sich der Aufwand auch finanzieren lässt, den die Akteure des Gesundheitswesens für ihre Dienstleistung verlangen dürfen sollen.
III. Die Reformdebatte und ihre fundamentalistische Fortsetzung
Genau so grundsätzlich, wie Obama seine Reform angelegt hat, wird sie von seinen Kritikern genommen. Die Opposition gegen das Projekt beruhigt sich auch gar nicht darüber, dass Obama wesentliche Bestandteile seines ursprünglichen Vorhabens – etwa das Angebot einer eigenen staatlichen Krankenversicherung in Konkurrenz zu den Privaten, oder auch die Beschränkung der Schadenersatzzahlungen für Kunstfehler, die die Budgets von Ärzten und Krankenhäusern belasten – gar nicht hat durchsetzen können. Egal: Damit, dass Obama sich überhaupt mit seiner Reform an allen eingerichteten und bislang auch fraglos anerkannten Interessen zu schaffen macht, handelt er sich die herzlichste Feindschaft ein – quer durch alle Schichten der Gesellschaft und Politik.
Die geschädigten Interessen melden sich zu Wort
Diese Gegnerschaft ist wenig verwunderlich, soweit sie aus den Reihen derer kommt, für deren Geschäft die Reform neue Konditionen setzt, die sie sich nicht bestellt haben. So selbstverständlich die Vertreter von Kapitalinteressen jede „Staatseinmischung“ begrüßen, wenn sie dem eigenen Geschäft nützt, so wenig können sie es leiden, wenn die politische Aufsichtsmacht sie zwingt, aus ihrer Sicht sachfremde Gesichtspunkte – und das sind alle, die ihnen Kosten bereiten – in ihre Geschäftskalkulation aufzunehmen. Da ist das Geschrei groß, dass der Staat sich am Markt vergehe und gerade damit verhindere, dass die Unternehmen ihrer Pflicht zur Versorgung der Gesellschaft mit diesem oder jenem nachkommen. Da berufen sich alle maßgeblichen Akteure auf ihr Geschäftsinteresse als vom Staat anerkannte Notwendigkeit und Funktionsbedingung des gesamten Systems; also auf die Erpressungsmacht, über die sie da nach wie vor verfügen:
Dem Geschäft der Versicherungen führt die Reform zwar mit der Versicherungspflicht für Private und der Pflicht der Betriebe zur Einrichtung von Betriebskrankenkassen neue Kundschaft zu. Als Zumutung betrachtet die Branche aber die neuen Pflichten, die auf sie zukommen, ebenso wie die vom Staat verordneten neuen Konkurrenzbedingungen. Angesichts solch unerträglicher Belastungen seiner Kostenrechnung prophezeit das Versicherungsgewerbe schon mal vorsorglich, dass es die Beiträge wohl insgesamt erhöhen müsse, wo immer ihm dies weiterhin erlaubt ist; wenn nicht bei der neuen Armutsklientel, dann eben bei der besser verdienenden Kundschaft. Diese Freiheit im Umgang mit den neuen Aufgaben hat ihm der Staat ja gelassen.
Die Unternehmerschaft beschwert sich über neue Lasten, die ihr den – vom Staat doch ebenfalls gewollten – Erfolg in der Weltmarktkonkurrenz unweigerlich erschweren werde.
Die Interessenvertreter der Krankenhäuser finden es kontraproduktiv, dass sie sich bei der Behandlung von Medicare-Patienten an Leistungskontrollen gewöhnen müssen und demnächst für Medicaid-Patienten wahrscheinlich auch noch Billigabrechnungen akzeptieren müssen. Die Zusatzkosten, die ihnen da entstehen, können, so mahnen sie, doch unmöglich im Sinne des Staates sein, der doch die Kosten gesenkt haben will.
Etwas anders ist das Echo auf die Reform bei den Bürgern gestrickt, denen der Staat durch die Reform zu einer besseren Versorgung verhelfen will. Da scheiden sich die Geister: Da gibt es jede Menge Betroffene, die über die neuen Leistungen froh sind, zu denen die Reform ihnen Zugang verschaffen will. Eine nicht geringe Zahl amerikanischer Bürger sieht die Sache aber gar nicht so. Quer durch alle Klassen und Schichten entdecken Leute in dem Reformpaket einen Anschlag auf ihre Freiheit: Nämlich die, als amerikanischer Bürger selbst darüber entscheiden zu dürfen, welche Risiken des kapitalistischen Alltags man wie auf sich nimmt und bewältigt. Die neue Beitragspflicht verstehen sie als Inbeschlagnahme ihres Einkommens durch eine übermächtige Staatsgewalt, die ihnen die Früchte ihres rechtschaffenen Kampfes um Arbeit und Auskommen raubt; manche sehen in den neuen Kontrollmaßnahmen, die der Staat gegenüber der Gesundheitsbranche etabliert, den ersten Schritt zu einer „socialized medicine“, in der seelenlose Bürokraten in Washington diktatorisch über Leben und Tod von Alten und Kranken entscheiden... Der Schaden, der hier verbucht wird, bewegt sich also mehr im Ideellen. Der amerikanische Bürger mag ja arm sein und es in der Konkurrenz schwer haben – vom Staat bevormunden lässt er sich deswegen noch lange nicht, und ob gerade er eine Krankenversicherung braucht und was die ihn kosten soll, wird er ja wohl immer noch selbst entscheiden dürfen. Alles andere ist sozialistischer Zwang, den er sich nicht gefallen lassen muss.
Besserverdienende, die versichert sind, begreifen die Sache so, dass sie nun in unangemessener Weise und völlig zu Unrecht mit Extrakosten bestraft werden. Sie sehen überhaupt nicht ein, wieso sie mit höheren Beiträgen dafür geradezustehen haben, dass nun auch Leute, die nichts leisten und nur kosten, in den Genuss einer Krankenversicherung kommen sollen. Für sie steht fest, wer daran schuld ist: Nicht etwa die Versicherungen mit ihrer Kostenkalkulation – die geht als anerkanntes Geschäftsgebaren voll in Ordnung – , sondern Obama und Co., die unbedingt arme Leute zu Mitteln verhelfen wollen, die ihnen nicht zustehen.
Arbeiter, die einst mit ihren Kämpfen in den 1960er Jahren bei den Big3 in Detroit die Cadillac insurances erkämpft haben, sehen sich um den Lohn ihrer Mühen gebracht; vor allem aber auch um die Sonderstellung, die sie als Gewerkschaftsmitglieder bei diesen ehemals renommierten Unternehmen genießen durften und die ihnen nun vom Staat bestritten wird.
Unterm Strich sehen jede Menge Leute aus den unteren Klassen sich als die eigentlichen Verlierer der Reform. Statt, wie es Obama gerne hätte, dem Staat für die Stärkung ihrer Stellung als Versorgungsberechtigte dankbar zu sein, nehmen sie sein Reformwerk als Angriff auf ihr Recht, ihrem life, liberty and pursuit of happiness
unbehelligt von der Staatsmacht nachzugehen und ganz selbst und frei mit den Widrigkeiten und Chancen der Konkurrenz kalkulieren zu dürfen; deshalb auch als Verstoß gegen ihr Recht, nichts an diejenigen „abgeben“ zu müssen, die mit ihrer Niederlage in der Konkurrenz auch das Recht auf entsprechende Vorteile verwirkt haben.
Die Gesundheitsreform als nationaler Sündenfall in Sachen „american way of life“
Für Obama ist die Reform des Gesundheitswesens ein bedeutsamer Schritt in der Abkehr der USA von einem falschen Weg: Von dem nämlich, allzu sehr auf „corporate interests“ als Garanten des Erfolgs der Nation gesetzt und zu wenig darauf geachtet zu haben, ob das Wohl der Nation darüber auch zustande kommt. Seine Gegner von oben wie unten sehen die Sache genau umgekehrt: Dabei kann nichts Gutes für die Nation herauskommen, wenn die Staatsgewalt umverteilend in die Ergebnisse der ökonomischen Konkurrenz ihrer Bürger eingreift, Erfolgreiche bestraft und Schwache mit durchzieht. Das ist für sie der eigentliche Schaden, den die Gesundheitsreform anrichtet: Dass die politische Gewalt dabei das Kapital wie den freien Bürger in ihrem Leistungswillen und ihren Erträgen beschränkt. Als gute Amerikaner sind sie es schlicht so gewohnt, dass ihr partikularer Standpunkt als Garant das Wohls der Nation von der politischen Gewalt anerkannt und gefördert wird – und jetzt kommt ausgerechnet ein Präsident daher und behauptet, das sei nicht mehr so. Die Kritiker hingegen sind sich auch ganz ohne näheres Hinsehen sicher: Wenn der Staat sie beschränkt, dann verschwendet und verspielt er in Wahrheit genau die Kräfte und Ressourcen, die Amerika groß und stark gemacht haben; vor allem eben ihre Freiheit, es als Konkurrenzsubjekte zu etwas zu bringen. Das ist die Sache, um die es für sie bei der Gesundheitsreform überhaupt bloß geht: Hier findet eine Umwertung aller erprobten und gültigen amerikanischen Werte statt; ein Anschlag auf die Prinzipien, die Amerika noch immer groß und stark gemacht haben.
In diesem Sinne nutzen die Gegner Obamas ihre politischen Machtpositionen, um das Reformwerk nach Kräften zu torpedieren. Das tun sie nicht nur in beiden Häusern des Kongresses; zusätzlich nutzen sie, soweit sie die entsprechende Regierungsgewalt innehaben, die politischen Befugnisse der Einzelstaaten, um die Reform oder jedenfalls Teile von ihr noch nachträglich zu Fall zu bringen. Ihre parlamentarische Niederlage erkennt die Opposition nicht als das demokratisch legitimierte Ende der Debatte an; sie setzt alle verfassungsrechtlichen Hebel in Bewegung, um die Reform doch noch zu Fall zu bringen. Dabei berufen sich die Gegner Obamas darauf, dass die Reform einen einschneidenden Eingriff in die gesetzgeberischen Rechte und die Gestaltungsfreiheit der Einzelstaaten darstellt. In der Tat steht das Unterfangen Obamas, so etwas wie einen nationalen Standard der Gesundheitsversorgung herbeizuregieren, der Sache nach quer zu dem Prinzip, nach dem die politischen Zuständigkeiten zwischen den verschiedenen Abteilungen des Staatsapparats geregelt sind: Die verschiedenen Versicherungsgesetze, das unterschiedliche gesundheitliche Versorgungsniveau in verschiedenen Bundesstaaten etc. pp. verdanken sich dem Umstand, dass die Potenz des Staatswesens zur Finanzierung sozialer und infrastruktureller Leistungen abhängig gemacht ist von der Ertragskraft der Wirtschaft vor Ort. In dieser Zuordnung von Zuständigkeiten existiert materiell das Prinzip, wonach das Gemeinwesen immer so gut fährt, wie die Privatwirtschaft Erträge erwirtschaftet; darauf richten sich die Regierungen vor Ort mit ihren sozialstaatlichen Vorschriften und Maßnahmen ein. Diese unterschiedliche Leistungskraft anerkennt der Bundesstaat, wenn er etwa die Zahlung von Medicaid-Leistungen abhängig macht vom jeweiligen Leistungsniveau der Einzelstaaten; oder er anerkennt sie eben nicht, wenn er, wie Obama dies tut, die Zahlung bestimmter Leistungen zur nationalen Sache erklärt oder national gültige Vorschriften für die Aktivitäten von Versicherungen im Gesundheitswesen durchsetzt. Gegen solche Vorstöße werden die politischen Gegner Obamas aktiv: Einige Einzelstaaten verabschieden Verfassungsänderungen, mit denen dafür gesorgt sein soll, dass die Reformmaßnahmen der Zentralregierung bei ihnen nicht Platz greifen können. 21 Einzelstaaten haben beim Verfassungsgericht Klage gegen die Reform eingereicht mit dem Argument, das Gesetz würde in unzulässiger Weise in ihre gesetzgeberischen Befugnisse eingreifen. So dokumentiert die Opposition, wie grundsätzlich ihre Gegnerschaft gegen das Reformwerk gemeint ist.
Damit nicht genug: Außerhalb des etablierten politischen Spektrums gründet sich eine neue Volksbewegung. Die gibt sich einen Namen, der fundamentalistischer nicht sein könnte: Die „Tea-Party“-Bewegung sieht sich in der direkten politischen Nachfolge der amerikanischen Ur-Bürger, die Front machten gegen die britischen Kolonialherren und, so will es die nationale Gründungslegende, damit den Anstoß zur Gründung des freien Gemeinwesens Amerika gaben. Genau so unterdrückt und von Fremdherrschaft gegängelt, so darf man sich denken, muss man sich heutzutage als amerikanischer Bürger fühlen, wenn der Staat einem sein Konzept von Volksversorgung aufdrückt und damit die heiligsten Prinzipien nationaler Lebensart über den Haufen wirft. Dem muss entschlossen Widerstand entgegengesetzt werden. Wie das geht, steht für diese aufrechten Menschen schon fest: Obama muss weg.
[1] In den letzten 10 Jahren ist die Zahl der Versicherten um mehr als 10 % gesunken. Mittlerweile zählt man fast 50 Millionen Unversicherte, davon mehr als 10 Millionen Kinder; bereits vor der Krise verloren jährlich mehr als 2 Millionen Leute den Versicherungsschutz.
[2] In den ersten mit den Gewerkschaften ausgehandelten Verträgen haben die Arbeitgeber die Beiträge noch komplett übernommen; diese Praxis ist über die Jahre immer mehr aufgeweicht worden.
[3] Auch Wal-Mart, mit 1,5 Millionen Beschäftigten der größte Betrieb ohne nennenswerte gewerkschaftliche Vertretung, lässt sich nicht nachsagen, seiner Belegschaft keinen Versicherungsschutz anzubieten – so sieht der dann auch aus: Der Versicherungsschutz beginnt erst bei Ausgaben über 5000 $ zu greifen, zudem gibt es zahlreiche Zahlungs- und Leistungsbeschränkungen; die Police muss zu über 40 % vom Mitarbeiter bezahlt werden. Ursprünglich hat Wal-Mart versucht, den Abschluss der Police an eine Nicht-Gewerkschaftsmitgliedschaft zu knüpfen; dieser Versuch des union busting ist juristisch gestoppt worden. (http://www.ufcw.org/take_action/walmart_workers_campaign_info/facts_and_figures/walmartonbenefits.cfm)
[4] Vgl. GegenStandpunkt 4-05. S. 80; www.afl-cio.org
[5] Darunter werden Zusammenschlüsse in der Gesundheitsbranche zum Zweck gemeinsamer Leistungserbringung gegenüber Versicherungen oder Betrieben gefasst. Anfänglich waren Managed Care Organisations vornehmlich ärztliche Zusammenschlüsse. Die HMOs (Health maintenance organization), die am weitesten durchgesetzte Form, sind entweder reine Diagnostikbetriebe oder umfassende Behandlungzentren. Der Versicherungsschutz, der sich an eine HMO bindet oder die das HMO selber anbietet, gilt nur für diesen Leistungserbringer. Mit der ausdrücklichen Zielsetzung, die Kosten von health care
in den Griff zu bekommen, wurden diese Organisationen von der Nixon-Administration 1973 ausdrücklich gefördert: Die Betriebe wurden gesetzlich verpflichtet, ihrer Belegschaft HMOs als Versicherungsalternative anzubieten (HMO-Gesetz). Diese Vorschrift ist inzwischen aufgehoben, weil die Institutionen flächendeckend durchgesetzt sind. PPOs (Preferred Provider Organization) haben sich als Geschäftsmodell aufgrund weit verbreiteter Kritik an den Serviceleistungen der HMOs etabliert. Da gibt es zwar auch einen Hauptvertragspartner, doch Kosten von anderen Ärzten und Krankenhäusern werden, wenn auch in reduziertem Umfang, übernommen, während POSs (Point-of-Service) Elemente beider Gruppen-Versicherungen aufzuweisen haben. (http://en.wikipedia.org/wiki/Managed_care)
[6] Das heißt natürlich nicht, dass Unternehmen das „Argument“ roter Zahlen dafür bräuchten, um Angriffe auf den Lohn ihrer Beschäftigten zu starten: Aktuell streiken gerade die Arbeiter einer Saftfabrik nahe New York, weil die Firma trotz Rekordprofiten Lohnkürzungen von 3000 $ im Jahr, das Einfrieren von Pensionszahlungen sowie eine Erhöhung ihrer Beiträge für „health care“ verlangt – mit dem Argument, sie wolle das betriebliche Lohnniveau an die örtlichen Gegebenheiten anpassen. Sie lügen uns nicht einmal an; sie sagen ‚wir brauchen das finanziell gar nicht, aber wir wollen das sowieso, weil wir glauben, das durchsetzen zu können.‘
(Der zuständige Gewerkschaftsvertreter lt. IHT, 19.8.10)
[7] Unabhängig vom Alter werden etwa die Kosten von Dialysepatienten übernommen; die praktische Krankenhausausbildung des überwiegenden Teils der Ärzte wird staatlich bezahlt; und Lohnabhängigen wird beim Verlust des Arbeitsplatzes die Fortführung der Betriebskrankenversicherung für die Bezugsdauer von Arbeitslosengeld (bis zu 26 Wochen) überbrückt. Einige Einzelstaaten sind jetzt in der Krise dazu übergegangen, diese Kosten bis zu zwei Jahre lang zu übernehmen.
[8] Siehe hierzu Reform im US-Gesundheitswesen, GegenStandpunkt 1-04
[9] Zu solchen Maßnahmen gehört z.B. die Reform der Notfallbehandlung: Seit 1986 sind alle Krankenhäuser, die Zahlungen aus dem Medicare-Programm des Staates akzeptieren (d.h. fast alle), verpflichtet, Patienten in Notfällen kostenlos zu behandeln. Seitdem nimmt die Zahl der emergency rooms ab und auch Krankenhäuser schließen vermehrt. (http://en.wikipedia.org/wiki/Emergency_Medical_Treatment_and_Active_Labor_Act)
[10] Als öffentlicher Arbeitgeber reagiert der Staat bzw. seine regionalen Agenturen auf seine haushalterischen Probleme wie die Privatwirtschaft mit Leistungskürzungen bei benefits. Diese Kürzungen gestalten sich allerdings deutlich verhaltener; auch deswegen hat man es als Ami mit einer Stelle im öffentlichen Dienst, auch wenn sie ansonsten mäßig bezahlt wird, vergleichsweise gut getroffen.
[11] http://www.whitehouse.gov/briefing-room/signed-legislation
[12] Hierzu gehören Massachusetts, Minnesota und Connecticut, die bereits aktiv geworden sind, und Kalifornien, Maine und Vermont, die ihre Pläne erstmal wegen der Reform gestoppt haben. Hawaii mit einer Arbeitgeber-Pflichtversicherung und New Jersey, das Krankenhausrechnungen zu einem stark reduzierten Preis übernimmt, wenn die Patienten selber nicht zahlen können, sind weitere Beispiele für den Versuch, einen allgemeinen Versorgungsstandard zu sichern. S.Wikipedia, Health Care Reform
[13] Bei mir zu Hause in Illinois steigen die Prämien um bis zu 60 % ... – einfach so. Und weil diese Märkte so konzentriert sind, ist man festgelegt. Man hat nur die Wahl: Entweder keine Krankenversicherung ... mit der Gefahr, im Krankheitsfall Bankrott zu gehen und alles zu verlieren – oder man bringt dauernd Geld auf, das man sich nicht leisten kann … Neulich gab es bei Goldmann-Sachs eine Konferenz, auf der ein Versicherungsmakler den Anlegern der Wall Street erzählt hat, wie das Geschäft in den nächsten Jahren läuft. Er sagte, dass die Versicherungen wissen, dass sie Kundschaft verlieren, wenn sie ständig die Beiträge erhöhen; aber weil es so wenig Konkurrenz im Versicherungsgewerbe gibt, macht das nichts, weil viele Leute gar nicht anders können, als zu zahlen. Und auch wenn welche rausfallen, verdienen sie trotzdem an den Kunden, die sie behalten … Sie sagen ihren Anlegern Folgendes: Wir werden weiter Profite machen, auch wenn viele Leute in Not kommen.
(Obama ebda)