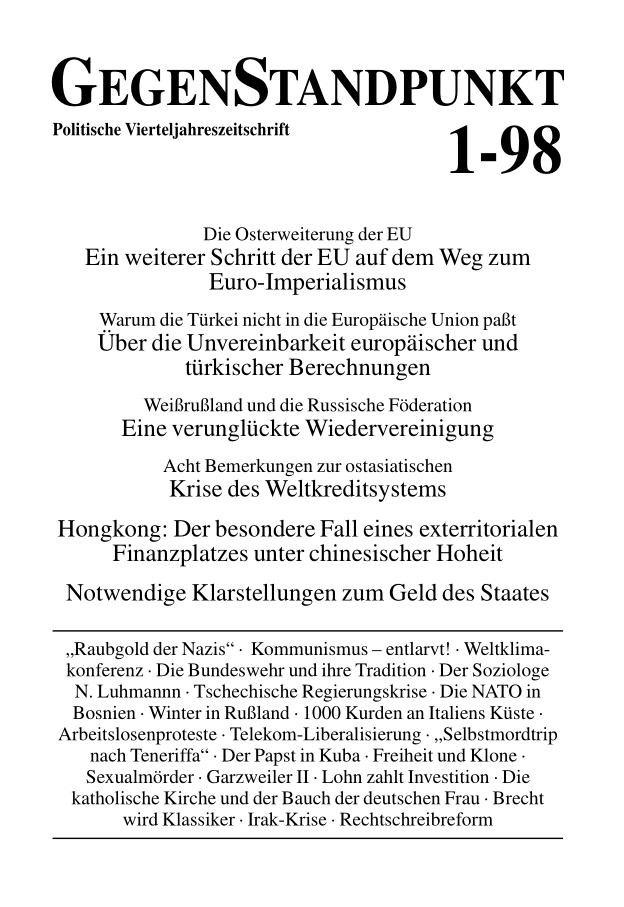Notwendige Klarstellungen zum Geld des Staates
Zwei Leserbriefe zu dem Artikel „Der Staatshaushalt – Von der Ökonomie der politischen Herrschaft“ in GegenStandpunkt 4-97
Klarstellungen zur Leistung des modernen Staates, das Geld von jedem Warencharakter zu emanzipieren, es selbst gesetzlich zu schaffen – die politökonomische Natur des gesetzlichen Zahlungsmittels –, sich darin zu verschulden und alle ökonomischen Aktivitäten seiner Gesellschaft zu fördern, damit sie seinem Anspruch auf kapitalistischen Erfolg genügt.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Siehe auch
Systematischer Katalog
Leserbriefe
Notwendige Klarstellungen zum Geld des
Staates
Zwei Leserbriefe zu dem Artikel „Der
Staatshaushalt – Von der Ökonomie der politischen
Herrschaft“ in GegenStandpunkt 4-97, S.191 … und
eine Antwort der Redaktion
1.
Kritische Anmerkungen zu Eurem Artikel ‚Der Staatshaushalt…‘
Der Zahlungsverkehr im modernen Kapitalismus findet hauptsächlich mittels Bewegung von sog. Buchgeld statt: D.h. mittels Überweisung, Scheck, Lastschrift, Kredit-/Scheck-Karte etc. findet eine Geld-Übertragung zu Lasten des Kontos des Zahlungspflichtigen und zu Gunsten des Kontos des Zahlungsempfängers statt. Zahlungen mittels Bargeld (Banknoten und Münzen) nehmen immer mehr an Bedeutung – gemessen am Transaktionsvolumen im bargeldlosen Zahlungsverkehr – ab und kommen hauptsächlich bei Geschäften des „täglichen Bedarfs“ (Zahlungen im Konsumbereich, die sich in verhältnismäßig kleinem Rahmen halten) vor.
Was Ihr über den Vorteil für die Geschäftsbanken betreffs des Ersatzes von Bargeld (= echtem Geld – Gold) durch Banknoten auf Seite 194 habt anklingen lassen, gilt analog für den Ersatz von Banknoten/Münzen durch Buchgeld. Daß den Geschäftsbanken die Emission von Banknoten untersagt ist, bedeutet nicht, daß sie keine Geldschöpfung betreiben könnten. Im Gegenteil – diese findet als Schöpfung von Buchgeld statt (z.B. durch Kreditgewährung). Schranken findet die aktive Buchgeld-Schöpfung
1. durch die Vorsorge, die jede Geschäftsbank im Interesse ausreichender Liquidität zur Abdeckung von Barverfügungen treffen muß (Bsp: Ein Kassenbestand von DM 1.000.- wäre ausreichend für eine mittels Kredit geschöpfte Sichteinlage von DM 20.000,00, wenn diese lediglich zu 5% als Bargeld abgezogen würde);
2. durch den Staat, der die Geschäftsbanken dazu zwingt, Buchgeldbestände (Mindest-Guthaben, deren Höhe in Abhängigkeit von den Kundeneinlagen bestimmt wird) bei sich zu unterhalten. (Mindestreservepolitik der Bundesbank).
Der Witz am Konto der Geschäftsbank bei der Notenbank ist nicht der Zugriff auf deren Banknote – im Zeitalter des Bargeldlosen Zahlungsverkehr wäre das merkwürdig –, sondern der Zugriff auf Zentralbankgeld, was nicht dasselbe ist! Dieses beinhaltet auch das Buchgeld der Geschäftsbanken bei der Notenbank. Der Staat erhöht nicht die Geldmenge, indem er die Notenpresse anwirft – sondern indem er den Spielraum für die aktive Geldschöpfung durch die Geschäftsbanken ausweitet durch
1. Senkung der Mindestreservesätze (Senkung der Mindestguthaben, die bei der Bundesbank zinslos zu unterhalten sind)
2. Zentralbankgeld (Buchgeld)-Schöpfung durch die Bundesbank durch den Ankauf von Wechseln (Diskontpolitik) resp. Offenmarktgeschäft (Ankauf von Zinstragenden Wertpapieren) bzw. Lombardkredit (Kredit gegen Hinterlegung von Wertpapieren)
(Indem der Preis für die Refinanzierung – per Senkung des Diskonts, des Lombards u./o. des Wertpapierpensionssatzes – sinkt und diese Preissenkung an die Kunden in Form gesunkener Zinssätze für die an sie herausgelegten Kredite weitergereicht werden, wird sich die umlaufende Geldmenge dann erhöhen, wenn die billiger gewordenen Kredite vermehrt nachgefragt werden.)
Die Verwandlung von Buchgeld in Banknoten mittels Barabhebung seitens der Geschäftsbanken ist also nicht erforderlich, um „das Kreditgeschäft in idealer Weise zu vollenden“ (S. 197) – tatsächlich ist das Volumen an Banknoten und Münzen, welches in den Tresoren der Geschäftsbanken verwahrt wird, verschwindend gering in Relation zu den Buchgeldbeständen bei der Notenbank!
Noch mal. da das Bargeld in seiner Bedeutung mit dem Buchgeld nicht mithalten kann, stellen die bei den Geschäftsbanken eingelaufenen Bargeldsummen praktisch keine Schranke für das Kreditgeschäft dar. Nicht die sind das Problem, sondern verfügbares Buchgeld. Diesem Problem widmet sich die Zentralbank mittels ihrer Geldpolitik (Wie oben beschrieben). Aber nicht so, daß die Zeichen stets auf Expansion stehen (wie auf Seite 198 unterstellt wird). Die Geldpolitik kann auch in die andere Richtung gehen (Erhöhung der Mindestreservesätze; Reduzierung der Offenmarktgeschäfte oder andere Maßnahmen, die den „Geldhahn zudrehen“). Um an Buchgeld bei der Zentralbank heranzukommen, sind sehr wohl gelaufene Geschäfte vorausgesetzt: In die Wertpapiere, die beliehen werden oder zeitweilig (wie beim Wertpapierpensionsgeschäft) überlassen werden, muß ja auch erst einmal investiert werden! Also. weil die Auszahlung eines Kredits in der Regel nicht als Barauszahlung erfolgt (sondern als Buchgeldbewegung stattfindet), stellen fehlende Banknoten (die die Geschäftsbanken nicht emittieren dürfen) auch kein Problem dar – folglich ist staatliches Bargeld auch nicht das Mittel, das Kreditgeschäft zu „entschränken“. Mittels seiner Geldpolitik besteht der Staat gegenüber seiner Gesellschaft darauf, daß sie kapitalistische Verwertungsleistungen zustande bringt, die seine Geld-Schöpfung (Bargeld + Buchgeld!) als „hart“ erweisen.
(S.214) Bei keiner Zentralbank der Welt heutzutage besteht die Verpflichtung, die von ihr ausgegebene Währung zurückzunehmen und gegen Gold oder Devisen umzutauschen. Keine Zentralbank der Welt verfolgt (oder hat verfolgt) eine Politik, die darauf zielt, einen Gold- oder Devisenschatz anzusammeln, der als materielle Sicherheit für die eigene Währung fungiert. Wenn Zentralbanken Devisengeschäfte betreiben, dann tun sie das nicht, weil sie wie kapitalistische Banker von der Kursbewegung profitieren wollen, und auch nicht, weil sie einer gesetzlichen Umtauschverpflichtung nachzukommen haben: Sie intervenieren auf den Devisenmärkten, damit der Kurs sich in gewünschten Bahnen bewegt: Die gewaltigen $-Reserven der Bundesbank sind das Ergebnis solcher „Kurspflege“ (daß die Bundesbank dabei Gewinne einfährt, ist ein willkommener Spin-off – aber nicht der Zweck des Unternehmens) – auch die nicht mehr vorhandenen Devisenreserven der südkoreanischen Zentralbank verdanken sich der im Prinzip gleichen Politik (Stützungsaktionen für den Kurs der eigenen Währung).
Nicht notwendigerweise fällt das Ergebnis des internationale Grenzen überschreitenden Geldeinnehmens und – ausgebens zusammen mit der Geldbewegung in der Devisenkasse der Zentralbank: Die Dollars, die die Devisenkasse der Bundesbank füllen, entstammen nicht dem erfolgreichen Export auf dem Weltmarkt, sondern sind das Ergebnis der o.a. Kurspflege (der Export ist allenfalls indirekt verantwortlich- aber war der Erfolg des zweitbesten Exporteurs der Grund für eine Spekulation gegen den Dollar?!)
Devisen werden von der Zentralbank benötigt, um den Wert der eigenen Währung zu sichern – aber nicht – wenn der Wert trotzdem sinkt – um diese zurückzunehmen und gegen Gold einzutauschen (s. Bsp. USA) oder gegen andere (Wert-haltige) Devisen.
(Noch ein anderer Zweck ist denkbar und wird praktiziert: Belgien hat große Teile seiner Goldbestände verkauft, um mittels der realisierten Gewinne Haushaltslöcher zu stopfen! – auch die Schweiz beabsichtigt dies )
Der Witz an den Kredithilfen für „schwache“ Länder besteht nicht darin, daß „staatliche Devisenschulden als Ersatz für einen abbanden gekommenen Staatsschatz fungieren“.
Bsp. Südkorea: Jetzt verfügt nicht die koreanische Zentralbank wieder über Devisen, mit denen sie auf den Devisenmärkten intervenieren kann – sondern diese „Finanzhilfen“ dienten im wesentlichen dazu, fällig werdende Kredite zu prolongieren – wozu die ausländischen Gläubiger nur allzu gerne bereit waren. weil sie sonst ihre Kredite hätten abschreiben können (zumal die „Fundamentaldaten“ in diesem Land stimmen: funktionierende Ausbeutung – niedrige Löhne, wenig Urlaub – hohe Arbeitsintensität und -produktivität).
Inflation: Auch hier wieder der Fehler, alles über die Banknote abzuleiten: Doch kann sich der Staat verschulden, ohne daß auch nur eine einzige Banknote zusätzlich in die Zirkulation geworfen wird: Erstens bezahlt der Staat i. d. R. seine Rechnungen per Buchgeld (Überweisung). Zweitens wird auch die Investition in Staatspapiere i.d.R. nicht bar beglichen, sondern (schon wieder) per Buchgeld bezahlt. (Wo ist da eine Banknote im Spiel?!)
Inflation durch Staatsverschuldung kommt auf zweierlei Wege zustande:
1) wächst die zahlungsfähige Nachfrage nach Waren und Diensten dadurch, daß Gelder, die gar nicht für den Kauf von Waren und Diensten bestimmt waren (das Geldvermögen nicht nur der Geldkapitalisten, Spargelder) über die Investition in Staatspiere nachfragewirksam werden, ohne daß im gleichen Maße das Angebot an Waren und Diensten wächst (bei der Investition in Firmenpapiere würde sich der Unterschied geltend machen, daß Staatsausgaben Konsumausgaben darstellen, also keinen Vorschuß darstellen, der sich durch vermehrte Wertproduktion rechtfertigen soll).
2) Die Beleihung (oder in Pensions-Gebung) der Staatspapiere bei der Notenbank (durch die Geschäftsbanken) schlägt sich unmittelbar in entsprechenden Guthaben (Buchgeldschöpfung!) der Geschäftsbanken bei der Zentralbank nieder. Die Verwandlung in Banknoten durch Barabhebung ist dazu nicht notwendig.
2.
In den Seiten 193ff des GegenStandpunkt 4-97, S.191, sind zentrale Behauptungen, denen ich nicht zustimme:
– die Behauptung, daß die Qualität des Geldes darin gegeben sei, daß es von einer Bundesbehörde gemacht werde; qualitativ ist Geld, gleich durch welches Medium symbolisiert oder vertreten, Maß und allgemeines Äquivalent der Warenwerte.
– die Behauptung, daß die Zentralbank mit der Emission des Zentralbankgeldes, des „Staatspapiergeldes mit Zwangskurs“, positiv an den Kreditgeldumlauf vergangener Jahrzehnte anknüpfe, ihn vollende; die umlaufenden Wertzeichen (Bundesbankbargeld) sind kein Kreditgeld („Schuldpapiere“), wie es die früheren, die konvertiblen Banknoten waren. Sie haben ihren ökonomischen Ursprung im Geldumlauf, nicht im Kredit.
– die Behauptungen, daß die Währung, das Bundesbankgeld, Wertmaß sei und die Substanz des Werts der Währung ein Gewaltverhältnis; der Warenwert hat eine ökonomisch bestimmte Substanz, und sein Maß muß eben diese Substanz haben. Wie kann denn das „Maß Gewaltverhältnis“ Arbeitszeit ausdrücken und quantifizieren?
Antwort der Redaktion
1.
Beide Leserbriefe beziehen sich zwar auf das erste Kapitel unseres Aufsatzes über den Staatshaushalt, befassen sich aber nicht mit dessen Gegenstand. Uns ging es weder um die technischen Hilfsmittel des modernen Zahlungsverkehrs noch um den Begriff des abstrakten Reichtums. Insofern können die Leser beruhigt sein: Weder bestreitet der Artikel, daß heutzutage alle Welt mit Scheck und Kreditkarte zahlt, weil er sich mit dieser erregenden Entdeckung gar nicht beschäftigt; noch stellt er die Bestimmung des Geldes als verdinglichte Privatmacht des Eigentums über abstrakte Quanta „toter“ wie „lebendiger“ Arbeit in Abrede – das hätten wir schon deutlich gesagt, wenn uns diesbezüglich neue Erkenntnisse gekommen wären. Uns ging es – wie die Überschrift es ankündigt – um den Staatshaushalt: um die eigentümliche Manier des bürgerlichen Souveräns, seine Herrschaft über die Gesellschaft mit dem Mittel des Geldes zu bewerkstelligen; eines Geldwesens, das er nicht bloß benutzt, wenn er Steuern einzieht und Schulden macht, das er vielmehr selber unter der Regie einer als Bank verfaßten Behörde organisiert. Gegenstand des Kapitels I. ist dieses staatliche Regime über das Geld der Gesellschaft und seine Leistung. Die Erklärung soll unseren Lesern einleuchten, gleichgültig ob ihnen die Geldtheorie von Marx oder die hilfreichen Broschüren der Deutschen Bundesbank zur Organisation des Bankwesens geläufig sind.
Mindestens zwei unserer Leser haben dieses Thema einfach nicht angenommen. Aber vielleicht läßt sich dafür ja – um den Preis einiger Wiederholungen – noch etwas tun.
2.
Daß eine staatlich autorisierte Behörde das nationale – oder demnächst in Europa eine staatengemeinschaftlich eingerichtete Instanz ein mehreren Nationen gemeinsames – Geld stiftet, indem sie gesetzlich gültige Zahlungsmittel herausgibt, was sonst niemand darf: das ist keine „Behauptung“ unseres Artikels, sondern als – erklärenswerte – Tatsache zur Kenntnis zu nehmen. Die Erklärung beginnt, u.E. zweckmäßigerweise, mit der Untersuchung, was mit dieser Art – wie man so sagt – „Liquiditätsversorgung“ politökonomisch geleistet ist.
a) Noch bevor eine staatliche Banknote die Druckerei verlassen hat, ist mit ihr die Einheit definiert, in der der Reichtum der Nation sein verbindliches Maß hat.
Es ist ein Glück für das kapitalistische Gemeinwesen, daß die zuständige Staatsbank diese Maßeinheit festlegt, ohne daß sich ihre Manager Rechenschaft darüber geben müßten, was mit der nationalen Währung überhaupt gemessen wird und was ein Ding wie „die Mark“ oder „der Euro“ selber ist, so daß es das Maß aller Einkommen und Ausgaben, jeglichen privaten und öffentlichen Vermögens, sämtlicher Geschäftsmittel und Geschäfts(miß)erfolge ist – die Marktwirtschaft käme sonst wohl kaum in Gang. Die Sachwalter der „Volkswirtschaft“ und ihres Geldwesens gehen einfach davon aus, daß der nationale Produktionsprozeß, seine Mittel und der zustandegebrachte Reichtum ihrer ökonomischen Natur nach allesamt eine einzige „Dimension“ aufweisen, die sich durch solche nur quantitativ verschiedenen Maßeinheiten wie „Mark“, „Franc“, „Euro“ oder „Dollar“ beziffern läßt. Ihr Interesse gilt allein den Verhältnissen und Verschiebungen zwischen den verschiedenen nationalen Maßeinheiten, weil dadurch sämtliche nationalen Geschäfte affiziert werden und sie damit umzugehen haben; was sich da verschiebt, brauchen sie dafür nicht zu wissen. Schon die Frage danach ist für die Manager der Geldwirtschaft und das von ihnen belehrte Publikum unverständlich.
Zu Recht; denn die Antwort ist ein wenig subversiv. Gemessen wird nämlich in jedem nationalen Geld ein die gesamte Marktwirtschaft begründendes Gewaltverhältnis: die Zugriffsmacht des Eigentums auf die Arbeitsleistungen anderer, die ihrerseits durch Verkauf ihrer Produkte oder Dienste Geld erwerben. Sehr viele nur sehr wenig, so daß die Reichweite ihres Eigentums sich regelmäßig schon an den Geldsummen blamiert, die gewisse andere fürs Lebensnotwendige verlangen; bei denen wiederum, die als Unternehmer das Eigentum an der Arbeitsleistung vieler anderer besitzen, bewährt sich die Privatmacht des Geldes als Mittel seiner Vermehrung. Nach beiden Seiten hin ist das von der zuständigen Behörde auf seinen nationalen Namen getaufte und emittierte Papiergeld das Maß der privaten Macht – oder eben Ohnmacht – über die Produktion gegenständlichen Reichtums, die in wechselseitiger Abhängigkeit gleichberechtigter Privatpersonen vonstatten geht.
Was daraus über diese Produktionsweise folgt, haben wir in anderen Artikeln unserer Zeitschrift verständlich zu machen versucht, z.B. in der Abhandlung über „Arbeit und Reichtum“ in den Nummern 4-96 und 1-97. In dem Aufsatz zum Staatshaushalt haben wir uns zunächst mit einer Fußnote begnügt, die Bemerkungen von Marx über das Geld als „das reale Gemeinwesen“ zitiert, und dann in Kapitel II. ausführlich darüber verbreitet, wie der Staat diese Produktionsweise gemäß den Sachzwängen des von ihm etablierten Geldregimes organisiert. Wichtig schien uns vorweg die Erläuterung eben dieser Sachzwänge.
b) Mit seinem gesetzlichen Zahlungsmittel setzt der bürgerliche Staat das Ding in die Welt, in dem der dadurch gemessene gesellschaftliche Reichtum: die private Zugriffsmacht auf Arbeit und deren Produkte, als solcher, losgelöst von jedem besonderen Gebrauchswert und frei verfügbar, existiert.
Was die politökonomische Natur dieses Dings betrifft, so lohnt ein Vergleich mit seinem historischen Vorläufer, der Edelmetall-Währung, die auch schon Papiergeld kannte, aber im Prinzip als bloßen Stellvertreter eines gewissen Quantums wirklicher, gesellschaftlich produzierter Geld-Ware. Das moderne Staatsgeld tritt mit Gesetzeskraft an die Stelle dieser Geldware selber; nicht nur in der Weise eines papierenen Repräsentanten, sondern als die neue „Materie“, an der die dem Eigentum innewohnende Verfügungsmacht, quantitativ gestückelt, hängt. Daß eine staatliche Verfügung nötig ist, aber auch genügt, um einem Papiergeld diese gesellschaftliche Verbindlichkeit zu verleihen, also ein Gesetz alle Mühseligkeiten der Edelmetallbeschaffung überflüssig macht, braucht niemanden zu wundern: Unter allen marktgängigen Arbeitsprodukten diejenigen der Gold-und-Silber-Scheideanstalten als diejenigen auszusondern und abzustempeln, die fortan mit ihrem Gewicht als Maßeinheit, mit ihrer Menge als selbständige Existenz der dinglichen Privatmacht des Eigentums fungieren sollten, war schon immer, so wie erst recht das Eigentum und dessen Verfügungsmacht selber, staatliches Dekret, also Ergebnis eines ziemlich totalitären Gewaltverhältnisses; auch wenn die zuständigen Regierungen sich speziell in ihrem Verkehr untereinander immer so dazu gestellt haben, als fänden sie die Geldeigenschaft des Edelmetalls wie eine Naturbestimmung an diesem vor und bräuchten mit ihrem Stempel nur noch zu beglaubigen, daß es wirklich gediegen genug sei, um seiner Geld-Natur zu genügen. Die in dieser Hinsicht aufgeklärten modernen Staatsgewalten halten sich denn auch enorm viel auf einen Fortschritt zugute, mit dem sie sich doch eigentlich bloß dazu bekennen, daß ihr „Fetischismus“ des Geldes – das dingliche Vorhandensein gesellschaftlicher Verfügungsmacht – eine Perversität ist, die ohnehin nur durch ihre souveräne Gewalt Gültigkeit erlangt.
Diese Gültigkeit kommt nun also den staatlichen Banknoten zu, und zwar exklusiv. Deswegen haben wir sie in unserem Artikel hartnäckig als das Bargeld der Gesellschaft bezeichnet – im Unterschied einerseits zu den früheren privat emittierten Banknoten, die zwar schon einiges dafür geleistet und der bürgerlichen Staatsgewalt als Vorbild dafür gedient haben, die edelmetallische Geldware durch zirkulationsfähige Zettel zu ersetzen, die aber den ökonomischen Status des erfolgsabhängigen Schuldscheins, des auf wirkliches Geld verweisenden Zahlungsversprechens nicht losgeworden sind, eben weil das keine banktechnische Angelegenheit, sondern eine Gewalt-„Frage“ ist. Auf der anderen Seite wollten wir so den Unterschied zum sogenannten „Buchgeld“ markieren: zu all den papierenen oder elektronisch verbuchten Zahlungsversprechen, die, so wie früher den edelmetallischen Geldreichtum der Geschäftswelt, heute eben die staatlichen Banknoten in allen geschäftlichen Transaktionen so prächtig zu vertreten vermögen – jedenfalls bis zum Bankrott des für die Stichhaltigkeit seiner Buchungen haftenden Kreditinstituts.
c) Um gleich an die letzte Bemerkung anzuknüpfen: Die politökonomische Bedeutung des Bargelds – des früheren edelmetallischen wie des modernen, mit allerlei Kunstgriffen möglichst fälschungssicher gemachten papierenen – liegt nicht in der Masse der Zahlungsvorgänge, die damit abgewickelt werden, schwindet also auch nicht mit dem Fortschritt von der Lohntüte zur Kreditkarte. Die Funktion, in der es im Kapitalismus unersetzlich ist, ist die des separaten gesellschaftlichen Geldschatzes, auf dem sämtliche Kredit- – und, als deren technische Seite, „Buchgeld-“ – Operationen in einer kapitalistischen Nationalökonomie beruhen. In ihm existiert in selbständiger Form jener Reichtum, auf den sich alle Schuldscheine und Forderungen beziehen; er steht für den unaufhebbaren und unaufgebbaren Unterschied zwischen versprochener und erfolgter Zahlung ein, auch wenn in der Praxis des Bankgewerbes Zahlungen fast ohne Gebrauch von Bargeld abgewickelt werden; insofern ist er die Grundlage des nationalen Kreditgeschäfts. In dieser Hinsicht macht es nun einen bedeutenden Unterschied, ob das wirkliche Geld, mit dem die Kreditkünstler des Kapitalismus operieren und letztinstanzlich auch für ihre Schulden einstehen müssen, in erworbener, bei ihnen deponierter, nach und nach akkumulierter Geldware besteht oder in Druckerzeugnissen, auf die die Staatsbank das Copyright hat. Nicht bloß den mehr technischen, den wir nicht weiter erwähnenswert gefunden haben, daß im letzteren Fall die dingliche Anwesenheit von Bargeld in den Tresoren der Kreditinstitute weitgehend durch ein Konto bei der Staatsbank zu ersetzen ist, von dem das benötigte Bargeld jederzeit abgerufen werden kann, ohne daß die Staatsbank dafür ihre eigenen Tresore leerzuräumen bräuchte. Politökonomisch bedeutsam ist die Tatsache, daß mit dem Staatsauftrag an eine bankmäßig verfaßte Behörde, das Geld der Gesellschaft zu drucken und den Banken im Wege eines speziellen Leihgeschäfts zukommen zu lassen, der Geldschatz selber, auf den die Finanzkapitalisten ihre Kreditgeschäfte begründen, neu definiert ist: Er ist nicht mehr an die aus besonderen Bergwerken herausgeholte Geldware gebunden und damit auch nicht mehr auf die vom „Publikum“ verdienten und bei Banken und Sparkassen hinterlegten Geldsummen beschränkt. Nicht als ob Depositen fürs Bankgeschäft damit belanglos würden; was an Geld erworben und den Finanzkapitalisten überlassen wird, ist und bleibt der „Stoff“, mit dem dieser Geschäftszweig wirtschaftet; und die staatlichen Notenbanken richten ihren Verkehr mit den Geschäftsbanken auch so ein, daß sie Zugriff auf richtiges Geld im Verhältnis zum Volumen solider Kreditgeschäfte gewähren. Gerade diese Restriktion gibt jedoch darüber Aufschluß, daß für die Banken die eine Schranke nicht mehr gilt, die in der allemal endlichen Größe des von ihnen verwalteten Bestandes an selbständig existierendem abstraktem Reichtum liegt. An dessen Stelle treten eben die erst einmal schrankenlose, deswegen dann gesetzlich restringierte Befugnis der obersten staatlichen Geldbehörde, Geld zu schaffen, und die Berechtigung der Banken, es sich zu leihen. Deren Kreditgeschäft wird damit die in der Dinglichkeit des Geldes liegende Einschränkung los – und nicht nur das.
d) Indem die bürgerliche Staatsgewalt sich mit ihrer aktiv wahrgenommenen Geldhoheit als Geldquelle ihrer nationalen Kreditwirtschaft betätigt, beglaubigt und vollendet sie das Verhältnis zwischen Finanzkapital und kommerzieller Profiterwirtschaftung, das sich aus der Konkurrenz zwischen diesen beiden Abteilungen kapitalistischer Geschäftstätigkeit von selbst ergibt, daß nämlich die Urheber des Kredits mit ihrer Macht über das allgemein benötigte Geschäftsmittel Produktion und Handel beherrschen und deren Erträge als ihre Ertragsquelle und Rechtfertigung ihrer Kreditschöpfung in Anspruch nehmen – für nähere Erläuterungen hierzu möge man andere Artikel des GegenStandpunkt, z.B. Kapitel IV. des Aufsatzes über „Arbeit und Reichtum“ zu Rate ziehen. Indem er aus eigener Machtvollkommenheit die gültigen Finanzmittel schöpft und diese unter Auflagen und gegen Zins an die Geschäftsbanken der Nation verleiht, betätigt sich der Staat als allererster Finanzausstatter und somit Urheber aller kapitalistischen Geschäftstätigkeit in seinem Land und nimmt diese insgesamt als eine einzige große Geldvermehrungs- und Zinszahlungsmaschinerie in Anspruch.
Dabei ist die im Staatsbankgewinn ausgewiesene Teilhabe der Staatsmacht an den Zinserträgen der nationalen Kreditwirtschaft bloß eine sehr erwünschte Nebenwirkung des eigentümlichen Sachzwangs, den der Staat mit der Stiftung des nationalen Geldes einrichtet. Indem er es emittiert, ermächtigt er das Finanzkapital zur Ausweitung der nationalen Geschäftstätigkeit, ohne ihm, geschweige denn den kreditierten Unternehmern und Privatpersonen, ihr jeweiliges Geschäftsrisiko abzunehmen: Die hergeliehenen Finanzmittel wollen erst erfolgreich verwendet sein, müssen wirkliche kapitalistische Bereicherung in Gang bringen, um ihre Schöpfung zu rechtfertigen. Die staatliche Geldschöpfung unterwirft somit die nationale Ökonomie insgesamt einem Leistungstest eigener Art: In dem Maß, in dem die Staatsgewalt ihre Kreditierung sicherstellt, hat sie sich als lohnende Anlagesphäre für den geschaffenen Kredit zu bewähren.
e) Der Schluß des Kapitels I. deutet an, daß und inwiefern mit diesem anspruchsvollen Zugriff auf den nationalen Kapitalismus das Staatsgeld selbst auf dem Spiel steht: nicht seine Gültigkeit als Maß und Materie des gesellschaftlichen Reichtums, nämlich der Privatmacht des Eigentums überhaupt, wohl aber das wirkliche Maß und die in einer bestimmten Summe realisierte Reichweite der privateigentümlichen Kommandogewalt über Güter und Dienste anderer, die das nationale Geld seinem Besitzer verleiht. Denn jetzt ist der Geldschatz der Nation eine der Staatsmacht frei verfügbare Größe, dadurch der nationale Kredit von den Schranken des in der Gesellschaft verdienten Geldes definitiv freigesetzt, jede Menge rentabler Produktion eingeleitet – aber damit noch lange nicht der abstrakte Reichtum geschaffen, den die staatliche Geldschöpfung antizipiert. Am Geld selbst, nämlich seinem „Wert“, macht sich bemerkbar, daß es von dem Gesamterfolg des nationalen Kredits, den es herbeiführen will, selber abhängt: Seine Geldqualität wird ein bißchen relativ. Das ist der Preis des Fortschritts von der Geldware zum definitiven Staatspapiergeld. Das Stichwort „Inflation“ führen wir in diesem Zusammenhang ein, weil darunter gewöhnlich die Wirkungen dieser eigentümlichen Unschärferelation subsumiert werden: Das Geld unterliegt jetzt selber einer „Wertbestimmung“, fällt unter ein so eigentümliches Qualitätskriterium wie „Härte“ – und gibt seinem Urheber neue politökonomische Sorgen auf, um deren Begriff es dann im Kapitel IV. des Aufsatzes gehen soll.
3.
Die beiden Leserbriefe, wie gesagt, befassen sich mit anderen Gegenständen. Doch wenn sie schon an unserem Artikel zum Staatshaushalt vorbeireden, wollen wir wenigstens nicht völlig an unseren Briefschreibern vorbeiantworten und mit ein paar Anmerkungen zu den Überlegungen dienen, die sie angestellt und mitgeteilt haben.
Zunächst zu der ausführlichen Belehrung.
a) Wenn ein Artikel von der „Ökonomie der politischen Herrschaft“ handelt und in einem ersten Kapitel darlegt, mit welchem Geldregime der bürgerliche Staat seine Gesellschaft zum Geldverdienen – je nach dem – zwingt und ermächtigt, dann mag man das als Auskunft über die ‚Bedeutung‘ staatlicher Geldschöpfung auffassen. Die liegt dann aber ganz gewiß nicht in der Menge der mit diesem Geld geleisteten Zahlungen; mit der Unterscheidung der alltäglichen Zahlungsvorgänge danach, ob sie bar oder unbar geleistet werden, geschweige denn dem Anteil beider Zahlungsarten am gesamten Zahlungsverkehr hat sie nichts zu tun; die Erinnerung daran ist fehl am Platz und steht zu den Behauptungen des Artikels nicht im Verhältnis einer „kritischen Anmerkung“. Soviel zu dem falschen Versprechen des Leserbriefverfassers.
b) Was die Unterscheidung von „Banknoten/Münzen“ einerseits, „Buchgeld“ andererseits betrifft, die dem Briefschreiber so sehr am Herzen liegt, so ist damit erst einmal nur die Banalität festgehalten, daß unter einem entwickelten Bankensystem der gesellschaftliche Zahlungsverkehr mehr durch die Verbuchung von Zahlungsanweisungen auf Girokonten als durch den Gebrauch von Bargeld abgewickelt wird. Dadurch verschwindet zwar nicht der – theoretisch ganz aufschlußreiche – qualitative Unterschied zwischen bargeldloser und Barzahlung, den man am Zahlungsvorgang selbst festhalten kann: Ein Kassierer, der einen namhaften Geldschein bekommt, tut gut daran, dessen Echtheit zu prüfen, denn der echte Schein, aber nur der ist Geld; bekommt er hingegen einen Scheck oder eine Plastikkarte in die Hand gedrückt, so prüft er zweckmäßigerweise nach, ob das bezogene Konto gedeckt ist, nämlich durch einen vom zuständigen Kreditinstitut bestätigten Anspruch auf einen Geldbetrag in der angewiesenen Höhe. Dieser jederzeit einlösbare Anspruch auf Geld genügt für die Bedürfnisse der Geldzirkulation aber so vollkommen, daß seine wirkliche Einlösung in barem Geld weitgehend überflüssig wird – andernfalls brächte die große Errungenschaft des bargeldlosen Zahlungsverkehrs ja auch gar keine bedeutende Ökonomisierung der Geldwirtschaft. Umgekehrt läßt sich mit Zahlungsanweisungen der verschiedensten Art – „Buchgeld“ im Sinne des Leserbriefs; private Bank-Noten haben früher übrigens auch dazu gehört – nur deswegen definitiv zahlen, weil die angewiesenen und verbuchten Beträge Ansprüche auf Geld übereignen, das zwar keineswegs dinglich in entsprechender Quantität bereitliegen muß – aber eben nur deswegen, weil es jederzeit in gegenständlicher Form bereitgestellt werden kann. – Theoretisch, wie gesagt, ist dieser Unterschied von Belang, auch wenn man sich an der Kaufhauskasse besser nicht in ihn vertiefen sollte.
Dieser Ersatz von Bargeld durch – auf Bargeld als Maß und unterstellte Materie der Transaktion lautende – Zahlungsanweisungen funktioniert deswegen so umfassend, weil er nichts mit Kreditieren zu tun hat. Oder, um es ganz unmißverständlich auszudrücken: Der Unterschied zwischen Zahlung und Kredit ist von anderer ökonomischer Natur als der – ziemlich belanglose – zwischen Bar- und bargeldloser Zahlung und liegt in der geschäftlichen Praxis quer dazu. Kredit entsteht, wenn Geld verliehen wird, egal ob durch die Überlassung von gesetzlichen Banknoten – selbstverständlich gegen ein irgendwo verbuchtes Schuldeingeständnis, ein Zahlungsversprechen – oder durch die Einräumung eines bankmäßig verbuchten Anspruchs auf „Liquidität“ in Form eines entsprechend ausgestatteten Kontos. Ein sachlicher Zusammenhang zwischen Kreditvergabe und bargeldlosem Zahlungsverkehr ergibt sich nur darüber, daß die durch Buchungs- und Verrechnungstechniken vollendete Verfügungsgewalt des Bankgewerbes über die verdienten Gelder der Gesellschaft Freiheiten bei der Kreditschöpfung eröffnet. Damit ist die – ebenso risikoreiche wie gewinnträchtige – Gepflogenheit des Finanzkapitals gemeint, bei der Kreditvergabe über die Summe der wirklich hinterlegten und verfügbaren Gelder hinauszugehen und die Zahlungsversprechen der Kreditnehmer, Anweisungen auf zukünftige, erst noch zu verdienende Erträge, als Vermögenstitel zu behandeln, mit denen sich nötigenfalls sogar aktuell fällige Zahlungen leisten lassen. Untereinander behandeln und handeln die Banken solche Geldforderungen – je nach ihrer „Ausstattung“ – geradezu als Zahlungsmittel; einige können sogar bei der staatlichen Notenbank regelrecht in Geld verwandelt werden. Auch dadurch hören solche „Wertpapiere“ freilich nicht auf, bloße Zahlungsversprechen oder – andersherum – -forderungen zu sein, die der fortdauernden Bestätigung durch Zinszahlungen und Tilgung bedürfen, um ihren Wert zu behalten. Andernfalls erweisen sie sich nämlich, sogar nachdem sie zur Bezahlung offener Rechnungen weitergereicht worden sind, als das, was sie sind: verbuchte Schulden – und eben kein „Buchgeld“.
Damit wird drittens deutlich, daß Kreditvergabe und -schöpfung nichts mit Geldschöpfung zu tun hat. Das hätten Finanzkapitalisten zwar gerne, daß jede Geldforderung, die sie an einen Schuldner haben, auch schon verdientes und wieder hereingekommenes Geld wäre. Und praktisch nehmen sie sich auch, wie erwähnt, die Freiheit heraus, ihre wertpapierenen Belege über weggegebene Geldsummen wie vorhandenes Geldvermögen und verfügbare Zahlungsfähigkeit zu verbuchen und auch für Zahlungen zu benutzen; gerade so, als wäre der Unterschied zu wirklichen Guthaben und zu Zahlungsanweisungen, mit denen über bereits verdientes Geld verfügt wird, bestenfalls gradueller Natur, eine Frage des „Liquiditätsgrads“. Den prinzipiellen Unterschied zwischen versprochenem und verdientem Geld verlieren Bankiers dennoch nicht aus dem Auge – wie jeder aus Erfahrung weiß, der jemals für die Überziehung seines Girokontos zweistellige Zinsraten gelöhnt hat und seine Hausbank nicht davon überzeugen konnte, daß es sich bei Plus oder Minus auf seinem Konto doch bloß um den geringfügigen Unterschied zwischen zwei Arten „Buchgeld“ handeln könne. Eine Bank riskiert nämlich ihren Bankrott, wenn sie es mit der Verbuchung ihrer „Außenstände“ als Vermögen und deren Gebrauch als Zahlungsmittel übertreibt: Dann brauchen am Ende nur ein paar Schuldner säumig zu bleiben, und um ihre eigene Zahlungsfähigkeit ist es geschehen.
c) Die definitive Überführung von Geldforderungen in Geld bleibt der staatlichen Notenbank vorbehalten: Wenn sie von ihren Geschäftspartnern Zahlungsversprechen akzeptiert – z.B. Wechsel re-diskontiert –, dann setzt sie im Gegenzug ihrerseits nicht wiederum erfolgsabhängige Anweisungen auf zukünftigen Reichtum, sondern bares Geld in die Welt. Andersherum: Was die staatliche Notenbank emittiert und in Verkehr bringt, sind keine Kreditpapiere, für deren Wert ein Schuldner mit Zins und Tilgung erst noch einstehen müßte; sie treibt keine Kreditschöpfung in dem Sinn; was sie schöpft, ihren Geschäftspartnern gutschreibt oder auch bei Bedarf im Panzerwägelchen hinfährt, ist zuschüssiges bares Geld. Und das ganz unabhängig davon, in welcher Form die Geschäftsbanken dann über ihre Zentralbankguthaben verfügen: Ob sie für ihre Kassenhaltung das Nötige „abheben“ oder Zahlungspflichten gegenüber anderen Banken darüber abwickeln, in jedem Fall verwenden sie ein Geld, das genauso Teil des gesellschaftlichen Geldschatzes ist wie alle verdienten und bei ihnen hinterlegten Geldvermögen der Gesellschaft.
Der Leserbrief liegt daher falsch – auch wenn er sich auf manche Unterscheidungen und Zurechnungen berufen kann, die die Profis des privaten und staatsbankamtlichen Kreditgeschäfts nach ihren pragmatischen Gesichtspunkten vornehmen –, wenn er die Geschäftsbanken zu den Urhebern der „aktiven Geldschöpfung“ erklärt und der staatlichen Zentralbank, noch dazu mit Verweis auf die quantitativ geringfügige Rolle ihrer Notenpresse, die Funktion zuschreibt, dafür „Spielräume“ zu schaffen und im Hintergrund mit Zinssätzen und Mindestreservepflichten die Drähte zu ziehen. Nochmals: Geldschöpfung ist – entgegen manchen marktwirtschaftlichen Sprachregelungen, die vom Begriff des Geldes ohnehin unberührt sind – überhaupt nicht Sache des Finanzkapitals. Das verdient auf der einen Seite an der erweiterten Reproduktion des abstrakten Reichtums der Gesellschaft, also an der Mehrung des Geldes mit, die es durch seine Kreditvergabe anleiert, auf die es mit seiner Kreditschöpfung aber auch angewiesen ist. Da und soweit dieses höchst aktive Kreditgeschäft den Rückgriff auf zuschüssige, noch gar nicht verdiente und verfügbare Gelder benötigt, also die Ausweitung des gesellschaftlichen Geldschatzes verlangt, steht die Staatsgewalt als Stifter des gesellschaftlich gültigen Zahlungsmittels bereit: Sie schöpft das Benötigte. Damit betätigt sie sich als letzter Urheber des nationalen Finanzgeschäfts und des von diesem kreditierten kapitalistischen Erwerbslebens. Auf dieses prinzipielle politökonomische Verhältnis legen wir in unserem Artikel deswegen gesteigerten theoretischen Wert, weil es in der finanzkapitalistischen Praxis leicht umgekehrt erscheint; so nämlich, daß die Banken nach ihren Geschäftsbedürfnissen auf ihre National-Bank zurückgreifen oder auch nicht. Es ist dennoch nicht bloß eine „optische Täuschung“, sondern ein Fehler des Leserbriefs, die Freiheit zur Geldschöpfung den Geschäftsbanken zuzuschreiben und das diesbezügliche Monopol der Notenbank theoretisch in ihre Regulierungstechniken – Mindestreserve- und Zins-„Politik“ – aufzulösen; Techniken, die tatsächlich doch nichts anderes als dieses Monopol exekutieren. Denn schließlich verteilt die staatliche „Bank der Banken“ keine Lizenzen ans private Kreditgewerbe, sich durch „Buchgeld-Schöpfung“ zu bereichern, sondern ermächtigt es mit ihrer Geldschöpfung zu den enormen Kreditgeschäften, an denen sie dann ihrerseits mit einem Anteil am Zinsgewinn beteiligt ist.
d) Die Erwirtschaftung von Zinsgewinnen ist gleichwohl nicht das Ziel der staatlichen Notenbank, wenn sie die Zinssätze und sonstige Konditionen für den bankgewerblichen Zugriff auf ihr Geld festlegt. Vielmehr meinen und versuchen die Staatsbanker auf diesem Wege ihre Finanzkapitalisten so zu beeinflussen und zu lenken, daß ein nationaler Gesamterfolg am Ende gar nicht ausbleiben kann. Sie machen sich damit zu Anwälten des Anspruchs, den der Staat an seine Gesellschaft stellt, wenn er ihr ein Geldwesen verpaßt – nämlich daß sie mit erfolgreichem Gelderwerb das mit der staatlichen Geldschöpfung verbindlich antizipierte Wachstum auch wirklich zustandebringt. Die Probleme, denen sie sich mit ihrer trickreich ausgetüftelten „Geldpolitik“ widmen, lassen überdies Rückschlüsse auf den Widerspruch zu, den der bürgerliche Staat mit seinem Geld- und Kreditregime installiert: Um die Stabilität des Geldwerts geht es in all ihren Sorgen um und Vorsorgemaßnahmen für eine – wozu auch immer – passende „Geldmenge“…
Der Leserbrief erwähnt geldpolitische Techniken der Notenbank im Tonfall eines Einwands oder einer dringend notwendigen Ergänzung; zu ihrer Erklärung trägt er freilich nichts bei. Stattdessen lassen die Bemerkungen zum Umfang der „umlaufenden Geldmenge“ eine Vorliebe für den Fehler bürgerlicher Wirtschaftstheorie erkennen, das System der kapitalistischen Konkurrenz und des Kredits als einen sinnreichen und – die nötige Raffinesse vorausgesetzt – manipulierbaren Funktionszusammenhang aufzufassen. Jedenfalls gibt der Leserbrief sich theoretisch damit zufrieden, solche „Zusammenhänge“ wie den zwischen Zentralbankzinsen, Kreditvergabe und Geldmenge namhaft zu machen – als wäre das die notwendige, hinreichende und einzig senkrechte Aufklärung über Geld, Kredit und das staatliche Regime darüber.
e) Immerhin läßt sich so eventuell ein Mißverständnis aufklären, das aus dem Zusammenprall des Interesses unseres Leserbriefschreibers, sich das kapitalistische Wirtschaftsleben als Ensemble funktioneller Bedingungsverhältnisse vorzustellen, mit unserem Artikel entstanden ist. Er stößt auf Seite 197 auf den Satz:
„Indem die Zentralbank die Ersetzung des Geldes durch Banknoten perfekt macht, vollendet sie somit zugleich das kapitalistische Kreditgeschäft in so idealer Weise, daß sie auch dessen ‚Logik‘ gewissermaßen auf den Kopf stellt.“
Es geht an dieser Stelle – um es nochmal mit anderen Worten zu sagen – darum, daß der moderne Staat mit seiner Kreation eines gesetzlichen Zahlungsmittels, das die auf kapitalistischem Wege zusammenverdiente Geld-Ware seiner Gesellschaft definitiv ersetzt, das Kreditgewerbe mit einem praktisch umsonst und beliebig vermehrbaren Kreditmittel ausstattet: mit Zahlungsmitteln, die in keiner Weise mehr durch den akkumulierten Geldschatz der Gesellschaft beschränkt sind; die vielmehr prinzipiell für den Geldbedarf sämtlicher per Kredit anzuschiebenden kapitalistischen Geschäfte reichen; die dabei aber nicht von Annullierung bedroht sind, wenn die kreditierte Profitmacherei mißlingt und auch das Bankgeschäft Verluste zu verbuchen hat. In dem zitierten Satz ist diese Leistung der staatlichen Geldhoheit zu den in die gleiche Richtung gehenden Bemühungen des privaten Bankgeschäfts ins Verhältnis gesetzt: Die Emanzipation vom akkumulierten Geldschatz, die die private Banknote bereits zustandebringt und doch immer noch vom Erfolg der kreditierten Geschäfte abhängig macht, ist nun definitiv; staatliche Geldschöpfung ist die Basis aller kapitalistischen Kreditschöpfung; der nationale Kapitalismus ist damit als Mittel zur erfolgreichen Benutzung und ökonomischen Rechtfertigung des staatlich garantierten Kreditmittels bestimmt. „Vollendet“ und „auf den Kopf gestellt“ ist damit – so unsere Behauptung – das Verhältnis zwischen Kredit- und kreditiertem Geschäft.
Der Leserbriefschreiber hat das alles etwas anders aufgefaßt. Nämlich so, als hätte er bei uns etwa folgenden Satz gelesen:
„Um das Kreditgeschäft in idealer Weise zu vollenden, ist es erforderlich, daß die Geschäftsbanken ihr Buchgeld mittels Barabhebung in Banknoten verwandeln.“
Diese Behauptung läßt er nicht gelten, weil
„das Volumen an Banknoten und Münzen, welches in den Tresoren der Geschäftsbanken verwahrt wird, verschwindend gering (ist) in Relation zu den Buchgeldbeständen bei der Notenbank!“
Die anschließende Versicherung:
„Noch mal. Da das Bargeld in seiner Bedeutung mit dem Buchgeld nicht mithalten kann, stellen die bei den Geschäftsbanken eingelaufenen Bargeldsummen praktisch keine Schranke für das Kreditgeschäft dar.“
stellt endgültig klar: Der Leser hat bei uns so entschlossen nach einer Art Funktionsgleichung zwischen Bargeldvolumen und Kreditmenge gesucht, daß er, statt einer Zurückweisung seines theoretischen Interesses, glatt eine solche entdeckt hat, und zwar eine, die er als falsch zurückweisen möchte. Richtig fände er demgegenüber folgenden problematischen Zusammenhang:
„Nicht die (sc. eingelaufenen Bargeldsummen) sind das Problem, sondern verfügbares Buchgeld.“
Von diesem „Problem“ erfährt man dann, daß es betreut wird:
„Diesem Problem widmet sich die Zentralbank mittels ihrer Geldpolitik. (Wie oben beschrieben)“
Wir lernen also: Nicht bar eingezahlte, sondern unbar verbuchte Geldsummen beschränken das Kreditgeschäft; das ist das Problem; die Staatsbank kümmert sich darum; ihre Geldpolitik bedient sich gewisser Techniken. – Und die Aufklärung sollen wir uns als Einwand zu Herzen nehmen?!
f) Der Leserbrief befaßt sich weiter mit dem Devisenhandel der staatlichen Zentralbanken. Wir haben dieses Thema eigentlich gar nicht behandelt, vielmehr die Leistung erläutern wollen, die der Staat, der das intern, für seine Gesellschaft verbindliche Geld selber schöpft, notwendigerweise erbringen muß, um Zahlungsfähigkeit nach außen, im grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr, zustandezubringen und sicherzustellen: Er muß ein Austauschverhältnis zwischen seinem Geld und den Währungen anderer Nationen herstellen; nicht nur ideell im Vergleich der Maßeinheiten, sondern praktisch durch die Garantie, daß ein in seinem Hoheitsbereich verdienter Geldbetrag auch anderswo abstrakten Reichtum darstellt. Dafür ist genau das nötig, was die Staatsgewalt nach innen durch ihre Geldhoheit ersetzt, nämlich ein Schatz an Geldern anderer: an Devisen, die als kapitalistisch erworbener Reichtum der Nation einer edelmetallischen Geldware gleichkommen; umgekehrt tut auch diese für die Geschäftsfähigkeit der Nation nach außen noch immer ihre Dienste. Aus der Forderung des Staates an sich selbst, dieser Notwendigkeit eines für jede womöglich verlangte Garantieleistung hinreichenden Staatsschatzes zu genügen, macht er einen zusätzlichen Anspruch an die von ihm kreditierte Nationalökonomie, nämlich auf außenwirtschaftlichen Erfolg.
Der Leserbrief konfrontiert uns nun mit der Erkenntnis, das alles könnten wir vergessen; wichtig am Wechselkurs – den ein Geld unseres Erachtens erst mal kriegen muß – sei allein dessen Pflege; die erbrächte dann schon irgendwie die Mittel, mit denen sie bewerkstelligt wird; und wenn sie nichts erbringt, sondern das Erworbene aufzehrt – wie im Fall Südkorea –, so sei das wieder nur dasselbe, nämlich: das Ergebnis von Kurspflege-Politik… Sollen wir den Autor nun darauf aufmerksam machen, daß ein Wechselkurs nur „gepflegt“ werden kann, wenn die Währung als internationales Geschäftsmittel fungiert; daß sie das nur kann, wenn der zuständige Staat bezüglich ihrer Geltung Verbindlichkeiten gegenüber anderen Staaten und der von den Weltwirtschaftsmächten zum Devisenhandel ermächtigten Spekulantenwelt eingeht; daß diese Verbindlichkeiten durch die Verfügung des verantwortlichen Souveräns über einen Devisenschatz beglaubigt sein müssen…? Könnte der Hinweis etwas nützen, daß der Unterschied zwischen der deutschen Bundesbank mit ihren großen und der südkoreanischen Staatsbank mit ihren abhanden gekommenen Devisenreserven nicht darin liegt, daß beide dieselbe Politik treiben; eher schon darin, daß die eine über ganz viel auswärtiges Geld verfügt und die andere nicht…? Vielleicht müssen wir dem Briefschreiber doch allmählich mitteilen, daß er vor lauter Interesse an Techniken des zweckmäßigen Umgangs mit ökonomischen Gegenständen weder von diesen Gegenständen noch von den ihnen einbeschriebenen Zwecken etwas mitkriegt.
Dennoch noch etwas Sachliches a) zu den Verpflichtungen staatlicher Zentralbanken im Allgemeinen: Selbstverständlich haben die die Aufgabe, den Außenwert der Währung zu verteidigen; und zwar durch Rückkauf gegen Devisen – was denn sonst? –; und das gerade dann, wenn dieser Wert angegriffen ist und sinkt, weil sich sonst das Problem gar nicht stellt, daß die Geschäftswelt das nationale Geld in ein besseres umgetauscht haben will. Deswegen verfolgen alle Zentralbanken das Ziel, über genügend Devisen zu verfügen, um Spekulationen abwehren zu können; nötigenfalls leihen sie sich sogar fremdes Geld bei ihresgleichen oder werden beim IWF vorstellig, um jederzeit für den Wert ihrer Währung eine materielle Sicherheit bieten zu können; nach Möglichkeit so überzeugend, daß ihnen der wirkliche Umtausch dann doch gar nicht erst abverlangt wird. Ein wenig anders sieht das b) für die Ausnahme-Nationen aus, deren Währung den Rang eines weltweit benutzten und benötigten Transaktions- und Reservemediums hat. Was den Dollar betrifft, so machen wir es uns bequem und verweisen auf den 2. Teil unseres USA-Artikels in Nummer 3-97. Da steht auch einiges über c) die Dollar-Reserven der deutschen Bundesbank und die Ausnahmesituation, daß da ein Währungsinstitut jahrelang massive spekulative Zuflüsse aus dem „Dollarraum“ zu managen hatte – eine Spekulation auf die D-Mark, die ihr wichtigstes Argument in der aufgrund enormer Exporterfolge notorisch positiven Zahlungsbilanz der BRD und den bei der Zentralbank angesammelten Devisenbeständen hatte. Die Sorgen deutscher Bundesbanker von damals, die quasi an Stelle Amerikas „Kurspflege“ für den Dollar betreiben mußten, hätten Südkoreas Währungshüter heute gern; stattdessen haben sie zur Verteidigung des Außenwerts der Währung, in der der Reichtum ihrer Nation nun einmal sein Maß hat, gegen spekulative Umtauschgeschäfte nichts als Devisen-Schulden aufzubieten – und die noch nicht einmal zur eigenen freien Verfügung. Sie merken jetzt, was es heißt, wenn – Zitat des Leserbriefs aus unserem Aufsatz – ‚staatliche Devisenschulden als Ersatz für einen abhanden gekommenen Staatsschatz fungieren‘ müssen.
g) Was schließlich die „Inflation durch Staatsverschuldung“ betrifft, die den Leserbriefautor am Ende auch noch beschäftigt, so kommt sie nur auf einem Weg zustande: durch Staatsverschuldung. Nämlich dadurch, daß der Staat mit dem Geld, das er selber schöpft, sich selbst kreditiert. Dieses „Rätsel“ erklären wir in unserem Artikel über den Staatshaushalt – und noch einmal gesondert nur auf Nachfrage. Was der Leserbrief von „zweierlei Wegen“ weiß, hat damit nichts zu tun und taugt nicht einmal zur oberflächlichen Beschreibung der kleinsten Teuerungsrate: Wenn der Staat sich Erspartes leiht und damit einkaufen geht, dann gibt es überhaupt keinen Grund, daß er irgendwie zu wenige „Waren und Dienste“ käuflich vorfindet oder auch nur weniger als ein Kapitalist, der für sein Geschäft dasselbe tut. Und aus der Beleihung von Staatspapieren bei der Notenbank folgt tatsächlich nichts weiter, als daß eine Geschäftsbank ihre Staatspapiere beliehen und folglich bei der Zentralbank ein Bargeldguthaben in den Büchern stehen hat.
4.
Zu dem andern Brief.
a) Es ist falsch, der Erinnerung an die Tatsache, daß das Geld moderner Nationen nicht in erworbenen Edelmetallschätzen und auch nicht in deren papierener Repräsentation, sondern in gesetzlich verbindlich gemachten Geldzeichen besteht, die Funktion des Geldes als allgemeines Äquivalent und als Wertmaß wie ein Argument entgegenzuhalten. Den zu erklärenden Gegenstand zu leugnen, kann schwerlich der Auftakt zu einer richtigen Erklärung sein.
Es trifft die Sache auch nicht, in Anlehnung an Marx von „Staatspapiergeld mit Zwangskurs“ zu reden, wenn es ein gesetzlich festgelegtes Kursverhältnis zu einer vorausgesetzten Metallsubstanz des Geldes nicht mehr gibt, die Staatsmacht vielmehr die Unterscheidung zwischen offiziellem Geldzeichen und Geld überhaupt – in ihrem souveränen Zuständigkeitsbereich verbindlich, über diesen hinaus kraft Vereinbarung mit gleichgesinnten Souveränen – annulliert. Statt darauf zu beharren, daß das irgendwie nicht sein könne, hätte sich ein Typ wie Marx jedenfalls, unserer unverbindlichen Einschätzung nach, eher an der Erklärung beteiligt, was die bürgerliche Staatsmacht – sich – leistet, wenn sie sich glatt noch für die „Wertsubstanz“ ihrer Papierzettel als solche verantwortlich erklärt.
b) Es ist verkehrt, Behauptungen zurückzuweisen, die nicht aufgestellt worden sind. Unser Artikel über den Staatshaushalt verwendet etliche Zeilen auf die Darlegung, inwiefern die gesetzlichen Zahlungsmittel, obzwar Banknoten nach dem Muster privater Zahlungsanweisungen, keine bloßen Zahlungsversprechen – „Schuldscheine“ – sind. Und die Behauptung, daß damit „vollendet“ wird, was das private Kreditgewerbe mit der Emission zirkulationsfähiger Zahlungsversprechen betreibt, nämlich die Emanzipation des Kredits vom Geldschatz der Gesellschaft, will immerhin zugleich klarstellen, daß nur der staatliche Gewaltmonopolist diese „Vollendung“ hinkriegt, indem er ein Kreditzeichen zum Bargeld erhebt – womit das Verhältnis zwischen realisiertem Wert und Kredit, auf dem alle kapitalistischen Kreditgeschäfte in letzter Instanz beruhen, „auf den Kopf gestellt“ ist.
Was der Brief zurückweist, ist denn auch weniger ein Argument unseres Artikels als die einzige theoretische Alternative, die sich sein Verfasser zu seiner Auffassung vom Zentralbankgeld als Geldzeichen „mit Zwangskurs“ im Verhältnis zum „richtigen“ Geld, nämlich einer Geldware, vorstellen kann: die „Deutung“ des Staatsgelds als Schuldpapier, das bedingt als Zahlungsmittel akzeptiert wird – als Kreditzettel eben. So – und nur so – ergibt dann auch die Antithese des Briefschreibers, den „ökonomischen Ursprung“ des Zentralbankgelds betreffend – „im Geldumlauf, nicht im Kredit“ –, einen Sinn. Allerdings einen falschen: Wenn das Geld, das in der Gesellschaft zirkuliert, dadurch in die Zirkulation kommt, daß eine staatliche Behörde sich als letztinstanzliches Refinanzierungsinstitut fürs nationale Kreditgewerbe betätigt und ihr Papiergeld als Basis und als unanfechtbar gültiges Geschäftsmittel für sämtliche Kreditoperationen ausleiht, dann hat es seinen „ökonomischen Ursprung“ in eben diesem eigentümlichen Verhältnis: daß der Staat seinen nationalen Kapitalismus kreditiert.
c) Die rhetorisch gemeinte Frage im
dritten Punkt – Wie kann denn das ‚Maß
Gewaltverhältnis‘ Arbeitszeit ausdrücken und
quantifizieren?
– läßt die Vorstellung vom Warenwert,
die der Briefautor unserem Artikel entgegenhält, selber
zweifelhaft erscheinen. Soll man das etwa so verstehen,
daß Geld in Wahrheit der quantifizierende „Ausdruck“ für
Arbeitszeit wäre? „Mark“ und „Dollar“, oder wenn
schon nicht die Maßeinheiten der modernen Papierwährung,
dann jedenfalls die herkömmlichen Gewichtseinheiten des
Edelmetalls – im Grunde lauter Zeitangaben? Ganz
so ist es sicher nicht gemeint – sonst müßten wir glatt
nachfragen, wieso die kapitalistische Wertbestimmung
nicht gleich bei Stunden und Minuten bleibt, und warum,
wenn schon Geldeinheiten die passenden Maße für
Arbeitszeit sein sollen, der GegenStandpunkt mit seinen Unmengen
Besprechungs-, Schreib- und Redaktionszeit, vom
Nachdenken noch ganz abgesehen, bloß 25,– DM kostet,
ein mit viel weniger Aufwand hergestellter VW hingegen
25.000,–… Der Briefautor geht wohl stillschweigend davon
aus, daß wir uns bei „Arbeitszeit“ die kapitalistischen
Bestimmungen der Arbeit – abstrakt, privat,
gesellschaftlich notwendig, durchschnittlich… – schon
hinzudenken werden. Das tun wir auch – und eben deswegen
irritiert uns der Verweis auf die Arbeitszeit als das im
Geld „Ausgedrückte“ ein wenig. Denn gerade diese
Bestimmungen schließen die Vorstellung aus, daß
im Geld nichts weiter als eine unschuldige Zeitbestimmung
gemessen würde. Es ist doch umgekehrt: Durch das Geld,
und das heißt notwendigerweise: durch die
Unterwerfung des gesamten gesellschaftlichen
Lebensprozesses unter die Bedingung des
Gelderwerbs, ist festgelegt und klargestellt,
als was die produktive Tätigkeit in dieser
Gesellschaft bloß zählt – nämlich eben als
Mittel, Tauschwert zu schaffen und damit
Geld zu verdienen. Als Beitrag zum
gesellschaftlichen Reichtum gilt und zählt Arbeit nur,
wenn sie private Arbeit für andere ist;
wenn ihr Produkt sich unter Abstraktion von
jedem Gebrauchswert und jeder aufgewandten Mühe als
Quantum Eigentum darstellt und im Verkauf
bewährt; wenn und soweit sie also einen Eigentumserwerb
zuwegebringt. Deswegen kommt es auf Arbeit einerseits
bloß nach ihrer Menge an, also – es handelt sich ja um
Tätigkeit – nach ihrer Dauer; die abgeleistete
Arbeitszeit bewirkt und nützt andererseits nur soviel,
wie sich an allgemeinem Äquivalent aus ihr herausschlagen
läßt. Dieser verächtliche Umgang mit der verausgabten
Arbeit – als Mittel, von dem ausgerechnet deswegen
nie genug zu kriegen ist, weil es nur so
bedingt und relativ zählt! – ist mit der
wunderbaren Erfindung des Geldes festgeschrieben. Und
dieses Verhältnis läßt sich schlechterdings nicht und nie
wieder in dem Sinne umkehren und „auf die Füße stellen“,
daß die Arbeitszeit, die wirklich – „substanziell“ – in
einem Produkt „drinsteckt“, das Maß dafür vorgäbe, mit
welcher Geldsumme sie korrekt „ausgedrückt“ und folglich
zu vergüten wäre. Die „ökonomische Substanz“,
auf die es beim „marktwirtschaftlich“ produzierten
Reichtum ankommt, besteht gerade in der
Abstraktion von aller produktiven Anstrengung,
die am Produkt selber dingfest zu machen wäre: in deren
Reduktion nämlich auf die im Tausch realisierte
Fähigkeit, damit fremdes Eigentum anzueignen. So erteilt
der Gelderwerb ex post den verbindlichen Bescheid
darüber, wie gesellschaftlich notwendig die geleistete
Arbeit war und wieviel von der aufgewandten Arbeitszeit
gesellschaftlich, d.h. zum Zwecke der Eigentumsvermehrung
überhaupt nötig. Dieser üble Scherz ist das Prinzip der
„gesellschaftlichen Arbeitsteilung“, nämlich der Ein- und
Verteilung der gesellschaftlichen Arbeitszeit in der
„Marktwirtschaft“. – Der Genosse Marx weist darauf
übrigens an einer Stelle seiner Ableitung im 1. Band des
‚Kapital‘ einmal ausdrücklich hin:
„Die Frage, warum das Geld nicht unmittelbar die Arbeitszeit selbst repräsentiert, so daß zum Beispiel eine Papiernote x Arbeitsstunden vorstellt, kommt ganz einfach auf die Frage heraus, warum auf Grundlage der Warenproduktion die Arbeitsprodukte sich als Waren darstellen müssen, denn die Darstellung der Ware schließt ihre Verdopplung in Ware und Geldware ein. Oder warum Privatarbeit nicht als unmittelbar gesellschaftliche Arbeit, als ihr Gegenteil, behandelt werden kann.“ (MEW 23, S.109, Anm. 50)
Fragen wir also lieber zur Verdeutlichung noch einmal andersherum: Was mißt denn das Geld? Ohne Zweifel das, worauf es in der politischen Ökonomie des bürgerlichen Gemeinwesens ankommt; denn vom Geld hängt alles ab, und um seinen Erwerb und seine Vermehrung dreht sich alles. Keine Frage also: Es mißt die „ökonomisch bestimmte Substanz“, das eigentliche Produkt dieser arbeitsamen Gesellschaft. Und das wäre? Ganz ohne allen Streit über die „Arbeitswertlehre“: In seinen Maßeinheiten quantifiziert das Geld die in ihm gegebene private Verfügungsmacht über die Arbeit anderer – private Macht über gesellschaftlich, nämlich in wechselseitiger Abhängigkeit produzierten Reichtum. Dieser Reichtum ist seinerseits, ebenso abstrakt und „eindimensional“, seiner ökonomischen Natur nach als Objekt dieser Zugriffsmacht definiert: gesellschaftliche Produktion, Arbeit für andere, als rein quantitativ bestimmte Verfügungsmasse – von der ausgeschlossen ist, wer zuwenig Geld hat, um sich etwas davon anzueignen; die umgekehrt den, der darüber verfügt, mit entsprechender Verfügungsmacht ausstattet. Produktion für andere, unter Absehung von jedem materiellen Inhalt nur dadurch bestimmt, daß sie stattfindet, und zwar in dem gesellschaftlich notwendigen Umfang – was sich wiederum nach den sachgesetzlichen Interessen der Geldbesitzer bestimmt –, als Quelle und als Objekt privater Verfügungsmacht: Das ist die „ökonomische Substanz“, um die es geht, wenn das Geld das Maß aller Dinge ist. – Und das soll etwas anderes sein als ein vom Staat etabliertes Gewaltverhältnis? Oder genauer: Ausgerechnet im Rahmen dieses politökonomischen Systems, das die Arbeit zum Mittel dafür pervertiert, die Macht über sie zu reproduzieren und zu vergrößern, soll die Arbeitszeit das eigentlich wuchtige ökonomische Ding, die „Substanz“ des gesellschaftlichen Reichtums sein und die Gewalt eine irgendwie außerökonomische Begleiterscheinung?
d) Bleibt im Sinne des Briefschreibers höchstens noch eine Frage: Wenn das Geld dem produktiven Dienst am Eigentum entstammt und auf der anderen Seite das Mittel des Zugriffs auf ein Quantum produzierten Eigentums ist, muß es dann selber ein Produkt dieser Sorte Arbeit sein? Beantwortet ist diese Frage längst, nämlich praktisch: Die Staatsgewalt, die die Herrschaft des Eigentums begründet und seine ökonomische Zugriffsmacht mit dem passenden Mittel ausstattet, hat mittlerweile die Entbehrlichkeit der Produktnatur des Geldes für seine sämtlichen ökonomischen Funktionen, einschließlich der des wirklichen gesellschaftlichen Schatzes, dekretiert und sogar über ihren Machtbereich hinaus mit anderen bürgerlichen Souveränen vereinbart. Ihr Papiergeld hat sie zum Geld der Gesellschaft erklärt und zur Grundlage des Finanzkapitals, darüber des kapitalistischen Geschäfts überhaupt gemacht. Wie perfekt sich durch solches Geld kapitalistisch angewandte Arbeit – und nur solche! – nach der ökonomisch allein entscheidenden Seite ihres eigentumsstiftenden Stattfindens hin „ausdrücken und quantifizieren“, nämlich kommandieren und ausbeuten läßt, ist alltäglich zu besichtigen – an Reichtum und Armut in einem jeden Land, das von lauter arbeitsbedürftigen Figuren bevölkert ist.
5.
Noch ein letztes nachträgliches Wort zum besseren Verständnis unseres Artikels. Dessen Thema sind gar nicht so sehr die – nun also noch einmal erläuterten – Bestimmungen des staatlich durchorganisierten Geldwesens, sondern die Notwendigkeiten, die sich für die Staatsgewalt daraus ergeben – und für die regierte Menschheit aus der Tatsache, daß die Staatsmacht ihre Notwendigkeiten zu Existenzbedingungen ihrer Untertanen macht. Zu diesen Notwendigkeiten gehört der zweckmäßige haushaltspolitische Umgang mit den Konsequenzen der Leistung des modernen Staates, das Geld von jedem Warencharakter zu emanzipieren, es selber gesetzlich zu schaffen, es damit zum Ausgangspunkt seiner Nationalökonomie zu machen, sich selber darin zu verschulden und alle ökonomischen Aktivitäten seiner Gesellschaft damit zu fördern, damit sie seinem Anspruch auf kapitalistischen Erfolg genügen. Daraus folgt nämlich für die Staatsmacht die übergeordnete, gewissermaßen methodische Aufgabe, für ein stabiles Geld zu sorgen – darauf müssen staatskapitalistische Geldfetischisten ja auch erst einmal kommen; und darauf wären sie nie gekommen, wenn sie die selbständige Existenz des Reichtums, um den es geht, nicht selber zu einer so frei und flexibel einsetzbaren, damit allerdings auch so eigenartig instabilen, „weichen“ Angelegenheit gemacht hätten.
Was von unserem Artikel über den Staatshaushalt noch aussteht, ist also die Erklärung der Geld- und Haushalts-Politik, die die bürgerliche Staatsgewalt auf Grundlage des von ihr eingerichteten Geldregimes und seiner Konsequenzen betreibt. Dabei kommen die geldpolitischen Instrumente der Staatsbank, ihre Art, die privaten Kreditinstitute zu betreuen, die politischen Anstrengungen, Preise und Zinsen zu beeinflussen, und dergleichen Schönheiten notgedrungen auch zur Sprache. Freilich nicht, um Detailkenntnisse zur Schau zu stellen und einem erstaunten Publikum mitzuteilen, was es da alles gibt; ihre Informationspolitik sollen die staatlichen Institutionen weiterhin selber betreiben. Auch mit dem Kapitel IV. unseres Aufsatzes kommen unsere Leser nur auf ihre Kosten, wenn sie die Frage mitmachen, warum und wozu es nach aller Wirtschafts-, Sozial- und sonstigen Politik noch eigens eine Geldpolitik gibt, und sich auf den Gegenstand einlassen, um den es da geht.