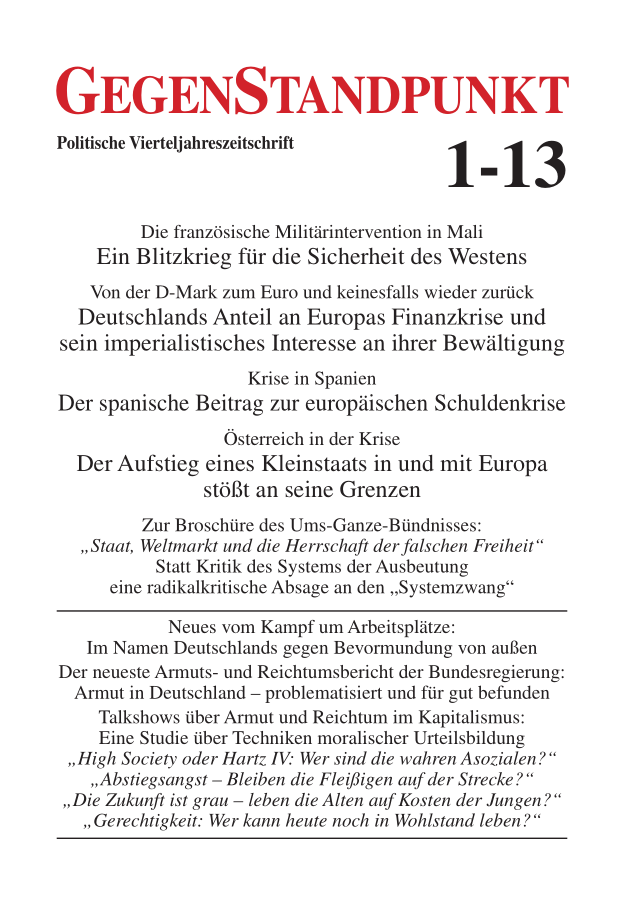Krise in Spanien
Der spanische Beitrag zur europäischen Schuldenkrise
Wann ist es soweit? Wann überwinden die Spanier ihren sprichwörtlichen Stolz und bitten um „rescate“, um Rettung beim europäischen „Rettungsschirm“ ESM? Und welche Konditionen wird man ihnen einräumen? Oder kann die Regierung Rajoy doch den Hilfsantrag vermeiden, wie sie immer wieder behauptet? Das sind die Fragen im Herbst 2012, und das sind sie 2013 immer noch. Spanien ist so überschuldet und die Zinsen für die Refinanzierung der Staatsschuld sind so untragbar geworden, dass ESM und EZB dauernd ihre Bereitschaft zur Unterstützung erklären, selbstverständlich nur im Gegenzug gegen mehr Aufsicht über den spanischen Haushalt und die Einhaltung von europäischen Auflagen für das dortige Finanzgebaren.
Mit der Immobilien-, Banken- und Staatsschuldenkrise hat die Karriere einer hoffnungsvollen Aufsteigernation der EU ein vorläufiges Ende gefunden: in der Entwertung eines gewaltigen Bestandes bis neulich noch mit gutem Gewinn handelbarer Vermögensgegenstände – Häuser aus Beton und Schulden aus Papier – und zugehöriger Kreditportefeuilles nach dem spanischen Bauboom; in Rekord-Arbeitslosigkeit und wachsendem sozialen Elend, nachdem das Kapital am Standort an der Verwendung eines Gutteils der spanischen Arbeitskraft nicht länger interessiert ist; in der Überschuldung von privaten Haushalten, Banken und Staat, der Letztere mit so viel zusätzlichem Staatskredit stützt, dass seine Schulden immer größer und die Zinsen dafür immer teurer werden, weshalb er immer radikaler spart und dennoch zur bislang größten Kundschaft des neuen ESM zu werden droht; und in neu aufflammenden Sezessionsbestrebungen bei den üblichen Verdächtigen in Katalonien und dem Baskenland.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Gliederung
- Spanien und die EU – ein alternativloser imperialistischer Erfolgsweg
- Alles neu beim exfaschistischen Außenseiter – und keine Ruhe nach dem Beitritt
- Das europäische Entwicklungsprojekt lässt Wünsche offen
- Mit „Konvergenz“ gegen den „Entwicklungsrückstand“
- Die Nation übererfüllt sich ihre Wachstumswünsche selbst – Bauen fürs Finanzkapital, bis der Erfolg die Krise kriegt
- Der Staat rettet sein Kreditwesen und handelt sich eine Krise seiner Schulden ein – und das internationale Finanzkapital lernt, seine Euro-Schuldner immer besser zu unterscheiden
- Die Krise eskaliert – der Standort muss sich anpassen
- Spanien verlangt europäische Solidarität – und Respekt vor dem Stolz der Nation
- Spaniens selbstbestimmter Verarmungshaushalt – ein politökonomisches Resozialisierungsprogramm zur Wiederherstellung der Kreditwürdigkeit
- Vom Kampf gegen die ökonomische zur politischen Krise – zentralistische und regionale Nationalisten radikalisieren ihre unvereinbaren Staatsansprüche
Krise in Spanien
Der spanische Beitrag zur europäischen
Schuldenkrise
Wann ist es soweit? Wann überwinden die Spanier ihren
sprichwörtlichen Stolz und bitten um rescate
, um
Rettung beim europäischen „Rettungsschirm“ ESM? Und
welche Konditionen wird man ihnen einräumen? Oder kann
die Regierung Rajoy doch den Hilfsantrag vermeiden, wie
sie immer wieder behauptet? Das sind die Fragen im Herbst
2012, und das sind sie 2013 immer noch. Spanien ist so
überschuldet und die Zinsen für die Refinanzierung der
Staatsschuld sind so untragbar geworden, dass ESM und EZB
dauernd ihre Bereitschaft zur Unterstützung erklären,
selbstverständlich nur im Gegenzug gegen mehr Aufsicht
über den spanischen Haushalt und die Einhaltung von
europäischen Auflagen für das dortige Finanzgebaren.
Mit der Immobilien-, Banken- und Staatsschuldenkrise hat die Karriere einer hoffnungsvollen Aufsteigernation der EU ein vorläufiges Ende gefunden: in der Entwertung eines gewaltigen Bestandes bis neulich noch mit gutem Gewinn handelbarer Vermögensgegenstände – Häuser aus Beton und Schulden aus Papier – und zugehöriger Kreditportefeuilles nach dem spanischen Bauboom; in Rekord-Arbeitslosigkeit und wachsendem sozialen Elend, nachdem das Kapital am Standort an der Verwendung eines Gutteils der spanischen Arbeitskraft nicht länger interessiert ist; in der Überschuldung von privaten Haushalten, Banken und Staat, der Letztere mit so viel zusätzlichem Staatskredit stützt, dass seine Schulden immer größer und die Zinsen dafür immer teurer werden, weshalb er immer radikaler spart und dennoch zur bislang größten Kundschaft des neuen ESM zu werden droht; und in neu aufflammenden Sezessionsbestrebungen bei den üblichen Verdächtigen in Katalonien und dem Baskenland.
Der Staatsschulden will die Regierung mit einem Austeritätsprogramm Herr werden, das die verheerenden Konsequenzen des spanischen Wachstumserfolges der vergangenen Jahre heilen soll. Die damit einhergehende Rezession des BIP-notierten kapitalistischen Reichtums im Land läuft mit nationalem Schuldenstand und Haushaltsdefizit um die Wette, verhindert die Verbesserung des von Euroland geforderten Verhältnisses von Wachstum und Schulden und nötigt die Regierung, obwohl alle nach Wachstum lechzen, zur Fortsetzung ihres rigorosen Sparkurses: „Konsolidierung“ des Schuldenhaushalts soll den Absatz neuer Schuldpapiere zur Erhaltung der aktuellen Zahlungsfähigkeit und die Wiederherstellung unbezweifelbarer künftiger Kreditwürdigkeit auf dem Kapitalmarkt bewirken. In der souveränen Unterwerfung der Gesellschaft und des Staatsapparates unter dieses Diktat sieht die Regierung Spaniens trotz der zerstörerischen Folgen für den Reichtum der Nation und seine Quellen die einzige Möglichkeit, wieder die Herrschaft über das nationale Schicksal zu erlangen, die ohne das Vertrauen der Kreditmärkte nicht zu haben ist, auch wenn dem Land mindestens „zehn verlorene Jahre“ vorausgesagt werden. Dabei hat es schon schwere Zeiten hinter sich gebracht, bevor es sich ein paar Boomjahre lang als Erfolgsmodell europäischer Anschlusspolitik am Südrand der EU bewundern lassen durfte.
Spanien und die EU – ein alternativloser imperialistischer Erfolgsweg
Trotz aller Unzufriedenheiten, die die Krise des
europäischen Kredits beim spanischen Kapital, Staat und
Volk jeweils provoziert, ist bislang keine maßgebliche
Fraktion in Wirtschaft, Politik oder innerhalb der
sozialen Bewegungen des gebeutelten Volkes mit
antieuropäischer, EU-feindlicher Austrittsagitation
hervorgetreten. Die beiden großen Gewerkschaften und ihr
Bündnis mit über hundertfünfzig Grüppchen (Cumbre
Social
– Sozialer Gipfel) beklagen, dass die
konservative Regierung das Land zerstören wolle
,
weshalb man sie aufhalten
müsse, dass man endlich
reale Demokratie jetzt
und außer Bildung
und gerechten Hypotheken
auch eine Zukunft für
die Kinder
– alles Parolen von Großdemonstrationen
des Cumbre Social im September und Oktober –
haben wolle. Und dass man der Politiker-Mannschaft
insgesamt überdrüssig sei: Que se vayan todos!
.
Das alles wird mit Demos und Generalstreiks gefordert,
die nicht als Kampf, sondern von vorneherein als eine
radikalere Form von Bürgerprotest gegen eine säumige
Regierung angelegt sind: Der öffentliche Aufruhr stellt
weder die spanische Demokratie in Frage – die
Demonstranten haben ja nur von deren Führungspersonal so
ausdrücklich die Schnauze voll – noch den
kapitalistischen Weg Spaniens in und mit der EU. Und die
separatistischen Parteien in Katalonien und Baskenland,
von denen noch zu reden ist, wollen auch als unabhängige
Staaten unbedingt in der EU verbleiben und den Euro
behalten.
Von den Zentralregierungen in Madrid, gleich welcher politischen Couleur, wurde Spaniens Mitgliedschaft in der EU ohnehin stets als alternativloser Erfolgsweg der Nation behandelt, auch wenn der das Land schon vor dem heutigen Schadensfall einiges gekostet hat. Und daran hält Madrid nach wie vor fest und damit an dem nationalen Programm, in und vermittels des vereinten Europa Spanien endlich (wieder) den ihm gebührenden Platz in der Welt zu verschaffen. Dieses Ziel schien den demokratischen Kräften des Landes nach Franco erreichbar und jede Anstrengung der Nation wert. Dabei setzten sie mit ihren Ambitionen, in die Führungsriege Europas und damit als Mitspieler in den Kreis der wichtigen Staaten der Welt aufzusteigen, auf die Bereitschaft der schon zur EG vereinten Staaten, sich um Spanien als wichtiges Land zu erweitern. Spaniens Aufstiegswille in Europa und der imperialistische Expansionsdrang der Führungsmächte des Vereinten Europa trafen sich also im Projekt des Anschlusses Spaniens an Europa.
Dass die Zusammenkunft des großen Spanien mit dem unter Führung von Deutschland und Frankreich expandierenden demokratischen Europa ausschließlich nach den Regeln der EG ausgestaltet wurde, die Spanien durch die gründliche Umwandlung des ganzen Landes zu erfüllen hatte, ließ dessen Führer aus wechselnden Parteien nie ernsthaft an ihrem großen Fortschrittsprojekt zweifeln. Schließlich entsprach es ihren Vorstellungen, dass ihre Nation politisch und ökonomisch die Hinterlassenschaft des Faschismus abschütteln musste, dass also Spanien sich ändern, ‚modernisieren‘ musste, damit es mitbestimmender Teil einer zukünftigen europäischen Großmacht werden konnte.
Alles neu beim exfaschistischen Außenseiter – und keine Ruhe nach dem Beitritt
Für die demokratischen Kräfte Spaniens, die schon im Untergrund vor dem Ende des Franco-Faschismus mit einiger Förderung und intensiver Betreuung seitens der jeweiligen Schwesterparteien in Westeuropa auf ihre Zukunft „in Europa“ hinorientiert wurden, war also klar, dass ein nachfranquistisches, demokratisch-kapitalistisches Spanien nur innerhalb der damaligen EG zu einem erfolgreichen Kapitalstandort und zur ökonomischen Basis eines politischen Subjektes mit weltweit anerkannten Macht- und Rechtsansprüchen werden konnte. Das Land, wegen seines falschen Regierungssystems von den Wiederaufbau-Krediten des Marshall-Plans ausgeschlossen, war ja nicht nur politisch zu Lebzeiten Francos in einer Außenseiterposition, auch wenn es von Seiten der USA und der NATO Wohlwollen als antikommunistisches Bollwerk genoss. Die faschistische Führung hatte sich auch ökonomisch nach dem Bürgerkrieg eine eigenständige Grundlage für ihr Regime zurechtorganisiert und sich auch nach dem zweiten Weltkrieg nicht vorrangig an den Ansprüchen und Gegebenheiten des freien Weltmarkts orientiert, wie ihn die USA eingerichtet hatten: Unter der Regie staatlicher Industrieholding-Institute (das größte und wichtigste, das Instituto Nacional de Industria – INI) wurden im Land mit staatlichem Kredit und unter Anwendung einer streng und billig gehaltenen Arbeiterklasse Betriebe der Grundlagenindustrie von beachtlicher Größe aufgebaut.[1] Im Bergbau und der Stahlindustrie, in der Werftindustrie, im Fahrzeugbau, im Bereich der Fischfangflotte, der Energieerzeugung oder der Telekommunikation, bei Chemie und Rüstung erreichten manche von ihnen weltmarktfähige Größe, ebenso wie im Bereich der mit Niedriglohn konkurrierenden Leichtindustrie (Textil und Schuhe z.B.) und in der Landwirtschaft (v.a. Olivenöl, Obst, Gemüse). Ausländische Beteiligungen an ihnen oder der konkurrierende Zugang zu den von ihnen bedienten spanischen Inlandsmärkten für die europäischen Kapitale, die sich ab den 60er Jahren in einigen dieser Bereiche schon in eine eigene Überakkumulation hineinkonkurriert hatten, waren nicht zugelassen. Waren Betriebe nicht rentabel, wurden sie unter politischen Gesichtspunkten des nationalen Bedarfs und der Benützung der nationalen Arbeitskraft von den staatlichen Holdings übernommen, um sie fortzuführen oder später wieder zu privatisieren. Diese auf Erhaltung und Pflege einer nationalkapitalistischen Wirtschaftsbasis ausgerichtete Politik hatte in den Grundzügen bis in die 70er Jahre Gültigkeit.
Deren Ergebnisse nahmen sich vom Standpunkt des expansionswilligen EG-Kapitals und seiner politischen Agenten vielversprechend und störend zugleich aus.[2]) Der Druck der EG, den sie schon Mitte der 70er Jahre, noch vor den 1979 offiziell begonnenen und mit dem Beitritt 1986 beendeten Beitrittsverhandlungen aufbaute, zielte deshalb von Anfang an auf die Öffnung der spanischen Märkte für das europäische Kapital, also darauf, die nationale, protektionistische Organisation der spanischen Märkte aufzubrechen und Spaniens Ökonomie den Regeln des europäischen Marktes mit seiner Kapitalfreiheit zu unterwerfen. Das hieß für den spanischen Standort zunächst einmal, sich schon im Vorfeld des EG-Anschlusses mittels der Schließung von Produktionsstätten, insbesondere im Bereich der von Quoten regierten Märkte des Montan-Bereiches [3]), aber auch der Werft- oder der Fischereiindustrie auch gegen den Widerstand der betroffenen Belegschaften überhaupt „beitrittsfähig“ zu machen, ohne dafür gleich Kompensationen in Form von Marktöffnungen für eigene Exporte zu erhalten. Umgekehrt öffnete Spanien schon in den Jahren der Vorbereitung des Beitrittes die Grenzen für die Waren aus dem EG-Raum, mit der Folge, dass ein umfangreicher Teil auch kleinerer Unternehmen, die bislang die Kaufkraft des inneren Marktes exklusiv für sich genutzt hatten, ruiniert wurde.
Den demokratischen Nachfolgern des 1975 verstorbenen Franco leuchtete das alles offenbar als unumgänglicher Preis ihrer europäischen Modernisierung ein, deren Notwendigkeit ihnen zusätzlich durch eine Wirtschaftskrise Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre im Gefolge stark gestiegener Ölpreise vor Augen geführt wurde. Die mit Löhnen weit unterhalb des spanischen Niedriglohns und viel Staatskredit immer produktivere Konkurrenz der japanischen und koreanischen Werften machte den nordspanischen und andalusischen Betrieben das Leben schwer und bestätigte das europäische Urteil über die Überflüssigkeit des spanischen Schiffsbaus ebenso wie die billigere amerikanische Kohle das über die Bergwerke in Asturien und anderswo; zumal der Schuldenstand der vormals rettenden Staatsholdings für nicht mehr tragbar erklärt wurde und überhaupt die Erhaltung nicht mehr konkurrenzfähiger nationaler Industrien in allen Bereichen, in denen Überkapazitäten zum Abbau anstanden, als „Verzögerung notwendiger Strukturanpassungen“ galt, die der Politik der EG zuwiderlief.
Im „Pakt von Moncloa“ sollte schon 1977 – noch vor dem Inkrafttreten einer neuen Verfassung – mit Unterstützung der Gewerkschaften zwischen Regierung, Parteien und Unternehmen u.a. mittels einer Vereinbarung über einen möglichst schlanken Sozialstaat neuer demokratischer Prägung mit möglichst geringen Kosten für die Unternehmen Vorsorge für den neuspanischen Kapitalismus an der Front der Lohnkosten getroffen werden: Die dort ausgehandelte Begrenzung der Sozialausgaben der Betriebe und des Lohnanstiegs auf die Inflationsrate betrachteten aber offenbar weder die spanischen noch die jetzt auch vermehrt ausländischen Unternehmen in Spanien als Sonderangebot, bei einer Inflationsrate von 26,3 % im Jahr 1977 die Arbeitsbevölkerung flächendeckend für ihre Geschäfte zu benützen, so dass Anfang der 80er 22 bis 25 % der Arbeitsfähigen beschäftigungslos waren.
Die Betreuung der Arbeiterschaft, die nun mit den Kosten der Befreiung von ihrer armseligen korporativ-faschistischen Beschäftigungssicherung konfrontiert wurde, übernahm der neue Sozialstaat, der für alle bekannten Schadensfälle des nun freiheitlich-kapitalistischen Wirtschaftens die einschlägigen Sozialversicherungssparten einrichtete und darauf achtete, die Bemessungsgrundlagen und damit die Beiträge und Leistungen bei Arbeitslosen-, Renten- und Unfallversicherung konsequent auf ein konkurrenzfähiges nationales Niedriglohn-Niveau auszurichten. Die öffentliche Gesundheitsfürsorge mit ihrem Ärzte-, Pharma- und Klinikwesen war auch auf dem angestrebten bescheidenen Niveau so kostspielig, dass ihre Finanzierung durch Zwangsbeiträge von den Bruttolöhnen diese auf unerwünschte Weise gesteigert hätte. Deshalb wurde mit dem Ley General de Sanidad von 1986 das Gesundheitswesen zur steuerfinanzierten Staatsaufgabe erklärt und den Comunidades Autónomas, den regionalen Autoritäten, zum Vollzug überlassen. So wurde auch in Spanien der demokratisch-sozialstaatliche Wohlfahrtsstaat – el Estado de Bienestar – zur Pflege der rentablen Armut lohnarbeitender Massen ins Werk gesetzt, mit dessen kostengünstiger Ausgestaltung in ganz Europa um die Konkurrenzfähigkeit an der Front der Lohnnebenkosten gerungen wird.
Von der Seite der Arbeitsgesetzgebung wurde beizeiten dafür gesorgt, dass Investoren die den speziellen Umständen des spanischen Arbeitsmarktes entsprechenden Rechtsformen vorfanden: Saisonverträge für Landwirtschaft und Tourismus, befristete Arbeitsverträge für den Bausektor und andere interessierte Sparten und die Fortschreibung des alten Mindestlohns als offiziell definiertes, auch moralisch akzeptables (Über)Lebensniveau drängten unbefristete Arbeitsverhältnisse immer mehr zurück und machten „prekäre“ Einkommen zum bis heute, in der Krise mehr denn je, überhandnehmenden Normalfall. Zusätzlichen Druck auf die Löhne übte stets das Heer der halb und ganz illegalen Immigranten aus.
In die Zeit der Gonzalez-Regierung (seit 1982) und ihrer Nachfolger nach dem Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft 1986 fiel die endgültige Zerschlagung der „alten Industrie“ Spaniens. Für die Stahl- und Kohle-Industrie galten nun die Quoten der EG, mit denen die ohnehin herrschende Überproduktion in dem Sektor geregelt und der entsprechende Abbau der Belegschaften vorangebracht wurde;[4] zusätzliche Erschwernisse existierten für Spanien in Form von jahrelangen Exportbeschränkungen in die EG, die solange galten, wie die gemeinschaftskonforme Industriereform noch nicht vollständig verwirklicht war. Ähnlich erging es der spanischen Landwirtschaft, deren Produkte auf Betreiben der französischen Konkurrenz, die jahrelang gedroht hatte, wegen der Landwirtschaftsfrage den spanischen Beitritt scheitern zu lassen, noch fast ein Jahrzehnt vom gemeinsamen Markt ausgeschlossen wurden. An die 200 Staatsunternehmen und mehrere 100 Tochterunternehmen aus dem Bestand der INI wurden privatisiert oder verkauft oder, soweit sich keine Käufer fanden, geschlossen. Damit sollten nach den Regeln der EG der Einfluss des spanischen Staates in der Wirtschaft zurückgefahren und europäischem Kapital lohnende Investitionen in den neuen Standort ermöglicht werden – und auf diese Weise das Land, so die spanische Berechnung, nach den schweren Verlusten bei den traditionellen Industrien mit ausländischer Kapitalhilfe und Unterstützung durch die EU-Fonds endlich mit modernen Reichtumsquellen bestückt werden.
Das europäische Entwicklungsprojekt lässt Wünsche offen
Das hat zum Teil funktioniert. Die spanische Staatsmacht hat viel dafür aufgewendet, im Zuge der postfranquistischen Aufholjagd auf die Gründungsstaaten der EG das Land gewaltig umzupflügen, um es als Teilhaber des gemeinsamen Marktes zu einem wichtigen Subjekt des Weltkapitalismus und der Weltpolitik zu machen. Die Veränderung der alten Lebensverhältnisse der Bevölkerung durch die Umwälzung der Ökonomie im Dienste des Aufbaus eines modernen spanisch-europäischen Investitionsstandortes war aber eben nur die halbe Miete. Die alte INI wurde mit ihrem Firmenbestand dann doch nicht, wie es sich deren staatliche Manager vorgestellt hatten, zum organisatorischen Zentrum eines neuen spanischen Kapitalismus,[5] sondern 1995 endgültig geschlossen und durch eine neue Gesellschaft abgelöst, die nur mehr die verbliebenen Kapitalbeteiligungen der öffentlichen Hand verwaltet. Europäische und internationale Investoren sicherten sich bei der Nutzung der neu eröffneten Geschäftsgelegenheiten aus dem Bestand der spanischen Unternehmen das, was sie brauchen konnten, und entwickelten in der Zukunft ihre Geschäfte durchaus ohne Rücksicht auf den spanischen Standort: Das große, ehemals staatliche Energieunternehmen ENDESA etwa, wichtigster Energieversorger in Spanien, hat seinen Geschäftsschwerpunkt inzwischen in Südamerika und ist mittlerweile mehrheitlich in italienischer Hand; Ähnliches gilt für die ehemals staatlichen Erdölunternehmungen, die in der Repsol AG privatisiert wurden und jetzt ebenfalls ihre Hauptgeschäfte in Lateinamerika und ganz Südeuropa machen; die Reste der Stahlindustrie gehören zum indischen Mittal-Konzern, der seine Werke auf der ganzen Welt um die günstigste Erledigung der zu verteilenden Aufträge konkurrieren lässt; SEAT, eine INI-Gründung von 1951, ist seit 1986 eine Filiale des VW-Konzerns, für den der spanische Standort im Lauf der Jahrzehnte schon mehrmals im Rahmen seiner weltweiten Produktions- und Absatzstrategie zur Disposition stand. Die internationale Autoindustrie (VW, Ford, Renault, Nissan u.a.) wie alle anderen zugewanderten Investoren nutzten durchaus die Förder- und Steuersparangebote der spanischen Regierungen und die trotz der nominellen Lohnsteigerungen infolge des Moncloa-Vertrages immer noch vergleichsweise günstigen Preise der Arbeitskraft [6] beim Aufkauf spanischer Industrieunternehmen oder für Neugründungen. Dazu, aus Spanien eine Exportnation zu machen, die mit dem auf ihrem Boden stattfindenden und von ihm ausgehenden Geschäft ihren Kredit rechtfertigt und vermehrt und so ihre ökonomische Basis und die darauf gegründete politische Macht stärkt, hat es nach der europaorientierten Zerlegung der alten Ökonomie aber nie so richtig gereicht. Nach den statistischen Index-Kurven über die monatlichen Defizite in der Außenhandelsbilanz des Landes, die das Archiv des Banco de Espana für historisch Interessierte anbietet, hat Spanien von 1962 bis heute keinen einzigen monatlichen Exportüberschuss erzielt.[7]
Mit „Konvergenz“ gegen den „Entwicklungsrückstand“
Was den Bestand an exportfähiger Industrie am spanischen
Standort überhaupt betrifft, so entdeckt der
Industriekommissar der EU, Antonio Tajani, heute, nachdem
in der Krise nun Teile der Bauindustrie zusammengebrochen
sind, die zehn Jahre lang die Hauptstütze der
spanischen Wirtschaft
(FTD,
31.10.2012) war und zeitweise bis zu 20 % des BIP
erwirtschaftete, im Rückblick Fatales: Neben der
fehlenden Konkurrenzfähigkeit
sieht er als
schwerwiegendsten Mangel der nationalen
Industriepolitik
die Zerstörung des industriellen
Geflechtes
in Spanien, die dringend eine
Reindustrialisierung
(El
Pais, 9.10.2012) des Landes nötig mache.
Die Erkenntnis des Kommissars, Spanien habe sein
Wachstum auf falsches Manna (gemeint ist das des
Baubooms) gegründet
, ist eine Schlaumeierei ex post:
An einem kapitalistischen Wachstum, das wächst, egal
worauf gegründet, würde auch er nicht viel Falsches
finden. Schließlich wird es zum verkehrten Manna ja erst,
wenn es aufhört. Von diesem Zustand war Spanien nach der
Erfüllung der Beitrittsauflagen weit entfernt, vielmehr
musste die Akkumulation am Standort überhaupt erst wieder
auf neuer Grundlage richtig in Gang gebracht werden. Es
lag allerdings auf der Hand, dass das Land mit der
Finanzierung seines Status als florierendes
Entwicklungsprojekt der sich in Richtung Süden
arrondierenden EG überfordert war. Spanien, ein
europäischer Hoffnungsträger imperialistischer
Spekulationen auch im Hinblick auf die
lateinamerikanischen Märkte und die nordafrikanische
Gegenküste, konnte sich die Herstellung eines
konkurrenzfähig modernisierten, florierenden EG-Standorts
gar nicht aus eigenen Mitteln leisten. Die Entblößung des
Landes von wichtigen Teilen seiner hergebrachten
Reichtumsquellen und seine selektive Erschließung durch
ausländisches Kapital taugten nicht dafür, den Standort
zur tauglichen Basis für die anspruchsvollen Ambitionen
der neuen Demokratie und der in der EG vereinten
europäischen Nationen zu machen und spielten dem
spanischen Staat längst nicht die für seine einschlägigen
Entwicklungsbedürfnisse nötigen Mittel ein.
Dieses Ungenügen war der Ausgangspunkt der Förderung
durch die europäischen „Kohäsions-“, „Regional-“ oder
„Sozialfonds“, deren Vorformen schon lange vor Spaniens
Beitritt in den 60er Jahren für die Abwicklung und
Umwandlung der Landwirtschaft in „strukturschwachen
Gebieten“ erfunden wurden. Die Zerschlagung der alten
produktiven Basis Spaniens und der Zugriff des
europäischen Geschäfts auf den spanischen Markt und seine
Kaufkraft fixierten ja den Konkurrenzunterschied zwischen
dem Neumitglied und den kapitalmächtigen Standorten oder
vergrößerten ihn weiter, anstatt ihn verschwinden zu
lassen. Mit den Mitteln der Fonds wurde die Verbesserung
der nationalen Geschäftsbedingungen für künftige
Investoren v.a. auf dem Feld der „Infrastruktur“
angegangen und darauf gesetzt, dass sich die Vorteile der
überlegenen europäischen Kapitale auf dem jetzt frei
zugänglichen Markt schon irgendwann ausgleichen würden,
wenn man nur die Voraussetzungen der privaten
Bereicherung für alle Interessenten, die inländischen wie
die ausländischen, entwickelte. Um diese Erwartung in
zukunftsorientierte Politik umzusetzen, wurden also über
die Jahre zwei- bis dreistellige Milliardenbeträge
mobilisiert, zur Unterstützung von Maßnahmen, die
unter das Ziel ‚Konvergenz‘ fallen. Dieses Ziel besteht
in der Beschleunigung der Konvergenz der Mitgliedsstaaten
und Regionen mit den größten Entwicklungsrückständen
durch die Verbesserung der Voraussetzungen für Wachstum
und Beschäftigung.
(Aus der
Zusammenfassung
vor dem Verordnungstext für die
dritte Förderungsperiode des
Kohäsionsfonds) [8]
Und weil als besonders förderungswürdig die Finanzierung
in den Bereichen Umwelt und transeuropäische
Verkehrsnetze
(Vorbemerkung zur
Europäischen Verordnung über den Kohäsionsfonds)
galt, die Fonds bis zu 85 % der Projektkosten übernahmen
und der Restkredit bei gesunkenen Kreditzinsen für das
neue EG-Mitglied billig zu haben war, wurde das Land erst
einmal mit sehr vielen Straßen, großen Eisenbahnlinien
und allerlei Häfen, Flughäfen und Flughafenerweiterungen
vollgestellt. An den Küsten erledigte das Aufbauwerk die
aufblühende Tourismus-Industrie mit immer mehr und
größeren Hotelkomplexen und Feriensiedlungen und begann
vorzuexerzieren, wie man im Urlaubsgeschäft mit dem Ziel,
schöne Landschaft zu Geld zu machen, die schönen
Landschaften ruinieren kann. Das summierte sich, alles in
allem, zu schönen Wachstumszahlen,[9] gab der Bauindustrie einen
kräftigen Schub und auch der inländischen öffentlichen
und privaten Bankenwelt, die die Abwicklung der
Finanzierungen übernahm, etwas zu verdienen.
Die Nation übererfüllt sich ihre Wachstumswünsche selbst – Bauen fürs Finanzkapital, bis der Erfolg die Krise kriegt
Dass das europäische Kapital die spanischen Angebote, aus dem regierungsseitig zurechtgemachten Land und seinen billigen Arbeitskräften das erwünschte Wachstum zu schlagen, trotz zahlreicher Teilerfolge[10], dann doch nicht im erwarteten Ausmaß wahrgenommen hat, hat die politischen Organisatoren des Standorts nie entmutigt. Sie haben ihren Status als europäisches Entwicklungsprojekt und ihre Einbindung in den Eurokredit und die internationalen Kreditmärkte als Gelegenheit genutzt, sich mit deren Hilfe ihren Aufschwung zur EU-Wirtschaftsmacht einfach selbst zu machen.
In der zweiten Hälfte der 90er Jahre erschloss die konservative PP-Regierung Aznar den finanziell notleidenden Gemeinden durch eine Reform des Bodenrechts eine neue Einnahmequelle: Die Gemeinden durften fortan in einem vereinfachten Verfahren weitgehend eigenständig ihren Boden als Bauland ausweisen und vermarkten. Davon machten sie ausgiebig Gebrauch, vervielfachten in Rekordzeit die bebaubare Fläche und sanierten ihre kommunalen Haushalte; das richtige Abstimmungsverhalten im Sinn eines Investors machte nebenbei sehr viele Stadträte und örtliche Parteigliederungen reich.[11]
Die Maßnahme wurde darüber hinaus als politische Wohltat
für die Massen der bau- und kaufwilligen Spanier verkauft
– traditionell ca. 85 % Eigentümer ohne
„Mietkultur“[12] (n-tv.de,
17.5.2010) –, die trotz niedriger und unsicherer
Einkommen auf der Suche nach billigen Eigentumswohnungen
waren, oder, wenn man es sich wegen besserer
Einkommenslage zutraute, auf der Suche nach einer
Ferienwohnung am Meer – ein „Marktsegment“, das auch
ausländische Käufer in Scharen in die explodierenden
urbanizaciones
zog. Vor allem aber war die
politische Maßnahme der Regierung Aznar ein Angebot an
das Bau- und Bankkapital: Das kaufte in Massen das neue
Bauland auf, gründete selbst oder finanzierte mit seinem
Kredit eine Unzahl neu entstehender
Immobiliengesellschaften, die sich wiederum zusammen mit
Baufirmen, Bauträgern und Maklerorganisationen auf die
Planung, Erstellung und Vermarktung von Bauprojekten
warfen.
Die Zinsen waren in der EU günstig für das Geschäft und
ab der Einführung des Euro – 1999 als Buchgeld, 2002 als
Bargeld – erst einmal sinkend:[13] Das spanische Bankensystem
und der spanische Staat waren mit der Einführung des Euro
in den Augen der weltweiten Schuldenhändler, Kreditgeber
und Anleger so kreditwürdig, dass man Anlage suchendes
Geldkapital für dortige Geschäfte gerne verfügbar machte.
Der gemeinsame Kredit des gesamten Euroraums galt als
gleichermaßen sicher, die Vorschriften des
Maastricht-Vertrages stifteten Vertrauen in seine
Solidität und ließen keine Zweifel daran aufkommen, dass
Spanien wie jeder Eurostaat mit Finanzierungswünschen
seinen Kredit nach Menge und Qualität verdiente. Die
Konkurrenz des Finanzkapitals um solch verlässliche
Kundschaft drückte die Zinsen und verschaffte damit allen
engagierten Geschäftemachern jede Menge billigen Kredit
in- und ausländischer Herkunft, der für eine Expansion
des Immobilienmarktes mit steigenden Preisen und das
boomende Wachstum sorgte, das jetzt im Nachhinein, nach
dem Zusammenbruch der dergestalt angetriebenen
Überakkumulation, als dramatische Fehlallokation
gegeißelt wird.[14]
Auf dieser Grundlage machten die Anbieter von Hypothekendarlehen auch der Masse der überwiegend gar nicht gut betuchten Kaufinteressenten mit reichlich Kredit zu niedrigen Zinsen Mut. Die galoppierenden Immobilienpreise mussten keinen armen Mann vom Kauf abschrecken: Hatte er erst einmal eine Immobilie gekauft, wurde er ja auf dem Papier immer reicher. Damit er den Kauf überhaupt realisieren konnte, boten die Kreditinstitute Ratensenkung durch Laufzeitverlängerung an, bis zu Rekordlaufzeiten von 50 Jahren, in denen die Käufer mit den Zinsen die Wohnung gleich ein zweites Mal kauften, wie eine Vereinigung aufgeweckter Bankkunden ausrechnete. Der staatlichen Vorschrift, Hypothekenkredite auf 80 % des Grundstückswertes zu begrenzen, begegneten die findigen Verkäufer durch fiktive Höherbewertungen der Kaufobjekte bis zu 120 % des wirklich bezahlten Kaufpreises, so dass auch ein Kredit in Höhe von 80 % dieses fiktiven Marktwertes halbwegs für einen Kauf ganz ohne Eigenkapital reichte. So wurde die gesetzliche Restriktion als Vermarktungshindernis für Baukredite abgeräumt, ohne dass sich einer der Beteiligten Sorgen machen musste: Der boomende Markt berechtigte ja zu der schönen Hoffnung, dass er vielleicht schon nächste Woche den überhöhten Eintrag im Wertgutachten über das gehandelte Grundstück wahr machen könnte. Das Verfahren vermehrte zudem das Volumen des umgeschlagenen Kredits, bescherte dem Kreditgeber ein auf dem Papier höherwertiges Pfand in den Büchern und minderte die staatlich geforderten Rückstellungen – verschlechterte allerdings auch das Verhältnis von Kreditsumme und aktuell erzielbarem Wert des Pfandes. Zunächst aber freute das alles die Bank, zumal sie sich zu Lasten des Käufers völlig vom Risiko steigender Zinsen während der langen Laufzeiten befreien konnte: Das erlaubte die landesübliche, in anderen Ländern teils unübliche, teils verbotene Geschäftssitte, Hauskredite ausschließlich mit variablem Zins – meist Euribor (Interbanken-Zins) + ca. 1 % – zu vergeben, welch schöner Brauch allerdings die ohnehin wegen niedriger und unsicherer Einkommen wackligen Kreditverhältnisse für den Fall von Zinserhöhungen extrem prekär machte.
Die PP-Regierungen, die den Boom auf politischer Seite
angestoßen hatten, waren auch auf der Seite des Geschäfts
gut vertreten: Die Führung der größten öffentlichen
Banken, dem deutschen Sparkassensystem vergleichbar, lag
in den Händen der Partei, so dass die bis zu ihrer Fusion
zur Bankia größten, caja Madrid und
Bancaja, als caja de ahorros del PP
–
Sparkasse der PP – (El Pais, 10.5.2012) galten. Die
öffentlichen Banken schoben den rasanten Aufschwung der
neuen spanischen „Schlüsselindustrien“ Bau und Kredit im
Dienst von Wachstum und Arbeitsplätzen kräftig an. Sie
wollten das Kreditgeschäft nicht den großen Privatbanken
überlassen, die ohnehin gut im Rennen waren, nutzten ihre
flächendeckende Präsenz im Land und zogen einen großen
Anteil der florierenden Finanzierung an sich. Die brachte
die Baukonjunktur im Lauf weniger Jahre so in Schwung,
dass große Teile der brachliegenden spanischen
Arbeitskraft von ihr absorbiert wurden (bis 2007 ein
Rückgang auf ca. 8 % Arbeitslosigkeit) und Europa und die
Welt respektvoll vor der spanischen Erfolgsgeschichte
standen, ungeachtet pessimistischer „Marktbeobachter“,
die ab 2006 anfingen, vor dem „Platzen der Blase“ zu
warnen. Die Betreiber und Profiteure des Geschäfts ließ
der eigene Erfolg erst einmal auf dessen Fortschreibung
spekulieren. Sie kreierten schließlich selbst mit ihrem
Boom aus den Reihen der neu in Arbeit Gekommenen und all
jener, die von deren neu erworbener, bescheidener
Kaufkraft profitierten, ihre künftige neue Kundschaft.
Der dienten sie ihren sagenhaft günstigen Kredit auch für
Zweit- und Drittwohnungen an der Küste, zur
Alterssicherung oder einfach – angesichts der steigenden
Preise – für ein lohnendes, zukunftssicheres Investment
an. So verwandelte sich das Bedürfnis des Baugeschäfts
nach mehr Kredit für sein immer schnelleres Wachstum
zügig in das Bedürfnis des Kreditgeschäfts nach noch mehr
Bauten, mittels derer angesichts des Umsatzes auf dem
Wohnungsmarkt – in Spanien sind Wohnungen so liquide
wie Wertpapiere
, bemerkte der Wirtschaftsteil des El
Pais auf dem Höhepunkt der Spekulation 2007 – neu
bereitgestellter Kredit in prinzipiell jeder Höhe zu
verwerten war. Um diesen drängenden Bedarf des
Bankkapitals zu decken, lief die Bauindustrie zu Hochform
auf und stellte in den Rekordjahren im Auftrag ihrer
vielfältigen Kreditagenturen so viele Neubauten auf
spanischen Boden wie ihre Branchenkollegen in
Deutschland, Frankreich und England zusammen; jetzt nicht
mehr zur Bedienung einer irgendwie bekannten oder
vermuteten Nachfrage, sondern im spekulativen Vertrauen
darauf, dass sich der angewendete Kredit durch den
Verkauf auf einem garantiert boomenden Markt mit
entsprechend steigenden Preisen in jedem Fall bewähren
werde.
Insgesamt sog sich die spanische Bankenwelt mit Kredit
aus aller Welt voll: Die privaten Großbanken, allen voran
Santander und BBVA entwickelten sich zu
weltweit tätigen Schuldenmonstern, die im Ausland
aggressiv expandierten
(FTD,
26.10.2012), in Brasilien, Chile oder Mexiko, aber
auch in Deutschland und Großbritannien mitmischen und es
inzwischen auf die Liste der 28 global
systemrelevanten Banken
geschafft haben, die man
keinesfalls pleite gehen lassen dürfe. (SZ,
3./4.11.2012). Die Banken des caja-Systems
warfen sich hauptsächlich auf das Inland und seinen
Immobilienmarkt als ihre wichtigste Wachstumsquelle. Sie
begannen schon in den Jahren vor dem Ende des Booms und
erst recht danach einen landesweiten Fusionsprozess, um
mit immer höheren Bilanzsummen ihre Bonität gegenüber
wachsenden Zweifeln an der Werthaltigkeit ihrer – später
als toxisch
verrufenen – Aktiva zu garantieren.
Die spanischen Baufirmen erreichten im
nationalen Aufschwung wie die Banken internationales
Format, und die wenigen, die bislang die Krise
überstanden haben, bauen inzwischen weltweit Häfen,
Autobahnen, Eisenbahnen, Schifffahrtskanäle und Flughäfen
und kaufen bisweilen sogar altdeutsche
Traditionsbaukonzerne wie die Firma Hochtief AG auf,
nicht zuletzt, wie mitgeteilt wird, um die Last ihrer
vielen Schulden durch weitere Expansion tragen zu können.
(vgl. El Pais, 28.10.12)
Der Staat rettet sein Kreditwesen und handelt sich eine Krise seiner Schulden ein – und das internationale Finanzkapital lernt, seine Euro-Schuldner immer besser zu unterscheiden
Als im Sommer 2007, noch ein Jahr vor der Lehman-Pleite,
in den USA schon wieder ein großer Immobilienfinanzierer
zusammenbricht, französische und deutsche Banken die
ersten ABS-Fonds auf amerikanische Papiere schließen und
die EZB dem europäischen Bankensystem 95 Milliarden Euro
Liquidität spendiert, um eine Panik zu vermeiden
(telepolis, 10.8.2007),
wachsen in einem Umfeld erhöhter Unsicherheit und
gedämpfter Bereitschaft der Banken zur Kreditvergabe
(finanzen.net/nachrichten/aktien/,
29.11.2007) die Zweifel der Kreditgeber am
Fortgang auch des spanischen Geschäfts: Die Anhebungen
der Kreditzinsen durch die EZB
– vom Tiefstand 2003
mit 2 % auf 4,25 % im August 2007 – und die immer noch
steigenden Preise haben da schon für eine allgemein
abnehmende Kauftätigkeit bei Immobilien gesorgt
(telepolis, ebd.), mit der
Folge, dass im Frühjahr 2008 das spanische
Wohnungsbauministerium erstmals einräumen musste: Die
Immobilienpreise fallen.
(Die
Presse, 21.4.2008) So wird nach allen Regeln
kapitalistischen Geschäfts vorgeführt, dass auch die
finanzkapitalistische Akkumulation des spanischen
Bankkapitals mit Hilfe des großen Konjunkturmotors
Bauwirtschaft
(Die Presse,
ebd.) am Ende nichts anderes als eine ziemlich
großformatige Überakkumulation darstellt; wobei das
„Zuviel“ in ebendem Augenblick zustande kommt, in dem der
nationale und internationale Kredit es der spanischen
Mörtelbranche und den Vertreibern ihrer Produkte nicht
länger zutraut, die so lange erfolgreich vermehrten
Schulden von Kon-strukteuren, Bauträgern,
Grundstückshändlern und der werten Endkundschaft für die
Bank als Kapital, also als sich vergrößerndes Vermögen
umzuschlagen. Die nun sinkenden Preise und die ungewisser
werdenden Absatzchancen der kreditierten Häuser
bestätigen das wachsende Misstrauen der weltweit aktiven,
von der US-amerikanischen Pleitewelle mehr oder minder
direkt bedrohten Kreditbranche und wirken auf die weitere
Verknappung des Kredits für laufende und neue Projekte
hin. Die Baubranche hat jedenfalls innerhalb
weniger Monate in Spanien ihre Rolle als die große
Umwälz-Agentur für den Kredit am Standort ausgespielt.
Der Euribor, dessen Anstieg widerspiegelt, wie die Herren
des Kredits beginnen, sich gegenseitig immer weniger zu
trauen, hat sich im Frühjahr 2008 gegenüber 2003 mit
4,8 % schon mehr als verdoppelt und macht auf der
Käuferseite immer mehr Schuldnern, die auf ihren
variablen Darlehenszinsen sitzen, deren Bedienung
unmöglich, zumal mit dem Abflauen der Bautätigkeit auch
die Arbeitslosigkeit wieder steigt. Schon zu diesem
Zeitpunkt sind 300 000 Unternehmen und 2,4 Millionen
Kreditnehmer säumig
, und die Regierung kündigt
deshalb ein erstes Hilfspaket von 10 Mrd. Euro an –
für Steuernachlässe und die Förderung des sozialen
Wohnungsbaus
, wie es heißt. (Die
Presse, ebd.)
Manchen Beobachtern gilt dennoch 2009, zwei Jahre nach
dem Ende des Booms, das spanische Bankensystem als Hort
der Solidität – Grundstücke und Schuldforderungen standen
da vielfach noch mit ihren ursprünglichen und nicht mit
den längst gesunkenen, aktuellen Verkehrswerten, wenn sie
denn überhaupt noch welche hatten, in den Bilanzen der
Banken –, und seine Manager dürfen sich dafür loben
und loben lassen: So hätten wegen der strengen
Aufsicht in Spanien niemals Subprime-Kredite verkauft
werden können
und: ... das massive Wachstum im
spanischen Kreditgeschäft schützte die Banken des Landes
vor riskanten Abenteuern in Übersee
; außerdem würden
die Banken die meisten ihrer Kreditnehmer seit Jahren
kennen
, haben diesen ihre Hypothekenkredite also als
eine Art Nachbarschaftshilfe verkauft, und, besonders
beruhigend: Wohneigentum ist dem Spanier sehr wichtig,
deswegen wird die Hypothek das Letzte sein, was er nicht
mehr bezahlen wird.
(Zeit
Online, 4.5.2009) [15]
So abenteuerlich sich die wüsten Auskünfte aus heutiger
Sicht ausnehmen: Sie geben ein trotz des Zusammenbruchs
des Immobilienkredits noch anhaltendes Vertrauen von
Teilen der Öffentlichkeit und vor allem der Finanzwelt in
das spanische Kreditwesen wieder. Weil es nicht so
sehr wie die britische Konkurrenz von der
amerikanischen Subprimekrise betroffen ist und
sich die heimische Immobilienkrise noch
nicht in existenzbedrohenden Zuständen betroffener
Kreditporfolios ausdrückt, sieht man spanische Banken,
vor allem die beiden großen Privatbanken Santander und
BBVA, am Vormarsch
(Die
Presse, 22.4.2008), ist ihnen im Mai 2009 der
Neid der Konkurrenz gewiss
(Zeit
online, 4.5.2009), wenn sie ihre Quartalszahlen
vorlegen, und scheint lediglich in Spanien ... eine
aufmerksame Bankenaufsicht Schlimmeres verhindert
(n-tv.de, 1.4.2008)) zu
haben, wie es in anderen Staaten Europas im
Bankengeschäft geschehen ist.
Als das Handelsblatt Mitte 2010 berichtet: Spaniens
Banken ordnen sich neu
(HB,
14.6.2010), und damit vor allem die mit
Milliardenbeträgen aus der Staatskasse überhaupt erst
ermöglichten Fusionen im Bereich der Sparkassen meint,
die nach dem Platzen der Immobilienblase unter einem
Berg fauler Kredite ächzen
, ist schon einiges
passiert: Die gesamte spanische Wirtschaft leidet
derzeit unter schwierigem Zugang zu externer
Finanzierung
(HB, ebd.)
und befindet sich seit dem Ende des Immobilienbooms in
einer Rezession
(Manager
Magazin, 3.4.2008). Seit die Immobilienbranche
ihre Rolle als Wachstumsträger nicht mehr spielt, zeigt
sich, dass der große Rest der spanischen Wirtschaft
diesen Ausfall nicht ausgleichen kann. Die
Wachstumsschwäche des spanischen Kapitals infolge der
Knappheit des Kredits aus privater Quelle bekämpft die
Regierung Zapatero mit politisch „geschöpftem“ Kredit:
Anfang 2008 beschließt sie ein milliardenschweres
Konjunkturprogramm; nach der Wiederwahl im April schiebt
sie noch einmal 18 Mrd. nach, im November neuerlich 11
Mrd., für 2009 und 2010 20 Mrd.; Anfang 2010 legt sie
dann im Rahmen eines Plan E
(Estimulo de la Economia y del
Empleo) ein Förder- und
Bankenstabilisierungsprogramm von insgesamt 70 Mrd. auf,
mit der Folge einer Haushaltslücke von 220 Mrd., die mit
neuen Schulden gedeckt wird und Spanien wegen des
Defizits von 11,2 % des BIP ein Defizitverfahren der
EU-Kommission einbringt. (nach: Auswärtiges Amt, Die
aktuelle Lage der spanischen Wirtschaft, März 2010).
Diejenigen, die mit dem Kreditbedarf von Staaten ihr Geschäft betreiben und unter dem Sammelnamen „die Märkte“ firmieren, haben sich die Entwicklung am spanischen Standort offenbar genau angesehen und reagieren auf ihre Weise: Sie lassen sich die Investitionen in spanische Staatstitel ab 2010 mit rasant steigenden Renditen vergelten. Einen Schuldner, der seit dem Ende des Booms im Baukredit 2007 nicht mehr auf die Beine kommt, der offenbar nach dieser abgerissenen Erfolgsstory nicht genug aufbieten kann, um den Standort wieder zum Wachsen zu bringen, der vielmehr Kapitalwachstum mit immer mehr Staatskredit kaufen und gescheiterten privaten Kredit mit noch mehr Staatskredit in Wert halten will – einen solchen Schuldner halten „die Märkte“ für ein „Risiko“, dem man nur gegen eine extra „Prämie“ neues Geld für seine zweifelhaften Unternehmungen leiht. Dementsprechend springen die Renditen für zehnjährige spanische Anleihen, die sich bis 2009 in einem Bereich von 3,5 bis 4,5 % bewegt hatten, ab 2010 auf über 5,5 und bis 2012 auf „untragbare“ 7 %, während gleichartige deutsche Papiere zu Niedrigrenditen von unter 1 % gekauft werden.
Die finanzkapitalistischen Käufer, Verwerter und Händler von Staatsschulden haben also seit der Einrichtung des Eurokredits dazu gelernt: Den Standpunkt, Schulden von Euro-Ländern seien gleichermaßen gute Handelsware für das internationale Finanzkapital, werthaltig, vermögenswirksam, so liquide wie Bares in Euro selbst und deswegen von mindestens dreifacher A-Bonität, nur weil sie eben Kredit in der gemeinsamen Währung darstellten, haben sie aufgegeben. Zehn Jahre nach der Einführung des Euro und drei ruinierte PIG-Staaten später, nehmen sie zur Kenntnis, dass der gemeinsame Ausdruck nationaler Kreditmacht in einer supranationalen Währung eben nicht dasselbe ist wie ein gemeinsamer Kredit; sondern dass sich Nationen in der Konkurrenz mit anderen, mit denen sie die Währung teilen, den in diesem Geld aufgeschriebenen Kredit national verdienen müssen. Sie müssen als Erfolg ihrer Verschuldung einen akkumulierenden Standort vorweisen können, der Investments in öffentlichen wie in privaten Kredit mit sicheren Vermögenszuwächsen belohnt. An den „Fällen“ Portugal, Irland und Griechenland hat die Finanzwelt als ersten durchexerziert, dass der Euro keine verlässliche Solvenzgarantie mehr für die Euro-Staaten und deswegen der „Euro-Raum“ keine Heimstatt auch nur annähernd einheitlicher Zinssätze für verschiedene nationale Schulden mehr ist, und wendet diesen praktisch erworbenen Erkenntniszuwachs jetzt auf Spanien an. Die Renditesprünge der spanischen Staatsschuld – und das Rekordtief der deutschen Anleihezinsen – drücken aus, dass die Identität zwischen der gemeinsamen Währung und der Sicherheit des jeweiligen nationalen Kredits auch für Spanien nicht mehr besteht. Spanien, wenn auch seinen ökonomischen Potenzen nach ein anderes Kaliber als die bereits ruinierten Euro-Nationen, muss sich nun wie jedes Land die Prüfung durch das Finanzkapital gefallen lassen, ob und wie es weitere Investitionen in seine Schuldtitel durch seine Konkurrenzlage rechtfertigen kann. Das aus diesem Vergleich resultierende Urteil über die Kreditwürdigkeit Spaniens fällt seit 2010 ausweislich der stark gestiegenen Refinanzierungskosten für die nationalen Schulden bekanntlich nicht gut aus. Die Rücksichtslosigkeit, mit der die Regierung den nationalen Kredit in die Waagschale wirft, um den Zusammenbruch ihres Bankensystems zu vermeiden, und der Radikalismus andererseits, mit dem auf dem Weg der Sparpolitik die dadurch expandierende nationale Schuldenbilanz irgendwie unter Kontrolle gehalten werden soll, auch auf Kosten verschärfter Rezession, nährt das Misstrauen der Investoren. Die bilanzieren kritisch, dass innerhalb von wenigen Jahren die Schulden des Landes von im europäischen Vergleich vorbildlichen gut 60 % auf für 2013 vorgesehene 90,5 % des schrumpfenden BIP wachsen (HH-Entwurf d. Regierung, dpa, 29.9.12), ohne dass das Wachstum am Standort wieder „angesprungen“ wäre.
Mit Renditeforderungen von 7 % für den Ankauf spanischer
Staatsschulden, die nach Auffassung der Regierung und
aller sachkundigen Beobachter die Zahlungsfähigkeit der
Nation auf Dauer übersteigen und nur zeitweise durch die
Erwartung eines Hilfsantrages an die europäischen
Rettungsfonds oder durch Interventionen der EZB gedrückt
werden, weisen die Finanzmärkte dem ehemaligen Aufsteiger
der EU vorerst einen Platz in den Reihen der europäischen
Krisennationen zu. Von denen unterscheidet sich der
„Fall“ Spanien aber deutlich – durch die Größe
seiner Finanzierungsprobleme. Wenn Spanien „fällt“, also
zahlungsunfähig wird, dann so die Sorge, ist der Euro am
Ende: Denn dann kauft vielleicht auch niemand mehr
italienische Euro-Anleihen, und ob dann die Schulden
Frankreichs und am Ende Deutschlands den Märkten noch als
Vermögen gelten oder nur mehr als Schuldenberge, die das
Scheitern der Währung beweisen, in der sie
aufgeschrieben sind, steht infrage. Spanien, so die
Auskunft, fungiert als Bollwerk
, an dem sich
die Wellen der Spekulantenattacken brechen sollen, …weil
es so auch Italien schützt, womöglich sogar Frankreich –
zwei Länder, die um jeden Preis davor bewahrt werden
müssen, ins Visier der Märkte zu geraten, soll der Euro
erhalten bleiben.
(SZ,
21.9.2012)
Die Krise eskaliert – der Standort muss sich anpassen
Die internationalen Investoren sehen sich durch den
Fortgang der Krise und des politischen Umgangs mit ihr
bestätigt: Eine Masse von ca. 650 000 unverkäuflichen
Wohnungen, manche schätzen den Bestand auf über eine
Million, entwertet sich immer weiter; deren Ersteller,
Verkäufer und Vermittler gehen in den Konkurs; bei den
Kreditgebern sammeln sich immer größere Mengen nicht
bedienter Kredite und im Wege der Zwangsvollstreckung
erworbener abgewerteter Wohnungen. Das macht die
Kapitalbasis von immer mehr Banken nach europäischen und
spanischen Vorschriften immer unhaltbarer: Das größte
Institut des caja-Systems, die aus mittlerweile
sieben Regionalsparkassen zusammenfusionierte
Bankia, macht 2011 noch einen
Finanzierungsversuch an der Börse und landet dann im
Frühjahr 2012 mit ein paar Dutzend Milliarden Euro
Sanierungsbedarf in der Verstaatlichung. Der spanische
Staat anerkennt die „Systemrelevanz“ seiner bedrohten
Banken und strengt nach dem Übergang zur konservativen
Regierung Rajoy im Herbst 2011 weiter seinen Kredit an:
jetzt nur mehr für immer neue Rettungsaktionen und nicht
mehr für Konjunkturprogramme wie unter der
Zapatero-Regierung, die allerdings auch schon mit einem
gewaltigen staatlichen Sparprogramm zu Ende gegangen war,
das den Spaniern die bis dahin größten sozialen
Einschnitte seit der Franco-Zeit
(euronews, 27.5.2010) brachte. Die
seitdem weiter gewachsenen Staatsschulden und die
deswegen angezweifelte Bonität sollen unter Rajoy durch
weitere und noch viel umfangreichere Spar-,
Steuererhöhungs- und Sozialkürzungsprogramme wieder
saniert werden. 60 Mrd. Haushaltseinsparung werden nach
Regierungsantritt, weitere 50 Mrd. im Frühsommer 2012
angekündigt.
Nach den Jahren der rasanten Akkumulation muss jetzt
alles billiger werden: die Arbeitskraft fürs Kapital,
damit es sich in diesen schweren Zeiten überhaupt wieder
etwas „Wettbewerbsfähiges“ trauen kann am Standort; die
Massen an unverkäuflichen Neubauwohnungen im Portfolio
der Banken, die flüssige Mittel brauchen und, vom Staat
gedrängt, ihre Bilanzen den tatsächlichen Wertverlusten
anpassen sollen; die Lohn- und Sachkosten des
öffentlichen Dienstes, die sich der Staat nicht mehr
leisten will; und die Sozialkosten fürs Volk sowieso. Die
Kaufkraft der durch Arbeitslosigkeit von im
Landesdurchschnitt 25 % verarmten Massen sinkt wie auch
die Nachfrage des Staates, und alles zusammen lässt
Wachstumszahlen und Staatseinkünfte weit unter den schon
zusammengestrichenen Haushaltsbedürfnissen erwarten.
Arithmetik ist ehrlich und unbarmherzig
meint dazu
ein bekannter englischer Investmentstratege
: Sie
lässt das Ziel, die spanischen Schulden auch nur zu
stabilisieren, als unerreichbar erscheinen.
(El Pais, 4.11.2012)
Es ist ja nach dem „Platzen der Immobilienblase“ nicht
nur das Wachstum am Standort zum Stillstand gekommen. Es
werden eben bedeutende Teile der Kapitalausstattung des
Standortes durch Entwertung zerstört, weil die „Blase“
doch nicht einfach nur mit heißer Luft gefüllt war,
sondern mit geldwerten Schulden, die bis neulich noch
fungierendes Vermögen darstellten. Dementsprechend
brechen die Geschäfte ein und haben seit Beginn der Krise
2007 mehr als 210 000 Unternehmen ihren Betrieb
eingestellt, deren Rechnungen nicht mehr bezahlt werden
und die dasselbe selbst nicht mehr können. Das gilt nicht
nur unmittelbar im Baubereich, sondern in allen mehr oder
weniger abhängigen Nebenbranchen und denen des größeren
oder kleineren Massenkonsums [16]. Die überschüssigen
Wohnungen gehen jetzt, wenn überhaupt, bei
Zwangsversteigerungen mit 20 bis 40 % Wertverlust über
den Tisch. Der für Januar angekündigte Banco Malo
– die Bad Bank der Regierung – kündigt für
die geplante Übernahme von Grundstücken und toxischen
Aktiva
aus Kreditforderungen vom Staat geretteter
Banken Abschläge zwischen 32,4 und 79,5 %
an
(SZ, 30.10.2012)[17], wie sie von der
gerade gegründeten hauseigenen Bad Bank der
verstaatlichten Bankia schon praktiziert werden. Darüber
hinaus hat sich die Kapitalflucht in den letzten 12
Monaten mit 235 Milliarden Euro auf Summen erhöht, die
beispiellos sind in den Archiven des Banco de Espana.
(El Pais, 28.9.2012)
Für den spanischen Staat summiert sich der Schaden, den das Kapital erleidet, zu einer heftigen Belastung des nationalen Standortes, aus dessen Erträgen er seine Macht finanziert und seine Kreditwürdigkeit begründet, und für den einzutreten er sich unter der misstrauischen Beobachtung der Agenturen des internationalen Finanzkapitals genötigt sieht: Dass der Rückfall des privaten Kredits der Nation auf einen großartigen Berg prekärer Schuldverhältnisse die heimische Reichtumsproduktion umfassend beschädigt und der politischen Gewalt in den Augen ihrer Krediteure die Grundlage ihrer Verschuldung entzieht, ist den politischen Verwaltern des spanischen Kapitalstandortes geläufig. Deshalb sollen die Bemühungen der Regierung um den Ersatz von immer mehr gescheitertem privatem Kredit durch staatlichen das Misstrauen der Märkte beruhigen und demonstrieren, dass die Staatsmacht durchaus in der Lage ist, die Bedingungen des nationalen Geschäfts und die ökonomischen Grundlagen der Staatsmacht zu erhalten. Dafür halten die staatlichen Rettungsprogramme bis an die Grenze der eigenen Verschuldungsfähigkeit die entwerteten Assets der Kreditinstitute formell in Kurs und drängen zugleich auf „Sanierung“ durch Bilanzbereinigungen der Banken und eine – meist staatlich finanzierte – Stärkung ihrer Kapitalbasis, also auf eine gesamtgesellschaftliche Durchsetzung der faktischen Entwertung im Rahmen einer irgendwie „verträglichen“, „geordneten“ Abwicklung, was leider schon wieder weiteren staatlichen Kreditbedarf mit sich bringt.
Zugleich, ab Juni 2012, melden sich immer mehr Autonome
Regionen bei der Zentralregierung mit Anträgen auf
Finanzhilfe, ohne die sie ihre Schulden nicht mehr
bedienen und ihre laufenden Kosten nicht mehr bestreiten
könnten. Denen wird mit Krediten eines in aller Eile neu
geschaffenen innerspanischen Rettungsfonds von 18 Mrd.
Euro geholfen, für deren Beschaffung praktisch der
Gesamtheit aller nationalen Finanzinstitute
(El Pais, 21.9.2012), egal
wie pleite sie sind, neue Staatsbons aufs Auge gedrückt
werden, während die staatliche Lotterie mit einem
Darlehen von 4 Mrd. Euro aushelfen muss.
Die internationalen Kreditgeber sehen angesichts
des andauernden Hin und Her zwischen Anerkennung und
Dementi der staatlichen Zahlungsunfähigkeit keinen
Anlass, von ihren risikobewussten Renditeansprüchen
abzurücken und machen es Spanien immer schwerer, den
wachsenden Finanzbedarf zu decken, so dass das Land im
Kampf um die Verteilung des Schadens aus der
europäischen Schuldenkrise nach und nach doch
als Objekt der Betreuung und Unterordnung durch die
überlegenen Wettbewerber dasteht. So bestätigt sich die
Beschädigung aller Konkurrenzmittel des Standortes und
seines Hüters, der der Prüfung seiner
Verschuldungsfähigkeit immer weniger standhalten kann:
Spaniens Rolle als Retter seiner Banken und Garant seines
eigenen Kredits liegt gar nicht mehr allein in nationalen
Händen, sondern hängt an politischen Zusagen aus dem
Ausland von EFSF, IWF, EZB und aus Berlin; Instanzen, die
die Nutzung des gemeinsamen Kredits, sobald Spanien ihn
braucht, unter von ihnen definierte Vorbehalte stellen.
So kann die Regierung Rajoy den Antrag auf Rescate
und die förmliche Unterwerfung unter das EFSF-Regime nur
mehr aufschieben – und diese schöne Dialektik reizt sie
aus, solange es nur geht –, weil „Rettungsfonds“,
EZB und IWF bereitstehen
(Draghi), den Spaniern eben dieses Regime
auf Antrag aufzuerlegen.
Spanien verlangt europäische Solidarität – und Respekt vor dem Stolz der Nation
Dem Angebot von Kredithilfen als Gegenleistung für die Unterordnung unter das institutionelle Rettungs-Regime hält Spanien seinen Anspruch auf „europäische Solidarität“ entgegen, die nicht an unzumutbare Bedingungen geknüpft sein dürfe. Die Regierung präsentiert die Nation als ein Mitglied der Gemeinschaft, das sich an Europa-Treue von niemandem übertreffen lässt. Wird anderswo erbittert gestritten, ob sich Europa und der Euro im Hinblick auf den Nutzen der Nation überhaupt „lohnten“, so herrscht in Spanien inner- wie außerhalb der „politischen Klasse“ weitgehende Einigkeit in dem Urteil, der Euro und der europäische Kredit seien auch in Zukunft und gerade in der Krise das alternativlose Mittel Spaniens und deswegen auf keinen Fall wegzuwerfen. Dass Spanien deshalb bei der Bewältigung der Krise geholfen werden muss und sein Wiederaufstieg aus der Rezession im Interesse Europas ist, das ist für die spanische Politik ausgemachte Sache.
Die Regierung bekommt auch zunächst einmal die Zusage eines 100-Milliarden-Kredits für die Stützung der nationalen Banken, behauptet, davon eigentlich nur 60, später dann nur 40 Milliarden zu benötigen, und wird von den Kreditgebern sogleich in einen Streit darüber verwickelt, ob der Betrag direkt den spanischen Staatsschulden zuzuschlagen sei, ob es einen Unterschied mache, ob das Geld direkt oder über den nationalen Bankenfonds FROB den Geldinstituten zugewiesen werde und ob man die übrigen 40 Milliarden, wie von Spanien gewünscht, vielleicht noch für andere dringende Vorhaben verwenden könne, wenn möglich wieder ohne Anrechnung auf die Schulden ...
Die Antwort der angegangenen Kreditinstitutionen ist
eindeutig: Draghi erklärt sich zum wiederholten Mal
bereit, für Anleihenkäufe EZB-Euros zu beschaffen, wenn
die Spanier sich EU-kontrollierten Sparauflagen für ihren
Haushalt unterwürfen. Es käme auch die Einräumung von
„Kreditlinien“ in Frage als Vorstufe zu einer
EFS-Rettungsaktion, allerdings müssten auch da
Bedingungen erfüllt und von außen kontrolliert werden,
was natürlich erst recht gelte, wenn Spanien „endlich“
seinen formellen Antrag auf Rescate beim ESF
stellen würde, damit ihm so richtig geholfen werden
könne. Das hält die Regierung Rajoy aber monatelang für
nicht zwingend
(SZ,
31.10./1.11.2012) und setzt darauf, dass
vielleicht schon die Bereitschaft zur
Kreditierung Spaniens durch ESF und EZB ihm zur
Refinanzierung an den Kapitalmärkten zu billigeren Zinsen
verhelfen und die Unterwerfung unter das Regime des ESF
vermeiden könnte. Letzten Endes sei so ein Hilfsantrag
allein Sache der Spanier, lassen sich die Deutschen
vernehmen, bestehen aber – in diesem Punkt ganz einig mit
der spanischen Regierung – darauf, dass nur mit
strengster Haushaltsdisziplin die Krise überwunden werden
könne. Rajoy kündigt allerdings an, seine Regierung
(werde) nicht hinnehmen können, dass ‚von außen‘ diktiert
werde, auf welche Weise der Staatshaushalt saniert werde,
...eine Troika, wie sie in Griechenland, Portugal oder
Irland die Bücher kontrolliert, komme nicht in Frage...
Er will einfach kein Stück Souveränität abgeben.
(SZ , 13.9.2012). Und
Deutschland setzt beim Gipfeltreffen im Herbst 2012
durch, dass die beschlossene europäische Finanzaufsicht
nicht schon nächstes Jahr, sondern erst 2014 kommen werde
– Qualität vor Schnelligkeit
lautet die
Lektion –, was zur Folge hat, dass Spanien
jedenfalls die 40 Milliarden für seine Banken erst einmal
selbst finanzieren muss und zusätzlich auf seine
Staatsschulden angerechnet bekommt: Deutschland bremst
die sofortige Rettung Spaniens
, Deutschland
schlägt Spanien die Türen zu
(El
Pais, 1.10. und 19.10.2012). Rajoy hingegen stellt
im Dezember klar, dass nicht Spanien, sondern Berlin
unentschlossen sei in der Frage eines spanischen
Rettungsantrags: Deutschland wolle gar nicht, dass
Spanien um Rettung nachsuche, weil Angela Merkel Angst
davor habe, sich dem Verdikt des deutschen Parlamentes zu
unterwerfen.
(Rajoy in El Pais,
16.12.2012)
Spaniens Hilfsanträge und seine Forderungen nach souveränitätsschonenden Sonderkonditionen basieren auf der Spekulation, dass die Garantiemächte des Euro, die dem Land ihre externe Kontrolle aufzwingen wollen, sich einen Ausfall von der Größe Spaniens oder gar einen Euro-Austritt des Landes nicht leisten können: Der hätte womöglich die weitgehende Entwertung ausländischer Guthaben in bisher nicht da gewesener Höhe zur Folge, wie etwa die gut 434 Mrd. Euro Negativ-Saldo aus dem europäischen Zahlungsverkehrssystem (Stand August 2012, bde.es/Datenbank) oder die ca. 1,8 Billionen Euro Gesamtauslandsverschuldung aller „öffentlichen Hände“ in Spanien (Stand 30.6.2012, bde.es). So munitioniert überziehen sich Spanien, am Rande der Zahlungsunfähigkeit, und die Agenten und Kontrollmächte des Eurokredits, die sich von einem spanischen Zusammenbruch bedroht sehen, wechselseitig mit gegensätzlichen Ansprüchen auf gemeinschaftsverträgliches Verhalten, welche sämtlich an die „letzten Fragen“ der spanischen Staatlichkeit und umgekehrt der Durchsetzungsfähigkeit der Kreditkontrolleure rühren.
Wenn also die deutsche Öffentlichkeit, parteilich für
„unsere“ Vormundschaft über unzuverlässige südliche
Schuldenmacher, kopfschüttelnd vor der iberischen
Sturheit steht, die kein Stück Souveränität
abgeben
will, wie wenn die Abtretung der spanischen
Haushaltsführung nur ein, eben jetzt unvermeidliches,
weiteres Portiönchen Souveränitätsverzicht bedeuten
würde, dann ist zwar der Tatbestand der Verharmlosung des
Gegensatzes erfüllt; der höchst prinzipielle Charakter
des Streits ist aber beiden Seiten offenkundig geläufig.
Spaniens selbstbestimmter Verarmungshaushalt – ein politökonomisches Resozialisierungsprogramm zur Wiederherstellung der Kreditwürdigkeit
Die mit europäischen Kredithilfen verbundenen Auflagen hält Spanien jedenfalls für eine unzumutbare Beschneidung seiner haushälterischen Souveränität. Die insoweit drohenden Angriffe auf die Freiheit der Nation weist die Regierung praktisch damit zurück, dass sie sich die Zumutungen der Austeritätspolitik selbst zum souveränen Anliegen macht: Dass auch der spanische Kredit daran genesen soll, dass die Schuldenwirtschaft der öffentlichen Haushalte durch Sparsamkeit wieder solide wird, hat sich die konservative Führung vom ersten Tage der Regierungsübernahme an selbst zum Programm gemacht, das sie mit aller Härte verfolgt, ohne Rücksicht darauf, dass damit der Standort weiter beschädigt wird und die spanischen Schulden dennoch nicht sinken, sondern steigen. Dem soll auch mit massiven Steuererhöhungen entgegengewirkt werden, mit denen die Zentralregierung und die autonomen Regionen weitere Teile der Kaufkraft der Gesellschaft beschlagnahmen.[18] Die „investiven“, also irgendwie wirtschaftsförderlichen Haushaltsposten werden um 57 % gegenüber dem letzten Zapatero-Haushalt 2011 gekürzt; darüber hinaus streicht die Regierung die Zuweisungen an die Comunidades Autónomas drastisch zusammen, die u.a. für Gesundheitswesen, Bildung und Armenfürsorge zuständig sind.
Dem spanischen Volk werden die „notwendigen“ Opfer für
die „Genesung der Wirtschaft“ abverlangt. Die
Arbeitslosenzahlen erhalten durch die
Arbeitsmarktreform
der PP einen neuen Schub.
Kündigungen werden erleichtert durch die Abschaffung oder
Kürzung bisher üblicher Abfindungen, damit sich
Unternehmen jene, die sie gerade entlassen wollen, eher
wieder einzustellen trauen, weil sie sie ja jetzt
leichter wieder loswerden. So ist inzwischen mehr als ein
Viertel der gesamten nationalen Arbeitskraft und die
Hälfte der jüngeren Arbeitsfähigen außer Dienst gestellt.
Auch der Staat, einschließlich der Regionen, entledigt
sich großer Teile seines Personals,[19] das ihm in der
Hungerleider-Arbeitslosenversorgung weniger Kosten
verursacht als auf seinen Gehaltslisten, wo er den
Aufwand für die Verbliebenen durch Gehaltskürzungen und
Arbeitszeitverlängerungen fortwährend nach unten drückt.
Dass inzwischen mehrere Millionen junge Leute ohne
Schulbesuch, Studium, Berufsausbildung und ohne jede
sonstige Beschäftigung herumhängen, verbucht die
Öffentlichkeit als Gefahr für die langfristige
sittliche Leistungsfähigkeit und -bereitschaft
des Volkskörpers, bringt die Politik aber nicht von ihrem
Kurs ab.[20]
Die Pflege des physischen Volkskörpers durch das
Gesundheitswesen ist am stärksten von Einschnitten
betroffen
(El Pais,
29.9.2012) mit 22,6 % Kürzung innerhalb nur eines
Jahres, mit einem angekündigten Einsparbetrag von ca. 10
Mrd. Euro, ohne dass schon über ein paar Programmpunkte
hinaus – Zuzahlungen der Patienten, Reduzierung der
Medikamentenversorgung [21] u.ä. – feststünde, wo genau
und wie diese Ersparnis aus der Gesundheit der staatlich
Versicherten herausgewirtschaftet werden soll.
Währenddessen treibt die PP ihr altes Projekt, die
Förderung der privaten Krankenversicherung und
Gesundheitsfürsorge für Zahlungsfähige auf
Geschäftsbasis, gegen den bisher dominierenden
öffentlichen Gesundheitssektor voran und beweist mit der
Unfinanzierbarkeit von Salud Publica die
Überlegenheit eines privatisierten Gesundheitswesens.
Gegen die Privatisierungspläne der konservativ regierten
Region Madrid treten Ärzte und sonstige Beschäftige des
öffentlichen Gesundheitswesens einen unbefristeten
Streik, der nach einer Frist von ein paar Wochen auch
wieder ziemlich vorbei ist und in großem Wehklagen über
den großen Beilhieb gegen den Sozialstaat
(El Pais, 15.12.2012) endet.
Der zu beklagende Schaden reicht dabei weit über das
hinaus, was den Patienten in einem kaputt gesparten
System der Heilbehandlung blühen könnte: Das aktuelle
öffentliche Gesundheitssystem
gibt nämlich in seiner
jetzigen Gestalt angeblich ein starkes Motiv des
nationalen Stolzes
ab und soll ein authentischer
Edelstein in der Krone unserer Institutionen
sein
(El Pais, 1.12.2012). Das
sehen die Politiker der PP anders, die auch sonst nicht
viel von sozialstaatlichen Edelsteinen halten: Zeitgleich
geht eine nie da gewesene Welle von Zwangsräumungen über
das Land hinweg, weil immer mehr Wohnungskäufer die
Kreditzinsen nicht mehr zahlen können und die Immobilien
gepfändet, zwangsversteigert und gnadenlos geräumt
werden.[22]
Über die Anpassung der künftig nach deutschem Vorbild
erst ab 67 statt ab 65 zu zahlenden Renten, deren
„Unantastbarkeit“ die PP vor der Wahl hoch und heilig
versprochen hat, gibt es eine lange Debatte, ob man
wirklich für den Erhalt der Kaufkraft der Rentner mitten
im Sparhaushalt knappe Mittel vorhalten müsse. Manche
Regionalregierungen, selbst am Rande der Pleite, erklären
im Umfeld von Wahlen in einigen Comunidades,
eigene Mittel zu mobilisieren, um eventuelle Ausfälle bei
Renten und Krankenversorgung auszugleichen, sehen sich
mit Klageandrohungen seitens der Zentralregierung
konfrontiert, während sich die Regierung inzwischen
entschlossen hat, die Kaufkraftkürzung der Rentner durch
Nicht-Anpassung ihrer Renten als eine
verantwortungsvolle Maßnahme
(La Vanguardia, 15.12.2012) zu
betrachten.
Angesichts dessen, dass die privaten Haushalte in Spanien
seit 2006 ein Drittel ihres gesamten Vermögens verloren
haben, 13 Millionen Leute aus der Mittelklasse
in
die Armut abgestiegen sein sollen und z.B. in Katalonien
45 % der Bevölkerung und 87 % der Alten ohne staatliche
Nothilfe als arm gelten müssten (El Pais, 23.10.2012),
spricht ein Kolumnist des Pais, blumig, aber nicht
unberechtigt, von einem sozialen Massaker
, das
leider – er zitiert dafür einen angeblichen Kenner der
Verhältnisse von Goldman Sachs – eben erst
angefangen
(6.11.2012)
habe.
Vom Kampf gegen die ökonomische zur politischen Krise – zentralistische und regionale Nationalisten radikalisieren ihre unvereinbaren Staatsansprüche
Auf der Grundlage eines komplizierten Geflechtes von
exklusiven, gemeinsam oder nur im Auftrag der Zentrale in
Madrid erledigten Verwaltungsaufgaben und verwickelter
Steuereinnahme- und Ausgabe-Kompetenzen bezahlen die
Autonomen Regionen inzwischen weit mehr öffentliche
Angestellte als die Zentralregierung und steuern ca. 40 %
aller öffentlichen Ausgaben bei. Aufgrund des
krisenbedingten Einbruchs ihrer eigenen Steuereinnahmen
und ihrer inzwischen vollkommenen Kreditunwürdigkeit auf
den Kapitalmärkten sind ihre Finanzen zerrüttet. Ihre
Zahlungsfähigkeit wird im Zweifel nur mehr durch den
innerspanischen Rettungsfonds der Zentralregierung
aufrechterhalten. In dieser Lage „überträgt die
Zentralregierung den gesamten Kürzungsbedarf der
öffentlichen Haushalte (zur Erreichung der geplanten
Defizit-Reduzierung, d.Verf.) für 2013 an die
Comunidades“, wie das gemeinsame Forschungsinstitut
Fedea des Banco de Espana und einiger
Großunternehmen in einer Studie vorrechnet (El Pais,
16.10.2012). Das halten die Forscher für ziemlich
desproporcionado
, die Führer der Regionen aber für
einen Riesenskandal und manche von ihnen für einen neuen
Höhepunkt der Ungerechtigkeiten, die sie schon immer der
Zentrale in Madrid vorwerfen. Die Comunidades
sehen sich durch die Krisenpolitik Madrids nicht nur von
allen als ihnen allein zustehend beanspruchten
Geldmitteln ihrer autonomen Politik abgeschnitten und
ökonomisch in vollständiger Abhängigkeit von der
Zentralregierung und deren Wille und Fähigkeit, für die
Regionen Notkredite zu organisieren. Sie sehen damit auch
ihre in Jahrzehnten ausgebauten und ausbalancierten
Autonomie-Rechte ausgehöhlt und entwertet und ihre
Eigenständigkeit gegenüber Madrid wirtschaftlich und
politisch ruiniert. Das will insbesondere die
nationalistische Führung Kataloniens nicht mehr
hinnehmen. Sie unterstützt die Massendemonstration, die
am 11. September 2012, dem Nationalfeiertag der
Katalanen, mit dem sie sich schon immer so gern an das
Leid der Eroberung Barcelonas und des Verlustes der
Unabhängigkeit im Spanischen Erbfolgekrieg 1714 erinnern,
stattfindet, nimmt den Schwung mit in vorgezogene
Neuwahlen im November und kündigt, nachdem eine
Parlamentsmehrheit für die separatistischen Parteien
zustande kommt, ein Referendum zur Unabhängigkeit in der
neuen Legislaturperiode an.
Aus der Sicht der regierenden Zentralnationalisten hat die Rücksichtslosigkeit gegenüber den Interessen der Regionen, durch die sich die politischen Vertreter der autonomen Regionen provoziert sehen und die sie zu einer neuen Qualität ihrer Sezessionsbestrebungen anspornt, ihre zwingende Logik: Schließlich sieht sich Madrid durch die Finanzkrise aufs Äußerste gefordert. Den „Märkten“, auf die die Regierung so bald wie irgend möglich als guter Schuldner „zurückkehren“ will, und den aufsichtsführenden Euro-Mächten, die Madrid mit ihrem Rettungsregime belauern, schuldet sie die Konsolidierung der Staatsfinanzen, also jede mögliche Form der Geldersparnis im Haushalt und zusätzlich den Beweis ihrer machtvollen Kompetenz und Durchsetzungsfähigkeit in allen politischen Fragen des nationalen Sparhaushalts. Die Demonstration ihrer Durchgriffsmacht auf die ganze Nation, der Nachweis ihrer Befähigung, das Volk ebenso wie alle als zu teuer beurteilten Gliederungen der Staatsverwaltung auf alternativlose Verbilligung zu verpflichten, alles also, was zur Stiftung von internationalem Vertrauen in ein nationales Krisenmanagement geeignet ist, das die Verhältnisse im Land im Griff hat, muss aus der Sicht der Zentralregierung sein.[23] Rücksichtnahmen auf regionale Empfindlichkeiten bei der Vollstreckung von Spardiktaten sind angesichts der Größe der Aufgaben nicht vorgesehen.
Umso mehr steigt die Erbitterung gegenüber denen, die mit ihrem Subnationalismus der Nation auf diesem schwierigen Weg Knüppel zwischen die Beine werfen, mit ihrem Separatismus die innere Stabilität gefährden und in schweren Zeiten den Kampf gegen die Krise sabotieren, in der die Nation mehr denn je Anspruch auf Zusammenhalt hätte. Auf Grundlage dieser gesamtstaatlichen Anspruchs- und Rechtslage verdienen Kataloniens Unabhängigkeitsbestrebungen nur unversöhnliche Gegnerschaft: Sie sollen keine Chance haben. Die Region wird, so die Drohung Madrids, im Fall ihrer Sezession von der EU und vom Euro ausgeschlossen sein und keinesfalls von europäischen Kredithilfen profitieren. Dass man es gar nicht erst so weit kommen lassen, sondern eine Abspaltung legitimerweise mit allen Mitteln verhindern werde – schließlich stellten die einschlägigen Bestrebungen ja einen schwerwiegenden Verfassungsbruch dar –, wird den Freunden des Separatismus auch bedeutet – bis hin zur Androhung von Waffengewalt aus Armeekreisen.[24]
Diese Absage an jeden Kompromiss mit dem regionalen
Nationalismus, wenn es um die Rettung der
gesamtnationalen Kreditwürdigkeit geht, also um das
wichtigste Lebensmittel aller Spanier und ihres
Staates, ist wiederum die größte anzunehmende Provokation
für alle echten Katalanen: Nicht nur ihr mit überragendem
katalanischem Fleiß und landestypischem Talent
geschaffener Reichtum verschwindet in den dunklen Kanälen
des spanischen Finanzausgleichs und lässt das
schaffensfrohe Völkchen mittellos und hoch verschuldet
zurück; auch die mühsam erkämpften Rechte katalanischer
Staatlichkeit lösen sich damit in Luft auf, was deren
Vorkämpfer in ihren schon immer angestellten Rechnungen
nur bestätigt: Denn wer so den Finanz- und
Rechteausgleich konsequent nicht vom Standpunkt des
ausgleichenden Gesamtstaates, sondern von dem der Region
betrachtet, die diesem Ausgleich und seiner negativen
Fortschreibung im Rahmen der Krisenbewältigungspolitik
unterworfen ist, der findet zielsicher auf die Frage
danach, ob sich Spanien für Katalonien lohnt
, die
richtige Antwort. Mit der exakt baugleichen Er- und
Verbitterung, mit der die Zentralisten den katalanischen
Separatismus als Verrat an der spanischen Sache in der
Stunde der Not mit ihrer Feindschaft bedenken, halten die
katalanischen Nationalisten die krisenpolitische
Rücksichtslosigkeit der Zentralregierung gegenüber ihren
ökonomischen Interessen und heiligen Rechten für den
letzten „Beweis“ dafür, dass die Zeit des Versöhnlertums
vorbei sein und endlich zur Separation fortgeschritten
werden muss. So führt die Lage der Staatsfinanzen und
ausgerechnet der wild entschlossene Radikalismus der
Rajoy-Regierung, der beim Kampf um die Wiederherstellung
der nationalen Kreditwürdigkeit keine Verwandten kennt,
mitten in der ökonomischen Krise eine Krise der
spanischen Staatlichkeit und der Stabilität ihrer
Institutionen herbei, die sich weder die spanischen und
europäischen Krisenretter noch die Märkte bestellt haben.
[1] Die Staatsholding
INI wird gegründet im Dienste der Nation die
Schaffung und Wiederbelebung unserer Industrien
voranzutreiben und zu finanzieren, insbesondere jener,
die anstreben, die sich aus den Mängeln der
Landesverteidigung ergebenden Probleme zu lösen, und
derjenigen (Industrien), die sich der Entfaltung
unserer wirtschaftlichen Autarkie verschreiben, wobei
es den spanischen Ersparnissen eine sichere und
attraktive Anlage bietet…
(Artikel 1 des Gesetzes vom 25.9. 1941 über
das Instituto Nacional de Industria) Die unter
ständigem Kapitalmangel leidende Wirtschaft des
Franco-Staates wurde zwar schon Ende der 50er Jahre von
der OECD und der Weltbank betreut und mit mehreren
Liberalisierungsplänen zwecks Relativierung der
Autarkie-Ökonomie beglückt, die aber nur teilweise
umgesetzt wurden und zu innenpolitischen Streitigkeiten
zwischen konservativen Staatswirtschaftlern und
Reformern führten.
[2] Von deren Standpunkt aus waren die nicht strikt weltmarktorientierten und auf auswärtigen Kapitalzugriff ausgerichteten Vorstellungen von den Aufgaben der Ökonomie im faschistischen Staat ein einziger Beweis für die Weltfremdheit und Rückständigkeit, also für den dringenden Renovierungsbedarf einer von einem falschen politischen System gegängelten, unfreien Wirtschaft.
[3] Im Bereich von Stahl
und Kohle hatte mit der Gründung der „Montanunion“
bereits 1952 der Übergang von der alliierten
Nachkriegskontrolle der deutschen Stahlproduktion zu
einer Zollunion für Kohle und Stahl zwischen den
Benelux-Staaten, Frankreich, Italien und Deutschland
stattgefunden, die Frankreich den dringend benötigten
Zugriff auf deutsche Kokskohle zu deutschen
Inlandspreisen und Deutschland die nun stetige Erhöhung
der Stahlproduktion brachte. Mitte der 60er Jahre
hatten es die Vertragsstaaten schon zu einem nach
Auffassung der Beteiligten ruinösen Wettbewerb
gebracht, der mit Billigung der Montanunion durch
Verkaufskartelle mit zwischen Betrieben übertragbaren
Quoten bekämpft werden sollte. Das verhinderte nicht
die enorme Überproduktion
(Spiegel-Archiv) Ende der 70er Jahre,
auf die man – immer noch auf Basis der Montanunion – in
den frühen 80er Jahren reagierte: mit neuen
„Mengenkartellen“, der Zuteilung von Produktionsmengen
für die jeweiligen nationalen stahlindustriellen
Verbände, Preisregulierungen für den Binnenmarkt und
einem durch die EG-Kommission forcierten Abbau von
Überkapazitäten. In diesen Prozess wurde Spanien von
Beginn der Beitrittsverhandlungen an eingemeindet.
[4] In den 80er Jahren gab es z.B. allein in Asturien 22 000 Mineros, heute sind es in ganz Spanien noch 8000. Die verbliebenen Minen sollen im Zug des Abbaus der Staatshilfen, die von der EU noch bis 2018 geduldet werden, möglichst sofort geschlossen werden. Die Monatsverdienste liegen derzeit bei wöchentlich 45 Arbeitsstunden bei ca. 1100.- Euro netto. (lt. einem Info-Portal der IGB, www.igbce.de, 9.7.2012)
[5] Vgl. dazu und zu den näheren Umständen des Weges Spaniens in die EG: Gegenstandpunkt 1-93, Nach dem Jahr der Rasse – Ebbe in der Kasse und: Gegenstandpunkt 3-04, Das Rezept der EU-Aufsteigernation Spanien
[6] Die Inflationsrate hatte sich von 1986 auf 1987 von 8,25 auf 4,6 % fast halbiert und die Wirkung des Moncloa-Paktes auf die Lohnentwicklung entschärft. (www.inflation.eu)
[7] Das Handelsbilanzdefizit beläuft sich bis zum EG-Beitritt fast ein Vierteljahrhundert lang auf ca. eine Milliarde (umgerechneter) Euro, um nach der Euro-Einführung bis zum Höhepunkt der Immobilienkrise auf den nie da gewesenen Rekordwert von ca. 9 Milliarden monatlich zu wachsen. (bde.es/Datenbank Banco de Espana)
[8] Die spanische Politik hat es verstanden, in harten politischen Verteilungskämpfen mit anderen Anspruchstellern, etwa in den Jahren zwischen 1994 und 1999, ca. 55 % der Mittel des Kohäsionsfonds auf sich zu ziehen, und in der darauf folgenden Periode von 2000 bis 2006 den Anteil auf ca. 62 % zu erhöhen, unter der Androhung der Aznar-Regierung, anderenfalls den Beitritt der absehbar um die Mittel mitkonkurrierenden Ostländer zu blockieren.
[9] Ein Prozent des spanischen Wirtschaftswachstums 2003 von insgesamt 2,3 % stammt angeblich allein aus den Zuweisungen des Kohäsionsfonds und des Regionalfonds (lt. Nachrichtenportal telepolis, 7.6.2004)
[10] Erwähnenswert u.a. die alte Telefonica (1926 gegründet), die heute ein Marktführer in ganz Lateinamerika ist, wenn auch inzwischen mit einer Verschuldung ungefähr i.H. ihres Umsatzes (ca. 60 Mrd. Euro,) und nur mehr ein Viertel ihres Geschäfts in Südeuropa abwickelt; ebenso allerlei weitere Ansiedlungen der internationalen Autoindustrie, und, nach dem Beitritt – schon 1971 – zum Airbuskonsortium, die Gründung mehrerer EADS/Airbus Montage- und Forschungsbetriebe.
[11] Das bereicherte
später auch den spanischen Sprachgebrauch im Zug einer
endlosen Kette von Korruptionsprozessen gegen
„concejales“ – Stadträte –, überwiegend, aber
nicht nur, aus den Reihen der PP, um eine neue
Deliktskategorie: die corrupción urbanistica
.
[12] Die „Kultur“ ist
den Spaniern seit einiger Zeit ausgetrieben worden:
Ein Mietmarkt ist in Spanien fast völlig
verschwunden, wegen scharfer Mietkontrollen und eines
umfangreichen Mieterschutzes ...
(Transitionsbericht 2012 der Europäischen Bank
für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE)) Man
sieht: Wenn es keine Vermieter mehr gibt, halten die
auch scharfen Mieterschutz gut aus!
[13] Hypothekenzinsen lagen in Spanien 1993 noch bei 14 %, zwischen 1999 und 2007 nach Abzug der Teuerung im Durchschnitt bei unter 1,5 % (nach Chr. Krefs auf hispanorama.de, 15.6.2011), teilweise – in den Jahren 2004 und 2005 – wurden bei Inflationsraten von 3,23 und 3,74 % und einem verbreiteten Hypothekenzins von ca. 3,1 % sogar negative Zinsen erreicht. (www.inflation.eu und Graphen des Euribor, deutsche bundesbank.de)
[14] Seit den
frühen 2000er Jahren wurden internationale
Kapitalströme wegen Strukturänderungen und der
Deregulierung der Finanzindustrie in den Bereich der
Hypothekenkredite geleitet. Die USA, ... , Spanien und
Irland machten die Erfahrung von zahlreichen
Kreditausfällen auf Seiten von
Grundstücksentwicklungsgesellschaften, was zu einer
Bankenkrise führte.
(Transitionsbericht der EBWE, ebd.) Der
einzige „Fehler“, den sich diese „Allokation“ vorwerfen
lassen muss, ist offenbar, dass ihre jahrelang
ausgezeichneten Geschäfte irgendwann aufgehört haben.
[15] Das ist vielleicht das einzige wahre Wort an dem ganzen Geschwätz: Derzeit kann man beobachten, wie es zugeht, wenn ein paar Millionen Spanier auch das Letzte nicht mehr bezahlen können.
[16] 95 % aller Spanier geben anlässlich einer großen Umfrage an, infolge der Krise ihre Konsumgewohnheiten und ihren „Lebensstil“ geändert zu haben (El Pais, 28.10.2012). Die sinkenden Umsätze des Einzelhandels wegen sinkender Gehaltssummen und Sozialleistungen beziffern das. Sie gehen seit 2007 um 22,4 % zurück (ohne Kfz-Handel, der um mehr als 30 % einbricht). (Eurostat.ec.europa.eu/Datenbank)Der Automobilsektor, in dem derzeit in Europa ein paar Millionen Autos mehr produziert als gekauft werden und dessen Verkäufe in Spanien auf das Niveau der 90er Jahre abgestürzt sind (El Pais, 30.10.2012), scheint gleichwohl eine bemerkenswerte Ausnahme zu bilden: Ford kündigt Investitionen von 200 Mio. Euro in Spanien an, während es in Belgien und England drei Werke mit 4500 Leuten schließt (SZ, 29.10.2012) VW-Seat kündigt Investitionen von 800 Mio. Euro in Spanien an; Nissan 300 Mio., IVECO-Fiat will 1200 Leute einstellen und Renault lässt seine drei kleineren spanischen Produktionsorte mit denen in der Türkei konkurrieren und verspricht 1300 Arbeitsplätze für Spanien, wenn die Belegschaft bei Löhnen, Arbeitszeit und „Flexibilität“ der Arbeit alles zugesteht, was man von ihr haben will. (El Pais, 9.10.2012) Offenbar hat die Autoindustrie die Krisenlage in Spanien wegen der billigen Löhnen und einer von Massenarbeitslosigkeit zermürbten Arbeiterschaft als Gelegenheit entdeckt, sich dort eine Basis für den verschärften Konkurrenzkampf angesichts der gerade erst in Schwung kommenden Überproduktionskrise der Autoindustrie zu schaffen – wenn denn die Ankündigungen im Verlauf der Krise nicht wieder storniert werden.
[17] Die Abschläge
betreffen ca. 10 % aller Kredite in den Büchern der
spanischen Banken, etwa 179 Mrd. Euro (FTD,1.10.2012),
die schon als faul
angesehen werden, wobei aber
insgesamt mehr als die Hälfte aller
Immobilienkredite als gefährdet gilt
. (SZ,
4.10.2012)
[18] Die Mehrwertsteuer wird erhöht, in manchen Regionen eine Vermögens- und eine Grundverkehrssteuer eingeführt, eine Erhöhung der Körperschafts-, Kapitalertrags- und der Steuer auf Mieteinkünfte beschlossen (El Pais, 29.9.2012).
[19] Seit Ende 2011 wurden allein im Sozial- und Gesundheitsdienst 220 472 Beschäftigte entlassen (El Pais, 2.10.2012), insgesamt sollen es ca. 300 000 sein, davon allein 4 526 Lehrer und Hochschuldozenten nur in Andalusien (El Pais, 7.9.2012).
[20] Seitens der europäischen Konkurrenten, vor allem von Deutschland, wird der spanische Arbeitsmarkt auf brauchbare Kräfte gefleddert, denen man als Ersatzbevölkerung für deutschen Bedarf gönnerhaft Perspektiven bei der Behebung „unseres Fachkräftemangels“ bietet.
[21] In manchen Gegenden stockt die Versorgung mit Medikamenten, weil die öffentlichen Besteller so große Zahlungsrückstände aufgehäuft haben, dass die Händler und Hersteller nicht mehr liefern.
[22] In den letzten
drei Jahren gab es ca. 400 000 desahucios
–
Zwangsräumungen –, über die täglich groß in der Presse
berichtet wird, zumal sich inzwischen mehrere
Selbstmorde von Obdachlosen ereignet haben. Bis
Jahresende 2012 sind es weitere 200 000
Zwangsräumungen, weil im Vorfeld des Banco Malo viele
Banken hoffen, die gepfändeten Wohnungen noch zu
besseren Preisen loszuwerden, als unter dem Druck der
flächendeckend durchgesetzten Abschläge seitens der Bad
Bank. Insgesamt wird etwa eine Million Räumungen
erwartet. (SZ, 9.11.2012) Die Räumungen gehen besonders
leicht auf Grund eines Gesetzes von 1909, das keinerlei
soziale Rücksichtnahmen kennt, so dass viel moralische
Erregung ins Spiel kommt, wenn täglich Todkranke, Alte
und völlig Mittellose aus ihren Wohnungen geworfen
werden. Die Regierung will nicht über eine Empfehlung
für einen freiwilligen Kodex für anständiges Verhalten
beim Räumen – einen Codigo de Buena Conducta
–
hinausgehen, weil eine Gesetzesänderung dem Ansehen
Spaniens und der Bewertung der Banken schaden
(El Pais, 25.10.2012)
würde. Sie kommt aber Mitte November dann doch etwas
unter moralischen Druck und erlässt ein paar neue
Regeln zur Zwangsräumung, die aber so eng gefasst sind,
dass sie wohl weder dem Ansehen Spaniens noch der
Bewertung der Banken schaden werden. Die
Zwangsgeräumten haften bei alledem weiterhin für die
noch nicht getilgten Kreditanteile, die von den Erlösen
der abgewerteten, zwangsversteigerten Wohnungen nicht
gedeckt sind. Das und ihre furchtbare Überlastung durch
den ganzen Immobilienkram empört große Teile der
Richterschaft inzwischen so, dass manche das verpönte
Gesetz nicht mehr anwenden wollen und Räumungsklagen
von Banken, die doch schließlich an dem ganzen Desaster
schuld seien, wegen Rechtsmissbrauchs abweisen
(El Pais, 29.10.), bis die
Kläger dann in der nächsten Instanz Recht bekommen,
oder die Vorschriften doch noch geändert werden.
Inzwischen ruft die Polizeigewerkschaft – wenn auch mit
nur mäßigem Erfolg – ihre Mitglieder auf, sich nicht
mehr an Zwangsräumungen zu beteiligen. (TVE,
12.11.2012)
[23] Ob die Regierung Rajoy den Beweis ihrer verlässlichen Regierungskompetenz ge-genüber ihren Krediteuren auf Dauer hinbekommt, da ihr neben sozialen Protesten und widerspenstigen Regionen im Februar 2013 nun auch noch ein die ganze Parteispitze der PP betreffender Schmiergeld-Skandal zu schaffen macht, der auch den Regierungschef öffentlichem Misstrauen aussetzt, bleibt abzuwarten. Die „Märkte“ jedenfalls reagieren zunächst schon ein wenig „nervös“ und lassen die zuletzt gesunkenen Renditen der spanischen Schulden wieder ein wenig ansteigen...
[24] Unabhängigkeit
für Katalonien wird es nur über meine Leiche und die
vieler anderer Soldaten geben ...
Die katalanischen
Nationalisten seien „Geier“, die es zu „vernichten“
gelte. Die Streitkräfte würden die Integrität des
Landes verteidigen, und jeden, der sich an den
Vorbereitungen zum Auseinanderbrechen Spaniens
beteilige, wegen Hochverrats vor ein Kriegsgericht
stellen
. (So angeblich ein Armeeoberst, nach Junge
Welt, 6./7. 10.2012) Ob das später angezweifelte Zitat
des Obristen nun authentisch ist oder nicht: Die
Erbitterung zwischen den Lagern kennzeichnet es schon,
dass die offene Androhung eines Bürgerkrieges an die
Adresse der Separatisten für möglich gehalten wird.