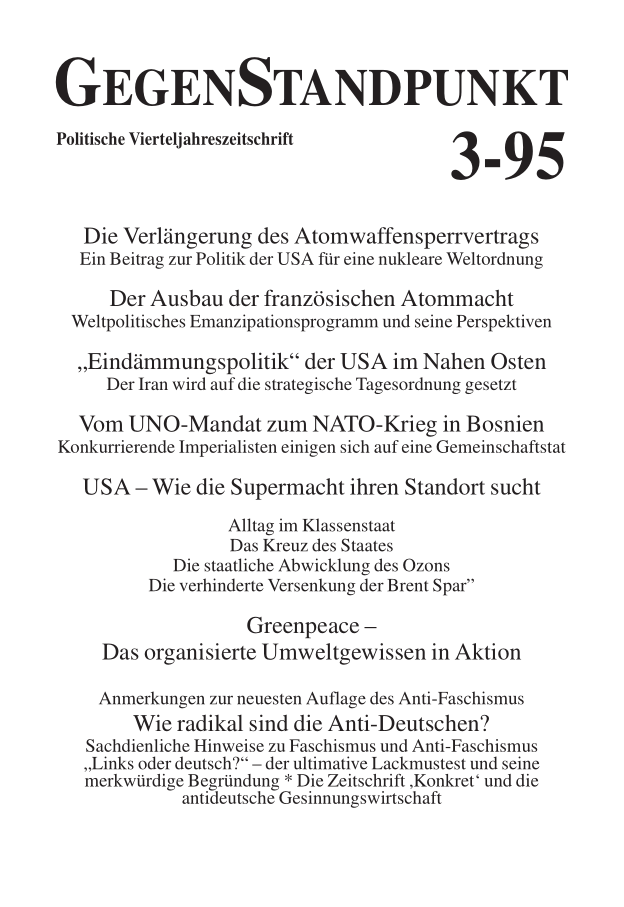Alltag im Klassenstaat (Teil II)
Mit dauerhafter Lohnkostensenkung durch das Kapital gerät die sozialstaatliche Umverteilung des Lohns auf die ganze Arbeiterklasse zum immer gravierenderen Kassenproblem. Der Sozialstaat muss grundlegend umgebaut werden, da er nicht zum Durchfüttern der Minderbemittelten eingerichtet ist. Ab sofort ist er eine zu verwaltende Last und mit Reformen bei der Pflegeversicherung, Sozial- und Arbeitslosenhilfe nutzt der Staat seine Hoheit über den Lebensstandard der Arbeiterklasse entsprechend aus.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Alltag im Klassenstaat (Teil II)[1]
Der Sozialstaat ist Gegenstand einer zunehmend fundamentalistisch geführten Dauerdebatte. Angesichts der Finanzierungslücken, die sich trotz aller Beitragserhöhungen und Kostendämpfungsrunden in den Sozialkassen stets von neuem auftun, steht für den teilnehmenden Sachverstand mittlerweile das Gesamturteil fest, daß er „unbezahlbar“ ist. Von dieser Diagnose aus werden rückwärts die gelaufenen Reformen als Flickschusterei kritisiert. Radikalere Vorschläge werden in die Zirkulation geworfen, die grundsätzliche Leistungen der Sozialversicherungen in Frage stellen bzw. gleich mit dem Anspruch vorgetragen werden, dem bestehenden Sozialversicherungssystem eine Absage zu erteilen. Debattiert wird über eine Umstellung der beitragsfinanzierten Altersversorgung auf eine steuerfinanzierte Grundrente, die sich von vornherein nur als Zusatz zur privaten Eigenvorsorge der Betreffenden versteht; über die Zurückführung der Krankenkassenleistungen auf einen medizinischen Kernbereich, der nur das Nötigste abdeckt; über die Ausgliederung selbstverschuldeter Risiken aus dem Deckungsbereich der Krankenversicherungen; über Kürzungen bei der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, über neue Anwendungsmöglichkeiten des Modells „Pflegeversicherung“ etc.. Nicht nur debattiert, sondern als konkrete Gesetzesvorhaben verhandelt werden die Festschreibung der Arbeitgeberbeiträge zur Krankenkasse, die Anpassung der Arbeitslosenhilfe an die Sozialfürsorge, die Reform des bedarfsorientierten Sozialhilfesatzes usw.. Den Fundamentalisten in der Auseinandersetzung, die das bestehende Sozialversicherungssystem in Frage stellen, treten Sozialstaatsreformer entgegen, die die Notwendigkeiten seiner gründlichen Reformierung in keiner Weise abstreiten, jedoch gerade in der Anpassungsfähigkeit des bisherigen Kassenwesens einen seiner entscheidenden Vorzüge sehen.[2] Die gelten dann in der Debatte als besonnen bzw. als verbohrte Besitzstandswahrer, obwohl der von ihnen angemeldete Handlungsbedarf nichts von Halbherzigkeit erkennen läßt.
Warum die Sozialstaatsdebatte so grundsätzlich wird
In der desolaten Finanzlage der Sozialkassen registrieren die Zuständigen einen banalen Sachverhalt: Der Lohn, die Finanzquelle dieser Kassen, gibt die Leistung nicht mehr her, die sie ihm abverlangen. Sie verhandeln über Einrichtungen, die mit verstaatlichten Anteilen des Lohns der arbeitenden Bevölkerung den Erhalt der fürs Kapital unbrauchbaren, von ihm überflüssig gemachten bzw. verschlissenen Bestandteile des Arbeitsvolks finanzieren und auf diese Weise dafür sorgen, daß die Angehörigen der auf den Dienst an fremdem Eigentum festgelegten Klasse auch in den Lebenslagen, in denen dieses Dienstverhältnis für sie keinen Lohn abwirft, von nichts anderem als vom Lohn leben. Weil es der Auftrag der Sozialkassen ist, den Lohn so umzuverteilen, daß er für den Unterhalt der ganzen Klasse der Lohnabhängigen reicht, machen sich die Erfolge der Unternehmer, ihre Lohnkosten zu senken, als Finanzprobleme dieser Kassen bemerkbar. Die durch leistungssteigernde Rationalisierungen überflüssig gemachten Lohnempfänger bilanzieren sich bei ihnen einerseits als ausfallende Einnahmen und verlängern auf der Ausgabenseite die Liste derer, die auf ihre Leistungen verwiesen sind; und alle in- und außerhalb der Tarifrunden stattfindenden Anstrengungen der Unternehmer, die Geldsumme herunterzudrücken, die das Arbeiterindividuum im Dienst am Kapital verdient, schlagen zusätzlich noch einmal negativ auf der Einnahmenseite zu Buche.[3] Die zuständigen Kassenwarte, die diesen Sachverhalt als Finanzprobleme ihrer Institute behandeln und wie einen unumstößlichen Sachzwang verhandeln, dem sie unterliegen, beweisen damit zuallerst eines: Sie halten eisern am staatshaushaltsschonenden und dem Klassenverhältnis so gemäßen Prinzip ihres Zwangsversicherungssystems fest, daß die Kost, die Unternehmer gesamtgesellschaftlich für die lohnende Anwendung von Arbeit verausgaben, die ganze Arbeiterklasse ernähren muß. Damit steht grundsätzlich auch der Handlungsbedarf fest, den sie aus dem wachsenden Finanzbedarf der Sozialkassen laufend ableiten: Weil weniger Lohn bezahlt wird – sowohl individuell wie gesamtgesellschaftlich –, muß mehr von ihm verstaatlicht werden.
Auf die Dauer allerdings, wenn der Sozialstaat immer mehr Lohn zur Finanzierung seiner Einrichtungen beschlagnahmt, wenn sich womöglich die Anzeichen dafür häufen, daß nicht zuletzt durch den wachsenden staatlichen Zugriff auf den Lohn der Lebensstandard der arbeitenden Bevölkerung, der sich mit den verbleibenden Einkommen noch finanzieren läßt, immer deutlicher in Richtung auf den Leistungsstandard hin tendiert, den die Sozialkassen ihrer Klientel gewähren, sehen die Verantwortlichen gewisse „Grenzbelastungen“ erreicht und bekennen sich zu der Zielsetzung, für „Beitragsstabilität“ zu sorgen. Unter dieser Zielsetzung betreiben sie seit geraumer Zeit eine Reformpolitik, mit der sie das Leistungsniveau der Sozialversicherungen an die schwindende Leistungskraft ihrer Finanzquelle anpassen. Angespornt werden sie in dieser Bemühung – die Beitragserhöhungen natürlich überhaupt nicht überflüssig macht – durch Rücksichten, die sie auf den Unternehmerstand nehmen. In der wachsenden Diskrepanz zwischen dem Lohn, den Unternehmer zahlen, und dem davon immer geringeren Anteil, der der arbeitenden Bevölkerung als Einkommen zufließt, sehen sie eine wachsende Belastung der Arbeitgeber durch „Lohnnebenkosten“. Das stellt die Sache zwar ziemlich auf den Kopf; schließlich vergreift sich der Staat nicht an der Einkommensquelle seiner Unternehmer, sondern bedient sich ausschließlich an der Kost für Arbeit, die sie verausgaben, weil und sofern sich der Einsatz der Arbeit für sie lohnt. Für Politiker, die das Senken von Lohnkosten zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der nationalen Wirtschaft für geboten halten, kommt es jedoch schon einer Geschäftsschädigung nahe, wenn die Anstrengungen der Unternehmer, diese Kost nach Kräften zu ihren Gunsten variabel zu gestalten, dadurch konterkariert werden, daß der Sozialstaat einen immer größeren Teil von ihr zur fixen Größe erklärt, die er für seine Kassen beansprucht. Auch in der Hinsicht macht es Sinn, durch die Kürzung von Leistungen und die Privatisierung von Kosten, für die bislang der Sozialstaat aufgekommen ist, wenigstens die Steigerungsraten in Grenzen zu halten, mit denen zusätzliche Lohnprozente verstaatlicht werden.[4] Die privatisierten Kosten belasten dann die Lohneinkommen der Versicherten exklusiv, ohne über den Automatismus des Abrechnungsmodus – Arbeitgeber und Arbeitnehmer „zahlen“ je die Hälfte – die Lohnkosten der Arbeitgeber zu strapazieren.
Mit ihrer Reformpolitik liefern die Zuständigen den praktischen Beweis, daß der Sozialstaat auch mit ein paar Millionen Arbeitslosen prächtig funktioniert. Sie sehen in der Anpassungsfähigkeit ihres Kassenwesens, das mit der wachsenden Zahl der auf Sozialleistungen Angewiesenen einfach dadurch fertig wird, daß die Ansprüche auf diese Leistungen zusammengestrichen werden, sogar ein Gütesiegel ihrer Einrichtungen und entnehmen dem nach wie vor wachsenden Finanzbedarf dieser Institute unverdrossen den Auftrag zur konsequenten Fortsetzung des eingeschlagenen Reformkurses. Auf diese Weise haben sie mit einigen entschlossen durchgeführten Kostendämpfungsrunden für jedermann sichtbar offengelegt, wie wenig der Sozialstaat wirklich leistet. Eine Arbeitslosenversicherung, die gerade dann ihre Leistungen verweigern muß, wenn sie einmal zeigen könnte, wozu sie imstande ist, entzieht den in Umlauf gesetzten Gerüchten über ihre Funktion, die nationale Arbeiterschaft für den Dienst am Wirtschaftswachstum brauchbar zu halten oder sogar brauchbar zu machen, jede Grundlage und blamiert gründlich das Jahrzehnte lang gepflegte Gerede vom entscheidenden Beitrag, den der Sozialstaat am Erfolg der Nation hat.[5] Es zeigt sich, daß der schäbige Auftrag des Sozialstaats doch bloß darin besteht, dafür zu sorgen, daß der menschliche Ausschuß des Kapitalismus mit dem umverteilten Lohn auskommt. Weil ein weitergehender nationaler Nutzen dieser Alimentierung nicht absehbar ist, wird der Sozialstaat so fundamentalistisch in Frage gestellt. Denn eines steht in der Auseinandersetzung für alle Beteiligten fest: Daß das Durchfüttern von Minderbemittelten kein Staatszweck ist.[6]
Die „Unkosten des Sozialstaats“
In dieser Debatte erfreut sich die klassenneutrale Figur des Beitragszahlers wachsender Beliebtheit. In ihrem Namen lamentieren Unternehmer, Gewerkschaften und Politiker über die ausufernden Lasten, die der Sozialstaat dem sich paritätisch aus Arbeitgebern und Arbeitnehmern konstituierenden nützlichen Staatsvolk aufbürdet. Die Klageführer machen kein Geheimnis daraus, daß sie für die Alimentierung der unbrauchbaren Bestandteile des Arbeitsvolks nichts übrig haben: Daß die nutzlose Mannschaft keinen Anteil an der nationalen Reichtumsproduktion hat, spricht gegen sie; und daß der Sozialstaat sie alimentiert, spricht gegen ihn. Weil den dafür verausgabten Kosten die politische Rechtfertigung fehlt, sind es Unkosten, denen durch adäquate Maßnahmen Einhalt zu gebieten ist. An diesbezüglichen Vorschlägen mangelt es nicht. Das bringt die Debatte erst einmal in Schwung.
Entschiedenste Verfechter dieses Standpunkts sind die Kapitalisten und ihre Verbände. Wie in den Zeiten der Einführung der ersten Fabrikgesetze melden sie sich mit einem Geschrei über die wirtschaftlich ruinösen Folgen aller sozialstaatlichen und tarifvertraglichen Regelungen zu Wort. Das ist nicht weiter verwunderlich. Auf Basis des etablierten Sozialsystems und nach dessen Rechnungsweise verbuchen sie ihren „Arbeitgeberanteil“ als staatlich verfügte Zusatzbelastung ihrer „eigentlichen“ Lohnkosten und verlangen vom Staat Lohnkürzungen per Reduzierung ihrer anteiligen Ablieferungspflicht. Außerdem bestehen sie standesgemäß auf dem Standpunkt unternehmerischer Willkür, der sich durch Sozialgesetze prinzipiell verletzt weiß. Weil sie sich in diesem Standpunkt politisch ins Recht gesetzt sehen, werden sie in ihren Forderungen etwas zügellos. Sie zeigen mit ihnen, daß sie für den Erhalt der Arbeiterklasse, die sie benutzen und mit einem untauglichen Lebensmittel ausstatten, also in ihrem Bestand gefährden, kein Verständnis haben, und erinnern nachdrücklich daran, daß die Sorge um den Zustand ihres Geschäftsmittels wenn überhaupt, dann ein nationales Anliegen ist, das der Staat gegen sie durchsetzen muß.
Zu den Vertretern des Beitragszahler-Arguments gehören mittlerweile auch die Gewerkschaften. Das ist schon eher verwunderlich. Schließlich vertreten sie die Beitragszahler, die auf die Leistungen des Sozialstaats angewiesen sind. Wenn sich die deutschen Arbeitervereine im Namen von mehr „Beitragsstabilität“ neuerdings für den Vorschlag stark machen, im Gesundheitswesen nicht nur „für einzelne Leistungssparten einen Ausgabenhöchstbetrag“ einzuführen, sondern „ein Globalbudget für alle Kassenleistungen“,[7] wenden sie sich gegen ein Stück sozialstaatlich organisierter Vorsorge für die mit der Lohnarbeit verbundenen Lebensrisiken. Sie haben dabei das Argument auf ihrer Seite, daß diese Vorsorge ihre Mitglieder teuer zu stehen kommt und deren Lohn zunehmend überfordert. Da sie sich jedoch längst nicht mehr zuständig wissen, dafür zu sorgen, daß der Lohn die Lebensnotwendigkeiten ihrer Mitglieder hergibt, bleibt ihnen nur, beim Staat um Verständnis für die Notlage ihrer Mitglieder zu werben und dafür zu plädieren, er möge bei der Bemessung der Krankenkassenleistungen mehr Rücksichten darauf nehmen, was sich seine Arbeiterklasse mit ihrem Lohn an Gesundheitsvorsorge noch leisten kann. Die Gewerkschaften rufen mit ihrem Plädoyer in Erinnerung, daß diejenigen, die von der Lohnarbeit leben müssen, sich nicht auch noch mit eigenen Mitteln und aus eigenem Interesse um den Bestand ihrer Klasse kümmern können. Im Wissen um die Tatsache, daß es das im Dienst am Kapital verdiente Einkommen gar nicht gestattet, für die Zeiten vorzusorgen, in denen dieses Dienstverhältnis kein Einkommen abwirft, setzt der Staat auch der Arbeiterklasse gegenüber deren eigene Reproduktion als nationales Anliegen gewaltsam durch, indem er Zwangsabzüge vom Lohn erhebt.
Also erhebt sich die Frage, wie es der Sozialstaat, der sich die Korrektur am praktischen Standpunkt seiner Klassen erlaubt, mit seinem Anliegen hält. Denn nicht zuletzt seine Vertreter zeigen tiefes Verständnis für die Sorgen des Beitragszahlers. Und zwar nicht bloß deswegen, weil sie sich sowieso gerne auf ihr Volk berufen. Es ist nämlich nicht zu übersehen, daß sie es nicht bei der Berufung auf einen vorfindlichen Standpunkt belassen, sondern daß sie auf diesen grundsätzlich sozialstaatskritischen Standpunkt Wert legen und ihr Volk entschlossen für ihn agitieren.
Wie das geht, hat jüngst der sächsische Ministerpräsident Biedenkopf, seines Zeichens Ökonomie-Professor, beispielhaft vorgeführt. Er ist mit einem Grundsatzpapier an die Öffentlichkeit getreten,[8] in dem er etwas für die seiner Auffassung nach dringend gebotene „Aufklärung der Bevölkerung“ zu tun verspricht:
„Da die Mehrheit der Bevölkerung wohlhabend ist und durch Erbgang ein neuer Wohlstandswachstumsschub bevorsteht, kann der ärmere Teil (die Minderheit) nicht mehr den wohlhabenden Teil zwingen, sich an Umverteilung zu beteiligen.“
Eine etwas eigenartige Auffassung von Minderheit und Zwangsgewalt in der kapitalistischen Gesellschaft; außerdem ein gewisser Widerspruch zu der von Biedenkopf empfundenen Notwendigkeit, eine uneinsichtige „Mehrheit“ darüber aufklären zu müssen, daß und wie sie ausgeplündert wird. So genau darf man aber seine Beschreibung des Zustandes, der die Bevölkerung, namentlich die „arbeitende“, knechtet, ohnehin nicht nehmen. Einiges läßt er bewußt im Dunkeln; z.B. die Motive des Staates bei der angesprochenen zwangsweisen Umverteilung, die Materie dieser Umverteilung, die ökonomischen Charaktere der Beteiligten etc. Soviel wird jedoch deutlich: Biedenkopf ist der Auffassung, daß für die deutsche Arbeiterklasse der Zenit ihres „Wohlstandes“ überschritten ist. Er klärt sie über ihre Zukunftsperspektiven auf, die ihr das im internationalen „Wettbewerb“ engagierte Kapital diktiert; er macht sie damit vertraut, daß sich die „vorhandenen Arbeitschancen“, die sie ernähren, nicht im „notwendigen Umfang“ vermehren lassen; und er fordert sie auf, sich illusionslos der „demographischen Entwicklung“ zu stellen, die unausweichlich dazu führen wird, daß der Lohn von immer weniger Beschäftigten immer mehr Rentner miternähren muß.
Im Lichte dieser Zukunftsperspektiven prangert er den untragbaren Zustand an, daß die arbeitende Bevölkerung darauf verpflichtet wird, unproduktives Volk mit durchzufüttern; und zwar von einem Sozialstaat, auf dessen Leistungen sie selbst ob ihres satten Wohlstands angeblich nicht mehr angewiesen ist. Mit dem aufklärerischen Gestus, in dem er das nützliche Staatsvolk darauf hinweist, daß es sich den Anschlag auf seine Taschen nicht länger bieten zu lassen braucht, zeichnet er das Bild einer Mannschaft, die desinformiert in dem Fehlglauben lebt, ihre Existenz sei gesichert, und erteilt sich damit den Auftrag, ihre „Sicherheitsillusionen“ gründlich zu zerstören:
„So ist es bis heute nicht möglich, die arbeitende Bevölkerung über die wahre Höhe der Abgaben zu unterrichten, die sie an ihrem Arbeitsplatz durch ihre Leistung erarbeiten müssen, um beschäftigt werden zu können. Noch immer glaubt eine Mehrheit, der Arbeitgeber leiste einen eigenständigen Beitrag zu den Kosten, der die Beschäftigungschancen der Arbeitnehmer nicht beeinflußt.“
Daß Unternehmer mit dem Lohn, den sie für ihre Arbeitskräfte bezahlen, den Rechtstitel auf die Leistung erwerben, die sie ihnen abverlangen; daß ihnen mit der Entrichtung des Lohns diese Leistung ganz gehört und sie von ihr nichts „abgeben“; daß der Sozialstaat keinen Tribut auf diese Leistung erhebt, sondern Anteile vom Lohn einbehält; daß diese Lohnanteile weg sind und am Arbeitsplatz nicht wieder „erarbeitet“ werden – all das weiß Biedenkopf natürlich auch. Die Vorstellung, die Belegschaften müßten einen erheblichen Teil ihres Arbeitstages damit verbringen, den vom Sozialstaat verschleuderten Reichtum zu erarbeiten, so daß die Unternehmer mit dem verbleibenden Rest der Arbeitsleistung kaum mehr auf die ihnen zustehenden Kosten kommen und sich das Arbeitgeben dreimal überlegen, paßt jedoch viel besser zu dem Lernziel, das Biedenkopf für seine Volksgenossen vorgesehen hat. Mit seinem Szenario, in dem ein wachsendes Rentnerheer, mit unumstößlichen, staatlich garantierten Ansprüchen ausgestattet, den Reichtum aufzehrt, den die arbeitende Bevölkerung schafft, und diese darüber auch noch um ihre Beschäftigungschancen bringt, weist er sie darauf hin, daß die Alimentierung der Alten ihre sicher geglaubte Existenz gefährdet – und sie umdenken müssen. Und zwar in eine Richtung, die den Kunstgriff, mit dem Biedenkopf seine Adressaten schon die ganze Zeit mit ihren eigenen Ansprüchen konfrontiert, endgültig seiner Fadenscheinigkeit überführt. Sie sollen einsehen, daß ihr Anspruch auf eine irgendwie gesicherte Altersversorgung untragbar ist, der so getrennt von ihrer Interessenslage, wie es Biedenkopf nahelegt, wenn er ihr die Ansprüche der Alten entgegenstellt, dann doch nicht existiert:
„Nach wie vor ist die Mehrheit der Beitragszahler in der gesetzlichen Rentenversicherung überzeugt, sie erhielten später ihre Beiträge zurück. Sie kennen also immer noch nicht den Unterschied zwischen Altersfürsorge (für die heutigen Alten) und Altersvorsorge (für ihr eigenes Alter)…“
Der Mangel an Bildung, den Biedenkopf konstatiert, bezieht sich auf einen Unterschied, für dessen praktische Durchsetzung er sich gerade stark macht. Er besteht auf der Aufhebung des Zusammenhangs zwischen Beitragszahlung und Rentenanspruch, der zwar noch nie so bestanden hat, wie es sich die Volksmeinung angeblich vorstellt, der bislang aber auch nicht in der Weise aufgekündigt ist, wie es Biedenkopf verlangt. Wenn er gegen das Mißverständnis anrennt, die Versicherten würden mit ihren Beiträgen einen Anspruch auf staatliche Altersfürsorge erwerben, der sie davon entbindet, für ihr Alter selbst vorzusorgen, will er gegenüber der Rentenversicherung künftig den Maßstab nicht mehr gelten lassen, sie habe – wie auch immer – für das Einkommen der Alten aufzukommen, und die Versicherten darauf verpflichten, selbst rechtzeitig zuzusehen, daß sie im Alter nicht auf dem Trockenen sitzen. Er läßt es also nicht an Klarheit fehlen, wie sein Befund, die arbeitende Bevölkerung sei in der Regel wohlhabend und könne für sich selbst vorsorgen, und seine Erkenntnisse über massenhaft bevorstehende Erbschaften zu verstehen sind. Er plädiert mit ihnen dafür, daß der Staat seine Zuständigkeit für die Bevölkerungsteile zurücknehmen soll, die aus ihrem Lohnarbeiterdasein ihren Unterhalt nicht selbst hinkriegen.
Mit diesem Standpunkt steht Biedenkopf nicht als radikaler Außenseiter in der politischen Landschaft. Wenn anläßlich einer Steuerdebatte aus den Reihen der SPD der empörte Aufschrei ertönt, man solle Steuern nicht zur Finanzierung des Existenzminimums von Minderbemittelten „verfrühstücken“,[9] wenn Seehofer die Auffassung nahelegt, Sozialhilfeempfänger seien arbeitslos, weil sie vom Staat ausgehalten werden, oder wenn sein Kollege im Arbeitsministerium die Werttheorie auf Arbeitslose anwendet, um die Minderung ihres „Ersatzlohns“ zu beschleunigen, dann wird allemal mit der Gleichung von unproduktiv = nicht erhaltenswert argumentiert. Die vom Kapital nach seinen Erfolgskalkulationen praktisch vollzogene Scheidung der Arbeiterbevölkerung in einen benutzten und entlohnten und in einen unbrauchbaren und daher auch nicht mit einem Einkommen ausgestatteten Teil wird in ein Urteil über die geschiedenen Bevölkerungsteile übersetzt, das die ihnen vom Kapital zuteil werdende Behandlung rechtfertigt. Und mit diesem Werturteil, das als solches allgemeine Anerkennung beansprucht, ist auch der Anspruch in die Welt gesetzt, der Staat habe sein Handeln an ihm auszurichten. Auf sein Tun übertragen, ist es die Quelle der grundsätzlichsten Kritik am Sozialstaat, der mit der Alimentierung von unnützem Volk gegen den überhaupt nicht veralteten moralischen Grundsatz verstößt: Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen.
Die billigste Lösung: Der Sozialstaat
Über die praktische Relevanz dieses theoretisch allseits präsenten Grundsatzes entscheidet allerdings überhaupt nicht die Moral. Seine allzu forschen Anhänger bekommen von den zuständigen Managern der Staatsnotwendigkeiten – im folgenden ist es Blüm, der diesen Part übernimmt – ein politisches Bedenken entgegengehalten, dem sie Rechnung tragen müssen und dem sie als politisch denkende Zeitgenossen auch aufgeschlossen sind:
„Wer tragende Prinzipien unseres Gemeinwesens – aus welchen Gründen auch immer – verändern will, der muß tatsächlich und politisch tragfähige Alternativen aufzeigen. Fehlen diese Alternativen, so führen Fundamentaldiskussionen in der Sache nicht weiter.“ [10]
Als müßte eine moralisch durchgeknallte Mannschaft erst wieder zur Besinnung gebracht werden, daß gar nicht die Wohltat der Alimentierung Minderbemittelter zur Verhandlung steht, sondern eine Staatsaufgabe, erinnert Blüm daran, daß der „aus welchen Gründen auch immer“ einleuchtende Vorschlag, den menschlichen Schrott, den der Kapitalismus hinterläßt, nach Möglichkeit sich selbst zu überlassen – pardon: der arbeitenden Bevölkerung die Empfehlung mit auf den Weg zu geben, sich privat zu versichern –, das Ärgernis gar nicht beseitigt, um das es geht. Der wohlfeile Einfall ändert nämlich gar nichts daran, daß der Staat auf einem Haufen Volk sitzt, das zu nichts Staatsnützlichem zu gebrauchen, mit keinem Lebensmittel ausgestattet und deswegen vom Staat irgendwie zu verwalten ist:
„Wer aus dem heutigen Sozialversicherungssystem aussteigt, darf sich … nicht dem Trugschluß hingeben, daß in einem anderen System die soziale Sicherheit kostenlos zu haben wäre.“
So bleibt es den zu radikalen Lösungen aufgelegten Sozialstaatskritikern doch nicht erspart, sich der Frage nach dem zweckmäßigsten Umgang mit diesem Ärgernis zu widmen. Und diese Fragestellung gibt der Debatte, die mit der Klage über die ausufernden „Unkosten“ des Sozialstaats beginnt, eine bemerkenswerte Wende. Denn das durchschlagende Argument, das letztlich doch immer wieder – zumindest grundsätzlich – für das bestehende Sozialversicherungswesen spricht, lautet schlicht und ergreifend: Eine billigere Weise, den sozialen Problembestand des Kapitalismus zu verwalten, ist nicht in Sicht. Erkenntnisse wie die folgende gelten daher als ungemein überzeugend:
„So werden in Deutschland nur acht Prozent des Sozialprodukts für Gesundheitsleistungen ausgegeben, während es im privatwirtschaftlichen System der USA elf Prozent sind.“
Das spricht schon mal für „Niveau und Effizienz“ des deutschen Kassenwesens, auch wenn die Floskel vom „Sozialprodukt“ dessen entscheidenden Vorzug eher verschleiert als verdeutlicht. Es kommt nämlich nicht einfach nur auf die Niedrigkeit der Kosten fürs Soziale an, sondern vor allem darauf, wer sie trägt. Vorschläge, die auf eine mit Steuern finanzierte Sozialverwaltung abzielen, die die Einkommensquelle aller Bürger belasten und damit auch die der maßgeblichen, in deren Händen sich der nationale Reichtum akkumuliert, kommen deswegen grundsätzlich ziemlich schlecht weg:
„Denkbar wäre eine allgemeine Grundversorgung plus Eigenvorsorge. Jedoch würden sich in einem solchen, wohl steuerfinanzierten System, die Wohlhabenden eher schlechter als im bewährten Sozialversicherungssystem stellen.“
Auf den Vorzug des „bewährten Sozialversicherungssystems“ gegenüber einer „allgemeinen Umverteilung“, daß es nur den Lohn der arbeitenden Bevölkerung belastet und innerhalb der Klasse der Lohnabhängigen umverteilt, daß seine vielbeklagten „Kosten“ also gar keinen Abzug von dem Reichtum darstellen, auf den es im Kapitalismus ankommt, wollen die deutschen Sozialstaatsmanager nicht so schnell verzichten. Blüm mag ihn seinem Volk auch nicht vorenthalten, das mit „selbsterworbenen Ansprüchen“ nach dem „Prinzip Leistung für Gegenleistung“ entschieden besser fährt, als wenn es sich in die grausame Abhängigkeit von „der Bereitschaft der Steuerzahler, für die Rentner einen Teil des Steueraufkommens abzuzweigen“, begibt. So bleibt der Nation auch die mit dem Beitragszahlerargument etwas demolierte Solidaritätspropaganda des Staats bis auf weiteres erhalten.
Die Leistung der Debatte
Mit einer Bestätigung des status quo hat das Pochen aufs „bewährte“ Prinzip des Sozialversicherungssystems freilich nichts zu tun. Schließlich leistet die Debatte das genaue Gegenteil. Haben für die alte Bundesrepublik die guten Gründe ihrer sozialstaatlichen Verfassung im Prinzip festgestanden und hat sie auf dieser anerkannten Grundlage ihre Sozialverwaltung dem Kostengesichtspunkt unterworfen, steht das neue Deutschland mit seiner Sozialstaatsdebatte umgekehrt prinzipiell auf dem Standpunkt, daß das Soziale am Staat eine durch keinen nationalen Nutzen gerechtfertigte Unkost ist. Vom Standpunkt der Unkosten aus stellt es die Notwendigkeit der eingerichteten sozialstaatlichen Verhältnisse in aller Grundsätzlichkeit in Frage und verlangt, daß sich vor diesem prinzipiellen Zweifel an ihrer Notwendigkeit alle Sozialeinrichtungen politisch neu zu rechtfertigen haben – denn daß sie für den Staat überflüssig werden, bloß weil ihre Klientel in die Rubrik nutzlose Überbevölkerung fällt, stimmt gerade nicht. Bei der Neudefinition ihres Auftrags bekennen sich die Maßgeblichen dazu, daß sie eine Last zu verwalten haben. Ihre Aufgabe sehen sie darin, den Sozialstaat von jedem überkommenen Anspruch zu befreien, der auch nur das Mißverständnis nahelegen könnte, seine Einrichtungen wären für einen Ersatz für ausbleibende Lohneinkünfte zuständig und hätten ihrer Kundschaft doch irgendwie eine Fortsetzung ihrer bisherigen bürgerlichen Existenz zu ermöglichen. Mit diesem selbstbewußten Standpunkt betreiben sie ihre Reformen. Sie exekutieren also auch nicht einfach die in ihrem Kassenwesen angelegten Sachzwänge einer notorisch desolaten Finanzlage, sondern handhaben die Finanzprobleme der Kassen souverän als heilsamen Zwang[11], der es allen Beteiligten aufnötigt, sich dem Auftrag zu stellen, den deutschen Sozialstaat an die Erfordernisse einer vom Kapital produzierten, dauerhaften und wachsenden Überbevölkerung anzupassen, die für das Kapital auch nicht mehr als Reservearmee in Betracht gezogen wird. Daß sie bei der Durchsetzung ihres Auftrags auf nationale Belange Rücksicht nehmen, daß sie in ihrer Reformpraxis überhaupt der Notwendigkeit einer staatlichen Sozialverwaltung, den funktionellen Gesichtspunkten ihrer verschiedenen Abteilungen sowie deren zweckmäßiger Abstimmung aufeinander Rechnung tragen und deswegen von den radikalsten Vorschlägen, mit denen der ungebremste Moralismus einer nach kapitalistischen Nützlichkeitskriterien vollzogenen Sortierung des Volks vorprescht, nur die Hälfte wahrmachen, trägt ihnen – auch das gehört zu den Leistungen der Debatte – den Schein der Zurückhaltung ein.
Der aktuelle Handlungsbedarf
Die nächsten praktischen Schritte bauen durchgängig auf den Erfolgen der gelaufenen Sozialstaatsreformen auf, die die bemerkenswerte Eigenschaft haben, den ihnen zugrundeliegenden Handlungsbedarf nicht zu befriedigen, sondern zu verallgemeinern und auszuweiten.
a.) Die Pflegeversicherung ist dafür nur ein besonders prägnantes Beispiel, weil mit ihrer Einführung in mehrfacher Hinsicht Maßstäbe gesetzt worden sind, an denen die Reformpolitik ihre nächsten Fortschritte macht: Erstens rechnet ein Sachverständigengutachten vor, „die Arbeitgeber würden mit der Streichung des Buß- und Bettags in 15 Ländern nur zu höchstens zwei Dritteln für ihre Pflegebeiträge kompensiert, wenn diese am 1. Juli 1996 steigen“,[12] und legt damit erneut Handlungsbedarf offen: Weil mehr Lohn verstaatlicht werden soll, sind Arbeitgeber von weiteren Lohnzahlungen für in Anspruch genommene Arbeitskraft zu befreien. Diese Forderung steht dermaßen fest, daß zur Diskussion einzig noch die Frage steht, ob die Streichung eines weiteren Feiertages den Kirchen zugemutet werden kann, oder ob der Urlaub bzw. die Lohnfortzahlung an Krankheitstagen gekürzt werden muß. Fest steht diese Forderung deswegen, weil mit der Kompensation von Arbeitgeberbeiträgen eben nicht nur an einer Stelle im Sozialstaat eine etwas außergewöhnliche Maßnahme ergriffen, sondern ein neues Prinzip durchgesetzt worden ist. Die Politik hat sich mit ihr dazu bekannt, Beitragserhöhungen unter der Prämisse zu beschließen, daß sie den Preis der Arbeit für den Unternehmerstand nicht erhöhen dürfen. Der damit praktisch anerkannte Gesichtspunkt emanzipiert sich daher zweitens vom Anlaß und behaupteten Grund seiner Einführung und beflügelt eine Debatte darüber, ob es nicht überhaupt zum Zwecke der Lohnkostensenkung nützlich wäre, die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall zu kürzen oder endlich den Skandal aus der Welt zu schaffen, daß Arbeitgeber ihren Mitarbeitern die Urlaubszeit zahlen müssen, in der sie doch gar nicht für sie arbeiten. In beiden Fällen wird der Anspruch erhoben, daß der Lohn nur den Teil eines Arbeiterlebens zu vergüten hat, den die Arbeitskraft im Betrieb verbringt, und die Reproduktion der Arbeitskraft nicht zu bezahlen hat. Drittens hat sich der geniale Einfall, dem Staat durch Eröffnung einer neuen Kasse für Sozialleistungen, für die bislang seine alten Kassen zuständig waren, eine zusätzliche Finanzquelle zu erschließen, offensichtlich derart bewährt, daß die Pflegeversicherung mittlerweile als Modell gehandelt wird, für das sich weitere Anwendungsfälle denken lassen.[13] – Wie gesagt, nur ein Beispiel dafür, wie wenig die Probleme, mit denen sich die Sozialpolitik befaßt, mit Notlagen zu tun haben, und wie sehr sie ganz in der Handlungsfreiheit begründet sind, die sie sich verschafft hat.
b.) Von den durchschlagenden Wirkungen der letzten Kostendämpfungsrunden können die für die Sozialhilfe zuständigen Gemeinden ein Lied singen. Sie verzeichnen einen sprunghaft wachsenden Zulauf bei ihren Fürsorgeämtern, der eindrucksvoll belegt, wie erfolgreich die Arbeitslosenversicherung bei der Kürzung ihrer Leistungen war. Kein Wunder also, daß sich an der Schnittstelle zwischen Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe der nächste Handlungsbedarf auftut. Er ergibt sich in folgender, von der Frankfurter Rundschau vom 15.7.1995 völlig korrekt wiedergegebener Reihenfolge: „Die Zahl der Langzeiterwerbslosen steigt. Bonn reagiert auf die Mehrausgaben mit dem Abbau der Arbeitsförderung. Beide Entwicklungen schlagen sich in den Kassen der Sozialhilfeträger als zusätzlicher Kostendruck nieder. Am kommenden Dienstag bringt Gesundheitsminister Seehofer den Entwurf seines Sozialhilfe-Reformgesetzes ins Kabinett.“
Warum die Anzahl der Arbeitslosen wächst, die von vornherein keinen bzw. nie mehr einen Arbeitsplatz bekommen, ist angesichts eines Verhältnisses von 10 zu 1 zwischen den Arbeitsuchenden und den angebotenen Stellen überhaupt kein Rätsel. Die wachsende Diskrepanz zwischen dem vom Kapital geschaffenen Angebot an überflüssig gemachten Arbeitskräften und seiner Nachfrage nach ihnen ist allerdings nur der halbe Grund dafür, daß der Staat immer mehr Langzeitarbeitslose registriert. Er selbst hat mit der Verkürzung der Dauer, für die Arbeitslosengeld gezahlt wird, und mit der Verschärfung der Bedingungen, unter denen es gewährt wird, dafür gesorgt, daß die Einordnung in diese Rubrik beschleunigt erfolgt. Das rückt nun die für sie zuständige Arbeitslosenhilfe verstärkt ins Blickfeld der Reformer. Diesem aus Steuermitteln finanzierten Ableger der Arbeitslosenversicherung hat der Staat eine Zwischenstellung zwischen der Arbeitslosenversicherung und der Sozialfürsorge zugewiesen: Er zahlt nur – ähnlich wie die Fürsorge –, wenn der Antragsteller für seinen Unterhalt nicht mit seinem eigenen „Vermögen“ aufkommen kann; seine Zahlungen bemessen sich jedoch – ähnlich wie beim Arbeitslosengeld – grundsätzlich nach einem Prozentsatz von dem einmal verdienten Lohn; wobei ‚grundsätzlich‘ zu unterstreichen ist, weil sich die Arbeitslosenhilfe wesentlich dadurch auszeichnet, daß ihre Bemessungsgrundlage mit der Dauer der Arbeitslosigkeit kontinuierlich nach unten korrigiert wird. Mit dieser Ausnahme von der Regel, ausschließlich mit abgezweigten Lohnprozenten den Zwang zu organisieren, daß auch die Erwerbslosen vom Lohn leben müssen, hat der Staat bei der Einrichtung dieses Instituts in weiser Voraussicht dem Umstand Rechnung getragen, daß jede längerfristige Arbeitslosigkeit das Finanzierungsprinzip seiner Arbeitslosenversicherung von vornherein sprengen würde. Er hat sich diese Ausnahme allerdings unter einem funktionellen Gesichtspunkt genehmigt, der die Regel ausdrücklich bestätigt. Seine Arbeitslosenunterstützung handhabt er als Druckmittel, die auf sie Angewiesenen wieder der Lohnarbeit zuzuführen, indem er die Höhe ihrer Bezüge mit der Dauer ihrer Erwerbslosigkeit kürzt und damit den Zwang auf sie erhöht, Arbeitsangebote auch unter immer schlechteren Bedingungen für zumutbar zu befinden.
So, daß der Staat mit Steuergeldern für den Unterhalt massenhaft anfallender und damit absehbarerweise chancenloser Dauerarbeitsloser einsteht, war die Arbeitslosenhilfe also nie gemeint. Weil die Chancen gar nicht angeboten werden, auf deren Nutzung ihre Klientel verpflichtet werden soll, verliert sie ihre funktionelle Bedeutung und die Zahlung, die sie leistet, ihren Rechtfertigungsgrund. Sie wird daher reformiert. Durchgesetzt wird eine beschleunigte Absenkung der Bemessungsgrundlage für die Arbeitslosenhilfe. Nach der bislang gültigen Regelung wurde sie schrittweise alle drei Jahre nach unten korrigiert, künftig erfolgt die Abstufung vom Akademiker- zum Hilfsarbeiterlohn, auf den der einschlägige Prozentsatz gezahlt wird, in spätestens zwei Jahren. Den Betroffenen bleibt es auch in Zukunft ausdrücklich unbenommen, die Maßnahme dahingehend zu interpretieren, daß auf sie noch einmal der Druck erhöht werden soll, den letzten Versuch zu unternehmen, durch Fallenlassen aller Zumutbarkeitskriterien doch noch eine Stelle zu ergattern. Daß sie dazu mit noch soviel Bereitschaft wenig beitragen können, ist jedoch allgemein bekannt. Also geht es auch weniger darum, ein Druckmittel zu schärfen, als darum, daß der Staat in der weiteren Unterstützung von Langzeitarbeitslosen keinen Sinn mehr sieht, weil er über sie zu dem Urteil gelangt ist, daß sie endgültig abzuschreiben sind.[14] Diese sachgerechte, nämlich den vom Kapital hergestellten Verhältnissen auf dem Arbeitsmarkt entsprechende Einordnung steht für die Bezieher der sog. „originären Arbeitslosenhilfe“ – dem Stempelgeld für Neueinsteiger ins Arbeitsleben – in Zukunft von vornherein fest. Wer den Eintritt ins Berufsleben gar nicht erst geschafft hat, dem werden auch keine Chancen mehr eingeräumt, es noch zu schaffen; das Institut wird daher abgeschafft und seine Klientel direkt an die Fürsorge verwiesen. Die Angleichung der Arbeitslosenhilfe an die Sozialhilfe ist im übrigen ja auch explizites Ziel der Blümschen Reformpläne. Der Grenzwert, unter dem die Bedürftigkeit und damit der Anspruch auf Arbeitslosenhilfe anfängt, wird von derzeit 8000 Mark Eigenmitteln auf die bei der Fürsorge maßgeblichen 2500 Mark abgesenkt. Auch das ist konsequent, wenn für den Sozialstaat erst einmal feststeht, daß die Betreffenden keinen „Notgroschen“ mehr brauchen, weil der letzte Notfall für sie eingetreten ist.
c.) Der Übergang zur Fürsorge ist allerdings auch erst neu zu regeln. Die Leistungskürzungen der Sozialversicherungen, insbesondere der Arbeitslosenkasse, haben nämlich die wohldurchdachte Architektur der Sozialverwaltung gründlich durcheinandergebracht, in der die Zuständigkeiten grundsätzlich so geregelt sind, daß die Sozialämter in jeder Hinsicht die letzte Instanz sind. Sie werden erstens erst dann zuständig, wenn alle Wege ausgeschöpft sind, den anrückenden Problemfall an vorgelagerte Sozialbehörden abzuschieben; wenn sich über das Arbeitsamt keine Möglichkeit ergibt, ihn einer Lohnarbeit zuzuführen; wenn der Ausländerbehörde die Handhaben fehlen, ihn loszuwerden; wenn auch kein Fall für das BAFöG-Amt vorliegt – wenn also behördlich festgestellt ist, daß es sich um ein Element des gesellschaftlichen Bodensatzes vergeigter Existenzen handelt, der allenfalls noch als Störung der öffentlichen Ordnung von sich reden machen kann. Ihre Zuständigkeit üben die Sozialämter in so einem Fall zweitens aus, indem sie die Bedürftigkeit ihrer Kundschaft prüfen und deren nähere und weitere Umgebung im Hinblick auf alle Möglichkeiten durchforsten, dem Staat Unterhaltszahlungen zu ersparen; durch Mobilisierung letzter Geldreserven, durch die Inpflichtnahme von Angehörigen, von Wohnungsgenossen oder auch nur durch die Ausnutzung gutmeinender Nachbarn.[15] Erst wenn auch diese Prüfung erfolglos ausgegangen ist, leisten die Sozialämter Unterhaltszahlungen. Die bemessen sich drittens an einem Existenzminimum, dessen Höhe aus den zum Leben unbedingt benötigten Kalorien, Heizungskosten und Strumpfwaren so kleinlich errechnet wird, daß in dieser Rechnung sogar ein Posten für verdorbene Nahrungsmittel bedacht wird.
Wenn es dennoch immer mehr Arbeitslose, Rentner, untertariflich bezahlte ausländische Arbeitskräfte, aber auch mit ordentlichem Arbeitsverhältnis und Tariflohn ausgestattete Inländer schaffen, in den Genuß der staatlichen Fürsorge zu gelangen, die Zuständigkeit der Sozialhilfe also immer weiter ins ganz normale Lohnarbeiterdasein hineinreicht, weil vorgelagerte Instanzen ihre Dienste versagen, wird diese letzte Instanz in ihrer bisherigen Verfassung ausgehebelt. Sie wird in wachsendem Umfang mit dem Anspruch konfrontiert, nach Maßgabe des Sozialhilfesatzes für einen Lebensstandard einzustehen, der sich aus dem gesamtgesellschaftlich gezahlten Lohn für die Arbeiterklasse nicht mehr finanzieren läßt. So, als untere Einkommensgrenze, die der Sozialstaat seiner vom Lohn abhängigen Mannschaft garantiert, war der Sozialhilfesatz allerdings nie gemeint. Er war einfach eine denkbar schäbige staatliche Definition dessen, was eine nutzlose Existenz kosten darf, also braucht, und die wird revidiert, sobald sie den Charakter einer Schranke für die fällige Beschränkung annimmt, die das Kapital durchsetzt. Mit der Neuregelung des Fürsorgesatzes, die künftig gewährleistet, daß sich ein Sozialhilfe beanspruchender Haushalt mindestens um 15 Prozent schlechter stellt als ein Haushalt mit einer alleinverdienenden Billigarbeitskraft, bereinigen die Zuständigen das aus dem Lot geratene Verhältnis wieder und zwar endgültig.[16] Denn das nunmehr in Gesetzesform gegossene „Abstandsgebot“, sorgt dafür, daß das Mißverhältnis zwischen dem Mindestmaß, das der Sozialstaat für seine Unterstützungsleistungen festsetzt, und dem Lohnniveau nicht mehr auftreten kann, weil er künftig seine Festsetzung des Existenzminimums in Abhängigkeit vom Lohnniveau vornimmt und das der kapitalistischen Rechnungsweise sachfremde Kriterium des Existenzbedarfs dabei nicht mehr anerkennt.[17] Das eröffnet auch gleich neue Perspektiven. Beispielsweise bei der Einführung behördlicher Handhaben, den Regelsatz für Sozialhilfeberechtigte um 25 Prozent zu kürzen, wenn sie sich gegenüber der Drangsalierung mit dem Anspruch, sich nützlich zu machen, nicht aufgeschlossen zeigen.[18]
d.) Der Gesundheitsminister hat die nächste Stufe seines Reformwerks angekündigt, die Mitte kommenden Jahres Gesetzesform erlangen soll. Soweit er die Grundzüge seines Vorhabens angedeutet hat, geht es ihm darum, mit den Beiträgen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die er gesetzlich festschreiben will, nur noch einen „Kernbereich medizinischer Leistungen“ finanzieren zu lassen; was darüber hinausgeht, soll künftig „allein von den Versicherten finanziert werden“. Dieses Vorhaben hat er mit der Deckelung von Budgetposten im Gesundheitswesen hervorragend vorbereitet. Die Sachverständigen, die von dem beschränkt zur Verfügung stehenden Etat ausgehen, streiten sich seitdem nur noch um das zweckmäßigste Kriterium, nach dem die Krankenkassenleistungen zusammengestrichen werden sollen. In der Diskussion ist zum einen die Einführung des Schuldprinzips ins Gesundheitswesen:[19] „Individuell beeinflußbare“ Gesundheitsrisiken z.B. durch Rauchen und Trinken, durch übermäßiges Essen, das Abweichungen vom Idealgewicht zur Folge hat, aber auch durch Betreiben gefährlicher Sportarten, sowie durch Auto- und Motorradfahren usw. sollten, so erst einmal die Idee, die Versicherten selber abdecken. Das wirft natürlich die Frage auf, wo die individuelle Beeinflußbarkeit aufhört und die Unausweichlichkeit von Gesundheitsschäden anfängt: Sind Fahrten zur Arbeit vermeidbare Risiken? Bloß die in den Urlaub? Fördert oder gefährdet Sport die Gesundheit? Wo verläuft die Grenze? Was überhaupt ist am Kapitalismus nicht ein gleichermaßen vermeidbares und unausweichliches Gesundheitsrisiko? Die Fachdiskussion hat also noch einiges zu klären. Zum anderen wird über Möglichkeiten nachgedacht, die Scheidung von unbedingt notwendigen und verzichtbaren medizinischen Leistungen in Vorschriften zu gießen. Auch diese Scheidung läßt sich nicht sachlich vollziehen, beflügelt also den unsachlichen Expertenstreit. Theoretisch wird mit diesem Streit jedoch schon mal an dem hehren Prinzip gerüttelt, daß es der fachlichen Kompetenz des Arztes obliegt, über die Notwendigkeiten der Behandlung zu entscheiden, und sich die Kassen die dafür notwendigen Finanzen bei den Beitragszahlern holen.
Der Minister beteiligt sich an solchen Diskussionen nicht. Im souveränen Umgang mit Sachzwängen erfahren, beteuert er, daß der „Kernbereich“, für den die Kassen künftig allein zuständig sein sollen, die im „gegenwärtig geltenden Leistungskatalog“ enthaltenen Leistungen umfassen wird. Wohlweislich will er jedoch nicht diesen Leistungskatalog „gesetzlich festschreiben“, sondern „die Höhe der Beitragssätze“, mit denen der „Kernbereich“ finanziert werden soll.[20] Er setzt damit den heilsamen Zwang in Kraft, der es absehbarerweise notwendig macht, mit jeder künftigen Kostenexplosion, die die Pharmaindustrie, die Ärzteschaft und die Krankenhäuser zustandebringen, den Leistungsumfang zu reduzieren, den die Kassen aus den dann feststehenden Beiträgen noch finanzieren können. Und sorgt auf die Weise dafür, daß die Lohnkosten der Unternehmer – ihr Beitragssatz steht dann ja fest – von künftigen Kostenexplosionen unberührt bleiben und alle steigenden Kosten in Zukunft ungedeckelt aus dem Geldbeutel der Versicherten zu finanzieren sind.
Die Reduzierung der Kassenleistungen auf eine „Grundversorgung“, von den Zuständigen als politisches Vorhaben stets dementiert und ebensooft wieder ins Gespräch gebracht, ist damit erstmals – im Prinzip – als positive Zielvorstellung eingeführt. Der Sozialstaat nimmt seine Zuständigkeit für die medizinische Betreuung der arbeitenden Bevölkerung ein Stück zurück, indem er sie zu einem absehbarerweise beständig wachsenden Teil zu deren Privatangelegenheit macht. Das hat einen guten Grund. Seine Zuständigkeit für ein Gesundheitswesen, das er so organisiert hat, daß er mit den zwangsweise eingesammelten Lohnprozenten den Markt für ein paar blühende Geschäftssphären geschaffen hat – die Pharmaindustrie, den ärztlichen Mittelstand, die Krankenhäuser –, hat sich durch das Schwinden der Leistungskraft der Finanzquelle zunehmend zu dem Widerspruch ausgewachsen, daß sich der Staat mit seinen kostendämpfenden Maßnahmen als Beschränkung dieses Marktes geltend gemacht hat. Das nicht gerade geschäftsfördernde Verfahren, Kostenexplosionen, mit denen besagte Geschäftssphären verdienen, zu deckeln, wird daher für überholt erklärt. Es hat seinen Dienst getan, nämlich bei der Kürzung des Leistungskatalogs der Kassen, der jetzt die Festschreibung der Beitragssätze auf niedrigem Niveau ermöglicht. Danach wird der Deckel gelüftet, so daß das im Gesundheitswesen angelegte Kapital künftig nicht mehr an staatlich gesetzte Marktschranken stößt, sondern austesten kann, wieviel den Versicherten ihre Gesundheit zusätzlich wert ist. Hierfür sollen die Kassen in Konkurrenz zu den Angeboten der Privatversicherer unterschiedliche Tarife zur Wahl anbieten. Die Versicherten sollen Leistungen, die die mit ihren Zwangsbeiträgen finanzierte „Grundversorgung“ dann nicht mehr enthält, gegen höhere Beitragssätze wieder zuwählen können; oder sich mit privaten Zusatzversicherungen eindecken; oder sich für den Grundtarif entscheiden – in der Hoffnung, nicht allzu heftig krank zu werden, und mit der Perspektive, in dem Fall dann ihre Behandlung zu einem erheblichen Teil selbst zahlen zu müssen bzw. sich nicht leisten zu können. Freie Bürger dürfen also künftig frei wählen, nämlich zwischen unterschiedlichen Modi, zugunsten des in seiner Preisgestaltung nicht mehr gedeckelten Gesundheitsgeschäfts anderswo zu sparen.
***
Das alles ist Teil des Klassenkampfs von oben. Des Teils, den nicht Unternehmer führen, sondern der Staat. Der macht sich als Sozialstaat dafür programmatisch zuständig, indem er einen Teil des Lohns der Verfügung seiner Arbeiterklasse entzieht, Höhe wie Verwendung politisch dekretiert und der lohnarbeitenden Klasse damit allgemeine Existenzbedingungen vorschreibt. „Die da unten“ haben dem nichts entgegenzusetzen. Sie werden konfrontiert mit einer Angelegenheit, die ihrem Einfluß entzogen ist, in der lauter Gesichtspunkte eine Rolle spielen, die von der Interessenslage eines Arbeiters oder eines Arbeitslosen meilenweit entfernt sind, und die einen Sachverständigenrat im Gesundheitswesen, Spezialisten für ausgewogene Rentenformeln und Finanzexperten der Kassen mit ihren erlesenen Problemen versorgt. Das Blöde ist nur: Es geht bei der ganzen Angelegenheit um gar nichts anderes als um die Existenz der Arbeiterklasse. Die wird abhängig gemacht von den Kalkulationen höherer Art, in denen manches gesellschaftliche Interesse Berücksichtigung findet, weil es für die Nation von Bedeutung ist, das der lohnarbeitenden Bevölkerung jedoch nicht einmal vorkommt. Angemeldet wird es ja auch nicht. Zu Wort melden sich allenfalls Gewerkschaften, die sich an besagten Kalkulationen mit eigenen Sozialexperten beteiligen und für die Standortbedürfnisse deutscher Unternehmen und die Standortpolitik des deutschen Staates in Sachen Lohnkostensenkung volles Verständnis aufbringen. Ihre spezielle Sorge gilt dem „sozialen Frieden“, den die andere Seite auf harte Proben stellt und den sie unter allen Umständen aufrechterhalten wollen. Deswegen wollen sie seit Jahren den „sozialen Kahlschlag“ verhindern, durch eigene Vorschläge zum „Umbau des Sozialstaats“, dessen Notwendigkeit ihnen nach allen Seiten hin einleuchtet. Deswegen lassen sie davon auch nicht ab, wenn sie erfahren müssen, daß ihre Vorschläge gar nicht sonderlich gefragt sind. Auf ihrer unverdrossenen Suche nach „sozialverträglichen Lösungen“, die sie unter Anerkennung aller maßgeblichen Gesichtspunkte anstellen, haben auch sie die Lohninteressen der Arbeiter gänzlich aus dem Blick verloren. Und das ist eine nicht unerhebliche Leistung für Gewerkschaften, die das anerkannte Monopol auf deren Vertretung haben: Als Arbeiterinteressensvertretungen perfektionieren sie die Subsumtion der Arbeiterklasse unter den Klassenkampf von oben, indem sie sozialen Frieden halten.
[1] Der in GegenStandpunkt 1-95, S.65 erschienene Artikel „Alltag im Klassenstaat“ erläutert, wie der deutsche Sozialstaat funktioniert und was seinen „Umbau“ fällig macht. Der vorliegende Artikel handelt von den Fortschritten, die auf diesem Feld zu verzeichnen sind.
[2] „Unser Sozialversicherungssystem ist anpassungsfähig, ohne seine Grundprinzipien aufgeben zu müssen.“ Blüm in der Frankfurter Rundschau vom 29.6.1995
[3] Diesen doppelten Angriff auf den Lohn führt das Kapital permanent fort. Es nutzt nicht nur laufend alle Freiheiten des Lohnkostensenkens, die es sich verschafft hat – vgl. dazu den erwähnten Artikel in GegenStandpunkt 1-95, S.65 –, sondern erweitert überdies beständig das Repertoire seiner Methoden. Bei VW z.B. probiert man unter dem Titel „strategic insourcing“ gerade wieder eine neue lohnsparende Technik aus, über die gemeldet wird: „Beim Pilotprojekt von VW und Continental gibt es weniger Lohn für längere Arbeitszeit“. Die frohe Botschaft verdankt sich dem Umstand, daß der Autokonzern die Produktion von Servolenkungsleitungen formell von sich abtrennt und als Auftrag an den Gummihersteller vergibt. Dieser „Zulieferer“ produziert die von VW benötigten Leitungen in den Werkshallen von VW unter Einsatz von VW-Arbeitern. Letztere gelangen durch die strategische Zusammenarbeit in den Genuß, nicht mehr nach dem für VW gültigen Metall-Tarif, sondern nach dem für VW günstigeren Chemie-Tarif bezahlt zu werden. Auf diese Weise bekommen sie pro Mann und Monat um 600 bis 800 Mark weniger Lohn bei 8,7 Stunden mehr Arbeit pro Woche (vgl. Süddeutsche Zeitung vom 19./20.8.1995). Die Gewerkschaft hat diesem Pilotprojekt – Weiterungen sind bereits geplant – ihren Segen erteilt, „weil damit der Standort langfristig gesichert werden kann“, und bekommt ihr Argument von VW postwendend um die Ohren gehauen: Das Unternehmen droht mit der Verlagerung von Produktionsabteilungen ins Ausland, wenn die Gewerkschaft bei den anstehenden Metall-Tarifverhandlungen seiner Forderung nicht zustimmt, für den gleichen Lohn 3,2 Stunden mehr Arbeit pro Woche zu bekommen (vgl. Süddeutsche Zeitung vom 26./27.8.1995). Dafür bietet es eine befristete Verlängerung der „Beschäftigungsgarantie“ an, die es vor zwei Jahren mit der Gewerkschaft ausgehandelt hat – damals wurde vereinbart, die Rationalisierungserfolge des Unternehmens nicht als Massenentlassung abzuwickeln, sondern in Gestalt einer 10-prozentigen Kürzung der bezahlten Arbeitszeit für alle Beschäftigten von VW. Dem gewerkschaftlichen Bekenntnis zur bedingungslosen Unterwerfung unter die Abhängigkeit des Lohnarbeiters vom Kapital, das die deutschen Arbeitervereine mit ihrem Dauerbrenner „Arbeitsplätze sichern“ abliefern, entnimmt die Gegenseite logischerweise den Freibrief, den Gewerkschaften laufend verschlechterte Bedingungen zu diktieren, unter denen in Deutschland gearbeitet und entlassen wird.
[4] Die Zuständigen
können sich dann zu Recht Leistungen der folgenden Art
rühmen: Nach den vorliegenden Schätzungen hätte der
Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung ohne
die Rentenreform von gegenwärtigen 18,6 Prozent in 25
Jahren, also bis zum Jahr 2020, bis auf 28,1 Prozent
steigen müssen, was einer Steigerung um rund 51 Prozent
entspricht. Durch die Rentenreform wird diese
Steigerung in etwa halbiert werden können. Im Jahr 2020
wird der Beitragssatz nach Schätzungen des BMA 23,7
Prozent betragen, das entspricht einer Steigerung um
rund 27,4 Prozent.
Blüm, von der Frankfurter
Rundschau vom 29.6.1995 zitiert, beschönigt wohlgemerkt
nicht etwa das Scheitern seiner Reformunternehmung,
sondern faßt deren absehbaren Erfolg völlig sachgerecht
zusammen. Was soll schließlich bei der Umverteilung von
Anteilen einer im gesellschaftlichen Maßstab sinkenden
Lohnsumme auf die Alten auch anderes herauskommen als
die Verteilung des mit der umverteilten Materie
feststehenden Mangels auf beide Seiten?
[5] Immerhin soll es einmal so gewesen sein – wie ein Kommentator sich anläßlich des fünfzigjährigen Geburtstags der CDU erinnert –, daß sich die Regierungspartei in den Anfängen der BRD zur „politischen Umsetzung dessen“ bekannt hat, „was in der katholischen Kirche seit vielen Jahrzehnten an sozialpolitischen Vorstellungen in Konkurrenz zu sozialistischen Modellen entwickelt worden war: das führte von selbst sehr sozialistischen Ansätzen Ende der vierziger Jahre zu dem, was schließlich als soziale Marktwirtschaft das Erfolgsrezept der Bundesrepublik Deutschland wurde.“ (Busche in der Süddeutschen Zeitung vom 29.6.1995) Der Kommentator erinnert daran, daß es nur ein systemfremder Grund war, der die Politiker damals dazu veranlaßt hat, sich zum sozialen Charakter ihrer Musterrepublik zu bekennen, und daß sie aus diesem Grund sogar eine Zeit lang die Fiktion gepflegt haben, das Soziale an der Marktwirtschaft sei das „Erfolgsrezept“ ihrer Nation. Beides hat sich erübrigt. Der systemfremde Grund, aus dem sich der bundesdeutsche Kapitalismus als sozialverträgliches System darstellen zu müssen meinte, hat sich mit dem Ende des realen Sozialismus erledigt; der Systemvergleich ist praktisch dahingehend entschieden, daß der Kapitalismus das für die Nation einzig erfolgversprechende System ist. Und die Sache mit dem nationalen „Erfolgsrezept“ ist durch das Millionenheer von Arbeitslosen, das die Wirtschaft für ihren Erfolg nicht mehr braucht, ebenfalls praktisch erledigt.
[6] Stillschweigend und mit noch größerer Selbstverständlichkeit vorausgesetzt ist dabei, daß es erst recht keine Angelegenheit ist, die die Lohnarbeiter mit ihren Benutzern kämpferisch zu regeln hätten. Mit der Einrichtung der Sozialkassen nimmt der Sozialstaat eben nicht bloß ein Drittel oder so vom Lohn in die Hand; er nimmt auch den entscheidenden Streitpunkt zwischen Lohnarbeit und Kapital unter seine Kontrolle: die Kollision zwischen dem Lohn als Unkosten für lohnende Arbeit und dem Lohn als Mittel der Arbeiterklasse, sich überhaupt zu reproduzieren. Mit der „Verstaatlichung“ dieses Gegensatzes, seiner Erhebung zum politischen Problem – und nicht mit irgendeiner materiellen Gunst! – stiftet der Sozialstaat hier tatsächlich „sozialen Frieden“.
[7] DGB-Vizevorsitzende Engelen-Kefer in der Süddeutschen Zeitung vom 15./16.7.95. Kritik an der Organisation des Gesundheitswesens als per Gesetz aus Lohnteilen alimentierte Geschäftssphäre hat sie nicht geäußert – wie überall, so wenden sich Deutschlands Gewerkschaften auch hier höchstens gegen „Mißbräuche“.
[8] Die Frankfurter Rundschau vom 29.6. und vom 4.7.1995 zitiert aus diesem Papier
[9] Der stellvertretende Wirtschaftssprecher der SPD-Bundestagsfraktion, zitiert von der Süddeutschen Zeitung vom 5.7.1995. Im angesprochenen Fall ging es um die höchstrichterliche Verpflichtung des Fiskus, bei der Besteuerung der Armut gewisse Schranken der Verelendung einzuhalten. Der Finanzminister stellte sich dieser Verpflichtung, indem er die Finanzierung des zu erwartenden Steuerausfalls zur Debatte stellte und damit die nicht ganz freiwillig ergriffene Initiative in eine staatsnützliche Richtung brachte. Die im Bundestag vertretenen Parteien machten sich auf die Suche nach zusätzlichen Steuereinnahmen des Staats und einigten sich nach heftigem Streit auf einen „Subventionsabbau“ eigener Art: auf eine Streichung von der Einkommenssteuer absetzbarer Posten. Daß die so beschlossene Erhöhung der Einkommenssteuer in Sprachregelungen gekleidet wurde, die den völlig abseitigen Gedanken nahelegen, es könnte um so etwas wie eine Existenzsicherung für Minderbemittelte gegangen sein, für die Unternehmer zur Kasse gebeten werden sollten, ist vor allem das Verdienst der SPD. Diese Partei übt sich seit geraumer Zeit in der Kunst, hinter den Vorhaben der Regierung soziale Absichten zu entdecken – um diesen Absichten aus Verantwortung für den Wirtschaftsstandort Deutschland entschieden und öffentlichkeitswirksam eine Absage erteilen zu können. Mit solchen absichtsvoll antisozialen Tönen und einer umso konstruktiveren Mitwirkung beim Zustandekommen von Regierungsvorhaben pflegen die Sozialdemokraten seit einiger Zeit das Profil ihrer Partei. Sie wollen sozialdemokratische Wirtschafts- und Regierungskompetenz beweisen, beharren an erster Stelle auf einer strikt an nationalen Standortinteressen ausgerichteten Politik, empfehlen sich als Garant dafür, daß die Nation auch nach einem eventuellen Regierungswechsel auf rot-grün keinen Kurswechsel erleidet, und leisten einen entscheidenden Beitrag dazu, daß die Regierung Kohl jenseits aller Kritik steht. Der Vorsitzende dieses Vereins verkörpert in seiner ganzen von nationaler Verantwortung triefenden Art den Widerspruch einer Oppositionspartei, die sich dazu entschlossen hat, mit der demonstrativen Absage an Opposition an die Macht kommen zu wollen. Daß er mit dieser Parteilinie als Oppositionsführer ziemlich notwendigerweise eine matte Figur macht, trägt ihm bei parteiinternen Konkurrenten den Vorwurf ein, seine Linie nicht entschlossen genug durchzusetzen. Das stürzt die SPD in eine Führungskrise.
[10] Blüm in der Frankfurter Rundschau vom 29.6.1995; auch die folgenden Zitate stammen aus dieser Quelle.
[11] Ein Mann wie Seehofer beispielsweise erweckt nicht gerade glaubwürdig den Eindruck, einem Sachzwang zu unterliegen, wenn er die nächste Kostenexplosion im Gesundheitswesen pünktlich zum 1.1.1996 ankündigt (dann läuft die von ihm eingeführte gesetzliche Etat-Deckelung in seinem Ressort aus), wenn er dabei deutlich macht, daß diese Kostenexplosion recht besehen weniger das Problem des Staats ist als vielmehr das der Krankenkassen und der an ihr Beteiligten, und aus dieser Distanz die dritte Stufe seines Reformwerks ins Auge faßt, mit der er seine bisherigen Reformen offenbar in den Schatten stellen will. Die Forderung nach „mehr Selbstbeteiligung der Patienten“, die jetzt aus den Reihen der FDP laut wird, kommt ihm angesichts der Therapien, an denen er mittlerweile arbeitet, jedenfalls ziemlich überholt vor: „Es sei geradezu lächerlich, das System mit ein paar hundert Millionen Mark Selbstbeteiligung steuern zu wollen.“ Vgl. Der Spiegel Nr. 26/95
[12] Süddeutsche Zeitung vom 10.7.95
[13] Blüm in der Frankfurter Rundschau vom 29.6. 1995: „Mit der Pflegeversicherung sind wichtige Weichen gestellt worden. Im Bereich der hauswirtschaftlichen Beschäftigungsfelder müssen Weichenstellungen noch erfolgen.“ Schließlich ist es kein Zustand, daß Hausfrauen keine „selbsterworbenen“ Ansprüche auf Sozialleistungen haben, sondern bislang in der Familienmitversicherung der Krankenkasse untergebracht sind und von der Rentenanstalt eine Hinterbliebenenrente gezahlt bekommen.
[14] Kritische Einwände gegen solch einen Vorstoß können offenbar gar nicht bescheuert genug sein, um in Deutschland für besonders stichhaltig befunden zu werden. Kritik handelte sich Blüm bekanntlich vor allem für den Titel ein, unter dem er seine Initiative ankündigte; deren sachlicher Gehalt war damit erst einmal aus dem Gespräch. Da jedoch auch niemand ein Argument auf Lager hatte, warum es eigentlich mitten im Kapitalismus unschicklich sein soll, über den „Marktwert“ von Leuten zu verhandeln, war der Minister mit der Behauptung, daß dieser Begriff aus dem „Wörterbuch des Unmenschen“ nie über seine Lippen gekommen ist, aus dem Schneider. Dann meldete sich die CDA mit dem Bedenken zu Wort, daß „insbesondere die schlechte Vermittelbarkeit von älteren Arbeitslosen auf deren Marktwert durchschlagen könnte.“ Womit die christliche Arbeitnehmervereinigung dem Minister offenbar die merkwürdige Befürchtung nahebringen wollte, der Zweck seines Vorhabens könnte eintreten. Schließlich war Hildebrandt von der SPD zur Stelle: „Mit einer solchen Regelung sei eine Umverteilung der Sozialausgaben, aber keine Einsparung möglich.“ Das sitzt, der Minister versagt vor seinem eigenen Anspruch; wirkliche Einsparungen beim Sozialen, die ihren Namen verdienen, gibt es nur mit der SPD… (Vgl. Süddeutsche Zeitung vom 12.7.1995)
[15] Sozialhilfeberechtigte, denen Privatmenschen aus Mitleid oder Sympathie eine kostenlose Unterkunft zur Verfügung stellen, bekommen vom Staat erst einmal ihre Sozialhilfe gekürzt – schließlich brauchen sie weniger Geld, weil sie keine Miete zahlen müssen. Mit demselben Argument wird übrigens auch Obdachlosen der Regelsatz zusammengestrichen…
[16] „Es ist zu gewährleisten, daß bei Haushaltsgemeinschaften von Ehepaaren mit drei Kindern die Regelsätze zusammen mit Durchschnittsbeträgen für Kosten von Unterkunft und Heizung um mindestens 15 vom Hundert unter den erzielten monatlichen durchschnittlichen Nettoarbeitsentgelten unterer Lohn- und Gehaltsgruppen zuzüglich Kindergeld und Wohngeld in einer entsprechenden Haushaltsgemeinschaft mit einem alleinverdienenden Vollzeitbeschäftigten bleiben.“ Seehofer-Entwurf, zitiert von der Frankfurter Rundschau vom 15.7.1995
[17] Das Existenzminimum ist eben keine Größe, die in der kapitalistischen Ökonomie Realität besitzt. Seine Höhe richtet sich ausschließlich nach dem, was der Klassenstaat als Mindeststandard für seine Arbeiterklasse anzuerkennen sich genötigt sieht, um den passenden sozialen Frieden zu gewährleisten. Sei es wegen inneren Widerstands einer Arbeiterbewegung, sei es auch nur – wie im Fall der BRD – wegen der realen Existenz einer sozialistischen Alternative im Ausland. Aber wie gesagt, die Zeiten sind ja vorbei…
[18] Diese Verbilligung der Fürsorgeempfänger ist jedenfalls das absehbare Ergebnis von Seehofers Initiative, „Arbeit statt Sozialhilfe zu finanzieren“. Welche weitergehenden Vorstellungen staatlicherseits mit dieser Initiative verbunden sind und warum aus ihnen absehbarerweise nichts wird, geht aus einer Meldung der Süddeutschen Zeitung vom 24.7.1995 hervor: „Bundesgesundheitsminister Horst Seehofer (CSU) wirft deutschen Betrieben vor, die Integration arbeitsfähiger Sozialhilfeempfänger in den Arbeitsmarkt zu behindern. In Wirtschaftszweigen wie der Landwirtschaft gebe es Widerstand gegen die Bemühungen der Bundesregierung, die Zahl der Arbeitserlaubnisse für Ausländer zu reduzieren und niedrig bezahlte Stellen mit arbeitslosen Deutschen zu besetzen.“ Warum wohl sperren sich deutsche Unternehmen gegenüber dem dem nationalen Verstand so einleuchtenden Anliegen, endlich den Skandal zu beseitigen, daß Ausländer deutschen Sozialhilfeempfängern die Arbeitsplätze wegnehmen? Warum wehren sie sich auch gegenüber Blüms Vorstoß, durch eine Allgemeinverbindlichkeitserklärung deutschen Tarifrechts zu unterbinden, daß die ausländische Konkurrenz sie durch „Lohndumping“ ihrer Marktchancen beraubt? Und warum ziehen die zuständigen Minister aus ihren Klagen nicht einfach die adäquaten gesetzgeberischen Konsequenzen? Weil es für sie nicht in Frage kommt, deutschen Unternehmern die Ausnutzung ausländischer Billigarbeitskräfte zu untersagen. Es bereitet ihnen Schwierigkeiten allgemeine Konkurrenzregeln festzulegen, die die Praxis der ausländischen Konkurrenz unterbinden, die gleiche Praxis deutscher Unternehmer jedoch zulassen sollen. Was ausländische Unternehmen auf deutschem Boden treiben, besteht eben gar nicht in einem Wettbewerbsverstoß und hat mit Dumping nichts zu tun. Sie verkaufen nicht unter ihren Kosten, um Konkurrenten im Preiskampf aus dem Feld zu schlagen, sondern wenden dieselbe lohnkostensenkende Konkurrenzmethode an, die auch deutsche Firmen zum Einsatz bringen. Deswegen bleibt es bis auf weiteres bei dem Leiden der Minister, die auf dem nationalen Ertrag von Geschäften bestehen, die ein Unternehmerstand macht, der es aus guten ökonomischen und staatlicherseits gebilligten Gründen an Vaterlandstreue fehlen läßt.
[19] Vgl. Frankfurter Rundschau vom 5.7.1995: „Sachverständige wollen Solidarsystem amputieren“
[20] Süddeutsche Zeitung vom 31.7.95