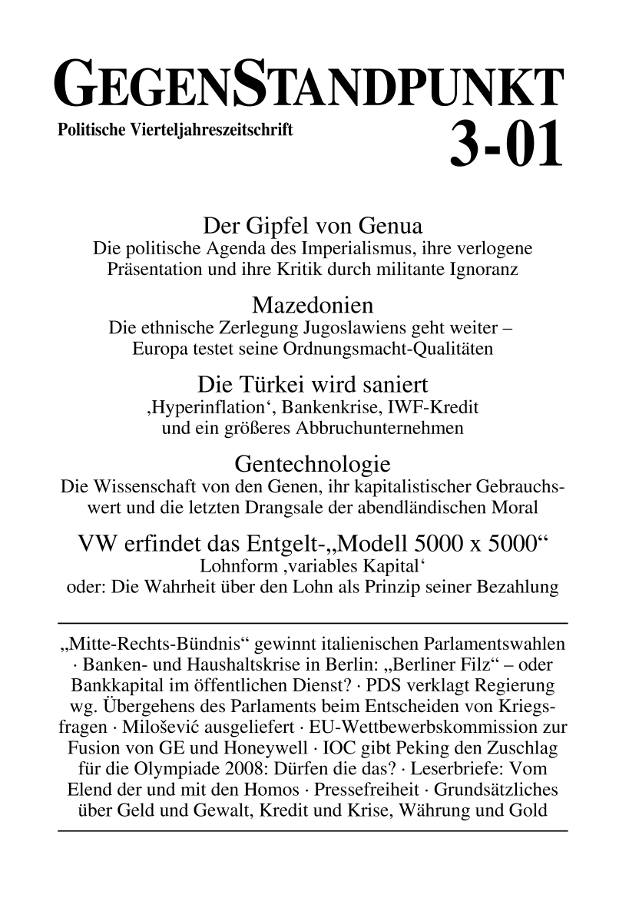‚Hyperinflation‘, Bankenkrise, IWF-Kredit und ein größeres Abbruchunternehmen
Die Türkei wird saniert
Das Problem der Türkei mit ihrer Nationalökonomie: Zu wenig Kapital für so viel Staat. Der Staat garantiert seine eigene Verschuldung – bis zum Ruin des Umlaufsmittels. Die Grundlage der internationalen Geschäftsfähigkeit der Türkei: Geliehene Kreditwürdigkeit. Sanierung per Hyperinflationsbekämpfung. Die „Februarkrise“ und ihre konsequente Durchführung: Sanierung als Abbruchunternehmen. Sanierung contra Erhaltung des Standorts: Kampf zweier Linien im türkischen Wirtschafts-Nationalismus. Die harte Kreditlinie des IWF und der Standpunkt seiner Auftraggeber: Sanierung ohne imperialistischen Unkostenbeitrag.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Gliederung
- Das Problem der Türkei mit ihrer Nationalökonomie: Zu wenig Kapital für so viel Staat
- Der Staat garantiert seine eigene Verschuldung – bis zum Ruin des Umlaufsmittels
- Die Grundlage der internationalen Geschäftsfähigkeit der Türkei: Geliehene Kreditwürdigkeit
- Sanierung per Hyperinflationsbekämpfung
- Die „Februarkrise“ und ihre konsequente Durchführung: Sanierung als Abbruchunternehmen
- Sanierung contra Erhaltung des Standorts: Kampf zweier Linien im türkischen Wirtschafts-Nationalismus
‚Hyperinflation‘, Bankenkrise,
IWF-Kredit und ein größeres Abbruchunternehmen
Die Türkei wird saniert
Daran hat sich die öffentliche Meinung hierzulande schon seit Jahren gewöhnt: Wirtschaftlich gesehen fällt der mächtige NATO-Staat Türkei unter die Rubrik „kranker Mann am Bosporus“, der in schöner Regelmäßigkeit seine „schweren Krisen“ hat. Die kommen, gehen aber auch wieder, weil es immer jede Menge „Hilfe von außen“ gibt, mit der gewährleistet ist, dass die Dinge dann irgendwie wieder ins Lot kommen. Jetzt also wieder so ein „Vorfall“, als ein „Wortgefecht“ zwischen Präsident und Regierungschef von den „Märkten“ zum Anlass genommen wird, der türkischen Währung das „Vertrauen“ zu entziehen, so dass diese binnen kürzester Zeit die Hälfte ihres Werts verliert:
„Die Türkei ist ein Land des Déjà-vu. Seit dem zweiten Weltkrieg musste alle zehn Jahre eine drohende Zahlungsunfähigkeit durch Abwertungen und Sanierungsprogramme abgewendet werden. Dreimal mündeten die begleitenden politischen Krisen in einer Machtübernahme durch die Generäle. Insgesamt hat es die Türkei auf achtzehn Beistandsabkommen mit dem Internationalen Währungsfonds gebracht.“
Also alles wie gehabt und weiter nichts Besonderes? Das in dem Leitartikel der Frankfurter Allgemeinen ausgebreitete Szenario der aktuellen Krise, worin von „Grundübeln“ der türkischen Wirtschaft die Rede ist, die „alle nicht beseitigt“ sind, aber jetzt „endlich abgestellt“ werden müssen, spricht da eine etwas andere Sprache:
„Die nächste Krise ist nur eine Frage der Zeit. Die türkische Regierung muss jetzt handeln. Sie kann nicht mehr weitermachen wie bisher, wenn die Türkei nicht der kranke Mann am Bosporus bleiben will.“ (FAZ, 28.2.01)
Inzwischen ist aus der jüngsten „Februar-Krise“ eine „unendliche Krisengeschichte“ (SZ, 18.7.) geworden, mit einer nicht enden wollenden „Welle von Pleiten, Fabrikschließungen und Entlassungen“ (Der Spiegel); und die türkische Währung verliert weiter und stetig an Wert, weil diejenigen, auf die es ankommt, nicht damit rechnen, dass Besserung eintritt:
„Die Akteure an den Finanzmärkten, die immerhin die Kapitalströme leiten, auf die das Land am Bosporus in seiner gegenwärtigen Krise besonders angewiesen ist, trauen der Situation nicht.“ (NZZ, 12.7.)
Dabei steht auch das in jedem zweiten Artikel zum Thema: Die türkische Regierung „handelt“, und zwar durchaus so „konsequent“, dass hiesige Beobachter angesichts des verfolgten „Sanierungsprogramms“ schon hoffnungsvoll von „einer Art Neugründung der Türkei“ (SZ) zu berichten wissen. So dass bereits „besorgte Stimmen“ laut werden, auf türkischer Seite nämlich, die den wirtschaftlichen „Genesungsprozess“ als einen „Härtetest“ für ihr Land einordnen, der schwer zu verkraften ist:
„Hohe Arbeitslosigkeit, Fabrikschließungen, Bankenpleiten. Die Bauern werden nicht mehr subventioniert, der Staat schrumpft, der Privatsektor wird sich auf eigene Ressourcen stützen müssen. Die Türkei muss sich auf die längsten zehn Jahre der Republik einstellen.“ (FTD, 20.3.)
So deutet jedenfalls einiges darauf hin, dass mit der
Krise des NATO-Mitglieds Türkei so etwas wie die
Geschäfts- und damit Handlungsfähigkeit
dieser Nation auf dem Spiel steht. Also wirklich nichts,
was unter der Rubrik Alles wie gehabt
zu verbuchen
ist.
Das Problem der Türkei mit ihrer Nationalökonomie: Zu wenig Kapital für so viel Staat
Entgegen anders lautenden Gerüchten und anders, als die einschlägige Krisenberichterstattung suggeriert, ist auch in der Türkei nicht „die Korruption“ zur herrschenden Produktionsweise geworden. Es geht kapitalistisch zu: Bauern, Textilarbeiter, Bergleute, Hotelangestellte usw. werden nach den Regeln der Kunst ausgebeutet und gemäß den Vorschriften der politökonomischen Weltvernunft schlecht bezahlt – wenn überhaupt. Ein vielfältig engagierter „Mittelstand“ und eine kleine, aber feine Klasse großer Industrieller werden dadurch reicher; ausländische Investoren auch. Eine funktionstüchtige Bankenwelt thront darüber, kreditiert Fortgang und Ausweitung des nationalen Geschäftslebens, „investiert“ in Staatsanleihen und vermehrt so die Depositen von Geldanlegern sowie ihr eigenes Kapital. Dabei und dafür kann sie sich auf die staatliche Zentralbank verlassen, die sich – wie die Staatsbanken sämtlicher kapitalistischen Länder – mit ihrem unerschöpflichen, weil selbst hergestellten Reservoir an türkischer Lira für die Refinanzierung des nationalen Bankgeschäfts in Anspruch nehmen lässt und dabei auf den Außenwert ihres Geldes, also darauf achtet, in welchem Verhältnis zu ausländischer Währung die eigene sich als Weltgeld bewährt. Das alles ist eher banal und nur deswegen der Erinnerung wert, weil vor lauter begeisterter Kolportage über die Krisenlage der türkischen Volkswirtschaft – und vor allem über die Machenschaften ihrer Macher – völlig weggedrängt wird, was da überhaupt in einer Krise steckt, und weil folgerichtig auch über das Warum vor lauter geheuchelter oder sogar echter Sorge um einen gedeihlichen Fortgang und ideellem Engagement für eine Sanierung des ganzen Ladens bloß lauter als Diagnose ausgedrückte moralische Ermahnungen zum Bessermachen in Umlauf sind.
Die türkische Nationalökonomie funktioniert so, wie ein moderner, nämlich vom Staat mit Papiergeld kreditierter Kapitalismus eben funktioniert. Kapital akkumuliert; eigentumslose Massen werden überwiegend nützlich, zu großen Teilen aber auch überflüssig gemacht; die Staatsgewalt kann sich eine beträchtliche Machtentfaltung leisten, einen inneren Krieg sogar, der seit vielen Jahren ganze Landesteile verwüstet; und nebenher können sich sogar noch etliche Machthaber über das Maß hinaus bereichern, das ihnen von Amts wegen sowieso zusteht. Grund zur Unzufriedenheit gibt der türkische Kapitalismus allerdings auch – den auf eine ziemlich armselige Existenz festgelegten Massen sowieso; aber das zählt am Kapitalstandort Kleinasien so wenig wie überall auf der Welt. Die Macher und Nutznießer selber werden über einen Nebeneffekt nicht froh, den ihre Volkswirtschaft seit Jahren und Jahrzehnten – außer Profiten und Staatseinnahmen – hartnäckig immerzu mitproduziert: Das Geld, um dessen Vermehrung sich alle wirtschaftlichen Aktivitäten drehen, verliert mit jeder Umschlagsperiode an Wert – aufs Jahr gerechnet die Hälfte bis zwei Drittel im Schnitt der letzten 20 Jahre. Das bedeutet zwar nicht, dass die Kapitalisten des Landes ärmer statt reicher würden und laufend Verluste bilanzieren müssten: Die sind es ja, die die Preise so steigern, dass eine fixe Lira-Summe immer weniger kauft, haben die Geldentwertung im Großen und Ganzen also schon dadurch ausgeglichen, dass sie sie hervorbringen; und das Finanzkapital hält sich mit Zinsraten schadlos, die die Entwertungsrate schon enthalten und kräftig überkompensieren – eine Realverzinsung von 25% soll in den zurückliegenden Jahren die Regel gewesen sein. Die Staatsgewalt gerät darüber auch nicht ins Elend. Die muss für ihren Herrschaftsbedarf zwar auch immer höhere Preise zahlen und für ihre Schulden immer höhere Zinsen; im Maße ihrer Zahlungsverpflichtungen gestattet sie sich aber – wie jeder aufgeklärte Finanzminister – neue Schulden, und in ihrer Eigenschaft als Zentralbank verdient sie sogar an der Refinanzierung des nationalen Kreditbedarfs durch neu emittierte Lira-Mengen. Insofern geht die notorische Höchst-Inflation schön einseitig, wie es sich für einen funktionierenden Kapitalismus gehört, zu Lasten derer, die weder ein Recht auf freie Preisgestaltung, geschweige denn die Macht dazu, noch die Lizenz zu grenzenloser Schuldenakkumulation besitzen. Es ist nur so, dass der türkische Staat wie die türkische Geschäftswelt sich mit ihrer heimischen Währung weltwirtschaftlich nirgends sehen lassen können. Denn für sich genommen ist ihre Lira mit ihrer Vermehrungsrate, die durch Entwertung, oder umgekehrt mit ihrer Entwertungsrate, die durch Vermehrung „ausgeglichen“ wird, ein Hohn auf die Funktionen, die ein kapitalistischer Geschäftsmann ebenso wie ein staatlicher Haushälter sich von einem nationalen Geschäfts- und Kaufmittel erwartet; im und für den Welthandel, also nach den Maßstäben, die auch für jedes innertürkische Geschäft über Erfolg und Misserfolg entscheiden, taugt sie überhaupt nur unter der Bedingung, dass, und in dem Maße, wie eine Kompensation ihrer permanenten Wertminderung im Verhältnis zu einem wirklichen, soliden Weltgeld garantiert wird – also von sich aus überhaupt nicht. Was die Zentralbank an Lira in die Zirkulation wirft, ist nach den geltenden kapitalistischen Maßstäben, nämlich als weltweit brauchbares Geschäftsmittel, nur so viel wert, wie sie als verantwortlicher Emittent an Gegenwert in Devisen garantieren kann. Insofern ist die türkische „Devise“ entgegen der Gültigkeit, die der Staat ihr beimisst, bloßes Geldzeichen, Stellvertreter gewissermaßen, und das in rasant sich verschlechternder Proportion, für das einzige wirkliche Weltgeld, über das die Nation verfügt: ihre Dollar- und Euro-Bestände. Und das ist für eine kapitalistische Nationalökonomie, die „in die Weltwirtschaft integriert“ ist, was immerhin so viel bedeutet wie: die gegen den Rest der Welt darum konkurriert, als interessante, weil besonders ergiebige Geldquelle auftrumpfen zu können, ein eklatanter Misserfolg.
Wie kommt es dazu, wenn am türkischen Kapitalismus doch grundsätzlich gar nichts auszusetzen ist?[1] Die entscheidende nationale Instanz hat daran eben doch etwas auszusetzen, und zwar etwas ganz Entscheidendes: Was die türkische Wirtschaft an geldwertem Überschuss hervorbringt und überhaupt an „Volkseinkommen“ schafft, an dem er sich vergreifen kann, das langt dem Staat nicht. Es ist zwar schön und gut, was an Ausbeutung stattfindet; nicht einmal die Rendite lässt insgesamt zu wünschen übrig – und wenn doch, dann gibt es die Geschäftsleute und die staatlichen Betreuer schon, die sich um ihre Optimierung kümmern. Es ist nur insgesamt zu wenig für alles das, was die Staatsmacht sich selbst und ihren ausgreifenden politischen Ambitionen schuldig ist und was sie der Entwicklung ihrer materiellen Grundlage selber, dem Fortschritt des türkischen Kapitalismus, schuldet – an Ruhe und Ordnung in der Gesellschaft, an Infrastruktur, an Entwicklungsprogrammen für rückständige Branchen und Regionen, an Staudämmen, an Beihilfen zur Industrieansiedlung, an Reparatur von Erdbeben-Schäden… Und weil die türkische so wenig wie irgend eine andere kapitalistische Staatsmacht weder ihre selbstdefinierten Vorhaben aufgibt, nur weil es ihr an Steuereinnahmen fehlt, noch von der Kapitalismus-konformen Methode bürgerlicher Herrschaft, mit Geld nämlich, abrückt, wo sie doch gerade für sich und ihre politische Ökonomie etwas Gutes tun und ihre Gesellschaft als Geldquelle ergiebiger machen will, beschreitet sie nach weltweit praktiziertem und mancherorts so glänzend bewährtem Vorbild den Weg der Kreditschöpfung. Die fällt freilich etwas heftig aus, eben weil sie die praktische Kritik an der viel zu schmalen Basis ist, die das kapitalistisch Erwirtschaftete dem Staatshaushalt bereitstellt, und entsprechend große Defizite zu finanzieren sind. Doch es geht, natürlich, und zwar lege artis:
Der Staat garantiert seine eigene Verschuldung – bis zum Ruin des Umlaufsmittels
Die Regierung beschafft sich, was sie an Geldmitteln benötigt, am heimischen Kapitalmarkt. Die dort tätigen Kreditinstitute, öffentlich-rechtliche wie private, leihen ihr gerne, was sie von großen und kleinen Geldbesitzern an Geld an sich ziehen können, und beschaffen sich, weil das bei weitem nicht ausreicht, das Benötigte gegen Zins bei der Zentralbank; denn einen besseren Schuldner als den Staat finden sie nicht. Natürlich machen sie sich außerdem auch zum Gläubiger der kapitalistischen Produzenten und Kaufleute im Land; es ist einfach albern, wenn publizistische Krisengeier wie Der Spiegel, die selber von der schlagartigen Überschuldung der gesamten kleinen und mittleren Geschäftswelt im Gefolge der derzeitigen Kreditkrise zu berichten wissen, dem Bankgewerbe verantwortungslose Bequemlichkeit bei der finanzkapitalistischen Ausnutzung des „Mittelstands“ vorwerfen:
„Anstatt mühsam (!) mit kleinen Krediten den Aufbau eines gesunden Mittelstandes zu finanzieren, verliehen die Banken ihr Geld an den Staat, der es mit vollen Händen ausgab, teuer zurückzahlte und damit sowohl Zinsen als auch Inflation immer weiter nach oben trieb.“ (Der Spiegel, 10/01)
Doch nach Lage der Dinge, die der Staat gerade ändern will, übersteigen Kreditbedarf wie Kreditwürdigkeit der öffentlichen Hand bei weitem die Nachfrage der privaten Geschäftswelt und erst recht die Sicherheiten, die diese zu bieten hat. Manche Geschäftszweige können auch bei den Zinsen nicht mithalten, die der kredithungrige Staat seinen Banken bietet; da leistet sich der Staat dann – je nach Bedeutung, die er der betroffenen Branche beimisst – einen zusätzlichen Posten für Zinssubventionen oder eine subventionierte „Anschubfinanzierung“, was zwar Geschäft ermöglicht, den Staatshaushalt aber zusätzlich so belastet, dass geschickte Haushaltspolitiker vieles aus Gründen der Bilanzkosmetik und nach dem ehrenwerten Vorbild des „Fonds Deutsche Einheit“ lieber außerhalb des offiziellen staatlichen Rechenwerks ausweisen:
„Es existieren 26 Finanzierungsfonds, die außerhalb des Staatsbudgets angesiedelt sind: Fonds für Agrikultur, kleinere und mittlere Unternehmen,“ (also von wegen, es hätte an „Mittelstandsförderung“ gefehlt!) „Wohnen etc., denen man noch gewisse Militärausgaben hinzufügen muss, die ebenfalls außerhalb des normalen Budgets getätigt werden.“ (Figaro, 17.4.)
Das sachgerechte Ergebnis sind jedenfalls Staatsschulden in einer Menge, die die Finanzkraft der heimischen Wirtschaft in solchem Umfang übersteigt, dass sich das kapitalistisch so sinnreiche wechselseitige Finanzierungs- und Refinanzierungsverhältnis zwischen Staat und Kapital weitgehend auf eine Verschuldung des Staats in seiner Eigenschaft als Staatshaushalt bei sich selbst in seiner Eigenschaft als Zentralbank zusammenzieht – mit denkbar kurzem Umweg über das bestens mit Zinsen bediente Bankgewerbe. Kapitalistisches Wachstum findet zwar statt; es hält aber mit dem Wachstum der Staatsschuld und der für deren Finanzierung emittierten Zentralbankgelder nicht Schritt;[2] in steigender Proportion hilft frisch gedrucktes Geld dem Staat über die relativ immer engeren Grenzen des kapitalistisch geschaffenen und verdienten Geldes hinweg. Die dadurch induzierte allgemeine Teuerung und Geldentwertung begründet wiederum höhere Zinszahlungen der öffentlichen Hand, die auf demselben Weg wie die Staatsausgaben der ersten Ordnung – für materielle Herrschaftsbedürfnisse – durch umso höhere Verschuldung samt Aufblähung der dafür benötigten Kreditmittel, also der Masse an türkischer Währung finanziert werden. Und so kommt es, wie es kommen muss: Die Freiheit, mit der der türkische Staat sich über die für ihn viel zu schmale Finanzbasis hinwegsetzt, die sein einheimischer Kapitalismus ihm bietet, rächt sich ganz folgerichtig – wenn man es Marx-mäßig ausgedrückt haben will: ganz im Sinne des „Wertgesetzes“, wonach nur durch Ausbeutung von Arbeit Wert zu Stande kommt – am Wert des Umlaufsmittels, dem ja niemand mehr ansieht, ob es auf dem Weg ehrlicher Ausbeutung in die Zirkulation gelangt ist oder bloß als Vehikel staatlicher Selbstfinanzierung. Die „galoppierende Inflation“ der Lira ist die notwendige Folge und deswegen auch, umgekehrt, der eindeutige Index dessen, dass der türkische Staat mit seinem Haushalt die Erwirtschaftung von Geld in seiner Nationalökonomie notorisch überfordert – der „Geldfetisch“ höchstpersönlich hält das nicht aus.
Auf diese Weise kommt es zu einer Währung, die zwar den ganzen nationalökonomischen Zirkus: die kapitalistische Geldwirtschaft der Türkei in Schwung hält, aber eben in der paradoxen Weise, dass sie sich im Maße ihrer Entwertung aufbläht und im Maße ihrer Aufblähung entwertet. Sie ist kein Geld in dem Sinn, wie Kapitalisten es von ihrem Geschäftsmittel fordern und Staaten es als ihr hoheitliches Kaufmittel brauchen, nämlich allseits bedingungslos anerkannte Wertmaterie. Sie fungiert trotzdem als nationales Kredit- und Zahlungsmittel, liefert dabei aber permanent einen Offenbarungseid über ihre Wertlosigkeit ab; und dieser Offenbarungseid hält sich nur deswegen in den Grenzen eines doch immer bloß relativen Wertverlustes, weil dann doch echtes Geld dahintersteht – genauer: die Garantie der Zentralbank, dass sie fürs nationale Spielgeld zwar in beständig verschlechterter Relation, aber überhaupt Devisen hergibt: Die türkische Lira taugt zwar nichts, ist aber konvertibel.
Die Grundlage der internationalen Geschäftsfähigkeit der Türkei: Geliehene Kreditwürdigkeit
Freilich: Die formelle Selbstverpflichtung des türkischen Staates zum Tausch von eigenem in fremdes Geld ist eine Sache, die wirkliche, belastbare Gewährleistung des Umtauschs zum jeweils versprochenen Wechselkurs eine ganz andere – und gar nicht einfach. Denn wenn schon überhaupt und im Allgemeinen in der Nation zu wenig Kapital akkumuliert, um die Selbstausstattung der Staatsmacht mit Finanzmitteln ökonomisch zu rechtfertigen, woher sollten dann erst recht und im Besonderen die Devisen kommen, die dem Staat dann doch seine internationale Geschäftsfähigkeit garantieren und seinem verfallenden Kreditgeld die für wirkliche „Konvertibilität“ hinreichende Basis verschaffen könnten? Die Devisenbilanz – durch Exporte, im Tourismus, per Überweisung oder Geldanlage von Auslandstürken, durch Investitionen ausländischer Geldanleger usw. kommt gutes Geld ins Land, für Importe, für türkische Kapitalanlagen im Ausland, für den Gewinntransfer engagierter Multis usw. und vor allem für die Bedienung der aufgelaufenen Schulden geht es wieder hinaus – ist selber Teil des Problems, dass am Standort Türkei zwar ein durchaus beachtlicher Bruchteil des weltweit akkumulierenden kapitalistischen Reichtums geschaffen und verdient wird – aber eben bei weitem nicht das, was die Nation bräuchte, um für ihre von Staats wegen aufgeblähte Schuldenwirtschaft einstehen zu können.
Für die Zentralbank stellt diese Sachlage sich so dar, dass sie mit einer Aufgabe betraut ist – sie soll mit überzeugender Zuverlässigkeit für die „Konvertibilität“ der Lira zum jeweiligen Wechselkurs sorgen –, für deren Lösung sie aus eigener Kraft nicht viel tun kann. Bei Bedarf zieht sie im Geschäftsverkehr mit den Banken des Landes dort eingereichte Devisen an sich, bei umgekehrtem Bedarf muss sie aber auch wieder deren Nachfrage bedienen; außerdem muss sie für die Lira, die sie gegen Devisen tauscht, auch ihren heimischen Geldbesitzern gegenüber schon wieder eine Bürgschaft für Werterhalt übernehmen und für Devisen, die sie sich von denen leiht, Zinsen zahlen. Das Auf und Ab ihrer Devisen-Zu- und -Abflüsse ist aber sowieso keine gute Grundlage, um ihrer Umtauschgarantie den nötigen Schein von Verlässlichkeit zu verleihen; dafür muss sie sich schon ein bisschen unabhängig machen vom aktuellen Gang ihrer Devisengeschäfte. Und dafür gibt es auch durchaus einen Weg, nämlich den der Auslandsanleihen: Das „globalisierte“ Finanzkapital hilft gerne aus – mit Devisenkrediten an den Staat. Für die gilt allerdings schon wieder, dass deren Bedienung, und zwar direkt in gutem Geld, gesichert sein muss – wo es doch gerade darum geht, durch die Beschaffung von Devisen genau diese Sicherheit erst herzustellen. So findet sich die Türkei auf die weltwirtschaftliche Absurdität zurückgeworfen, dass ihr ihre Kreditwürdigkeit selber kreditiert werden muss. Doch selbst das geht in der Weltwirtschaft von heute, und für die Türkei schon gleich. Denn die hat erstens quasi unbegrenzt zahlungsfähige Partner, die wissen, was sie an ihrem südöstlichsten NATO-Partner haben. Und zweitens gibt es mit IWF und Weltbank die Finanzinstitution, die ganz unabhängig von solchen besonderen Partnerschaften – und ihrer eingedenk schon gleich – genau dafür „Beistandskredite“ vergibt, dass Staaten ohne eigenes gutes Geld das Finanzkapital trotzdem von ihrer Kreditwürdigkeit überzeugen können und so ihre Geschäftsfähigkeit wahren.
Diese Beihilfe ist der Türkei auch zuteil geworden. Und zwar wiederholt; zum achtzehnten Mal mittlerweile, wenn die FAZ sich nicht verzählt hat; woraus zwei Dinge hervorgehen. Erstens hat es dieser Staat mit all seinen Bemühungen um mehr kapitalistisches Wachstum und eine „Stabilisierung“ des nationalen Geldes, mit dem er seinen Haushalt finanziert und seine Gesellschaft bewirtschaftet, nicht geschafft, aus eigener Kraft kreditwürdig – geschweige denn in eigener Währung international zahlungsfähig – zu werden; für seine Geschäftsfähigkeit bleibt er auf Kredit der höheren, nicht kommerziellen, sondern Kommerz ermöglichenden, weltwirtschaftspolitischen Art angewiesen. Zweitens hat die Türkei diesen Kredit auch immer genossen; ihre Geschäftsfähigkeit ist durch ihre maßgeblichen Verbündeten immer fraglos sichergestellt worden. Immerhin hat jedoch der IWF schon vor der derzeitigen Finanzkrise nachdrücklich darauf gedrängt, dass das Land es mit Hilfe eines „letzten“ Beistandskredits endlich einmal dahin bringt, die ihm geliehene Kreditwürdigkeit dauerhaft zu machen. Grund dafür ist ein Interesse der Nationen, mit deren guter Währung der IWF dafür sorgt, dass ihnen ihre ruinierten Geschäftspartner erhalten bleiben: Militärisch ist die Türkei eine Macht, politisch für den Westen ein wichtiger Vorposten, außerdem weltwirtschaftlich nicht ohne Eigengewicht, für die EU sogar ein Kandidat – wenn schon nicht für den Beitritt, dann doch zumindest für einen Kandidatenstatus neuer Art –, also insgesamt viel zu groß und zu wichtig, um in der Unterklasse der weltwirtschaftlichen Problem- und Betreuungsfälle zu versacken; auf der anderen Seite ist die große antisowjetische Konfrontation vorbei, unter deren Vorzeichen der Westen sich allzu kritisches Nachrechnen von vornherein gespart hat. Umgekehrt ist der türkische Staat aus ungefähr denselben Gründen mit der Untauglichkeit seiner heimischen Geldware und der fortdauernden Abhängigkeit der nationalen Zahlungsfähigkeit von geliehenen Devisen unzufrieden; er will selber seine weltpolitische Rolle definieren und deswegen aus dem Zustand herauskommen, dass er nach allen weltwirtschaftlich herrschenden Gesichtspunkten kein Geld hat und von finanzkräftigen Paten im Geschäft gehalten werden muss.
Sanierung per Hyperinflationsbekämpfung
Das alles zusammen hat bereits vor drei Jahren zu einem energischen Beschluss geführt, der durch die Konsequenz beeindruckt, mit der er die einschlägigen politökonomischen Ursache-Wirkungs-Verhältnisse auf den Kopf stellt: Wenn es der Türkei mit ihrer so aberwitzig inflationierten Lira immerzu nicht gelingen will, autonom und zum eigenen Vorteil im kapitalistischen Weltgeschäft mitzumischen, dann – so die auf Biegen und Brechen praktizierte Schlussfolgerung – liegt das ja wohl daran, dass die Lira nicht stabil ist; eine Politik der Inflationsbekämpfung ist also geboten. Und die geht folgendermaßen:
Erstens macht man einen Plan, in dem drinsteht, in welchem Zeitraum die Inflationsrate in welchem Umfang sinken wird – dass man sie per Gesetz nicht gleich abschaffen kann, scheint klar zu sein, aber mit einer zeitlichen Öffnungsklausel soll genau das doch gehen:
„Die Regierung Yilmaz hat mittlerweile der Bekämpfung der chronisch hohen Inflation, welche die Türkei seit über 20 Jahren plagt, die höchste Priorität eingeräumt. Gemäß dem Dreijahresplan soll sie Ende dieses Jahres auf 70%, nächstes Jahr auf 50% und im Jahr 2000 auf unter 10% gesenkt werden.“ (NZZ, 14.7.98)
Zweitens plant man Maßnahmen zur Einschränkung der staatlichen Kreditaufnahme; denn dass der Staat damit den Geldwert ruiniert, ist schon irgendwie klar. Da aber der Beschluss, die staatliche Geldvermehrung zu bremsen, weder die Staatseinnahmen erhöht noch einen einzigen Ausgabeposten überflüssig macht, einigt man sich mit dem IWF darauf, den Staatshaushalt streng zu überprüfen und im Übrigen drittens die Sache vollends von ihrem letzten Ende her anzugehen: Der Außenwert der Lira wird fixiert. Nicht gleich ein für alle Mal auf einen Festbetrag; das wäre – ebenso wie ein direktes Inflationsverbot – dann doch zu kühn; aber nach einem letzten größeren Schnitt soll eine in vorab festgelegten kleinen Schritten sinkende Parität zu einem Kombinat aus Dollar und Euro gelten; und dieses „crawling peg“ – kein Unsinn, für den es nicht einen englischen Fachausdruck gäbe – sollte doch die internationale Finanzwelt dermaßen beeindrucken, dass sie fortan auch ohne neuerlichen IWF-Beistand der Kreditwürdigkeit der Türkei vertraut. Fürs Innenleben der Nationalökonomie wäre damit, so die weitergehende Spekulation, ein Sachzwang etabliert, dem sich die Inflationsrate auf Dauer unmöglich entziehen könnte. Zumal viertens beschlossen wird, die Zinsen für Staatsanleihen an die angestrebten niedrigeren Inflationsraten anzupassen, also ihre sukzessive Senkung vorzuschreiben, die „die Märkte“ dann nur noch nachzuvollziehen brauchen. All das ändert zwar überhaupt nichts an dem Missverhältnis zwischen dem Umfang kapitalistischer Geldvermehrung im Land und deren finanzkapitalistisch astreiner, freilich etwas exzessiver Inanspruchnahme durch die Staatsmacht. Doch das geht versierte Finanzpolitiker nichts an: Die sind sich einfach sicher, über Manipulationen beim Gebrauch des nationalen Umlaufsmittels müsste dessen Wert sicherzustellen und die Inflation totzukriegen sein. Welche Alternative hätten sie auch sonst?
Mit dieser Exposition nimmt der erste Akt eines politökonomischen Dramas seinen Lauf, in dessen drittem Akt die Türkei mittlerweile angelangt ist. Er dauert bis zum Herbst 2000, handelt davon, dass keine der wichtigen nationalen Bilanzen sich an die trotzdem weiter aufrechterhaltenen antiinflationären Vorgaben der Regierung hält[3] – die Inflationsrate sinkt einfach nicht richtig, die Zinsforderungen der Banken auch nicht wie geplant, außerdem kommen im Haushalt eingeplante Privatisierungserlöse nicht zu Stande, die Leistungsbilanz lässt schon wieder zu wünschen übrig, und die ausländischen Geldanleger machen sich zunehmend Sorgen –, und endet mit der „Novemberkrise“ in einem Offenbarungseid des Inhalts, dass der staatliche Sanierungswille, je ernsthafter er zur Tat schreitet, umso mehr akuten Sanierungsbedarf schafft: Dieser zweite Akt zieht sich bis Februar 2001 hin, und seine einzelnen Szenen verdienen ausnahmsweise mal Beachtung.
Am Anfang steht eine Bankenkrise: Etliche private
Kreditinstitute werden zahlungsunfähig, weil ihre
Spekulation auf weiterhin hohe Zinsen für Staatspapiere
durch Zinssenkungen durchkreuzt wird und gleichzeitig die
Zentralbank die Konditionen für die Emission frischen
Geldes verschärft[4] – also weil die Regierung
gerade angesichts eines absehbaren Fehlschlags ihrer
Inflationsbekämpfungspolitik mit ihren zwei wichtigsten
Bremsmanövern ernst macht. Das zieht natürlich Kreise –
zwecks Geldbeschaffung werden Staatspapiere verkauft;
deren Wert sinkt; die Vermögenspositionen der nächsten
Banken geraten in Gefahr… Deswegen greift die Regierung
ein, stellt 10 Banken unter Zwangsverwaltung, sichert
deren Verbindlichkeiten teils zu Lasten größerer
Staatsbanken, teils auf Rechnung des Staatshaushalts
selber ab – und vergrößert dadurch den nationalen
Schuldenberg, für den der Staat haftet und dessen Abbau
eigentlich, nicht zuletzt durch die Privatisierung von
Banken, vorankommen sollte. Selbstverständlich tut die
Regierung das nicht, ohne die Schuldfrage aufzuwerfen;
und mit der kommen, ebenso selbstverständlich, all die
offiziellen und ein Teil der inoffiziellen
„Verflechtungen“ zwischen Behörden, Parteien und
Bankmanagement ins Visier, die zum Kreditgewerbe
sämtlicher Kulturnationen dazugehören und immer dann als
anrüchig gelten, wenn Geschäfte fehlschlagen und von
erhofften Spekulationsgewinnen nur die Vergütung für die
Hauptbeteiligten übrig bleibt. Da die Bankrotteure
außerdem an ihren alten Geschäftsgepflogenheiten
festgehalten haben, auch nachdem die Regierung deren
Fortsetzung aufgekündigt hatte, liegt die Diagnose
Korruption
auf der Hand; der Ministerpräsident
entlarvt gar Sabotage an seiner wunderbaren
Zinssenkungspolitik.[5] Das alles hilft aber nichts:
Ausländische Finanzkapitalisten honorieren den neuen
Willen zu sauberen Verhältnissen überhaupt nicht, sondern
finden sich in dem Misstrauen, das jede Spekulation
begleitet, bestätigt und – zweiter Akt, zweite Szene –
ziehen ihre getätigten oder geplanten Engagements in
türkischen Staatspapieren, Aktien oder gleich im
nationalen Bankensektor zurück. Das lässt die Kurse für
sämtliche Wertpapiere erst richtig abstürzen, Devisen
fließen ab statt zu, internationale Liquidität wird
knapp, und die Zentralbank kommt mit ihrer noch immer
festgehaltenen Austausch- und Wechselkursgarantie unter
Druck. Um der Spekulation gegen ihre Währung
entgegenzuwirken, setzt sie die Zinsen für Lira-Kredite
hoch – auf bis zu 1600% für Tagesgeld Anfang Dezember:
das extreme Gegenteil dessen, was eigentlich im Programm
ist und, siehe oben, zur Auslösung des krisenhaften
Geschehens beigetragen hatte. Im dritten Bild des Aktes
tritt eine gewisse Entspannung der Lage ein, weil der IWF
der türkischen Zentralbank in ihrem Kampf um die
Aufrechterhaltung der festgelegten Lira-Parität mit einem
Währungskredit über etliche Milliarden Dollar beispringt
und sich öffentlich und mit Nachdruck den
durchschlagenden Erfolg seines Manövers attestiert. Zudem
gelingt der Abschluss eines „Stillhalteabkommens“ mit
Auslandsbanken, an die die IWF-Gelder andernfalls zwecks
Schuldenbedienung sogleich hätten weggezahlt werden
müssen – in welchem Fall sie womöglich gar nicht
geflossen wären. Alle Türkei-Kenner und Finanzfachleute
wiegen sich bereits in skeptischer Zuversicht, da schlägt
in der vierten Szene die Katastrophe zu. Es beginnt,
dramaturgisch geschickt, mit einem Gag: Der allseits
verehrte Staatspräsident wirft dem schon nicht mehr so
beliebten Ministerpräsidenten Versagen und fehlenden
guten Willen bei der Korruptionsbekämpfung vor; Letzterer
macht den Fehler und empört sich öffentlich; das auch
noch in Anwesenheit von IWF-Vertretern – und schon ist
der gesamten internationalen Spekulantengemeinde klar:
Die „Finanzkrise“ ist zur „Staatskrise“ eskaliert. Dieses
Urteil meint zwar bloß, dass die
politischen Manager des türkischen Finanz- und
Anleihemarktes und der zentralbankamtlichen
Liquiditätszufuhr kein Vertrauen verdienen. Es korrigiert
also überhaupt nichts an der grundverkehrten
verharmlosenden Vorstellung, die weitere internationale
Geschäftsfähigkeit des Landes wäre tatsächlich eine Frage
der Einigkeit der Verantwortlichen bei der Ausmerzung
„schwarzer Schafe“ in der Grauzone zwischen Staatsmacht
und Staatskredit. Von den wirklichen Rückwirkungen der so
eklatant aufgeflogenen nationalen Finanznot auf die
politischen Verhältnisse will schon gleich keiner was
wissen – außer eben dem mehr lachhaften Unterpunkt, dass
der eine dem andern die türkische Verfassung an den Kopf
geworfen haben soll.[6] Aber was soll’s: Genau dieses
falsche Bewusstsein ist das praktisch maßgebliche; und
deswegen reicht das Gerücht schon für den – dann doch
auch wieder politökonomisch ziemlich sachgerechten –
Entschluss: Nichts wie ’raus mit dem eigenen Kapital aus
türkischen Geldanlagen und türkischer Währung. Die
handelnden Akteure ziehen Kredit zurück, lassen die Kurse
aller Wertpapiere in den Keller fallen, bringen die
staatlich behauptete Währungsparität in Gefahr,
spekulieren auf diese Gefahr, also gegen die Lira,
kassieren die Devisenreserven, die der Staat zur Rettung
seines Geldes aufwendet, bis zur Erschöpfung dieser
Reserven, und sind diesmal nicht zu bremsen. Die
Zentralbank kapituliert, gibt – mit Zustimmung des IWF –
den Wechselkurs frei; schlagartig halbiert sich der
Außenwert der türkischen Währung und des darin gemessenen
nationalen Vermögens. Dafür verdoppeln sich – das bringt
der praktisch vollzogene neue Währungsvergleich ebenfalls
mit sich – für alle, die in Lira rechnen und
wirtschaften, ihre in Devisen bezifferten oder auf Dollar
und Euro bezogenen Schulden und die fälligen Leistungen
für den Schuldendienst. – Ende des zweiten Aktes.
Die „Februarkrise“ und ihre konsequente Durchführung: Sanierung als Abbruchunternehmen
Der dritte Akt fängt – entgegen der dramaturgischen Regel – mit dem Auftritt des Deus ex Machina an: Der IWF entsendet einen Fachmann türkischer Nationalität, den Vize-Präsidenten der Weltbank Kemal Dervis, als neuen „Superminister“ für Wirtschaft nach Ankara. Der personifiziert dort das grundsätzliche Vertrauen der Instanzen und der politischen Herren des Weltkapitalismus in die Türkei als Partner, der für die Rettung seiner Kreditwürdigkeit Kredit verdient, und zugleich die Bedingungen, an die dieses Vertrauen geknüpft ist. Er ist die leibhaftige Zusage, dass der IWF tun wird, was er zur Wiederherstellung der Geschäftsfähigkeit des Landes für unerlässlich befindet, und steht mit dem ganzen politischen Gewicht, das die benötigte und versprochene Milliardensumme ihm im Kabinett Ecevit verleiht, dafür ein, dass der Staat die Sanierungspolitik, mit der er sich fürs Erste ruiniert hat, unerbittlich weiter- und zu einem „befriedigenden“ Ende führt.
Das Rezept, das der Mann dafür aus Washington mitbringt, lautet – erst einmal ganz vertraut und unverfänglich – so:
„Politik und Wirtschaft müssen in der Türkei getrennt werden. Es sind ja nicht nur die Politiker, die sich ins tägliche Leben der Wirtschaft einmischen, es ist auch die Wirtschaft, die von der Politik dauernd irgendwelche Subventionen verlangt.“ (Dervis in: Die Zeit, 18/01)
„Das Programm umfasst 15 Gesetzesvorhaben, von denen sich Dervis eine Vergrößerung der Transparenz und Effizienz der öffentlichen Hand sowie eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der privaten Wirtschaft verspricht.“ (FAZ, 17.4.)
Für die Türkei haben diese Ankündigungen und Initiativen eine ziemlich fundamentale wirtschaftspolitische und praktische nationalökonomische Bedeutung. Angesagt ist damit erstens ein Programm zur Privatisierung staatlicher Wirtschaftsunternehmen; ganz gleich, ob der Fiskus damit bislang Geld eingenommen hat – dann sollen ab sofort kapitalistische Investoren einsteigen und damit der Lira und der Börse aufhelfen – oder für ein „marktwirtschaftliches“ Überleben ihm wichtiger Unternehmen oder sogar ganzer Wirtschaftszweige gesorgt hat – dann sollen die sich auf das Maß des von sich aus Profitablen „gesundschrumpfen“ –; gleichgültig auch, ob überhaupt eine zahlungsfähige Nachfrage vorhanden ist, die der Staat für sich ausnützen könnte. Es geht insbesondere um die Gasindustrie und die Telekommunikation, außerdem soll das staatlich geschützte Zuckermonopol aufgehoben und die Tabakindustrie mit ihrem Anhang an knapp lebensfähig gehaltenen Tabakpflanzern aus staatlicher Obhut entlassen werden; überhaupt wird die Landwirtschaft – in der, wie man in dem Zusammenhang erfährt, „über 60 Prozent der Erwerbstätigen beschäftigt sind“ – mit einem „wettbewerbsfördernden“ Sparprogramm bedient:
„Ab 2002 werden die Agrarsubventionen abgeschafft, alle staatlichen Landwirtschaftsbetriebe verkauft.“ (FTD, 9.4.)
Ob die türkische Landwirtschaft dann endlich gegen die bekanntlich überhaupt nicht subventionierte EU-Landwirtschaft bestehen kann? Auf alle Fälle ist massenhaftes Bauernlegen angesagt, um „den Markt“ entscheiden zu lassen, wer – „Großagrarier“ soll es ja dort auch geben – und was dessen „harten Kriterien“ genügt.
Unternehmensverkäufe wie Subventionsabbau sollen den türkischen Kapitalismus effektiver machen; sie sollen außerdem den staatlichen Kreditbedarf verringern; und das ist schon Teil des zweiten großen Programmpunkts. In dessen Mittelpunkt steht die Vollendung der bereits im Herbst 2000 so verheißungsvoll begonnenen „Bankenreform“. Wegreformieren will die Regierung nichts Geringeres als die Grundlage des bisherigen Bankgeschäfts, die risikolose und höchst renditeträchtige Bewirtschaftung des staatlichen Kreditbedarfs unter Verwendung reichlich verfügbarer Lira: Zinssenkung und „Liquiditätsverknappung“ stehen erneut auf dem Programm. Kreditinstitute, die schon bankrott sind oder diese neuen Geschäftsbedingungen absehbarerweise nicht überleben, sollen von den Großbanken übernommen werden, bei denen sich freilich auch ein erheblicher Abschreibungsbedarf ansammelt und denen der Staat außerdem politisch gewollte Zinsnachlässe nicht vergütet.[7] So macht die Sanierung der staatlichen Finanzwirtschaft den türkischen Bankensektor insgesamt zu einem großen und höchst kostspieligen Sanierungsfall; 43 Milliarden Dollar, immerhin ein Fünftel dessen, was die Türkei sich zuletzt als Bruttosozialprodukt zusammengerechnet hat, werden nach letzten Schätzungen fällig und müssen so oder so vom Staat aufgebracht werden, um das nationale Finanzkapital zu erhalten, aufgelaufene Devisenschulden abzudecken und die Kreditwürdigkeit des Gewerbes wiederherzustellen. Ganz nebenher ist die gesamte kreditnehmende Geschäftswelt erst recht betroffen: Da die Banken Schulden und Schuldendienst in Dollar-Gegenwert berechnen, sind ihre Lira-Schulden mit der Abwertung vom Februar schlagartig doppelt so hoch wie zuvor, ohne dass es ihr insgesamt gelingen könnte, entsprechend verdoppelte Lira-Preise flächendeckend durchzusetzen; um zahlungsfähig zu bleiben oder wieder zu werden, brauchen die Unternehmen mehr denn je neuen Kredit; den bekommen sie aber unter den staatlich verordneten neuen Konditionen für Kreditschöpfung und Refinanzierung, wenn überhaupt, nur zu verschärften Bedingungen:
Per Saldo gerät so das Krisenbewältigungsprogramm, das der aus Washington importierte „starke Mann“ durchdrückt, zur staatlich inszenierten und kontrollierten Durchführung einer regelgerechten Krise des türkischen Kapitalismus. Ein Abbruchunternehmen wird exekutiert; mit dem doppelten Ziel, im nationalen Geschäftsleben nur das wirklich Rentable überleben zu lassen und den Staatshaushalt auf das ohne „unverantwortliche“ Kreditschöpfung Finanzierbare zusammenschrumpfen zu lassen. Auf so reduzierter Basis soll das nationale Kapital neu loslegen und mit echt guten Profitraten ein solides Wachstum hinlegen, und die Zentralbank soll in die Lage kommen, den Wert ihrer Lira nach innen und außen zu garantieren: Dafür gibt es IWF-Kredit, nämlich um die unvermeidlichen beträchtlichen Mehrkosten eines Neubeginns auf niedrigerer Stufenleiter so einwandfrei zu finanzieren, dass das Finanzkapital an einen hoffnungsvollen Neubeginn auch wirklich glauben kann.
Nach der absurden Logik des Kapitals und seiner Krisen ist das alles auch sehr vernünftig. Es hat nur einen kleinen Haken: Die „Krisis“, die die türkische Regierung ihrer Nationalökonomie zumutet, bereinigt die Krisenlage nicht. Es mag schon sein, dass die Kapitalakkumulation dort, wo sie noch oder wieder stattfindet, womöglich noch besser funktioniert als zuvor, wenn dem auf einem neuen Anspruchsniveau und mit neuer Härte geltend gemachten Rentabilitätskriterium erst einmal ein Fünftel der Textilindustrie, ein Haufen Bauern und genügend sonstige wacklige Unternehmen samt lohnarbeitendem Anhang zum Opfer gefallen sind. Auf alle Fälle ist es aber so, dass weniger kapitalistisches Geldverdienen im Lande stattfindet. Das Problem der mangelnden Masse, das die Staatsmacht mit ihrer ökonomischen Basis hat – und das sie per Selbstkreditierung bewältigt, womit sie ihre Währung ruiniert… –, wird folglich eher größer als kleiner. Deswegen rückt auch das schöne Ziel eines stabilen Geldes bei aller Sparsamkeit nicht näher. Die Geschäftsfähigkeit der Türkei als Weltmarktteilnehmer hängt wie bisher an einer Geld-Garantie, die die Zentralbank nur auf Basis geliehener Devisen überhaupt abgeben kann – in der Hoffnung, sie nicht einlösen zu müssen. Der Preis dafür sind neue Devisenschulden, die eben um der Kreditwürdigkeit des Landes willen unbedingt pünktlich bedient werden müssen, also die nationale Devisenbilanz zusätzlich belasten.
So zieht der dritte Akt des Dramas sich hin – und bietet eine Neuauflage des ersten in verschärfter Fassung: ein dauerndes Gezerre um Reformen, die der Türkei zu guten Bilanzen verhelfen sollen und erst einmal dieselben Bilanzen verschlechtern; ein Nebeneinander von Effektivierung und Brachlegung der kapitalistischen Bewirtschaftung von Land und Leuten; eine Selbstverpflichtung der Staatsgewalt auf bestimmte Zwischenziele bei der Inflationsrate, den Zinssätzen und dem Außenwert der Lira, die dann doch nicht erreicht, aber nicht aufgegeben, sondern „korrigiert“ werden; das alles unter den Augen des „globalisierten“ Finanzkapitals, das sich mit spekulativen Engagements zurückhält. Mitten im August reichen dann schon wieder ein paar Gerüchte über regierungsinterne Streitigkeiten um das Reformprogramm, um die Lira innerhalb einer Woche um 12 Prozent auf ein neues „Rekordtief“ – 1,5 Millionen für 1 US-Dollar – fallen zu lassen (HB, 16.8.)…
Sanierung contra Erhaltung des Standorts: Kampf zweier Linien im türkischen Wirtschafts-Nationalismus
Dabei ist das nun wirklich gar nicht überraschend: dass die harte Sanierungspolitik der Regierung im Land auf Widerstände trifft und politischen Streit auslöst. Immerhin schafft sie jede Menge Opfer. Vor allem, wie es sich gehört, unter den lohnabhängigen Massen der Gesellschaft, die sich allerdings ausgesprochen anständig aufführen. Im Großen und Ganzen erweisen sie sich, Militärherrschaft hin, Islamismus her, als demokratisch gut genug erzogen, um durch ihr verschärftes Elend nur zu der einen Frage bewegt zu werden: wem sie die Herrschaft darüber am ehesten anvertrauen möchten – keiner der regierenden Parteien, wie man hört, aber einem amtierenden Politiker schon, nämlich ausgerechnet dem tatkräftigen Macher aus Washington.[8] Betroffen sind aber auch viele Stützen der türkischen Gesellschaft, die sich jetzt Korruption vorwerfen lassen müssen – und andere, die in einer ganz anderen Hinsicht nicht „korrupt“ sein wollen: Sie wollen die Politik der Regierung nicht mittragen, weil sie die Sorge haben, die nationalen Interessen der Türkei würden verraten. So der Minister für Privatisierung, Yalova:
„Die türkische Regierung hatte in einem Schreiben an den IWF eine Aufhebung des staatlichen Tabakmonopols bis Ende Mai zugesagt. Yalova begründet seinen Widerstand mit schweren Nachteilen für die rund 600000 Beschäftigten dieser Industrie.“ (SZ, 2.6.)[9]
Auch der Staatspräsident, der hierzulande zur „Riege der Reformer“ gezählt wird, schließt sich diesem Protest an und stoppt mit seinem Veto vorerst die Umsetzung dieses Gesetzesvorhabens – mit ersichtlich staatstragenden Argumenten:
„Sezer argumentiert, dass dieses Gesetz die Existenz der heimischen Produzenten gefährde, die Verfassung aber verlange, das Wohl des Landes zu mehren, weshalb das Gesetz gegen die Verfassung verstoße.“ (NZZ, 10.7.)
Nicht bloß der „korrupte“ Materialismus, auch und erst recht der Patriotismus türkischer Politiker findet sich durch das Sanierungsprogramm des Kollegen Dervis herausgefordert. Der ist freilich auch kein bloßer Erfüllungsgehilfe fremder Interessen, sondern selber türkischer Nationalist und als solcher keineswegs allein[10] der Überzeugung, dass die Türkei sich für die aktive Rolle, die sie als nach Osten ausgreifende NATO-Macht und als ambitionierter EU-Kandidat in der Weltpolitik zu spielen gedenkt, aus der Abhängigkeit von geliehener Kreditwürdigkeit befreien muss; als Weltfinanzfachmann weiß er dafür den Weg. Und zu dem weiß anscheinend sogar das Militär keine rechte Alternative, obwohl es selber auch betroffen ist. Den patriotischen Standpunkt, dass die Ehre der Nation sich mit dem politökonomischen Status eines Anhängsels auswärtiger Kreditentscheidungen nicht verträgt, teilt es sowieso; jetzt akzeptiert es – einstweilen – ein Programm zur Überwindung dieser Schwäche, das – ausgerechnet! – seine eigene finanzielle Ausstattung beeinträchtigt, statt dass es – wie früher – auf einem Ausgleich verlorener Kaufkraft für Waffen besteht, und „stellt wegen der schweren Wirtschaftskrise erstmals seine umfangreichen Rüstungsvorhaben auf den Prüfstand“ (SZ, 15.3.).[11] Umso mehr bekommt dadurch auf der anderen Seite der Standpunkt Auftrieb, mit der Politik, die das Heil der Nation in der Wiedergewinnung internationaler Kreditwürdigkeit sucht, würden Volk und Heimat verraten…
So wird auf alle Fälle das politische Leben um eine Kontroverse reicher: Zur noch lange nicht bereinigten kurdischen „Frage“ und zur immer noch zunehmenden islamistischen „Gefahr“ kommt der Widerstreit entgegengesetzter Konzepte zur Sanierung des Wirtschaftsstandorts hinzu – einschließlich der immer neu zu entscheidenden Machtfrage, wo eigentlich das angebliche Hauptübel der nationalen Produktionsverhältnisse, „die Korruption“, zu Hause ist und wer es wie am besten bekämpft.
Die harte Kreditlinie des IWF und der Standpunkt seiner Auftraggeber: Sanierung ohne imperialistischen Unkostenbeitrag
Dass der Wirtschaftsminister Dervis sich derzeit offenbar recht eindeutig mit seiner Linie durchsetzt, liegt denn auch keineswegs an deren Unanfechtbarkeit oder gar an seiner persönlichen Überzeugungskraft. Dazu tragen schon die auswärtigen Freunde und Förderer einer geschäftstüchtigen Türkei sowie deren gemeinschaftliche Weltkreditbehörde das Ihre bei, nämlich allen erpresserischen Nachdruck, den die Mission des neuen „starken Mannes“ für ihren Erfolg benötigt. Der IWF formuliert die Leitlinie, durchaus ein wenig selbstkritisch mit Blick auf seine 17 früheren Interventionen und den Vorwurf, er hätte mit seinen bisherigen Beistandskrediten der Türkei viel zu viel finanzpolitische „Nachlässigkeit“ ermöglicht, knallhart:
„Der Fonds will keine Krisen mehr in der Türkei, dazu werden wir ein robustes Programm erstellen.“ (FTD, 20.3.)
„Robust“ bedeutet in der Praxis: Der zur Aufrechterhaltung der Geschäftsfähigkeit des Landes unabdingbar notwendige Milliardenkredit wird in kleine Tranchen aufgeteilt und nur Zug um Zug gegen eingreifende Reformgesetze und -maßnahmen und als Belohnung für erzielte Erfolge hergegeben; und das wird penibel überprüft. Wird das jeweils Verlangte nicht pünktlich geliefert, dann wird die Anweisung des versprochenen Teilbetrags gestoppt; ergibt die Prüfung, dass die Regierung zur Zufriedenheit kooperiert und „die Reformen“ vorantreibt, dann folgt dem Lob der in Washington für passend erachtete Devisenbetrag.[12] Auch das zieht sich hin; das eigentümliche ‚Do ut des‘ zwischen dem supranationalen Vertrauensstifter und der nationalen Reformpolitik, das Hin und Her zwischen Kritik und Umgestaltung gerät zur Dauerveranstaltung. Und so wird eine kaum haltbare nationale Krisenlage ganz allmählich zum neuen Normalzustand der türkischen Nationalökonomie[13] – mal wieder so eine Glanzleistung des internationalen Krisenmanagements!
Mit dieser Politik exekutiert der IWF einen ziemlich klaren Auftrag, nämlich den politischen Willen seiner eigenen politischen Aufsichtsräte, die mit ihrem türkischen Verbündeten auch schon mal anders verfahren sind:
„Wenn die türkischen Staatskassen leer waren, griffen Freunde und Verbündete bereitwillig in die Tasche. Ein Land wie die Türkei konnte schon wegen seiner strategischen Lage nicht Bankrott gehen – ja, es brauchte sich nicht einmal besonderer finanzpolitischer Disziplin zu befleißigen.“ (HB, 4.7.)
Egal, ob das wirklich je so war, wie es heutzutage alle Welt wissen will: Wichtig ist, dass die zuständigen imperialistischen Mächte – allen voran die USA – das in etwa genau so sehen. Denn nach anfänglicher Unklarheit darüber, wie es mit der „Türkei als Testfall für die Regierung Bush“ (NZZ) ausgehen würde, sind die von der NATO-Führungsmacht ausgesandten „Signale“ ziemlich eindeutig. Der Feststellung, dass das Land nach wie vor ein „wichtiger Bündnispartner“ sei, folgt die Klarstellung, dass angesichts von „Korruption und Misswirtschaft“ (US-Finanzminister O’Neill) der in die Krise geratene Partnerstaat wie jeder andere Fall dieses Kalibers zu behandeln sei.[14] Mehr noch:
„Von amerikanischer Seite wurde der Türkei klar gemacht, dass ein weiteres Hilfspaket nicht gewährt würde, wenn mit den neuesten Maßnahmen das Vertrauen nicht wiederhergestellt werden könne.“ (NZZ, 30.4.)
Mit der Richtlinienkompetenz der Führungsmacht wird so der Kreditbetreuung der Türkei ein klarer Weg gewiesen: Natürlich wird der Staat weiterhin als wichtiger Bundesgenosse und Vorposten in Anspruch genommen; doch diese Inanspruchnahme schließt kein finanzielles Entgegenkommen des großen Partners, sondern im Gegenteil den speziellen Anspruch ein, dass die Türkei sich, ihrer wichtigen Rolle und ihren eigenen Ambitionen gemäß, aus eigener Kraft als geschäftsfähige und -tüchtige Macht bewährt. Nach Ende der west-östlichen Weltkriegslage sieht Amerika jedenfalls überhaupt nicht mehr ein, weshalb es für die durchaus erwünschte nationale Stärke der Türkei irgendwelche Unkosten übernehmen sollte, und stimmen selbst der kollektiven Kredithilfe per IWF nur nach einigem Widerstreben zu.
Aus europäischer Perspektive nimmt sich die Sache – zunächst – nicht ganz so eindeutig aus. Dem deutschen Kanzler fällt zum „dramatischen Kurssturz“ der Lira gleich die desolate Lage auf dem Balkan ein; er fürchtet ein „womöglich noch größeres Pulverfass“, was zumindest die Bedeutung hat, dass Deutschland mit verheerenden Rückwirkungen eines regelrechten türkischen Staatsbankrotts auf sich und die EU als selbstverständlich erstzuständige Ordnungsmacht rechnet. Deswegen setzt Schröder sich für „bilaterale“ Kredithilfen ein, was in dem Fall allerdings nicht mit „zweiseitig“ zu übersetzen ist – eine deutsche Leihgabe an die Türkei könnte er mit der anderen Seite ja leicht ausmachen, ohne sonst jemanden zu fragen –, sondern auf den Antrag hinausläuft, alle interessierten Partner der Türkei sollten das Land gemeinsam aus seiner Krise herauskaufen:
„Schröder will in Washington dafür werben, dass Amerikaner und Europäer den maroden Staatsbanken schnell bis zu 30 Milliarden Dollar pumpen, um das Land vor dem Fall ins wirtschaftliche Nichts zu bewahren.“ (Der Spiegel, 13/01)
Doch genau das wollen die USA nicht; ihre Weltherrschaft sieht derartige faux frais – erst einmal in diesem Fall – nicht mehr vor. Und daran nehmen die EU-Macher sich ein Beispiel – obwohl es sich bei der Türkei um einen „Brückenpfeiler“ ihrer Nahostpolitik handelt, den sie immerhin als Beitrittskandidat vorgemerkt haben: Allein wollen sie für den schon gar nichts tun. Also „verzichten“ auch die Euro-Besitzer auf Kredithilfen am IWF vorbei, setzen dadurch dessen Sanierungsprogramm ohne Abstriche in Kraft – und verfolgen damit eine Direktive, die sich so allmählich als die generelle Leitlinie ihres kollektiven Imperialismus herausstellt, auch wenn die vielleicht nie so beschlossen worden ist: Mit ihrer Zuständigkeit greifen sie immer weiter aus – und funktionieren soll ihr Zugriff so, dass die davon betroffenen Staaten selber ihn beantragen, sich freiwillig unterordnen und alle entstehenden Unkosten auch noch alleine tragen.
Den Geist dieser Maxime haben im Übrigen die ideell zuständigen Türkei-Kenner gut verstanden und sich in ihren Expertisen zur Lage des Landes gleich zu Eigen gemacht: Alternativen gibt es nicht; das Land hat sowieso nur die eine Chance, die der IWF ihm gewährt; das Beste, was man ihm antun kann, ist ein „Sachzwang“, der die Führung zu dieser Einsicht zwingt. Für innertürkische Querelen hat man daher kein Verständnis und schon gar nicht für verantwortungslose Politiker, die doch glatt eine „Diskussion über nationale Würde und Nationalstolz lostreten“ (Die Welt, 30.7.) – als könnte eine solche Nation sich Stolz und Würde überhaupt leisten! Dass im Umgang des Westens mit der Türkei ein gewisses Moment von Zumutung enthalten ist, fällt dem Schweizer Weltblatt in seinem Bericht über den Widerstand des Staatspräsidenten gegen das Gesetz zur faktischen Liquidierung des heimischen Tabakbauernstandes wenigstens noch auf:
„Man mag nun die Argumente von Sezer überzeugend finden oder nicht, auf jeden Fall legt der Widerstand ausgerechnet jenes Politikers, der als Vorkämpfer der Demokratisierung und als unbestechlich gilt, den Finger auf den wunden Punkt: Der Westen fordert die Demokratisierung der Türkei und zwingt ihr gleichzeitig Reformen ohne Rücksicht auf ihr institutionelles Gefüge auf.“ (NZZ, 10.7.)
Da ist was dran. Aber es ist nirgends zu sehen, dass sich irgendein westlicher Demokrat von diesem „wunden Punkt“ irgendwie beeindrucken ließe. Viel eher macht man sich, nicht ohne Zynismus, auf die Streitigkeiten in und zwischen den Herrschaftsorganen der Türkei den optimistischen Vers, dass es sich dabei um die demokratisch produktive Zerstörung der alten – „korrupten“ – Verhältnisse handeln dürfte. Sollte es doch anders ausgehen, dann hat auf alle Fälle die Türkei ihre Chance gehabt und sie offensichtlich nicht genutzt:
„Außenstehende blicken kaum noch durch, wie das Innenleben des türkischen Machtgefüges funktioniert. So viel scheint jedoch festzustehen: Die Türkei ist schon wieder auf dem besten Weg, eine Chance zur radikalen Umkrempelung ihrer verkrusteten Strukturen zu verspielen.“ (Die Welt, 30.7.)
Selber schuld, wenn die Türkei ein Stück weiter kaputtgeht – so spricht die demokratische Öffentlichkeit ihre regierenden Macher von jeder Notwendigkeit frei, sich die Instandhaltung der Instrumente ihres Imperialismus einen Pflegebeitrag oder auch nur einige Rücksicht kosten zu lassen.
[1] Der Vorwurf, die türkische Wirtschaft hinge – im Unterschied zu dem Kapitalismus an „gescheiten“ Standorten wie dem deutschen oder dem amerikanischen – „am Tropf“ staatlicher Subventionen, wäre also ineffektiv und „von sich aus“ gar nicht lebensfähig, ist zwar gut gemeint, nämlich eine unmissverständliche Aufforderung zu größerer Effektivität bei der Ausbeutung der Arbeit und Verbilligung der Lohnarbeit von Staats wegen. Er blamiert sich aber an jeder deutschen oder US-amerikanischen Subventions-Statistik.
[2] So banal löst sich das Rätsel auf, das die Fachleute vom Spiegel aus der Umdrehung des Zusammenhangs verfertigen: „Seit knapp 20 Jahren gibt die türkische Wirtschaft den Ökonomen ein Rätsel auf: Obwohl zum Teil eine galoppierende Inflation herrschte, verzeichnete das Land bemerkenswerte Wachstumsraten.“ (Der Spiegel, 10/01)
[3] Richtig süß der
Bericht des Handelsblatts: Seit Dezember 1999 hatte
die Türkei den Wechselkurs der Lira an einen
Währungskorb von einem US-Dollar und 0,77 Euro
gebunden, als Teil des mit dem IWF vereinbarten
Disinflationsprogramms. Die Vereinbarung sah bis Mitte
2001 eine Abwertung von 0,9% im Monat vor. Danach
sollte die Lira in immer größeren Bandbreiten um den
Festkurs schwanken dürfen. Die Realität war
offensichtlich schneller.
(HB,
23.2.01)
[4] Voller Mitleid die
SZ: Schon seit geraumer Zeit ächzt der Bankensektor
des Landes unter Liquiditätsengpässen, da es der
türkischen Zentralbank auf Grund der Vereinbarungen mit
dem IWF verboten ist, mit frischem Geld die noch immer
hohe Inflation des Landes anzufeuern.
(2.12.2000)
[5] Das Handelsblatt
berichtet: Ecevit spricht von einer ‚künstlichen
Krise‘. Heraufbeschworen worden sei sie von der
‚Hochzinslobby‘, die sich gegen rückläufige Inflation
und sinkende Zinsen aufzulehnen versuche
, und
kommentiert verständnisvoll: „Richtig daran ist,
dass viele der kleineren Privatbanken (die anderen
nicht? und was hätten sie sonst tun sollen?) von
den exorbitanten Zinsen der letzten zwei Jahrzehnte
profitiert haben. Vielen türkischen Geldinstituten
dürfte es schwer fallen, in einem Umfeld niedriger
Zinsen profitabel zu operieren.“ – ein sehr
zurückhaltender „Schluss“ angesichts der ersten
Bankrotte. (HB, 7.12.2000)
[6] Ein schönes Dokument
dieser eher albernen Sichtweise liefert wieder das
Handelsblatt: Wieder einmal steht die Türkei vor
einem Scherbenhaufen. Der handfeste Krach in der
Führungsspitze über die Korruptionsbekämpfung
eskalierte binnen weniger Stunden zu einer panikartigen
Krise an den Finanzmärkten. Das mühsam nach einer
Intervention des IWF vor wenigen Monaten gekittete
Vertrauen in die Türkei ist mit einem Mal wieder
zerplatzt.
(HB, 23.2.)
[7] Unter dem Titel
Türkische Bankensanierung wird teurer als
erwartet
berichtet das Handelsblatt von den
Problemen der drei großen Staatsbanken u.a. folgendes:
Sie drohen allmählich unter der Last der sogenannten
duty losses zusammenzubrechen. Darunter versteht man
‚Pflichtverluste‘ aus subventionierten Krediten, die
auf Weisung der Regierung ausgegeben wurden. Diese
Verluste sollten die Staatsbanken aus eigenen Gewinnen
decken.
(HB, 15.5.)
[8] Der weiß seinerseits
ganz gut, wie man als Machthaber die Massen
drangsaliert und sie gleichzeitig bei der Stange hält:
Von zwei weiteren Gesetzen zur Arbeitssicherheit und
zum Dialog zwischen den Tarifparteien verspricht sich
Dervis die Bewahrung des sozialen Friedens.
(FAZ, 17.4.)
[9] Es zeugt mal wieder vom guten demokratischen Geist deutscher Kommentatoren, wenn sie dem Widerstand solcher Politiker gegen einzelne Kahlschlag-Maßnahmen vorwurfsvoll die Berechnung ankreiden, sie wollten sich bloß Wählerstimmen sichern. Wer „im Wählerauftrag“ etwas unternimmt, was von der Generallinie der kapitalistischen Vernunft abweicht, disqualifiziert sich als Politiker, das ist klar!
[10] So weiß auch der
für EU-Belange zuständige Minister Yilmaz, dass die
Türkei ihre Wirtschaft „für Europa“ gründlich „fit“ zu
machen hat: Es geht um ein großes
Transformationsprojekt, das mit der Zeit immer wieder
aktualisiert werden muss. Dabei geht es nicht um
technische Verbesserungen, sondern es geht um eine
fundamentale Revision unseres politischen, sozialen und
wirtschaftlichen Systems.
(FTD, 20.3.)
[11] „Auf den
Prüfstand“ kommt noch viel mehr, nämlich der reguläre
Militärhaushalt ebenso wie die vielen „Pfründen“,
industriellen Beteiligungen und sonstigen
Finanzierungsquellen, die außerhalb einer ordentlichen
staatlichen Haushaltsführung angesiedelt sind. Und
tatsächlich zeigen die Truppenchefs – notgedrungen –
Einsicht: Der Chef des türkischen Generalstabs hat
angekündigt, das gesamte Beschaffungsprogramm der
Streitkräfte einer Revision zu unterziehen. Die
türkische Armee sieht sich zu diesen Einschnitten
gezwungen, weil die öffentlichen Finanzen der Türkei
zunächst 1999 durch das verheerende Erdbeben und jetzt
durch die Finanzkrise im Februar stark in
Mitleidenschaft gezogen worden sind. Das trifft die
Armee, weil sie eine Hälfte ihres Budgets direkt aus
dem Staatshaushalt erhält. Die andere Hälfte fließt ihr
aus bestimmten Steuern, der nationalen Lotterie sowie
ihren Industriebeteiligungen zu, die auch die
Zurückhaltung der Verbraucher zu spüren bekommen.
(FAZ, 15.3.) Hinzu kommt
dann noch, dass mit der angesagten „Privatisierung“ die
eine oder andere Finanzierungsquelle des türkischen
Militärs ganz aus dem Verkehr gezogen wird.
[12] Exemplarisch der
Fall der zur Privatisierung vorgesehenen Türk Telekom.
Deren neu zu berufenden Vorstand will der IWF mit
„erfahrenen Managern“ besetzt wissen; der
Regierungschef gibt sich widerspenstig – …denken
nicht daran…
–; daraufhin storniert der Fonds
seinen Beistandskredit und bleibt damit bei seiner
harten Linie, die er zu Beginn der vergangenen Woche
eingeschlagen hatte. Zum Wochenauftakt hatte er die
Auszahlung der zweiten Tranche aus dem
Beistandsabkommen mit der Türkei vom vergangenen Mai
verweigert.
(FAZ,
9.7.); die Wirkung tritt sofort ein:
„Missmut“ grassiert unter den Spekulanten:
Die meisten Analysten rechnen damit, dass die
Istanbuler Finanzmärkte an diesem Montag erneut unter
Druck geraten werden. Denn trotz der zur Schau
gestellten Zuversicht des Wirtschaftsministers Dervis
ist die Auszahlung der Hilfsgelder alles andere als
gesichert.
(HB, 9.7);
die Regierung fügt sich; der IWF erklärt sich
zufrieden: Die Türkei verschärft das Tempo bei
Reformen
(HB, 11.7.);
die fällige Überweisung trifft ein.
[13] In diesem Sinne
kann der Wirtschaftsminister am ersten
August-Wochenende glatt erklären: Wir werden die
Krise meistern, wir haben sie mehr oder weniger bereits
bewältigt
(lt. HB,
6.8.), kurz nachdem seine Regierung
sich mit dem IWF darüber ins Benehmen gesetzt hat, dass
die Vorgaben des Sanierungsprogramms verfehlt worden
sind – Besorgnis löst vor allem das hohe Zinsniveau
aus, das die Bedienung der Inlandsschulden
verteuert
usw. (HB,
25.7.) –, und kurz bevor der Lira-Kurs
schon wieder um über 10 Prozent absackt. Das dauernde
Hin und Her ist die „Bewältigung“ der Krise –
wie sonst sollte sie aussehen?!
[14] Mitte April,
im Vorfeld der IWF-Frühjahrstagung
, gab es
darüber angeblich eine „harte Kraftprobe“ zwischen
State Departement und Finanzministerium (HB, 26.4.). So gehört es sich auch:
Alle Aspekte werden im Streit der Ministerien
abgewogen. Das Ergebnis ist eindeutig.