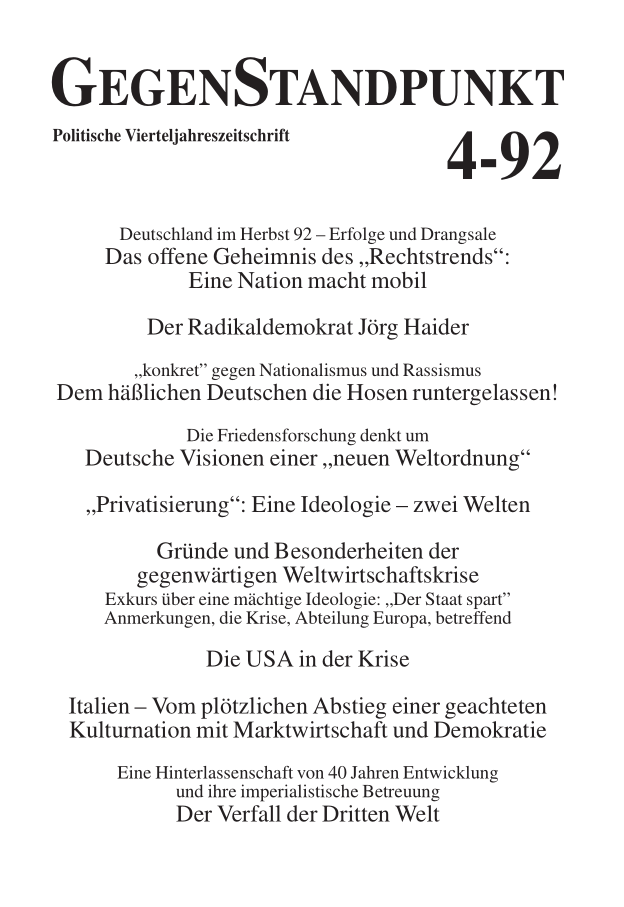„Privatisierung“: Eine Ideologie – zwei Welten
Vergleich der Prinzipien der Privatisierung im Kapitalismus und im ehemaligen Ostblock. Im Kapitalismus werden Staatsbetriebe privatisiert, damit sie nach den Maßstäben internationaler Profitproduktion einen größeren Beitrag zum Wachstum liefern. In der Ex-SU dagegen zeugen die Privatisierungsbemühungen von der Notlage des Staates, dass seine Ökonomie keine Quelle des Wachstums, sondern v.a. eine Belastung für ihn ist.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Siehe auch
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
„Privatisierung“: Eine Ideologie – zwei Welten
Seit Oktober erhält jeder russische Bürger einen „Voucher“, einen Anteilsschein über 10.000 Rubel, mit dem er nach einem noch festzusetzenden Verfahren zu einem noch festzulegenden Zeitpunkt Vermögensanteile an noch zu bestimmenden Betrieben erwerben können soll. Auf diese Weise sollen ehemals sozialistische Staatsbetriebe in Aktiengesellschaften verwandelt werden. „Privatisierung“ heißt das Zauberwort. Durch diesen Schritt soll in Rußland endlich der Durchbruch zu marktwirtschaftlichen Verhältnissen geschafft werden. Die Überführung von Staatsunternehmen in private Hand, also der Eigentumswechsel soll der entscheidende Hebel für die Kapitalisierung des Landes sein, soll die Ineffizienz der Kombinate und den schädlichen staatlichen Dirigismus ein für alle Mal erledigen und das Wirtschaften dem privaten Bereicherungsinteresse und Sachverstand überantworten. Jelzin und seine Berater berufen sich dabei wie immer auf das westliche Vorbild.
Dort ist das Programm „Privatisierung“ gegenwärtig ja sehr im Schwange. Deutschland mit seinem Osten, aber auch Nationen wie Italien und Großbritannien haben es zur wirtschaftspolitischen Leitlinie erhoben und knüpfen daran das Versprechen eines umfassenden ökonomischen Aufbruchs. Genauso wie die russischen Reformer verkünden westliche Wirtschaftspolitiker, daß sich der Staat mit seinem bürokratischen Apparat aus einer Sphäre heraushalten muß, in der er nichts zu suchen hat, weil er vom Wirtschaften nichts versteht. Dadurch, daß er seine Betriebe privatisiert, soll effektives Wirtschaften gewährleistet sein: effektiv nach der Seite des geldlichen Ertrags, effektiv aber auch nach der Seite, daß die Privatbetriebe ihre angeblichen gesellschaftlichen Versorgungs- und Beschäftigungsaufgaben besser erfüllen als unter staatlicher Regie. Daß dabei auch manches an Leistungen, Arbeitsplätzen und Unternehmen gestrichen wird, sei nur der Beweis für die bisherige staatliche Verschwendung und insofern der unvermeidliche Preis für allgemeine Kostenersparnis, Modernisierung und Wachstumsfortschritt. Auch im Westen gilt „Privatisierung“ als ein Schlüssel zum nationalen Erfolg, so daß man sich fragt, wieso es überhaupt noch Staatsbetriebe gibt.
Dabei sind die vorgestellten heilsamen Wirkungen gar nicht der Witz an Privatisierungen im Westen. Und schon gar nicht sind sie es in Rußland, wo mit dieser Ideologie etwas ganz anderes auf den Weg gebracht wird als die Überführung von öffentlichem Eigentum in Kapitalistenhände.
Privatisierung im Kapitalismus
1. Privatisierungen sind in kapitalistischen Staaten eine hoheitliche Technik zur Änderung von Eigentumsverhältnissen. Betriebe, die als staatliches Eigentum und in staatlicher Regie geführt werden, werden in Aktiengesellschaften umgewandelt. Sie werden so in Mittel privater Reichtumsvermehrung verwandelt.
Die Existenz von nicht wenigen Staatsbetrieben beweist, daß die politischen Agenten der Marktwirtschaft ganz und gar nicht auf dem Standpunkt stehen, der „Markt“, die konkurrierenden privaten Geschäftsberechnungen, erledigte schon alle nationalen Wachstumserfordernisse. Kapitalistische Staaten kümmern sich selber hoheitlich um die Sicherung von Grundlagen allen Handels und Wandels – Infrastruktur, Grundversorgung mit Energie, Kommunikationswesen usw. –; sie sorgen auch selber für den Aufbau und Erhalt national bedeutsamer Großbetriebe und Branchen. Überall dort, wo der private Geschäftssinn mit dem politischen Anliegen kollidiert, über ein umfassendes Geschäftsleben in den eigenen Grenzen und über sie hinaus zu gebieten, schwingt sich der oberste Souverän vom Garanten zum Betreiber von Produktions- und Dienstleistungsbetrieben auf. Gelegenheiten dafür bieten sich genügend: Manche allgemeine Bedingung eines nationalen Geschäftslebens erfordert bei ihrem Aufbau oder Betrieb eine Kapitalgröße und Kapitalbindung aufgrund der langen Umschlagszeit – ideologisch: eine Risikobereitschaft – die die Fähigkeit und den guten Willen der versammelten privaten Anleger übersteigt und daher auch vom Staat ihrer Entscheidung nicht anheimgestellt wird. Wo eine profitable Erledigung solcher erforderlicher Dienste erst gar nicht in Sicht oder nur auf Kosten ihrer allgemeinheitsdienlichen Ausführung denkbar ist, da verlangt „die Wirtschaft“ nach dem Staat, und dieser nimmt die Sache selber in die Hand. Wo Grundlagenindustrien, bevorzugte „Wachstums“branchen, aber auch andere für unverzichtbar angesehene Ressourcen und bedeutsame Teile einer nationalen Wirtschaft im internationalen Vergleich nicht konkurrenzfähig sind, da entzieht sie der Staat nicht selten dem ruinösen Vergleich, indem er sie selber betreibt. Und dort, wo wie bei der Rüstungsindustrie ganze Bereiche sowieso rein von staatlichen Aufträgen leben, kümmert er sich darum, daß solche unverzichtbaren „High-tech“-Produktionsstätten im Zweifelsfall als öffentliche Anstalten zustandekommen, damit sie ausreichend vorhanden sind.
Solche hoheitlichen Unternehmungen sind also die Konsequenz der generellen staatlichen Fürsorge für ein umfassendes und einträgliches privatwirtschaftliches Leben in seinem Hoheitsbereich. Der Staat übt damit die Rolle des ideellen Gesamtkapitalisten aus, der alles in seiner Macht Stehende unternimmt, damit Land und Leute in seinem Umkreis sich als Standort für Kapitalvermehrung bewähren und so auch sein Reichtum wächst. Er kümmert sich darum, allgemeine Produktionsvoraussetzungen, vorhandene Produktionszweige, den technischen Fortschritt sowie seine Machtmittel unabhängig von kapitalistischen Rentabilitätskriterien zu sichern und voranzubringen, weil die ganze Nation Material privaten Geschäftssinns ist und sein soll und dafür vom Telefon bis zum Militär alles bereitstehen muß.
Damit leistet sich der kapitalistische Staat allerdings einen Widerspruch. Wo nichts dem privaten Wirtschaften, das mit lohnenden Kosten und steigenden Überschüssen rechnet, vorenthalten sein soll, entzieht er Teile der nationalen Ressourcen und Mittel der Verfügung seiner Lieblingsbürger. Er entlastet die in seinen herrschaftlichen Gefilden tätigen privaten Anleger und Produzenten von notwendigen allgemeinen Kosten, die für sie nicht lohnend sind, indem er sie aus seinem Haushalt bestreitet – und so qua seiner Hoheit der gesamten Gesellschaft aufbürdet.
Den politischen Wirtschaftsförderern ist dieser Widerspruch durchaus bewußt. Deswegen wird der hoheitliche Aufwand auf den Fortschritt des nationalen Geschäftslebens ausgerichtet, das den Staatshaushalt speist. In vielen Fällen ist der staatliche Einsatz sowieso von vornherein darauf berechnet, nationale Wirtschaftsbereiche konkurrenzfähig zu machen. Als Posten des Staatshaushalts unterliegen diese Betriebe daher einem Rechnungswesen, das Kosten und Erträge bilanziert. Finanz- und Wirtschaftsminister behandeln sie wie Wirtschaftsunternehmen und stellen sie unter den Anspruch, nach den gültigen Profitmaßstäben lohnend zu sein bzw. zu werden. Auch wenn sie die Existenz dieser Unternehmungen davon nicht abhängig machen, kalkulieren sie sie wie Unternehmer, die Gewinne und Verluste ausweisen, die letztlich bei der öffentlichen Hand anfallen. Staatskosten werden wie Betriebsschulden verrechnet, so daß für reichlich Unzufriedenheit mit dem hoheitlichen Eigentum gesorgt ist. Denn alles, was die Standortqualitäten der Nation verbessern soll, verschlechtert zugleich die staatliche Haushaltsrechnung.
2. Der Staat begutachtet seinen Haushalt, die faux frais kapitalistischer Produktion, immer unter dem doppelten Gesichtspunkt: Ob diese Kosten notwendig sind und ob sie sich lohnend machen lassen. Kapitalistische Staaten trennen sich deswegen auch immer wieder von solchen Betrieben, überführen sie in privates Eigentum und üben politische Selbstkritik: In den Fällen, wo Staatsunternehmen sich als profitabel erweisen, stellt der staatliche Eigentümer sie früher oder später seiner Wirtschaft als eine Geschäftsgelegenheit zur Verfügung, weil er seine Aufgabe erledigt sieht. In anderen Fällen kommen sie aus Sparsamkeitsgesichtspunkten zu der Auffassung, daß die staatliche Regie lauter Kosten nach sich gezogen hat, die bei ordentlicher Geschäftsführung nicht notwendig wären. In vielen Fällen, wo sich in den Bilanzen die Schulden statt der Gewinne mehren, kreiden sie sich die Vergeblichkeit des Bemühens an, mit ihrer staatlichen Unternehmertätigkeit Konkurrenzfähigkeit herzustellen, und gestehen damit politisch ein, daß die nationale Industrie – nicht bloß hier und da, sondern in entscheidenden Bereichen – den gültigen Standards lohnenden Produzierens nicht genügt. Von höchster politischer Warte wird damit das Urteil vollzogen, daß nur, was sich an den Kriterien des Profits bewährt, auch wert ist, erhalten zu werden. Was keinen Gewinn abwirft, ist auch keine Reichtumsquelle; was aber Gewinn abwirft, soll auch als solche Reichtumsquelle verwendet werden. Mit einer solchen Selbstkritik bekennen sich Nationen zu dem Grundsatz, daß als Standortqualität eines Landes letztlich nur das taugt, was das frei kalkulierende Kapital bei seinem Standortvergleich zufriedenstellt. Sie gestehen damit, nicht selten in Form einer wirtschaftspolitischen Wende, ihre Abhängigkeit vom weltweiten Vergleich der Kapitalanleger ein, von deren erfolgreichen Geschäften die Nation lebt; und nachdem sie eine Niederlage in der Konkurrenz der Staaten erlitten haben, setzen sie ihre nationale Industrie der Konkurrenz der Multis aus, auch wenn dabei viele, bisher für unverzichtbar gehaltene Unternehmen und ganze Branchen brachgelegt werden. Allerdings leisten sie sich diesen Radikalismus in der Erwartung, daß bei diesem „Gesundschrumpfungsprozeß“ genügend Industrie übrigbleibt, die sich international behaupten und damit wirklich zur Bereicherung der Nation beitragen kann. Ob diese Erwartung aufgeht, ist eine andere Frage.
Ob aus einer nationalen Notlage heraus, ob aus neuen staatlichen Haushaltsgesichtspunkten oder weil ein Staatsbetrieb marktfähig ist – mit seinen Privatisierungsprogrammen kehrt der ideelle Gesamtkapitalist den Widerspruch seiner Bemühungen um ein kapitalistisches Wachstum um: Die Bewährung an den internationalen Maßstäben profitabler Produktion wird über die Bewahrung und Pflege nationaler Produktionsbedingungen und -mittel gestellt.
3. Die Überführung des staatlichen Eigentums in Privathand stellt allen anderslautenden Gerüchten zum Trotz die Geschäftsfähigkeit der Staatsbetriebe nicht her, sondern vollzieht das Urteil über ihre erreichte Geschäftsfähigkeit. Der Staat wendet sich nämlich an die Kapitalistenwelt und präsentiert seine Unternehmen als ein Angebot für anlagesuchendes Kapital. Mit der Plazierung an der Börse eröffnet er die Gelegenheit, Eigentumstitel zu erwerben, die ein Anrecht auf die Teilhabe am Geschäftserfolg des Betriebs eröffnen. Damit setzt er sein „Objekt“ der Bewertung durch das versammelte Geldkapital aus, das die Tauglichkeit der verschiedenen Anlageobjekte in puncto Geldvermehrung vergleicht. Mit dieser Verwandlung in gemeinschaftliches Privateigentum wird das Unternehmen mit einigen Geschäftsmitteln und einer Kreditwürdigkeit ausgestattet, die sich auf die Bewertung seiner Geschäftsaussichten gründet.
Die bisherigen staatlichen Bemühungen bewähren sich bei dieser Transaktion als weitgehend kostenloser Extra-Dienst am Geschäft. Nationale Großunternehmen wie die Eisenbahn oder Postabteilungen werden überhaupt nur zum kalkulierbaren Geschäftsartikel, weil das Objekt betriebsfertig vorliegt, das Kapital also keinerlei Entwicklungskosten mehr aufzubringen braucht. Anderswo fallen auf Staatskosten zustandegebrachte technologische Fortschritte und Großproduktionsstätten Anlegern zu vergleichsweise verschwindenden Preisen zu. Honoriert wird das von der Geschäftswelt allerdings nicht. Sie bewertet nicht die vergangenen Leistungen, sondern die künftige Leistungsfähigkeit, die sie nicht mit viel Geld herstellen, sondern für die Vermehrung ihres Geldes benutzen will. Für den entsprechenden Leistungsnachweis muß der Staat daher in den meisten Fällen erst noch sorgen und sich um die Attraktivität seines Angebots kümmern, damit die Anleger zugreifen. Die Privatisierungsplaner nehmen den Vergleich, dem ihr Objekt an der Börse ausgesetzt ist, daher auch schon vorweg und machen es durch zusätzliche Maßnahmen lohnend. Sie trennen erst einmal die profitträchtigen Bereiche von solchen, die Kapitalisten keine müde Mark wert sind und daher beim Staat verbleiben. Sie verbessern die „Kostenstruktur“, „rationalisieren“, steigern also die Produktivität, führen neue Leistungsanforderungen an die Belegschaft ein und entlassen auf der anderen Seite massenhaft; sie übernehmen großzügig „Altlasten“ und Schulden und bieten ebenso großzügig Subventionen an. Über den Verkauf und die kapitalistische Nutzung wird dann durch den privatwirtschaftlichen Sachverstand das vollendet, was die staatlichen Anbieter bei der Herstellung der Verkäuflichkeit noch nicht erledigt haben. Die ehemaligen Staatsbetriebe und ihre Leistungen werden noch einmal nach ihrer Geschäftsfähigkeit durchforstet und sortiert. Darüber schrumpft manches Unternehmen auf ein paar „Filetstücke“ zusammen, viele bisher benutzte Produktionsanlagen und ihre Belegschaften werden aus dem Verkehr gezogen, alles mögliche, was bisher schon nicht ganz billig war, wird nach den Sachgesetzen lohnenden Verkaufs noch teurer, und viele staatlich garantierte Leistungen für die Gesellschaft verkommen oder verschwinden mehr oder weniger ersatzlos. So macht sich die Rücksichtslosigkeit, die der Staat sich leisten zu können bzw. zu müssen meint, in der fortschreitenden Scheidung zwischen kapitaltauglichen und untauglichen Funktionen und Diensten geltend.
4. Der Widerspruch, daß das ganze Innenleben der Nation dem Kapital zur Verfügung stehen soll, dafür aber immer dort durch den Staat tauglich gemacht und entsprechend erhalten werden muß, wo es sich für Kapitalisten nicht rechnet, tritt so neuerlich auf. Der Staat sieht sich auf die Sorge zurückgeworfen, daß nicht zuviele und keine entscheidenden Standortbedingungen ruiniert werden. ‚Nicht profitabel‘ ist eben nicht dasselbe wie ‚nicht gebraucht‘ für die Attraktivität des Standorts und die Ansprüche der Nation. Die politische Aufsicht ist gefragt und erklärt sich weiterhin oder neuerlich für manches mehr zuständig als ursprünglich gedacht. Wo die Konkurrenz, der die Nation sich ausliefert, den nationalen Standort gefährdet und Geschäfte und Geschäftsbedingungen ruiniert statt fördert, steht die oberste Gewalt daher neuerlich vor der Grundsatzfrage, ob nicht eine nationale Kraftanstrengung in die entgegengesetzte Richtung angebracht ist, will sie nicht im internationalen Vergleich hoffnungslos zurückfallen. Die Weltmarktbewährung durch mehr staatliche Regie über die nationale Industrie oder durch programmatische Privatisierungen gehört daher zu den bleibenden Alternativen kapitalistischer Nationen.
5. Die ganze Rücksichtslosigkeit eines solchen kapitalistischen Staatsprogramms führt das wiedervereinigte Deutschland mit seinem nationalen Großprojekt der Privatisierung in den neuen Bundesländern vor, in denen bisher nach anderen Grundsätzen produziert worden ist. Durch die Treuhandanstalt wird ein ganzes Land mit seinen ehemaligen Staatsbetrieben, Grund und Boden, Bauern und Werktätigen zum Angebot für private Anleger gemacht. Die sollen zugreifen, wo sie eine Geschäftsgelegenheit vermuten; wo nicht, sind alle vorhandenen Produktionsmöglichkeiten und Produktionswilligen auch nichts wert. Die Regierung setzt dabei Staatskredit und Staatsgewalt ein, um das, was jetzt unter ihrer Hoheit steht, zum Gegenstand geschäftlichen Vergleichs zu machen. Sie kümmert sich radikal um die Herstellung der Verkäuflichkeit und exekutiert ebenso radikal die Unverkäuflichkeit des größeren Teils der Betriebe. Darüber stößt sie dann auf das Problem, wieweit sie den Ruin ganzer Industrielandschaften und Landstriche zulassen will, auf deren Benutzung sie gesetzt hat. Abstand nimmt sie von ihrem Programm allerdings nicht. Ihr prinzipienfester Radikalismus, der an Privatisierung als nationaler Leitlinie festhält, speist sich aus dem zur regelrechten Staatsideologie aufgeblasenen Stolz auf die Tatsache, daß die Kapitalistenmannschaft, der sie ihren Zuwachs an Land und Leuten zur Verfügung stellt, bislang weltweit erfolgreich war. In diesem Fall geht es nämlich nicht darum, konkurrenzfähige nationale Geschäftsverhältnisse erst noch herzustellen, sondern um die wirtschaftspolitische Vollendung einer Annexion: die Unterwerfung neuer Hoheitsgebiete unter ein fertiges nationales Kapitalverhältnis, in dem Arbeit und Eigentum geschieden sind, erstere produktive Dienste am Eigentum versieht, letzteres sich darüber vermehrt und in Europa und im Weltmaßstab Standards lohnenden Geschäfts setzt.
Privatisierung in Rußland[1]
1. Jelzin und seine Reformer nehmen sich mit ihrem Programm der „Privatisierung“ nicht die Praxis kapitalistischer Staaten zum Vorbild, sondern deren ideologische Verbrämung, die Verwandlung von Staatsunternehmen in Aktiengesellschaften würde aus verlustreichen und ineffektiven Betrieben einträgliche und leistungsfähige Konkurrenzteilnehmer machen. Die russischen Fans der Marktwirtschaft nehmen diese Ideologie bitter ernst; umso mehr, als sie von ihren westlichen Beratern und ihren Auftraggebern – IWF und einschlägige Regierungen –, die selber ihr Credo von den segensreichen Wirkungen des Privateigentums glauben, darin bestärkt und ein ums andere Mal zu entsprechenden Maßnahmen aufgefordert werden. Sie nehmen sie so ernst, daß sie in der Privatisierung den staatlichen Hebel sehen und anwenden wollen, um bei sich ein völlig neues Verhältnis von Staat und Ökonomie herzustellen. Durch den Eigentumswechsel wollen sie die Marktwirtschaft stiften, die es bei ihnen noch nicht gibt.
Damit leisten sie sich allerdings ein Experiment, das ein kapitalistischer Staat nie veranstaltet, weil er es nicht nötig hat. Er verläßt sich bei seinen Privatisierungen auf die fertigen marktwirtschaftlichen Verhältnisse – auf ein funktionierendes kapitalistisches Geschäftsleben mit seiner Trennung von Eigentum und Arbeit, seinen profitablen Betrieben, seinem Banken- und Kreditwesen –, hat an deren Erfolgen hoheitlichen Anteil und gibt deswegen auch die Kontrolle über und seine Sorge um deren Gelingen nie aus der Hand.
Genau umgekehrt behandeln es die Reformer im Kreml. Weil sie den Kapitalismus nicht studieren, sondern kopieren wollen, glauben sie ihm die Dummheit, Marktwirtschaft sei dasselbe wie der Rückzug des Staates aus der Zuständigkeit für das ökonomische Leben aufs Wort. Deswegen entdecken sie in der Herstellung von Privateigentum den Generalschlüssel dafür, statt zu bemerken, daß für die beneideten Wirkungen des Eigentumswechsels ein bißchen mehr vorausgesetzt ist als eine bloße Änderung des Rechtstitels. Sie betrachten diese Änderung nicht als eine wirtschaftspolitische Maßnahme im Kapitalismus unter anderen, sondern als generelles Mittel, einen Systemwechsel zum Kapitalismus durchzusetzen, eine funktionelle Trennung von Ökonomie und Staat zu vollziehen und letzterem damit eine privatwirtschaftliche Reichtumsbasis zu stiften.
Deswegen verlegen sie sich entschieden auf die eine Seite kapitalistischer Wirtschaftspolitik. Was sie kopieren wollen, ist nicht das wirtschaftspolitische Hin und Her zwischen Staatsfürsorge für seinen Kapitalstandort und Überantwortung des Produzierens in die befugten Hände privaten Geschäftssinns, sondern nur die zweite Hälfte, die ihnen allein zum Programm Marktwirtschaft zu passen scheint. Wie wenn die Rolle des ideellen Gesamtkapitalisten verzichtbar und hinderlich wäre, wenn es um ein kapitalistisches Geschäftsleben geht.
Damit ist für sie auch die Frage beantwortet, wie denn nun, wenn die neuen Eigentumsverhältnisse geschaffen worden sind, eigentlich die Ökonomie in Bewegung kommen soll: von ganz alleine. Mit einem bodenlosen Voluntarismus gehen sie davon aus, daß der Privatisierungsbeschluß im Kreml und die Verteilung der Anrechtsscheine auf Eigentum ein entscheidender Schritt sei, dem die entsprechenden Verhältnisse quasi automatisch nachfolgen würden. Als ließe sich Kapitalismus mit einer rechtlichen Umwidmungsaktion einführen.
2. Dabei ist gar nicht abzusehen, wie dort, wo all die Voraussetzungen und Verhältnisse überhaupt nicht gegeben sind, in denen kapitalistische Staaten an dieser oder jener Stelle zur wirtschaftspolitischen Maßnahme der Privatisierung schreiten, ausgerechnet mit der Umwidmung von Eigentumstiteln irgendetwas für das Programm „Einführung des Kapitalismus“ geleistet werden soll. Es ist eine Sache, wenn die Reformer mit aller Entschiedenheit von der alten Staatsauffassung Abstand nehmen, daß Privateigentum und Profit auf der Ausbeutung der werktätigen Bevölkerung und auf der Verschleuderung nationaler Produktionsquellen und Schaffenskraft beruht. Eine andere Sache ist es, die Bedingungen herzustellen, unter denen eine ganze Gesellschaft für die Profitproduktion eingespannt ist. Das ist keine Frage des Rechts, sondern der gesamtgesellschaftlichen Verhältnisse und materiellen Bedingungen, die aus der rechtlichen Verfügung erst die ökonomische Macht zum Kommando über die Arbeit und ihre Erträge machen. Durch die Vergabe von Zetteln, die Anrechte auf Eigentumstitel darstellen, durch die rechtliche Übertragung des bisherigen Staatseigentums wird keines der kapitalistischen Reichtumsmittel, die sie so bewundern und deren Fehlen sie so bedrückt, geschaffen, also auch keine der ökonomischen Sorgen, die den Staat bewegen, beseitigt. Durch die massenhaft unters Volk verteilten Vouchers und die daran geknüpften weiteren Privatisierungsperspektiven wird an den Verhältnissen in diese Richtung überhaupt nichts geändert:
– Der offizielle Schein, mit den Anrechtstiteln würde das Volk in Eigentum eingesetzt – was den Geboten kapitalistischen Wirtschaftens sowieso widerspricht –, löst sich durch den massenhaften Verkauf der Scheine schnell auf. Das Volk wird nicht zum Eigentümer an seinen Arbeitsprodukten. Genausowenig aber wird es zur funktionellen Arbeitskraft gemacht, die sich für die Vermehrung von Eigentum nützlich macht. Eine Scheidung vom Eigentum mag passieren, wenn die Titel sich flott in anderer Hand konzentrieren. Aber darüber wird aus der wachsenden Verarmung noch lange keine nützliche Armut, aus den Werktätigen des realen Sozialismus noch lange kein Proletariat, das so und soweit arbeitet, wie es sich für geschäftlich kalkulierende Anwender von Arbeit lohnt. Das hängt nämlich gar nicht vom Vorhandensein arbeitswilliger Armer, sondern von der profitablen Verwendbarkeit des Eigentums ab.
– Und daran ändert sich durch die Anrechtstitel ebensowenig. Sie sind kein noch so kleiner Schritt in Richtung auf die Verwandlung von Geld in Kapital. Erstens machen sie ihren Besitzer nicht zum Geldkapitalisten, Repräsentanten eines Geldes, das nach lohnender Anlage sucht und sich zwischen konkurrierenden Gelegenheiten entscheidet. Diese Gelegenheiten, die dafür notwendigen Mittel und daher auch der Wille zu investieren, kommen über noch so viele Anrechtsscheine auf irgendwelche Betriebsteile kein Stück voran: Weder gelangen die Eigentümer mit den Zetteln in den Besitz von verläßlichem Geld und Kredit, noch bietet sich ihnen irgendeine neue erfolgsversprechende Anlagealternative für deren produktive Verwendung.
– Es findet nämlich auch keine Verwandlung der Produktion in produktives Kapital statt. An der alten Industriehinterlassenschaft ändert sich durch den Besitzerwechsel kein bißchen: Auch die Betriebe werden nicht mit neuen Gelegenheiten, Mitteln und damit Antrieben für eine Kalkulation mit Vorschuß und Überschuß ausgestattet. Die ganze Transaktion berührt sie gar nicht, ändert daher auch nichts an ihren Sorgen, wie, für wen und mit welchen Mitteln sie produzieren sollen. Weder wird gesellschaftliches Geld eingesammelt und Betrieben zur Verfügung gestellt, also der Staat durch kapitalkräftige Anleger ersetzt. Noch wird irgendeine neue Marktbeziehung gestiftet, für die sich das Kaufen, Produzieren und Verkaufen lohnen würde und verläßlicher und ausreichender Kredit notwendig, bzw. durch die er zu verdienen wäre. Der Eigentumswechsel bringt keinen zuverlässigen und kostengünstigen Lieferanten und keinen gesicherten und zahlungsfähigen Abnehmer hervor. So stehen die Betriebe nach wie vor vor dem Problem, daß sie auf keinen ökonomischen Zusammenhang bauen können, wo das Geschäft an einer Stelle das an anderer benutzen und damit befördern kann.
– Das ist auch alles gar kein Wunder. Denn der Staat kräftigt mit dieser Eigentumsübertragung per Schenkung nicht seine Macht, eine Scheidung zwischen Eigentum und Arbeit herzustellen und das gesellschaftliche Produzieren entsprechend umzustellen. Er leistet gar nichts für das praktische Ziel, Verhältnisse herzustellen, wo das Eigentumsrecht an den Produktionsmitteln auch die Monopolisierung eines Mehrprodukts einschließt, wo also Eigentum kein bloß formeller Rechtstitel ist. Er unterwirft nicht die Gesellschaft dem ökonomischen Zweck des Privateigentums. Sondern er überantwortet die Nation einem Marktgeschehen, das es gar nicht gibt.
3. Was das russische Privatisierungsprogramm wirklich darstellt und leistet – und zwar schon durch seinen ersten vorläufigen Schritt, Berechtigungsscheine zum späteren Erwerb von Eigentumstiteln auszugeben – ist eine andere Sache.
Zunächst wird das Volk, das dem nächsten härteren Hungerwinter entgegensieht, qua staatlicher Hoheit mit einer Spende beglückt, deren nomineller Wert unter 100 DM liegt, die aber gar keinen feststehenden Wert hat. Bei den 10.000 Rubel-Scheinen handelt es sich um eine reine Phantasiezahl, nicht, weil es spekulative Papiere sind – das sind Aktien auch –, sondern weil sie eine bloß aus dem staatlichen Willen zur Bewertung seiner Betriebe geborene Berechnung repräsentieren. Sie stellen nach dieser Seite eine pure Umbenennung von ehemals sozialistischem Staatsvermögen in Volksvermögen dar. Der Anrechtstitel ist andererseits völlig getrennt vom Eigentum, das man damit erwerben können soll. Art, Umfang und Objekte der künftigen Eigentumsumwandlung liegen noch gar nicht fest. Mehr als der Gedanke, Betriebe oder auch Grund und Boden bzw. Wohnungen demnächst öffentlich zu versteigern, ist den Wirtschaftsberatern der russischen Regierung bisher noch nicht eingefallen. Statt eines wirklichen Eigentumstitels erhält das Volk ein staatliches Geldgeschenk, dessen Größe von den Fährnissen der Spekulation abhängt, die sich auf diese Scheine richtet. Das Volk kann mit diesen Scheinen wenig anfangen, außer sie verkaufen. Als dauerhaftes Eigentum sind sie in jedem Sinne untauglich – schon wegen der Not, die die Massen zwingt, sie in Rubel umzusetzen, bzw. wie Zahlungsmittel zu benutzen, um sich irgendetwas Lebensnotwendiges, das täglich rapide teurer wird, zu besorgen. Dieses massenhafte Angebot sorgt mit für einen flotten Verfall des Werts der Scheine und dafür, daß sie sich woanders sammeln.
Objekt einer Spekulation sind sie nämlich durchaus, allerdings einer negativen, die der Mangel an Geschäftsgelegenheiten beflügelt. Investmentfonds schießen aus dem Boden, die ins Blaue hinein unerhörte Renditen versprechen – fast so wie ein Lottogewinn –, ohne daß sie sich der segensreichen Tätigkeit des „Investierens“ in laufende Geschäfte widmen würden. Gekauft werden die Vouchers aus anderen Gründen: Erstens, um wertlose Rubel loszuwerden. Leute, die es bei der Auflösung des staatswirtschaftlichen Produzierens in ein Marktgeschehen, bei dem vor allem der Mangel die Preise regiert, auf die eine oder andere Art zu Rubelmillionen gebracht haben, verwandeln diese mangels anderer Sicherheiten in Vouchers. Zweitens knüpfen sie daran die Hoffnung, bei der endgültigen Verwandlung in Eigentumstitel sich „Sachwerte“ zu sichern, d.h. Zugriff auf das zu verschaffen, was an Produktion noch übriggeblieben ist. Mit dem Verscherbeln von Gebrauchswerten, die noch aus sozialistischer Produktion stammen – auf den Warenbörsen, die den Zusammenbruch des bisherigen betrieblichen Zulieferwesens und die entsprechende Notlage der Betriebe ausnutzen, sowie beim Handel auf den Privatmärkten –, werden Wucherpreise erzielt. Für dieses Geschäft mit den immer knapper und teurer werdenden Gebrauchswerten bieten die Vouchers eine vage Perspektive. Eigentum soll mit ihnen erworben werden, nicht um es durch profitable Produktion zu vermehren, sondern um Betriebe auszuschlachten oder, wo sie noch produzieren, für die Bedienung der Warenbörsen zu benutzen. Bei diesen Berechnungen setzen sie ganz anders, als sich der Staat das gedacht, auf seine Einsicht, daß er seine Betriebe nicht umstandslos sich selbst überlassen kann. Drittens werden die Vouchers von den entsprechenden Figuren gesammelt wegen der Spekulation, mit ihrer Hilfe den Besitz einer ausreichenden Zahl von Wertpapieren vorweisen zu können, der die Zulassung zum Makler an den Warenbörsen eröffnet.
Umgekehrt sehen sich die Betriebe durch den politischen Privatisierungswillen und die mit den Vouchers eröffnete Spekulation gar nicht geschäftlich beflügelt, sondern ganz im Gegenteil einer doppelten Bedrohung ausgesetzt, der sie zum Kampf ums Überleben zwingt. Der vorgesehene staatliche Rückzug aus der Verantwortung beraubt sie tendenziell der noch verbliebenen Adresse für ihre wachsenden Schwierigkeiten, überhaupt noch zu produzieren. Statt dessen droht die Zerschlagung der verbliebenen zwischenbetrieblichen Zusammenhänge und der Betriebe selber. Von den Privateigentümern aber haben sie statt einer kapitalmäßigen Ausstattung und Förderung eher die Unterwerfung unter deren gar nicht produktionsförderliche Interessen zu erwarten. Im Interesse der Fortführung ihrer Produktion, versuchen sie sich daher gegen die Privatisierungsdrohung zu wehren. Einerseits beteiligen sie sich an der Voucherspekulation. Betriebsleitungen sammeln Privati-sierungs-Schecks, um im Falle der Umwandlung möglichst viele eigene Anteile zu erwerben und ihr Unternehmen zusammenzuhalten sowie gegen den Zugriff unliebsamer Eigentümer zu schützen. Einige Staatskonzerne sind längst aus eigenem Beschluß Aktiengesellschaften geworden – sie brauchten sich dafür nur umzubenennen – und haben sich gegenseitig Aktienbeteiligungen zugeschoben, um so ihren Bestand und ihren verbliebenen Zusammenhang bei der wechselseitigen Belieferung und Materialversorgung nach Möglichkeit zu retten. Auf der anderen Seite kämpfen Betriebe, die noch funktionieren, erbittert gegen das Privatisierungsprogramm, unterstützt von politischen Reformgegnern und Rayonsverwaltungen, die nicht nur die Produktionsstätten, sondern auch die sozialen Versorgungsinstitutionen retten wollen, die immer noch an ihnen hängen.
4. Das alles beweist, daß hier eine ganz andere staatliche Rücksichtslosigkeit vorliegt als bei den Privatisierungen eines westlichen Staats, der das vorhandene kapitalistische Treiben in seiner Nation unter das Gebot der Konkurrenztauglichkeit setzt. In Rußland zieht sich der Staat dem Programm nach mehr oder weniger ersatzlos aus seiner Rolle als Garant eines geschäftlichen Lebens unter seiner Hoheit zurück. Was wie ein nationaler Aufbruch zu einem neuen wirtschaftlichen Leben daherkommt, ist die politische Nichtzuständigkeitserklärung für den Gang und die Aufrechterhaltung der produktiven Tätigkeiten und ihrer Bedingungen und Voraussetzungen. Damit ist nicht bloß diese oder jene Funktion betroffen, für die bisher der Staat eingestanden ist, sondern die gesamte nationale Produktion. Die hat schließlich bisher auf der Staatsorganisation beruht; eine Trennung und ein Zusammenhang von privaten Geschäften und einem staatlichen Förderer und Beaufsichtiger existieren nicht. Wo der Staat sich privatisierend betätigt, da eröffnet er kein Angebot an eine nationale Geschäftswelt, sondern setzt nur seine bisherigen Garantien außer Kraft, zieht sich also im wörtlichen Sinne zurück.
Das zeigt, daß der positive Aufbruch in die Marktwirtschaft, der mit dem Privatisierungsprogramm versprochen wird, in Wirklichkeit einen anderen Ausgangspunkt hat als die begründete Erwartung, der staatlich gestiftete Eigentumswechsel würde wie von selbst lohnende Betriebsaktivitäten und ein neues Wirtschaftswachstum nach sich ziehen. Die Schenkungsaktion zeugt von einer Notlage des Staates. Die bisherigen Maßnahmen in Richtung Marktwirtschaft, die Konvertierbarkeit des Rubels und die Freigabe der Preise haben ganz andere Wirkungen als die erhofften gezeitigt: Der Staat muß laufend untaugliche Zirkulationsmittel vermehren, und der Rubel verfällt; die Preise steigen und machen das Kaufen immer schwieriger, zumal auf der anderen Seite die Produktion immer weiter sinkt. Außer beim Staat existiert nicht einmal das praktische Bedürfnis, aus Staatsbetrieben privates Kapital und damit auch nationale Reichtumsquellen zu machen. Im Land gibt es keine Kapitalisten, und die auswärtigen zeigen kein Interesse. Die russischen Wirtschaftsreformer hatten ursprünglich wie die anderen Reformpolitiker des ehemaligen Ostblocks darauf gesetzt, daß das westliche Kapital die neu eröffneten Gelegenheiten im Osten, die ihm zu Sonderkonditionen angeboten wurden, ergreifen würde. Jetzt sind sie um die Erfahrung reicher, daß sich außer der Ausbeutung von Rohstoffen und Energiequellen für westliche Geschäftsleute das Produzieren im Osten nicht lohnt und der riesige potentielle Markt, den sie darüber erschließen könnten, eine reine Chimäre ist. Der russische Staat erfährt daher – entgegen seiner eigenen Behauptung – seine Ökonomie nicht als erhaltenswerte Quelle seines Reichtums, sondern erst einmal vorrangig als eine Belastung, von der er sich dadurch freimachen will, daß er sie zum eigenverantwortlichen Wirtschaften verpflichtet.
So macht er seine Betriebe aber nicht nur für sich, sondern auch für jedermann sonst unbrauchbar. Für alle bisherigen Produktionszwecke sowieso, für alle neuen aber auch. Allerdings erfüllt er mit seinen Eigentumsprogrammen die Auflagen des IWF, dem die Reformmaßnahmen immer nicht weit genug gehen. Auch das eher ein Ausdruck der Not, die versammelten auswärtigen Gläubiger politisch zufriedenzustellen, als einer ökonomischen Berechnung. Weil das westliche Privatisierungsverlangen möglichst schnell erfüllt werden soll, Käufer für die Betriebe aber nicht zu finden sind, ist die russische Regierung darauf verfallen, das Volk vorläufig zum ideellen Anwärter auf Privateigentum zu erklären. Damit verleiht sie dem Privatisierungsprogramm ganz nebenbei auch noch den Schein, das Volk würde mit seiner Beteiligung für die Härten entschädigt, die ihm zunehmend aufgebürdet werden.
5. Damit stehen die Reformer allerdings vor dem Widerspruch, daß die Selbstentlastung des Staates von seinen alten bürokratischen Lasten, die produktiv wirken soll, gar keinen Ersatz für sein früheres Einteilungs- und Verteilungswesen schafft, und schon gar keinen einträglicheren. Der Produktionsrückgang wird damit nicht aufgehalten, die staatlichen Geldzettel werden bloß durch einen neuen staatlich gestifteten Schuldentitel vermehrt, die „Schattenwirtschaft“ nicht erledigt, sondern angeheizt und ihr Zugriff erweitert. Daher kann der Staat seine Betriebe dann doch nicht einfach der „Marktwirtschaft“, d.h. sich selber überlassen, sondern muß sich mit neuen schlechten Rubeln und seiner Hoheit darum kümmern, daß die nationale Ökonomie nicht vollständig ruiniert wird. Dieser Zwiespalt kann auch den radikalen Marktwirtschaftsfanatikern im Kreml nicht verborgen bleiben. Deswegen haben sie die Privatisierung wie ein Experiment gestartet, bei dem sie selber noch nicht genau wissen, was dabei herauskommt und wie es weitergehen soll. Die wirkliche Privatisierung ist noch gar nicht in Gang gekommen, und schon sehen sich die Reformer in ihren Erwartungen weitgehend enttäuscht. Abstand nehmen sie deshalb nicht davon. Der ideologische Glaube an die Leistungen der Marktwirtschaft paart sich nur mit einer gewissen Ratlosigkeit angesichts der schon eingetretenen und zu befürchtenden Folgen ihrer Reformen. Eins aber wissen sie ganz genau: Das liegt nicht am Staatsprogramm, sondern höchstens an Fehlern und Versäumnissen bei seiner Durchführung. Und am immer noch wirksamen Staatsbürokratismus und an den reaktionären Bremsern und Hintertreibern ihrer Reformen.
[1] Zum allgemeinen Charakter der Wirtschaftsreformen in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion, zu ihren Absichten, Leistungen und Wirkungen vgl. GegenStandpunkt 2-92, S.119: Weder Markt noch Wirtschaft!