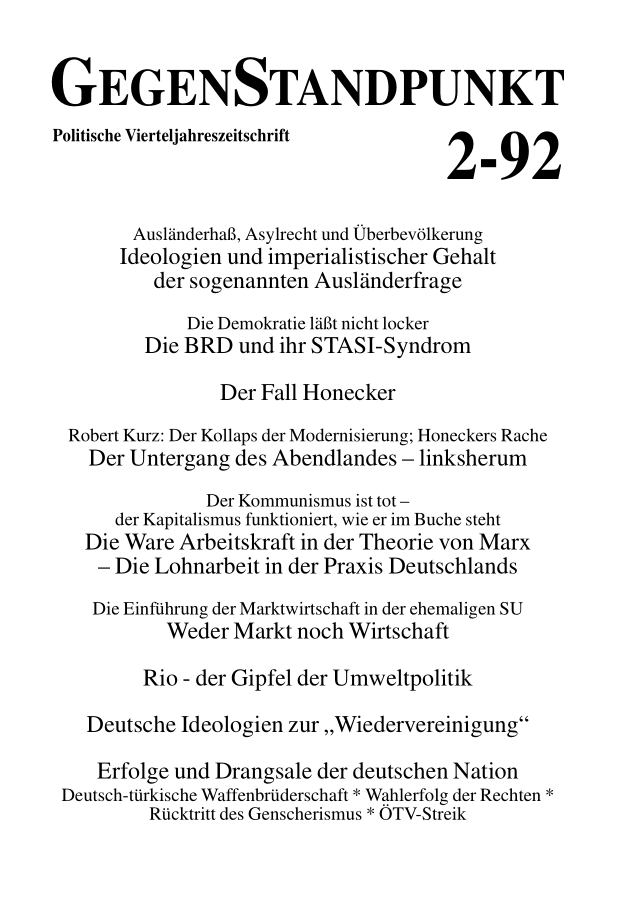Die Einführung der Marktwirtschaft in der ehemaligen Sowjetunion – weder Markt noch Wirtschaft
Der Beschluss der sowjetischen Machthaber, ihre Wirtschaftsweise auf Kapitalismus umzustellen, um über mehr international tauglichen Staatsreichtum zu verfügen. Die ‚Methoden‘: Preisfreigabe und Privatisierung und ihre Konsequenzen für Betriebe, Arbeiter, Volk und den Rubel. Die staatliche Wahrnehmung der Lage als Inflationsproblem und ihre zerstörerische Auswirkung auf den Staatshaushalt. Die Antwort: ‚Sparhaushalt‘. Steuern als staatlicher Wucher. Die Konkurrenz der ehemaligen Sowjetrepubliken um den ehemals sowjetischen Nationalreichtum dezimieren ihn. Die imperialistischen Ansprüche an die Umstellung.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Siehe auch
Systematischer Katalog
Gliederung
- I. Die sogenannte Freigabe der Preise
- II. Privatisierung
- III. Die Zusammenfassung der unmöglichen politischen Vorhaben in einem fiktiven Staatshaushalt
- IV. Die Aufteilung der Sowjetökonomie unter den Erben
- Die Zerlegung des sowjetischen Wirtschaftsraums unter dem Anspruch auf „Außenhandel“
- Alle wollen den Rubel abschaffen, können ihn aber nicht loswerden
- Ein Zwischenspiel und sein Resultat: Für ein eigenes Geld braucht man mehr als Druckmaschinen, Papier und Farbe
- Kalkulationen mit einem wertlosen Rubel
- Der Ausweg: Außenhandel mit imperialistischen Partnern
- Schuldenbedienung als ökonomisches Erbe und Startbedingung der neuen Souveränitäten
- Der IWF als Freund und Helfer – Überführung unter die Aufsicht der Weltmarktsmächte
- V. Passiver Imperialismus statt „Kapitalismus in einem Lande“
Die Einführung der Marktwirtschaft in der ehemaligen Sowjetunion – weder Markt noch Wirtschaft
Die Nachfolgestaaten der Sowjetunion haben, wie schon die anderen Staaten des ehemaligen RGW, unter dem Titel Reform ein einmaliges Projekt angezettelt: Es geht um die Einführung des Kapitalismus als Grundlage ihrer Nation. So etwas hat es noch niemals gegeben, daß Staaten mit einer kompletten, anders funktionierenden Produktionsweise aus freien Stücken beschließen, diese abzuschaffen und eine andere einzuführen. Anders als in früheren Fällen, in denen Nationen mehr oder weniger gewaltsam in den Weltmarkt einbezogen und damit den kapitalistischen Geschäftsprinzipien unterworfen worden sind, war das einheimische Produzieren ja nicht auswärtigem Geld und Handel ausgesetzt, so daß es davon untergraben und revolutioniert worden wäre. Zu schaffen hatte die Sowjetunion damit nur in der Weise, daß sie sich in beschränktem Maße auf Verträge über Güteraustausch mit dem Westen eingelassen hat. Diese vom Staat im Rahmen seines Außenhandelsmonopols unterhaltenen Handelsbeziehungen haben zwar manche Betriebe und Ressourcen der sowjetischen Staatswirtschaft auf die Beschaffung von Devisen ausgerichtet und damit der inneren Verwendung entzogen. Dennoch wurde dadurch die interne Funktionsweise von Produktion und Verteilung nicht in Frage gestellt und die realsozialistische Wirtschaft hat immer noch soviel Reichtum und verfügbare Ressourcen geschaffen, daß die Sowjetunion bis zuletzt als solider Handelspartner und Schuldner gegolten hat. Im Unterschied zur allgemein verbreiteten Mär, daß der Sozialismus durch und durch marode gewesen sei, hat die realsozialistische Produktionsweise nämlich funktioniert. Die Belege, auf die sich die antikommunistische Propagandalüge stützt, das Vorkommen von armen Leuten und verrostenden Eisenbahnen usw., gelten ja auch bei den USA nicht als Beweise für die mangelnde Überlebensfähigkeit des kapitalistischen Systems. Der Sozialismus hat für den westlichen Geschmack sogar viel zu gut funktioniert: Dank der Erträge dieser Ökonomie hatte die Sowjetunion sich immerhin mit modernsten Machtmitteln ausgestattet und damit zur Weltmacht und zum Hauptfeind der westlichen Welt entwickelt. Außerdem hat sie die Gesellschaft zusätzlich mit allem Lebensnotwendigen versorgt, so daß auch in dieser Sphäre die Staatsgewalt nicht zur Aufgabe zu erpressen war. Weder ist der Sozialismus wegen seiner eigenen Unfähigkeit „zusammengebrochen“, wie es die heutige Legendenbildung herausgefunden haben will – er hat ja 70 Jahre lang gehalten und dabei etliche massive Bedrohungen überlebt. Noch hat sich die Sowjetunion, wie frühere Staaten, der Gewalt anderer Nationen, die die Gesetze des Kapitals durchsetzen, beugen müssen. Die Abschaffung ihrer Produktionsweise verdankt sich dem Beschluß der regierenden Partei, sich auf eine andere, kapitalistische Grundlage zu stellen.[1]
Dieser Beschluß kommt als Respektsbezeugung vor den kapitalistisch erfolgreichen Nationen daher; er resultiert aus der Bewunderung des staatlichen Reichtums, über den die führenden Staaten des Westens gebieten, und will deren ökonomische Staatsraison einführen. Das ist der Leitfaden der sowjetischen ‚Reformen‘. Die Voraussetzungen, die die bekehrten sowjetischen Politiker dafür vorfinden, ist die übernommene Sowjetökonomie. Die soll den Vorstellungen von einem gelungenen Kapitalismus gemäß gemacht werden. Alles worüber man gebietet, sachlicher Reichtum, Produktionsstätten, Arbeitskräfte, Geld und Recht, soll verwandelt, einer völlig neuen Geschäftsrechnung unterworfen und doch zugleich benützt werden, wie wenn es unabhängig von der jeweiligen ökonomischen Zwecksetzung auch für die neue, gegensätzliche Produktionsweise das taugliche Material wäre. Die Reformer begreifen sich als Vorsteher einer beachtlichen Nationalökonomie, die sie nur auf Marktwirtschaft „umzustellen“ hätten, und täuschen sich damit gleich doppelt.
Erstens über den bewunderten Reichtum ihrer vormaligen westlichen Feinde. Ihre Vorstellung von dem, was her muß, faßt sich in einer Merkmalssammlung eines funktionierenden Kapitalismus zusammen. Diese Merkmale – Angebot und Nachfrage, Privateigentum, Geld, Banken und Börsen, Werbung und Manager –, ökonomische Praktiken, die tatsächlich zum Kapitalismus gehören, fassen sie aber nicht als Bestandteile des kapitalistischen Systems auf. Sie verstehen sie nicht als die passenden Umgangsweisen und Kalkulationen einer Geschäftswelt mit den schon vorhandenen Mitteln und Ergebnissen kapitalistischen Wirtschaftens – mit einer Produktion, die den Grundsätzen der Rentabilität gehorcht und den auf dem Weltmarkt durchgesetzten Konkurrenzmaßstäben entsprechend eingerichtet ist, also sich auch auf dem Weltmarkt bewährt und entsprechende Erträge abwirft; mit einem Geld, das sich im internationalen Maßstab als Geschäftsmittel beweist und entsprechenden Wert hat; mit einer Eigentumsordnung, die dafür sorgt, daß sich der produzierte Reichtum in Privathand mehrt und als Quelle für wachsenden Staatsreichtum taugt. Sie meinen vielmehr, in diesen Vorgehensweisen die passenden Methoden entdeckt zu haben, die die entsprechenden Mittel schaffen und damit den gewünschten geschäftlichen Erfolg und entsprechend wachsende staatliche Einkünfte sichern würden. Sie fassen die Grundsätze, nach denen im Westen jedes Stück Reichtum in Geld gemessen und für die Vermehrung von Geld eingespannt wird, wie eine praktische Anleitung für Regierungsbeschlüsse auf, mit denen sich kapitalistischer Reichtum quasi naturwüchsig und von selbst einstellen müßte.
Zweitens täuschen sie sich über ihre eigene bisherige sozialistische Wirtschaft und deren Resultate. Ihre Staatswirtschaft messen sie nämlich an diesen Vorstellungen ‚vernünftigen‘ kapitalistischen Produzierens, das mit den richtigen staatlichen Vorgaben herbeizuregieren wäre. Gemäß diesem Vergleich werfen sie dem Staat, dem Subjekt der realsozialistischen Ökonomie, vor, diesen Vorstellungen nicht entsprochen, also lauter Versäumnisse und Fehler begangen zu haben. Was getan worden ist, wird allein unter dem einfältigen Gesichtspunkt betrachtet, was man bisher im Umgang mit der Produktion und der Verteilung mißachtet, welche Notwendigkeiten man verletzt hat, so daß die imponierenden Resultate des Kapitalismus nie zustandegekommen sind. Das Material, an dem sich ihre Reformbemühungen zu schaffen machen, das unübersehbar die Spuren dieser alternativen Produktionsweise an sich trägt, betrachten sie umgekehrt als brauchbare Grundlage für ein anderes System, der nur mit den richtigen politischen Beschlüssen zur Entfaltung verholfen werden müßte. Die ökonomische Beschaffenheit dieser Produktions- und Konsumtionsmittel, der dem Kapitalismus fremde Charakter ihres bisherigen Staatsreichtums, interessiert bei diesem Standpunkt überhaupt nicht. Vor lauter Selbstkritik wird vergessen, daß die ganze jetzt verteufelte Staatswirtschaft programmatisch darauf ausgerichtet war, eine Produktion und Verteilung auf die Füße zu stellen, die der Kapitalismus nie und nimmer projektiert hätte. Der Staatssozialismus hat doch gerade nicht dieselbe Kosten-Nutzen-Rechnung angestellt, sonst wäre nämlich die vorhandene Lebensgrundlage für die vielen Völker in der Union erst gar nicht zustandegekommen. Gerade aufgrund der Ablehnung kapitalistischer Kriterien ist schließlich in der Sowjetunion ein ökonomischer Aufbau in die Welt gesetzt worden, der z.B. grundsätzlich die Selbstversorgung ermöglicht hat und eine Arbeitsorganisation, die nicht auf pures Aushalten und Verschleiß der Arbeitskraft im Dienste einer Kosten-Ertrags-Rechnung ausgerichtet war und sich deswegen vor der Produktivität der Marktwirtschaft blamiert hat. Spottbilliges Herumfliegen in der ganzen Union und andere nach kapitalistischen Maßstäben unmögliche Sitten wie ganze Soziallandschaften um die Fabriken herum waren dort üblich. Vom Staatsprogramm einer gleichmäßigen Entwicklung der Produktivkräfte ist soviel wahrgemacht worden, daß überall im Lande Industrie herumsteht, im hintersten Sibirien ganze Industriestädte aufgebaut worden sind usw., usw.. Das alles, was kapitalistisch gerechnet völlig unsinnig, unökonomisch wäre, macht nun einmal die nationale Ökonomie aus.
Weil die Reformer rücksichtslos die Methoden des Wirtschaftens vergleichen und sich für die vom Standpunkt staatlicher Bereicherung überlegenen kapitalistischen entscheiden, den andersartigen Zweck des Wirtschaftens, dem sich die materiellen Mittel verdanken und für den allein sie tauglich sind, aber gar nicht zur Kenntnis nehmen wollen, kommt erst gar nicht die Idee auf, daß diese für den gestrigen Staat brauchbaren Strukturen des materiellen Lebens vor kapitalistischen Maßstäben versagen. Dementsprechend sehen die Resultate der ‚Reformen‘ aus, nämlich völlig anders, als sich das die Kapitalismusfans vorgestellt haben. Mit ihrer Wirtschaftspolitik, die sich von diesem falschen Vergleich leiten läßt und Ernst macht mit der Behauptung, Kapitalismus sei bloß ein anderer, effektiverer Umgang mit vorhandenen Produktivkräften, regieren die Reformer erst einmal nur den Bankrott der Produktivkräfte herbei. Der Einstieg in die kapitalistische Nationalökonomie gemäß der Überzeugung, das Verfahren gehöre geändert, während der Zweck im Grunde derselbe sei, nimmt die Ideologien des alten Systemvergleichs für bare Münze und wendet sie auf die Erbmasse der Sowjetunion, den vorhandenen Reichtum, an. Die Ideologien blamieren sich dabei auf der ganzen Linie, was die Reformer nicht wahrhaben wollen. Und das aus dem alten System übernommene ökonomische Erbe bleibt auf der Strecke; was die Reformer bedauernd zur Kenntnis nehmen, aber nicht ihrer Anwendung der Ideologien, sondern – je länger, umso mehr – dem alten System zuschreiben, obwohl das gar nicht mehr regiert.
Was sie sich vorgenommen haben, ist schließlich nur dem Namen nach eine Reform, der Sache nach eine Revolution und zwar eine von oben. Es geht – objektiv, auch wenn die Veranstalter das nicht so sehen – um die Umwälzung sämtlicher Zwecke, Mittel und Formen des Produzierens. Dahinter steht – im Unterschied dazu, wie sich die kapitalistischen Gesetzmäßigkeiten in den Geburtsländern durchgesetzt haben – kein einziges Interesse in ihrer Gesellschaft, keine Klasse, die mit ihrem Geldreichtum die Staatsgewalt auf sich und auf dessen ökonomische Forderungen verpflichten würde, sondern auch nur das staatliche Bedürfnis, über einen schlagkräftigen, international gültigen Reichtum zu verfügen. Es mögen zwar auch sonst alle „für die Marktwirtschaft“ sein, aber darunter stellen sie sich ungefähr soviel vor, daß man da alles kaufen kann. Die von oben erwünschten ökonomischen Praktiken fallen an keiner Stelle mit vorhandenen Interessen und Mitteln zusammen, so daß das Programm, je länger es dauert, den staatlichen Urheber immer mehr darauf verweist, daß nicht das Unterlassen dirigistischer Sünden, sondern der Einsatz von Gewalt gefragt ist – gegen die unhandliche ökonomische Basis. Die Zuständigen nehmen das Verhältnis umgedreht, nämlich mit der ärgerlichen Feststellung wahr, daß ihr menschliches und materielles Inventar auch in gar keiner Hinsicht zu der Reform „paßt“, dabei nicht mitmacht, vielmehr immer alles nur „hintertreibt“. Sie bekennen sich auch immer mehr zu „notwendigen harten Maßnahmen“, die sie nur deswegen immer wieder korrigieren, weil die beabsichtigten Effekte sich nicht einstellen. Auch ein Beweis, daß die Marktwirtschaft nicht gerade aus der Menschennatur entspringt.
I. Die sogenannte Freigabe der Preise
Das Rezept
Die neue Regierungsmannschaft in Moskau, angetreten mit der Prätention, im Unterschied zum zögerlichen Gorbatschow mit den Reformen Ernst zu machen, hat zum Jahresbeginn die „erste Etappe“ angesagt, nämlich die „Freigabe der Preise“. Soviel will man nämlich begriffen haben, daß die staatssozialistische Festlegung eines Preissystems „echte“ Preise und deren nützliche Wirkungen verhindert haben soll. Ein „freier“, d.h. dem Verkäufer als sein Instrument überlassener Preis, die Erlaubnis, am Verkauf nach Kräften zu verdienen, soll dagegen das Produzieren lohnend machen und darüber allseits vorwärtsbringen. Zu diesem Glauben bekennen sich die Zuständigen – und sind nach ein paar Wochen „freier Preise“ enttäuscht, weil er sich nicht bewahrheitet:
„Jelzin räumte ein, daß sich die Freigabe von Preisen nicht als Anreiz zur Produktionssteigerung auswirke“ (Süddeutsche Zeitung, 17.1.), Burbulis, daß es „nicht einmal einen Hinweis für eine Steigerung der Produktivität gebe“ (SZ 4.2.).
Der entscheidende Unterschied zwischen Planwirtschaft und Kapitalismus ist eben auch nicht der, ob Preise staatlich „festgelegt“ oder „gelassen“ werden, ob sie „diktiert“ werden oder „zustandekommen“, sondern daß sie im Kapitalismus das Resultat von Kostpreis und Profit darstellen, das Resultat einer unter dem maßgeblichen Zweck der Geldvermehrung eingerichteten Produktion, in der jedes Element auf diese Rechnung zugeschnitten ist. Die Erwartung, daß eine den Verkäufern überlassene Preisgestaltung allein schon Gewinne und damit eine ertragreiche Produktion erlaubt, unterstellt Preisen eine Leistung, die sie gar nicht erbringen können, nämlich ein lohnendes Verhältnis von Kosten und Überschuß herzustellen. Die Bezahlung der Preise realisiert aber nur dieses Verhältnis, indem sie Waren durch Verkauf in Geld verwandelt – und das auch nur, wenn diese Waren so kalkuliert und produziert worden sind, also Resultat einer an dieser Rechnung ausgerichteten und ihr genügenden Produktion sind; der kapitalistische Gewinn entsteht nicht aus Preisaufschlägen, aus Prellerei.
Seine Folgen
Wenn die Kapitalismus-gläubigen Wirtschaftspolitiker ihre neue Einsicht anwenden, daß der Staat sich zur Marktwirtschaft bekehrt, indem er „sich heraushält“ statt „kommandiert“, und die Preise freigeben, bewirkt diese Maßnahme folglich etwas völlig anderes, als sie sich erwarten: Die Erlaubnis wird allseitig ergriffen, es wird für das Abtreten der Produkte überall mehr Geld verlangt, und das ist auch schon alles. Was damit in Gang gesetzt wird, ist ein schlichter Umverteilungsprozeß von den Käufern zugunsten der Verkäufer, mit dem das vorhandene Geld konfisziert wird; damit steht es auch für weitere Käufe nicht mehr zur Verfügung. Die Käufer werden unfähig gemacht, all das zu erwerben, was zu den alten Preisen noch ging; folglich werden die Verkäufer einiges zu den neuen Preisen los, vieles aber auch nicht mehr. Die wirkliche Leistung der freien Preise besteht nur in der durch diese Umverteilung von Geld bewirkten Trennung von Produktion und Verbrauch. Der Haupterfolg der ersten Reformetappe liegt denn auch darin, daß die Bevölkerung sich empört, wie sie überhaupt noch zu ihren Lebensmitteln kommen soll, und die Betriebe klagen, daß sie auf ihren Produkten sitzenbleiben. Und die Reformer wundern sich, daß nichts anderes herauskommt und ihr „Markt“, auf dem doch bisher schon verkauft und gekauft worden ist, durch seine „Liberalisierung“ nicht gewinnt, sondern zugrundegeht.
Das Material des Experiments
In ihrem neuen Glauben, daß die sozialistische Preisfestlegung nur zur Behinderung eines Geschäftswesens getaugt hat, haben sie den positiven Zweck dieser Einrichtung vergessen, die mehr als ein staatlicher Gewaltakt, nämlich ein auf bestimmte sachliche Resultate berechnetes Diktat gewesen ist. Die Sowjetökonomie war eben keine schlecht funktionierende, weil unterdrückte Marktwirtschaft, sondern ein völlig anderes Produktionssystem. Vorgeschriebene Preisverhältnisse waren nichts anderes als die in Geldform eingekleidete staatliche Verfügung, daß diese und jene Produktion, dieser und jener Neuaufbau von Produktionszweigen für die Entwicklung der gesamten Ökonomie und die Versorgung der Bevölkerung mit einem bestimmten Warenkatalog auf jeden Fall stattzufinden hatten. In Gestalt der „verkehrten, administrierten Preise“ wurden Produktions- und Konsumtionsmittel zugeteilt, was sich in den Augen der zur kapitalistischen Rechenweise bekehrten Reformer wie ein einziger Verstoß gegen „natürliche Preise“ ausnimmt und zu den gängigen Beschwerden über die alten sozialistischen Unsitten wie „Subventionen“ oder „planmäßig unrentable Betriebe“ führt. So stellt sich für sie die frühere staatliche Preisplanung dar, die dafür sorgen sollte, daß Produkte dem betrieblichen oder privaten Verbrauch zugeführt werden. Dieser Auftrag wurde durch Niedrigpreise dekretiert, und wenn diese Niedrigpreise dem Herstellerbetrieb die Erfüllung der Finanzvorschriften nicht erlaubten, wurden Finanztitel hin- und hergeschoben, damit auch die rechnerische Seite ordentlich aussah. Der industrielle Aufbau, den die GUS-Staaten ererbt haben, ist auf diesem Weg zustandegekommen. Wenn aber auf eine derart eingerichtete Güterzirkulation das Rezept der freien Preise angewendet wird, führt das nur zur Unterbindung von bisherigen Belieferungen. Der Standpunkt, daß an Energie und Rohstoffen endlich gescheit verdient gehört, macht die weiterverarbeitenden Industrien unfähig dazu, im selben Maß wie früher zu produzieren; Lebensmittel, als Gelegenheit zum Geldverdienen behandelt, sind von der Bevölkerung nicht mehr bezahlbar usw.
Zweitens aber ignorieren die Reformer wild entschlossen noch einiges mehr, nämlich die Tatsache, daß ihr Vorgänger Gorbatschow, bzw. dessen Perestrojka schon viel von ihrem Programm der freien Preise wahrgemacht hat. Die staatlichen Stellen bilanzieren bei ihrer Aufzählung der alten sozialistischen Sünden nämlich nicht zuletzt die allseitigen Schäden in der nationalen Ökonomie, die die schon seit etlichen Jahren eingeführten Anleihen beim Vorbild Kapitalismus angerichtet haben: Aufgrund der Erlaubnis, Produkte als quasi-private Geschäftsmittel zu behandeln, sind diese an zahllosen Stellen den alten Verwendungszwecken entzogen worden, was zu Produktionsbeschränkungen bei den traditionellen Abnehmern geführt hat. Die haben sich mittlerweile zu einem allgemeinen Rückgang der Produktion in allen Zweigen akkumuliert. Ersatzteilmangel, Stromausfälle, nicht vorhandene Vorräte zur Versorgung der Bevölkerung werden Monat für Monat registriert, und daneben wird unbeeindruckt die Hoffnung geäußert, daß echt und endgültig freie Preise die Produktion wieder aufleben lassen. Angesichts von Zuständen, die jeden kapitalistischen Staat zu Notstandsmaßnahmen und Zwangsbewirtschaftung veranlassen würden, um die sachlichen Voraussetzungen seiner Staatsherrlichkeit zu retten, ja gerade wegen dieser Zustände behaupten Jelzins Reformer, daß der einzig mögliche Ausweg ihr Rezept der freien Preise sei und deshalb nur umso schneller und flächendeckender ergriffen werden müsse.
Die Bevölkerung soll sich mit der Vorstellung, es könnte noch viel schlimmer kommen, über die katastrophale Lage hinwegtrösten, die sie mit ihrer Reform anrichten, und sich für diese Reformen stark machen:
„Auf die Frage, was er den Russen wünsche, sagt Gajdar: ‚Ein nüchternes Verständnis dafür, wie schrecklich die Alternativen zur Preisfreigabe sind.‘“ (Frankfurter Rundschau, 3.1.) Jelzin auf seiner Volksstimmungsprüfungsreise verteidigt die Freigabe der Preise als „unsere letzte Chance, die Wirtschaft zu sanieren“. (SZ 10.1.)
Als ob sich Diagnose und Rezept nicht in gewisser Weise ausschließen würden: Schließlich ist es völlig unerfindlich, wie die Gelegenheit, seinen Kunden einen hohen Preis zu berechnen, einem Betrieb, dem periodisch der Strom abgestellt wird, der keine Ersatzteile oder neuen Maschinen auftreiben kann, überhaupt in irgendeiner Weise dazu verhelfen könnte, besser zu produzieren. Das Ergebnis der Abschaffung des alten Preissystems ist nur, daß die von der Perestrojka begonnene Zerrüttung der produktiven Beziehungen noch erheblich beschleunigt wird: Seit Anfang des Jahres fällt die Produktion pro Monat in 10prozentigen Raten.
Überlebensstrategien der Betriebe
Die Reform verpflichtet alle Mitglieder und Bestandteile der übernommenen sowjetischen Gesellschaft aufs Geld, ohne daß sich damit der Erhalt eines Betriebes oder der privaten Existenz bestreiten ließe. Die versuchen deswegen mit allen Mitteln, die ihnen zu Gebote stehen, sich diesem ruinösen Zwang zu entziehen. Anstatt daran die Untauglichkeit ihres Vorhabens zu bemerken, bekämpfen die Reformer diese Überlebensstrategien oder sehen sich zu Korrekturen genötigt, die sie zugleich als „Rückfall“ in alte Unsitten bedauern, die aber etwas ganz anderes sind.
Die Betriebe nehmen die staatliche Aufforderung wahr, für einen Zahlungsverkehr zu sorgen, auch wenn er gar nicht geht. Sie stellen sich z.B. Rechnungen aus und verzichten auf Zahlung, die der Abnehmer nicht erbringen kann. Auf diese Weise können sie die Produktion ein Stück weit fortsetzen, aber der staatlich geforderte Ertrag, in Geld bemessene Überschüsse, stellt sich nicht ein; und an all den Stellen, wo ein Betrieb doch Geld benötigt, ist er aktionsunfähig. Dieselbe Technik, etwas verfeinert, wird mit Hilfe der staatlichen Erlaubnis eines privaten Geldverleihwesens angewandt: Neue Banken sind des öfteren Gemeinschaftsgründungen von sozialistischen Betrieben, die darüber sich finanzieren, also über das Ausstellen von Wechseln Geld fingieren. Auf die Weise wird der Auftrag zum Geldverdienen formell bedient und materiell zugleich unterlaufen.
Soweit die Betriebe andererseits darauf aus sind, mit ihren Anlagen auch etwas zu produzieren und sich dadurch zu behaupten – schließlich setzt ja auch der neue staatliche Auftrag, Überschüsse zu erwirtschaften, die Herstellung von irgendwelchen nützlichen Gütern voraus –, versuchen sie die Versorgungskrise auf eigene Faust zu bewältigen: Sie setzen ihre Erzeugnisse als Tauschmittel ein, um sich Produkte zu verschaffen, die sie entweder zur Fortsetzung ihrer Produktion oder zum Unterhalt ihrer Arbeiter brauchen. Auch dieser sogenannte Barter, der mittlerweile auch schon zu höheren Formen des Ringtauschs übergegangen ist, in dem Ziegel und Videorecorder beliebte Tauschmittel darstellen, schädigt einerseits die überkommene Arbeitsteilung; andererseits wird ein bißchen weiteres Produzieren ermöglicht. Oder die Betriebe unternehmen den Versuch, sich selber Ersatz zu schaffen, ein Versuch, so etwas wie eine industrielle Subsistenzwirtschaft zu betreiben, im Prinzip ein Unding, zu gewissen Teilen aber durchaus machbar. Auf Techniken, sich gegen unzuverlässige Lieferungen abzusichern, waren realsozialistische Betriebsführer schon immer angewiesen; das Resultat, eine, wie es hier heißt, „enorm hohe Fertigungstiefe“ ist im betrieblichen Aufbau vorhanden. Das und der ebenso ziemlich unkapitalistische Einsatz der Arbeiter zu Flick- und Bastelarbeiten wie zum Ausschlachten alter Maschinerie erlaubt noch eine gewisse Zeit, wie Produktionsinseln zu funktionieren. Unter den heutigen Bedingungen bemühen sich Betriebsleiter sogar darum, diese Technik noch weiter fortzutreiben und sich als Betrieb mit Zulieferern, z.B. auch Kolchosen, zusammenzuschließen oder eigene Zulieferabteilungen neu aufzumachen. Auch so geht das Produzieren weiter, aber Geld verdient, ein Überschuß akkumuliert, wird damit gerade nicht.
Unter dieser Maßgabe kommen Betriebsleiter schließlich auch darauf, daß sich, wenn das Produzieren ohnehin kaum noch zu organisieren ist, auch ganz anders Geld machen läßt: Statt ihre Betriebe produktiv zu nutzen, behandeln sie sie als eine Ansammlung verkäuflicher Güter. Vorräte, Produktionsmittel, Grundstücke, „Dienstleistungen“ lassen sich verramschen, Ingenieure und Produktionstechniken ans Ausland „ausleihen“, bis die Substanz für diese Sorte Geschäft aufgebraucht ist. Auf der anderen Seite findet ein Ausverkauf der eigenen Produkte statt, wenn dafür nur Devisen gezahlt werden, rücksichtslos dagegen, ob der Betrieb damit seine Kosten bestreiten oder seine Produktion instandhalten kann. Mit kapitalistischer Preiskalkulation hat das allerdings nichts zu tun; deren Zweck besteht nicht darin, daß überhaupt Geld an Land gezogen wird, sondern daß lohnend verkauft, also ein Überschuß realisiert, Eigentum vermehrt und auf immer größerer Stufenleiter produziert wird.
All solche Verfahrensweisen sind Techniken des Entzugs, also alles andere als der langsame Übergang zum Kapitalismus. Diese Methoden, mit denen sich die Betriebe auf die neuen Anforderungen einstellen, demonstrieren die Unmöglichkeit, den staatlichen Auftrag zu erfüllen: Wenn sich der Betrieb vom wirklichen Geldverdienen abhängig macht, erweist sich, daß er dazu gar nicht fähig ist, er wird zahlungsunfähig; wenn er das bloße Eigentum erhält, indem er Betriebselemente wirklich zu Geld macht, hört er absehbarerweise auf, als Produktionsstätte zu fungieren; wenn er seine Rentabilität erschwindelt, ist er nicht rentabel; wenn er sein sachliches Funktionieren erhält, ist er es auch nicht. Gerade diese Techniken, an denen sich ein letztes Mal sehen läßt, daß man durchaus ohne Geld, ohne Gewinn usw. produzieren kann, erlauben es ironischerweise den Reformern, ihren Glauben zu bewahren, daß sie trotz aller Schwierigkeiten über eine brauchbare Grundlage für einen Reichtum zu verfügen, der sich nur noch am Geld und seiner Vermehrung messen soll.
Die Überlebensfrage für die Bevölkerung
Die ehemaligen Sowjetbürger sind dem Preisexperiment mehr oder weniger ohnmächtig ausgeliefert; sie können sich glücklich schätzen, wenn sie einem Betrieb angehören. Rentner, Studenten und Arbeitslose, alle, die nur von ihrem staatlichen Einkommen leben müssen, fallen schlagartig unter das staatliche ermittelte Existenzminimum. Mit der Freigabe der Preise ist nämlich das Grundelement des realsozialistischen Sozialstaats aufgekündigt worden: die Versorgung der Werktätigen mit Konsumgütern, die der staatliche Handel zu Niedrigpreisen zur Verfügung gestellt hat. Seitdem der Staat sich nicht mehr für Preise zuständig erklären will, die vom Lohn garantiert zu bezahlen sind, und nur noch bedingt dafür, daß im Staatshandel alles Lebensnotwendige auftaucht, ist die Aufgabe an den Betrieben hängen geblieben, sich mit der Tatsache zu befassen, daß auch Arbeiter irgendwie Nahrungsmittel brauchen. Schon seit längerem ist die Zuteilung von Naturalien und Konsumgütern in sowjetischen Betrieben ein Bestandteil des Lohns, denn immerhin braucht der Betrieb, solange er noch produziert, Arbeiter, die arbeiten können. Mehr als eine notdürftige und höchst zufällige Versorgung springt dabei allerdings auch nicht heraus – eine Planwirtschaft läßt sich schlecht von unten organisieren. Was ein Betrieb seinen Arbeitern zukommen lassen kann, hängt davon ab, was sich gerade auftreiben läßt, mit welchen Gegenlieferungen er einen Kolchos zu einem Bündnis bewegen oder in Schiebergeschäfte einsteigen kann. Lohnerhöhungen werden, nachdem in fast allen Abteilungen und Branchen gestreikt worden ist, auch reihum zugestanden. Sowjetische Betriebsführer haben andere Sorgen als die, Löhne zu drücken, und sind unter den neuen Bedingungen mehr denn je darauf angewiesen, daß die noch benützte Belegschaft sich für alles mögliche einspannen läßt. Allenfalls haben sie Schwierigkeiten, die nötigen Scheine aufzutreiben, daher kursieren auch diverse betriebliche Zettel und Einkaufsgutscheine.
Mehr als Streiks – für mehr Rubel, die nur bedingt kaufkräftig sind, für Zahlung in Naturalien oder Devisen, die die Betriebe versprechen, aber nicht garantieren können –, gelegentliche Plünderungen und Vergehen gegen die eingerichtete Ordnung, also ohnmächtige Versuche, sich zu wehren oder auf verbotene Weise durchzukommen, sind den sowjetischen Werktätigen nicht eingefallen. Ihre schlechte Gewohnheit, nach Verantwortlichen zu schreien, bringt sie angesichts ihres wachsenden Elends nur verstärkt auf den Gedanken, daß es gar keine Verantwortlichen, keinen richtigen Staat mehr gibt und einer her müßte, der mit starker Hand für Ordnung sorgt.
Mit Rubellöhnen alleine läßt sich der Lebensunterhalt jedenfalls nicht mehr bestreiten, bestenfalls den Preissteigerungen hinterherjagen. Das, was in den Staatsläden noch angeboten wird, überholt vielfach die Preise auf den „freien Märkten“. Vieles gibt es gegen Rubel gar nicht, und überhaupt besteht die Reproduktion eines sowjetischen Werktätigen vor allem darin, sich ständig damit zu befassen, wo es gerade was gibt und was sich sonstwoher organisieren läßt. Wenn nunmehr Rentner auf der Straße versuchen, ihren mickrigen Privatbesitz zu Geld zu machen, um an Brot zu kommen, besitzen die Moskauer Größen durchaus die Nerven, das als Übergang zur Marktwirtschaft zu würdigen:
„Gajdar: Ebenso schwer ist zu beurteilen, wie weit das Lebensniveau tatsächlich gesunken ist. Früher standen die Menschen stundenlang Schlange, um überhaupt etwas für ihr Geld kaufen zu können. Nun erleben wir eine allmähliche Umorientierung der Aktivitäten: von den Käuferschlangen…
Spiegel: …zu den langen Reihen derjenigen, die überall auf den Straßen etwas – und oft das letzte – verkaufen möchten…
Gajdar: …zu Gelegenheiten, auf irgendeine Weise, Geld zu verdienen. Das ist doch eine gesunde Entwicklung.“ (9.3.)
Allerdings fällt auch den hartgesottensten Marktwirtschaftsfans spätestens an der Berufung auf den Volksunmut, mit dem die politische Konkurrenz operiert, noch auf, daß das in dem Sinne auch keine „Entwicklung“ ist, daß sich das flotte Marktgeschehen mit massenhaften Käufen und Verkäufen nicht einstellen will und statt dessen die Kaufkraft, also das Lebensniveau der Bevölkerung rapide schwindet. So viele geheimnisvolle Quellen, Nahrungsmittel aufzutreiben, stehen sowjetischen Werktätigen nun einmal nicht zu Gebote, als daß sie nicht doch auch davon leben müßten, was sie sich kaufen können. Darüber, was sie sich jetzt alles nicht mehr kaufen können, wird zuverlässig Bilanz geführt:
„Das Mindesteinkommen soll um ‚etwa 200 Rubel angehoben‘ werden… Nach Einschätzung der Regierung könnten mit monatlich 550 Rubel die ‚biologischen‘ Grundbedürfnisse befriedigt werden. Erst mit 1500 Rubel könnten weitergehende Bedürfnisse gedeckt werden.“ (FR 6.2.) „Die russische Regierung teilte mit, 90 % der Bürger hätten weniger als 700 Rubel im Monat zur Verfügung. Die Nahrungsmittelversorgung im gleichen Zeitraum kostet durchschnittlich 1300 Rubel.“ (FR 21.2.)
Das Abwarten auf die fiktive Wirkung sinkender Preise und üppiger Produktion läßt sich nicht beliebig verlängern. Weil nur die negative Wirkung eintritt, daß die Bevölkerung sich nicht mehr das Lebensnotwendige beschaffen kann, werden die Reformer darauf gestoßen, daß die Reproduktion der Arbeiterklasse nach wie vor nicht aus ihrer geschäftlichen Benützung resultiert, sondern von staatlichen Beschlüssen abhängt, zumindest was die Ausstattung mit Rubeln betrifft. Daher lassen sie sich dann auf die Notwendigkeit ein, sich soweit für die Ernährung ihres Volks zuständig zu erklären, daß es staatlicherseits mit mehr Rubeln ausgestattet werden muß. Mindestrenten und Mindestlöhne werden erhöht, für betriebliche Lohnzahlungen, die die Betriebe nicht erwirtschaften, springen die Regierung oder die lokale Stadtverwaltung ein, die nichtausgezahlten Löhne belaufen sich nach dem Bericht des russischen Staatskomitees für Statistik allein im Januar auf 19 Milliarden Rubel (Iswestija, 20.2.).
Dieses Hinundher zwischen entschiedenem Reformwillen und notwendigen „sozialen Korrekturen“, um das von der Regierung bis zum russischen Volksdeputiertenkongreß öffentlich und ziemlich fruchtlos gestritten wird, wird vom Westen prompt als „Rückfall“ beklagt – immerhin ein unfreiwilliges Eingeständnis, daß das Geheimnis erfolgreichen kapitalistischen Wirtschaftens doch nicht in der marktwirtschaftlichen Versorgung des Volks mit Gütern, sondern in seinem Ausschluß vom produzierten Reichtum liegt und die korrekte sozialstaatliche Sorge um den Erhalt des Volks sich ganz nach den Grundsätzen seiner geschäftlichen Brauchbarkeit richtet. Der Sache nach handelt es sich aber gar nicht um einen Rückfall in den Sozialismus. Vielmehr bemerkt der Staat, daß die Verwandlung seiner Volksmassen in ein benutzbares und benutztes Proletariat nicht durch die Aufforderung zur Bedienung auf dem Markt stattfindet. Der „Markt“ macht aus dem Volk keine Arbeiterklasse, die zum Geldverdienen in Beschlag genommen und eingesetzt wird. Das allseitige Mißverhältnis von Angebot und Nachfrage, von Preisansprüchen und Zahlungsfähigkeit zeigt nur, daß von geregeltem Produzieren und Verdienen nicht die Rede sein kann, daß also weder eine aus Lohneinkommen gespeiste Kaufkraft noch ein auf diese Kaufkraft berechnetes Warenangebot zustandekommt; das entsprechende ‚Marktgeschehen‘ sorgt höchstens für eine entsprechend brutale, weil geschäftlich und politisch nutzlose Massenarmut. Weil aber doch auch auf das Volk als Bestandteil einer künftigen funktionierenden Nationalökonomie spekuliert wird, muß der „Rückfall“ in den alten „Versorgungsstaat“ sein, auch wenn die Maßnahmen alles andere als den Charakter von Versorgung haben. Die Regierenden bemerken, daß nach wie vor keine Instanz in ihrer Gesellschaft, kein geschäftliches Interesse ein irgendwie geregeltes Einkommen einer Arbeiterklasse ermöglicht. Nachdem sie auf ein ökonomisch und politisch nutzbares Volk nicht gleich programmatisch verzichten wollen, müssen sie sich daher ganz entgegen ihrer Absicht doch wieder für zuständig erklären und das fehlende kapitalistische Interesse an der Benutzung und Bezahlung von Lohnarbeitern kompensieren. Entsprechend sehen die staatlichen Maßnahmen aus: Sie haben bestenfalls den Charakter von finanziellen Überlebenshilfen.
Das in Kraft gesetzte Geld: Wucher statt Kapitalvermehrung
Die durch die freien Preise bewirkte Umverteilung von Geld sorgt dafür, daß die ererbten Versorgungsbeziehungen weiter zerstört werden. Sie produziert also das Gegenteil des erwarteten Produktionsaufschwungs, auf der einen Seite Armut, auf der anderen unbrauchbares Geld. Der Rubel ist zwar das vorgeschriebene Kaufmittel, erfüllt aber über die Preisfreigabe diese Funktion immer weniger: Die maßlos steigenden Preise entwerten ihn laufend; vom Lohn oder betrieblichem Einkommen können die Preise immer weniger bezahlt werden, und immer weniger wirklicher Reichtum geht überhaupt in den Handel gegen Rubel ein. Entsprechend unbrauchbar ist das nationale Geld. Unbrauchbar für die, die noch Reste davon haben: Die berühmten Ersparnisse der sowjetischen Bevölkerung sind schnell aufgebraucht. Unbrauchbar für die, die Geld erwerben: Die Preise, die sie in Rechnung stellen können, garantieren ihnen weder, daß sie ihre Produkte zu diesen Preisen losschlagen, noch daß sie ihrerseits notwendige Produktionsmittel dafür kaufen können. Unbrauchbar schließlich auch für den Staat, der an seiner Ökonomie verdienen will, aber von seinen Betrieben keine Einkünfte erhält und auch mit seiner neuen, aufs Schröpfen der Konsumenten berechneten Mehrwertsteuer nicht froh wird, weil die Käufer darüber erst recht zahlungsunfähig gemacht werden. Unter der neu befohlenen allseitigen Geldrechnung wird überall Minus verzeichnet. So setzt sich allenthalben die Einsicht durch, daß brauchbares Geld nur im Ausland zu haben ist.
Es gibt allerdings Stellen, an denen sich das Geld vermehrt – im sogenannten „Handel“, d.h. im Wucher, wie er sich auf der Grundlage einer Mangelwirtschaft entwickelt: Wo keine auf einen vorhandenen Markt berechnete Produktion stattfindet, weil umgekehrt keine gesicherte Kaufkraft vorhanden ist, um die Warenpreise zu bezahlen, da richten sich die Preise auch nicht nach der Kalkulation der Produzenten mit Kostpreis und Profit, sondern nach dem Mißverhältnis des Warenangebots zu der Nachfrage, die auf die entsprechenden Güter angewiesen ist. Die Besitzer der immer zu wenig verfügbaren käuflichen Güter lassen sich also das Fehlen der benötigten Lebens- und anderen Mittel teuer vergüten, so daß dieser „Handel“ nicht die Gewinne einer für den Markt stattfindenden Produktion realisiert, sondern jedermann, einfache Konsumenten wie Betriebe, mit ihrem Bedarf erpreßt. Wo es allmählich zur wichtigsten Betätigung von Betrieben gerät, Ware zu suchen bzw. ihrerseits mit allem möglichen Zwischenhandel zu betreiben, läuft das große Geschäft an „Warenbörsen“: Dort werden ‚Defizitwaren‘, das sind ungefähr alle, für astronomische Summen umgeschlagen – zu Preisen, die nicht nur das Monopol ihrer Besitzer versilbern, sondern darüberhinaus auch noch die sinkende Kaufkraft des Rubels kompensieren sollen. Dessen Verfall sorgt zusätzlich für eine Verknappung des Warenangebots. Die Gewinne werden nämlich schleunigst wieder in Gebrauchswerte angelegt, die im Gegensatz zum Rubel an Wert gewinnen und als Anweisung auf „echtes Geld“, im Idealfall Devisen, gehortet werden. Insofern steht auch diese Rubelakkumulation nur für den Befund, daß es sich um unbrauchbares Geld handelt, das nicht zur produktiven Anlage taugt.
Sowohl realsozialistisches Geld wie kapitalistisches Geld vermitteln einen Zusammenhang: Im staatlich vorgegebenen Preissystem wurden Produktion und Bedarf einander zugeordnet, die Preisrelationen haben – wenn auch nicht immer zur vollsten Zufriedenheit – produktiven und individuellen Verbrauch garantiert. Kapitalistische Preise, kapitalistisches Geld vermitteln den Zusammenhang erfolgreicher Geschäfte, die Reproduktion des Kapitals über die kleine und große Zirkulation. Die Einführung des Kapitalismus über die Freigabe der Preise, die staatliche Aufforderung, Produkte als Mittel zum Geldverdienen einzusetzen, setzt aber nur die negative Funktion des Geldes in Kraft: Es trennt das Verbraucherbedürfnis vom Produkt, den Produktionsbedarf von der Zulieferung. Der staatliche Auftrag, den Rubel geschäftsmäßig zu benützen, gerät zu einer hinderlichen Bedingung des Produzierens, zerstört den produktiven Zusammenhang. Nicht darin, daß das Geld als Schranke zwischen Produktion und Verbrauch fungiert, besteht die Besonderheit dieses Geldes; sondern darin, daß es nur als Schranke fungiert, als Mittel einer unproduktiven Trennung zwischen sachlichem Reichtum und seinen bisherigen Verwendungsweisen.
Die reform-ideologische Bewältigung der Lage
Die Wirkungen ihrer „Preisfreigabe“ lassen die Verantwortlichen bemerkenswert kalt, sieht man einmal von der Konkurrenz um die Macht ab, die reihum mit der Vorhersage von Hungeraufständen bestritten wird. Streng nach dem Dogma der Reformer betrachtet, sind all diese Folgen nur ein neuerlicher Beweis, daß ihre Maßnahmen wegen der Widerstände des alten Produktionssystems und seiner bürokratischen Obstruktion noch nicht gegriffen haben, also ein Argument dafür, daß es eben seine Zeit braucht, bis die erhofften Wirkungen eintreten. Die Wahrheit, daß es bei einem ordentlichen Markt um den Unterschied von Raus- oder Reinhalten des Staats gar nicht geht, fällt ihnen nicht ein. Schon gar nicht wollen sie zur Kenntnis nehmen, daß Preise im Kapitalismus massenhaft Staatswerk sind und auch die geschäftlich kalkulierten Preise durch staatliche Vorgaben und Förderungen, Subventionen eingeschlossen, modifiziert und mitbestimmt werden. Statt dessen glauben sie felsenfest daran, daß Preise sich frei nach Angebot und Nachfrage bilden, und erklären von daher ihr vergangenes System zu einem einzigen unvernünftigen und eigentlich unmöglichen System von Subventionen, in dem letztlich der Staat so gut wie alles gezahlt, also maßlos über seine Verhältnisse gelebt haben soll. Daß „dennoch“ produziert worden ist und zwar nicht vom Staat, übersehen sie dabei geflissentlich.
Angesichts der allen ihren Ideologien widersprechenden Folgen ihrer Reform stellen sie sich deswegen nur die kindische Frage, warum denn bei schwindender Nachfrage dennoch die Preise nicht sinken, wie sie es ihrem Volk vorhergesagt hatten. Jelzin:
„Es wird allen für ungefähr ein halbes Jahr schlechter gehen, dann wird es eine Senkung der Preise und die Füllung des Konsummarktes mit Waren geben.“ (Prawda, 29.10.91)
„Die Regierung rechnet für Januar und Februar mit einer Hyperinflation, spätestens im April aber mit einer leichten Stabilisierung bei etwa 7 % pro Monat, weil dann – so wird erwartet – die Nachfrage nicht mehr mit dem Angebot mithalten kann.“ (FR 2.1.)
Der April ist vorbei, die Wirkung will einfach nicht eintreten und kann es auch gar nicht. Wenn die Nachfrage nicht mehr mit dem Angebot mithalten kann – diesen Erfolg können sich die Reformer durchaus zugutehalten –, heißt das nämlich keineswegs, daß Preise sinken müssen; diese Milchmädchenrechnung mit Angebot und Nachfrage stimmt auch im Kapitalismus nicht. Kapitalisten senken nämlich angesichts sinkender Nachfrage nicht einfach die Preise, sondern sorgen dafür, daß sie auch mit niedrigeren Preisen Überschüsse erwirtschaften. Um eine gesunkene zahlungsfähige Nachfrage geschäftlich zu benutzen, verbilligen sie ihre Produktion, sparen mit verbesserter Maschinerie oder betrieblichen Umorganisationen an Kosten, ein effektiverer Umgang mit der Belegschaft ist dabei allemal eingeschlossen. Solche „Rationalisierungen“ erfordern manchen technischen und finanziellen Aufwand. Das dafür erforderliche „Know how“ muß vorhanden sein, vor allem muß ein Betrieb das erforderliche Geld schon verdient haben. Beide Bedingungen fehlen den ehemals sozialistischen Betrieben. Sie sind folglich gar nicht in der Lage, ihre Preise nach kapitalistischer Manier zu senken. Umgekehrt: Je weniger sie verdienen, umso mehr müssen sie versuchen, sich mit hohen Preisen schadlos zu halten.
II. Privatisierung
„Kampf den Monopolen“
Mit dem unerschütterlichen Glauben an den Mechanismus von Angebot und Nachfrage läßt sich allerdings auf die verkehrte Frage, warum trotz aller Anstrengungen die Preise nicht sinken, eine Antwort finden. Man entdeckt, daß es richtig freie Preise eigentlich noch gar nicht gibt:
„…so funktioniert das nicht. Weil von freien Preisen ja keine Rede sein kann. Früher legten ein paar Beamte in der Regierung die Preise fest, jetzt legen ein paar Bürokraten in den Monopolbetrieben die Preise fest.“ (Jawlinski, Wirtschaftswoche, 31.1.)
„Dem noch bestehenden staatlichen Handel warf Jelzin ‚offene Sabotage‘ vor, der man sich hart widersetzen müsse.. kündigte Korrekturen für die bisherigen Reformen an. So sollen etwa Produktionsmonopole gebrochen, Konkurrenz und ‚echte Preise‘ erreicht und Handel sowie Dienstleistungen noch in diesem Jahr privatisiert werden.“ (FR 17.1.)
Die passende staatliche Antwort heißt Privatisierung: Diese 2. Etappe des Reformprojekts soll unter anderem die Aufgabe bewältigen, den angeblichen Widerstand der als „aggressive Monopole“ verteufelten sozialistischen Betriebe zu brechen.
Die Einführung eines weiteren Stücks funktionierender Kapitalismus ist das zwar nicht, aber eine originelle Lösung der Schuldfrage: Den Kombinaten, früher eingerichtet als nationale Versorgungsinstanzen, wird heute die Schuld zugewiesen, daß sie für die neuen politischen Ansprüche an die Produktion nicht tauglich sind. Ausgerechnet die Kapitalismus-Einführer, die Privateigentum und Privatmacht zum Allheilmittel erklären, werfen ihren Betrieben vor, daß in deren Händen zuviel Privatmacht liegt. Dabei zielt die Anklage „Monopolismus“ gar nicht darauf, daß die zur Mehrung privaten Reichtums ermunterten Betriebe diese Freiheit für sich ausnützen, sondern daß sie damit nicht den erhofften geschäftlichen Aufschwung und den erwarteten Zuwachs an staatlichem Reichtum zustandebringen. Weil die erwartete Funktion des freien Umgangs mit dem Privateigentum an den Produktionsmitteln ausbleibt – sinkende Preise und steigende Produktion –, stellen die Reformer das Recht zum freien Umgang mit diesem Eigentum, das sie gerade gewährt haben, wieder in Frage. Vorschläge zur Bestrafung werden erörtert; z.B. wird überlegt, „Monopolgewinne“ erstens zu verbieten und zweitens zu besteuern. Dieser Vorschlag verbindet die geniale Idee, den angeblichen Mechanismus von Angebot und Nachfrage, dessen Wirken das geschäftliche Treiben des Privateigentums vermissen läßt, durch Staatseingriffe zu imitieren, schöpferisch mit der Entdeckung einer – vermeintlichen – zusätzlichen Einnahmequelle für den Staat. Dagegen meldet sich dann freilich wieder der Standpunkt, daß solche Maßnahmen doch genau wieder die unzulässigen Staatseingriffe seien, denen man abgeschworen haben will.
In Wirklichkeit erzielen die Betriebe gar keine Monopolgewinne, sondern sind weder zu Gewinnen noch zu nützlichen Beiträgen zur Steigerung des nationalen Reichtums fähig. Und das spricht sich bei der Regierung auch wieder herum:
„Seit 3 Wochen beschweren sich hier immer wieder Direktoren, ihre Erzeugnisse würden einfach nicht gekauft. Gestern waren die Papiererzeuger hier… Auch Hüttenwerke fordern zusätzliche Kredite. Kühlschränke und Fernseher nimmt ebenfalls niemand mehr ab. Wegen der Geldknappheit liefern die Betriebe nur noch, wenn sofort bezahlt wird. Erdöl findet zu freien Preisen überhaupt keinen Absatz…“ (Gajdar, Spiegel, 9.3.)
Im Endeffekt doktern die Reformer daher an beiden Seiten herum, am Recht auf Privateigentum und an der Funktion, die es ausüben soll. Es werden Methoden erwogen, die Betriebe unter Druck und einschränkende staatliche Vorschriften zu setzen, und dann werden sie doch wieder staatlicherseits mit Krediten unterstützt, damit sie nicht zumachen müssen. Auch ein Eingeständnis, daß Kapital so nicht geschaffen wird.
Wegen der vermeintlichen Aufgabe der Entmonopolisierung der Wirtschaft hat sich die russische Regierung den langjährigen Chef des Bundeskartellamts, Kartte, als Berater ins Land geholt. Der hat qua Amt einen gigantischen Konzentrationsprozeß des westdeutschen Kapitals überwacht und fast immer gutgeheißen, weil Kapitalgröße eine elementare Voraussetzung für die Konkurrenz ist, zumal dann, wenn sich EG-Kapital für den Weltmarkt herrichtet. Was dieser Mann zu dem aparten russischen Problem wohl zu beraten hat?
„Kampf gegen die ländliche Warenblockade“
Die Anwendung der Sichtweise, daß die monopolistischen Wirtschaftsstrukturen Widerstand gegen die Intentionen der Reform erlauben, auf die Landwirtschaft hat ihre besonderen Schönheiten:
„Jelzin sprach von einer Warenblockade des Landes gegen die Städte, die wirksam nur beseitigt werden könne, wenn die Bauern Land erhielten.“ (FR 17.1.) „In der Landwirtschaft sollten innerhalb der nächsten 2 bis 3 Monate unrentable Betriebe aufgelöst werden. Das Land sollten Privatbauern erhalten.“ (SZ 17.1.)
Während in der EG das Bauernlegen vorangeht, damit weltmarkt-konkurrenzfähige Betriebsgrößen zustandekommen, will man in Rußland den Parzellenbauern als Inbegriff landwirtschaftlicher Effektivität entdeckt haben. Das Gerücht, daß nur der Besitz einer eigenen Scholle ein wirklicher Stimulus zu guter Arbeit sein soll, ist ein weiteres Erbe des realen Sozialismus; und zwar einmal seiner penetranten Verwechslung von Ökonomie mit Methoden, Arbeitsmoral zu erzeugen. Zum anderen hat die legendäre Produktivität des privaten Stückchens Land ihren banalen Grund darin, daß sie als Nische neben den Kolchosen von deren Mitteln gezehrt hat; als Grundlage der Agrarwirtschaft wäre ein solches Privatbauerntum ein Witz. Die eigene Scholle, die den Bauer zu Höchstleistungen in Sachen Selbstausbeutung bewegt, ist auch im Kapitalismus nicht das Geheimnis einer produktiven Landwirtschaft: Nur eine Eigentumsgröße, auf der sich die Arbeit anderer gewinnbringend einsetzen läßt, macht aus Ackerbau und Viehzucht einen Geschäftszweig. Wegen ihrer falschen Kritik an den Kolchosen versäumen die Reformer hier wiederum eine Grundwahrheit der Marktwirtschaft, die sie einrichten möchten: Die Scheidung von Arbeit und Eigentum ist deren Grundlage und nicht die Parole „Grund und Boden an alle, die sie bebauen“!
So kämpferisch sich diese Reden gegen die angebliche „Warenblockade“ durch das Land auch geben, sie sind andererseits gar nicht einfach wahrzumachen. Die Sachlage ist nämlich auch nicht unbekannt, daß die Kolchosen sich gar nicht verweigern, sondern daß ihnen öfters schlicht die Mittel fehlen:
„Rußlands Bauern fehlen vor der Frühjahrsaussaat die landwirtschaftlichen Geräte… Der Chef der Agrargeräteabteilung des Landwirtschaftsministeriums:.. möglicherweise könnten 200 000 Traktoren wegen des Zusammenbruchs des staatlichen Verteilungssystems nicht geliefert werden. Nur 20 % der Lieferverträge seien abgeschlossen. 33 Betriebe, darunter die Altai-Werke weigerten sich, Verträge zu unterzeichnen… erklärten ihre Weigerung mit dem Mangel an Metallen, die für die Produktion von Ersatzteilen gebraucht würden… Die Bauern benötigten 430 000 neue Traktoren, hätten aber nur veraltete Maschinen. Wenn man den Treibstoffmangel hinzurechne, werde das Frühjahr vollständig unberechenbar…“ (SZ 12.2.)
Wegen fehlender Futtermittel ist in diesem Winter schon so viel Vieh geschlachtet worden, daß die kommenden Versorgungslücken mit Fleisch und Milchprodukten jetzt schon feststehen, die Regierung rechnet zur Zeit mit einem Rückgang um 22 %.
Wo die Ökonomie nicht einmal für die Kolchosen genügend Betriebsmittel hergibt, ist es nicht übermäßig erstaunlich, daß das Angebot an die Kolchosmitglieder, sich als Privatbauern zu etablieren, keine besondere Resonanz findet. Wo doch, nämlich in den Staaten, in denen die Bauernschaft mehr auf ihre alten Traditionen als auf solche praktischen Fragen hält und dieser Direktive mit Freude nachgekommen ist, steht umgekehrt das erste freiheitliche Bauernlegen an:
„Und was passiert mit den vielen Kleinbauern, die nach der Zerstückelung der Kolchosen mit ihren wenigen Hektar Land kaum überleben können? Von den 70 000 Landwirten werden wohl 20 000 pleite machen, schätzt Benkins, Vizeagrarminister Lettlands.“ (FR 26.2.)
Wenn Jelzin zu seiner Ankündigung stehen will, alle nach den neuen Maßstäben unrentablen Kolchosen aufzulösen, wird er sich mit der Frage befassen müssen, wie überhaupt noch Lebensmittel auf russischem Boden produziert werden sollen. Seine westlichen Freunde jedenfalls weisen ihn jetzt schon darauf hin, daß die Veranstaltung von diesem Winter, eine rudimentäre Volksernährung über Importe und westliche Nahrungsmittelkredite zu bestreiten, auf Dauer nicht drin ist. Ihr Kredit ist nicht „unbegrenzt“, d.h. für Wichtigeres da als die Förderung der Lebensmittelversorgung einer hungernden Bevölkerung. Da fällt den Kreditgebern ein, daß Rußland ein „Faß ohne Boden“ ist. Ein schönes Kompliment aus berufenem Munde für die Marktwirtschaftler in spe!
Die Verwandlung von Volkseigentum in Privateigentum
Der Kampf gegen den vermeintlichen preisverfälschenden Monopolismus ist aber nur eine Front. Beschlossen ist schließlich auch die umfassende Verwandlung der Staatsindustrie in Privateigentum. Ein Unterfangen, bei dem die Reformer schon wieder uneins sind. Gestritten wird unter Berufung auf das Vorbild der ehemaligen RGW-Staaten um die Alternative, die Privatisierung entweder möglichst schnell durchzuziehen – dann wird das tschechoslowakische Modell der Verteilung bzw. billigen Veräußerung von Volksaktien favorisiert – oder die Betriebe an potente Eigentümer zu veräußern, die ihre Potenz als Geldbesitzer erweisen, die Betriebe kaufen können und darüber auch dem Staat Einnahmen verschaffen.
In der russischen Regierung haben sich die Anhänger der zweiten Methode durchgesetzt. Die Vorstellung, eine Freisetzung der sozialistischen Betriebe, parallel zur Freisetzung der Preise, genüge schon, um sie in ihren eigentlichen Beruf, flottes Geldverdienen zu entlassen, hat nämlich schon einigermaßen gelitten, vor allem wegen der enttäuschenden Erfahrungen mit dem, was unter der Perestrojka in dieser Hinsicht schon alles gelaufen ist: Was an Geschäftemacherei in Gang gekommen ist, hat dem Staat nichts gebracht und dem wirtschaftlichen Fortschritt eher geschadet. Das führen die Reformer wiederum nicht auf die fehlenden Geschäftsmittel und Gewinnaussichten, sondern auf den mangelnden geschäftlichen Willen und das fehlende Interesse der Betriebe an einem entsprechenden Einsatz des Privateigentums zurück. Deshalb fällt ihnen bei der Privatisierung ein, daß es nicht damit getan ist, daß sich überkommene Instanzen bloß so aufführen, wie wenn es um ihren Vorteil, die Mehrung ihres Eigentums ginge – es müssen „echte“ Eigentümer her, die „wirklich“ Interesse am Geschäft haben und kein Risiko scheuen, was zum Beruf eines echten Kapitalisten wirklich nicht dazu gehört. Das heutige Ideal der Privatisierung lautet von daher: Die Eigentümer sollen mustergültige Geschäftsleute sein, die die Gewinn-Aussichten, die mit dem Betrieb verbunden sind, erkennen und nutzen wollen, die entsprechend produzieren, Leute entlohnen, Steuer zahlen und Gebrauchswerte zur Verfügung stellen. Die bringen dann auch das zustande, was die Betriebe von sich aus gar nicht leisten. Der Staat will seine Betriebe also veräußern, damit und so daß aus ihnen Geldquellen gemacht werden.
Leider sehen die, an die er sie veräußern will, die Sachlage genauso. Erstens sind Geldbesitzer, die einen Betrieb ersteigern könnten, nur sehr beschränkt vorhanden. Zweitens scheitert der staatliche Wunsch daran, daß die potentiellen Käufer nur zu gut wissen, daß mit dem Betrieb keine Gewinnaussichten verbunden sind – gesicherte Lieferanten mit kostengünstigen Angeboten, zahlungskräftige Abnehmer, ein funktionierender Markt, ein brauchbares Geld, kurz alles, was profitable Geschäfte in Gang setzt und beflügelt, fehlt. Eigentumstitel unter die Leute zu bringen, das werden die Reformer schon schaffen, aber rechtlich als Eigentum definierte Betriebe erwerben darüber keineswegs die ökonomische Funktion des Eigentums quasi automatisch mit, zur Geldvermehrung zu taugen. Eigentum wird zwar erworben, aber nicht, weil man damit geschäftlich kalkuliert – die Brauchbarkeit für solche Rechnungen ist mehr als fraglich –, sondern weil man darauf spekuliert, daß es sich vielleicht irgendwie einmal auszahlen könnte, wenn sich die Zeiten doch ändern sollten.
Die neuen Rubelmillionäre erwerben wegen der Fragwürdigkeit ihrer Rubel auch Anteilsscheine von Betrieben, in der Spekulation, bei möglichen künftigen Geschäften dann auf jeden Fall dabei zu sein. Bei ihnen verdankt sich der Eigentumserwerb also der Untauglichkeit des Geldes für lohnende Anlage. Auf der anderen Seite betreiben die Betriebe ihre „Privatisierung“ auf eigene Faust: Kapitalkräftige Investoren sind in den seltensten Fällen in Aussicht; so erklärt man sich sicherheitshalber schon einmal selbst zu Aktiengesellschaften, tauscht untereinander Besitztitel aus. Betriebe schließen sich mit Zulieferern und Abnehmern und lokalen Staatsorganen zusammen, in einer Art Defensive, um sich zu retten, auch um sich gegen die Drohung, Monopolbetriebe in Teile aufzuspalten, zu versichern, und mit der völlig haltlosen Spekulation darauf, wenn es einmal kapitalistisch zugeht, mithalten zu können. Weil aber dieser Formwechsel an den betrieblichen Erträgen gar nichts ändert, nur das bisherige Durchwursteln mit dem Titel AG versieht, fallen diese Versuche unter den staatlichen Verdacht auf Betrug, zumal kein Gewinn für ihn durch Veräußerung an Verkäufer herausspringt. Diese Schaffung von Privateigentum wird regierungsoffiziell als „Widerstand“ gegen die Reformen und „Scheinprivatisierung“ angegriffen:
„Vielerorts übernehmen nur die Arbeitskollektive das Kommando… Ähnlich zweifelhaft ist eine andere Methode, mit der viele Staatsbetriebe durch das ‚Minenfeld der Privatisierung‘ kommen wollen: Sie wandeln sich in ‚geschlossene Aktiengesellschaften‘ um, an denen andere Staatsbetriebe beteiligt werden… Der Generaldirektor des Textilkombinats Raduga ist beispielweise dabei, die Aktien seines Betriebs an ‚unsere Lieferanten, die Transporteure und die örtlichen Machtorgane zu verkaufen‘… Den Widerstand vor Ort hofft Tschubais jetzt durch den Aufbau einer neuen Mammutbehörde zu brechen, die mit 92 000 Mitarbeitern in allen Winkeln des russischen Reichs ans Werk gehen soll.“ (Wirtschaftswoche 28.2.)
Die Resultate der Privatisierung sind absehbar: Der Staat wird mangels zahlungsfähiger und -williger Käufer seine Betriebe nicht los bzw. es bleibt beim rein formellen Eigentumstitel. Der Staat wird daher auch seine Zuständigkeit für die Zahlungsfähigkeit der Betriebe, die sie selber gar nicht garantieren können, nicht los: Die mögen sich als Aktiengesellschaften bezeichnen – sobald sie den Regeln eines Geldverkehrs genügen sollen, Arbeiter entlohnen, Rechnungen bezahlen, Steuern entrichten und Kredite bedienen, sind sie dazu nicht in der Lage und stellen den Staat vor die Alternative, entweder die Fiktivität seines Geldwesens einzugestehen oder einzuspringen. Wenn die Einführung von Privateigentum nicht als großangelegte Enteignung, als Streichen aller überkommenen Rechts- und Geldtitel stattfindet, stellt sie sofort den Staat vor das Erfordernis, sich zu verschulden; der – in einer besonderen Bedeutung – ideelle Gesamtkapitalist muß immerzu Kosten übernehmen, damit den wie Privateigentum behandelten Produktionsstätten Bedingungen für ihr Überleben gesichert werden…
Kapitalistisches Privateigentum besteht in nichts geringerem als dem Monopol der Privatmacht des Geldes über die gesellschaftliche Arbeit – wenn es das nicht ist, dann ist Eigentum bloß der Rechtstitel der Betriebe, sich dem staatlichen Zugriff zu entziehen. Dann bedeutet die Einführung von Privateigentum auch wiederum nur, daß die negative Seite wahrgemacht wird: Der Staat setzt per Rechtstitel den Ausschluß von der Benützung der vorhandenen Produktionsmittel in Kraft und zwar vor allem gegenüber sich selbst, dem ehemaligen Volkseigentümer. Das Monopol über Produktionsmittel steht nicht für den Zugriff auf die eigentumslose Klasse, sondern nur für den Entzug von jeder Benützung.
III. Die Zusammenfassung der unmöglichen politischen Vorhaben in einem fiktiven Staatshaushalt
„Inflation“
Mit ihrer Preisfreigabe haben die russischen Regierenden etwas zustandegebracht, was auch noch nie da war. Sie haben ihr ganzes Menschenmaterial zu Sozialfällen zurechtreformiert, die vor den Preisen kapitulieren müssen. Das sehen sie aber – ganz gelehrige Schüler kapitalistischer Ideologien – anders, nämlich als Problem des Staates mit dem Wert seines Geldes: Sie beklagen eine wachsende „Inflation“.
Kapitalistisches Geld verliert an Wert, weil Staat und Geschäftswelt unabhängig vom Gang der Produktion den Kredit vermehren und die wachsende Zahlungsfähigkeit mit höheren Preisen ausgenutzt wird; Geldbesitzer entdecken, daß die Leistungsfähigkeit ihrer Geldzettel schwindet; Geldkapitalisten und Nationen vergleichen ihr Geld mit dem anderer, so daß sich der Kaufkraftverlust des Geldes auch im internationalen Wert der Währung niederschlägt: In all diesen Hinsichten ist die Bezeichnung „Inflation“ für den Rubel irreführend. Die russischen Marktwirtschaftsaspiranten haben mit etwas ganz anderem zu tun. Die Untauglichkeit ihres Geldes ist keine relative, sondern absolut: Einen Außenwert besitzt ihr Geld überhaupt nicht, es wird vom internationalen Geschäft gleich gar nicht benützt und gehandelt, und im Inneren beweisen die Versuche der Geldbesitzer, über Wucher und über das Horten von Gebrauchswerten an echtes Geld heran und damit vom Rubel loszukommen, daß dem nationalen Geld die Qualität des Geldes abgeht.
Mit der Redeweise von der steigenden Inflation ist zweierlei geleistet: Anstatt die Leistung der Preisfreigabe zu würdigen, die die überkommenen Austauschverhältnisse und damit die verbliebenen Existenzbedingungen der Betriebe wie der Bevölkerung liquidiert, wird der Rubel zum vorrangigen Pflegefall erklärt. Zweitens wird die Tatsache, daß der Rubel sich überhaupt nicht als brauchbares Geld in seinen verschiedenen Funktionen bewährt, zielstrebig damit verwechselt, daß es sich um ein brauchbares Geld handelt, das bloß laufend relativ geschwächt wird. Die Frage, warum er dann so ein schlechtes Geld ist, wird in schöpferischer Aneignung marktwirtschaftlicher Dummheiten mit seiner Quantität, seinem allzu reichlichen Vorhandensein im Verhältnis zur Warenmenge beantwortet, als läge der Witz des Geldes darin, den Kauf der gerade vorhandenen Waren zu vermitteln:
„Die harte Finanzpolitik ist die Grundvoraussetzung für die Stabilisierung des Rubel. Wir müssen die Geldversorgung mit der Güterversorgung wieder ins Gleichgewicht bringen“. Netschajew (Handelsblatt 21.2.)
Und als läge ein Fall von Geldüberangebot vor, das die Geldnachfrage senkt:
„Wir tun unser Bestes, eine Geldknappheit herbeizuführen, in der Absicht, die Nachfrage nach der Währung zu erhöhen“, Gajdar.
Die Redeweise mag es ja geben, wenn kapitalistische Staaten Währungspflege betreiben, daß es darum ginge, „Geld knappzuhalten“. Allerdings ist bei den einschlägigen Techniken immer auch festzustellen, daß die Nationalbank weder das Geldscheindrucken einstellt noch die absolute Höhe von Krediten reglementiert, sondern nur Kredite verteuert – weil es nicht um die Geldmenge, sondern um die Modalitäten ihrer geschäftlichen Benützung geht. Kapitalistische Staaten richten ihre nationale Verschuldungspolitik nie an den vorhandenen Kauf- und Verkaufsakten aus, die über die nationalen Kreditzettel und Münzen vermittelt werden, noch an den Bedürfnissen der Geldbesitzer nach einem stabilen Geldwert; tatsächlich wird in der „Marktwirtschaft“ immerzu mit unterschiedlichen Raten der Geldentwertung gerechnet. Jelzins glorreiche Reformmannschaft hat sich das Programm der Geldverknappung aber auch nicht nach einem Studium westlicher Haushaltspraktiken zueigen gemacht, sondern als passende falsche Erklärung für ihr eigentümliches Problem, den Rubel zum vorschriftsmäßigen und halbwegs zuverlässigen Kaufmittel zu machen. Das nennen sie „Re-Monetarisierung“:
„Gajdar: ..der Effekt ist wirklich der einer inneren Stärkung des Rubel. Seit Januar hat ein Prozeß der Re-Monetarisierung begonnen. Nach der langen Phase des Tauschhandels – Autos gegen Kohle, Kohle gegen Kühlschränke, Kühlschränke gegen Wer-weiß-was – beginnt das Geld wieder, seine natürliche Rolle in der Wirtschaft zu spielen.“ (Spiegel)
In Wirklichkeit beweist der „Tauschhandel“ genauso wie die „Inflation“, daß der Rubel für die Geldfunktionen gar nicht taugt, für die er vorgesehen ist, weil er kein lohnender Geschäftszweck ist, durch die nationale Ökonomie nicht verdient und vermehrt wird und daher auch keinen Nationalreichtum repräsentiert, an dem der Staat sich bedienen und den er umgekehrt in Form seiner Schuldenzettel einer Geschäftswelt zur Benützung anbieten kann. Die Anwendung der Vorstellung von einem Gleichgewicht von Waren- und Geldmenge „stärkt“ daher auch nicht den Rubel, macht ihn nicht zu einem benutzbaren Kauf- und schon gar nicht zum Kreditmittel und einer anerkannten, weil international gefragten Währung.
Die Veranstaltung eines „Sparhaushalts“
Das Projekt, ebenfalls zu Beginn des Jahres hoffnungsvoll angekündigt, durch eine rabiate Verminderung von Haushaltsdefizit und Staatsverschuldung das Geld in Ordnung zu bringen, macht sich an einem „Haushalt“ zu schaffen, der mit dem eines kapitalistischen Staates wenig zu tun hat. Der alte sowjetische Staatshaushalt hatte keine privaten Geschäfte zur Voraussetzung, von denen er Einnahmen bezogen hätte und auf die seine Ausgaben wiederum berechnet gewesen wären. Er war vielmehr die Sammlung der gesellschaftlichen Aufgaben, denen der realsozialistische Staat seine Planung gewidmet hatte. Der geplante Auf- und Ausbau der verschiedenen Abteilungen wurde auch in Form von Geldgrößen festgelegt. Einnahmen waren dabei kein Problem, weil auch sie vom Staat selbst in Gestalt von geplanten Preisen, Gewinnen und planmäßigen Abführungen festgesetzt wurden. Funktioniert, rein finanztechnisch, hat das einwandfrei; bloß die Deckung der Geldgrößen mit den erwünschten sachlichen Effekten ließ häufig zu wünschen übrig, weil die materielle Zuteilung eine ganz andere Frage war.
Mit der Perestrojka freilich wurde ein neuer Tatbestand geschaffen. Auf einmal sollten „Gewinne“ nicht geplant, sondern gemacht werden und den Betrieben gehören, in ihre Verfügung fallen und ihre Geschäfte befördern; dem Staat sollte als Hüter der reformierten Ordnung und deren Nutznießer nur ein festgesetzter steuerlicher Anteil an den Geschäftsergebnissen zufallen. Seitdem an die Stelle einer Zu- und Verteilungsrechnung das höchstförmliche, durchaus dem Kapitalismus abgelauschte Verhältnis von geschäftlichem Wachstum und nationalem Haushalt eingeführt ist, vermeldet die Zentrale, daß die „planmäßig abgeführten“ Gewinne fortlaufend und rapide geschrumpft sind. Heutzutage ist die beabsichtigte Trennung von Staat und Privatgeschäft zumindest insoweit sehr erfolgreich gelungen, als so gut wie keine Abgaben seitens „der Wirtschaft“ beim Staat eintreffen. Verblieben vom Haushalt alter Machart sind aber die versammelten „gesellschaftlichen Aufgaben“, die anerkannten Institutionen und Titel, mit und unter denen der alte Staat den gesellschaftlichen Aufbau betrieben hatte. Darauf wird nunmehr das Rezept „Sparhaushalt“ angewendet.
Das heißt in Wahrheit erst einmal nur, daß mit der programmatischen „Verknappung des Geldes“ bisher vom Staatshaushalt per Geldzuweisung organisierten Abteilungen der nationalen Produktion und sozialen Versorgung die staatliche Existenzgrundlage entzogen wird: Die angekündigte Streichung von Militärausgaben legt Teile der Rüstungsindustrie still und verwandelt Soldaten in überflüssiges Personal. Die „Streichung von Subventionen“ beendet das Umverteilen von Gewinnen zugunsten bestimmter Preisverhältnisse. Die davon betroffenen Betriebe sollen sich an der Zahlungsfähigkeit ihrer Kunden schadlos halten, die allerdings darauf gar nicht eingerichtet ist, so daß durch Preissteigerungen zahlungsunfähig gemachte Verbraucher zahlungsunfähige Betriebe nach sich ziehen. Andererseits sollen durch die Reform gründlich in Geldnot versetzte Betriebe sich keine Kredite mehr verschaffen können, die sie nach den staatlichen Kriterien erfolgreichen Geschäfts gar nicht verdienen. Da sie gerne die Gelegenheit ergriffen haben, sich für ihren Geldbedarf Banken zu gründen, wird ganz nach Lehrbuch auch das private Geldverleihwesen eingeschränkt:
„Das russische Haushaltsdefizit wird im 1. Quartal 92 auf 10 % der Wirtschaftsleistung sinken, sagte Matjuchin. Die Zentralbank sei jetzt in der Lage, die Inflation zu meistern. Sie habe ihre Zinssätze von 8 auf 20 % und die Pflichteinlagen der Banken von 2 auf 20 % erhöht.“ (SZ 26.2.)
Der Entzug von Rubel läßt sich zwar anordnen, seine geschäftsmäßige Benutzung damit aber nicht erzwingen; der Effekt ist vielmehr, daß in dem Maß auch alle Transaktionen, für die Rubel gebraucht werden, verunmöglicht werden. Während Betriebe mehr denn je zu ihren Erpressungsgeschäften mit Gegenlieferungen genötigt sind, werden die Werktätigen schlicht unfähig gemacht, sich durch Kaufen zu ernähren. Mieten werden kaum mehr gezahlt, und die Kommunen haben kein Geld für den Unterhalt der öffentlichen Einrichtungen, so daß sie vor der Entscheidung stehen, ob sie mehr für die Marktwirtschaft oder für die Beibehaltung minimaler sozialer Leistungen wie Hygiene und Krankenbetreuung eintreten wollen.
Die Veranstalter dieser Geldpolitik sind sehr bald darauf gestoßen worden, daß sie mit ihrer rigorosen „Sparpolitik“, die im Gegensatz zu dem entsprechenden lohnsenkenden und wirtschaftsfördernden Steuer- und Haushaltsgebaren kapitalistischer Staaten sämtliche staatlichen Dienste zusammenstreicht, zwar kein hartes Geld, auf jeden Fall aber bei den Betrieben, die sie als ihre ererbten nationalen Reichtumsquellen betrachten, Zahlungsunfähigkeit erzeugen. Weder stehen die dann für die neue Pflicht, Einkünfte für den Staat zu produzieren, zur Verfügung, noch läßt sich mit dem marktwirtschaftlichen Vorsatz, unrentable Betriebe radikal zu schließen, ernst machen, wenn dieses Urteil fast die gesamte nationale Ökonomie liquidieren würde. Das war schließlich auch nicht die Absicht des ganzen Reformprojekts.
Steuereintreiben am untauglichen Objekt – staatlicher Wucher
Zu Beginn ihrer Reform haben die Zuständigen auch gleich daran gedacht, daß in den ganzen finanziellen Wirren auf jeden Fall der Staat seine Einkünfte zu sichern hätte, und haben entsprechende Steuergesetze verabschiedet. Z.B. eine 28prozentige Mehrwertsteuer, mit deren geballter marktwirtschaftlicher Weisheit der damalige Ministerpräsident Gajdar dem Spiegel imponieren will:
„Diese Steuer behindert Investitionen doch nicht, die hat ja der Verbraucher zu zahlen.“
Dabei wurde die Frage der staatlichen Einkünfte in erster Linie wie ein Ordnungsproblem behandelt, das ein drakonisches staatliches Durchgreifen verlangt. Wie z.B. mit der Idee, Buchhalter als Angestellte des Staats zu führen, damit sie in ihrem jeweiligen Betrieb als staatliche Aufpasser vor Ort fungieren und verhindern, daß Gelder hinterzogen, Geschäfte am Staat vorbei organisiert werden. Weniger bedacht wurde bei diesen Beschlüssen, von welchem Objekt die Steuern eigentlich abgepreßt werden sollten: Die Schwierigkeiten der Betriebe, Rubeleinkünfte zu erzielen, werden durch die Besteuerung nur erhöht. Die berühmte Mehrwertsteuer wirkt ihrerseits nur wie ein zusätzlicher wucherischer Aufschlag auf Preise, die ohnehin schon die vorhandene Zahlungsfähigkeit überschreiten. Mit ihrer Besteuerung hat die russische Regierung eine neue Hürde für den von ihr ebenso erwünschten Geschäftsverkehr errichtet. Wenn Betriebe versuchen, ihre Steuern auf den Preis ihrer Produkte zu überwälzen, wenn der Staat an allen Stellen seine 28 % draufschlägt, bekräftigt das ausschließlich das „Inflation“ genannte Problem einer allgemeinen rasanten Teuerung, die Käufe und Geschäfte verunmöglicht. Und deren Wirkung, zahlungsunfähige Betriebe und Einkommen, von denen sich nicht leben läßt, macht sich wiederum als Anforderung an den Staatshaushalt bemerkbar, mit Krediten und Lohnerhöhungen einzuspringen.
Der dazugehörige „Rückfall“
Nach zweieinhalb Monaten „Sparhaushalt“ hat sich das Projekt auch schon wieder blamiert:
„ …wird die Regierung im 1. Quartal nur 190 Mrd Rubel einnehmen, weit weniger als die Hälfte des Haushaltsansatzes… ein gigantisches Quartalsdefizit von 84 Mrd. Rubel… Das Steuersystem ist größtenteils zusammengebrochen. Die neueingeführte 28prozentige Mehrwertsteuer spült nur einen Bruchteil der erwarteten Summen in die Regierungskasse. Die Exportabgaben werden im 1. Quartal gerade 5 % des Haushaltsansatzes einbringen. Die Kreisverwaltungen und autonomen Republiken der Russischen Föderation liefern die erhobenen Gewinnsteuern nicht in Moskau ab, sondern verbrauchen sie selbst… Statt 3 Mrd Rubel wie vorgesehen nimmt der russische Finanzminister nur 300 Mill Rubel durch die Privatisierung ein… Nach den Angaben der Zentralbank waren bis zum 10.3. Kredite und Zinsen in Höhe von 532 Mrd Rubel überfällig.“ (HB 25.3.)
Folglich werden nach einigen Streitigkeiten die ehrenwerten Absichten, das Geld zu verknappen und durch Mehreinnahmen die Schulden solide zu machen, wieder aufgegeben. Auf der Ausgabenseite werden neue Posten eingesetzt: Kredite für die Betriebe, eine Erhöhung der Mindestrenten und -löhne, der nächste „Inflationsschub“ wird angekündigt und der nächste Inflationsbekämpfungsbeschluß ist absehbar. Dieselbe Korrektur erfolgt auf der Seite der Einnahmen: Für einzelne Produkte soll der Mehrwertsteuersatz wieder gesenkt werden, und an den verschiedensten Stellen muß eingestanden werden, daß sich der angekündigte Rigorismus, daß Steuern unbedingt eingetrieben werden, gar nicht durchhalten läßt. Die Regierung sieht sich gewissermaßen von ihrem gesellschaftlichen Material dazu genötigt, gegen ihre guten geldpolitischen Prinzipien zu verstoßen, von ihrer ökonomischen Grundlage dazu erpreßt, Geld herauszugeben, was sie – eigentlich – gar nicht will. Auch eine Weise festzustellen, daß das Projekt und die vorfindlichen Voraussetzungen nicht zueinander passen.
In beiden Fällen, ob die Regierung nun die Linie ausgibt, zu sparen oder vermehrt zu kreditieren, die Einnahmen zu steigern oder darauf Rücksicht zu nehmen, daß das die Gewinnaussichten schmälert, imitiert sie bloß Praktiken kapitalistischer Staaten. Genau genommen verfügt sie über gar keine Einkünfte, festgelegte staatliche Anteile an privaten Geschäften, bei deren Erhebung sie die Wirkungen aufs Geschäftsleben kalkulieren und bei deren Verwendung sie sparen könnte. Sie tätigt auch keine Ausgaben, die sie für und im Vertrauen auf die Leistungsfähigkeit des nationalen Wirtschaftslebens senken könnte, um damit ihr nationales Geld solider zu machen. Ob nun gespart oder kreditiert wird, immerzu druckt die Staatsbank Geld, das nur in verschiedenen Quantitäten ausgeteilt wird und in der Zirkulation versickert.
Es fehlen alle Kriterien einer Staatsverschuldung, das womit, das wovon, das wofür: Ein Geld, das Kaufmittel, Maß der Werte ist, in dem sich wirklich privates Eigentum an einem gültigen Wertzeichen verläßlich schätzen ließe, ein Zirkulationsmittel, mit dem der Austausch vonstatten ginge, ein Zahlungsmittel, bei dem garantiert ist, daß es heute wenigstens ungefähr noch dasselbe wie morgen wert ist – all das ist der Rubel eingestandenermaßen nicht. Ein Staat, der das alles garantiert, der verschuldet sich auch mit diesen Leistungen seines Geldes, seine Schulden sind mit dieser Garantie versehen. Das Maß seiner Schulden macht die Garantie manchmal besser, manchmal schlechter, aber sie gilt.
Ein Staat, der über eine „Marktwirtschaft“ gebietet, verschuldet sich, indem er von einem funktionierenden Geldmarkt, den er garantiert, Gebrauch macht. In den steigt er als Konkurrent und Anbieter ein, fügt den laufenden Kreditgeschäften ein zusätzliches hinzu; aber er ist nicht die einzige Figur in seinem Machtbereich, die Kredit stiftet und nimmt zugleich. Geldbesitzer, die ihrerseits am Geldverleihwesen verdienen und dafür den Aufkauf von Staatstiteln betreiben würden, sind aber in der ehemaligen Sowjetunion einfach nicht vorhanden – die neuen Banken sind Einrichtungen, um die Zahlungsunfähigkeit ihrer Kundschaft zu verstecken, wo sich die verschiedenen Interessenten Kredite einräumen, die keinerlei Bezug auf irgendwelche laufenden Geschäfte, zu erwartende Einnahmen und lohnende Anlagen haben. Die Verantwortlichen mögen sich ja, akademisch gebildet, mit den Experten vom IWF über das Schuldenproblem beraten – es sind nur der Form nach Haushaltsposten, die auf geregelte Staatseinnahmen und ein geregeltes nationales Wirschaftswachstum bezogen sind. Die in jedem Sinne fehlenden Voraussetzungen treten im eklatanten Mißverhältnis sämtlicher Haushaltsposten, von kaum vorhandenen Einnahmen und notwendigen Ausgaben zutage. Allerdings nicht nur da. Neben seinen Ausflügen in die höheren Regionen der internationalen Kreditinstitutionen berichtet der Chef der Nationalbank immer wieder, daß sein größtes praktisches Problem zur Zeit darin besteht, drucktechnisch und papierzulieferbedingt, den Nachschub von Scheinen zu garantieren. Das kommt davon, wenn man ein Un-Geld in eine nicht vorhandene Zirkulation wirft und nicht einmal die Produktionsbedingungen des Schuldzettels richtig in der Hand hat. Wie mag es dann erst bei der Kindernahrung und den Traktoren stehen.
Schließlich fehlt dem staatlichen Geldzuschießen auch das kapitalistische ‚Wofür‘: Wenn ehemaligen Sowjetmenschen Einkommenszuschüsse finanziert werden, vollzieht der Staat keine sozialstaatliche Leistung, sichert nicht die geschäftliche Benützung einer Lohnarbeiterklasse ab und bestreitet diese Aufgaben nicht aus den Einkommen der benutzten Klasse, die er politisch verwaltet; wenn er Betriebe finanziert, ist das keine Konjunkturpolitik, sondern bloß das Dekret, irgendwie weiterzumachen, auch wenn sich keine geschäftlichen Erträge einstellen.
Mit der Entscheidung, jetzt wieder mehr Geld in „die Wirtschaft“ zu stecken, wird kein wirkliches Geschäft gesichert, sondern eigentlich nur der Befund hinausgeschoben, daß „die Umstellung auf Marktwirtschaft“ nicht gelingt. Würde die Regierung nämlich auf ihrem Programm bestehen, den Rubel zu Geld zu machen, und ihr gesellschaftliches Material dazu zwingen, daß Rechnungen bezahlt, daß Kredite bedient und getilgt, Steuern entrichtet und Löhne in Geld gezahlt zu werden haben, dann müßte sie die Untauglichkeit der Betriebe für diese Leistung offiziell konstatieren und sich der Entscheidung stellen, ob sie diesen Befund auch politisch exekutieren will. Der jetzige Wirtschaftsminister Netschajew hat – wie all seine Kollegen Wirtschaftsminister in den ehemaligen RGW-Staaten bei ihrem Amtsantritt – die baldige exemplarische Schließung „unrentabler Betriebe“ angekündigt, als ob die moralische Wucht dieser Drohung die Betriebsleiter zur schleunigen Beherzigung der Regeln der Marktwirtschaft bekehren sollte. Wie all seine Kollegen Wirtschaftsminister im befreiten RGW wird aber auch er feststellen müssen, daß, dem Kriterium ‚rentabel‘ unterworfen, die Nationalökonomie zur Bankrotterklärung ansteht.
Hinter der Alternative „Sparen“ oder „Kreditieren“, an der sich die Reformer abarbeiten, steht das Dilemma, daß die Bemühung um ein „hartes Geld“ und um den Erhalt der betrieblichen Substanz der Nation einander ausschließen. Wenn die Reformpolitiker nach einer „Geldpolitik“ suchen, die den Rubel „konsolidieren“ soll, wälzen sie eigentlich immer nur dasselbe Problem: Daß der Staat nicht mit einem Geld rechnen kann, das er zu garantieren und zu benützen vermag, weil es seine in Arbeiter und Eigentümer geschiedenen Untertanen benützen müssen und können. Eines kommt bei ihrer Herumreformiererei, im Hinundher zwischen Zwangsmaßnahmen zur Durchsetzung finanzieller Leistungen auf der einen und Unterstützungsbemühungen für die angeschlagene Ökonomie auf der anderen Seite, allerdings schon heraus. Das was einen bürgerlichen Staatshaushalt ausmacht, nämlich der Zugriff aufs Privateigentum, findet mangels Privateigentum gar nicht statt, aber eine schleichende Enteignung der zu Eigentümern erklärten Instanzen schon. Die Armut der Bevölkerung, in geldlicher und materieller Hinsicht, ist ohnehin das selbstverständliche Abfallprodukt. Darüberhinaus enteignet der Staat, das bisherige Subjekt des Volkseigentums, sich selbst, formell, indem er die Potenzen der Wirtschaft, die in die Marktwirtschaft eingebracht werden sollten, von seiner Verfügung trennt, materiell, weil er sie vor die Hunde gehen läßt.
Nicht zuletzt deshalb, weil sich die Nachfolgestaaten der Union ihr Erbe auch noch in anderer Hinsicht so aneignen, daß nichts davon übrig bleibt: Die Sowjetökonomie wird nationalisiert.
IV. Die Aufteilung der Sowjetökonomie unter den Erben
Die „Marktwirtschaft“ wollen alle Nachfolgestaaten der Sowjetunion einführen, sich zugleich aber auch noch als „unabhängige Staaten“ etablieren, und das auf der Grundlage einer Sowjetökonomie, einer Wirtschaft, deren Leistungsfähigkeit – auch das, was davon noch verblieben ist – auf der arbeitsteiligen Belieferung quer durch die Union, vom Baltikum bis nach Sachalin beruht. Mit den als Wirtschaftsreform an die Ökonomie angemeldeten Ansprüchen kommen die „Unabhängigen“ sich in die Quere, und sie müssen auch zur Kenntnis nehmen, daß das Erbe, auf das sie ihr Nationalprojekt gründen wollen, ihrem Unabhängigkeitsdrang an allen Ecken und Enden entgegensteht. Daraus will keiner der Beteiligten den Schluß ziehen, daß es ratsam wäre, doch lieber die materiellen Lebensbedingungen zu sichern und die Sache mit der Unabhängigkeit zu lassen. Darin sind sich die neuen Nationalpolitiker sicher, daß ihre Völker eine exklusiv völkische Herrschaft allemal viel mehr brauchen als eine regelmäßige Ernährung.
Wegen ihrer nationalen Sache sehen sie sich aber zu einer „Gemeinschaft“ gezwungen – auch die Balten mit ihrem unbändigen Freiheitsdurst, die sich demonstrativ aus allen Symbolen der Gemeinschaft ausklammern und unentwegt in Moskau verhandeln müssen –, die einer „zivilisierten Auflösung der Union“ dienen soll. Das Unternehmen gerät zu einem dauernden unauflöslichen Streit, gestiftet durch die wechselseitige Abhängigkeit auf der einen, die nunmehr freien nationalen Ansprüche auf der anderen Seite, die dabei nie zu ihrem Recht kommen, stattdessen nur das Material des Streits, den noch vorhandenen sowjetischen Reichtum in Mitleidenschaft ziehen. Bei dieser Materie erweist sich die Vorstellung, mit der die neuen Macher ihr Staatsprojekt angetreten haben, daß doch eigentlich nur der vorhandene Reichtum unter eine andere Wirtschaftsmethode bzw. unter ein neues Kommando zu übertragen wäre, endgültig als reine Ideologie. Damit betreiben sie die Zerstörung der Sowjetwirtschaft – eine originelle Klarstellung der Tatsache, daß ein Staat im Verhältnis zur Ökonomie faux frais darstellt: Die Einführung der Marktwirtschaft aus rein staatlichem Bedürfnis heraus, das Programm, aus der eigenen Machtgrundlage echten Reichtum herauszuschlagen, wird auf dem Boden der ehemaligen Union gleich von fünfzehn solchen Kostgängern exekutiert, dabei bleibt kein Stein auf dem anderen. Die Beteiligten bringen sich wechselseitig in eine Lage, in der sie, was jeden materiellen ökonomischen Bedarf betrifft wie auch den Bedarf nach wirklicher Gewalt, die ihre Streitigkeiten entscheiden könnte, nur noch nach Betreuung durch die imperialistische Staatenwelt verlangen.
Die Zerlegung des sowjetischen Wirtschaftsraums unter dem Anspruch auf „Außenhandel“
Was die beteiligten Staaten und auch die wohlmeinende westliche Presse in positiven Termini zu besprechen pflegen, als Eröffnung von 15 neuen Nationalökonomien, ist der Sache nach ein eher negativer Akt. Die neuen Souveräne machen sich weniger am „Aufbau“ einer Wirtschaft zu schaffen, als daran, die unter ihre Fuchtel geratenen Bestandteile der Sowjetökonomie dem Maßstab eines echt nationalen Nutzens zu unterwerfen.
An erster Stelle steht das dringliche Bedürfnis, ihr ökonomisches Vermögen im Unterschied und Gegensatz zu dem ihrer Nachbarn zu definieren, zunächst durch die schlichte Umbenennung zum Eigentum der Republik, durch die Nationalisierung der Betriebe, die auf dem jeweiligen nationalen Boden stehen. Solche Besitztitel zu deklarieren, ist einfach zu haben. Aber der neue nationale Besitztitel steht einigermaßen in Widerspruch zur Funktionsweise der Produktionsstätten, die auf den unionsweiten Austausch angewiesen sind. Die Nationalisierung der Güterbewegungen, die Umwidmung der bisherigen Zirkulation zugunsten eines 15fach definierten nationalen Nutzens ist weit weniger einfach zu haben. Grenzen als Mittel zur Kontrolle dessen, was sich hin- und herbewegt, werden überall eingerichtet, zumal sich damit auf jeden Fall schon einmal die staatliche Sorte Wegelagerei, die Zoll genannt wird, veranstalten läßt:
„Weißrußland erhebt von allen GUS-Bürgern, die bei Brest die Grenze nach Polen überschreiten, vom 13.1. an Zollgebühren. Sie sollen 100 Rubel betragen, für Autos sind 600 Rubel, für Kleinbusse 1500 und für Reisebusse 6000 Rubel zu entrichten.“ (SZ 11.1.) „Weißrußland erläßt Gesetze über die Export- und Importbesteuerung sowie über Transitsteuern. Außerdem eine Tschernobyl-Sondersteuer.“ (HB 20.1.)
Lieferbeziehungen, bisher unter Moskauer Kommando an den sachlichen Bedürfnissen der Produktion orientiert, müssen jetzt über Republiksgrenzen hinweg abgewickelt werden, da werden sie schon einmal unterbunden oder geraten zum Schmuggel. Bzw. zu regelrechten Heldentaten wie die eines Abteilungsleiters, der sich, versehen mit einer schußsicheren Weste, in eine umkämpfte georgische Stadt durchgeschlagen hat, um von einem dort gelegenen Betrieb Ersatzteile zu erbeuten. Ein Held der Arbeit völlig neuen Typs. Betriebe versuchen, sich zu Gemeinschaftsunternehmen zusammenschließen, um den Hindernissen auszuweichen, die die Nationalisierung für sie bedeutet; andererseits entsteht auf der Grundlage ein neuer Geschäftszweig: Firmen mit dem Angebot, im Bereich der Union alles zu „organisieren“, blühen auf, denn soweit sind die neuen Souveräne noch lange nicht, daß ihre frisch aufgemachten Grenzen auch ganz ihrem Willen gehorchten. Auch ein Schwarzmarkt neuen Typs, der einerseits nicht schwarz, sondern unter dem Titel „Marktwirtschaft“ den Betrieben gerade erlaubt worden ist. Andererseits entdecken die neuen Staatsinteressen, daß das erwünschte freie Geschäftsleben keineswegs automatisch der neu eröffneten nationalen Sichtweise dient. Auch die Kontrolle darüber ist erst noch herzustellen.
Die Nationalisierung der Sowjetökonomie bringt aber nicht nur einen neuen Gegensatz zwischen den Staatsgewalten und ihrer produktiven Basis in die Welt, auch die Staatsgewalten selber geraten aneinander und zwar auf eine ziemlich komplizierte Weise. Die Forderung, daß die Güterbewegung dem neuen nationalen Nutzen zu dienen hat, läßt sich erheben und durch Grenzen unterstreichen; damit ist allerdings auch noch nicht ausgemacht, worin der besteht bzw. wie er herzustellen wäre. Sortiert wird nach dem Gesichtspunkt einer jetzt national vervielfachten Mangelbewirtschaftung erst einmal, was alles die nationalen Grenzen nicht überschreiten darf, und das führt zu den entsprechenden Gegenreaktionen: Seit ihrer Gründung besteht die Gemeinschaft der Unabhängigen aus zahlreichen kleinen Handelskriegen, zum Teil mit interessanten Materialien:
„Die sibirische Region Krasnojarsk droht, ukrainischen Atommüll zurückzuschicken, wenn die Ukraine nicht ihre Handelsverpflichtungen einhält“. (SZ 10.1.)
„Die russische Regierung hat die Ausfuhr von Konsumgütern, vor allem von Lebensmitteln in einige andere Staaten der GUS untersagt… damit begründet, daß andere Mitgliedsstaaten ihrerseits die Ausfuhr von Konsumgütern nach Rußland beschränkt haben… Für die Überwachung der Ausfuhrbeschränkung sollen Kontrollposten errichtet werden.“ (SZ 11.1.)
Die Preisfreigabe in der russischen Föderation hat noch eigens als Anlaß zur Einrichtung von Handelsschranken und Exportverboten gewirkt. Im Prinzip hatten sich alle Republikshäuptlinge darauf geeinigt, daß in der Preisfreigabe der erste und wichtigste Schritt auf dem Weg zur Marktwirtschaft bestehen sollte. Nachdem die russische Regierung damit angefangen hatte, bekamen sie die Folgen zu spüren und mußten feststellen, daß die „Marktwirtschaft“ und ihre nationalen Ambitionen nicht übermäßig gut zusammenpassen. Ihren neuen Staatsvölkern erklärten sie freilich sofort, daß Moskau an allem schuld wäre:
„Nasarbajew wiederum macht die russischen Reformer verantwortlich für die Warnstreiks, die in seinem Land nach den Preiserhöhungen ausgebrochen sind.“ (HB 14.1.) „Auch Krawtschuk übte heftige Kritik an Jelzins Wirtschaftspolitik und machte Rußland dafür verantwortlich, daß in der Ukraine die Preise drastisch erhöht werden mußten.“ (SZ 16.1.)
„‚Die Moskauer mit ihren hohen Löhnen haben uns leergekauft und wir mußten uns wehren‘ – so lautet die offizielle Begründung für die Koupons, für die Zollkontrollen in den Zügen, für das strikte Ausfuhrverbot für Lebensmittel aus der Ukraine“. (FR 21.1.)
Mit der Einführung eines kapitalistischen „Außenhandels“ hat dieses Gezerre wenig zu tun: Nicht um die Benützung von anderen Staaten und deren Ressourcen wird gestritten, sondern die neuen „Handelspartner“ behandeln sich bzw. ihre Bevölkerung wechselseitig wie Plünderer, denen das Handwerk zu legen ist. Erst einmal wurde der nationale „Markt“ verteidigt, dann wurde schließlich wieder verhandelt. Denn mit dem Dichtmachen von Grenzen ist es wiederum nicht getan, schließlich ist jede Republik angewiesen auf Produktions- und Lebensmittel, die jetzt als Eigentum anderer Republiken firmieren.
Daher wird der Streit um die Konditionen eines national nützlichen Austauschs eröffnet, in dem eines feststeht: daß die Republiken wegen ihrer Herkunft aus einem einheitlichen Wirtschaftsraum ebenso viele Abhängigkeiten wie Erpressungsmittel gegeneinander aufzufahren haben, so daß keine ein entscheidendes Gewaltmittel auf ihrer Seite hat. Fest stehen zweitens die nationalen Ansprüche, die bedient sein wollen. Schließlich war das treibende Motiv für jede Staatsgründung die feste Überzeugung, daß unter der Knute Moskaus der eigene Landstrich immer nur ausgebeutet worden wäre, bislang viel zu viel gegeben und zu wenig empfangen hätte; dieser Standpunkt ist nunmehr umfassend ins Recht gesetzt. Der Vergleich, wieviel eine Region liefert und wieviel sie erhält, der im Rahmen der alten Planwirtschaft belanglos war bzw. nur theoretisch von den Nationalisten vor Ort angestellt wurde, wird jetzt zum maßgeblichen Kriterium, d.h. aktiven Verdacht. Der Güterverkehr muß sich vor dem Gesichtspunkt nationaler Bilanzen verantworten – allerdings ohne daß die Beteiligten zu bilanzieren vermöchten. Sie haben nämlich kein Maß für den nationalen Nutzen an der Hand, an dem sich ein lohnender Austausch bemessen ließe: Ihr Nationalismus will sich auf die Qualität des Rubel als Geld nicht verlassen; damit bestreiten sie wiederum die Funktion des Rubel im innersowjetischen Güteraustausch.
Alle wollen den Rubel abschaffen, können ihn aber nicht loswerden
Die neuen Souveräne, die die Güterbewegung im Gebiet der ehemaligen Union unter einen national ertragreichen Außenhandel subsumieren wollen, müssen die Bemessung anstellen, welche Lieferung welche Gegenlieferung wert ist, dabei scheiden sie einen Vergleich anhand von Rubelpreisen von vorneherein aus. Jede Republik wirft jeder anderen ihre „administrierten Preise“ vor, seien sie nun „frei“ oder noch nicht. Gerade der durch die unliebsamen Wirkungen der Preisfreigabe gestiftete Streit – etliche Republiken haben die Maßnahme befolgt, dann wieder ganz oder teilweise zurückgenommen – bekräftigt die allseitige Überzeugung, daß Rubelpreise gar nichts mehr „aussagen“, weil sie ja von Region zu Region, von Obrigkeit zu Obrigkeit verschieden ausfallen.
Eigentlich wollen sowieso alle „Weltmarktpreise“ für ihre Erzeugnisse reklamieren – neuerdings werden die Listen der imperialistischen Warenbörsen als Handhabe dafür regelmäßig veröffentlicht. Damit sind aber die nationalen Ansprüche gar nicht zufriedengestellt. Die neuen Chefökonomen mögen ja Weltmarktspreise für den Inbegriff wirtschaftlicher Rationalität halten, wenn sie aber z.B. Lebensmittelexporte gegen Energie- und Rohstofflieferungen an dem Maßstab aufrechnen, müssen sie feststellen, daß sie ziemlich schlecht aussehen. Die Preisrelationen der westlichen Warenbörsen lassen sich kopieren, aber eine Erfolgsgarantie für jede Republik sind sie nicht. Wenn der Austausch zwischen Republiken sich wirklich daran bemißt, bleibt einiges an materiellem Bedarf auf der Strecke, was unter den künstlichen Preisen von ehedem bedient wurde. Alle die neuen Souveräne haben die alten sowjetischen Preisrelationen für ungerecht erklärt, noch jede Provinz hat sich übervorteilt gefühlt; die Vorstellung, daß mit einem freien Außenhandel, frei von Moskauer Diktaten, alle viel mehr aneinander verdienen, konnte schlecht aufgehen. Der nationale Anspruch, der diese Rechnung angestellt hat, läßt sich aber auch durch Weltmarktpreise nicht widerlegen, wenn er damit schlecht fährt. Er findet dann eben andere „Argumente“ für sein Recht, und der Streit um die Preise bzw. die Preisfindung geht weiter.
Zudem krankt die Behelfsmethode, auf Weltmarktpreise zurückzugreifen, grundsätzlich daran, daß die Beteiligten kaum in einem der zitierten Gelder zahlen können; wenn gezahlt werden muß, ist dann doch wieder eine Umrechnung in Rubel erfordert und die leidige Frage, wieviel der wert ist, ist wieder auf dem Tisch. Zwischenzeitlich haben sich die GUSler für diese Operation auf einen GUS-Rubel „geeinigt“, der mit 20 oder 30 oder je nachdem mit noch einer anderen Zahl zu multiplizieren sein sollte, ungefähr so vom sowjetischen Ministerpräsidenten Gajdar bekanntgegeben. (SZ 10.2.) Dieses Bekenntnis zu einem gemeinsamen Zahlungsmittel mit einem unbestimmbaren Wert ist zwar originell, heißt aber auch nichts weiter, als daß um jeden „Preis“ gefeilscht werden muß. Und dieses Dilemma löst nur wieder allseitige Versuche aus, den Rubel zu umgehen, dem Ideal nach nur Lieferungen anhand von Weltmarktpreisen gegeneinander zu verrechnen. Geeinigt hat man sich auf einer dieser Konferenzen auf die Bemühung, „Zahlungsbilanzen auszugleichen“ – wiederum ein etwas hochgestochener Titel für den Versuch, einen Handel ohne ein gültiges und allseits anerkanntes Zahlungsmittel abzuwickeln. Das heißt dann aber auch, daß man entweder den Handel auf dieses Ziel zurückschneiden muß, entgegen den sachlichen Bedürfnissen, die ihm andererseits zugrundeliegen, oder daß eben doch eine Seite sich mit einem für untauglich gehaltenen Geld bezahlen lassen muß.
Ein Zwischenspiel und sein Resultat: Für ein eigenes Geld braucht man mehr als Druckmaschinen, Papier und Farbe
Die Manöver in Sachen Geld, die die Nachfolgestaaten der Sowjetunion seit ihrem Eintritt in die „Unabhängigkeit“ vorgeführt haben, sind ein eindrucksvoller Beleg, wie abgrundtief wenig Ahnung die Zuständigen von der Marktwirtschaft haben, die sie veranstalten wollen.
Losgegangen ist die GUS mit dem weisen Beschluß, zwar den Rubel weiterhin als gemeinsame „Geldeinheit“ zu benützen, aber eine einheitliche Zentralbank sollte es auf ausdrücklichen Wunsch der Ukraine nicht geben. Die Frage, wie das überhaupt gehen sollte, ein gemeinsames Zahlungsmittel zu verwenden, das aber gleichzeitig nach Willen von 12 verschiedenen Souveränen eingesetzt und vermehrt werden sollte, mußten die GUSler aber erst gar nicht beantworten, weil sie mit viel elementareren technischen Problemen ihrer „Geldpolitik“ konfrontiert wurden. Die russische Preisfreigabe erzeugte nämlich in sämtlichen Republiken einen enormen Rubelbedarf, schlicht um den Umlauf mit genügend Geldscheinen zu bestücken, den die Moskauer Staatsdruckerei nicht bedienen konnte. Daran fiel noch jeder Republik auf, daß ihr Anspruch auf souveränes Wirtschaften und die Abhängigkeit von einer Moskauer Gelddruckerei schlecht zusammenpassen. Folglich verkündeten dann alle die schnellstmögliche Einführung eines „eigenen Geldes“. Bloß mußte man dann wiederum feststellen, daß die Ausgabe national bedruckter Zettel nicht ganz dasselbe ist wie ein „eigenes Geld“. Die ukrainischen Oberen ließen alle Welt wissen, daß sie ab sofort die Löhne teilweise in Koupons auszahlen würden, die dann schon von ganz alleine den Rubel entwerten und verdrängen würden:
„Der Rubel solle noch im Februar auf dem Gebiet der Ukraine seine Gültigkeit verlieren, kündigte Krawtschuk an.“ (SZ 16.1.)
Das Resultat nach nur 2 Wochen:
„Koupons gelten nur in den staatlichen Lebensmittelläden. Im Staatshandel häufen sich inzwischen große Mengen… Niemand weiß, was mit ihnen geschehen soll, da es bisher keine Möglichkeit gibt, die Koupons auf Konten einzuzahlen oder anzulegen. Auf den freien Märkten und Kommerzgeschäften werden die Koupons entweder gar nicht oder nur äußerst ungern angenommen… bisher keinen offiziellen Rubelkurs festgelegt. Da die Staatsbetriebe jedoch nach wie vor untereinander mit Rubel abrechnen, ist das Chaos perfekt: Produktion und Handel verfügen praktisch nicht mehr über eine einheitliche Verrechnungsbasis. Die Regierung ist entschlossen, die Löhne zum 1.3. ganz in Koupons auszuzahlen. Was mit den Bankguthaben geschieht, ist bisher nicht entschieden. Da es kaum möglich sein wird, in einem Monat ein Zahlungsabkommen mit Rußland auszuhandeln, droht der völlige Zusammenbruch des Handels zwischen den beiden Staaten… Bisher hat sich die ukrainische Regierung noch nicht entschieden, was mit den rund 40 Mrd Rubel geschehen soll, die im Lande zirkulieren. Rußland beharrt darauf, daß die Rubelmassen vernichtet oder an die russische Zentralbank übergeben werden, falls in der Ukraine eine neue Währung eingeführt wird. Ukrainische Regierungsvertreter wollen einen Teil des Geldes jedoch auch nach dem 1.3. weiter benutzen. Die russische Zentralbank weigert sich deshalb im Gegenzug, neue Banknoten für die Ukraine zu liefern. Die erste Folge dieser Politik: Die neuen 200- und 500-Rubelnoten, die in Rußland ausgegeben worden sind, gelten in der Ukraine nicht als Zahlungsmittel. Die meisten Ukrainer haben im Januar nur 200 bis 300 Koupons bekommen – viel zu wenig, um die 2- bis 3-fach gestiegenen Lebensmittelpreise in den staatlichen Läden zu bezahlen. In kleineren Städten haben Rentner und Arbeiter bis heute noch nicht einmal alle Koupons erhalten, die ihnen zustehen… Im Sommer eine „richtige“ neue Währung… Die Nationalbank hält die neue Währung überhaupt nur für sinnvoll, wenn sie mit ausländischer Hilfe konvertierbar gemacht wird… Krawtschuk will die Griwna jedoch trotzdem einführen, um den Forderungen der Opposition zu begegnen. Die Ideologen der Ruch-Bewegung halten es schlicht für „Vaterlandsverrat“, daß der Rubel immer noch in der Ukraine zirkuliert.“ (HB 3.2.)
Immerhin hat man eine neue Geldfunktion entdeckt, diejenige, die Würde eines Volkes zu gewährleisten. Daß ein echtes Vaterland irgendwie sein eigenes Geld braucht, hat diese neue Sorte von Polit-Ökonomen sofort kapiert; aber alle anderen Kenntnisse davon, was ein Geld ausmacht, müssen sie nachholen. Nicht einmal die elementare Voraussetzung scheint ihnen bekannt zu sein, daß das Geld insoweit eine Gewaltfrage ist, als die Ausgabe von eigenen Zetteln mindestens durch ein Gesetz mit dem Inhalt ‚einziges zulässiges Zahlungsmittel auf dem Staatsgebiet‘ gültig gemacht werden muß. Die Vorstellung, daß ukrainische Koupons neben zirkulierenden Rubeln zweifelsfrei obsiegen müßten – wegen patriotischer Gefühle der Bevölkerung? – war jedenfalls nett. An die zweite entscheidende Frage, daß sich ein Staat diese Gewalt auch ökonomisch leisten können, nämlich sein Geld durch Geschäfte in Kraft setzen lassen muß, haben die Zuständigen auch nicht gedacht. Wozu ihre Koupons denn weiter taugen sollten, nachdem sie einmal an die Werktätigen ausgegeben, von denen im Staatshandel abgeliefert und dann dort aufgehäuft worden wären, ist gar nicht in Betracht gezogen worden. Die klassische VWL-Weisheit, Geld ist, wenn es genommen wird, ist dann leider gegen die als Rubelersatz proklamierten Koupons ausgeschlagen. „Genommen“ werden sie deswegen nicht, weil die Betriebe für ihr Funktionieren auf den unionsweiten Güterverkehr, und wenn auf Geldzettel, dann auf Rubel oder Devisen angewiesen sind. Die ukrainische Regierung hat nicht einmal soweit vorwärts gedacht, daß die Gründung ihres Geldes zumindest den Versuch benötigt hätte, die anderen GUS-Souveräne dazu zu veranlassen, überhaupt ein Verhältnis Rubel : ukrainisches Geld anzuerkennen, und daß sie selbst dafür eine gewisse materielle Grundlage zu schaffen hätte, um für dieses Verhältnis einstehen zu können.
Ähnliche Angebereien mit einem eigenen Geld, das bloß deswegen schon „stabil“ sein soll, weil es nicht Rubel heißt, waren zu Beginn des Jahres groß in Mode in der GUS. In den meisten Fällen ist es beim Austeilen nationaler Bezugsscheine geblieben, die die Käufer zusätzlich mit Rubeln vorlegen mußten, nur um auswärtige Käufer aus der regionalen Versorgung auszuschließen – mit Geld haben diese Zettel ungefähr genausoviel oder wenig zu tun wie Rationierungskarten. Was andererseits unter dem Titel nationales Geld auftaucht, wie der lettische Rubel, der jetzt angekündigt worden ist, stellt auch nur die Reaktion auf den ständigen Mangel nicht an Geld, sondern an Geldscheinen dar, nachdem immer noch alle von Lieferungen der Moskauer Druckerei abhängen und die sogenannte Inflation diesen technischen Geldbedarf dermaßen rasant steigert, daß er die Druckkapazitäten in Moskau überfordert.
Kalkulationen mit einem wertlosen Rubel
Die Erfindung des lettischen Rubels ist andererseits auch ein schöner Beleg für die praktische Not, in die sich die hoffnungsvollen Staatsgründungen gebracht haben. Gerade die Balten haben schließlich am lautesten nach Unabhängigkeit geschrien und erklärt, daß ihr Eintritt in die Weltgeschichte als eigener Staat sofort und bedingungslos mit der Einführung eines eigenen Geldes gekrönt werden sollte. Seit ungefähr einem Jahr darf man gespannt auf das Erscheinen von „Lit“, „Lat“ und „Kroon“ warten, und nun enttäuschen die Letten mit ihrem lettischen Rubel-Surrogat. Die freiheitsdurstigen Völker haben nämlich lernen müssen, daß sie mit der Einführung eines nationalen Zahlungsmittels umgekehrt auch sich selbst von der Zahlungsfähigkeit in Rubel ausschließen würden; die ist ihnen zwar suspekt und auch nur beschränkt vorhanden, aber verzichten wollen und können sie darauf auch nicht. Die russische Regierung hat die baltische Unabhängigkeit einmal ernstgenommen und die Bezahlung von Energielieferungen in Devisen verlangt. Daran ist den baltischen Wirtschaftsführern aufgefallen, daß ihnen eigene Geldzettel wenig helfen würden, um all das, was sie von anderen Republiken beziehen wollen, zu bezahlen. Dann müßten sie sich vielmehr erst recht Rubel oder sogar Devisen verdienen. Was ein lettischer Sachverständiger auf die reizend begriffslose Weise ausdrückt, daß man mit der Einführung des eigenen Gelds deswegen zögert,
„weil jede Rechnung, die man noch in Rubel bezahlen kann, sozusagen ein Gratisgeschäft ist.“ (FR 26.2.)
Auch die ukrainischen Meister wollten zwar großspurig den Rubel ersetzen, aber nicht einmal die ausgemusterten Scheine an Moskau zurückschicken. Die halbseidene Berechnung, nebeneinander das übernommene Geld des alten Staates benützen und ein nationales einrichten zu können, kann nicht gut aufgehen, gehört vielmehr zu der Sorte Eröffnung eines Staates, wie sie die losgelassenen Nationalisten der ehemaligen Union ausprobieren: Nach ihrem Beschluß, sich zur Nation auszurufen, in der festen Überzeugung, sämtliche Mittel einer ordentlichen Staatsmacht inklusive einer Nationalökonomie wären damit schon vorhanden oder würden sich einstellen, müssen sie sich in allen Hinsichten darüber belehren lassen, daß ihnen die Mittel eines wirklichen Staates abgehen.
Im übrigen ist die Moskauer Politik in Sachen Rubel das passende Gegenstück zu den „unabhängigen“ Geldexperimenten. Die Berechnung, daß die anderen Staaten schon merken würden, daß sie um eine Benutzung des Rubels gar nicht herum kommen und sich deswegen in eine freiwillige nützliche Abhängigkeit von Moskau begeben würden, von einem Moskau, das ihnen weiterhin die Souveränität in Sachen Gelddrucken voraushat und ihnen ihre Rubelkontingente zuteilt, kann genausowenig aufgehen. Denn Staat sein wollen nun einmal alle diese Provinzfürsten, das will ihnen auch die Jelzin-Regierung nicht bestreiten, und daß sich dieses Programm nicht damit verträgt, in der grundsätzlichsten Angelegenheit der ökonomischen Souveränität, der Verfügung über Geld, von Zuteilungen eines anderen Staates abhängig zu sein, das kapiert auch noch ein Harvard-Absolvent.
So sehr die Möchtegern-Staaten auch auf den Holzrubel schimpfen, sie wissen einfach nicht, wie sie aus eigenen Kräften davon loskommen könnten. Sie sind gewissermaßen auf den Rubel zwangsverpflichtet, auf einen Rubel, der allen als Inbegriff von untauglicher Wirtschaft und Unterdrückung durch die Zentrale, als ein reines Ungeld gilt und den zudem Moskau immer noch für sich und alle drucken muß. An Moskau wollen sie dabei immer als Unsitte genau das entdecken, was sie selbst gerne anstellen würden, aber nicht können: die Freiheiten eines Staates, sich Kredit zu verschaffen. Der neue Chefberater Krawtschuks Sawtschenko, 33jähriger Doktor der Ökonomie, 1 Jahr in Harvard studiert:
„Seiner Meinung nach kann die wilde Kreditschaffung der Banken nur noch durch ‚diktatorische Mittel‘ beendet werden. Da dies nicht möglich sei, bleibe der Ukraine nur der Ausweg, ‚unsere Grenzen dichtzumachen und eine eigene Währung einzuführen‘.“ (HB 4.2.)
Darüber setzt sich bei allen Beteiligten immer mehr die Überzeugung fest, daß nur die imperialistischen Nationen ihnen aus ihrem Dilemma heraushelfen können. Die sollen ihnen dabei behilflich sein, ein eigenes Geld zu stiften. Mittlerweile erhebt ungefähr jede Republik Anspruch auf einen Marshall-Plan, schwärmt von Ludwig Erhard und denkt dabei an ihr gutes Recht, so ähnlich wie die BRD zu werden.
Der Ausweg: Außenhandel mit imperialistischen Partnern
Mit ihren Streitigkeiten bescheinigen sich die neuen Souveräne wechselseitig, daß sie gar nicht über ein Geld verfügen, das den Handel untereinander lohnend machen würde. Ebenso müssen sie aber an ihren Geldnöten feststellen, daß sie selbst nur sehr bedingt dazu fähig sind, sich davon zu lösen und ihr Programm der Nationalisierung der Sowjetökonomie wahrzumachen. Ihre Abhängigkeit – von arbeitsteiligen Zulieferungen anderer Republiken, von dem Unionsgeld, mit dem sich das immerhin noch teilweise regeln läßt – zwingen sie dazu, sich immer wieder zueinander ins Verhältnis zu setzen, aber dabei fühlen sich alle um ihren nationalen Erfolg betrogen. Daneben besitzen sie jetzt allerdings die Handlungsfreiheit, um andere Geschäftsgelegenheiten auszuprobieren, und zwar Gelegenheiten, bei denen die nationalen Rechnungen auf ihre Kosten kommen: Es gibt die Möglichkeit, „echtes“, unzweifelhaft gültiges Geld zu verdienen – auf dem kapitalistischen Weltmarkt. Es gibt dort ebenso die Möglichkeit, wirkliche Ware zu erwerben – alles, was in der Union als Defizitware rangiert oder unter Exportverbote anderer Republiken fällt, ist dort käuflich.
Die Gelegenheit wird von allen Republiken mit Begeisterung ergriffen. Sie besichtigen ihre Reichtümer unter dem neuen Gesichtspunkt der Exportfähigkeit und schaffen sie über die alten Unionsgrenzen, wo immer ein Interesse auf dem Weltmarkt auszumachen ist. Export für Devisen, aber auch für Bartergeschäfte, für Lebensmittel und Produktionsmittel, die in der GUS nicht zu haben sind, ist der einzige Weg, wirkliche, nationale Geschäfte zu eröffnen. Auf diesem Weg können die GUS-Staaten Reichtum erobern, den ihre „Gemeinschaft“ nicht hergibt – die andere Seite besteht allerdings darin, daß jedes dieser Exportgeschäfte Güter aus dem alten Unionszusammenhang entzieht. Turkmenistan will Erdöl und Gas an den Iran und die Türkei und über deren Vermittlung nach Europa liefern anstatt in die GUS. Die baumwollproduzierenden Republiken wollen ihre Baumwolle zu Weltgeld machen, die russische Föderation will noch viel mehr Öl und Gas nach Europa liefern… Die Möglichkeit, die Produktion soweit auszudehnen, daß sowohl die alten Abnehmer in der GUS wie die neuen Adressen auf dem Weltmarkt bedient werden können, ist in den seltensten Fällen vorhanden, so daß jeder solche Außenhandelserfolg einer Republik die Schädigung anderer nach sich zieht. Gewinne und Verluste mögen unterschiedlich verteilt sein, betroffen sind alle davon, daß Produkte aus dem ehemaligen sowjetischen Güterkreislauf herausgezogen und auf dem Weltmarkt versilbert werden. Was die eine Republik als Gelegenheit zum Geldverdienen begreift, erzeugt für die anderen den Zwang, sich Ersatz außerhalb der GUS beschaffen, also ihrerseits Geld verdienen zu müssen; so arbeiten sie sich dann an den Weltmarkt heran. Sie werden darüber nicht weltmarkttauglich, sondern machen sich wechselseitig weltmarktbedürftig.
Diese Geschäfte werden nicht zuletzt durch die imperialistischen Staaten und deren Geschäftswelt gefördert, die auch Barter gar nicht unbedingt verschmäht, die Geschäfte florieren wie noch nie – zumal jetzt auch Betriebe, zur Privatinitiative berechtigt, alles, was nur geht, ins westliche Ausland verramschen; sämtliche westlichen Rohstoffkonzerne jammern über die GUS-Verkäufe, die ihre Preise in den Keller bringen. Der Westen ist seinerseits an dieser Sorte Ausverkauf tatkräftig beteiligt, z.B. ist eine Bedingung für die Gewährung der Hermes-Bürgschaft die, daß es um „Geschäfte, die der Stärkung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, insbesondere der konkreten Verbesserung der Devisenlage dienen“, (HB 21.1.) geht. Westliche Rohstoffkonzerne kümmern sich auch schon vor Ort um die Devisenlage der GUS-Republiken, zusammen mit ihrer eigenen. Die Lücken, die die Sorte Geschäft dann auf dem Gebiet der ehemaligen Union hinterläßt, belegen wiederum die westliche Hetze gegen das kommunistische System, das seine Unfähigkeit jetzt erst recht in seinem Zusammenbruch dokumentiert… Ärgerlich vermerkt werden solche Geschäfte mit der sowjetischen Erbmasse nur, wenn der Iran sie macht oder die Russen meinen, sie könnten den Gaspreis erhöhen.
Devisen werden auf diese Weise verdient, bei denen handelt es sich einwandfrei um Geld; ob das allerdings einen national erfolgreichen Außenhandel garantiert, ob der Ertrag überhaupt einen nationalen Gewinn, nämlich Überschuss über Kosten darstellt, ist nicht auszumachen, denn intern gar nicht geldlich zu bemessen. Die Exporte laufen ja gerade umgekehrt so gut, weil die neuen Republiken ihre aus der Union ererbten Produktionsanlagen wie eine Gratisgabe behandeln und nicht wie Kapitalgrößen, die sich erstens reproduzieren und zweitens vermehren müssen. Ob dieser Handel überhaupt einen Beitrag zur stofflichen Reproduktion der Produktionsbedingungen leistet, ob also seine Erträge nicht nur auf dem Ausverkauf vorhandener Reichtümer, der Aufzehrung vorhandener Produktionsmittel beruhen, ist auch die Frage. Daß ungefähr alle Republiken Anträge ans kapitalistische Ausland stellen, ihnen mit Erschließungs- und Erneuerungsinvestitionen bei ihren Exportgeschäften zu helfen, spricht nicht dafür, daß die Exporterträge für die Erneuerung der Produktionsanlagen geradestehen. Auf jeden Fall entziehen sie sich mit ihren Exporten wechselseitig Produktionselemente und bringen damit die Frage auf den Tisch, ob und wie lange die ererbten Fabriken und Förderanlagen noch in Gang bleiben.
Darüber verwandelt sich die günstige Gelegenheit, Devisen verdienen zu können, rapide in den Zwang, Devisen verdienen zu müssen, und das nationale Aufbruchsprogramm in die Aufgabe, sich für auswärtige Interessen herzurichten. Dem haben die Republiken auch noch aus anderen Gründen nachzukommen.
Schuldenbedienung als ökonomisches Erbe und Startbedingung der neuen Souveränitäten
Mit der Gründung der GUS ist dem Westen ein guter Schuldner abhanden gekommen. Deswegen hat man im Westen aber auf keinen Dollar Sowjetschulden verzichtet. Die neue demokratische Staatengemeinschaft, die sonst nichts mehr mit der alten Sowjetwirtschaft zu tun haben wollte und sollte, wurde mit der größten Selbstverständlichkeit für alte Kredite haftbar gemacht, für die bislang das „Reich des Bösen“ als zuverlässiger Zahler eingestanden war. Daß ohne Bekenntnis zu dieser Erblast eine diplomatische Anerkennung für die Nachfolgestaaten nicht in Frage kam, war von westlicher Seite her so klar, daß darum gar kein überflüssiges Aufhebens gemacht werden mußte.
Im Prinzip haben die neuen Souveräne die Verpflichtungen der alten Sowjetunion auch anerkannt. Allerdings hatte sich schon vorher, in der Endphase der SU, gezeigt, daß gar nicht mehr wie in den guten alten Zeiten des Osthandels eine absolut verläßliche Wirtschaftsmacht hinter dem aufgelaufenen Schuldenberg stand. Seit Dezember meldet die für die Schuldenbedienung zuständige Außenhandelsbank immer wieder Zahlungsschwierigkeiten. Im Januar wurden auch vereinbarte Zinszahlungen eingestellt, seitdem tagen die russischen Vertreter und die westlichen Gläubiger fast ununterbrochen.
Die neuen Souveräne, gerade noch innigst vereint in ihrem Bestreben, die Union samt Gorbatschow abzuservieren, haben an der Frage der Devisen und Schuldenbedienung blitzartig ihre Konkurrenz untereinander gemerkt. Nachdem Jelzin die sowjetische Staatsbank und Außenhandelsbank annektiert hat, wollten die anderen Republiken nicht mehr einsehen, warum sie ihre Devisenerträge bei einem russischen Institut unter russischer Aufsicht deponieren sollten. Sie nationalisierten konsequent Abteilungen der Außenhandelsbank auf ihrem Gelände, beschlagnahmten Devisenkonten auf ihrem Terrain; umgekehrt wurden die ihnen zugeordneten Devisenkonten in Moskau von der russischen Republik gesperrt. Im Prinzip, d.h. dem Westen gegenüber, haben sie sich alle bereit erklärt, die alten Schulden der Union zu bedienen; aber untereinander wirft das überhaupt erst die produktive Frage auf, wohin denn die alten Kredite eigentlich geflossen sind. In der jeweils eigenen Republik sind sie nämlich garantiert nicht angekommen. Jedenfalls kommen von den Republiken kaum mehr Devisen bei der Vneshekonombank herein.
Seit neuestem gibt es aus dem Bereich der alten Union, in dem es kein Kapital gibt, auch eine sogenannte „Kapitalflucht“: Die mit den neuen Exportgeschäften verdienten Devisen landen nur zum Teil in den Nationalbanken der Republiken. D.h. die Betriebe sichern das wirkliche, nämlich auswärtige Geld auch gegen ihren Staat, indem sie es im Ausland deponieren bzw. für einen Außenhandel auf eigene Faust verwenden. Soweit ist die erwünschte Trennung von Staat und Betrieben wirklich gelungen, allerdings etwas im Gegensatz zu den staatlichen Absichten. Der Beschluß der russischen Regierung, von sämtlichen Exportgeschäften 40 % abzukassieren, um die Schuldenbedienung zu garantieren, hat die verschiedensten Umgehungsmethoden zur Folge:
„Sehr viele Joint Ventures seien nur gegründet worden, um die Devisenbestimmungen zu umgehen… Sie hätten es dem russischen Partner ermöglicht, ein Konto im Ausland zu eröffnen, um somit der Devisenabgabe an den russischen Staat zu entgehen.“ (HB 5.2.)
Erst nachträglich und erst aufgrund der auswärtigen Forderungen, denen sie sich gegenübersehen, bemerken die russischen Reformer, daß ihre Vorstellung von „Marktwirtschaft“ – die Betriebe machen ihre Geschäfte, auch mit dem Ausland, und spielen dem Staat darüber seine Mittel in die Hand – ein bißchen schlicht gewesen ist. Sie hätten gerade umgekehrt, eine der üblen Praktiken des alten Staates fortsetzen müssen, nämlich sein Außenhandelsmonopol, mit dem Zweck der Devisenbewirtschaftung, wie sie noch jeder kapitalistische Staat betreibt, wenn es darauf ankommt, die nationale Ökonomie als Instrument zur Sicherung der staatlichen Zahlungsfähigkeit nach außen einzusetzen. Zu dieser Einsicht verhelfen ihnen gerade auch ihre marktwirtschaftlichen Vorbilder und interessierten Gläubiger im Westen, die die russische Regierung mit einem internationalen Institut bekannt gemacht haben, das erfolgreich im Aufspüren von „Flucht“geldern tätig ist.
An dieser spannenden Materie, wie sich die Schuldenlage bewältigen läßt, haben die neuen Souveräne das Verhältnis zwischen Souveränität und Schulden praktisch ein wenig ausgelotet. Da war zum einen die Forderung des Westens, alle gerechten Abgrenzungsbemühungen, auch in Wirtschaftsfragen, dem Gesichtspunkt der Solidität alter Sowjetschulden unterzuordnen. So weit durfte die neue nationale Freiheit auf gar keinen Fall gehen, daß einzelne GUS-Mitglieder die Regelung der alten Schulden einfach anderen überließen. In dieser Lage hat zuerst die russische Föderation Führungsqualitäten bewiesen. Sie hat sich den westlichen Gläubigern als einzig solider Garant der alten Schulden angeboten, damit die ökonomischen Machtverhältnisse und die Rangfolge der Mitglieder in ihrem GUS-Verein klargestellt, und nach außen ein interessantes Stück Weltpolitik probiert: Ausgerechnet die Übernahme der gewaltigen Schuldenlast sollte Grundlage einer gewaltigen Rolle gegenüber den Gläubigernationen sein. Gewissermaßen nach dem Motto: je größer die Schulden, um so gewichtiger der Schuldner. Die Ukraine, Hauptkonkurrent der russischen Föderation in allen Macht- und Geltungsfragen, hat sich gleich als Opfer dieser diplomatischen Technik begriffen und sie kopiert. Gegenüber dem Westen und gegenüber den Russen hat sie darauf bestanden, sich aus der Erbmasse der Sowjetunion ein eigenes Schuldenpaket zuzurechnen, dieses auch alleine zu tragen und so einen eigenen Anspruch auf ein Stück Rechtsnachfolge der alten Union zu erheben.
Die westlichen Gläubigernationen waren dadurch in eine bemerkenswerte Machtposition versetzt. Sie hatten abzuwägen zwischen dem Geltungsanspruch der konkurrierenden Republiken und der Sicherheit ihrer Kredite und haben sich dafür entschieden, zunächst einmal einen Einigungszwang zu verordnen. Sie haben darauf bestanden, daß die alte sowjetische Außenhandelsbank der einzige Verhandlungspartner bleibt und als solcher von allen Republiken anerkannt wird. Entschieden ist damit allerdings nur, daß die Schuldenbedienung zum Dauerstreit zwischen den GUS-Republiken wird, für den der Westen in jeder Hinsicht die Konditionen setzt.
Kredite, die noch der Union gewährt worden waren, wurden auf Rußland übertragen, ebenso die Zusage von Lebensmittellieferungen, bis schließlich auch die Ukraine nachgeben mußte und sich der Forderung nach einer gemeinsamen Garantie gebeugt hat. Nebenbei mußten sich die Russen eine weitere Lektion zu Gemüt führen. Sie hatten die Auffassung vertreten, eine von den Deutschen verlangte russische Staatsbürgschaft als Absicherung für die deutsche Hermesbürgschaft könnten und dürften sie gerade nach den Regeln marktwirtschaftlicher Moral, nach denen Staat und Privatwirtschaft zwei paar Stiefel sind, nicht zugestehen:
„ …weigert sich die russische Regierung, Direktgarantien für Geschäfte zwischen privaten deutschen und russischen Unternehmen zu geben, da dies die russische Verfassung verbiete.“ (HB 12.3.)
In der Frage mußten sie ihre Verfassung dann verraten. Auf die Weise haben die Weltmarktsmächte den neuen Staaten eine erste Einführung in die Marktwirtschaft erteilt: Bevor einer von ihnen daran denken kann, selbst gutes Geld zu verdienen, muß er sich 1. für den Dienst am Geld der Gläubiger und zwar auch für den der anderen verbürgen. 2. besteht der Unterschied zwischen Planwirtschaft und Marktwirtschaft nicht in der Bequemlichkeit, daß die Privatwirtschaft fürs Geldverdienen zuständig ist und der Staat davon nur abzusahnen braucht.
Der IWF als Freund und Helfer – Überführung unter die Aufsicht der Weltmarktsmächte
Auf die westlichen Forderungen eingelassen haben sich die GUS-Staaten, weil ihnen die Bedienung der alten Schulden als unerläßliche Bedingung für neue „Hilfe“ präsentiert worden ist, und diese Zusicherung verwechseln sie grundsätzlich mit einer Unterstützung für ihre Projekte. Das westliche Wohlwollen gegenüber ihrer Entschlossenheit, sich in den Weltmarkt einzugliedern, verwechseln sie mit einem Versprechen der imperialistischen Nationen, ihnen bei einem Wirtschaftsaufbau zur Seite zu stehen, der sie zumindest langfristig an das Niveau dieser Nationen heranführt. Auch wenn zwischenzeitlich schon öfters Enttäuschung über ein westliches „Zögern“ aufgekommen ist und darüber, daß sich die Herren Unternehmer nicht wie wild auf den sperrangelweit offenen Markt der GUS stürzen und ihr Gebiet mit Fabriken bepflastern, um die Aufrechterhaltung der Hoffnung hat sich der Westen, allen voran die BRD, gekümmert. Er hat seinerseits die Aufnahme in den IWF als eine weitere notwendige Vorbedingung für „Hilfe“ definiert und genehmigt. Dieser Schritt und die Zusage eines sogenannten „Stabilisierungsfonds“ für den Rubel sind in der GUS und der Weltöffentlichkeit einhellig als eine umwerfende Freundschafts- und Solidaritätsaktion gewürdigt worden, wie ein überdimensionales Päckchen-Schicken.
Die Aufnahme in den IWF wird wie eine Gnade angesehen, weil die Mitgliedschaft das Recht auf gewisse Kredite einschließt; Kredite sind allerdings entgegen der landläufigen Auffassung immer noch keine Geschenke, sondern müssen verzinst und zurückgezahlt werden. Die Pflicht, Weltgeld zu verdienen und woanders abzuliefern, die materielle Abhängigkeit der GUS vom Weltmarkt wird im Maß dieser großzügigen Kredite gesteigert. Auch die Vorstellung, die russische Regierung würde damit gutes Geld zu ihrer freien Verfügung erhalten, trifft nicht zu. Zweck und Bewegungsziel der Summen, aus denen sich die imposanten 24 Mrd $ zusammensetzen, werden gleich mitgeliefert: Zum ersten wird mit neuen Krediten der Zusammenbruch der Schuldenbedienung durch die GUS, die offizielle Feststellung ihrer Zahlungsunfähigkeit fürs erste verhindert. Die imperialistischen Staaten finanzieren also die Bedienung ihrer alten Schulden, versichern sich auf diese Weise dagegen, daß ihre alten Kredite für uneinbringlich erklärt werden und sich ihr Nationalkredit insoweit entwertet.
Zweitens finanzieren die imperialistischen Staaten mit ihren Krediten Gewinne ihrer Geschäftswelt, die Exporte der US-Farmer, der EG-Nahrungsmittelüberschüsse und die Option auf ostdeutschen Erfolg:
„Die G-7-Länder seien allein bereit, 12 bis 13 Mrd. für Exportbürgschaften und Nahrungsmittelkredite zur Verfügung zu stellen. Deutschland bringe die für dieses Jahr in Aussicht gestellten Hermes-Bürgschaften von 5 Mrd. ein.“ (HB 2.4.) „…1,1 Mrd. für den Kauf landwirtschaftlicher Produkte in den USA, 600 Mio für Rußland und 500 Mio für die anderen Republiken.“ (SZ 2.4.)
Drittens finanzieren sich die imperialistischen Staaten die Eingriffe bzw. Beschlagnahme von sowjetischen Machtmitteln, die sie aus dem Verkehr ziehen oder unter ihre Kontrolle bringen wollen:
„Ferner soll eine Ausweitung der Verwendungsmöglichkeiten der schon bewilligten 500 Mio $ für die Verbesserung der Sicherheit der Kernkraftwerke in der GUS, zur nuklearen Abrüstung und zur Konversion ehemaliger Rüstungsfabriken in zivile Produktionsstätten beschlossen werden.“ (HB 3.4.)
Zuguterletzt heißt die mit den Krediten verknüpfte Bedingung, daß sie nur dann bewilligt werden, wenn der mit dem IWF abgestimmte Weg der Reformen auch eingehalten wird. Mit der „jungen russischen Demokratie“, bei anderer Gelegenheit als kostbare Errungenschaft hochgelobt, wird in der Frage etwas rüde umgesprungen: Der russische Volksdeputiertenkongreß, der sich ein paar Tage darin ergangen hat, seiner Unzufriedenheit mit den Folgen der Reformpolitik Luft zu machen, wurde vom eigens angereisten US-Finanzminister Brady verwarnt, daß aus der Unzufriedenheit gefälligst keine Taten zu folgen hätten. Andernfalls würden die Kredite nicht genehmigt. Kredit erhält die neue russische Staatsmacht also nur, wenn sie ihre wirtschaftspolitische Souveränität, kaum daß sie da ist, an den IWF abtritt:
„Einvernehmen haben die G7 über einen Stabilisierungsfonds in Höhe von 6 Mrd für den russischen Rubel erzielt… an strikte Bedingungen gebunden. So müßten die Auflagen des IWF-Anpassungsprogramms nicht nur akzeptiert, sondern auch vollzogen werden…“ (HB 2.4.) „Milliarden-Signal soll Jelzin stützen… immer unter der Voraussetzung, daß das russische Parlament das vom IWF geforderte Reformprogramm Jelzins akzeptiert… Schon im Mai soll dann in Rußland das Einsparungskonzept, das „Anpassungsprogramm“ genannt wird, umgesetzt werden. Als Folge werden Preissteigerungen erwartet, weil zum angestrebten Abbau der Haushaltslöcher die staatlichen Subventionen gestrichen werden.“ (FR 2.4.)
Der sogenannte „Stabilisierungsfonds“ geht dabei durchaus auch auf das Bedürfnis der russischen Regierung bei ihrem Kampf um den Rubel ein: Deren Bemühen, daraus ein vorschriftsmäßiges nationales Zahlungsmittel zu machen, an dem einzig sich die Geschäfte zu bemessen und dem sie zu dienen haben, wendet sich schließlich auch gegen die überall in ihren Grenzen eingerissenen Geschäfte, die nur noch über Devisen vollzogen werden – von der Karstadt-Abteilung im Kaufhaus Gum bis zu den Warenbörsen. Im Sommer will die russische Regierung einen Ukas erlassen, der allen, auch ausländischen Geschäftssubjekten auf dem Boden der RFR den Rubel als verbindliches Zahlungsmittel vorschreibt. Damit dann nicht alle bisher in Devisen abgewickelten Geschäfte schlagartig erliegen, muß dieser Zwang auch mit einem Angebot versehen werden, einem Umtauschkurs von Rubel in Devisen, der die Fortsetzung der Geschäfte attraktiv macht. Aus eigenen Kräften kann die russische Regierung ein solches Angebot aber schon gar nicht bestreiten; erst nach der Zusage des „Stabilisierungfonds“ hat man sich überhaupt zugetraut, einen solchen Ukas anzukündigen. Andererseits aber ist jetzt schon abzusehen, daß die russische Geschäftswelt in ihrem Devisenbedarf und die ausländische Geschäftswelt in ihrem verständlichen Bemühungen, Rubelgewinne gegen die unsicheren Umstände ihrer Weiterverwendung abzusichern, diesen Fonds bald erschöpft haben werden. Dann stehen beide Seiten, die Regierung und ihre auswärtigen Betreuer, mit etwas anders gelagerten Interessen im Prinzip wieder vor derselben spannenden Frage, wie aus dem Rubel ein nationales Geld, aus den Überresten der Sowjetökonomie eine Geschäftssphäre zu machen geht.
Denn im Grunde ist der Name „Stabilisierungsfonds“, als handelte es sich beim Rubel um so etwas wie ein in der Konkurrenz geschwächtes Geld, ein Witz, was auch in den Kommentaren nach dem Motto „Faß ohne Boden“ vermerkt wird. Die Absicherung eines Rubel-Kurses, wenn bekanntermaßen die russische Ökonomie keine Grundlage für überhaupt einen Rubelkurs hergibt, so daß der tatsächliche Rubelkurs eine Angelegenheit der Taxifahrer ist; die Ausstattung der russischen Regierung mit einem Devisenfonds, um ein Umtauschverhältnis zu „stabilisieren“, bei dem der Umtausch immer nur einseitig, nämlich weg vom Rubel erfolgt, weil sich keine Geschäftswelt danach reißt, ihn zu verdienen; so etwas ist wirklich ein Faß ohne Boden. Daß die imperialistischen Staaten nun einfach Geld verschenken würden, ohne jeden Sinn und Zweck, ist aber auch nicht die Wahrheit. Mit dieser Kreditierung erobern sich die führenden kapitalistischen Staaten ihr Recht auf Kontrolle, der Anspruch auf eine politische und demnächst ökonomische Benützung der Nachfolgestaaten wird damit materiell untermauert. Wie eine solche Benützung allerdings aussehen könnte, was zu dem Zweck mit der GUS noch alles angestellt werden muß, ist eine ganz andere Frage.
Der IWF geht an diesen noch nie dagewesenen Fall – mit der Revolutionierung einer andersartigen Produktionsweise ist er bisher noch nie beauftragt worden – erst einmal wie an eines seiner Routineprojekte heran, wie auch bei den anderen ehemaligen RGW-Staaten. Mit Ratschlägen, wie er sie immer und überall erteilt: Kurspflege durch eine strenge Geldpolitik, Sparhaushalt, Kürzung von Defiziten usw. usf. Mit diesen Ratschlägen wird zwar eine Art Test veranstaltet, ein Test auf die Bereitwilligkeit der GUS-Staaten, sich den Regeln des Weltmarkts, bzw. dem Willen seiner Aufsichtsorgane zu unterwerfen. Daß diese Rezepte aber wenig verfangen, daß sie die Benützbarkeit dieser Staaten für westliche Geschäfte gar nicht herstellen, ist auch offenkundig.
V. Passiver Imperialismus statt „Kapitalismus in einem Lande“
Die Nachfolgestaaten der Sowjetunion haben einen Erfolg zu verzeichnen. Sie wollen, ganz im Sinn der Perestrojka, unbedingt heraus aus der weltpolitischen und weltwirtschaftlichen Isolation der alten Sowjetmacht, hinein in die vom Westen bestimmte Weltgemeinschaft. Normale, anerkannte, geschätzte, für den Westen nicht bedrohliche, in den Weltfrieden der Nato eingefügte, weltoffene, kooperative usw. Mitglieder der Staatenwelt wollen sie sein; nach all den Regeln, die in und zwischen den Heimatländern des „marktwirtschaftlich“-demokratischen Erfolgs gelten. Das haben sie geschafft.
Einen Mißerfolg müssen sie auch verbuchen. Befreit von den „Fesseln“ des ehemaligen sozialistischen Lagers, wollen sie ökonomisch und politisch aufleben, nationale Potenzen in ungeahntem Umfang entfalten, gefragte und erfolgreiche Partner der westlichen Mächte sein. Von ihrer Teilnahme am Weltmarkt und politischen Weltgeschehen, in dem die kapitalistischen Demokratien des Westens Regie führen, wollen sie national profitieren und besser, reicher, mächtiger dastehen als bisher im Rahmen der sowjetischen Union oder sogar, so Rußland, als bisher die Sowjetunion selbst. Das geht voll daneben.
Rußland und seine wichtigen Partner interpretieren dieses zwiespältige Ergebnis nach der Logik des „schon“ und „noch nicht“. Damit liegen sie falsch. Denn zwischen ihrem Erfolg und Mißerfolg besteht ein ursächlicher Zusammenhang. Sie tun alles, um sich einzufügen; der Westen tut alles, um sie einzufügen; und damit geht die Bedingung dafür, aus der Einfügung in die Weltwirtschaft und ihre Ordnung den erstrebten Nutzen zu ziehen, kaputt. Die Unabhängigen Staaten sind damit konfrontiert, daß die fertige Welt des Imperialismus nicht bloß keine gute Aufstiegsbedingung für neue ehrgeizige Nationen ist, sondern aus lauter nationalökonomischen Erfolgsbedingungen besteht, denen sie mit ihrem verhunzten sozialistischen Erbe nicht entfernt gewachsen sind, also lauter Mißerfolge verdanken. Sich diesen Bedingungen zu entziehen, um sich erst einmal die Mittel zu beschaffen, mit denen sie in der marktwirtschaftlich durchsortierten Welt von heute allenfalls eine nationalökonomische Erfolgschance hätten, das steht andererseits gar nicht auf dem Programm: Das würde den Erfolg, den sie verzeichnen, sofort zunichte machen.
Umgekehrt: Auf den Erfolg, den sie haben, müßten sie verzichten, um mit ihrem Ehrgeiz, mächtige Staaten mit einer florierenden „Marktwirtschaft“ zu werden, überhaupt eine Chance zu haben. Denn so ist es ja nicht, daß dort, wo Stalin den „Sozialismus in einem Land“ hochgezogen hat, die Errichtung eines schlagkräftigen Kapitalismus natur- oder sachnotwendigerweise scheitern müßte. Daneben geht dieses Programm dann, wenn es von vornherein auf den Weltmarkt und dessen Kreditüberbau und die Gunst anderer Staaten und auf die Tauglichkeit der mitgebrachten Eigenmittel für die ersehnte Sorte Weltgeschäft im eigenen Lande setzt, statt dem ökonomischen Weltgeschehen einen eigenen Kapitalismus entgegenzusetzen und weltmarkttaugliche Mittel erst einmal zu schaffen. Wenn die Regierungen also ihre Staaten allen Bedingungen, Gepflogenheiten, Vorschriften, Interessen, Erpressungen und berechnenden Angeboten der kapitalistischen Mächte unterwerfen, ohne über Mittel und Fähigkeiten zu verfügen, um daraus auch für sich etwas Gescheites zu machen – dann geht es eben so zu, wie es zugeht.
Denn andersherum: Ein kapitalistischer Neubeginn, wie die GUS-Partner ihn sich wünschen, geht überhaupt nur als Kapitalismus in einem Lande. Da muß die Staatsmacht schon dafür sorgen, daß für schlechterdings jedes Stück Ökonomie im Land ein Mittel entscheidend ist und ein Kommando gilt: die sachzwanghafte Kommandogewalt des Geldes, das sie stiftet – also weder alte Rubel noch neue Devisen noch irgendwelche Überreste realsozialistischer Lieferbeziehungen, weder Exportchancen noch Importbedürfnisse und schon gar nicht das Oberkommando auswärtiger Schuldendienstforderungen und des IWF. Die Staatsmacht kommt dann zweitens nicht umhin, dafür zu sorgen, daß die Kommandogewalt dieses Geldes und keines anderen als Privateigentum in die Hände einer Klasse gelangt – egal, wer sie bildet; warum nicht altbewährte Minister, Schwarzhändler und Mafiabosse? die ersten Kapitalisten waren auch keine anderen Charaktere! –, die sich damit fremde Arbeit aneignet, um sich zu bereichern. Die Staatsmacht hat also drittens sicherzustellen, daß der große Rest des Volkes zum Arbeitsdienst und zu sonst gar nichts antritt. In diesen drei entscheidenden Fragen ist der Kapitalismus auch in den ‚Unabhängigen Staaten‘ nichts anderes als das, was er überhaupt ist: eine vom Klassenstaat – und nichts anderes wollen die GUS-Partner schließlich sein! – entschiedene Machtfrage. Deswegen muß die kapitalistisch aufstrebende Staatsgewalt, wenn sie ihre Aufgabe kennt und lösen will, viertens und vor allem sich als die allein über alles verfügende Macht durchsetzen, nach innen und nach außen; mehr nicht, aber das muß der Haushalt, den sie sich gönnt, hergeben.
Hätten sich die letzten Sowjetreformer und ersten demokratischen Herrscher zu so einem Programm entschlossen – sie haben nicht, weil sie ja vor allem ihre Ausgrenzung aus der schönen Welt der kapitalistischen Ordnung aufheben und unter deren menschengemäße Natur und Kultur heimkehren wollen, deswegen findet die Probe aufs Exempel bis auf Weiteres nicht statt; aber eins ist klar: Hätten die nationalen Führer der GUS sich entschlossen, zuerst kapitalistischen Erfolg zu haben und dann als machtvolle Konkurrenz der etablierten „Großen Sieben“ zum friedlichen Waren- und Güter- und Schlageraustausch anzutreten, dann wäre im Westen sofort ein unendliches Geschrei über die unmenschliche Brutalität eines solchen „Experiments“, das Stalins Kulaken-Legen ja vielleicht wirklich weit in den Schatten stellen würde, angestimmt worden. Und zwar von denselben Zynikern der freien Marktwirtschaft, die die Anbahnung von Millionen Opfern im Osten im Zuge der neuen menschenrechtlichen Völkerfreundschaft als unumgängliche „Durststrecke“ begrüßen und ansonsten als Problem der „Flüchtlings-“ und „Migrationspolitik“ behandeln. Denn im Gegensatz zu dem Ruin, den die Führer der Sowjet-Erbengemeinschaft als weltoffenen Freunde des Westens in ihren Ländern anrichten, wäre ein solcher Staatsaufbau mit national-kapitalistischen Mitteln sofort als Kampfansage begriffen und aufgegriffen worden.
Und das mit gutem Grund. Eine Ausgrenzung aus seinem universellen Ordnungs- und Benutzungswillen findet der Freie Westen nämlich auf gar keinen Fall dann und ausgerechnet deswegen harmlos und verzeihlich, wenn und weil sie von national ehrgeizigen „Marktwirtschaftlern“ statt von Bolschewiken mit einer Idee vom „proletarischen Internationalismus“ betrieben wird. Eine solche Ausgrenzung, vorgenommen von Rußland und Partnern, wäre im Gegenteil um so schlimmer und erst recht unverzeihlich, weil ein „Rückfall“, wo der Westen doch längst mit dem Wegfall der großen Gegenmacht weltpolitisch und -ökonomisch wuchert.
Insofern ist der Mißerfolg, den die Nachfolgestaaten der Sowjetunion bei ihrem „marktwirtschaftlichen“ Aufbruch verbuchen, eine Machtfrage des höchsten Kalibers, die sie freilich weder stellen noch gestellt kriegen wollen, sondern von sich her aus der Welt zu schaffen wünschen. Jenseits ihrer Integration in die „eine Welt“ des Imperialismus, die ihren ganzen Erfolg ausmacht und an deren Bedingungen und Konsequenzen sie sich heillos abarbeiten, steht faktisch einiges an Weltmacht bereit – wie in alten Zeiten und, was das Kräfteverhältnis angeht, unvergleichlich mehr! –, um die richtige Programmwahl der GUS-Führungen zu garantieren, und das unabhängig von politischen Absichten und Aufbau-Rezepten, auf die sie von sich aus noch verfallen mögen. Dem Westen ist jedenfalls praktisch allemal klar, daß hinter den ökonomischen Sachzwängen, an denen Erben und Erbschaft der Sowjetunion kaputtgehen, in letzter Instanz kein Sachzwang steht, sondern als einziger Zwang derjenige, den er ausüben kann.
[1] Zu Erfolg und Ende der Perestrojka vgl. GegenStandpunkt 1-92, S.61: Die Selbstzerstörung einer Supermacht und ihre unheimliche Erbengemeinschaft