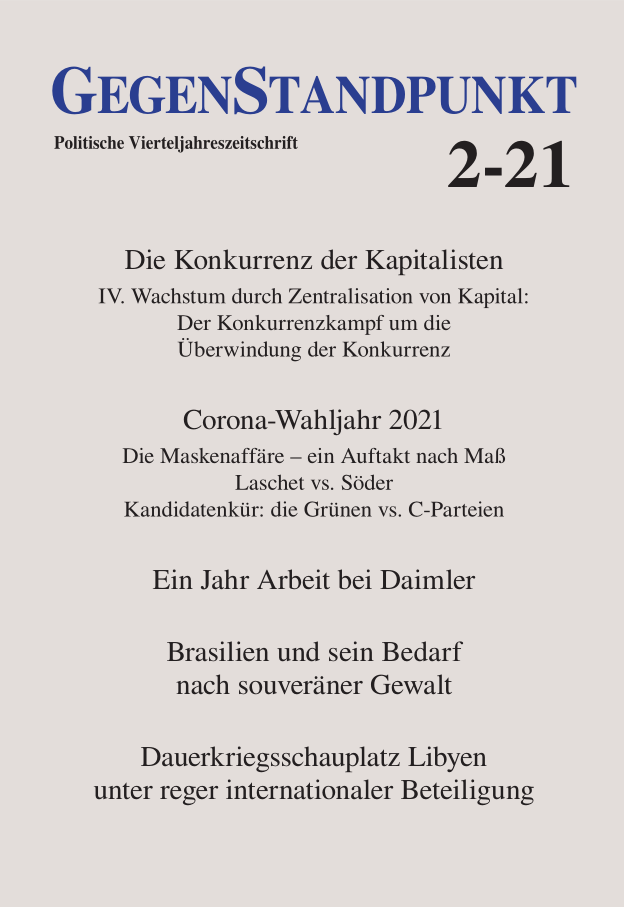Die Konkurrenz der Kapitalisten
Kapitel IV: Wachstum durch Zentralisation von Kapital: Der Konkurrenzkampf um die Überwindung der Konkurrenz
Der Machtkampf, den die Unternehmen unter- und gegeneinander führen, ist eigener Art. Er wird „Wettbewerb“ genannt, der auf „freien Märkten“ stattfindet, und gilt als Inbegriff wirtschaftlicher Effizienz und größtmöglicher Befriedigung von Bedürfnissen. Die Praxis sieht bekanntlich anders aus: In der wird viel Aufwand dafür getrieben, die lieben Mitbewerber so in die Enge zu treiben, dass sie möglichst vom freien Markt verschwinden. Dieser Kampf um die Enteignung freier Privateigentümer wird in der Fortsetzung unserer Abhandlung über die Konkurrenz der Kapitalisten erklärt: Wachstum durch Zentralisation von Kapital – der Konkurrenzkampf um die Überwindung der Konkurrenz. Dabei kommt sowohl die Rolle des Staates wie die des Finanzwesens zur Sprache, die dafür sorgen, dass der Kampf ums Monopol nicht das Ende, sondern der Alltag der kapitalistischen Konkurrenz ist.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Siehe auch
Systematischer Katalog
Gliederung
- § 19 Konzentration von Kapital in einer Hand
- 1. Größe des Kapitals: das Überlebensmittel eines Unternehmens, weil die Waffe, die andere von der Benutzung des Marktes und seiner Zahlungsfähigkeit ausschließt
- 2. Wachstum vor und statt Konkurrenz? Oder danach und ohne? Auf jeden Fall ist das Kapital anderer als Schranke ausgemacht, die wegmuss
- 3. „Kampf“ um Anlagesphären
- 4. Monopol – Expropriation
- § 20 Der Kampf um die Verfügung über den Markt
- § 21 Der Staat: Hüter eines Kapitalstandorts
- § 22 Die Verschmelzung von Kapital und Kredit
- 1. Um das Bedürfnis nach Kapitalgröße zu verfolgen, braucht es nicht nur wegen solchen staatlichen Zuspruchs keinen Kampf in dem Sinn. Der Kredit tut da bessere Dienste
- 2. Die Aktie und ihre Gesellschaft
- 3. Die Börse
- 4. Das Unternehmen als Spekulationsobjekt; die modernen Fusionen
- 5. Kein Ende der Konkurrenz, sondern Vor- und Zusatzveranstaltungen
- 6. Statt Verfügung über den Markt Gleichgültigkeit gegen ihn …
- 7. … Krise
Die Konkurrenz der Kapitalisten
Kapitel IV
Wachstum durch Zentralisation von Kapital: Der Konkurrenzkampf um die Überwindung der Konkurrenz
§ 19 Konzentration von Kapital in einer Hand
1. Größe des Kapitals: das Überlebensmittel eines Unternehmens, weil die Waffe, die andere von der Benutzung des Marktes und seiner Zahlungsfähigkeit ausschließt
Um in der Konkurrenz um Wachstum durch gesteigerte Kapitalproduktivität zu überleben, kommt es für den fortschrittlichen Unternehmer entscheidend auf die Größe seines Kapitals an. Sein Konkurrenzmittel ist eine Ausstattung der Arbeitsplätze in seinem1Betrieb, die die dort verrichtete Arbeit effektiver macht. Dabei geht es selbstverständlich nicht um mehr Leistung überhaupt, sondern um den Wirkungsgrad der bezahlten Arbeit. Arbeit wird als Kostenfaktor behandelt, von dessen Leistung als Produktionsfaktor – beides zusammen macht ihre Produktivität aus – die Rentabilität des Unternehmens abhängt. Die Verbesserung dieses Verhältnisses von Lohnsumme und Masse an verkäuflichem Produkt lässt der Kapitalist sich etwas kosten; er leistet sich kostspielige Investitionen, um die Arbeit als seine bezahlte Gewinnquelle ergiebiger zu machen. Dabei kommt es ihm nicht nur auf mehr Profit pro Arbeitskosten überhaupt, sondern darauf an, darin besser zu sein als die Konkurrenten. Das geht ins Geld. Mit der Konsequenz, dass die Steigerung der Rendite aufs gesamte Kapital, also das mit viel „technischem Fortschritt“ erwirtschaftete Wachstumspotential, hinter der gesteigerten Produktivkraft der Arbeit zurückbleibt.
Auf diese widersprüchliche Konsequenz treffen die Unternehmer am Markt für ihre Produkte, wo sich ihre Investitionen in produktivere Arbeit mit umso höheren Gewinnen bezahlt machen müssen. Die beanspruchte Zahlungsfähigkeit wächst ja nicht mit, wenn – und nur weil – die Unternehmer mit mehr Produkt pro bezahltem Entgelt eine höhere Rendite erzielen wollen. Mit der Verallgemeinerung des „Arbeit sparenden Fortschritts“ tritt vielmehr die entgegengesetzte Tendenz ein: Dass verminderte Lohnzahlungen „die Kaufkraft“ beschränken, merken nicht bloß die Gewerkschaften, die ausgerechnet das zum Argument für höhere Löhne machen wollen, was für die Unternehmer der ganze Zweck ihrer „Rationalisierungs“-Investitionen ist und insgesamt eine notwendige Wirkung des auch von den Gewerkschaften begrüßten allgemeinen „technischen Fortschritts“. Insgesamt nämlich stellen die Kapitalisten in ihrer Konkurrenz die allgemeine Geschäftsbedingung her, die ihnen mit jedem Erfolg das Geldverdienen zugleich schwerer macht: Mit ihrem Überlebenskampf um Preisvorteile bei der Ausbeutung des Faktors Arbeit nötigen sie einander dazu, mit gleichgerichteten Maßnahmen in ihren Betrieben den geltenden Marktpreis zu senken und so den Ertrag ihrer Fortschritte zu schmälern oder ganz zunichtezumachen. Auf die Art praktizieren sie den Konkurrenzkampf um die eben dadurch gesenkte Zahlungsfähigkeit des Marktes – und in der verschobenen Form den Widerspruch zwischen Arbeitsproduktivität und der damit vorangetriebenen und zugleich geminderten Kapitalproduktivität, den sie in ihren Betrieben ins Werk setzen.
Per Saldo wird das Konkurrieren immer teurer, der Erfolg immer fragwürdiger: Für das Wachstum, am Ende den Bestand des Unternehmens kommt alles darauf an, dass es groß genug ist, immer rechtzeitig genügend Vorschuss für Investitionen in effektivere Arbeitsplätze mobilisieren zu können; doch je kostspieliger die Investitionen, umso problematischer die Rate des damit zu erzielenden Wachstums. Gesichertes Überleben sieht anders aus.
Der Ausweg steht für Profis der kapitalistischen Konkurrenz aber auch schon fest. Für sie liegt der Grund der Notwendigkeit, immer wieder von Neuem und mit härteren Mitteln um den benötigten Ertrag ihrer teuren Fortschritte zu kämpfen, bei den Wettbewerbern, auf die sie und die auf sie ständig den entsprechenden Druck ausüben. Und dagegen ist es mit Investitionen in immer produktivere Arbeit nicht getan. Es gilt, die Sache zu einem Ende zu bringen, also explizit und entschieden zu betreiben, was ohnehin schon in der Konkurrenz um Wachstum durch überlegene Produktivität immer eingeschlossen und durchaus auch Absicht ist, nämlich die Wettbewerber auszuschalten, die mit ihren Aktionen und Reaktionen den wohlverdienten Nutzeffekt des Aufwands für Überlegenheit dauernd kaputtmachen. Die müssen so unter Druck gesetzt werden, dass sie keine Chance haben, mit den für sie erreichbaren Mitteln gesteigerter Kapitalproduktivität dagegenzuhalten. Dafür kommt es erst recht auf die Größe des Unternehmenskapitals an: nicht mehr bloß als Mittel, Konkurrenten mit Produktivitätsfortschritten zu konfrontieren, die sie zu teuren, für sie womöglich zu teuren Anpassungen an die neue Konkurrenzlage in Form eines abgesenkten Preisniveaus zwingen, sondern außerdem und in der Hauptsache als Waffe, ihnen den Zugriff auf die Zahlungsfähigkeit des Marktes überhaupt zu verwehren. Es braucht Investitionen in die Effektivierung, vor allem aber in die direkte Ausweitung des eigenen Produktionsbetriebs; und zwar in einer Größenordnung, die darauf berechnet ist, dass die stärksten Rivalen nicht mithalten können; in einem Umfang, der von vornherein auf die Okkupation der gesamten Zahlungsfähigkeit zielt, von der die Branche lebt. Verlangt ist der Aufbau von Überkapazitäten, mit denen das Unternehmen den Markt überschwemmt – was in Folge von Skaleneffekten die Bilanz sogar entlasten kann; aber davon darf die Massen-Offensive nicht abhängen. Entscheidend ist die allein von der Kapitalgröße abhängige Fähigkeit, auf eine Rendite, die den überdimensionierten Vorschuss lohnend machen würde, oder sogar ganz auf Gewinn zu verzichten; länger jedenfalls als Konkurrenten, die sich den Aufwand für einen ähnlich machtvollen Zugriff auf den Markt leisten müssten und nicht können. Gegebenenfalls muss das Unternehmen mit Kampfpreisen aufwarten, mit denen es Verluste macht, bis es seine Gegner zur Kapitulation oder in den Ruin getrieben hat; Verluste eben nicht als ungewollte Nebenwirkung eines zu groß geratenen Vorschusses, sondern strategisch geplant und eingesetzt, um Gegenspieler zu eliminieren und in der Folge den gesamten Gewinn abzuschöpfen, der an dem so umfassend bedienten Markt zu machen ist. Hinreichende Kapitalmacht vorausgesetzt, wird ein Minus in der Bilanz so fürs Wachstum produktiv. Wachstum allein durch die Macht der Kapitalgröße, per Ausschluss anderer vom Gewinnemachen, das funktioniert auch an anderen Fronten; etwa durch massive, gezielte Investitionen in den Ausbau der Fertigungstiefe des Produktionsbetriebs: Mit der Übernahme des Geschäfts von Zulieferern bis zurück zur Rohstoffgewinnung und von kommerziellen Abnehmern bis hin zum Endprodukt verdrängt das Unternehmen nach seinem Ermessen seine Geschäftspartner aus der Wertschöpfung in seinem Metier; es behandelt sie nur mehr als Gegner, die auf seine Kosten an dem Gewinn partizipieren, der aus dem Markt für seine Produkte herauszuholen ist, und eignet sich deren Umsatz und Profite an.
Chance und Gefahr dieses Überlebenskampfes sind in Gestalt so eigentümlicher, gar nicht im engeren Sinn ökonomischer Errungenschaften des Unternehmergeistes wie einer „Kriegskasse“ im Kalkül der Kapitalisten dauernd präsent: Manager bauen solche Reserven vorsorglich auf, um damit zu gegebener Zeit einen zielführenden Angriff oder bei Bedarf die nötige Abwehr zu finanzieren.
2. Wachstum vor und statt Konkurrenz? Oder danach und ohne? Auf jeden Fall ist das Kapital anderer als Schranke ausgemacht, die wegmuss
Was Kapitalisten in und mit ihrem Betrieb anstellen, um ihre Konkurrenten mit aller Macht aus dem Markt zu verdrängen und sich die Benutzung seiner Zahlungsfähigkeit exklusiv zu sichern, stellt die Logik des Wachstums, die sie befolgt und mit der sie es zu ihrer Kapitalmacht gebracht haben, auf den Kopf. Das Wachstum ihres produktiven Vermögens folgt nicht mehr dem und aus dem Konkurrenzerfolg, den sie, Stück um Stück, erzielen. Mit Art und Umfang ihrer Investitionen nehmen sie den Konkurrenzerfolg vorweg, der damit erreicht werden soll. In gewisser Weise ist das zwar immer der Fall; genau genommen schon beim Vorschuss von Kapital, der sich rentieren soll; ebenso dann, wenn erzielte Einnahmen in die Erweiterung des Betriebs gesteckt werden; erst recht, wenn der Kapitalist damit an die Schranken des Marktes stößt und die Steigerung der Produktivität zum Mittel der Konkurrenz um Umsatz und Gewinn macht. Aber jetzt steht etwas anderes an. Das alles garantiert ein dauerhaftes Wachstum und gesichertes Überleben ja nicht. Deswegen machen die Unternehmer, wenn ihr Kapital dafür groß genug ist, sich von dieser Art des Konkurrierens frei und leisten sich einen Vorgriff von anderer spekulativer Qualität, nämlich eben auf den definitiven, weil alleinigen Erfolg in der Bedienung des Marktes, also der Ausnutzung seiner Zahlungsfähigkeit: Sie bauen Kapazitäten auf, die den Konkurrenzvergleich als gewonnen voraussetzen, nämlich das Potential aller Wettbewerber überbieten; sie überschwemmen den Markt mit eigenen Waren, so als hätten sie sich schon gesichert, was der an Umsatz hergibt, um sich das zu sichern; sie verzichten auf Gewinn, leisten sich sogar Verluste in der selbstsicheren Erwartung, dass ihnen im Ergebnis aller Profit zufällt, um den sie schon immer konkurriert haben.
Die Kapitalisten folgen damit einem etwas widersprüchlichen, auf jeden Fall spekulativ sehr anspruchsvollen Rezept: Wachstum der Produktion vorauseilend zur Konkurrenz um deren Verkauf, um sich das – am Ende doch nie sicher zu gewinnende – Kräftemessen mit ihresgleichen zu ersparen. Oder dasselbe umgekehrt: Exklusive Okkupation des Marktes als Gesichtspunkt, Leitfaden und Kriterium der Ausweitung des produktiven Betriebs, also ohne sich an den Machenschaften, Strategien und Erfolgen seiner Konkurrenten zu orientieren. Konkurrenzlosigkeit ist der Standpunkt, mit dem sie ans Werk gehen.
Der Erfolg, um den es dem potenten Unternehmer dabei geht und auf den er setzt, indem er ihn voraussetzt, steht und fällt mit der Größe des Kapitals, das er dafür einzusetzen vermag. Die Masse des Betriebsvermögens nötigt und ermächtigt ihn, den Weg der Überwindung der Konkurrenz zu gehen, um weiter zu wachsen; sie ist das Mittel, dieses Ziel zu erreichen; mit ihrem zweckmäßigen Gebrauch wird sie auf die Probe gestellt, insofern aufs Spiel gesetzt. Damit wird ihre Zunahme durch Verdrängung von Konkurrenten, ihre Zweckbestimmung, zur Notwendigkeit. Dieser alternativlose Zweck wird mit jedem erledigten Konkurrenten, und nur so, eingelöst; der anmaßende Standpunkt der Konkurrenzlosigkeit wird in dem Maße wahr, wie andere Unternehmen aufgeben müssen. Entsprechend rücksichts- und bedingungslos wird er praktiziert: Mit ihm ist der Punkt erreicht, ab dem endgültig nicht mehr bestimmte Rivalen mit ihren Erfolgen und speziellen Initiativen zu überwinden sind, sondern jedes Kapital in fremder Hand, das sich überhaupt noch auf dem beanspruchten Markt herumtreibt, eine Störung ist, die wegmuss – nur logisch für ein Unternehmen, das in der Herrichtung seines Betriebs den totalen Markterfolg vorwegnimmt.
Der Radikalismus dieses Vorgehens ist der Endpunkt des Quidproquo, das überhaupt den Umgang der Kapitalisten mit der Schranke bestimmt, die sie mit dem Widerspruch zwischen gesteigerter Arbeitsproduktivität und damit bewerkstelligter Kapitalproduktivität selbst ihrem Wachstum setzen. Auf diese Schranke stoßen sie im Missverhältnis zwischen der von den Kapitalisten insgesamt geschaffenen allgemeinen Zahlungsfähigkeit und dem Anspruch, den die auf Wachstum programmierten Kapitalisten je für sich und gegeneinander darauf erheben; als Profis der Marktwirtschaft beziehen die sich darauf so, dass sie sich durch Konkurrenten beschränkt und herausgefordert sehen. So auch hier. Herausgefordert ist hier jedoch eben der im eigenen Betrieb schon handfest verwirklichte Standpunkt der Konkurrenzlosigkeit; das gibt diesem Gegensatz seine neue Qualität. Dass der Großunternehmer auf seinem Durchmarsch zum realen Gesamtkapitalisten seines Metiers immer mehr ganz unmittelbar auf die Grenze der Zahlungsfähigkeit stößt, die sein Markt überhaupt hergibt, macht das Wachstum seines Betriebs so definitiv unverträglich mit dem Kapital anderer.
Und das so abstrakt und prinzipiell, dass ihr immanenter Unvereinbarkeitsbeschluss sich nicht bloß gegen Wettbewerber im bisherigen eigenen Marktsegment richtet, sondern den Blick auf alle Sphären kapitalistischer Geschäftstätigkeit lenkt.
3. „Kampf“ um Anlagesphären
Für ein Wachstum durch Konzentration von Kapital in einer Hand sind besondere Gebrauchswerte, mit deren – gegebenenfalls zunehmend monopolisierter – Produktion ein Unternehmen groß und mächtig geworden ist, eine Wachstumsschranke; nicht mehr erprobtes Mittel für den kapitalistischen Zweck, sondern die unsachgemäße Verengung der Produktivkraft des Betriebsvermögens, ein Hindernis für deren angemessene Entfaltung. Der Kapitalist macht definitiv Ernst mit dem Grundsatz, der für sein Handeln von Beginn an bestimmend ist: dass Gebrauchswerte gleichgültige Vehikel für das Wachstum seines Kapitals und allein unter dem Gesichtspunkt von Interesse, also unbedingt austauschbar sind. Sein Kalkül geht daher auch nicht bloß, im Sinne einer jederzeit verfügbaren Option, über das angestammte Gewerbe hinaus. Es richtet sich unbedingt über alle Sektorengrenzen hinweg auf die kapitalistische Geschäftswelt insgesamt. Da wird ja überall, mit Produkten aller Art, gesellschaftliche Zahlungsfähigkeit okkupiert, die dem eigenen Wachstum zugutekommen könnte. Da betätigen sich nicht einfach gleichgesinnte Kollegen in anderen Geschäftsfeldern, sondern überall Konkurrenten, deren Gewinne als Abzug von dem Potential verbucht werden, das im Prinzip in der Reichweite des eigenen Vermögens liegt und für dessen Mehrung mit Beschlag zu belegen ist.
In dieser strategischen Sicht der Dinge stellt die ganze weite Welt kapitalistischer Geschäftstätigkeit sich dar als Vielzahl von Anlagesphären, die fürs eigene Wachstum zu funktionalisieren wären. Also steigen hinreichend große Unternehmen in ihnen bislang fremde Branchen ein. Nicht in der bescheidenen Absicht, sich auch da am Akkumulationsprozess zu beteiligen und im von geschäftstüchtigen Konkurrenten gesetzten Rahmen hochzuarbeiten, sondern mit der Macht und dem Willen, die Produktion insgesamt, branchenweit, zu übernehmen. Unabhängig davon, ob und inwieweit einem Unternehmen das gelingt: Erfolgreiche Kapitalisten verfolgen eine Wachstumsstrategie, die in letzter Instanz auf den Anspruch hinausläuft, ihr Regime über ganze Abteilungen des gesellschaftlichen Gesamtkapitals auszudehnen; gegen alle und zu Lasten aller anderen.
Dabei bescheiden sie sich nicht mit Investitionen in Geschäftssphären, die es schon gibt: Sie stiften neue. Teils werden sie selbst erfinderisch, teils nutzen sie aus, dass ihre Erfolge bei der monopolistischen Okkupation ganzer Branchen den Ehrgeiz aufstrebender Kapitalisten und geschäftstüchtiger Erfinder auf den Weg des Experimentierens mit neuen Gebrauchswerten und Produktionsmethoden verweisen: Unternehmen, die daraus entstehen, werden im Maße ihres – schon realisierten oder voraussichtlichen – Geschäftserfolgs zu Übernahmeobjekten und zum zusätzlichen Wachstumsmittel großer Konzerne. So beglücken tüchtige Kapitalisten die Menschheit immerzu mit neuen Sachen; die mächtigen Kollegen gründen die entsprechenden Produktionszweige samt Arbeitsplätzen und „Beschäftigung“, schaffen die dazugehörigen „Zukunftsmärkte“ und scheuen weder deren spekulativen Charakter noch die exorbitanten Kosten, die nötig sind, um etwas wirklich Neuartiges einzuführen und die Herstellung so komplett wie möglich in der Hand zu behalten; wozu im Übrigen nicht bloß einiger Entwicklungsaufwand gehört, sondern die rigide Abschottung der konzerneigenen Technologieabteilungen sowie, komplementär zum eigenen Dauerangriff auf fremde Betriebsgeheimnisse, die Abwehr feindlicher Industriespionage – teure Sumpfblüten des Überlebenskampfes fortschrittlicher Großkapitalisten. Firmen, die – sich – dank ihrer Größe das alles leisten können, bringen Produkte in die Welt, die den gesellschaftlichen Lebens- und Arbeitsprozess in entscheidenden Bereichen auf ein neues Gleis setzen, ohne dass das geplant oder von vornherein absehbar wäre. Sie führen stets von Neuem den praktischen Nachweis – und das noch viel handfester, als ihre Werbefritzen es auf ihre Art tun –, dass die menschliche Bedürfnisnatur das Produkt all der neuen, mit viel Pomp angepriesenen Bedarfsartikel wie der vielfältigen Anforderungen und Notwendigkeiten ist, denen sich die arbeitende Menschheit mit den Modifikationen im Herstellungsprozess dieser Artikel ausgesetzt sieht. Und sie bezeugen ebenso nachdrücklich, welcher Logik die Evolution hier folgt: Mit der Macht des in ihrer Hand konzentrierten Kapitals eröffnen potente Unternehmen nie dagewesene Gewerbe, deren Gründung im Nachhinein gerne als „Revolution“ gewürdigt wird, allein gemäß den Erfordernissen und im Rhythmus ihres Wachstums, mit dem sie periodisch an die Grenzen des zahlungsfähigen gesellschaftlichen Bedarfs stoßen. Die materielle Subsumtion von Arbeit und Leben der Gesellschaft unter die Bedürfnisse der Kapitalisten nimmt immer neue Gestalten an; aus keinem anderen Grund als dem, dass es dabei um nichts als schrankenloses Kapitalwachstum geht, und weil sie dank ihrer Kapitalgröße die Macht dazu haben, die bürgerliche Welt immer neu als Derivat ihres Kapitalwachstums entstehen zu lassen. Und zu keinem anderen Zweck und mit keinem anderen Resultat als dem, dass in der politökonomischen Hauptsache alles beim Alten bleibt, nämlich beim Wachstum des Kapitals über alle erreichten Grenzen hinaus und folglich auch bei der Notwendigkeit, immer neue Geschäftsfelder zu suchen und zu schaffen.
4. Monopol – Expropriation
Wenn Großunternehmen um das Regime über ganze Sektoren der gesellschaftlichen Produktion, herkömmliche und neu geschaffene, „kämpfen“, dann arbeiten sie an der Verwirklichung eines Ideals, das allen Kapitalisten vorschwebt, weil es ein Ideal der Konkurrenz überhaupt ist: am Monopol auf Profit. Sie betreiben ihr Wachstum direkt und strategisch gezielt gegen andere. Wachstum im Sinne der Mehrung des kapitalistischen Reichtums insgesamt kümmert dessen private Eigentümer sowieso nicht; in der Konkurrenz ums Monopol kommt ein Zuwachs entweder ganz und gar, in voller Größe, dem eigenen Unternehmen zu, oder er ist unerwünscht, weil und soweit er das Kapital anderer mehrt. Der Antagonismus, der die Wirtschaftstätigkeit der Kapitalisten von Beginn an bestimmt, die Unvereinbarkeit ihrer identischen Interessen, erreicht damit eine neue Stufe: Gemäß der Logik der politischen Ökonomie des produktiven Privateigentums, die sie praktizieren, geht es ihnen in und mit letzter Konsequenz um Enteignung. Zweck und zugleich Mittel zum Zweck ihres Wirtschaftens ist der Angriff auf das Eigentum, das ihren Konkurrenten als Existenzgrundlage dient.
Dieser Angriff ist so umfassend, dass er sich im Grunde gegen die Existenzgrundlage aller anderen, also der ganzen Klasse kapitalistisch wirtschaftender Eigentümer richtet. Deren gesetzlich geschütztes „Geschäftsmodell“: private Bereicherung durch immer produktiver gemachte Lohnarbeit, wollen die Größten im Endeffekt zu ihrem exklusiven Besitz machen. Und in jedem Schritt dahin betreiben sie die immer weitergehende Expropriation ihrer Klassengenossen: ein bemerkenswertes höchstes Stadium der Konkurrenz der Kapitalisten.
Mit einer Selbstaufhebung des Regimes des Privateigentums über Arbeit und materiellen Reichtum der Gesellschaft ist das nicht zu verwechseln. Den Großen des Gewerbes geht es um die Vollendung dieses Regimes, das sie mit ihrem Regime gleichsetzen. Dabei folgen sie einem eigenen Drehbuch, in dem neue Sitten des Umgangs der Kapitalisten miteinander beim Zugriff auf den Markt auf die marktwirtschaftliche Tagesordnung kommen (§ 20); in dem der Staat sich als Schutzherr des privaten Eigentums gegen die Macht der Expropriateure herausgefordert sieht (§ 21); in dem das kapitalistische Eigentum ganz neue Formen der Kombination von Konkurrenz und Kredit und sogar von Kollektivismus annimmt, neue – heutzutage ganz gewöhnliche – ökonomische Charaktere ihren Auftritt haben, das Wachstum in Episoden der Kapitalvernichtung umschlägt (§ 22) und in dem die politischen Machthaber Konjunktur und Globalisierung managen (§ 23).
§ 20 Der Kampf um die Verfügung über den Markt
Nichts geht über den freien Markt: Er bietet jedem tüchtigen Bürger mit Unternehmergeist Freiraum und Chancen; er sorgt von selbst für Effizienz und optimale Befriedigung aller Bedürfnisse – das gehört zum Selbstverständnis des marktwirtschaftlichen Systems. Und welcher aufgeklärte Kapitalist oder Manager wollte da widersprechen. Nur deren Praxis sieht ein wenig anders aus. Von gleichen Chancen halten sie jedenfalls nur solange etwas, wie sie sich davon bessere für ihr Geschäft erwarten; den Risiken des freien Wettbewerbs wirken sie nach Kräften mit Maßnahmen entgegen, die eine Korrektur – aus gegnerischer Sicht: eine Manipulation – des Marktgeschehens zu ihren Gunsten bezwecken. Kein Aktivist des Systems beugt sich dem Urteil des Marktes, bloß weil das irgendwie zu den Prinzipien der danach benannten Wirtschaftsweise gehört. Und das schon gleich nicht, wenn es einem Unternehmen darum geht, die auf Monopolisierung gewinnbringender Produktion programmierte Macht seines Betriebskapitals am Markt wirksam werden zu lassen. Denn:
1. Strategien der Überwindung der freien Konkurrenz
Im Kampf um Wachstum durch Übernahme und Einverleibung fremden Kapitals ist es mit dem Ausbau der hauseigenen Produktionskapazitäten und der Entwicklung zweckmäßiger Geschäftsverfahren nicht getan. Die Erweiterung des Betriebs in einem Umfang, der darauf berechnet ist, für Konkurrenten keinen Raum zu lassen, geht von vornherein Hand in Hand mit der Übernahme von Marktanteilen der Konkurrenz; und zwar nicht auf dem Weg der Durchsetzung eines gesenkten Verkaufspreises als neuen Marktpreis, der Wettbewerber ins Hintertreffen bringt – der Weg hat sich ja als zunehmend untauglich für eine Profitrate, die den wachsenden Kapitalaufwand rechtfertigt, erwiesen –, sondern vermittels direkter Eingriffe ins Marktgeschehen zu Lasten anderer. Zielsetzungen des Typs „Marktanteile sichern“, den „Marktzugang kontrollieren“, im Endeffekt „den Markt beherrschen“ werden bestimmend, um fremdes Kapital in den eigenen Besitzstand zu überführen.
Im marktwirtschaftlichen Alltag fängt so etwas an mit wackligen Bündnissen auch schon zwischen kleineren Unternehmen: mit Preisabsprachen, Kartellen, Abmachungen über die Aufteilung von Märkten, regional oder nach Produktarten. Solche Bündnisse sind – wie alle Assoziationen in der bürgerlichen Welt – so haltbar wie ihre Brauchbarkeit für den Zweck, Dritte auszuschalten. Wacklig sind sie, weil und solange sie auf dem eigennützigen Kalkül autonom handelnder Kontrahenten beruhen. Weiter in Richtung Kontrolle führen Zusammenschlüsse mit Kollegen; sei es per Fusion „auf Augenhöhe“, sei es per freundliche oder feindliche Übernahme, also per Aufkauf oder Kapitulation des andern. Unter dem Titel „Mergers & Acquisitions“ kennt der Erfindungsgeist der Kapitalisten hier verschiedene Wege zur Zentralisation des Kapitals über freie Marktbeziehungen. Im Erfolgsfall würdigt die Fachwelt das Ergebnis als „Bereinigung des Marktes“. Im Fall aufstrebender Jungunternehmer bietet sich ein Aufkauf vermittels wohlwollender Förderung an, bevor sich ein Rivale eine womöglich interessante Geschäftsidee wegschnappt. Und so weiter. Der Einrichtung von Marktverhältnissen ohne hinderliche Chancengleichheit für autonome Profitmacher dienen auch Erfindungen wie die vertikale Vernetzung von Unternehmen: Zusammenarbeit exklusiver Art mit Lieferanten und Abnehmern bis hin zur Einrichtung von Wertschöpfungsketten, die im besten Fall von der Selbständigkeit der Partner nichts übrig lassen. Auch das fängt gegebenenfalls mit wackligen Absprachen an; der Zusammenschluss in einem „vertikal integrierten“ Großbetrieb kann die abschließende, muss aber nicht einmal die beste Lösung sein. In jedem Fall sind solche Geschäftsbeziehungen eine Art und Weise, wie Firmen ihr Wachstum durch Konzentration von Kapital in ihrer Hand, am Ende per Ent- und Aneignung fremder Kapazitäten, markttechnisch bewerkstelligen; also im aggressiven Umgang mit ihresgleichen den Widerspruch auflösen, dass in ihrer Wachstumsstrategie die erreichte Größe ihres Kapitals sich als das Mittel bewähren soll, über sich selbst hinauszuwachsen.
Denn natürlich sind derartige Methoden, auf andere Marktteilnehmer loszugehen, keine Absage an die Techniken und kein Ersatz für die Bemühungen der Unternehmen, ihren Produktionsbetrieb so zu ertüchtigen und auszudehnen, dass anderen Firmen damit die Aussicht genommen wird, ihre selbständige Existenz zu behaupten. Sie beruhen vielmehr auf dem Vertrauen in die erprobten Ausbeutungs- und Geschäftsverfahren des Unternehmens, sind selber letztlich nur so viel wert wie die Potenz des Betriebs, mit der Masse und Produktivkraft seines Kapitals Geschäft zu monopolisieren. Sie sind aber unverzichtbare Mittel des über sich selbst hinauswachsenden Unternehmens, das in seinem Betrieb vergegenständlichte Kommando über Arbeit, Produktivkraft und produktiv nutzbare Ressourcen der Gesellschaft dem selbstgesetzten Wachstumsziel entsprechend ungehindert zur Wirkung zu bringen: nicht behindert durch autonome Konkurrenten; nicht gestört durch unberechenbare Effekte einer freien Konkurrenz. Ausgeschaltet wird die Anarchie des Marktes als Bewährungsprobe für die Strategie, mit Investitionen in die Erweiterung des eigenen Potentials Konkurrenten zu überfordern und auszuschalten, zu enteignen und sich einzuverleiben.
2. Beiträge des Handelsgewerbes zum Kampf um Kontrolle über den Markt
Die Unterwerfung des Marktes durch und unter die Macht des zentralisierten Kapitals vollzieht sich im Konkurrenzkampf der Firmen um Autonomie und Unterordnung; in den Strategien wechseln daher solche der mehr oder weniger freiwilligen Absprachen mit solchen der Erpressung und Ruinierung anderer nach Lage und Bedarf. Das Monopol bleibt da nicht ein fernes Ideal, sondern wird ernsthafter Gegenstand betrieblicher Umsatzplanung und Ziel der Konkurrenz. In der mischen neben anderen Produzenten natürlich auch die Großen des Kaufmannsstandes mit. Die ersteren arbeiten daran, mit allen Mitteln machtvoller Einflussnahme Lieferanten und Kunden von sich abhängig zu machen, ihrem Kommando zu unterwerfen, Produktion und Handel unter ihrer Regie zusammenzuschließen und Wettbewerber auszumanövrieren; letztere sind längst aus der Position der Dienstbarkeit fürs Geschäft der Industriellen herausgetreten und ihrerseits aktiv dabei, von ihrer Seite her die Trennung zwischen Warenproduktion und -zirkulation aufzuheben. Hersteller machen sie von den Vermittlungsdiensten abhängig, die sie mit zunehmender Reichweite und Perfektion, mittlerweile intensiv und extensiv auf immer höherer Stufe über das Internet anbieten. Sie führen Regie über ganze Produktionszweige. Und aus der Herstellung integrierter Wertschöpfungsketten lassen die sich auch nicht einfach verdrängen: Die führenden Unternehmen der Branche entwickeln mit wachsender Größe das Interesse und die Fähigkeit, sich über die bloße Organisation von Handelsgeschäften hinaus mit Software-„Lösungen“ in die Bürokratie wie in die Steuerung von Produktionsprozessen ihrer Firmenkunden einzuschalten.
Ganz entscheidende Beiträge leistet das Handelsgewerbe da, wo es darum geht, beim Endverkauf an den Endverbraucher das gewaltig störende Element der Unberechenbarkeit auszuschalten. An dem großen Vorhaben, im Interesse eines gesicherten Zugriffs auf Zahlungsfähigkeit mittels Werbung das Ideal der Manipulation wahr zu machen, arbeitet es sowieso. Hier haben Telekommunikationsunternehmen, die Fabrikanten vielseitig nutzbarer Taschencomputer, Internetbetreiber und in führender Funktion die als „soziale Medien“ bekannten, im Privatleben des modernen Smartphone-Benutzers allgegenwärtigen Reklamekonzerne einen entscheidenden Durchbruch zuwege gebracht. Es ist ihnen gelungen, einen derart allumfassenden, flächendeckenden, rund um die Uhr aktiven, dabei mit quasipersönlicher Ansprache an den Endverbraucher operierenden Vermittlungsdienst zwischen Warenangebot und Zahlungsfähigkeit zu etablieren, dass praktisch kein Unternehmer, der was auch immer an die Allgemeinheit zu verkaufen hat, ohne kostenpflichtige Benutzung dieser Funktion auskommt. In der Tradition von Handelsketten, die selber zuliefernde Produktionsfirmen in die Welt setzen, vernetzen kapitalstarke Dienstleister vom Endpunkt des kapitalistischen Geschäftsprozesses her große Teile von Handel und Produktion unter ihrer Regie. Dieselben und eine Handvoll anderer Konzerne arbeiten darauf hin, über den Verkaufsakt hinaus den Verbrauch selbst zum Objekt einer verkäuflichen Dienstleistung zu machen und darüber die Willkür des Endkunden als letztes Unsicherheitselement in der Verfügung über dessen Kaufkraft zurückzudrängen. Gemeinsam mit kapitalkräftigen Spekulanten, die darauf setzen, versprechen sie eine weitere der technologischen „Revolutionen“, mit denen die kapitalistische Industrie in ihrem Kampf um ein stets von Neuem entschränktes Wachstum die gewohnte Lebens- und Arbeitswelt nach Strich und Faden umstülpt, damit mit der Kapitalverwertung alles so weitergeht wie immer.
3. Hoheit, ungestört, über den Preis der Arbeit
In der Konkurrenz der Kapitalisten um Kontrolle über den Markt entstehen und vergehen gemeinsame Fronten gegen Dritte. Derselbe Fanatismus der Befreiung von allen unverfügbaren Geschäftsbedingungen, der da am Werk ist, führt im Verhältnis der besitzenden zur lohnabhängigen Klasse zu standfester Einheit. Hier haben die Kapitalisten es mit einem bleibenden gegnerischen Interesse zu tun; an der Front sind und bleiben sie sich im Grundsatz einig, stellen ihre Gegensätze hinter dem gemeinsamen Anspruch auf optimale Ausbeutungsverhältnisse zurück. Großunternehmen, deren Wachstumsinteresse und -strategie über das angestammte Metier hinaus auf alle Geschäftszweige zielen, beziehen die Lohn-Leistungs-Verhältnisse in allen Branchen direkt auf sich; da kalkulieren und agieren sie tatsächlich als Sachwalter des gesellschaftlichen Gesamtkapitals.
Mit diesem Anspruch auf Hoheit über den Marktpreis der Arbeit in der ganzen Nation und die Arbeitszeiten in allen Abteilungen des kapitalistischen Geschäfts treffen die Arbeitgeber auf ein Gegenüber, das sie sich wirklich nicht bestellt, für das sie aber mit ihren Strategien der Lohndrückerei und der permanent gesteigerten Arbeits- als Mittel der Kapitalproduktivität alle Gründe geschaffen haben: auf Gewerkschaften, die das defensive Interesse der Arbeiterschaft an ausreichendem Gelderwerb zu erträglichen Bedingungen vertreten. Dieses Interesse kommt bei der Ableistung der festgelegten Arbeitspflicht im Betrieb, unter dem Regime des Betriebseigentümers, unter die Räder. Die Betroffenen kommen daher nicht darum herum, daneben, als freie Markt-, nämlich Arbeitsmarktteilnehmer, die den Kapitalisten als Vertragspartner gegenübertreten, einen Streit um ihr Auskommen zu führen. Die Erfahrung ihrer individuellen Ohnmacht bringt sie – oder wenigstens eine respektable Minderheit der Klasse – zur Einsicht in die Notwendigkeit, ihre Konkurrenz untereinander zu suspendieren, als Kollektiv zu handeln und die Bedingungen ihrer Verfügbarkeit zum Verhandlungsgegenstand zu machen. Um von ihren Kontrahenten in diesem Sinn ernst genommen zu werden, brauchen sie eine Gegenmacht gegen die Kommandogewalt der Betriebsherren. Die ist nur da herzustellen, wo sie gebraucht werden, im Betrieb; durch Verweigerung der Arbeit, für die sie bezahlt werden, also mit dem paradoxen Mittel, den eigenen Gelderwerb – immerhin die eigene Existenzgrundlage – zu unterbrechen, um den Arbeitgeber zu Zugeständnissen zu nötigen: durch Arbeitskampf. Auf Arbeiterseite braucht es dafür nicht bloß die Tugend der Solidarität, sondern eine dauerhafte, von den Mitgliedern finanzierte Organisation, die Arbeitsverweigerung als Kampfform einführt, Streikziele festlegt, den Kampf leitet, den Lohnausfall mit vorweg eingesammelten Beiträgen kompensiert und die den Gegenangriffen der Arbeitgeber mit Streikbrechern, Aussperrung usw. standhält.
Und die auch wieder über die Einstellung des Kampfes entscheidet. Denn in dem Machtkampf, den die beiden Seiten sich liefern, stehen zwar unvereinbare Existenzinteressen gegeneinander; aber in der Hinsicht wird er ziemlich asymmetrisch ausgetragen. Die eine Seite streitet im Interesse ihrer Bereicherung um den ungehinderten Gebrauch ihrer Macht über die gesellschaftliche Arbeit. Die gewerkschaftlich organisierten Arbeiter sistieren vereinbarte Dienste, kündigen aber nicht ihre Dienstbarkeit. Mit Streiks setzen sie ihren Lebensunterhalt aufs Spiel, kämpfen aber nicht gegen ihre abhängige Lage, den Grund der Notwendigkeit ihrer Gegenwehr, sondern um Korrekturen an den Modalitäten ihrer Lohnarbeit: um Kollektivverträge für die Lohnabhängigen einer Branche, einer Berufssparte, bisweilen auch eines einzelnen Unternehmens. In dem Rahmen finden ihre gegebenenfalls nötigen Kampfaktionen statt, womit auch schon deren Reichweite definiert ist. So findet die im Willen zur Kontrolle des Arbeitsmarkts geeinte Kapitalistenklasse in den Gewerkschaften – die zudem von der Staatsgewalt auf ihren Daseinszweck als systemgemäße Kampforganisation festgelegt sind – am Ende zuverlässig einen Kontraktpartner für ihr Bedürfnis nach Marktbedingungen für den „Faktor Arbeit“, die dessen Produktivität sichern und immer wieder erhöhen.
Letzteres gilt in besonderer Weise für Großunternehmen, denen die Bereinigung des Marktes durch Eliminierung kleinerer Firmen, gegebenenfalls ihre Integration in den eigenen Konzern, oder ein Zusammenschluss mit einem Rivalen gelingt. Da wird regelmäßig unter der Rubrik ‚Synergieeffekte‘ die Entlassung einer Menge schlagartig und wie von selbst überflüssig gewordenen Personals fällig, was direkt sowie mittelfristig über eine verschärfte, als Arbeitsplatzkonkurrenz durchgezogene Auslese die Lohnbilanz entlastet; die Versorgung des Arbeitsmarkts mit zusätzlichen Arbeitslosen trägt zur Macht der Arbeitgeber über den Preis der Arbeit insgesamt bei.
Der Segen hat freilich seine Kehrseite:
4. Die exklusive Sicherung des Marktes, die man haben will, ist das nicht
Die Einsparung von Lohnkosten – durch Solidarität der Kapitalisten gegen eventuelle Arbeitskämpfe ihrer „Mitarbeiter“, durch die Eliminierung konkurrierender Firmen mitsamt ihrer womöglich unrentabel überbezahlten Belegschaft, durch die quasi automatischen Spareffekte der Zentralisation von Kapital in einer Hand, durch die wachsende Macht der Größten, den technischen Fortschritt in der Ausbeutung des Faktors Arbeit voranzutreiben ... – mindert die beanspruchte und benötigte allgemeine Zahlungsfähigkeit, führt also immer wieder zurück zu dem Widerspruch zwischen Größe und Rendite des Kapitals, der in Form von Absatzproblemen das Unternehmenswachstum bremst. Monopole, wo sie wenigstens näherungsweise erreicht werden, ermächtigen die erfolgreichen Unternehmen zum Zugriff auf Gewinne, die zuvor von anderen verdient worden sind; der Gewinn selbst, auf den das Unternehmen zugreifen kann, wächst aber nicht mit, wird auch durch Monopolpreise allenfalls so umverteilt, dass der Einstieg in einen verschärften Wettbewerb darum für andere Konzerne umso attraktiver wird; und sein Verhältnis zum vergrößerten Kapital, dem er zufällt, wird nicht besser. Das gilt auch für die Eröffnung neuer Geschäftssphären, zu der die von anderen angeeignete Größe ein Unternehmen womöglich befähigt. Es reproduziert so auf immer höherer Stufe den Widerspruch, der in seinem Wachstumserfolg steckt, nämlich zwischen geschaffener und beanspruchter gesellschaftlicher Zahlungsfähigkeit.
Der hat eben nicht da seinen Grund, wo die Kapitalisten ihn unerbittlich bekämpfen: in der Vielzahl konkurrierender Ansprüche auf die Zahlungsfähigkeit des Marktes. Gerade wenn erfolgreiche Großunternehmen auf dem Weg vorankommen, wenn es ihnen gelingt, das Marktgeschehen auf ihren Absatz- und Profitbedarf hin zu organisieren, dann machen sich die Grenzen der gesellschaftlichen Zahlungsfähigkeit selbst als Schranke für ihren weiteren Geschäftsgang geltend – und darin der politökonomische Grund: der Widerspruch der kapitalistischen Gleichsetzung von Arbeitsproduktivität und Kapitalproduktivität. Was für die engagierten Kapitalisten daraus folgt, steht aber schon fest: Umso mehr bemühen sie sich mit ihren Methoden der Beherrschung des Marktes, der Zentralisierung der um ihn konkurrierenden Kapitale, der Monopolisierung von Kaufkraft und Gewinn darum, diese Schranke unbedingt und endgültig hinter sich zu lassen. Deswegen räumen sie mit Wettbewerbern auf und die Besitzverhältnisse in ihrer Klasse permanent um – und bringen es zu einer entsprechend erbitterten Konkurrenz mit ihren Rivalen und mit denen gemeinsam zu einer permanenten Überforderung des Marktes, die immer wieder unter ihresgleichen Opfer fordert.
Zur gesicherten Verfügung über den Markt, so wie sie ihn wollen und brauchen, bringen sie es jedenfalls nicht. Stattdessen findet sich der Staat als Ordnungsmacht herausgefordert.
§ 21 Der Staat: Hüter eines Kapitalstandorts
Im Innern
1. Der Einspruch des Staats gegen Kartelle, Monopolbildung und dergleichen: Grundsätze und Praxis
Mit ihren Bemühungen um Überwindung der Abhängigkeit ihres Wachstums vom unberechenbaren Gang der Konkurrenz, um Beherrschung des Marktes, treffen die großen Kapitalisten auf ihrem Weg zum Monopol auf den Widerstand des bürgerlichen Staates. Die Instanz, die mit ihrer Macht über die Gesellschaft alles fürs Wachstum der kapitalistischen Geschäfte tut, von deren Erfolg sie lebt, die höchste Gewalt, die die marktwirtschaftliche Freiheit garantiert, setzt deren Gebrauch durch die Größten und Erfolgreichsten administrative und politische Grenzen und folgt dabei gar nicht der gewohnten Regel, dass der Erfolg letztlich doch Recht bekommt und die Interessen der Größten, also der wichtigsten Leistungsträger der Wirtschaft das gemeine Wohl definieren: Der Rechtsstaat verbietet Kartelle und Preisabsprachen, stellt Unternehmenszusammenschlüsse unter seinen Vorbehalt, duldet eine „marktbeherrschende Stellung“ großer Firmen nicht und geht mit eigenen Behörden, Kontrollorganen, Gerichtsinstanzen etc. dagegen vor.
Dabei folgt er einer Generallinie, die von einem ziemlich grundsätzlichen Misstrauen gegen seine um Fortschritt und Wachstum bemühten Unternehmer zeugt: Aufgabe des Kartellrechts ist es ... die missbräuchliche Ausnutzung von Marktmacht zu verhindern
; Zusammenschlüsse von Firmen dürfen nicht sein, wenn den beteiligten Unternehmen durch den Zusammenschluss ein wettbewerblich nicht mehr ausreichend kontrollierter Verhaltensspielraum zuwächst. Ein Unternehmen könnte dann seine Preise erhöhen, die Produktqualität vermindern, Innovationen einschränken oder auf andere Weise sein Angebot verschlechtern, ohne Gefahr zu laufen, Kunden zu verlieren
; also lautet § 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen: Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken, sind verboten.
Über den Eigennutz als Triebfeder seiner Ökonomie macht der staatliche Hüter der Marktwirtschaft sich nichts vor; auch nicht über dessen ungute Wirkungen. Und er sieht darin kein moralisches Problem, dem mit Appellen im Namen der Ideale der Konkurrenz beizukommen wäre, sondern eine echte Gefahr; für das nämlich, was derselbe Eigennutz aus seiner Sicht unweigerlich an Gutem hervorbringt, wenn er sich wettbewerblich kontrolliert
betätigt; wofür der freigegebene Wettbewerb aber gar nicht reicht, sondern eben machtvolle staatliche Aufsicht nötig ist. Klar bekennt sich der freiheitliche Rechtsstaat zur Konkurrenz als einem Zwangsregime, das er über seine freien Rechtssubjekte verhängt, und zwar speziell über die, denen er die Wirtschaft in seinem Land anvertraut und die ihre Gründe dafür haben, ihr Gegeneinander auf dem Markt zu stornieren und gemeinsame Sache zu machen. Ausgerechnet den größten und erfolgreichsten Wachstumsbringern seiner Nationalökonomie fährt er damit in die Parade; und er nimmt seinen rechtlichen Generalvorbehalt auch dann nicht wirklich zurück, wenn er in einem zweiten Durchgang dann doch Verständnis zeigt für die Anforderungen des Überlebenskampfes, den die kapitalistischen Konkurrenten einander liefern: Zusammenschlüsse zwischen Unternehmen sind grundsätzlich erlaubt und als Ergebnis einer freiheitlichen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung auch erwünscht. Unternehmen können so ihre Geschäftsfelder neu ausrichten oder ihr Innovationspotential erhöhen und damit den Wettbewerb beleben
. Ebendas, was hier als Möglichkeit angesprochen wird, ist die Bedingung für genehmigungsfähige Fusionen.
Mit seinem gesetzlichen Konkurrenzgebot verpflichtet der Staat die Unternehmer also nicht überhaupt aufs Konkurrieren, sondern darauf, in der richtigen Weise, nämlich mit der Waffe der permanent gesteigerten Kapitalproduktivität – mit Innovationen
– am Markt gegeneinander loszuziehen. So bekräftigt er, ausgerechnet entgegen den Kalkulationen der größten Kapitalisten, die kapitalistische Räson, auf die er seine Gesellschaft festgelegt hat: den harten Produktivitätsvergleich der konkurrierenden Kapitale als Grundlage und entscheidendes Mittel des ökonomischen Erfolgs. Der darf nicht außer Kraft gesetzt werden; das ist der erste, prinzipielle Gehalt des kritischen Wettbewerbsidealismus, den der Staat hier praktiziert. Verhindern will er damit – zweitens – durchaus auch, dass die Macht des großen Geldes am Ende auch solche Betriebe kaputtmacht, deren Geschäfte eigentlich, rein nach den Maßstäben der Profitmacherei, noch ganz gut laufen und das Ihre zum allgemeinen Wachstum im Land beitragen. So indirekt bezieht er sich, in der Sache, auf den Widerspruch, dass in der Konkurrenz der Großen gegen die Kleineren, bei denen deren Überleben auf dem Spiel steht, das mit Übermacht erzwungene Wachstum einiger Weniger auf Kosten des Wirtschaftswachstums insgesamt geht, an dem ihm doch gelegen ist. Und ganz grundsätzlich besteht der Rechtsstaat – drittens – darauf, dass die berechnend auszunutzenden Bedingungen des Markterfolgs durch ihn gesetzt werden und nicht durch Konzerne oder Verabredungen von Privatfirmen, die sich mit der Macht ihres Reichtums ihre eigenen Regeln schnitzen; das ist er als eifersüchtiger Gewaltmonopolist und souveräner Regelsetzer sich selber schuldig.
Die tüchtigsten Unternehmen finden sich also mit einem Einspruch der höchsten Gewalt gegen ihre ultimativen Wachstumsstrategien konfrontiert; Verstöße dagegen werden bestraft; wenn keine Lizenz nachfolgt, kosten sie Geld, womöglich sogar eine ganze Menge. Diese sensationelle Reaktion der politischen Gewalt reicht freilich nicht so weit, den Kapitalisten ihren Beruf zu verleiden. Die haben sich daran gewöhnt, mit einem Kartellgesetz und seinen Ausnahmen zu leben. Sie sind geübt darin, auszutesten, wo und wann und bei wem Verbote greifen; das Ausbleiben prompter Sanktionen nehmen sie als Erlaubnis und jede Gesetzeslücke als Ermächtigung. Wenn dann Manöver wie der Kauf von Firmen einzig zum Zweck ihrer Ausschlachtung und Lahmlegung als Übergriff von „Heuschrecken“ politisch geächtet werden, ist das im doppelten Sinn eine Ermunterung: Erstens ist Beschimpfung kein Verbot; und zweitens ist damit alles, was diesseits der Grenze zum politisch Unerwünschten liegt, als zum Repertoire des ehrlichen Kaufmanns gehörig anerkannt.
Großunternehmen nehmen auch überhaupt nicht Abstand davon, von dem Staat, der den Gebrauch ihrer Macht so streng zu kontrollieren verspricht, Unterstützung, auch in Form von massiven Vorleistungen, für das Wachstum ihres Betriebs in neue Größenordnungen zu fordern und Monopole anzustreben. Ihr begieriger Blick richtet sich da gern auf Bereiche der Versorgung der Gesellschaft, die wegen ihrer Wichtigkeit und Größe und unter den Bedingungen unzureichender Potenz oder mangelnden Interesses privater Kapitale von der öffentlichen Hand übernommen worden sind. Da erinnern sie die politisch Verantwortlichen nachdrücklich an die geltende Staatsräson, die die Wirtschaft den privaten Geldbesitzern überantwortet, erklären den Staat und seine Beamten pauschal zu schlechten Unternehmern, bestehen auf der Freigabe sozialistisch monopolisierter Geschäfte für die Konkurrenz, um das Gemeinwesen von der Last solcher Betriebe durch deren möglichst vollständige Übernahme zu befreien; was freilich nicht geht, ohne dass der Fiskus abschließend alle Verbindlichkeiten übernimmt, die in der Vergangenheit aufgelaufen sind. Hinsichtlich der „vertikalen Vernetzung“, mit der sie das Kommando über zuliefernde und weiterverarbeitende Betriebe zu übernehmen suchen, verlangen die großen Interessenten vom Staat die Bereitstellung materieller Infrastruktur, am besten in Form der Finanzierung des monopolistischen Geschäfts damit, und die Subventionierung ihres Aufwands für die Einrichtung von „Clouds“, die Entwicklung „künstlicher Intelligenz“ und dergleichen, weil sich der Fortschritt, mit dem sie sich da neue Wachstumsfelder erschließen, für einen modernen Industriestandort ganz einfach gehört. Gleiches gilt für alle „Zukunftsmärkte“, die von Wachstumssorgen gequälte Konzerne für sich entdecken; speziell für solche, deren Zukunft noch so weit weg liegt, dass ihre Eroberung eine Anschubfinanzierung durch staatliche Fonds gut gebrauchen kann. Und so weiter.
Nicht erst in dem Zusammenhang entdecken kapitalistische Unternehmer ihren Bedarf an einer noch ganz anderen Art des solidarischen Zusammenschlusses mit ihresgleichen, nämlich zum Verband oder zu einer Vereinigung, die nicht als Kartell auf den Markt, sondern als Lobby auf die Politik einwirkt. Denn wenn schon die Gestaltung der Bedingungen der Konkurrenz Sache der Obrigkeit ist und solange und soweit sie das bleibt, muss das Bemühen um die Überwindung des Zwangs zum freiheitlichen Wettbewerb eben auch diesen Weg gehen. Dies umso mehr, als hier in ganz vielen Fragen keineswegs die ganze Klasse in einem Boot sitzt, sondern – es herrscht schließlich Konkurrenz – Mächtegruppen, zu gesellschaftlichen Blöcken vereinigte Fraktionen des nationalen Unternehmertums mit durchaus gegensätzlichen Interessen zum Kampf um Einfluss antreten. Nicht zuletzt der „Mittelstand“ – das ist die vom Kommando über nennenswerte Stücke des gesellschaftlichen Kapitals weit entfernte Masse der kapitalistischen Produzenten und Kaufleute des Landes – bedarf dringend staatlicher Unterstützung, materiell sowie hinsichtlich lästiger wie förderlicher Regeln des fairen Wettbewerbs. Politisch überzeugend wirkt natürlich auch hier vor allem die aus der Größe des Kapitals folgende Macht – über Arbeitsplätze, national wichtige Wertschöpfungsketten oder überhaupt die Zukunft des Standorts...
Letztlich lässt sich der Rechtsstaat natürlich nicht erpressen; schon gar nicht in von ihm als solche definierten Machtfragen. Aber warum sollte das auch nötig sein? Die kollektive Interessenvertretung von Teilen oder auch einer Gesamtheit des nationalen Unternehmertums lässt er zu und nimmt er so wichtig, dass er mit einer leicht restriktiven Rechtsordnung für Lobbyarbeit deren Tätigkeit legitimiert; demokratische Regierungen finden es durchaus ganz hilfreich, wenn die Vertreter kapitalistischer Sonder- und Gesamtinteressen ihnen für die Formulierung von Vorschriften zur Geschäftsmaterie ihre Expertise und passende Textbausteine anbieten. Seine Hoheit wahrt der Rechtsstaat allemal hinreichend mit dem Verbot, seine Amtsträger zu bestechen, denen ihrerseits Bestechlichkeit untersagt ist. Über die unausbleiblichen Verfehlungen wacht nicht nur die dritte, sondern besonders gern die investigative Abteilung der vierten Gewalt im Staat.
2. Lizenz für den Machtkampf zwischen den Klassen
Eine deutlich härtere Zumutung als das Wettbewerbsrecht, dessen Fairnessregeln sich für Teile einer nationalen Unternehmerschaft immer wieder günstig auswirken, ist für kapitalistische Arbeitgeber die Lizenz, die der moderne Rechtsstaat den Gewerkschaften erteilt. Hier ist die Klasse der Firmenbesitzer und -manager insgesamt betroffen; und betroffen ist sie in der Weise, dass die Staatsgewalt sie im Stich lässt, wenn Arbeiter kollektiv die Erfüllung vereinbarter Arbeitspflichten verweigern. Ihnen wird erlaubt, mit einem Rechtsbruch die Ausbeutung des Faktors Arbeit im Betrieb lahmzulegen, um ihre Chefs zu Zugeständnissen in der Lohnfrage zu erpressen. Auf den Schutz ihres Eigentums an den Produktionsmitteln können die Kapitalisten sich zwar verlassen; irgendetwas davon kaputtmachen oder sich aneignen dürfen streikende Arbeiter nicht – das wäre ja auch noch schöner! –; auch müssen sie Streikbrecher gewähren lassen. Den gesellschaftlichen Machtkampf um die Bedingungen der Verfügbarkeit von Arbeitskräften lässt der Gewaltmonopolist aber zu; dazu hat er sich von politisch und gewerkschaftlich organisierten empörten Arbeitern erpressen oder jedenfalls drängen lassen. Er hat sich bereitgefunden, den Gewerkschaften ein dauerhaftes Einspruchsrecht gegen den Umgang der Arbeitgeber mit Lohnabhängigen einzuräumen, gegen den er selbst keine Einwände hat.
Freilich ist diese Lizenz mit ein paar Auflagen verbunden. Die legen als Erstes die Vereinbarung von Entlohnungs- und Arbeitsbedingungen als einzig zulässiges Streikziel fest, also die Wiederaufnahme der Arbeit im Dienst des Kapitals. Das deckt sich zwar mit dem defensiven Standpunkt, von dem aus, und mit der Perspektive, unter der Lohnabhängige sich überhaupt zu gewerkschaftlicher Aktion zusammenschließen. Doch darauf verlässt die öffentliche Gewalt sich nicht, wenn sie einer ganzen gesellschaftlichen Klasse das Recht auf einen kämpferischen Ausstand konzediert; auf einen Kampf, dessen Grund, die Untauglichkeit der Lohnarbeit als Lebensmittel, über den Zweck gewerkschaftlicher Gegenwehr, die Korrektur von Bedingungen dieser Sorte Gelderwerb, weit hinausreicht. Da schreibt sie lieber den systemkonformen Zweck als verbindliche Bedingung der Kampferlaubnis fest. Ein paar zusätzliche Rechtsnormen beugen der trotzdem allemal möglichen missbräuchlichen Verwendung des Streikrechts vor: Grundsätzlich gilt Friedenspflicht; für Kampfmaßnahmen müssen Abstimmungen eine eindeutige Zustimmung ergeben und Fristen eingehalten werden; Arbeitsgerichte passen auf die Respektierung von Sinn und Zweck der Veranstaltung auf. Die Gewerkschaften verstehen alle Einschränkungen konsequent als Bestätigung ihrer Rechtsstellung, genießen ihre Anerkennung als kollektive Vertragspartei und fungieren mit hohem Selbstbewusstsein als Partner der Arbeitgeber für Kontrakte, die deren Verfügungsmacht über Arbeitskräfte in die Form wechselseitiger Rechtsansprüche bringen. Die Vertreter der Kapitalseite – denen der Staat als Antwort auf einen Streik unter dem Gesichtspunkt der Waffengleichheit ein Recht auf Aussperrung nichtstreikender Arbeitnehmer gewährt – kritisieren den Kollektivvertrag als Beschädigung ihres Rechts auf freien Einkauf von Arbeit und lehnen den staatlich erlaubten gewerkschaftlichen Zusammenschluss ihrer angestellten Kräfte im Prinzip als Kartell von eben der Art ab, wie es ihnen verboten ist. Praktisch kommen sie mit dieser Zumutung allerdings ganz gut zurecht; vor allem haben sie nichts dagegen, dass der Tarifpartner ihnen – branchenweise oder sogar branchenübergreifend – gleiche Geschäftsbedingungen für ihre Konkurrenz gegeneinander sichert, so dass die Waffen des technischen Fortschritts und der Macht ihrer Kapitalgröße voll wirksam werden können. Das ändert zwar nichts daran, dass die Kapitalisten sich Streikrecht und Gewerkschaften, die es ausüben, weder bestellt haben noch unentbehrlich finden. Doch beide Seiten gewöhnen sich aneinander und an einen erlaubten Klassenkampf, der im Ergebnis immer von Neuem das Regime des Kapitals über die zum Faktor Arbeit degradierte Masse der Gesellschaft einvernehmlich festschreibt.
Für den Staat ist das Wagnis, den Lohnkampf zu erlauben, ein enormer Gewinn. Er nimmt seine Zuständigkeit für den Klassengegensatz in seiner Gesellschaft auch da, wo er sich in der Lohnfrage praktisch zuspitzt, äußerst effektiv und zweckmäßig wahr; eben in der Art, dass er ihn mit der einzigen Maßregel, dass sie sich einigen müssen, zur Sache der gegensätzlichen Parteien macht. Er regelt den Konflikt und dekretiert seine systemgemäße Bearbeitung, ohne sich selbst als Partei zu engagieren. Im Ergebnis sorgt er für ein allgemein akzeptiertes nationales Lohnniveau bzw. für einen im Einzelnen wie im Ganzen als gültig anerkannten Pluralismus von Lohnniveaus, ohne dass er es finden, vorschreiben und durchsetzen muss, was ihm mit Sicherheit nichts als den Undank beider Seiten einbringen würde. Wie die eine Klasse von ihrer Lohnarbeit lebt und die andere davon profitiert, haben die sich selbst zuzuschreiben; zu beschweren haben sie sich bei sich selbst. So schafft der liberale Staat mit der Lizenz zum Klassenkampf methodisch einen verlässlichen sozialen Frieden.
In der Gewerkschaft, die sich systemgemäß konstruktiv der Arbeitersache annimmt, hat der Sozialstaat zugleich den optimalen Partner für die sachgerechte Betreuung der lohnabhängigen Klasse. Mit ihrer Zulassung erteilt er ihr den Auftrag, sich um die konjunkturgemäße Ausgestaltung seiner Sozialpolitik verdient zu machen; und die Gewerkschaft quittiert die Aufgabe mit ganz viel Verantwortung für das gesellschaftliche Ehrenamt, das ihr damit zugefallen ist.
Nach außen
Die Tatsache, dass der Staat der Macht des Kapitals mit seinem Recht dort Schranken setzt, wo die Unternehmer und ihre Lobbys „über Gebühr“ auf die Bedingungen des Marktgeschehens und des gesellschaftlichen Lebens überhaupt Einfluss nehmen, gilt seinen konstruktiv kritischen Bürgern als demokratisch geboten und als Forderung des allgemeinen Wohls. Man sieht die politisch Verantwortlichen in der Pflicht, den Mittelstand zu schützen, für wirklich fairen Wettbewerb zu sorgen, Arbeitsplätze zu erhalten, den gesellschaftlichen Zusammenhalt vor übermächtigen Einzelinteressen, der heimlichen Herrschaft der Lobbys und den Gefahren eines „entfesselten Kapitalismus“ überhaupt zu bewahren; alles im Interesse des großen Ganzen und der „kleinen Leute“. Entsprechend kritisch reagiert eine aufmerksame Öffentlichkeit auf stereotyp wiederkehrende Berichte über die Kunst großer Konzerne, sich den Lasten und gerechten Forderungen des Gemeinwesens zu entziehen, von dessen Ordnung und Infrastruktur sie doch am meisten profitieren; über die Macht der Unternehmerverbände, die Politik zu manipulieren; über Weltunternehmen – vornehmlich ausländische –, die mit Lohndumping, Vernichtung von Arbeitsplätzen etc. Monopolgewinne einfahren; und darauf, dass der Staat das alles offenbar geschehen lässt, nichts oder viel zu wenig dagegen unternimmt, die ökonomisch Mächtigen mit Samthandschuhen anfasst und die Kleinen drangsaliert. Ob mehr die Ohnmacht oder mehr Pflichtvergessenheit, womöglich sogar Korruption oder böser Wille der Verantwortlichen dafür verantwortlich zu machen sind, darüber gehen bei eher rechten wie eher linken Volksanwälten die Meinungen auseinander. Was sie eint, ist die Vorstellung, der soziale Rechtsstaat wäre eigentlich die entscheidende, womöglich die letzte Bastion gegen die weltweite Machtergreifung international agierender Monopolisten und hätte seine souveräne Macht entsprechend einzusetzen.
Dass die Verwalter des Gemeinwesens Einschränkungen, die sie den Kapitalisten in ihrer Konkurrenz um maximale Marktmacht zumuten, mit Blick auf den weltweiten Machtkampf der Multis faktisch oder auch offiziell zurücknehmen, ist in der Tat nicht zu bestreiten. Der Grund liegt allerdings nicht darin, dass sie eine vorgestellte andere Politik unterlassen, sondern in dem Staatsinteresse, das sie verfolgen.
1. In seiner Eigenschaft als ‚Handelsnation‘ korrigiert sich der Staat in seiner antimonopolistischen Wirtschaftspolitik
Als Verwalter eines Kapitalstandorts, an dem und von dem aus gerade die großen Unternehmen um ihr Überleben im Weltgeschäft zu kämpfen haben, macht der Staat die Erfahrung, dass es für das Fortkommen seiner Ökonomie nicht genügt, wenn er Kapitalproduktivität im Allgemeinen und Besonderen fördert. Er muss erkennen und anerkennen, dass nationales Wachstum durch Eroberung des Weltmarkts zustande kommt und dass es dafür auf zwei Dinge ankommt: auf Kapitalgröße in eben dem Umfang und auf deren strategischen Einsatz für genau den Zweck der Enteignung von Schwächeren und der Herrschaft über das Marktgeschehen, denen er im Innern Schranken setzt, um das Kapital auf Produktivität als entscheidendes Konkurrenzmittel festzulegen und Chancengleichheit im Wettbewerb zu gewährleisten. In dem Sinn belehren ihn die Konzerne des Landes, die mit ihrer Größe die Konkurrenz im nationalen Rahmen für sich entscheiden und hinter sich lassen wollen und müssen, um auf den Weltmärkten zu bestehen; das beweisen ihm ausländische Konzerne, die mit der Macht ihres weltweit akkumulierten Reichtums die nationalen Märkte aufrollen und das Geschäft heimischer Firmen an sich ziehen. In seiner Eigenschaft als Sachwalter einer Handelsnation kommt der Staat nicht umhin, sich den Konkurrenzstandpunkt seiner im weltweiten Konkurrenzkampf engagierten Großkapitalisten zu eigen und die Eroberung der Weltmärkte durch die Champions seiner Wirtschaft zu seiner Sache zu machen.
Das erfordert eine Revision seiner Wirtschaftspolitik. Priorität bekommt die Entstehung von Unternehmen ordentlicher Größe. Der Schutz kleiner Firmen – des „Mittelstands“ – vor Enteignung durch wettbewerbsrechtlich fragwürdige Methoden muss hinter dieser Notwendigkeit im Zweifelsfall zurückstehen. Kapitale mit marktbeherrschender Stellung können, müssen sogar zugelassen werden, wenn der Stand der Nation im Weltgeschäft davon abhängt. Wenn sie um die nötige Größe und Marktmacht zu kämpfen haben, ist ihre Förderung geboten; über Fonds oder eigene Banken beteiligt sich der Staat am entsprechenden Wachstum „mittelständischer“ Produzenten, die im Prinzip, dann aber doch nicht aus eigener Kraft das Zeug dazu haben, Segmente des Weltmarkts monopolistisch zu besetzen. Wo zur Ausnutzung entstehender Geschäftssphären, womöglich wichtiger Schaltstellen im weltweiten Kapitalkreislauf am Standort nicht von selbst Konzerne mit der nötigen Potenz entstehen, müssen sie vom Staat geschaffen, durch Fusionen in die Welt gesetzt, mit Bürgschaften abgesichert werden.
Kriterium des Erfolgs, um den es dem Staat dabei geht, ist die fortschreitende, fortschreitend exklusive Bereicherung der Nation an den Reichtumsquellen der Welt. Die grenzüberschreitenden monopolistischen Benutzungsansprüche der im Land beheimateten Multis werden unter diesem Gesichtspunkt mit einer nationalen Besitzanzeige versehen: Ressourcen unter fremder Hoheit, auf die der nationale Kapitalismus Zugriff braucht und in gehörigem Umfang hat, heißen – exemplarisch – „unser Öl“; der weltweite Absatz von Gütern aus heimischer Produktion zu Lasten auswärtiger Konkurrenten firmiert als „unsere Exportmärkte“. Speziell der Weltmarkt für Energieträger, die stofflich und mit ihrem Preis in den gesamten Produktions- und Lebensprozess der Nation eingehen, ist ein Kampfplatz besonders großer Konzerne, die von ihren Heimatstaaten zu kommerziellen Führungsmächten bei der Förderung und Beschaffung benötigter Rohstoffe wie für die industrielle Herstellung „erneuerbarer“ Energien und der Produktionsmittel dafür herangezüchtet und in die Konkurrenz um Länder und Kontinente übergreifende Monopole hineingeschickt werden. Ebenso im Verkehrssektor, der längst bis in den Weltraum reicht, oder in all den Bereichen, die sich mit dem Attribut „digital“ schmücken. Mit ihrem Bemühen um Wachstum durch Beherrschung des Weltmarkts führen die Kapitalisten zugleich einen politischen Auftrag aus, den der Staat „partnerschaftlich“ mit Rückhalt und mit handfesten Mitteln versieht. Komplementär dazu begründet die Marktmacht ausländischer Konzerne, die sich in den nationalen Kapitalkreislauf einklinken, staatliche Sorgen um einen Ausverkauf heimischer Wachstumsquellen; landesfremde Unternehmen, die heimische Produzenten und Kaufleute zu enteignen, deren Marktanteile zu übernehmen drohen, werden nicht einfach wertneutral als Konkurrenten akzeptiert oder gar als prinzipiell wünschenswerter Beitrag zum kapitalistischen Wachstum am Standort willkommen geheißen, sondern unter Verdacht gestellt, sich zum Nachteil des nationalen Wirtschaftslebens und des Stellenwerts der Nation im Weltgeschäft am produktiven Reichtum der Nation zu vergreifen. Wirklichen oder auch nur befürchteten Machenschaften solcher Art begegnet der Staat mit den bewährten wie mit maßgeschneiderten zusätzlichen Regeln seines Wettbewerbsrechts oder auch direkt mit Eingriffen, die den goldenen Grundsatz außer Kraft setzen, in der freien Wirtschaft hätte allein der Markt über Erfolg und Misserfolg zu entscheiden. Auf die Organisation grenzüberschreitender Wertschöpfungsketten vom Ausland aus, auf die Einrichtung von Verkaufsplattformen samt digitaler Infrastruktur durch ausländische Konzerne u.ä. reagieren Wirtschaftspolitiker nicht bloß mit einem reflexhaften „Das wollen wir auch!“; sie erfinden auch Vorschriften – exemplarisch etwa beim Import und Vertrieb von Erdgas – zur Trennung von Geschäftsbereichen, die fremden Monopolisten ihr Geschäft schwermachen; sie unterwerfen deren Niederlassungen im eigenen Land restriktiven Regeln, die die Macht der Zentrale zu freier Disposition über Kosten und Erträge ihrer über die Welt verstreuten Unternehmensteile ausbremsen; sie greifen auf Monopolgewinne zu, die sie im Fall heimischer Geschäftemacher gegen den steuerlichen Zugriff fremder Souveräne abzuschirmen wissen; usw.
Alles das muss sein, staatliche Einmischung in die Konkurrenz der Multis per Stärkung der strategisch eingesetzten Kapitalmacht nationaler Champions wie per Abwehr fremder Übergriffe mit Enteignungspotenzial, weil ebendas Inhalt und Kriterium nationaler Konkurrenzfähigkeit im Weltmaßstab ist: die Produktivkraft, die in der auf Größe gegründeten Macht der Kapitale liegt.
2. Im Licht der Monopolkonkurrenz auf den Weltmärkten identifiziert und verwirft der Staat falsche Rücksichtnahmen sozialer Art
Zur Revision der Wirtschafts-, speziell der Wettbewerbspolitik, zu der sich der Staat in seiner Verantwortung für die Handelsnation genötigt sieht, gehört ein kritischer Blick auf seine Leistungen als Sozialstaat. Was er – sich – da geleistet hat, folgt der Logik der Nachhaltigkeit: Seine kapitalistische Wirtschaftsweise braucht die Pflege des Standorts in all den „Fragen“ der Ernährung seiner Klassengesellschaft, der Bildung und Erhaltung von Leistungswille und -vermögen der kollektiven Arbeitskraft, der Wahrung bzw. Restaurierung natürlicher Lebensbedingungen usw., die die freie Marktwirtschaft aufwirft, aber nicht beantwortet, die also den politisch fürs System Verantwortlichen zu tun geben. Und obwohl die ökonomisch herrschende Klasse, jedenfalls nach mehrheitlicher eigener Auffassung, ganz gut oder viel besser ohne Gewerkschaften zurechtkäme, hat die politische Herrschaft sich eine Lizenz sogar für konstruktive Arbeitskämpfe abringen lassen, mit der sie die Verantwortung für den Preis, also den Lebensunterhalt des Produktionsfaktors Arbeit an die Nutznießer und Betroffenen delegiert.
Wegwerfen kann und will der Klassenstaat das alles nicht. Er bekommt es aber damit zu tun, dass seine nationale Unternehmerschaft in ihrem Überlebenskampf mit Konzernen, nationalen wie internationalen, die Lasten der Instandhaltung eines nutzbaren Volkes und einer tauglichen Umwelt für untragbar befindet. Die Konzerne, die sich einen für ihre Wettbewerber ruinösen Konkurrenzkampf leisten können, um ihres maßlosen Wachstums willen aber auch leisten müssen, ertragen die Unkosten ihrer staatlich bereitgestellten Geschäftsbedingungen nicht gerne auch noch und kaum besser als die Schwächeren, von deren Enteignung sie leben. Schließlich stehen sie im Kampf nicht nur untereinander, sondern mit ausländischen Konkurrenten, die in ihrem Wachstum eventuell durch auswärts gültige Regeln, durch die Sozialpolitik des eigenen Klassenstaats und die von diesem erlassenen Vorschriften aber jedenfalls nicht behindert werden. Das macht natürlich jede einzelne Regelung, so gut sie gemeint und so wichtig sie für sich genommen auch sein mag, zu einem Ärgernis, dessen Beseitigung „die Wirtschaft“ von ihrem Staat und dieser nach Prüfung oft genug von sich selbst fordert. Denn wenn es für die wichtigen Konzerne – überhaupt und im internationalen Kräftemessen erst recht – darauf ankommt, mit der Macht ihrer Unternehmensgröße die Produktivität ihres Kapitals ungehindert wirksam werden zu lassen, dann wird so manche nationale Geschäftsbedingung, die sie respektieren müssen, zur unhaltbaren Einschränkung ihrer Konkurrenzfähigkeit. Und wenn nun einmal der Fortbestand der Nation als weltwirtschaftliches Kraftzentrum vom Weltmarkterfolg einheimischer Multis abhängt, dann korrigiert sich der Staat in seiner für die heimische Klassengesellschaft konzipierten und realisierten Ordnungs- und Betreuungspolitik.
Daran führt aus seiner Sicht außerdem aus Gründen der gegebenen, nämlich von den Kapitalisten hergestellten Sachlage kein Weg vorbei. Der globale Machtkampf der Multis um Monopole stellt die Arbeitswelt so auf den Kopf, dass traditionsreiche soziale Errungenschaften sowieso teils obsolet, teils unhaltbar werden. Mit der Expropriation von Teilen des kapitalistischen Mittelstands und mit der zunehmenden Macht der international erfolgreichen Konzerne, die sich natürlich auch auf den Gebrauch der weltweit verfügbaren Arbeitskraft erstreckt, schwindet das Job-Angebot im Verhältnis zur Nachfrage einkommensloser Massen weltweit, mit den entsprechenden Folgen für das soziale Kräfteverhältnis zwischen den kapitalistischen Klassen. Der Beruf des lebenslänglich und Vollzeit-beschäftigten Betriebsangehörigen, an dessen nützlicher Armut der Sozialstaat seine Betreuungspolitik ausgerichtet hat, schwindet ebenso dahin. An seiner Stelle werden „lückenhafte Erwerbsbiographien“ zum Normalfall; mit verheerenden Folgen für Willen und Fähigkeit des Proletariats, sich Berücksichtigung seiner Überlebensnotwendigkeiten zu erstreiten. Die Gewerkschaften verlieren jedenfalls an Widerstandskraft; und was sie allenfalls noch aufzubieten haben, geben sie mit dem paradoxen Kampf um Arbeitsplätze – in der Sache: dem drängenden Antrag im Namen der nicht gebrauchten Lohnabhängigen, benutzt zu werden – pseudo-offensiv aus der Hand. Ihren Einfluss auf die Politik, als Arbeitnehmer-Lobby, büßen sie damit auch ein. Entsprechend agiert der Sozialstaat: Er konstatiert „Entwicklungen“ und quittiert die mit „Anpassungen“, die von der gewohnten Organisation des Arbeitnehmerlebens nicht allzu viel übrig lassen. Und Mitbestimmungsrechte, die eine gewerkschaftsfreundliche Politik in manchen Ländern professionellen Belegschaftsvertretern zugebilligt hat – und die für Multis aus der Fremde ohnehin fast nie wirksam geworden sind –, werden zum Anachronismus, überleben allenfalls als leibhaftige Erinnerung an Verhältnisse, in denen Unternehmensfürsten sich gerne des konstruktiven Willens ihrer Arbeitnehmerelite zur Mitwirkung am Management versichert haben. Dementsprechend korrigiert sich der moderne Rechtsstaat auch hier: Gewerkschaftsnähe will er sich nicht vorwerfen lassen.
Der Staat versteht also und tut das Seine, dem Erfolgskriterium der globalen Konkurrenz um Monopole: der Produktivkraft purer Kapitalmacht durch Größe und ihren skrupellosen strategischen Einsatz, gerecht zu werden, also alternativlos Geltung zu verschaffen. Seiner kapitalistischen Elite macht er damit zusätzlich ein moralisches Geschenk, das die zwar nicht braucht, aber gerne annimmt: Er ermächtigt nicht nur, sondern ermuntert sie, wo immer er einmal einschränkende Regeln für nötig gehalten hat, zur Rücksichtslosigkeit.
§ 22 Die Verschmelzung von Kapital und Kredit
1. Um das Bedürfnis nach Kapitalgröße zu verfolgen, braucht es nicht nur wegen solchen staatlichen Zuspruchs keinen Kampf in dem Sinn. Der Kredit tut da bessere Dienste
Im Konkurrenzkampf um monopolistische Beherrschung des Marktes müssen die kapitalistischen Unternehmen mit einem Widerspruch fertigwerden: Um mit dem strategischen Einsatz der Macht ihres Betriebsvermögens und ihres Einflusses auf das Marktgeschehen definitiv erfolgreich zu sein, sich von ihren Konkurrenten zu befreien und sich deren Marktanteile anzueignen, brauchen sie die Potenz, i.e. die uneinholbare Betriebsgröße und den ausschließenden Zugriff auf den Markt, die sie sich durch die Überwältigung und Eliminierung ihrer Rivalen, durch die Aneignung der produktiven Fähigkeiten und die Übernahme der Marktanteile ihrer Gegner erst verschaffen wollen. Entsprechend rücksichtslos gehen die Großen gegen die Kleinen vor, betreiben die mächtigen Konzerne die Übernahme oder Eliminierung von Firmen des sogenannten Mittelstands; und das immerhin so konsequent und effektiv, dass die Staatsgewalt sich herausgefordert sieht, die Übergriffigkeit der Mächtigen mit allerlei Fairnessregeln und einer Wettbewerbsaufsicht zu bremsen. Im größeren Rahmen des globalen Wettbewerbs finden heimische Multis andererseits durchaus staatlichen Zuspruch und Förderung in ihrem Bemühen um Größe als Wachstumsmittel. Erlaubt, ja gewünscht ist die Eroberung ganzer Märkte durch nationale Konzerne; direkte Expropriation der Unternehmerschaft, die im deutschen EU-Jargon auf das Kürzel KMU hört, soll aber nicht sein. Der Kampf um die ausschließende Aneignung von immer mehr Umsatz und Gewinn ist zivil, nur mit erlaubten Mitteln zu führen.
Das geht. Die stärkste Waffe im Kampf um Wachstum finden die Kapitalisten im Finanzwesen vor, das private Geldvermögen zentralisiert und als Kredit verfügbar macht. Die Bereitstellung von Liquidität durch Geldhändler zur Überbrückung von Zahlungsfristen und Engpässen im Kapitalkreislauf erlaubt dem Unternehmer den Einsatz seines Vermögens in voller Größe als kapitalistisch wirksamen Vorschuss; mit geliehenem Kapital vermag er die Produktivkraft seines Betriebs über die Schranken seines Privateigentums hinaus so zu steigern, dass sich der vergrößerte Vorschuss auch nach Bedienung der Schulden für ihn lohnt. Und natürlich bekommen Konzerne auch Kredit, um den Übergriff auf Konkurrenten und ihren Vorgriff auf konkurrenzlose Größe zu finanzieren. Bei geborgter Liquidität und geliehener Größe kann es freilich nicht bleiben, wenn es dem Unternehmen darum geht, aus eigener Kraft über die Schranken des eigenen Wachstums hinauszuwachsen und mit seiner eigenen Größe die Konkurrenz aus dem Markt zu drängen. Als Kreditnehmer ist es mit seiner vergrößerten Potenz doch immer trennbar verbunden. Das Leihgeschäft ist befristet, und es liegt in der Macht des Geldkapitalisten, es nicht zu verlängern oder sogar zu kündigen. Zudem gehen Erträge aus dem Zuwachs an finanzieller Verfügungsmasse nicht uneingeschränkt ins Wachstumspotential der Firma ein. In der Pflicht zur Wegzahlung von Zinsen und zur Rückzahlung des Geliehenen, unabhängig vom tatsächlichen Erfolg der damit finanzierten Investition, macht sich geltend, dass sich mit dem Zugewinn an Mitteln und an Schlagkraft durch Schulden ein fremdes Interesse ins private kapitalistische Geschäft eingenistet hat. Dessen Fähigkeit, Geld zur Verfügung zu stellen, mag nicht von vornherein begrenzt sein; die Bereitschaft dazu hält sich aber im Rahmen des Vertrauens auf die Fähigkeit des Schuldners, das geliehene Geld vereinbarungsgemäß zu verzinsen und fristgerecht zurückzuzahlen. Zu der Macht und der Freiheit, die ein Unternehmer braucht, um sich als Monopolist gegen die Konkurrenz durchzusetzen, passt das nicht.
Im Finanzsystem, dieser großartigen Errungenschaft, privaten Unternehmern die Macht fremden Geldes verfügbar zu machen, finden die Kapitalisten dann aber doch einen geradezu revolutionären Ausweg: Getrieben von ihrem Interesse an wettbewerbsentscheidender Unternehmensgröße tun sie sich miteinander und mit fremden Geldbesitzern zusammen, stiften ein Gemeinschaftsunternehmen und teilen sich den Gewinn – was freilich deutlich weniger einfach ist, als es klingt. Denn über die Vergesellschaftung von Privatvermögen im Bankgeschäft geht dieser Zusammenschluss entscheidend hinaus. Praktiziert wird ein Kollektivismus, der dem freien Privatunternehmer wesensfremd ist. Vergemeinschaftung von Vermögen, freiwillige Aufhebung der ausschließenden Privatheit des Eigentums inmitten des Systems des Privateigentums, das kommt der Quadratur des Kreises nahe. Aber wo es um Größe als das alles entscheidende Mittel im Kampf um die Überwindung der Konkurrenz geht, da geht sogar das. Sieht dann natürlich entsprechend aus; funktioniert am Ende zwar zuverlässig, aber nur in Form eines unendlichen Überbaus aus Interessengegensätzen, Vermittlungen und immer neuen Widersprüchen zwischen privatem und kollektivem Eigentum.
2. Die Aktie und ihre Gesellschaft
Mit der Ausgabe von Aktien bietet ein Unternehmen interessierten Geldbesitzern Beteiligung an seiner Gewinnproduktion und verschafft sich von denen dafür ein Geld, das unwiderruflich zu seinem Eigenkapital zählt, mit dem es also frei und uneingeschränkt wirtschaften kann, ebenso wie mit dem in Aktien umgewandelten Privatvermögen des bisherigen Besitzers, der damit selber zum Teilhaber wird. Die Aktie repräsentiert auf der einen Seite ein anteiliges Eigentum an dem Unternehmen, aber ohne die Verfügungsmacht, die eigentlich zum Eigentum dazugehört; die geht über auf das Management des Unternehmens, das freilich – so indirekt bleibt ein Moment von Verfügungsgewalt erhalten – durch ein von der Gesamtheit der Aktienbesitzer gewähltes Gremium bestellt und kontrolliert wird und der Aktionärsversammlung Rechenschaft schuldet. Die Aktie verbrieft auf der anderen Seite ein Recht auf Ertrag aus dem Gewinn des Unternehmens; keine feste Summe, sondern eine dem Besitzanteil entsprechende Dividende aus der Summe, die als auszuschüttender Gewinn festgelegt wird. Für den Aktienbesitzer stellt sein Wertpapier folglich ein Geldkapital dar, das selbst und dessen Wert nicht in der Summe besteht, die ins Eigenkapital des Unternehmens übergegangen ist – die ist definitiv weg –, sondern aus dem verbrieften Recht auf eine Dividende entsteht: Der Ertrag gilt als Abkömmling einer fiktiven Geldquelle; die Aktie ist deren realer Repräsentant und als solcher ein frei handhabbares Stück Eigentum. Insofern läuft die eigentümliche Trennung zwischen Kapitaleigentum und kapitalistischer Verfügungsmacht auf eine Verdoppelung des Kapitals hinaus: Als Betriebsvermögen, das dem Unternehmen als juristischer Person selbst gehört, schafft es Profit; als Privateigentum repräsentiert es ein Geldkapital, das seine Kapitaleigenschaft getrennt vom Betriebsvermögen und dessen kapitalistischer Leistung aus dem darauf zwar beruhenden, dagegen aber verselbständigten Recht auf Ertrag ableitet.
Mit diesem Fortschritt in der kapitalistischen Sache ändert sich die politökonomische Identität der Kapitalisten, die sie betreiben. Der Berufsstand teilt sich ebenso auf, verdoppelt sich gewissermaßen. Den Job der Unternehmensleitung übernehmen angestellte Funktionäre; nicht mehr ein Stab von Prokuristen, die als „rechte Hand“ des Besitzers fungieren, sondern an der Spitze ein wirklicher, mit der Macht des kombinierten Eigentums ausgestatteter und agierender Chef. In seinem Berufsbild verselbständigt sich das Interesse des kapitalistischen Unternehmers als solches zu einer Profession in der Hierarchie der bürgerlichen Berufe; das Regime des Privateigentums über Vermögen und Personal der Firma wird zu einer unpersönlichen Sache, in deren Dienst eine bezahlte Fachkraft tritt. [1] Die kapitalistischen Eigentümer treten als Aktionäre zu ihrer Firma in ein entsprechendes unpersönliches Verhältnis, das im Prinzip überhaupt allen Geldbesitzern, sogar dem breiten Publikum offensteht; sie besitzen ihr gegenüber die Distanz und die Freiheit des Investors, der sich seine Unternehmensbeteiligung aussucht. Ihr privates Bereicherungsinteresse realisieren sie, dieser Rollenbeschreibung gemäß, auf einem eigenen Feld: in der Bewertung des fiktiven Kapitals, das sie mit der Aktie in Händen halten.
Die Größe dieses Werts zeichnet sich nämlich dadurch aus – das liegt in der Natur dieser eigentümlichen Sache –, dass sie schon mit der Einführung des Papiers nicht mehr mit der Summe zusammenfällt, die das Unternehmen als sein Eigenkapital verbucht und für sein Wachstum verwendet, sondern grundsätzlich durch einen Vergleich bestimmt ist; mit dem Zins nämlich, den das Geldkapitalgewerbe ortsüblich für seine Kredite berechnet. Der Zinsfuß ist der erste Anhaltspunkt, die erste Messlatte für die Berechnung der Summe, die als Geldkapital einen Ertrag von der Höhe der in Aussicht stehenden Dividende abwerfen würde und deswegen der Aktie als ihr Wert zugeschrieben wird. Freilich ist sie nur ein erster Faktor im Prozess der wirklichen Bestimmung des Aktienwerts. Der spielt sich ab im Tauschgeschäft zwischen den Geldanlegern, die mit Aktien handeln und dafür einen Markt eigener Art geschaffen haben:
3. Die Börse
An der Börse, durch permanenten Kauf und Verkauf zu dem Preis, über den Anbieter und Nachfrager mit ihren entgegengesetzten Interessen sich einig werden, findet ständig, institutionell betreut, im Sekundenabstand ausgewiesen, eine Bewertung der Aktien statt, also die Bestimmung der Größe des Geldkapitals, das das Wertpapier repräsentiert. Die entscheidet darüber, wie reich der Besitzer ist, auch wenn er seinen Besitz nur im Safe liegen lässt. Im Kalkül der Kontrahenten dieses Handels zählen die gezahlte Dividende, der Vergleich dieses Geldertrags mit dem aus alternativen Kreditgeschäften – darunter auch die Dividenden auf andere Aktien – und die Kapitalisierung der so gewichteten Einnahme von vornherein nicht als feste Rechengrößen, sondern als Anhaltspunkte für die Spekulation, wie es mit all diesen Größen weitergeht, so dass ein rechtzeitiger Ver- oder Zukauf angezeigt wäre. Dass zahllose Gesichtspunkte ökonomischer wie politischer, am Ende sogar sozialpsychologischer Art in diese Spekulation bestimmend mit eingehen, versteht sich. Das Ergebnis ist ein Aktienkurs, dessen Verlauf – neben der Dividende und mit sehr viel größerem Gewicht – mit seinem Auf und Ab darüber entscheidet, ob und inwieweit das von der Aktie zu einem bestimmten Zeitpunkt repräsentierte Geldkapital sich zu einem späteren Zeitpunkt ver- – oder im schlimmsten Fall ent- – wertet hat. Das Ergebnis bestimmt wiederum maßgeblich die Spekulation von Investoren und Aktienbesitzern und mit den entsprechenden Transaktionen den weiteren Kursverlauf. So vernünftig geht es zu, wenn das Privateigentum getrennt von der tatsächlichen Verwertung des Kapitals, in das es inkorporiert ist, damit das sein erforderliches Kampfgewicht erreicht, ein Eigenleben als sich verwertendes Geldkapital führt.
Was also als Mittel des Unternehmers in die Welt kommt, seinem Kapital über die Schranken seines individuellen Vermögens hinaus die für monopolistische Beherrschung des Marktes erforderliche Größe zu verschaffen, das wird an der Börse zum Stoff für einen Tauschhandel, der – ganz ohne Arbeit, allein aus dem Recht auf Ertrag, durch Spekulation und Transaktion zwischen Spekulanten – kapitalistisch wirksamen, nämlich sich vermehrenden, bei Bedarf in Geld realisierbaren Reichtum entstehen und – auf demselben Weg, ohne Konsumtion – auch wieder vergehen lässt. Der Geschäftsgang der AG, die Profitmacherei durch Einkauf, Produktion und Verkauf, fungiert dafür als Risiko – als ein Risiko neben zahllosen anderen – für die Spekulation auf eine dauerhafte Wertsteigerung der Aktie. Diese Risiken produktiv auszunutzen, i.e. zwischen alternativen Geldanlagen hin und her zu tauschen, dabei immer auf der richtigen Seite zu stehen und auf die Art ein ganzes Wertpapier-Portfolio erfolgreich zu bewirtschaften, ist hier die Methode der Bereicherung. Die zu beherrschen, macht den klugen Börsianer aus, folglich auch den Inhalt einer Dienstleistung, die bei einer eigenen Spezies von Börsen-Profis eingekauft werden kann. Zur Spekulation auf derartige Risiken – und daher zum Angebot der „Vermögensverwaltung“ – gehört, als nächste Etage des finanzkapitalistischen Überbaus, das Geschäft mit Angeboten zur Absicherung spekulativer Wagnisse. Das trennt sich im nächsten Schritt vom konservativen Versicherungszweck und entwickelt sich zu einem Subsystem von Wetten auf oder gegen den Eintritt spekulativ vorweggenommener Wertänderungen von was auch immer. Am Ende fungieren phantastische Summen, die freilich nur zu einem Bruchteil mit Geld „unterlegt“ sein müssen, allein dadurch als Bereicherungsquelle, dass damit ein Verlustrisiko eingegangen wird. [2]
4. Das Unternehmen als Spekulationsobjekt; die modernen Fusionen
Was sich an den Börsen und in den Computern der Spekulantenwelt an verselbständigten Geschäften mit fiktivem Geldkapital und dessen Derivaten entfaltet, das stellt das strategische Bemühen der großen Unternehmen um Wachstum durch zusätzliche Größe auf eine neue Grundlage. Denn mit der Gründung einer AG ist die Option auf Vergrößerung des Unternehmens über die Schranken seines angesammelten Betriebsvermögens und dessen Leistungsfähigkeit hinaus keineswegs erledigt. Als Spekulationsobjekt an der Börse etabliert, ist die AG Gegenstand eines allgemeinen finanzkapitalistischen Interesses und hat damit Zugang zu praktisch unbegrenzten Geldmitteln, den sie aktiv selbst zu gestalten vermag. Nach eigenem Interesse und Kalkül kann ihr Vorstand beschließen, neue Aktien zu emittieren, also den Kapitalbedarf der Firma, wie er sich aus bisherigen und geplanten Wachstumserfolgen ergibt, in ein Angebot an Geldbesitzer zur Gewinnbeteiligung als Anteilseigner verwandeln und darüber zusätzliches Eigenkapital besorgen. Dass es an Geld fehlen könnte, braucht er nicht zu befürchten; die Macht der Kreditmärkte, fiktives Kapital zu kreieren und zu refinanzieren und ein Erträge versprechendes Unternehmen damit auszustatten, übersteigt allemal jeden Kapitalbedarf. Das Interesse an solchem Engagement muss die Unternehmensleitung natürlich wecken; grundsätzlich durch errungene und die gute Aussicht auf neue Geschäftserfolge am Markt. Die sind aber nicht mehr Gegenstand einer kritischen Prüfung auf gesicherte Verzinsung und Rückzahlung einer bestimmten Leihsumme durch die Bürokratie einer Bank. Aktiengesellschaften gehen für eine von besonderen Projekten relativ unabhängige Vergrößerung ihrer Kapitalmasse auf die Finanzmärkte zu, und zwar mit dem Nachweis ihrer Investitionswürdigkeit, der in Form der Bewertung ihrer bisherigen Performance und ihrer Zukunftsaussichten überhaupt durch die Spekulation selbst, nämlich im Wert ihrer Aktien und, wichtiger noch, mit dessen Entwicklung bereits vorliegt. Die durch die finanzkapitalistische Fachwelt realisierte und antizipierte Steigerung des Kurswerts der Unternehmensaktien, die in der Summe den Börsenwert der AG ausmachen, entscheidet über die Qualität des Angebots, zu dessen Annahme alle Geldbesitzer und Kreditschöpfer eingeladen werden. Die Spekulanten entscheiden ihrerseits frei, nach ihren Kriterien des Vergleichs konkurrierender derartiger Angebote, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang sie sich in das Unternehmen einkaufen; je nachdem, wie viel Wertsteigerung ihres fiktiven Kapitals sie dem wirklichen Kapital zutrauen. [3]
Für AGs gilt also eine neue Form der Kreditwürdigkeit. Die besteht in der Zufriedenheit alter und vor allem in der Investitionsbereitschaft neuer Shareholder, somit im Wert der Aktien. Der ist erst einmal und grundsätzlich durch den Markterfolg des Unternehmens, sein Vorankommen in der Konkurrenz um die Monopolisierung gesellschaftlicher Zahlungsfähigkeit bestimmt. Insoweit wären das Wachstum des Börsenwerts der Firma, die Bereicherung der Anteilseigner, und das Wachstum am Markt per Eliminierung von Konkurrenten zwei Seiten derselben Sache. Dazwischen steht aber die Freiheit des Eigentümers, der „seiner“ Firma nur durch Spekulation, also auch im Erfolgsfall jederzeit trennbar verbunden ist, sein Engagement permanent mit Alternativen vergleicht und je professioneller, umso flotter dagegen austauscht. Börsenwert und Markterfolg der AG sind prinzipiell nicht deckungsgleich. Und es fehlt nicht an Gründen und Anlässen dafür, dass das Eigeninteresse der Firma an einsetzbarer Kapitalmacht und das der Investoren an der anderen Kapitalanlagen überlegenen Wertsteigerung ihres fiktiven Kapitals auseinanderlaufen und sogar in Gegensatz zueinander geraten.
So ist schon die Aufteilung des am Markt erwirtschafteten Überschusses auf Dividenden einerseits, Verfügungsmasse für Wachstumsstrategien andererseits eine immer wiederkehrende Streitfrage. Da werden den Shareholdern Kalkulationen aus der Welt von Lohn, Preis, Profit und technischem Fortschritt zugemutet, Kalkulationen mit Marktbedingungen und Konkurrenten, für deren Stichhaltigkeit sie sich auf ihre leitenden Angestellten verlassen müssen. Die wiederum müssen zu ihren eigenen Planungen und Berechnungen den Standpunkt des zu steigernden Börsenwerts der Firma einnehmen; das sind sie ihrem Arbeitgeber, dem kollektiven Eigentümer, aber ebenso der Kreditwürdigkeit und damit dem Wachstum des Unternehmens schuldig. Ob und wie diese mit Aktienkurs und Börsenwert erreichte Kreditmacht fürs Wachstum auszunutzen ist, wird konsequent zur nächsten Streitfrage: Die Emission neuer Aktien verschafft dem Unternehmen mehr Eigenkapital, kann aber den Wert der Anteile und damit den Besitz der Shareholder schmälern; die wiederum werden unmittelbar reicher, wenn das Unternehmen mit dem Rückkauf eigener Aktien deren Wert steigert. [4] Und so weiter.
Mit der Existenz als Spekulationsobjekt eröffnet sich dem Unternehmen schließlich die Perspektive einer ganz elegant geschäftsmäßigen Eliminierung von Konkurrenten und Aneignung ihres Betriebsvermögens, aber auch umgekehrt die Chance zur abschließenden Verwertung eines nicht mehr hinreichend erfolgreichen produktiven Kapitals im Akt seiner Eliminierung: Die Einverleibung eines an der Börse gehandelten Unternehmens in den Besitzstand eines werdenden Monopolisten nimmt ihren Weg über den Aufkauf seiner Aktien – nach und nach oder auf einen Schlag, einvernehmlich oder feindlich gegen die Leitung der anderen Firma, auf jeden Fall ganz nach den zivilen Sitten der Börsenordnung. In neu emittierten Aktien verfügt der übernehmende Konzern mittelbar oder unmittelbar, per Abfindung der bisherigen Eigentümer oder per Aktientausch, über das Zahlungsmittel für seinen Zuerwerb. So können in einer über den Aktienhandel bewerkstelligten Fusion Gewinner und Verlierer, also beide Seiten einer auf Eliminierung programmierten Konkurrenz schiedlich-friedlich auf ihre Kosten kommen.
5. Kein Ende der Konkurrenz, sondern Vor- und Zusatzveranstaltungen
Kapitalisten sind, wenn es darauf ankommt, durchaus bereit und in der Lage, mit ihrem Privateigentum gemeinsame Sache zu machen. Gruppenweise, offen für alle Interessierten, schließen sie sich zu Gesellschaftsunternehmen zusammen. Das Gegeneinander ihrer Betriebe delegieren sie an Funktionäre; ihre private Bereicherung verlagern sie auf das Feld des friedlichen Handels mit Wertpapieren aus verschiedensten Quellen. Sie vergesellschaften die kapitalistische Privatmacht ihres Eigentums und wirtschaften als Privateigentümer mit Papieren, die tatsächlich kollektiviertes Kapital repräsentieren.
Das Ende der Konkurrenz ist das nicht; im Gegenteil. Wenn private Geldvermögen zu Aktiengesellschaften zusammengeschlossen, ganze Betriebe in Gemeinschaftsunternehmen eingebracht werden, dann ist das der Auftakt dazu, mit der Waffe der Kapitalgröße den Kampf um Enteignung und Aneignung fremden produktiven Reichtums erfolgreich zu Ende zu führen. Dann konkurriert das Unternehmen dauerhaft um monopolisierte Marktmacht, zugleich um seinen Börsenwert, also um Interesse und Zuspruch des Finanzkapitals, und um das eine als Mittel fürs andere. Um diese doppelte Anforderung sachgerecht abzuarbeiten, braucht es seinen ganzen Stab hauptberuflicher Funktionäre. Auf der einen Seite werden die maximale Ausbeutung des Faktors Arbeit und die manipulative Kontrolle des Marktes endgültig zur unpersönlichen Sache, in der die Abstraktion „das Kapital“, sachgerecht in einer Vielzahl konkurrierender Kapitale, praktisch wahr wird; die begründet Berufsbilder, für die es wissenschaftliche Lehrbücher gibt. Auf der anderen Seite ist es im Umgang mit den Aktionären und vor allem mit möglichen Investoren mit der persönlichen Überzeugungskraft des Chefs endgültig nicht getan; die berechnende Selbstdarstellung des Unternehmens als zukunftssicheres lohnendes Investment und die Mittelbeschaffung werden ebenso zum Job für eine eigene Hierarchie von Fachleuten. Die wesentlichen Anforderungen haben hier die Form, dass die AG es am Kapitalmarkt ihrerseits mit Profis zu tun bekommt, die über Geld und Kredit der Gesellschaft – über Fonds, Guthaben und Forderungen, Spareinlagen aller Art, zu verwaltende Vermögen – verfügen. Die stehen untereinander in einer ganz eigenen Konkurrenz um Verfügungsmasse, deswegen um maximale Wertsteigerung des fiktiven Kapitals, als das sie die ihnen anvertrauten Finanzmittel wirken lassen. Ihr Job hat also den permanenten kritischen Vergleich finanzieller Engagements miteinander und deren zielgenauen, sekundenschnellen Austausch gegeneinander zum Inhalt. Für die Unternehmen in ihrer Existenzweise als Spekulationsobjekte heißt das: Sie werden nach Kriterien, die mit denen ihres eigenen Wachstums nicht zusammenfallen, einem ununterbrochenen Konkurrenzvergleich unterzogen. Den müssen sie bestehen.
Das ist deswegen eine anspruchsvolle Aufgabe, weil ihnen im Kalkül der Finanzprofis die harte Wahrheit ihres durch die gewonnenen Investoren in die Höhe getriebenen Wachstums begegnet: Ihr Kampf um die Monopolisierung von Märkten kennt unmöglich nur Sieger, kann gar nicht für alle gut ausgehen. Für die Spekulanten, die nach Maßgabe ihres Wettbewerbs diese irrwitzige Konkurrenz finanzieren, ist das egal, jedenfalls kein Geschäftshindernis, allenfalls ein besonderer Stachel für ihr immer waches Misstrauen. Sie setzen Geld und Kredit natürlich auf die Konzerne, in denen sie die Konkurrenzgewinner vermuten und deren Gewinnchancen sie damit begründen. In ihrer eigenen Konkurrenzstrategie machen sie sich davon aber nicht abhängig: Sie investieren in Wertpapiere verschiedener, auch gegeneinander konkurrierender Betriebe und haben genug damit zu tun, immer rechtzeitig genau das Richtige zuzukaufen und zu verkaufen und so ihr Kapital wachsen zu lassen. Gegen das Schicksal der Firmen, in deren Finanzierung sie befristet eingemischt sind, verhalten sie sich professionell bedenkenlos. Umso mehr wird es für die zur Überlebensfrage, als Spekulationsobjekt an der Börse präsent und für Anleger interessant zu bleiben: Die Größe, die sie brauchen, gibt es eben nur als Werk der Finanzkapitalisten, die über Geld und Kredit der Gesellschaft Regie führen; ihre Existenz ist ein Derivat von deren Spekulation.
Auf die können sie sich immerhin verlassen. Nicht auf etwas so Windiges wie Solidarität unter Eigentümern. Vielmehr auf die Konkurrenz der Investoren um die je besseren Anlageobjekte.
6. Statt Verfügung über den Markt Gleichgültigkeit gegen ihn …
Ausgestattet mit der Macht des vergesellschafteten Privateigentums, dadurch hinsichtlich ihrer Größe freigesetzt von den Grenzen bisheriger und aktueller Markterfolge, emanzipieren sich die Unternehmen in ihrer Wachstumsstrategie von den Schranken der gesellschaftlichen Zahlungsfähigkeit, die sie einander streitig machen. Das Engagement der Spekulanten hilft ihnen darüber hinweg, erlaubt ihnen den Standpunkt, allein die Größe ihres Kapitals, mit der sie Wettbewerber aus dem Feld schlagen, wäre die wahre Quelle seiner Vermehrung und es läge ganz in ihrer Macht, sie wirksam werden zu lassen. Die Tatsache, dass die Zahlungsfähigkeit des Marktes ihr Werk ist und eben deswegen Schranken hat, die ihrem Wachstum Schranken setzt, tritt völlig zurück hinter dem Interesse und der dafür mobilisierten Macht, ihn zu erobern und den realisierbaren Gewinn zu monopolisieren. Dass die Rechnung nicht für alle, allgemein also nicht aufgeht, braucht sie nicht zu interessieren, solange es auf dem eigenen besonderen Markt – und letztlich in der Welt der Marktwirtschaft überhaupt – noch zu überwältigende Rivalen gibt; und solange Geldkapitalisten mit ihren spekulativen Erwartungen und ihren daraus abgeleiteten, mit selbstbezüglichen Wettgeschäften vielfach abgesicherten Finanzmitteln für Nachschub an Geld sorgen. Natürlich stehen da den Gewinnern des Streits um freies selbstbestimmtes Wachstum immer Verlierer gegenüber, darum geht es ja. Unternehmen jeder Größenordnung scheitern am Markt, und Kredite lösen sich in leere Rechtsansprüche, fiktives Kapital in Nichts auf. Das ändert aber nichts daran, dass die kreditfinanzierte Konkurrenz ein unverdrossenes Weitermachen erlaubt und erzwingt. Auf kapitalistische Einzelschicksale kann da keine Rücksicht genommen werden.
Den Anspruch an den Markt, den jeder Kapitalist erhebt, im Maß des autonom programmierten Wachstums als Gewinnquelle zu funktionieren, macht das Engagement der Finanzwelt also mitnichten wahr. Was es stattdessen leistet: Es befähigt die Unternehmen dazu, die Schranken des Marktes konsequent als Konkurrenzfrage zu behandeln, die mit hinreichender Größe als Waffe zu entscheiden sei, und sich so darüber hinwegzusetzen. Es ermächtigt sie zu offensiver Gleichgültigkeit gegen die Geschäftsbedingung, die sie selber schaffen, indem sie die gesellschaftliche Reproduktion unter den Imperativ der lohnenden Arbeitsproduktivität subsumieren und so die Zahlungsfähigkeit, die sie schaffen, zugleich substanziell beschränken. Ausgestattet mit der Macht des fiktiven Kapitals machen die Kapitalisten in großem Stil praktisch wahr, was der Logik der Kapitalverwertung im unendlichen marktwirtschaftlichen Prozess des Kaufens, des Produzierens unter dem Kriterium des Gewinns und des Profit bringenden Verkaufens grundsätzlich eigen ist: Das in diesem Kreislauf sich fortwälzende Wachstum kennt kein „genug“. Es schießt mit Notwendigkeit beständig über das Maß dessen hinaus, was die vom Kapital insgesamt geschaffene Zahlungsfähigkeit im Verhältnis zu der mit bezahlter Arbeit geschaffenen Masse von Warenwerten hergibt. Es schafft Opfer unter den großen und kleinen kapitalistischen Konkurrenten, die mit ihrem notwendigen Scheitern praktisch beweisen, dass kapitalistische Bereicherung als Überakkumulation des kapitalistischen Reichtums stattfindet.
Die Produktivkraft des Kredits, die den Unternehmen die Konkurrenz ums Übermaß des Wachstums gestattet und aufgibt, hat freilich auch für die Finanzwelt ihren Preis. Der besteht darin, dass das Scheitern kreditfinanzierter Unternehmungen gar nicht so leicht auf Einzelfälle und das bilaterale Verhältnis zwischen Gläubiger und Schuldner einzugrenzen ist. Zahlungsausfälle, die Kredite oder Aktien und in der Folge alles mögliche fiktive Kapital entwerten, betreffen nie bloß einzelne Investoren und Spekulanten. Über die aneinander anknüpfenden Refinanzierungsgeschäfte, mit denen die Unternehmen des Finanzsektors die Schöpfung von Kredit wechselseitig anerkennen und praktisch in Kraft setzen, wirken sie sich tendenziell auf die Gesamtheit der Kreditschöpfer und Spekulanten aus. Deren Verluste schlagen wiederum auf die Geschäftswelt zurück, die für ihr fest programmiertes Wachstum frisches Geldkapital braucht und nicht mehr oder nur noch unter erschwerten Bedingungen bekommt; was dann unweigerlich zu weiteren Zahlungsausfällen und womöglich zu Einbrüchen im gesamtkapitalistischen Wachstum führt. Wie weit die reichen, ist wiederum eine Frage ihrer spekulativen Bewertung. Fest steht nur, dass die Entschränkung des kapitalistischen Wachstums durch die Macht der systemgemäßen Vergesellschaftung des Privateigentums periodisch umschlägt in eine Kontraktion des Kredits und der kreditfinanzierten Profitmacherei, sogar in eine mehr oder weniger flächendeckende Lahmlegung des Geschäftslebens überhaupt ausartet. Dann ist
7. … Krise
Macher und Experten der Marktwirtschaft haben sich darauf geeinigt, dass bei „Minus-Wachstum“ über so und so viele Quartale hinweg von Rezession geredet werden darf. Konsens ist auch, dass ein so gravierender Rückgang der Geschäfte daran liegt, dass die Geschäftsgelegenheiten fehlen. Denn so viel ist nicht zu übersehen: An Geschäftsmitteln fehlt es nicht. Verkäufliche Ware wäre da, mehr als reichlich; bei den Produktionsmitteln werden Überkapazitäten festgestellt; Leute, die arbeiten könnten und würden, gibt es im Überfluss. Woran es fehlt, ist das Geld, das die Firmen mangels Absatz nicht erlösen und auch vom Finanzsektor nicht kriegen. Der gibt nichts her, weil es ihm an guten Geschäftsaussichten fehlt und an Vertrauen in die eigenen Produkte, mit deren Schaffung und Hochbewertung er es womöglich übertrieben hat und die nun massenhaft herumliegen und nichts mehr wert sind, weil niemand sie mehr haben will. Deswegen haben manche Reiche sogar Geld übrig, mit dem sie nichts Besseres anzufangen wissen als es aufzuheben. Das alles führt zu dem Befund, dass die Geschäfte einbrechen, weil die Bedingungen für ihr Wachstum fehlen.
Woran das wiederum liegt und was deswegen zu tun ist, darüber gehen die Meinungen auseinander. Dabei ist nicht immer zu unterscheiden, ob die vorgeschlagene Therapie aus dem ermittelten Grund der Krise folgt oder umgekehrt; die Sorge um neues Gelingen ist auf jeden Fall am Werk. So vermisst die eine Denkschule – deren Vertreter gelten als eher „links“ – das Maß an zahlungsfähiger Nachfrage, das nötig wäre, um die Märkte zu räumen, und verfällt auf den Staat als die quasi externe Instanz, die mit eigenen Geldzeichen den Mangel an Zahlungsfähigkeit beheben könnte, den man der Marktwirtschaft als solcher nicht in die Schuhe schieben möchte, wo die doch gerade mit der Behebung des Mangels an Kaufkraft nicht fertigwird und Hilfe braucht. Die Mehrheit der Sachverständigen, und die betroffenen Praktiker des Kapitalismus sowieso, sind sich dagegen sicher, dass Waren unverkauft liegen bleiben, die Produktion stockt und keine Kredite fließen, weil sich das Produzieren und Verkaufen gar nicht mehr lohnen kann; und das, weil für die Rentabilität zu wenig getan worden ist: Man hat zu wenig „Geld in die Hand genommen“, um durch die richtigen Investitionen, nämlich in produktivere Produktionsmittel, das Verhältnis zwischen Vorschuss und Überschuss zu verbessern. Stattdessen ist auf Kosten der Rendite, trotz aller gelaufenen „Rationalisierungen“, immer noch zu viel Geld für den „Faktor Arbeit“ ausgegeben worden. Angesagt ist damit eine umfassende Wegwerfaktion, ebenso flächendeckend wie die Krise, die anders nicht in den Griff zu kriegen ist: der Abbau der nicht mehr rentablen Arbeitsplätze samt überflüssigem Personal sowie die Verschleuderung aller noch irgendwie verkäuflichen Waren und Wertobjekte, um wenigstens noch Restposten der aufgelaufenen Schulden pflichtgemäß zu bedienen.
Diese Konsequenz, die in der Praxis auf alle Fälle eintritt, mit oder ohne Theorie über fehlende Geschäftsbedingungen, zeugt auf ihre Art von dem wirklichen Grund der Rezession, unter der das Kapital immer mal wieder leidet: Offenbar ist viel zu viel Kapital zum Einsatz gebracht worden, als dass es aus dem Markt, den es selber macht, noch eine Rendite und ein Wachstum herausholen könnte. Das ist jedenfalls der politökonomische Sachverhalt, der in der Krise als Rückschlag für das gesellschaftliche Wirtschaftsleben wirksam wird: Die Klasse der konkurrierenden Kapitalisten stößt auf den Widerspruch, dass sie mit ihrer Ökonomie des unbedingten Wachstums ihren Reichtum ohne Ende steigert und für diesen Zweck die Quelle ihres Reichtums und ihrer Bereicherung, die bezahlte Arbeit, immer ergiebiger macht – also die Lohnabhängigen immer ärmer im Verhältnis zum Wert der Waren, mit deren Kauf die ihren Lebensunterhalt hinkriegen müssen. Dieses Übermaß kapitalistischen Wachstums führt die Marktwirtschaft in ihre Sackgasse und zur Annullierung kapitalistischen Reichtums. Was den Unternehmern da als Rückschlag für ihr schönes Wachstum in die Quere kommt, nehmen sie selber auch als Übermaß wahr, allerdings etwas anders: bei ihren Konkurrenten. Die sind zu viel – die Hölle, das sind mal wieder die andern –; deswegen müssen die ja weg. Darauf kommt es in der Krise umso mehr an. Dafür können die Akteure der freien Konkurrenz gar nicht genug tun. Und genau so schaffen sie das allgemeine „Zu viel“, wirtschaften sich folglich stets von Neuem in ihre Krise hinein.
Wo die ihren Anfang nimmt, wie sie in Gang kommt und fortschreitet, ist Sache der Anarchie des Marktes und der Spekulation auf Ergebnisse. Es kann ein Scheitern des kreditfinanzierten Kaufens, Produzierens und Verkaufens an den Schranken der beanspruchten gesellschaftlichen Zahlungsfähigkeit sein, eine Überfüllung der Märkte und die Feststellung heilloser Überkapazitäten, aus denen das Finanzgewerbe, das über solche Szenarien hinweghelfen soll, dann doch keinen Ausweg sieht. Es können wirkliche oder befürchtete Preiswechsel größeren Stils, natürlich oder politisch verursacht, oder das Platzen einer „Blase“ im Reich der Derivate und Zertifikate sein, was die Finanzwelt mit einem Absturz der Börsenwerte und einer Kündigung der Dienste quittiert, von denen der Fortgang der Geschäfte abhängt. Eine Krise wird aus solchen Störungen der Wirtschaft, wenn dadurch in der Welt des vergesellschafteten kapitalistischen Reichtums, d.h. der Schaffung von Krediten und Börsenwerten und ihrer Beglaubigung durch zirkuläre Refinanzierungsgeschäfte, eine dazu gegenläufige Kette von Entwertungen in Gang kommt, die – erst einmal – niemand stoppt. Im Ergebnis geht, zusammen mit vielen verbrieften Werten des Finanzgewerbes, dessen für beide Seiten so nahrhafte Symbiose mit dem anderen Teil der kapitalistischen Ökonomie kaputt, der in dem Zusammenhang „Realwirtschaft“ heißt. Sie schlägt um in ein hartes Gegeneinander unerfüllter Ansprüche: nicht bedienter Kredite und entwerteter Investments auf der einen Seite, abgelehnter Kreditbedürfnisse und gekündigter Kapitaleinlage auf der anderen; wobei das Privateigentum, das aus dem verbuchten Recht auf Erträge entsteht, bei aller Entwertung doch die Oberhand behält über das Eigentum aus kapitalistischer Produktion: Produktionsmittel und Lohnarbeit werden geopfert, Verkäufliches wird verschleudert, um, wenn schon nicht jeden Kredit, doch auf alle Fälle das Kreditgeschäft zu retten.
Dieser Antagonismus ist freilich kein Grund für unheilbare Entzweiung zwischen den kapitalistischen Fraktionen, und schon gar nicht für Bescheidenheit angesichts des gemeinsam angerichteten Desasters. Er tritt zurück hinter eine umso entschiedenere gemeinsame Anspruchshaltung: Die besitzende, i.e. managende und investierende Klasse besinnt sich offensiv auf die Systemrelevanz ihrer partikularen Interessen und verlangt, sektorenübergreifend, die Indienstnahme der restlichen Gesellschaft für die Wiederherstellung ihrer Macht als unentbehrlicher Dienstleister an der gesellschaftlichen Reproduktion. Dass sie mit ihrem Geschäft und dessen Scheitern an der eigenen Maßlosigkeit die Produktivkräfte der Gesellschaft geschädigt und ihr materielles Überleben in Gefahr gebracht hat, ist für sie der unschlagbare Beweis, wie unbedingt es für die Allgemeinheit darauf ankommt, dass ihre Rechnungen aufgehen und ihr Reichtum wächst. Nicht das Geschäftsleben hat sich den materiellen Notwendigkeiten einer sicheren Existenz für alle anzupassen, sondern die Allgemeinheit den Erfolgsbedingungen des Geschäftsinteresses der maßgeblichen Minderheit.
Und das geht, systemmäßig gesehen, in Ordnung. Denn wenn die lohnarbeitende Klasse dem Regime der Kapitalisten über Arbeit und Leben der Gesellschaft keine Schranke setzt, dann muss sie auch die Folgen ausbaden und zur Reparatur antreten, wenn die Kapitalisten periodisch an der Schranke scheitern, die sie selbst ihrem Erfolg setzen.
Das letzte Wort hat dabei, wieder einmal, die öffentliche Gewalt, ohne die in diesem System der Freiheit gar nichts geht.
[1] Wenn ihre Dienstzeit zu Ende geht, winkt den Spitzenmanagern ein Aufsichtsratsmandat – auch das ein aus der komplexen Figur des schlichten Kapitalisten ausgekoppeltes Amt, das die Rückbindung der Unternehmensleitung an das Privateigentum der Aktionäre und an deren Ansprüche an ihren Betrieb überwacht.
[2] Die Bewirtschaftung und ständig erweiterte Reproduktion aller derartigen Risiken, einschließlich der Konstruktion und Vermarktung immer neuer Derivate, machen die Banken als etablierte verfügungsberechtigte Sachwalter des gesellschaftlichen Geldvermögens und professionelle Geldschöpfer zu ihrem Geschäft; als Treuhänder fremden Eigentums wie auf eigene Rechnung. Zur seriösen, sicheren Abwicklung dieser Spekulation sind unbedingt verfügbare finanzielle Ressourcen, mit denen Fehlschläge sich ausgleichen oder überbrücken lassen, eine wesentliche Geschäftsbedingung. Der Rückgriff auf den Finanzmarkt für die Refinanzierung eingegangener Engagements muss auf alle Fälle gewährleistet sein, reicht aber nicht. Nötig ist eine ganz hauseigene Kapitalgröße, die gegenüber den kritischen Finanzmärkten für jede womöglich benötigte Summe die unzweifelhafte Solidität des Instituts verbürgt. Dieses Erfordernis ist ein eigener Grund dafür, dass die Macher des Bankgeschäfts gewöhnlich als AG, also mit der kollektiven Kapitalmacht einer Mehrheit von Geldbesitzern ihr Gewerbe betreiben.
[3] Unter den extremen Bedingungen einer Überfülle geldförmigen Reichtums auf der Suche nach interessanten Anlagemöglichkeiten sowie spezieller Erfolgsgeschichten, die als gültige Paradigmen kapitalistischer Bereicherung anerkannt werden, kann die Spekulation sich von dem Gesichtspunkt solider Umsätze und realisierter Gewinne auch völlig trennen, den Börsenwert von Unternehmen ohne wenigstens mittelfristige Aussicht auf Profit, der ihn rechtfertigen könnte, massiv aufblähen und unter der eigentümlichen Rubrik ‚Wagniskapital‘ Projekte finanzieren, deren kapitalistische Ertragskraft nicht mehr als eine – mit „Start-up“ passend gekennzeichnete – Hoffnung ist. Dass so etwas seit der historischen niederländischen Tulpenkrise die Geschichte der kapitalistischen Spekulation treulich begleitet, hindert die Fans der Szene nicht an der Vorstellung, auf die Art den Kapitalismus immer wieder neu – heutzutage: eine „New Economy“ – erfunden zu haben.
[4] In letzter Instanz behält das Eigentum sein Recht und das letzte Wort über das Kapital, das am Markt seine Konkurrenzkämpfe zu bestehen hat. Zwar kann kein Aktionär seinen Besitzanteil aus dem Unternehmen herauslösen und heimtragen. Die Gemeinschaft der Eigentümer kann aber mit der nötigen Mehrheit das Unternehmen insgesamt „von der Börse nehmen“, in Teile „zerschlagen“, die zu Geld machen usw.